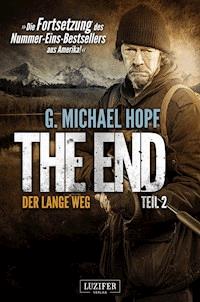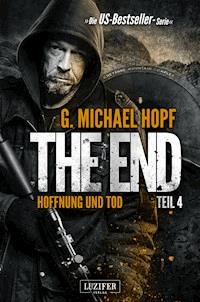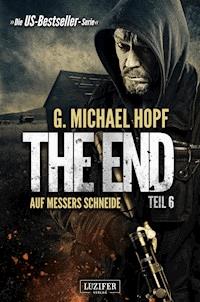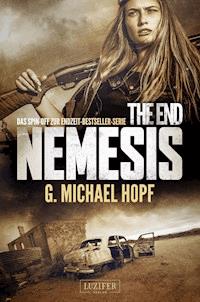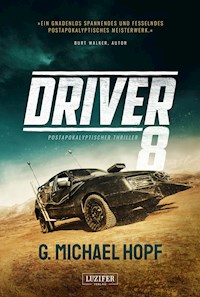Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: The End - Gordon Van Zandt
- Sprache: Deutsch
"Eine Geschichte mit Wendungen, wie sie überraschender nicht sein können. Ein tiefer Blick in die wahre - die düstere - Seele einer selbstverliebten Nation am Abgrund ihres Seins." Die Angriffe zu überleben bedeutet mehr, als sie sich jemals hätten vorstellen können … Monate, nachdem ein Super-EMP-Angriff die Vereinigten Staaten verwüstete, ist das Land nicht mehr wiederzuerkennen. Alle großen Städte sind in der Hand von marodierenden Banden, während die Überlebenden Hungers sterben und die Regierung machtlos gegen die Gesetzlosigkeit im Land ist. Diejenigen, die glaubten, auf das Ende vorbereitet zu sein, müssen nun feststellen, dass sie niemals vorbereitet waren. Während einige nach Rache dürsten, für die Verluste, die sie erleiden mussten, sind andere entschlossen, die Nation wieder aufzubauen. Gordon, Samantha, Sebastian, Barone, Connor und Pablo - sie alle befinden sich auf verschiedenen Wegen heraus aus dem Chaos, in eine neue Heimat. Sie alle sind auf der Suche nach einer Zuflucht. Das Buch von Michael Hopf stellt Szenarien dar, wie sie vielleicht in ein paar Jahren wirklich realistisch sein können, beziehungsweise Ausläufer schon geschehen sind. Gerade deswegen ist dieses Buch von Anfang bis Ende fesselnd für den Leser. Man möchte es gar nicht weglegen, weil man Angst hat, in den nächsten Zeilen gleich etwas zu verpassen. [Testmania] -------------------------------------------------------- "Hochspannung pur!" [Lesermeinung] "Klasse Fortsetzung! Wermutstropfen ... vieeeeel zu kurz, weil so spannend (hätte ruhig doppelt so lang sein können, ach was dreimal so lang!)" [Lesermeinung] "Der 3. Teil ist auch der absolute Hammer." [Lesermeinung]
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Inhalte
THE END 3 - ZUFLUCHT
Anmerkung
Widmung
Impressum
Prolog - 18. Oktober 2066
22. Februar 2015
23. Februar 2015
24. Februar 2015
25. Februar 2015
26. Februar 2015
27. Februar 2015
13. März 2015
14. März 2015
15. März 2015
17. März 2015
18. März 2015
Epilog - 18. Oktober 2066
Der Autor
Leseprobe
Der LUZIFER Verlag
THE END 3
ZUFLUCHT
G. Michael Hopf
übersetzt von
Andreas Schiffmann
Dieser Roman ist ein fiktives Werk. Namen, Charaktere, Orte und Ereignisse entspringen der Phantasie des Autors oder werden fiktiv verwendet. Jede Ähnlichkeit zu tatsächlichen Ereignissen, Schauplätzen oder Personen, lebendig oder tot, ist rein zufällig.
Für Dad
Impressum
ISBN E-Book: 978-3-95835-023-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen und senden Ihnen kostenlos einen korrigierten Titel.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
18. Oktober 2066
Olympia, Washington, Republik Kaskadien
Haley öffnete die Augen und schaute auf den Wecker, der neben ihr auf dem Nachttisch stand. Das grün fluoreszierende Zifferblatt der Uhr zeigte 7:18 Uhr an. Frustriert von einer weiteren schlaflosen Nacht blickte sie zum heller werdenden Horizont im Osten und vergaß für einen Moment das beklommene Gefühl, mit dem sie insgeheim lebte. Sie wollte ihre Augen nicht abwenden, weil sie befürchtete, die ersten Sonnenstrahlen des Tages zu verpassen. Wenn morgens kein typischer Nebelschleier über der Stadt hing, waren die Sonnenaufgänge atemberaubend. In solchen Momenten konnte sie die einfachen Freuden des Lebens genießen, das jetzt ganz anders war als in ihren jungen Jahren. Sie fragte sich oft, für wie selbstverständlich die Menschen in der alten Zeit ihr Leben gehalten haben mochten, und ob sie wohl gedacht hatten, der Alltag, den sie gewohnt waren, könne nie enden. Sie jedoch wusste nun, und zwar nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch anhand dessen, was die Geschichte sie gelehrt hatte, dass nichts ewig währte. Das Leben und insbesondere der Tod waren wesentliche Aspekte des menschlichen Daseins. Sie hatte genug vom Tod gesehen, mehr als sie jemals wieder erleben wollte, wusste aber auch, dass der Friede in der Form, wie er jetzt in ihrem Land herrschte, eines Tages enden würde. Das dunkelorange-farbene Licht der aufgehenden Sonne strahlte über den Horizont und erhellte ihr spartanisch eingerichtetes Schlafzimmer. Ihr Schlittenbett stand parallel zu dem breiten Fenster. Dem Bett gegenüber auf der anderen Seite stand ein alter Kleiderschrank, groß wie ein Monolith; er ragte über sechs Fuß hoch in den Raum. Sie zog sich die dicke Federdecke bis ans Kinn und schaute dabei zu, wie Mutter Natur einen neuen Tag gebar. Das Brummen des Trucks, der ihre Auffahrt hinunterrollte, riss sie zurück in die Gegenwart. Der Mann vom Lebensmittelladen vor Ort lieferte ihre wöchentliche Bestellung: Eier, Milch, Butter und Sahne. Sie drehte sich auf den Rücken und schaute an die Zimmerdecke. John wollte am späten Morgen kommen, um sein Interview fortzuführen. Ihr graute davor. Das ganze Wochenende lang hatte sie sich gefragt, warum sie überhaupt zugestimmt hatte, diese Befragungen über sich ergehen zu lassen. Die Vergangenheit war schmerzlich genug – ihre Erinnerungen breittreten zu müssen, holte jene fernen Momente nur in die Gegenwart. An einige der Menschen, die während ihrer frühen Kindheit Teil ihres Lebens gewesen waren, hatte sie vor Jahren zum letzten Mal gedacht. Die Aussicht darauf, sich abermals öffnen zu müssen, überwältigte Haley. Sie fragte sich nicht zum ersten Mal, warum sich ihr Vater damals die Zeit genommen hatte, um ihr seine gesamte Lebensgeschichte zu erzählen. Nie würde sie jenen Wintertag vergessen, an dem er sich zu ihr gesetzt und geschildert hatte, wie alles begonnen hatte, wie die Gesellschaft auseinandergebrochen und wieder zusammengekommen war. Einige Einzelheiten verfolgten sie bis zum heutigen Tag. Ihr knurrender Magen bewog sie letztlich dazu aufzustehen und ihren Tag zu beginnen. Außerdem freute sie sich auf ihre morgendliche Routine. Sie konnte nicht genau bestimmen, ob sie den frisch aufgebrühten Kaffee aus doppelt gerösteten Bohnen oder das leicht getoastete Roggenbrot, bestrichen mit einer dicken Messerspitze gesüßter Butter lieber mochte, aber so oder so konnte sie keinen Tag ohne beides antreten. Blind griff sie zu ihrem Teekessel aus Edelstahl und füllte ihn mit gefiltertem Wasser aus einem Fünf-Gallonen-Kanister, den sie in ihrer Speisekammer aufbewahrte. Frisches, sauberes Wasser war ein kostbares Gut. Nach dem großen Zusammenbruch waren viele Systeme, die die Gemeinden mit Trinkwasser versorgt hatten, mitsamt der Infrastruktur zusammengebrochen. Selbst nach jahrzehntelangem Wiederaufbau waren nur wenige instand gesetzt beziehungsweise den Standards angeglichen worden, die das Volk zuvor gewöhnt gewesen war. Olympias kommunale Wasserversorgung litt immer noch unter Kinderkrankheiten, weshalb Haley nicht darauf vertraute. So hatte sie vor Jahren ein Filtersystem in ihr Haus bauen lassen, zog es aber trotzdem weiterhin vor, sich jede Woche Trinkwasser von einem Betrieb liefern zu lassen, der ein kleines Reservoir 15 Meilen außerhalb der Stadt unterhielt. Obwohl sie bereits vor dem Stromausfall auf der Welt gewesen war, fiel es ihr schwer, sich an die Bequemlichkeiten zu erinnern, an die sich ihre Eltern immer gern erinnert hatten: frisches, leicht erhältliches Obst, unterschiedliche Fleischsorten, verlässliche Elektrizität, Reisefreiheit und vor allem unverdorbenes Wasser. Sie wusste, die Art und Weise, wie die Menschen Wasser jetzt behandelten und wertschätzten, hob sich deutlich von der Zeit vor alledem ab. Als das Wasser aufgehört hatte, ganz einfach überall zu fließen, war mit ihm auch das ordentlich gepflegte Landschaftsbild verschwunden. Jene malerischen Szenen von saftig grünen Rasen und immerzu blühenden Beeten waren durch Gärten mit widerstandsfähigen Pflanzen ersetzt worden. Mit dem wenigen Wasser, das die Menschen zugeteilt bekamen, gingen sie sparsam und produktiv um, damit ihre Grundlage gesichert war. Haley fand Blumen und Grasflächen ums Haus durchaus hübsch, aber sinnvoll waren sie nicht. Nachdem sie die Entbehrungen in der Zeit nach den Anschlägen und dem Großen Bürgerkrieg erlebt hatte, war sie stets auf alles vorbereitet. Nicht wenige in Kaskadien teilten ihre pragmatische Ansicht. Kaum jemand baute auf die Regierung, geschweige denn seine Mitmenschen, wenn es um persönlichen Schutz ging. Eine ganze Generation hatte ihren Nachkommen beigebracht, selbstständiger zu sein und autark zu leben. Das Pfeifen des Kessels lenkte sie ab. Sie goss das kochende Wasser über den fein gemahlenen Kaffee in der Stempelkanne, woraufhin ihr das starke, leicht rauchige Aroma in die Nase drang. Allein dieser Duft versüßte ihr den Tag. Sie machte sich auf den Weg zur Haustür, um die Milchprodukte hereinzunehmen, die dort abgestellt worden waren. Von der kühlen Sahne würde sie gleich etwas in ihren heißen Kaffee geben. Als sie die Tür öffnete, war sie überrascht, einen Mann vor sich zu sehen. Er hatte sein Gesicht von ihr abgewandt. »Kommst du, um das hier zu holen?«, fragte er, indem er einen Korb mit den Lebensmitteln hochhielt, die sie brauchte. Sie erkannte seine Stimme sofort, konnte es aber kaum fassen. »Hunter? Hunter, bist du das? Oh mein Gott, du bist es!« Haley schrie praktisch. Sie packte ihren Sohn und umarmte ihn. Während sie ihn fest drückte, sagte sie: »Mein Junge! Wie geht es dir? Ich kann nicht glauben, dass du hier bist!« »Mom, hi. Äh, Mom, du erwürgst mich und machst die Eier kaputt«, erwiderte Hunter. »Tut mir leid, ich bin nur so überrascht, dich zu sehen. Hätte ich das gewusst, hätte ich Eier Benedikt vorbereitet.« Haley strich ihm übers Haar. Sie umarmte ihn immer noch innig, fast als fürchte sie sich davor, ihn loszulassen. »Tut mir leid, dass ich nicht angerufen habe, doch ich wollte dich überraschen«, erklärte Hunter. Sie entzog sich und schaute in seine blauen Augen. Hunter Rutledge war ihr ältester Sohn. Mit sechs Fuß und zwei Zoll war er ein großer Mann mit braunem Haar und den aufgeweckten Augen, die so typisch für die Van Zandts waren. Haley erkannte ihren eigenen Vater in ihm. »Komm rein, bevor du dich noch erkältest«, forderte sie ihn auf und führte ihn ins warme Haus. »Ich wollte dich nicht erschrecken, Mom, aber dein Timing war unheimlich. Ich hob den Korb auf und wollte gerade klopfen, als du die Tür aufgemacht hast.« Hunter redete mit leicht nasaler Stimme; im Zuge der kalten, feuchten Luft war er ein wenig verschnupft. Sie nahm ihm den Korb ab und eilte zurück in die Küche. »Willst du eine Tasse frischen Kaffee?«, rief sie. »Sicher, klingt gut«, antwortete er, als er seine Jacke auszog. Dann ging er ins Wohnzimmer und schaute sich um. Sein letzter Besuch bei seiner Mutter war lange her. Das Haus, in dem sie jetzt wohnte, kannte er nicht. Sie war vor ein paar Jahren nach dem Tod seines Vaters hier eingezogen. Müde von seiner langen Reise nahm er auf einem Zweisitzer im viktorianischen Stil Platz. Haley huschte in den Raum, stellte die Kaffeetasse vor ihm auf den Tisch und drehte sich wieder um, um noch einmal in die Küche zu gehen. Nachdem sie ein paar Schritte getan hatte, wandte sie sich ihm erneut zu. »Du trinkst deinen Kaffee immer mit Sahne, richtig?« »Ach ja. Danke, Mom.« Er sah, wie der Dampf aus der Tasse stieg, nippte daran und grinste. Der kräftige Geschmack des Kaffees tat gut. Haley kam wieder herein und setzte sich ihm gegenüber hin. Sie unterhielten sich über Hunters Reise, und Haley merkte, wie nervös sie war, weil sie von seinem Besuch überrascht worden war. Über viele Geheimnisse, die sie John für das Interview anvertraute, hatte Haley ihrer Familie gegenüber kein Sterbenswort verloren. Um alles mit ihren Söhnen zu teilen, würde es eine richtige Zeit und einen passenden Ort geben, doch noch fühlte sie sich nicht bereit. Hunters Anwesenheit bedeutete nun jedoch, dass es eher früher als später geschehen musste. »Mom, ist alles in Ordnung?«, fragte er mit leicht besorgtem Unterton. Wenngleich er seine Mutter lange nicht gesehen hatte, kannte er sie gut, um zu wissen, dass ihr etwas Sorgen bereitete. »Ja, alles gut, ich bin nur glücklich, dich zu sehen! Mich verblüfft immer noch, dass du hier bist«, entgegnete sie heiter. »Bist du sicher?« »Ich muss gestehen, ich kann kaum glauben, dass du gekommen bist. Dich zu sehen, macht alles so viel schöner.« Haley grinste über beide Ohren. »Mom, was ist los?«, beharrte er. Sein Tonfall war sanfter geworden. Er stand auf und rückte einen Sessel dicht zu ihr. Sie nahm seine Hand. »Oh Hunter, mach dir keine Gedanken um mich. Ich will von dir hören! Wie lange kannst du bleiben?« »Der Botschafter ist wegen eines kurzerhand anberaumten, außerordentlichen Treffens hier, und morgen Abend brechen wir wieder auf.« »Ich begreife nach wie vor nicht, warum du eine Stelle bei der Republik Texas angenommen hast, wo du doch leicht hier einen Job bekommen hättest.« Haleys Stimme verhehlte ihre anhaltende Enttäuschung nicht. »Geht das schon wieder los?« Sie erkannte seine Gereiztheit und wählte rasch eine andere Gesprächsrichtung: »Wie stehen die Dinge in Texas?« »Gut. Doch, wirklich, uns geht es bestens dort unten.« »Bist du auch weiterhin in Sicherheit?« »Wir sind dort so sicher wie irgend möglich. Die ganzen Spannungen sind mehrere Stunden weit entfernt. In Austin ist es genauso sicher wie in Olympia«, betonte er. »Schatz, ich bin nicht von gestern und lese die Zeitung! Außerdem hast du wohl nicht vergessen, dass dein Cousin Brian für den Präsidenten arbeitet, oder? Das bedeutet, nichts geschieht, ohne dass ich Wind davon bekomme. Man erzählt mir ausführlich, was dort unten vor sich geht.« Haley starrte ihn an, bevor sie einen kräftigen Schluck Kaffee nahm. »Mein Auftrag in Texas ist bedeutsam. Die Republik so gut wie möglich zu unterstützen, steht für uns an erster Stelle. Das sind unsere Verbündeten, und ohne sie steht nicht viel zwischen uns und …« »Ich kenne die Kernfragen«, unterbrach Haley. »Aber ich bin den Krieg furchtbar leid.« »Diese Arbeit ist wichtig.« »Das weiß ich, Sohn, glaub mir«, beteuerte sie und wechselte das Thema: »Irgendetwas Neues von deinem Bruder Sebastian?« »Nein, ich habe seit Monaten nichts von ihm gehört.« »Ich auch nicht. Er macht mir Sorgen«, gestand sie und zwang sich zu einem Lächeln. »Muss an dem verdammten Blut der Van Zandts liegen, das auch durch deine Adern fließt. Es treibt die Männer der Familie dazu an, sich auf- und davonzumachen.« »Großvater ist schuld daran, richtig?« »Interessant, dass du ihn erwähnst.« Sie machte es sich in ihrem Sessel bequem. »Ich möchte ehrlich zu dir sein: Mit mir ist nicht alles in Ordnung.« Er wurde kreidebleich. »Was hast du?« Sie holte tief Luft. »Vor ein paar Wochen wurde mir angeboten, ein in die Tiefe gehendes Interview zu führen – über Großvater und Nana, deinen Onkel Sebastian, alles.« Sie hielt inne und räusperte sich. »Ich habe mich einverstanden erklärt. Die erste Sitzung fand letzten Freitag statt. Das klingt jetzt vielleicht erbärmlich, aber es war … viel anstrengender als gedacht, nicht weil ich über schwierige Zeiten spreche, sondern mir vorgenommen habe, ausnahmsweise offen zu sein und der Welt zu erzählen, waswirklichgeschah. Dadurch bietet sich mir nicht nur die Gelegenheit, die Geschichte unseres Landes wiederzugeben; es ist auch eine Chance, den Werdegang unserer Familie zu beschreiben … so, wie es tatsächlich passiert ist.« »Gut für dich, Mom!«, rief Hunter begeistert. Dann fügte er ernster hinzu: »Es mag anstrengend sein, aber auch wichtig.« Sie nickte und sprach weiter: »Ich glaube, dass ich jahrelang bewusst bestimmte Teile meiner Erinnerung abgeschaltet habe, doch jetzt ist mir klar, weshalb sich dein Großvater vor langer Zeit mit mir zusammensetzte. Er wollte, dass ich in der Lage bin, diese Geschichte zu erzählen. Wahrscheinlich sah er es kommen.« Sie machte eine Pause. »Er hat es schon immer gewusst.«
***
Haley versuchte, Hunter zum Bleiben zu überreden, doch er brach schon nach wenigen Stunden wieder auf, weil ihn die Pflicht rief, seine Arbeit für den Botschafter von Kaskadien. Er versprach, später zurückzukommen und über Nacht zu bleiben. Als sich Hunter für eine Anstellung im öffentlichen Dienst entschieden hatte, war es kein Problem gewesen, einen Posten für ihn zu finden: Die Namen der Familien Van Zandt und Rutledge genossen in vielen Teilen der Republik hohes Ansehen. Allerdings hatte er sich dem Willen seiner Mutter widersetzt und sich dem Auswärtigen Amt von Kaskadien als Sonderbeauftragter angedient. Dort war er rasch aufgestiegen und bekleidete nun den Rang des Hauptstellvertreters der kaskadischen Botschaft in der Republik Texas. Haley glaubte nicht so recht, dass der Job ihres Sohnes rein verwaltungstechnischer Natur war. Im Grunde ihres Herzens ahnte sie, dass er wahrscheinlich als Funktionär in einer Geheimabteilung arbeitete. Sie konnte es aber nicht beweisen, und niemand innerhalb ihres Einflussbereichs bei der Regierung wollte etwas preisgeben. Haley beunruhigte die Frage, wo sich ihre beiden Jungs verdingten. Die Welt war noch immer brandgefährlich. Kurz, nachdem Hunter gegangen war, kündigte ein Klopfen an der Haustür an, dass John eingetroffen war. Sie verhielt sich jetzt anders als beim ersten Mal, als sie ihm geöffnet hatte. Sie fühlte sich nach der Befragung vom Freitag zwar noch ein wenig aufgekratzt, doch Hunters Überraschungsbesuch und der wieder erstarkte Vorsatz, ihre Geschichten zu erzählen, um das Vermächtnis ihres Vaters zu ehren, hoben ihre Stimmung. John war diesmal allein gekommen. Das Kamerateam hatte beim vorigen Interview erhalten, was es benötigte. »Guten Morgen, John«, grüßte sie freundlich. »Guten Morgen, Haley«, entgegnete er mit verhaltenem Grinsen. Sie bat ihn herein, woraufhin sie Nettigkeiten austauschten und plauderten. Sie erzählte ihm nichts von Hunters Besuch; etwas Distanz und Privatsphäre mussten sein. Nach ein paar Minuten bezogen die beiden ihre Sessel im Wohnzimmer. John war gespannt auf den weiteren Verlauf des Interviews. Für ihn hatte sich das Wochenende ewig hingezogen, ihm aber auch die Möglichkeit gegeben, über das Gespräch nachzudenken und viel Zeit damit zu verbringen, eine Liste von Anschlussfragen zusammenzustellen. Er zog seinen dicken Notizblock heraus und klickte mit dem Kugelschreiber. »Wow – das ist alles, was ich sagen kann. Zugegeben, mit solchen Reaktionen auf das Interview habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich komme vorbei, wir sprechen miteinander, und Sie teilen den gleichen Kram mit mir, den ich schon mein ganzes Leben lang höre, aber das taten Sie nicht. Die Einzelheiten, mit denen Sie mich versorgen, nicht nur über Ihre Familie, sondern auch die anderen, die am Großen Bürgerkrieg beteiligt waren, sind erstaunlich. Ich möchte Ihnen noch einmal danken für diese Ehre – und das ist es wirklich.« »Ich bin froh, dass Sie das so sehen«, entgegnete Haley. »Das ist kein Interview wie jedes andere, sondern ein Geschenk an die Bevölkerung von Kaskadien. Sie müssen das erfahren.« »Gut. Sie sollen die Wahrheit kennenlernen, die ganze Wahrheit, Licht und Schatten.« Sie räusperte sich und fuhr fort. »Eine funktionierende Regierung zu stellen – eine Obrigkeit, die auf Rechtsgrundsätzen fußt, ist nicht leicht. So viele nehmen sie als gegeben hin. Als alles im Zuge der Angriffe zusammenbrach, war die US-Bundesregierung außerstande, die Situation in den Griff zu bekommen, sodass ein Machtvakuum entstand. Viele unterschiedliche Drahtzieher beeilten sich, jene Leere auszufüllen, die nach dem Kollaps der ehemaligen Zentralregierung entstanden war. Wie wir wissen, gerieten die Parteien zuletzt im Großen Bürgerkrieg aneinander, doch nur sehr wenige Personen sind im Bilde darüber, dass unser Sieg nicht nur der Waffengewalt und Strategie auf dem Schlachtfeld geschuldet war, sondern auch von einer Politik erwirkt wurde, die mit Kompromissen und Diplomatie arbeitete.« Wieder eine Pause. »Was unsere Kinder an Geschichte lernen, beläuft sich weitgehend auf Pablo und das panamerikanische Imperium gegen die Vereinigten Staaten, aber niemand kennt wirklich alle Personen, die damit zu tun hatten, und die Anfänge von alledem.« »Da gebe ich Ihnen recht, und aus diesem Grund bin ich so gespannt auf Ihren Blickwinkel. Es gibt da ein paar Fragen, die ich Ihnen gerne stellen würde, bevor wir fortfahren, wenn es Ihnen nichts ausmacht.« John fummelte an seinem digitalen Aufnahmegerät herum. Haley staunte darüber, wie er sich seit Freitagmorgen verändert hatte. Der vormals so selbstbewusste Reporter wirkte etwas weniger blasiert und viel nachdenklicher. Sie war davon überzeugt, dass diese Geschichte erzählt werden musste, wusste aber ebenfalls, dass er als Journalist auch egoistische Ziele verfolgte. Diese Geschichte – ihre Geschichte – würde hohe Zeitungsauflagen versprechen. Während sie darauf wartete, dass er sich bereit machte, warf sie einen Blick aus dem breiten Panoramafenster. Der Winter schien in diesem Jahr früh hereinzubrechen; ein leichter Schneeschauer ging gerade vom grauen Himmel nieder. »Es schneit«, bemerkte Haley. »Was?«, entgegnete John, ohne den Kopf anzuheben, da er seine Fragen noch einmal durchlas. »Für heute wurde doch gar kein Schnee gemeldet«, sagte Haley. »Doch, die Vorhersage sprach von heute und morgen. Angeblich zieht ein heftiger Sturm auf.« »Hm, was Sie nicht sagen?« Sie widmete ihre Aufmerksamkeit wieder John. »Ich bin bereit, wenn Sie es sind.« »Sicher, alles klar. Hoffentlich kommt Ihnen diese Frage nicht merkwürdig vor, doch als ich unsere Unterhaltung vom Freitag abhörte, fiel mir etwas ziemlich Wichtiges auf.« John löste sich von seinen Notizen und beäugte sie neugierig. »Woher kennen Sie die ganzen Details – oder genauer: Woher wissen Sie von Pablo, Colonel Barone oder sogar Brad Conner?« Haley schreckte nicht vor der Frage zurück und blinzelte nicht einmal. Stattdessen strahlte sie. »Verzeihung, falls mein Lächeln unangemessen erscheint, aber darüber habe ich gerade mit jemand anderem gesprochen. Vor vielen Jahren nahm mich mein Vater zur Seite und erzählte mir seine Geschichte. Damals war ich mir nicht so sicher, warum er diese Erlebnisse mit mir teilte; jetzt aber kenne ich den Grund dafür, warum er es getan hat – es ist so lange her – warum er mich mit einigen sehr schwierigen, sehr harten Tatsachen konfrontierte. Es ist, als habe er mich zu seiner Botschafterin machen wollen.« John neigte den Kopf zur Seite und kniff ein Auge zusammen. »Mit der Zeit haben viele das Interesse daran verloren, wie unser Land entstand«, sprach Haley weiter. »Friede und Wohlstand entstehen nicht zwangsläufig aus dem Chaos. Gute Menschen müssen bisweilen Gewalt anwenden, um sich eine stabile Existenz zu sichern; manchmal müssen sie so brutal und skrupellos sein wie diejenigen, die ihnen die Ketten der Sklaverei und Knechtschaft anlegen wollen. Man möchte uns weismachen, wir könnten mit Gruppen oder Einzelpersonen verhandeln, die nichts außer Boshaftigkeit kennen.« Sie unterbrach sich erneut. Haley begriff, dass ihr Vater Dinge getan hatte, die manchem nicht anders vorgekommen wären als das, was sie bekämpft hatten. »Für Sie und auch andere ist es ein Leichtes, die Handlungen meines Vaters zu hinterfragen«, fügte sie hinzu, wobei sie einen vorwurfsvollen Ton anschlug. »Äh, Entschuldigung?« John fühlte sich angegriffen. »Mein Vater teilte seine Geschichte mit mir, weil er wusste, dass die Menschen über ihn urteilen würden. Sie fragen also, woher ich das alles weiß; das tue ich, weil mein Vater die Menschen kannte, von denen wir gesprochen haben, oder ihnen begegnete. Er hat diese Episoden im Laufe der Jahre gesammelt. Ein Mann schwingt sich nicht durch Irrtum zum Präsidenten einer Republik auf. Vater war beileibe nicht ohne Fehler, brachte aber große Opfer dafür, dass Sie und ich bekommen konnten, was wir nun haben.« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Haley, ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich hätte niemals …« Sie schnitt ihm das Wort ab: »Ich klage nicht Sie direkt an, aber viele Menschen urteilen ihn ab. Hinterher glaubt man eben immer, es besser zu wissen. Noch heute leben wir im Angesicht einer Bedrohung, die zerstören könnte, was wir aufgebaut haben. Es gibt Menschen dort draußen, die glauben, wir könnten Probleme allein dadurch lösen, dass wir sie ausdiskutieren. Aus Erfahrung kann ich Ihnen eines sagen: Falls Ihr Gegner gewillt ist, Tausende brutal zu ermorden – Männer, Frauen und Kinder – und das Endziel Eroberung verfolgt,könnenSie nicht mit ihm diskutieren.« Ihr Tonfall wurde zunehmend wütender, und ihr Gesicht war rot angelaufen. »Haley, sollte ich etwas gesagt haben, das Sie aufgeregt hat, bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an«, bat John dringlich, auch weil er befürchtete, das Interview schlage eine andere Richtung ein als beabsichtigt. »Ich muss das hinauslassen; zu lange habe ich es für mich behalten. Ich muss es fast täglich lesen und mir anhören. Daddy zitierte vor langer Zeit einmal George Orwell für mich: ›Die Menschen schlafen nachts nur deshalb friedlich in ihren Betten, weil harte Männer bereitstehen, um für sie Gewalt auszuüben.‹ So ist es seit jeher gewesen. Unsere Generation schenkte Ihnen ein Land: eine Republik, die Ihnen ein friedliches Dasein gewährleistet; einen Ort, an dem wir alle gleich geschaffen sind und uns nach unseren Möglichkeiten entfalten dürfen. Dann hinterfragen viele Ihrer Altersgenossen, wie es dazu kam, weil sich einige der Taten, die im Rahmen der Entwicklung begangen wurden, nicht hübsch passgenau in eine Moralschublade stecken lassen. Sie konnten diese Moral überhaupt erst dadurch annehmen, dass Sie nie richtig dafür kämpfen mussten; Sie mussten nie eine wahrlich schwierige Entscheidung treffen – eine, von der tatsächlich Menschenleben abhängen.« »Tut mir leid, wenn ich ignorant daherkomme, aber woran liegt das?« Dass die geruhsame Frau, die er vergangene Woche kennengelernt hatte, derart aufbrausen konnte, bestürzte John. Haley atmete tief durch. »Ich habe michlangeim Schatten zurückgehalten. Jetzt darf ich dank Ihnen darlegen, wie und warum diese Republik gegründet wurde. Sie wollen alles wissen? Ich gebe Ihnen jedes schmutzige Detail. All Ihre Leser werden erfahren, dass viele dafür bluteten, dieses Land aus der Taufe zu heben, das wir heute Heimat nennen. Zuerst verlor ich meine Unschuld, dann meinen Bruder, doch das war nur der Anfang.« Haley stand auf, trat vor das breite Panoramafenster und beobachtete den herumwirbelnden Schnee. John blieb wie erstarrt sitzen. Er war unsicher, wie er weiter vorgehen sollte, und schaute hinunter auf sein Aufnahmegerät, um sich zu vergewissern, dass es während ihrer langen Monologe eingeschaltet gewesen war. Als er das hellrote Licht am Gerät sah, seufzte er leise vor Erleichterung. »John, ich bereue nicht, mich … klar ausgedrückt zu haben. Ich hatte lediglich das Gefühl …« »Schon in Ordnung, Haley. Ich weiß, dass das hart für Sie sein muss«, beteuerte John. Er kämpfte gegen den Drang an, weiter nachzubohren, warum sie ausfällig geworden war. In gewisser Weise fasste er ihre Schimpftirade als persönlichen Angriff gegen sich auf. Immerhin schrieb er eine Kolumne für dieCascadian Timesund hatte im Laufe der Jahre mehrere Kommentare beigesteuert, die einige der während des Großen Bürgerkriegs angewandten Taktiken kritisierten, insbesondere jene, die Gordon Van Zandt durchgesetzt hatte. Er vermutete, was er gerade erlebt hatte, war Haleys Reaktion auf jene Artikel.
22. Februar 2015
Wer nicht weiß, woher er kam, wird sein Ziel nie erreichen.José Rizal
Klamath Falls, Oregon
»Verdammt!«, donnerte Gordon. Massenweise Schnee kam herunter. Er sah allmählich so gut wie nichts mehr, und der Wagen, den er fuhr, war nicht für diese Witterung gerüstet. Ihm blieb nichts anderes übrig, als die Straße zu verlassen und einen Platz zu finden, an dem sie ihr Lager aufschlagen konnten. Brittany schaute ihn von der Seite an. »Wie wäre es, wenn du langsamer fahren würdest, Gordon? Rasen bringt bei diesem Wetter nichts.« Er warf ihr einen zornigen Blick zu, der jedoch rasch aufweichte. Immer wieder dachte er an jenen Tag vor Wochen, als er Tyler um Hilfe rufen gehört hatte. Zuerst wäre er am liebsten weitergezogen, doch nach dem, was Hunter passiert war, konnte er ein Kind in Not nicht im Stich lassen. Gordon und Brittany hatten jeweils ihre eigenen egoistischen Gründe dafür, gemeinsame Sache zu machen. Sie besaß ein funktionierendes Fahrzeug, und er konnte sie mit Tyler an einen sicheren Ort bringen. Aus diesem Schulterschluss war im Laufe mehrerer Wochen gemeinsam auf Reisen mehr als eine einfache Zweckgemeinschaft geworden; sie sorgten wirklich füreinander. Eine Situation, in der es um Leben oder Tod ging, konnte Menschen zu einem solchen Verhalten bewegen. Jeder Morgen unterwegs brachte neue Herausforderungen mit sich, doch Gordon erkannte schnell, dass Brittany in der Lage war, genau das zu tun, was notwendig war, und zwar zum jeweils richtigen Zeitpunkt. Einen Eindruck ihrer Standhaftigkeit hatte er erhalten, als sie so weit gegangen war, einen Mann zu töten, der Tyler bedroht hatte, und jeder weitere Tag bestätigte, wie viel sie wegstecken konnte. Gordon war froh, seinen Instinkten vertraut und den beiden gestattet zu haben, mit ihm zu kommen. Brittany kannte sich nicht nur hervorragend mit den Grundlagen des Überlebens aus – sie konnte aus Speiseresten genießbare Mahlzeiten zaubern und wusste mit einer Waffe umzugehen – sondern hatte sich auch als großartige Gefährtin herausgestellt. Sie war ebenso intelligent wie gelassen und eine ausgezeichnete Beobachterin, wenn es darum ging, rasch auf bestimmte Umstände zu reagieren, vor allem aber gut darin, mit seinem zuweilen unberechenbaren Benehmen umzugehen. »Wir müssen einen Platz finden, wo wir im Freien übernachten können«, sagte er lapidar. »Eben sah ich ein Schild, ungefähr eine Meile hinter uns«, erwiderte Brittany. »Wir kommen gleich an einem Rastplatz vorbei.« »Rastplatz? Hm …«, brummte Gordon. Er fuhr langsam weiter, während er die Optionen gegeneinander abwog. »Also, wir müssen von der Straße runter, aber der Gedanke an einen Rastplatz beruhigt mich nicht unbedingt.« »Wir können nicht schon wieder im Wagen schlafen. Außerdem gibt es dort vielleicht etwas zu essen«, stellte Brittany in Aussicht. Sie hatte recht. Sie hatten die vergangenen paar Nächte in dem engen Auto verbracht, und sich einmal beim Schlafen ausstrecken zu können, würde ihnen allen gut tun. Im Rückspiegel sah Gordon, wie Tyler aus dem Fenster starrte und an seinen Fingernägeln kaute. Er war ein stiller Junge, der ohne Widerrede tat, was seine Mutter ihm sagte. Hunter mochte etwas älter gewesen sein als er, doch obwohl Gordon versuchte, auf Abstand zu bleiben, ertappte er sich oft dabei, mit Tyler zu sprechen wie ein Vater mit seinem Sohn. »Hey, Kumpel, falls du hungrig bist, haben wir einen Müsliriegel, den du knabbern kannst«, scherzte Gordon. Da zog der Knabe schnell die Hand von seinem Mund weg und schaute in Gordons Augen im Spiegel. Er lächelte kurz und tat gleichmütig. »Der Kleine ist nervös; das tut er dann nämlich immer«, entschuldigte Brittany ihren Sohn. »Schon gut, ich habe das auch oft getan, als ich jünger war. Zählte zu meinen Lastern. Hey, Tyler, tut mir leid, ich wollte dich nicht bloßstellen.« Bevor der Junge antworten konnte, klopfte seine Mutter gegen die Windschutzscheibe. »Gleich dort ist die Ausfahrt! Siehst du sie?«, fragte sie aufgeregt. Gordon lehnte sich weiter nach vorne und kniff die Augen zusammen. Durch die schnell eingestellten Scheibenwischer konnte er sie kaum ausmachen. Er nahm den Fuß vom Gas, bis der Wagen regelrecht dahinkroch. Auf dem Weg die Ausfahrt hinunter fiel ihnen ein großer Sattelschlepper auf, der den Eingang zu den Gebäuden versperrte. »Du weißt, was ich von Situationen wie dieser halte«, sprach Gordon. »Das tue ich, aber habe ich mich bisher auf dieser Fahrt geirrt?« »Nein, hast du nicht, und ebendeshalb ist es einen Blick wert.« Brittany grinste. Wegen des dichten Schneefalls und langen Lasters sah Gordon zu wenig, als dass er hätte sagen können, ob sich schon jemand in den Gebäuden verschanzt hatte. Es gab nur eine Möglichkeit, sich zu vergewissern, ob es dort sicher war. Er wendete und parkte rückwärts ein, sodass der Wagen mit der Schnauze zur Straße zeigte – nur für den Fall, dass sie flugs die Flucht ergreifen mussten. »Brittany, ich will, dass du dich hinters Steuer setzt. Stell deine Uhr auf 15 Minuten«, bat Gordon. »Wenn ich dann nicht …« »Verstanden, verstanden: Wenn du dann nicht wieder hier bist, soll ich abhauen. Los, los, geh schon, es ist kalt.« Sie bedeutete ihm, die Tür zu schließen. Brittany rutschte auf den Fahrersitz. Sie zog eine halbautomatische Pistole und prüfte, ob sie schussbereit war, wie Gordon es ihr gezeigt hatte. Dann steckte sie diese wieder in ihren Halfter und blieb nachdenklich sitzen. »Mom, wie lange dauert es noch, bis wir in Idaho ankommen?« Sie drehte sich zu ihrem Sohn um und antwortete: »So lange, wie wir brauchen werden, Ty.«
***
Gordon schlich zum Führerhaus des Sattelschleppers und spähte daran vorbei. Er sah drei kleine Gebäude. Auf dem Parkplatz davor stand eine Handvoll Autos, ausnahmslos Modelle jüngeren Baujahrs. Er versuchte, sich einen möglichst guten Überblick zu verschaffen. Niemand in Sicht, nichts rührte sich. Nachdem er seine Sig Sauer gezückt hatte, lief er aufs mittlere Gebäude zu, bei dem es sich anscheinend ums Besucherzentrum handelte. Der einzige Eingang war eine gläserne Doppeltür. Durch seine Jacke fühlte sich die Mauer eiskalt an, als er sich gegen sie drückte. Dabei lief ihm ein Schauer über den Rücken, und er bekam eine Gänsehaut. Er beugte sich nach vorne und schaute hinein: nichts. Er stieß die Tür auf und schlüpfte mit vorgehaltener Waffe ins Innere. Keine Taschenlampe blendete ihn, niemand feuerte – ein gutes Vorzeichen. Die Pistole in der rechten und seine eigene Taschenlampe in der linken Hand haltend, orientierte er sich im Raum. Er war verlassen, und zwar, wie es aussah, schon seit den Anschlägen. Davon konnten sie profitieren, was umso mehr feststand, als sein Lichtkegel auf zwei unversehrt aussehende Verkaufsautomaten fiel. Er schritt ohne Zögern zu ihnen hinüber. Hinter der dicken Glasscheibe des einen lockte eine Tüte Doritos. Er konnte kaum erwarten, den beiden anderen zu erzählen, was er gefunden hatte, wenn er zurückkam. Als ihm einfiel, dass Brittany die Idee zu diesem Zwischenstopp gekommen war, musste er schmunzeln. Sie schien intuitiv zu erkennen, ob sie sich irgendwo sicher wähnen durfte – und falls nicht, wusste sie, wie sie darauf zu reagieren hatten. Dann kam ihm selbst eine Idee: Er steckte die Pistole ein und nahm seinen ausziehbaren Schlagstock heraus.
***
Brittany schaute ständig auf ihre Armbanduhr, während das Ende der Viertelstunde zusehends näher rückte. Sie wusste, wozu sie gezwungen war, wenn die Zeit ablief, doch die Vorstellung, Gordon alleinzulassen, versetzte ihr einen Stich. »Wo ist er, Mom?«, fragte Tyler unruhig. »Er kommt gleich«, beschwichtigte sie mit einem neuerlichen Blick auf die Uhr. Es wurde rasch dunkel, weil das Schneegestöber von Minute zu Minute zunahm. Falls sie fliehen musste, würde sie quasi überhaupt nichts sehen. »Mach schon, Gordon«; flüsterte sie bei sich, während sie mit einem Arm über die beschlagene Scheibe wischte. Als sie wieder hindurchschauen konnte, sah sie ein Paar Scheinwerfer auf sie zukommen. Sie gehörten zu einem Ford-Kleinlaster aus den 1990ern. »Duck dich!«, befahl sie Tyler. Als der Wagen näherkam, zogen sie die Köpfe ein, sodass sie nicht mehr durch die Fenster zu sehen waren. Brittanys Herz klopfte heftig. Jedes Fahrzeug, jede fremde Person stellte eine mögliche Bedrohung dar. Sie schloss die Augen und betete darum, dass er einfach nur vorbeifuhr. Das tat er, wenn auch langsam. Gerade als sie leise vor Erleichterung aufatmete, drehte er unvermittelt und blieb auf der Höhe ihres Autos stehen. Brittany lag mit dem Gesicht zur Fahrertür gedreht auf dem Rücken und hielt sich die Pistole vor; sie war bereit, sie einzusetzen, wenn es nötig wurde. Eine Tür des Ford ging auf, dann eine zweite. Was sie dann hörte, klang nach einem Mann und einer Frau, die sich unterhielten. Er lachte – mit tiefer, kehliger Stimme – und dann wurde draußen alles still, während die beiden aufs Auto zukamen, wohingegen Tylers hektisches Keuchen Brittany Schwierigkeiten bereitete, sich zu konzentrieren. Auf einmal fielen ihr die hinteren Türen ein. Sie riss die Augen auf, als sie sich umdrehte und sah, dass die Seite ihres Sohnes nicht verriegelt war. »Ty, sichere die Tür«, zischte sie kaum lauter als im Flüsterton. »Mom, ich kann nicht, ich hab Angst«, wisperte er im Gegenzug. Jetzt hörte sie Eis knirschen, als eine der beiden Personen zur hinteren Tür auf der Beifahrerseite trat. Wohl wissend, dass sie nur noch wenige Schritte voneinander trennten, fuhr sie hoch und wollte die Zündung betätigen – doch bevor sie das schaffte, wurde die Tür zur Rückbank aufgezogen. »Sieh an, was haben wir denn da?«, fragte der Mann, packte Tyler an den Schultern und versuchte, ihn aus dem Auto zu zerren. »Pfoten weg von ihm!«, schrie Brittany. Sie drehte sich mit ihrer Pistole um, konnte aber nicht ungehindert schießen, solange er den Knaben an sich drückte. Mit einem Mal knackte es, und ihre Windschutzscheibe platzte, woraufhin Splitter gegen die eine Seite ihres Gesichts spritzten. Benommen drehte sie sich wieder um und schaute in die Mündung einer Flinte, die von der Frau gehalten wurde. Ihr Gesicht war ausgezehrt und verschmiert, ihr langes, fettiges Haar hing unter einer dreckigen Wollmütze heraus. Als sie den Mund aufmachte, offenbarten sich gelbe Zähne mit Essensresten dazwischen. »Knarre runter und raus aus dem Wagen, verdammt!«, brüllte sie.
***
Als Gordon auf die Packung Doritos in seiner Hand schaute, lief ihm das Wasser im Mund zusammen, voller Vorfreude auf den Käsegeschmack der knusprigen Tortillachips. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann er zum letzten Mal welche gegessen hatte. Während er sich die Arme mit Schokoriegeln und Chipstüten volllud, ließ Gordon die bisherige Zeit mit seinen Mitreisenden Revue passieren. Er war froh, über seinen Schatten gesprungen zu sein und Brittany und ihrem Sohn geholfen zu haben. Hätte er das nicht getan, wären sie gestorben, und er müsste nun ohne verlässliche Hilfe auf der Suche nach Rahab auskommen. Dabei spielte es keine Rolle, dass die beiden nicht wussten, worauf sie sich einließen. Mittlerweile nagten Zweifel an Gordon, was sein neues Ziel betraf. Samantha und Haley fehlten ihm sehr, auch weil er mit jedem weiteren Tag weniger überzeugt davon war, dass er dem richtigen Plan folgte. Außerdem plagten ihn Gewissensbisse, weil er Brittany nicht gestanden hatte, wohin er sie in Wirklichkeit brachte. Wenngleich er sie nicht direkt anlog, schenkte er ihr aber auch keinen reinen Wein ein: Sie fuhren nach Idaho und in Sicherheit, das stimmte, doch zuerst würde er Rahab aufspüren und umbringen. Obschon Brittany unverblümt und von sich selbst überzeugt war, stellte sie nicht allzu viele Fragen und vertraute Gordon grundsätzlich. Allerdings war sie auch eine smarte Frau, und er wusste, bald würde der Moment kommen, da sie erfahren wollte, wieso sie nach Westen statt gen Norden Richtung Idaho fuhren. Er hatte sich seine Vorwände wiederholt im Kopf vorgesagt, doch jetzt klangen sie leer für ihn. Während er einsah, dass es unfair war, sie in seinen Rachefeldzug hineinzuziehen, fiel ihm nicht ein, wie er es vermeiden sollte. Als er das Gebäude verließ, waren die Schneeflocken dicker, und noch kälterer Wind wehte sie ihm entgegen. Auf dem Rückweg zum Wagen kicherte er in sich hinein, weil er sich die vielen Unterhaltungen und Streitgespräche vor Augen hielt, die er mit den Jahren über potenzielle Szenarien im Rahmen einer Apokalypse geführt hatte. Wer hätte geahnt, dass er einmal freiwillig eine ehemalige Kellnerin und ihren jungen Sohn aufnehmen würde, während er ums Überleben kämpfte? So oft hatte er jene Schreibtischhengste und Korinthenkacker als zukünftige Opfer einer Welt wie dieser gesehen, in der er jetzt lebte. Er bildete sich zu Recht etwas auf seine Fertigkeiten ein, begriff jetzt aber auch, dass mehr zum Überdauern gehörte als eine Reihe von Kompetenzen oder ein bestimmtes Kontingent an Vorräten. Genauso wichtig waren gewisse geistige Qualitäten, die gerne übersehen wurden, die aber gebraucht wurden, um für den Ernstfall auch ohne Probe oder sonstige Vorkehrungen gewappnet zu sein. Davon hing letztlich ab, wer durchkam und wer auf der Strecke blieb. Brittany zählte zum geistig starken Schlag, war eine besonnene, ausgeglichene Person in allen Lagen. Ehe die Lichter ausgegangen waren, hatte Brittany zu Hause Mutter gespielt, und ihre einzige berufliche Erfahrung als Kellnerin ging auf eine noch frühere Zeit zurück. Ihr verstorbener Ehemann war Lkw-Fahrer gewesen. Sie hatten sich von einem Gehaltsscheck zum nächsten gehangelt, und war einmal etwas übrig geblieben, hatte er es in das Auto gesteckt, mit dem sie jetzt fuhren. Bislang hatte Brittany ohne Ausbildung oder Ressourcen überlebt. Natürlich war es mit ihrem Glück nicht mehr weit her gewesen, als sich jene Männer vor so vielen Wochen auf sie und ihren Wagen gestürzt hatten, doch seit nicht allzu langer Zeit staunte Gordon immer wieder über ihre Fähigkeit, zu überleben. Wenn sie die Gelegenheit zum Auftrumpfen bekam, verblüffte sie jedes Mal, behauptete sich als leistungsfähig und gerissen. Sie ergänzte ihn, worin sie Samantha nicht unähnlich war. Brittany überlegte bewusst, hörte aber auch auf ihren Bauch und handelte, wenn Ärger im Verzug war. In Gordons Augen gab es drei Typen von Menschen: aktive, passive und Zauderer. Bei einem traumatischen Ereignis liefen die Aktiven der Gefahr entgegen, wohingegen die Passiven wie erstarrt stehen blieben und die Zauderer, so schnell sie konnten, in die entgegengesetzte Richtung Reißaus nahmen. Brittany hatte sich als aktive Person erwiesen. Obwohl ihr die Ausbildung fehlte, fürchtete sie sich nicht davor, in die Schusslinie zu treten. Er respektierte das und konnte nach mehreren gemeinsamen Wochen behaupten, er sei bereit, sein Leben in ihre Hände zu legen. Brittany zeigte sich außerdem als fähige Pflegekraft. Die Schnittwunde in seinem Gesicht, die ihm Rahab zugefügt hatte, verheilte noch, und Brittany sah zu, dass dies so gut wie möglich geschah. Nelsons hatte sie zwar zweckmäßig genäht, doch eine Entzündung war nicht ausgeblieben, also hatte sie die Wunde desinfiziert und wieder sauber verschlossen. Wenn sie endgültig verheilt war, würde eine lange, dicke Narbe zurückbleiben, ein ewiges Andenken an jenes fürchterliche Ereignis. Er musste Brittany zugutehalten, dass sie nicht einmal nach dem Ursprung fragte, und Gordon gab diese Information auch nicht von sich aus preis, weil er jene schreckliche Zeit nicht noch einmal durchleben wollte. Jetzt stürmte es so heftig, dass Gordon beim Gehen unter sich schauen musste. Er hob jedoch den Kopf, als er glaubte, einen Schrei inmitten des pfeifenden Windes gehört zu haben. Dann blieb er stehen; ein zweiter Schrei bestätigte seinen Verdacht. Gordon ließ Schokolade und Knabbereien fallen, um zum Auto zu rennen. Als er hinter dem Sattelschlepper hervorkam, machte er einen Kleinlaster, den Wagen und vier Personen aus. Er stürmte mit gezogener Pistole auf sie zu. Der Mann und die Frau merkten nichts, bis er nur noch zehn Fuß entfernt war. Ersterer schaute wie vom Blitz getroffen drein, als Gordon gelaufen kam, zog Tyler näher an sich und hielt ihm einen Revolver an die Schläfe. Die Frau richtete ihre Flinte auf Brittanys Rücken. Gordon schätzte die Szene rasch ein und gelangte zu dem Schluss, dass diese beiden zu keiner Bande gehörten, also war wohl auch keine Verstärkung für sie im Anmarsch. Er schaute zu Tyler, dem die Furcht in die grünen Augen geschrieben stand. Hätte das Paar Tyler und Brittany umbringen wollen, wären sie längst tot. Gordon schlussfolgerte daraus, dass sie keine Killer von Natur aus waren, aber zu töten imstande, wenn es sein musste. In diesen verzweifelten Zeiten vermochte der Bedarf an Nahrung, Obdach oder einem Fahrzeug so manchen zum Mörder zu machen. Gordon besaß wenig Handlungsspielraum. Sein Instinkt riet ihm, den Mann zuerst zu erschießen, woraufhin die Frau, so er sie richtig einschätzte, zögern und ihm damit Zeit geben würde, auch sie niederzustrecken. Er war sich aber nicht sicher – ein unvertrautes Gefühl für jemanden, der geradezu übertrieben entschlussfreudig war. Was, wenn die Frau, nachdem er den Mann gefällt hatte, kein Halten mehr kannte und auf Brittany feuerte? »Waffen runter! Ich werde Ihnen nichts tun, wenn Sie sofort Ihre Schießeisen niederlegen«, rief Gordon. »Sie und wir beide, jeder darf frei seiner Wege gehen.« »SielegenIhrSchießeisen nieder!«, brüllte der Mann. »Genau, wir sind zu zweit! Ich bring die Schlampe hier um!«, drohte die Frau. Gordon wagte es, ein paar Schritte weiterzugehen, um herauszufinden, wie sie sich verhielten. Der Mann beschränkte sich darauf, Tyler noch fester zu packen. Die Frau machte große Augen, als Gordon ebendiese paar Schritte ging, als wäre ihr nicht ganz klar, was sie von ihm erwarten sollte. Diese Reaktionen zeigten Gordon alles, was er zu wissen brauchte. Er ging sein letztes Risiko ein und begann, den Abzug zu betätigen. Der Schuss aus der Pistole klang fast gedämpft bei all dem Schnee und Wind ringsum. Gordon hatte zielgenau auf den Mann angelegt und ihn direkt unter der Nase getroffen. Er brach sofort zusammen, Blut quoll aus seinem Hinterkopf und färbte den weißen Schnee dunkel ein. Die Frau heulte laut auf, als sei sie selbst angeschossen worden. »Du Bastard!«, fuhr sie Gordon an. Brittany witterte ihre Chance: Sie entzog sich der Frau prompt, wirbelte herum und umfasste zugleich den Lauf der Flinte – ein Trick, den ihr Gordon beigebracht hatte. Er selbst zielte dann auf die Frau und drückte ab, verfehlte jedoch. Sie machte einen Satz auf Brittany zu und rang mit ihr um die Waffe. Gordon lief hinüber. »Lassen Sie das Gewehr los, und Sie dürfen verschwinden!«, bellte er. Die Frau zog kräftig, sodass der Lauf Brittany entglitt. Gordon richtete seine Pistole erneut aus und feuerte schnell zweimal hintereinander. Beide Kugeln trafen, eine in ihre Brust, die andere in den Bauch. Die Frau stöhnte und kippte aufgrund der Wucht des Aufpralls rückwärts gegen den Ford. Infolge der kräftigen Erschütterung gab sie einen Schuss ab, als die Flinte direkt auf Brittany zeigte. Diese schrie vor Schmerz auf und sackte zusammen. Gordon lief hin und ging mit leidvoll verzerrtem Gesicht neben ihr auf die Knie. Tyler blieb steif vor Schock stehen, wo er die ganze Zeit über verharrt hatte. Brittany hatte arge Mühe, Luft zu holen. Sie war schwer getroffen und blutete stark, während sie ausdruckslos in den grauen Himmel über ihr starrte. »Ich bin bei dir; alles wird gut, versprochen!«, sagte Gordon. Als er die Wunde untersuchte, stellte er fest, dass der Großteil der Ladung den oberen Bereich ihrer Schulter erwischt hatte, obwohl sich auch mehrere kleine Löcher am Hals und rechten Arm sowie an der Brust abzeichneten. Sie war mit Vogelschrot der Kugelgröße Nummer 7 angegriffen worden, aber aus unmittelbarer Nähe, also mit geringer, konzentrierter Streuwirkung. Das hatte ihre rechte Schulter schwer in Mitleidenschaft gezogen, doch sie konnte es überleben, wenn sie schnell behandelt wurde. »Tyler«, wisperte sie. Wie sehr sie litt, ließ sich an ihrer zittrigen Stimme erahnen. Gordon blickte über seine Schulter und sah, dass der Junge immer noch wie angewurzelt dastand. »Tyler, ich brauche deine Hilfe! Komm zu mir; wir müssen deine Mutter hineinbringen, damit ich das behandeln kann!« Tyler bewegte sich nicht, sondern starrte nur an Gordon vorbei. »Bitte kümmere dich um meinen Sohn«, flüsterte Brittany. »Pst! Du kommst wieder auf die Beine. Ich muss dich nur irgendwie nach drinnen schaffen«, sagte Gordon leise zu ihr. Er übte mit der linken Hand Druck auf die Wunde aus. Dann drehte er sich wieder nach dem Kleinen um und rief: »Tyler, kommt jetzt hierher!« Der Junge zeigte mit fahriger Hand auf etwas auf der Straße. Gordon fuhr mit dem Kopf in die Richtung herum, in die Tyler den Arm ausstreckte. »Shit!« Mehrere Paar Scheinwerfer näherten sich. Er richtete Brittany an den Schultern auf und fing an, sie zum Auto zu ziehen. Sie schrie auf, als er Hand an sie legte. Endlich reagierte Tyler, indem er auf die offene hintere Tür des Wagens zulief, aber noch bevor sie die Verletzte überhaupt hineinheben konnten, waren sie von drei Fahrzeugen umgeben, und mehrere Männer stiegen aus. Einer rief laut: »Nehmen Sie die Waffe herunter, wir sind Marines!«
Sandy, Utah
Sebastian betrachtete sich im Badezimmerspiegel. Alle paar Tage heiß duschen zu können, war ein Luxus, den nur noch wenige kannten, und er wusste ihn zu schätzen. Er kraulte sich den schon recht dichten Bart, den er sich stehen ließ. Obwohl er die Mittel hatte, sich zu rasieren, war er dazu übergegangen, sein Gesichtshaar mit einer Schere zu stutzen. Zudem gefiel Annaliese sein Bart, und dieser Grund wog alle anderen Argumente auf. Während er sich mit den Fingern durchs Gesicht fuhr, funkelte der goldene Ehering an seiner linken Hand im Badezimmerlicht. Im Lauf der vergangenen Wochen seit ihrer Ankunft in Utah hatten sich die Ereignisse überschlagen. Dass sich Annaliese und er liebten, war endlich publik geworden, und er hatte um ihre Hand angehalten. Ihr Onkel Samuel war gegen die Hochzeit gewesen, ihre Mutter zunächst ebenfalls. Letztlich hatte sie sich aber besonnen und Samuel davon überzeugen können, dass Sebastian, wenngleich kein Mormone, ein verantwortungsvoller Mann war. Sie kannten einander noch nicht so lange, wie es früher üblich gewesen sein mochte, aber diese Zeiten waren keine gewöhnlichen. Niemand wusste, was die Zukunft brachte, also hatten sie beschlossen, umgehend zu heiraten. Samuel war bereit gewesen, die Zeremonie durchzuführen, obschon sich Sebastian geweigert hatte zu konvertieren. Diese Beharrlichkeit von seiner Seite aus führte dazu, dass sich die Kluft zwischen den beiden Männern vergrößerte. Annaliese hatte viel Zeit damit verbracht, Samuel begreiflich zu machen, dass ihre Liebe zu Sebastian mehr war als der Feuereifer eines jungen Mädchens, so ihre Ausdrucksweise zunächst. Sicherlich fühlte sie sich auch körperlich zu ihm hingezogen, doch ihre Zuneigung füreinander war aufrichtig und innig. Sie hatten in so kurzer Zeit so viel gemeinsam durchgestanden und so viel mitgemacht, dass es gewissermaßen für mehrere Leben reichte. Im Zuge der Schicksalsschläge, die sie zusammen bewältigen konnten, war ihr offenbar geworden, mit was für einer Art von Mann sie zu tun hatte. Sie konnte ihm nicht nur ihr Leben, sondern auch ihr Herz anvertrauen. Sebastian hatte ihr bewiesen, dass er ein Mensch war, der seine Menschlichkeit in dieser neuen Welt zu bewahren wusste, ein wichtiger Wesenszug. So viele kamen davon ab, doch er bewährte sich als Mann, mit dem sie gerne zusammenblieb. Vor dem Zusammenbruch hätte Annaliese niemanden wie Sebastian kennengelernt, geschweige denn sich in einen solchen Mann verliebt. Die herben Umstände dort draußen veränderten ihren Blickwinkel und stellten ihren Glauben auf die Probe. Während andere ihr Heil in der Religion suchten, um Antworten darauf zu finden, warum ihre Welt untergegangen war, kam sie zu dem Schluss, dass Gott sein Volk im Stich gelassen hatte. An sich schwor sie ihm nicht ab, nur war sie von der dogmatischen Überzeugung einer Glaubensrichtung abgefallen, die sich bereits auf einen unantastbaren Gott versteift hatte. Sebastian nahm sich Zeit im Bad, genoss die warmen Dämpfe, nachdem er geduscht hatte, und das Gefühl, sauber zu sein. Bald war er wieder unterwegs, um seinen Bruder zu suchen. Annaliese und er unterhielten sich oft über seinen Aufbruch. Wenngleich sie sich wünschte, er würde bleiben, wusste sie, dass er seine Familie unbedingt wieder zusammenbringen wollte. Die letzten paar Wochen auf Onkel Samuels Anwesen hatten ihm die Zeit gegeben, sein Bein so weit ausheilen zu lassen, dass er wieder ohne Krücken gehen konnte. Es war immer noch bandagiert, woran sich in den nächsten sechs Wochen nichts ändern würde, aber er konnte nicht mehr dasitzen und die Hände in den Schoß legen. Sie hatte darum gebeten, ihn begleiten zu dürfen, doch er wollte das Risiko, sie mit auf die Reise zu nehmen, nicht eingehen. Dies war der einzige Punkt, in dem er mit ihrem Onkel einer Meinung war, doch Annaliese bezeugte einen starken Willen und brachte ihren Begehr, die Suche mit ihm anzutreten, jeden Tag aufs Neue zur Sprache. Allerdings ließ sich Sebastian nicht ohne Weiteres umstimmen, sondern weigerte sich kategorisch, seine frischgebackene Ehefrau unmittelbarer Gefahr auszusetzen.