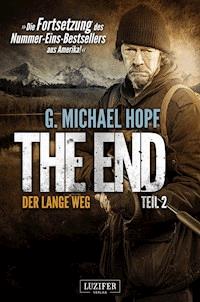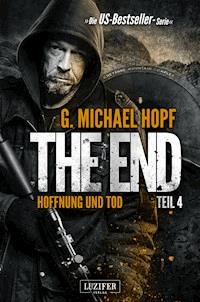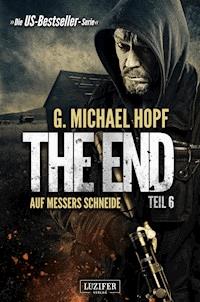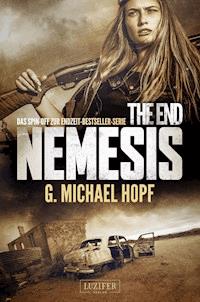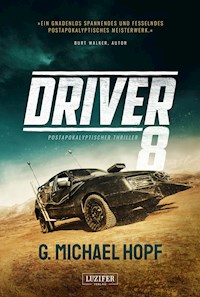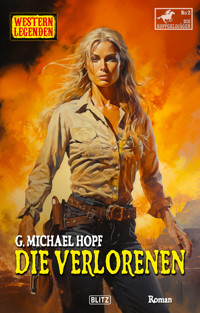Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: The End - Gordon Van Zandt
- Sprache: Deutsch
"Extrem spannend, düster, beklemmend und brutal – auf vielfache Art und Weise." [Huffington Post] "Erfrischend neues Endzeit-Szenario" [Lesermeinung] "Fesselnd und spannend! Realistisch zugleich ... Teil 2 ich komme ..." [Lesermeinung] "Das Buch von Michael Hopf stellt Szenarien dar, wie sie vielleicht in ein paar Jahren wirklich realistisch sein können, beziehungsweise Ausläufer schon geschehen sind. Man möchte es gar nicht weglegen, weil man Angst hat, in den nächsten Zeilen gleich etwas zu verpassen." [Lesermeinung] Inhalt: Für Gordon Van Zandt waren Treue und Pflicht gegenüber dem Vaterland so selbstverständlich, dass er direkt nach 9/11 das College hinschmiss und ins Marine Corps eintrat. Doch diesen jugendlichen Idealismus ließ er bald in einer kriegsgeschändeten Stadt im Irak zurück. Zehn Jahre später kämpft er noch immer mit den Geistern seiner Vergangenheit, als er und seine Familie plötzlich einer neuen Realität gegenüber stehen. Nordamerika, Europa und der ferne Osten erlitten einen verheerenden Super-EMP-Angriff, der vernichtende Auswirkungen auf die Stromnetze und alle elektrischen Geräte zur Folge hat. Nach dem totalen Zusammenbruch jeglicher wirtschaftlicher Infrastruktur - ohne Auto und Telefon - weiß Gordon, dass er um begrenzte und schwindende Ressourcen kämpfen muss. Gemeinsam mit befreundeten Nachbarn beschließt er, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen - und Rücksicht gegenüber anderen Menschen gehört nicht dazu. Jeden Tag muss er Entscheidungen treffen, die in der "alten Welt" extrem und äußerst brutal erschienen wären, nun aber überlebensnotwendig sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
THE END
Die neue Welt
Impressum
überarbeitete Ausgabe Originaltitel: THE NEW WORLD Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-943408-67-6
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Alles im Leben beginnt mit einer Idee, doch nur unter Aufwendung von unheimlich viel Energie wird sie zur Wirklichkeit. Dass man dabei einen längeren Weg beschreitet, gehört dazu und bedarf für gewöhnlich der Hilfe und Unterstützung anderer Menschen. Dieses Buch ist auf ähnliche Weise entstanden; am Anfang spukte eine Idee in meinem Kopf herum, dann nahm ich mir eines Tages Zeit und fing an, das niederzuschreiben, was ihr nun lesen werdet. Ich hätte es ohne die Zuneigung und den Beistand der folgenden Personen nicht fertigstellen können:
Mom: Tahnee, du hast mir vom ersten Tag an Liebe, Rückhalt sowie Orientierung gegeben und tust es bis heute. Stets hast du ein aufmunterndes Wort und einen nützlichen Ratschlag für mich parat. Ich liebe dich. Seit dem Tag, an dem ich dich kennengelernt habe, darf ich mich als gesegnet ansehen und führe ein reicheres Leben. Ich danke dir.
Judy, in deiner Hilfsbereitschaft bist du unbeirrbar; immerzu stehst du mir zur Seite, egal was ich gerade tue. Mit deinem Großmut und deiner Warmherzigkeit hast du meinem Leben die Krone aufgesetzt. Vielen Dank dafür.
Mike Smith, du hast diesem Roman den letzten Schliff verliehen und das gewisse Etwas gegeben, das jedes Buch braucht. Danke für deine kostbare Zeit und Mühe – du bist der Beste!
15. Oktober 2066
Olympia, Washington, Republik Kaskadien
Haley war aufgestanden und sah durch die dünne Fensterscheibe nach draußen, welche die kühle Luft am Pudget Sound aus ihrem Wohnzimmer hielt. Sie betrachtete das Kapitol in der Ferne. Dessen Sandsteinkuppel überragte die anderen Gebäude der Stadt, wie es schon seit 138 Jahren der Fall war. Früher fungierte die Stadt als Hauptstadt eines einzelnen Bundesstaats, jetzt war sie der Sitz der Regierung dieses Landes, einer auf Chaos und Zerstörung geborenen Nation.
Sie zwang sich, ihren Blick aus der Distanz loszureißen, um auf das Foto in ihrer Hand zu sehen, und strich über die Köpfe der darauf abgebildeten Personen. Es waren vier strahlende Gesichter, das Porträt einer glücklichen Familie – ihrer eigenen. Tränen kamen ihr, als sie an den Tag zurückdachte, an dem das Foto entstanden war. Sie erinnerte sich lebhaft daran, als sei es erst heute Morgen gewesen. Haley schloss die Augen und drückte das Bild an ihre Brust; die Tränen rannen an ihren Wangen hinab und blieben am Kinn hängen. Sie spürte wieder, wie ihr Vater sie festhielt, während sie auf seinem Knie hockte; wie er sie viele Male auf den Kopf küsste und betonte, wie stolz er auf sie sei, da sie ihre Schuhe an jenem Tag ganz allein geschnürt hatte.
Sie sehnte sich nach dieser unschuldigen Zeit ohne Sorgen und Verantwortungen zurück, wünschte sich die Tage herbei, in denen ihre Familie miteinander vereint und glücklich gewesen war.
Nicht lange, nachdem dieses Foto geschossen wurde, hielt die brutale Realität von Massenmord und Weltuntergangsstimmung Einzug in ihre heile Welt. Diese neuen Umstände sollten ihre Familie gewaltsam trennen, und was übrig blieb, konnte nie mehr so werden wie zuvor.
Ein Klopfen an der Haustür holte sie in die Gegenwart zurück. Rasch wischte sie sich die Tränen aus dem Gesicht und schob das Foto in die Tasche ihres Pullovers. Dann trat sie zur Tür, doch bevor sie öffnete, drehte sie sich zum Wandspiegel um und betrachtete sich selbst. Als sie sicher war, dass sie alle Tränen abgetupft hatte, richtete sie ihr grau werdendes Haar.
»Du schaffst das, Haley«, sprach sie sich zu, in einem Versuch, Selbstsicherheit für die schwierige Aufgabe zu finden, die vor ihr lag.
Sie wandte sich wieder ab und öffnete die Tür. Unter dem Vordach standen drei Männer: John, der Mitte dreißig war und als leitender Reporter für die Cascadian Times arbeitete, sowie zwei Fotografen, die jeweils nicht älter als fünfundzwanzig sein mochten. In jedem Fall handelte es sich um Nachkriegskinder, die den Schrecken und die Grausamkeit der großen Bürgerunruhen nicht erlebt hatten.
»Mrs. Rutledge?«, begann John mit ausgestreckter Hand.
»Richtig, aber bitte nennen Sie mich Haley.« Sie packte fest zu und schüttelte die Hand.
Nachdem sie die beiden anderen begrüßt hatte, gewährte sie ihnen Einlass. Man plauderte zwanglos, während die Fotografen ihre Gerätschaften für die Bilderreihe aufbauten, die sich dem Interview anschließen sollte.
»Mrs. Rutledge, lassen Sie mich wissen, wann Sie bereit sind, damit wir anfangen können«, sagte der Journalist.
»John, bitte nennen Sie mich Haley.«
»Gut Ma'am«, antwortete er mit einem betretenen Lächeln.
Haley war nervös, als sie so dasaß und die Hände auf ihrem Schoß fest ineinander verschränkte. In Erwartung der ersten Frage rieb sie sich die Finger.
»Haley, zunächst einmal danke dafür, dass wir zu Ihnen nach Hause kommen durften. Es ist uns eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen, um Ihre persönliche Geschichte und Sichtweise zu erfahren.«
»Keine Ursache, John. Zugegeben: Ich bin ein wenig nervös. Wie Sie wissen, stand ich noch nie gerne im Rampenlicht und führe nur ungern Interviews. Ohne Ihre Verwandtschaftsbeziehungen wären Sie nicht hier; ich kannte Ihren Vater, der ein Freund und Kollege meines Vaters war. Erst als ich hörte, dass Sie derjenige sind, der mich befragt, rang ich mich dazu durch.« Sie hielt sich beim Sprechen sehr gerade und schaute John rundheraus an.
»Ich weiß durchaus, dass in der Vergangenheit Verbindungen zwischen unseren Familien bestanden, also noch einmal danke. Darf ich gleich beginnen?«
Haley nickte zustimmend.
»Nächste Woche markiert den 50. Jahrestag für den Abschluss des Vertrags von Salt Lake. Dieses Abkommen bedeutete den formellen Sieg unserer jungen Republik über den Feind und die Geburt unseres Landes. Ihr Vater wohnte der Unterzeichnung in Salt Lake bei; was können Sie uns über ihn erzählen?«
Haley kicherte kurz, bevor sie antwortete. »Wow, das ist keine leichte Frage. Was ich über meinen Vater erzählen kann … wo soll ich da bloß anfangen?« Sie hielt einen Moment inne. »Möchten Sie wissen, wie er damals war?«
»Ich merke schon, ich habe die Frage zu ungenau gestellt, Verzeihung. Lassen Sie es mich anders formulieren: Ihr Vater spielte eine maßgebliche Rolle bei der Entstehung dieser Nation; er ist einer unserer Gründungsväter, wie manche Stimmen behaupten. Während er von vielen für seine Opferbereitschaft gelobt wird, halten einige sein Handeln während des Großen Bürgerkrieges für fragwürdig. Wie würden Sie ihn beschreiben?«
»Mir sind ein paar jener Revisionisten ein Begriff, die nun im Schutze unserer hart erkämpften Freiheit die Wege anzweifeln, auf denen ebendiese gewonnen wurde. Ihnen sage ich: Ihr habt es nicht erlebt, ihr wart nicht dabei. Man kann sich leicht ins gemachte Nest setzen, behaglich unter dem blutbesudelten Banner unserer Revolution«, erklärte Haley in entschiedenem Ton. »Falls Sie hier sind, um die Taten meines Vaters infrage zu stellen, sollten wir meiner Meinung nach dort ansetzen, wer er genau war und woher er kam. Ich kannte ihn als liebevollen, behütenden Mann. Er sorgte für mich und den Rest seiner Familie, wobei er sich zu allem bereit zeigte, was unser Überleben sicherte. Viele bewerten die Historie, ohne sich der Umstände bewusst zu sein. Man muss es erlebt haben, um wirklich zu begreifen, was die Menschen zu ihrem Handeln motiviert hat. Mein Vater war ein Mann der Taten und reagierte sofort, wenn es jenen zugutekam, die er zu schützen geschworen hatte. So pragmatisch ist er allerdings nicht immer gewesen.« Haley hielt inne, verlagerte ihr Gewicht im Sessel auf die andere Seite und fuhr mit sanfterer Stimme fort. »Daddy machte keinen Hehl aus seiner Vergangenheit. Oft hörte ich Geschichten darüber. Er erzählte mir davon, wie das Schicksal zuschlagen und unsere Sichtweise auf das Leben verändern kann, dass uns bestimmte Erlebnisse in unseren Grundfesten erschüttern mögen und uns zum Umdenken anregen. Das ist meinem Daddy mehrere Male passiert. Zum ersten Mal, soweit ich mich erinnern kann, als Marinesoldat im Irak, wie er mir anvertraute. Was dort geschah, machte ihn zu einem anderen Menschen und ließ ihn den Weg einschlagen, an dessen Ende wir nun in diesem Wohnzimmer sitzen. Hoffentlich haben Sie etwas Zeit mitgebracht, denn ich werde diese Sache jetzt ein für alle Mal klarstellen.«
16. November 2004
Seid höflich und professionell, aber macht euch darauf gefasst, jeden töten zu müssen, dem ihr begegnet. – Marine-General James Mattis zu seinen Soldaten im Irak
Falludscha, Irak
»Ziel in Reichweite!«, rief Sergeant Gordon Van Zandt, während er konzentriert durch das Tagessichtvisier des TOW-Panzerabwehrgeschützes blickte.
Rings um Gordon knatterten Gewehre. Er fasste das Ziel ins Auge, das er gewählt hatte: ein kleines Fenster. Von dort aus hielt ein irakischer Scharfschütze eine Truppe Marines weiter oben auf der Straße in Schach. Die Reflexion seines Fernrohrs und wiederholtes Mündungsfeuer gaben seine Position preis.
Nachdem man den in Not geratenen Trupp darüber in Kenntnis gesetzt hatte, dass ihm keine Luftunterstützung zur Verfügung stand, wurde Gordons Panzerabwehreinheit herbestellt, um das Nest der Scharfschützen auszuheben. Ursprünglich waren ihre Waffen entwickelt worden, um gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören; im ersten Golfkrieg hatten sie sich jedoch auch auf weitläufigen Schlachtfeldern als nützlich erwiesen, etwa um Bunker zu sprengen.
Gordon zwang sich ruhig zu atmen und hielt das Fadenkreuz auf das Ziel gerichtet, während sein Fahrer Lance Corporal Bivens mit seinem Halbautomatikgewehr im Anschlag an der hinteren Fahrerseite des Wagens kauerte.
Er brüllte: »Rückstoßbereich sauber!« Bivens' Statur entsprach nicht dem Musterbild eines Marine: Er war klein, vielleicht 1,70 Meter, und hager, doch sein Spitzname Pitbull sagte mehr über ihn aus als alles andere. Er war ein standhafter Fighter und hatte sich als würdiger Gegner im Nahkampf erwiesen.
Gordon langte sofort mit dem rechten Arm über seinen Kopf, um den Hebel zur Entsicherung zu betätigen, und rief zurück: »Kanone bereit!«
Dann zog er beide Hände behutsam zurück auf die Armatur des Geschützschlittens und legte den Abzugsbügel mit dem rechten Daumen um.
Im selben Augenblick sah er den Gewehrlauf des Scharfschützen aus dem Dunkel des kleinen Verschlags ragen, den er besetzte. Indem er keine weitere Sekunde verschwendete, brüllte Gordon: »Volle Deckung!«
Dann drückte er ab.
TOWs gehen mit einem lauten Knall los, gefolgt von einem Zischen. Binnen weniger Sekunden ließ das laute Brausen der Rakete, die das Rohr auf dem Weg zu ihrem Ziel verließ, Gordons Ohren klingeln. Er verfolgte sie durchs Visier. Nicht lange, und er sah einen Blitz; sie war eingeschlagen. Alles, was Gordon nun erkannte, war dichter Rauch, der aus dem Fenster quoll.
»Treffer, Ziel zerstört!«, bestätigte er. Nachdem er sich wieder nach oben ausgestreckt hatte, um die Arretierung aufzuheben, ließ er das leere Rohr auf die Erde fallen.
Bivens schulterte sein Gewehr und öffnete schnell die hintere Luke des Geländewagens. Gordon, dem er flugs eine neue Rakete daraus reichte, lud das Rohr des Werfers ebenso rasch wie gewissenhaft und drückte den Verschluss nieder. Dann sprang er hinter das Visier, besah den Schaden und blickte sich nach weiteren Zielen um.
Sobald er sich sicher fühlte, wandte er den Blick von der Waffe ab und rief Lance Corporal Bivens zu: »Wir haben den Mudschahid-Wichser erledigt. Steig wieder ein, wir fahren los und helfen den Landratten.«
Der Fahrer kehrte hinter das Steuer zurück und sie machten sich auf den Weg zur Marinetruppe.
»Bivens, ruf die Kommandobasis an und bestelle einen Rettungshubschrauber.«
»Roger«, antwortete der Gefreite und griff zum Funkgerät.
Bivens und Gordon erreichten die Marines. Der Sergeant nahm sein M-4, sprang vom Geländewagen und drehte sich nach Bivens um. »Pass auf, während ich mich um die Jungs kümmere.«
»Roger«, sagte Bivens erneut, während er zurück in die Luke kroch.
Vor sich sah Gordon einzelne Mauern von Gebäuden, verstreute Kampfausrüstung und fallengelassene Waffen. Zwischen den Trümmern fand er elf Soldaten, einige verletzt und blutend, andere saßen an die Wand eines Hauses gelehnt in einer Gasse oder lagen reglos am Boden. Er konnte nicht ausmachen, ob sie tot waren. An seinen ersten Einsatz unter Feindbeschuss erinnerte er sich noch; damals waren ihm Zerstörung und Tod unwirklich vorgekommen, jetzt waren sie etwas Alltägliches.
Gordon näherte sich dem ersten Marine, ging vor ihm auf die Knie und fragte: »Wie ist dein Zustand?«
»Eingeweideschuss, verdammte Scheiße!«, brachte der Lance Corporal hervor.
»Hör zu, wir schaffen dich bald von hier weg«, versicherte Gordon, als er den Bauchverband des Verletzten anhob.
»Sanitäter, wie ist die Lage hier?«, rief Gordon dem Navy-Arzt zu, der sich gerade um einen anderen Verwundeten kümmerte.
»Wäre besser, wenn der Drecks-Hadschi seine Kugeln für sich behalten hätte«, entgegnete der Sanitäter beim Bandagieren des Mannes.
»Danke, dass ihr den Mudschahid hochgenommen habt. Euch muss der Himmel geschickt haben«, meinte ein Marine, der an Gordon vorbeiging. Als der Sergeant zu ihm aufsah, bemerkte er, dass dessen Bein und linker Arm bluteten, letzterer besonders stark.
»Wie geht es dir?«, wollte Gordon wissen.
»Beschissen, Sergeant. Hab schon bessere Tage gesehen, aber ich werd's überleben!«
»Gut, Mann. Wer hat hier das Kommando?«
»Na ja, eigentlich Corporal Davies, aber den erwischte der Scharfschütze zuerst. Kopfschuss«, erklärte der Marine und zeigte auf den leblosen Körper seines Vorgesetzten, der ebenfalls in der Gasse lag.
»Zu welcher Einheit gehörst du?«, fragte Gordon weiter.
»Erste und Drittes Platoon, Kompanie India, 3/1, Sergeant. Ich bin Lance Corporal Smith, aber nennen Sie mich einfach Smitty.«
»Mein Name lautet Sergeant Gordon Van Zandt, Waffentrupp, 3/1. Freut mich, dich kennenzulernen, Teufelskerl«, erwiderte Gordon und klopfte Smitty auf seine heile Schulter.
Daraufhin sah er nach und nach bei jedem verletzten Marine nach dem Rechten. Die Soldaten des Ersten Platoon von Bataillon 3 schlugen sich nun schon seit zehn Tagen auf dem Weg zu ihrem Einsatzziel durch. Es war ein harter Kampf, doch bei diesen Männern handelte es sich um Marines. Obwohl sie Verluste erlitten, blieben sie zielstrebig. Die Thundering Third, wie man sie nannte, würde ihr Soll erfüllen oder dabei draufgehen, wobei Letzteres für diese Männer allerdings außer Frage stand. Es gehörte zu ihrem Job, dafür zu sorgen, dass der Feind für seine Sache ins Gras biss.
Als Gordon auf einen außerordentlich schwer verletzten Infanteristen stieß, kniete er sich hin und besah sich die Wunden des Mannes. Anhand der Abzeichen an der blutgetränkten Uniform erkannte er, dass er es mit einem Private First Class zu tun hatte. Er mochte kaum älter als zwanzig sein, und Gordon kam nicht umhin, die finstere Voraussage zu treffen, dass dieser junge Kerl seinen einundzwanzigsten Geburtstag vermutlich nicht erleben würde. So nahm er dessen Hand und fragte: »Wie steht's, Soldat?«
Ohne die Augen zu öffnen, wisperte der PFC: »Mir ist kalt … bitterkalt.«
Gordon sah, dass sich die Blutlache unter dem Verwundeten weiter ausbreitete. Er neigte sich ihm zu und flüsterte in sein Ohr: »Wir haben den Fucker kaltgestellt, der das getan hat, und schaffen dich schnell von hier weg, versprochen.«
Ein Humvee rumpelte heran und bremste vor der Truppe. Aus den Hintertüren sprangen zwei Marines mit einer Tragbahre und liefen zu ihren in Mitleidenschaft gezogenen Kameraden. Einer nach dem anderen wurden diejenigen ins Fahrzeug geladen, deren Zustand am kritischsten war.
Gerade als man den Schauplatz räumen wollte, raste von Süden her etwas Schwarzes auf den Transporter zu und schlug in die Fahrerkabine. Die Explosion warf Gordon nieder.
Als er die Augen öffnete, wusste er nicht genau, wie lange er bewusstlos gewesen war. Die Rufe und Schreie … das Schießen … klang eigentümlich leise, wie aus der Ferne. Seine Augen brannten. Er sah einzig eine dicke, schwarze Rauchwolke, die über ihm waberte. Als er aufstehen wollte, fuhr ihm ein stechender Schmerz den Rücken hinauf.
»Gott verdammt!«, fluchte er. Indem er tief Luft holte, zwang er sich dazu, eine aufrechte Sitzhaltung anzunehmen. Seine Bewegungen waren mühevoll, doch er wusste, dass er sich aufraffen und etwas unternehmen musste. Als er sich umsah, entdeckte er Bivens, der hinter dem TOW stand und die Umgebung absuchte. Von der Ambulanz war wenig mehr übrig als die brennende Karosserie und vier qualmende Reifen. Die Insassen hatte es definitiv ausnahmslos zerrissen; auf den Vordersitzen erkannte er zwei brennende Leichname. Die verkohlenden Leiber waren vornübergebeugt und Flammen züngelten aus ihren offenen Mündern.
Gordon sah, dass die verbliebenen Marines Deckung suchten und zum Angriff gegen irgendetwas weiter unten auf der Straße übergingen. Er erhob sich, versuchte, das Gleichgewicht zu halten, und machte sich zu seinem Geländewagen auf.
»Bivens, falls du zum Schuss kommst, drück ab!«, befahl er.
»Ist nicht drin, Sergeant. Bei all dem Rauch lässt die Sicht zu wünschen übrig. Moment … da ist das Schwein … Ziel erfasst!«
Gordon blickte hinter das Geschütz, sah, dass sich niemand dort aufhielt, und rief zur Antwort: »Rückstoßbereich sicher!«
»Geschütz bereit«, brüllte Bivens – und kaum eine Sekunde später: »Volle Deckung!«
Nach dem vertrauten Knall und darauffolgendem Zischen schnellte die Rakete aus dem Rohr. Im Nu erreichte sie ihr Ziel, das Minarett einer Moschee, traf genau und ließ es in sich zusammenstürzen.
Die Marines jubelten, doch ihr Gefecht war noch nicht zu Ende: Mochten sie auch einen Aufständischen im Turm ausgeschaltet haben, so wurden sie weiterhin aus dem Gotteshaus mit Handwaffen angegriffen.
Während Gordon und Bivens das Geschütz nachluden, fuhr der zweite Humvee seiner Mannschaft vor. Gordon warf Corporal Nellis einen Blick zu, der die Ma Deuce bediente, das auf dem Dach montierte Maschinengewehr vom Kaliber .50.
»In dem Tempel, ungefähr anderthalb Blocks die Straße hinunter, hocken ein paar Alis. Gib den Landratten Feuerschutz mit der Browning«, wies er Nellis an, bevor er zu seinem Fahrzeug zurücklief und das Funkgerät bediente.
Er setzte sich mit der vorgeschobenen Kommandobasis in Verbindung, um weitere Unterstützung sowie erneut eine medizinische Rettungseinheit anzufordern.
Allmählich spürte Gordon die Nachwirkungen der Explosion. Als er die Funkverbindung beendete, bemerkte er Blut am Sprechteil. Beim Untersuchen seiner Finger stellte er fest, dass auch sie rot waren, also wischte er sie an seiner Hose ab. Als er an sich hinuntersah, tropfte es von seinem Kinn auf die Stiefel. Er fuhr sich mit einer Hand durchs Gesicht und betrachtete sie: Dickflüssiges Blut klebte an der Innenfläche. Im Seitenspiegel des Humvee schließlich offenbarten sich zahllose rote Tupfer wie Pockennarben in seinem Gesicht. Bei der Detonation war er von Schrapnellen getroffen worden. Um weiteres Blut zu entfernen, gebrauchte er seine Ärmel, doch da klar war, dass ihm keine Zeit blieb, sich um sein Gesicht zu kümmern, schloss er sich wieder den Kämpfenden an.
Die Kanone leistete mithilfe einiger weniger M203-Granaten ganze Arbeit an der Moschee, woraufhin die Umgebung, abgesehen von einzelnen Schüssen in der Ferne, verstummte.
»Was siehst du, Bivens?«, fragte Gordon.
»Nichts regt sich, aber Sie kennen diese Motherfucker ja.«
Die Moschee stand auf unheimliche Weise still da, ohne dass etwas daraus feuerte, geschweige denn sich bewegte. Als Gordon die Straße hinaufblickte, ahnte er, dass sich rechterhand einmal ein florierender Marktplatz erstreckt haben musste, links hingegen ein Fußballfeld. Jetzt lagen Trümmer auf der Straße; alle Gebäude waren zerschossen, und auf dem leeren Gehweg schwelten ein paar kleine Feuer. Der Sergeant wollte sich vergewissern, dass die Moschee sicher war, doch die einzige Möglichkeit dazu bestand darin, sie zu besetzen.
»Bleib am Geschütz und gib uns Deckung, falls wir sie brauchen. Ich werde diese Marines die Straße entlangführen und die Moschee absichern«, erklärte er Bivens. Im Wagen lagen weitere Sprenggranaten, nach denen er sich ausstreckte, um neben ein paar zusätzlichen Magazinen so viele an sich zu nehmen, wie er tragen konnte.
»Roger«, bestätigte sein Gefreiter.
»Ach nein, vergiss das gleich wieder. Dreh das Geschütz auf sechs Uhr und halt die Augen offen«, korrigierte Gordon und kehrte sich dem anderen Corporal zu. »Nellis, überwache unseren Vorstoß auf der Straße.«
»Roger«, entgegnete auch er.
Daraufhin lief der Sergeant zu Smitty. »Seid ihr in der Lage, loszuziehen und den Hadschi-Tempel einzunehmen?«
»Jawohl, sind wir«, erwiderte Smitty mit einem Lächeln.
Gordon führte die Soldaten durch die Geschäfte an der rechten Straßenseite, um eines nach dem anderen zu sichern. Dabei durchsuchten sie diese vom Erdgeschoss bis zum Dach, stiegen aufs benachbarte Dach und drangen wiederum nach unten vor. Das Schaufenster des letzten Hauses war zersprungen, der gesamte Bau mit Löchern durchsiebt. Der Sergeant nahm eine Sprenggranate zur Hand und warf sie durch die Öffnung. Der Explosion folgte ein Schrei aus dem Inneren.
Während die Marines gestaffelt entlang der Front darauf warteten, zur Tat schreiten zu dürfen, trat Gordon mit Anlauf gegen die Tür und stürzte hinein. Sie folgten und schwärmten jeweils in einen der Räume aus.
Er selbst hatte sich gleich links gehalten, wo früher einmal ein Café gewesen war. Leere Patronenhülsen lagen zwischen umgestoßenen Tischen und Stühlen.
»Sergeant Van Zandt, Sergeant Van Zandt!«, rieft Smitty aus einem weiter innen gelegenen Zimmer.
Gordon hörte die Marines laut durcheinanderreden, während irgendjemand auf Arabisch stotterte. Beim Betreten des Raums traf er auf Smitty, einen seiner Kameraden sowie zwei irakische Rebellen. Der eine trug einen weißen, allerdings über und über blutbefleckten Thawb, der andere lag reglos am Boden. Kugeln und Granatsplitter hatten die Wände durchlöchert, Trümmer und Unrat lagen verstreut herum. An einer Mauer standen drei AK47-Maschinengewehre. Smitty und der andere Marine schnauzten den verwundeten Einheimischen an, er solle die Hände hochheben und den Mund halten.
Der Aufrührer schrillte indes in seiner Muttersprache zurück. Richtig sattelfest war Gordon zwar nicht darin, doch nachdem er schon einmal im Ausland gedient und ein paar Brocken Arabisch aufgeschnappt hatte, meinte er, der Mann flehe: »Nicht schießen!«
Das Wortgemenge wirkte auf Dauer ablenkend, also musste Gordon die Kontrolle übernehmen und ihren Gefangenen so schnell wie möglich abfertigen.
»Klappe halten, und zwar alle! Smitty, durchsuche den Kerl und sieh zu, ob er uns irgendwelche Informationen geben kann. Wir anderen werden nach oben gehen.« Der Iraker schnatterte weiter, weshalb Gordon herumfuhr und brüllte: »Fresse jetzt, das reicht! Niemand wird dich erschießen!«
Da schwieg der Mann, als hätte er die Worte des Sergeant genau verstanden. Während er seinen Oberkörper wiegte und vor Angst zitterte, schluchzte er in sich hinein.
Nachdem Gordon das Zimmer verlassen hatte, schickte er sich an, die Treppe nach oben zu nehmen, wurde aber von Smittys aufgeregter Stimme unterbrochen. »Der andere Mistkerl …«
Eine laute Explosion erschütterte den Raum.
Gordon machte umgehend kehrt. Im Erdgeschoss war die Situation aus den Fugen geraten. Nun schrien die beiden Marines, die ihm nach oben folgen sollten, bloß verstand er ihre Worte nicht.
Als der Sergeant zurück nach unten kam, war von dem Zimmer nicht mehr viel übrig und der verletzte Iraker in Stücke gerissen. Auch einen der Soldaten hatte die Explosion zerfetzt, doch er erkannte nicht, um welchen es sich handelte.
Da rief jemand vom Flur aus: »Sergeant!«
Er drehte sich um und sah Smitty daliegen – im Blut von vier Menschen, einschließlich seinem eigenen.
»Was ist passiert?«, fragte Gordon und kniete neben ihm nieder.
»Der Mistkerl am Boden war gar nicht tot. Ist zur Seite gerollt und hatte auf einmal 'ne Handgranate. Grebbs hat's erwischt.«
»Dreckschweine!«, schimpfte der Sergeant.
In diesem Moment trat ein weiterer Trupp Marines ins Gebäude, gefolgt von einem zivilen Kriegsberichterstatter und seinen Kameraleuten.
Hinter ihnen kam ein Sanitäter herein, der sich umgehend um Smitty kümmerte.
»Ein Selbstmörder hat einen Soldaten in diesem Zimmer mit sich gerissen«, informierte Gordon die Eingetroffenen, indem er auf die Tür zeigte. »Oben konnten wir noch nicht nachsehen; holen wir das nach.«
Er nahm die Neuankömmlinge mit hinauf und sicherte das Obergeschoss. Vom Dach aus sah man die Moschee. Dort rührte sich noch immer nichts.
»Wir werden sie besetzen«, ließ Gordon die Marines wissen. Sie kehrten zügig nach unten zurück und verließen das Haus, wobei ihnen das Filmteam dicht auf den Fersen blieb.
Aus mehreren Fenstern an der Südfassade der Moschee rauchte es. Diese, sowie die Ostseite, zeichneten unzählige Einschusslöcher. Gordon und die Truppe pirschten sich nahe an den Eingang, ehe sie sich entlang der östlichen Mauer aufstellten. Der Sergeant bemühte wieder seinen Fuß, doch diese Tür gab nicht nach. Zwei weitere Male versuchte er es, aber vergebens.
»Sergeant, ich habe eine Flinte«, warf einer der Männer ein.
»In Ordnung, komm her.«
Der Soldat feuerte zweimal mit 12er-Schrotmunition auf den Türgriff und zog sich zurück. Dann ging Gordon einen Schritt nach hinten, trat abermals zu, und die Tür flog auf. Sofort warf er eine Sprenggranate hindurch und brachte sich in Sicherheit, indem er sich an eine Wand lehnte. Die Granate rollte durch den engen Vorraum in den breiten und hohen Saal der Moschee. Als sie explodierte, bebte die Erde. Dass die Marines den Bau nach der Detonation betraten, entsprach der üblichen Vorgehensweise im Feld, und der Reporter schloss sich mit seinem Team gleich hinter dem letzten Mann an.
Im ersten Raum rechts befanden sich eine Menge Munition und kleinkalibrige Waffen, jener auf der linken Seite war bis auf ein paar schmutzige Matratzen leer. Die Männer gingen weiter bis in den großen Saal, in dem ein paar Iraker an einer Mauer standen. Man riet ihnen lautstark dazu, sich nicht zu bewegen. Alle waren verwundet, aber anscheinend nicht lebensgefährlich.
»Keinen Mucks, und rührt euch verflucht noch mal nicht vom Fleck!«, drohte Gordon ihnen. Er verschaffte sich rasch einen Überblick der Lage vor Ort.
Im Hintergrund hörte er den Journalisten vor laufender Kamera sprechen: »Ich befinde mich hier gemeinsam mit den Marines in einer Moschee in Falludscha. Es war ein verbissener Kampf und die Iraker haben vehement Widerstand geleistet. Letztendlich können sie jedoch nichts gegen die überlegene Feuerkraft der US Army ausrichten. Diese Einheimischen hier schafften es, den Angriff schwer verletzt zu überleben, und bitten um Hilfe …«
»Bitten um Hilfe? Die haben nicht ein Wort von sich gegeben!«, blaffte ein Soldat den Reporter an.
Gordon hielt die etwas mehr als eine Handvoll Iraker mit seinem Gewehr in Schach, das er fest gegen seine Schulter stemmte. Am Rande seines Gesichtskreises nahm er wahr, wie sich derjenige am Ende der Reihe nach etwas am Boden ausstreckte.
Ohne Zögern drehte sich Gordon zur Seite und gab einen einzigen Schuss ab, der den Iraker in den Kopf traf. Der Knall schallte laut durch den großen Saal.
»Hast du das im Kasten … hast du das im Kasten?!«, stotterte der Sprecher vor seinem Kameramann.
»Ja, hab ich«, versicherte dieser und richtete sein Gerät auf den Sergeant.
»Dieser Marinesoldat hat soeben einen unbewaffneten, verletzten Einheimischen erschossen«, schilderte der Reporter mit Blick ins Objektiv, indem er mit einem Finger auf Gordon zeigte.
17. März 2014
Andere Dinge mögen uns verändern, doch aller Anfang und Ende ist die Familie. – Anthony Brandt
San Diego, Kalifornien
»Rosa oder Rot?«, fragte Gordons fünfjährige Tochter, wobei sie ihm zwei unterschiedliche Fläschchen Nagellack vorhielt.
»Ich mag Rot, aber Rosa ist mir lieber«, antwortete er und sah Haley dabei zu, wie sie die Behälter schüttelte.
»Krieg ich etwas zum Naschen, wenn wir fertig sind, Daddy?«, bohrte die Kleine weiter, während sie Gordon sorgfältig die Fingernägel lackierte.
»Ja, sicher. Was schwebt dir vor?«, entgegnete er mit sanfter Stimme.
»Was Süßes. Ich möchte Fruchtgummi und dann Octanauten schauen!«, quietschte Haley und blickte zu ihm auf. Sie strahlte ihn an und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht.
»Also gut, du bekommst einen Streifen Fruchtgummi«, sagte er und erwiderte ihr Lächeln.
Das Kind war klein für sein Alter und sah aus, wie man sich ein Mädchen vorstellte: lange blonde Locken und äußerst zarte Gesichtszüge. Haley benahm sich auch dementsprechend und liebte alles, was mit Prinzessinnen zu tun hatte.
Gordon ließ nichts über seine Familie kommen und hielt seine beiden Kinder für einen Segen. Hunter, sein siebenjähriger Sohn, und Haley waren sein ganzer Stolz und Sonnenschein. Sein Leben drehte sich gänzlich um sie und seine Ehefrau Samantha.
Die beiden hatten einander ungefähr ein Jahr, nachdem er die Marines unehrenhaft verlassen musste, kennengelernt. Ein weiteres Jahr später heirateten sie, und im darauffolgenden kam Hunter zur Welt.
Er schätzte sich glücklich und sicher, lebte jeden Tag im Hier und Jetzt. An seine Zeit im Korps dachte er nicht allzu oft zurück, und falls doch, so kam es ihm vor, als gehöre sie nicht zu seiner Vita, sondern der eines anderen.
Obwohl sein Kriegsdienst meistens außen vor blieb, schlugen sich seine beiden Stationierungen im Osten im Alltag nieder. Die Erfahrung verschob seine Prioritäten und änderte seine Sichtweise. Er hörte auf, ein Idealist zu sein, der davon überzeugt war, jedermann helfen zu müssen, und handelte eher pragmatisch, wobei er vor allem für seine Familie sorgen wollte. Die Zeit der Aufopferung für jene, die er nun als Ahnungslose bezeichnete, war vorbei.
»Kommst du nach deinem Termin im Schönheitssalon raus zu mir?«, bat Samantha ihren Mann im Vorbeigehen an der Tür auf ihrem Weg in die Küche.
Gordon blickte ihr über seine Schulter nach. »Okay, aber bist du sicher, dass du nicht auch ein bisschen Hand- und Fußpflege vertragen kannst?«
Samantha antwortete bereits aus der Küche: »Später vielleicht. Haley braucht ein wenig Ruhe, und uns beiden steht etwas Erwachsenenzeit zu.«
»Erwachsenenzeit?«, rief Gordon zurück. »Meinst du das so, wie ich es auffasse, oder im Sinn von Zeit, um etwas zu diskutieren, was meine volle Aufmerksamkeit erfordert?« Dabei beobachtete er, wie Haley die letzten Pinselstriche seiner Maniküre machte.
»Das erfährst du dann«, kam die Antwort aus der Küche.
»Du hast es wirklich faustdick hinter den Ohren«, gab er zurück.
»Was bedeutet das, faustdick hinter den Ohren?«, fragte Haley.
»Also Mäuschen, das ist, wenn …«
»Haley, das bedeutet, dass jemand ganz toll Witze machen kann«, unterbrach Samantha, die auf einmal im Türrahmen des Kinderzimmers stand.
Gordon verrenkte sich den Hals. »Meine Güte, du schleichst aber herum …« Er zwinkerte ihr zu, wobei er ihren leicht gereizten Blick zur Kenntnis nahm.
Samantha stand da und betrachtete ihren Mann. Sie liebte ihn über alle Maßen. Er war ein guter Vater für ihre beiden Kinder. Viele Kerle, die es über sich ergehen ließen, dass man ihre Fingernägel rosa lackierte, fielen ihr nicht ein. Sie war stolz auf sein Interesse an seinen Kindern und sah mit Freude, wie wichtig sie für ihn waren.
Ihre Bewunderung für Gordon war übergroß. Er entsprach ihrem Idealbild von einem Mann: groß und in seiner rauen Art attraktiv, nicht zuletzt wegen des kantigen Kinns, seiner hellen Augen und breiten Schultern. Neben ihm wirkte Haley so klein, so winzig im Vergleich zu seiner kräftigen, muskulösen Statur. Sie hatte sofort bei ihrer ersten Begegnung gewusst, dass er sie stets behüten würde. Bei ihm fühlte sie sich sicher.
»Fertig, Daddy! Kriege ich jetzt meine Belohnung?«, flötete Haley, als sie den Nagellack zuschraubte.
»Natürlich«, bestätigte er, bevor er sich anschickte, seine Finger trocken zu pusten. Als er jedoch bemerkte, dass Samantha ihn immer noch anstarrte, hielt er inne. Er schaute zu ihr auf und fragte scherzhaft: »Betont das Rosa meine blauen Augen?«
Haley sprang auf und lief aus dem Zimmer über den Flur zur Küche. Gordon schlenderte hinterher, jedoch achtsam aufgrund des feuchten Lacks auf seinen Nägeln.
»Sag schon, was ist los?«, drängte er seine Frau, bevor er sich nach vorne beugte, um ihr einen Kuss auf den Mund zu geben.
»Lass mich Haley für ihr Schläfchen fertig machen, dann treffen wir uns auf der Terrasse – sagen wir, in fünf Minuten?« Damit erwiderte sie seinen Kuss.
Gordon hatte sich auf der Terrasse niedergelassen und wartete auf Samantha. Er lehnte sich zurück, legte die Füße auf den Gartenkaffeetisch und ließ sich das Gesicht von der nachmittäglichen Sonne wärmen. Wenngleich seine Beziehung zu Südkalifornien generell von einer Art Hassliebe geprägt war, hielt er doch große Stücke aufs Wetter. Er bevorzugte Kleinstädte, und als solche konnte man San Diego wahrlich nicht bezeichnen. Alles in allem aber ging es ihnen gut. Er genoss einigen Komfort, wusste einen stattlichen Freundeskreis und eine tolle Familie um sich. Der einzige Verwandte, den er gerne häufiger gesehen hätte, war sein kleiner Bruder Sebastian, der vier Jahre, nachdem Gordon die Armee verlassen hatte, von den Marines rekrutiert worden war. Ursprünglich trat er dabei in die Fußstapfen des Älteren und wurde Panzerabwehrschütze, doch dies fand er zuletzt ein wenig öde. Als abenteuerlustiger Typ begann er gerade eine Laufbahn als Kundschafter-Scharfschütze.
Gordon döste in der Sonne, bis er durch Samanthas Kommen geweckt wurde. Als er die Augen öffnete, blickte sie von oben auf ihn herab.
»Dir geht es gut, was?«, fragte sie mit verschränkten Armen.
»Aber sicher doch, danke fürs Nachhaken«, erwiderte er grinsend.
»Wann wolltest du dich dazu herablassen, mir zu erzählen, dass uns dein Bruder heute zum Abendessen besucht?«, sagte sie, während sie sich ihm gegenüber setzte. »Du weißt, dass ich so etwas gerne vorab wüsste, damit ich das Haus auf Vordermann bringen kann.«
»Ich dachte, ich hätte es erwähnt, tut mir leid«, entschuldigte er sich und richtete sich etwas auf. »Das ist doch kein Problem, nicht wahr? Wir haben doch sonst nichts vor, oder?«
Nun war er es, der sie betrachtete, wie sie so vor ihm saß. Er war ihr sofort verfallen, als sie sich kennengelernt hatten. Alles an ihr liebte er, angefangen bei ihrer zierlichen Figur und dem langen blonden Haar, das leicht gewellt war, über die hellgrünen Augen bis zu ihren vollen Lippen. Sie gab für ihn das Bild der perfekten Frau ab.
»Nein, geht schon klar, aber beim nächsten Mal möchte ich eingeweiht werden. Hätte ich nicht die Sprachbox abgehört, wär's mir entgangen, also versprich einfach, dass du mir Bescheid gibst, wenn wieder so etwas ansteht.«
Gordon erhob sich und ging zu ihr hinüber. »Versprochen, ehrlich«, versicherte er im sanften Tonfall. Dann beugte er sich nach vorne, um sie fest in den Arm zu nehmen. Er küsste sie und flüsterte in ihr Ohr: »Sollen wir nach oben gehen, damit ich mich richtig entschuldigen kann?«
Samantha entzog sich ein wenig trotzig und gab ihm zu verstehen: »Du weißt doch, dass ich noch einige Dinge zu tun habe.«
»Dinge, die nicht weglaufen«, hielt Gordon dagegen, diesmal mit besonders samtiger Stimme, da er seine Frau nur zu gut kannte. Mit einem Vorschlag verlieh er der Bitte Nachdruck: »Ich helfe dir später bei deinen Dingen, wenn du mir jetzt etwas Gutes tust – was meinst du?«
Samantha zog die Augenbrauen hoch und lächelte diebisch. »Abgemacht.«
Dann nahm sie seine Hand und ging mit ihm nach oben.
»Da ist jemand an der Haustür!«, rief Hunter aufgeregt.
»Mach ruhig auf, das dürfte dein Onkel Sebastian sein«, erwiderte Samantha von der Küche aus. Sie richtete gerade Salat an und konnte nicht öffnen.
»Gordon, ich glaube, dein Bruder ist da«, ließ sie ihren Mann wissen, der in seinem Büro arbeitete. Sie mochte Sebastian sehr gerne, aber seine Besuche waren ihr nicht immer recht. Das lag nicht an ihm, allein seine Anwesenheit führte dazu, dass sich Gordon in den darauffolgenden Tagen anders verhielt. Nach Sebastians Abreise wirkte er für gewöhnlich sehr distanziert.
»Onkel Seb!«, jubelte Hunter, als er die Tür aufzog. Haley und er freuten sich jedes Mal, wenn Sebastian sie besuchte, und amüsierten sich während seines Aufenthalts köstlich.
»Onkel Sebastian, Onkel Sebastian!«, schrillte nun auch Haley, während sie die Treppe herunterhüpfte.
Ihr Gast trat ein und hob den Jungen hoch. Kaum dass das Mädchen unten angelangt war, klammerte es sich an sein Bein.
»Na, ihr zwei? Wie geht es meinem Lieblingsneffen und der besten Nichte, die ich habe?«, fragte Sebastian. Um Haley in den anderen Arm zu nehmen, ging er in die Hocke. Er nahm die zwei mit in die Küche, wo Samantha immer noch emsig das Dinner vorbereitete.
Sebastian war ebenfalls groß, rank und schlank, wie man beim Korps sagte. Gordon und er sahen sich sehr ähnlich; dass sie Brüder waren, daran bestand kein Zweifel. Gegensätze ergaben sich hauptsächlich aus ihrem Altersunterschied von sieben Jahren. Gordon ergraute an den Schläfen und bekam allmählich Geheimratsecken, während Sebastian noch dichtes braunes Haar ohne Silbersträhnen hatte. Er war zwar ein Kriegspferd, aber weder für einen Bürstenschnitt noch für kurze Stoppeln zu haben; vielmehr mochte er sein Haar und achtete darauf, dass es gerade so lang wie erlaubt war oder länger, so er damit durchkam. Sebastian blieb nie um ein Lächeln verlegen und nahm das Leben leichter als sein Bruder, der einen ernsteren, eher stoischen Charakter hatte.
Auch der Jüngere wollte eines Tages Kinder haben, genoss aber bis auf Weiteres das Single-Leben als Marine. Zum Draufgängertum neigte er nach wie vor, und da der Wehrdienst bereits ohne Familie anstrengend genug war, hielt er es für verantwortungslos, eine zu gründen. Vorerst also erfüllte sich Sebastian den Wunsch nach einem gesetzten Lebenswandel so gut es ging in der Familie seines Bruders.
»Hi Samantha!«
»Hallo Sebastian, wie geht es dir?«, grüßte Samantha, die ein wenig aufgelöst wirkte, weil sie fertig werden wollte. Sie war Perfektionistin, weshalb für die Gäste alles makellos aussehen sollte. Zumindest gönnte sie sich ein paar Sekunden, um Sebastian rasch zu herzen und ihm in die Wange zu zwicken. »Gordon ist in seinem Büro und führt ein Projekt zu Ende. Geh nur durch … am Ende des Flurs.«
»Das werde ich wohl.« Er warf einen Blick auf die Kids vor seiner Brust und zog die Augenbrauen hoch. »Zuerst aber wollen die zwei Äffchen in meinen Armen wissen, was ihr Onkel für sie mitgebracht hat.«
Die Kinder quiekten vergnügt: »Geschenke!«
Er ließ sie hinunter und kauerte nieder, um mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. »Geht raus zum Tisch, darauf liegen zwei Tüten, die grüne ist für Hunter, die pinkfarbene für …«
»Mich!«, würgte Haley ihn ab, als sie schon auf dem Weg zur Haustür war. Auch Hunter ließ sich nicht lange bitten und rannte los.
Sebastian stand wieder auf und trat zur Kücheninsel. »Wow, wie das duftet! Bin ich hungrig.«
»Das will ich schwer hoffen, denn wir haben tonnenweise zu essen, und Gordon ist gerade eben noch losgezogen, um dein Lieblingsfleisch zu besorgen.«
»Ihr zwei seid großartig, danke sehr«, sagte Sebastian und sah Samantha an. Er freute sich darüber, dass sein Bruder eine so tolle Frau gefunden hatte und musste lächeln, als er daran dachte, wie sehr Gordon dieses Leben verdiente, besonders nach allem, was er durchgemacht hatte.
Der Fernseher lief für gewöhnlich, wenn Samantha kochte; diese Zeit war wirklich die Einzige, in der sie dazu kam, die Nachrichten zu verfolgen. Die beiden Kinder waren ein Vollzeitjob, der einen Großteil ihres Tages in Anspruch nahm.
Gerade interviewte Bill O'Reilly Brad Conner, den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses der Republikaner, und die Stellvertreterin der Demokratischen Partei Kaliforniens, Shelly Gomez.
»Dem Präsidenten gelingt es eindeutig nicht, für die Sicherheit in unserem Land zu garantieren. Dem Iran die Herstellung von Kernbrennstoffen zu gestatten und der Regierung dort die Hände zu schütteln, wird uns nicht schützen. Das iranische Regime ist nicht vertrauenswürdig. Wir brauchen …«
»… wir brauchen was, Mr. Conner? Einen weiteren Krieg?«, konterte Gomez.
»Das alles darf nicht vom Tisch kommen. Wir müssen Stärke zeigen, statt an die große Glocke zu hängen, dass wir von Gewaltanwendung absehen.«
»Mr. Conner, Sie sind Befürworter von Erstschlägen. Ziehen Sie in Erwägung, iranische Atomanlagen anzugreifen, falls wir stichhaltige Beweise dafür hätten, dass das Land Kernwaffen baut oder waffenfähigen Brennstoff an Terroristen verkauft?«, fragte O'Reilly.
»Bill, der Iran ist ein Schurkenstaat. Um Ihre Frage also rundheraus zu beantworten: Ja, dazu wäre ich bereit.«
»Ms. Gomez, was sagen Sie dazu?«, fuhr der Moderator rasch fort.
»Mr. O'Reilly, wir dürfen keine Option außer Acht lassen, genauso wenig aber diplomatische Bestrebungen, jedenfalls nicht eher, bis wir sicher sind, alles versucht zu haben, um eine friedliche Lösung zu finden.«
»Also würden auch Sie einen Militärschlag gutheißen?«, fragte O'Reilly plump.
»Ich will damit nur sagen, dass wir uns nicht auf einen einzigen Weg festlegen lassen sollten.«
»Meine Frage verlangt nach einer schlichten Antwort, Ms. Gomez: Ja oder nein?«, stichelte der Mann.
»Mr. O'Reilly, Diplomatie ist zu sehr ein Kräftespiel, als dass ihr ein schnödes Ja oder Nein gerecht würde«, betonte die Sprecherin, die sichtlich wütend war.
»Das verstehe ich, Ms. Gomez, also lassen Sie mich die Frage umformulieren: Wenn Sie alle diplomatischen Mittel ausgeschöpft haben und über Indizien dafür verfügen, dass der Iran entweder eine Waffe entwickelt, drauf und dran ist, einer einschlägig bekannten Terrorzelle waffenfähigen Brennstoff zum Bau einer schmutzigen Bombe zu verkaufen oder noch schlimmer: einen richtigen Atomsprengkopf – geben Sie dann grünes Licht für eine Militäraktion?«
»Ich finde, Sie sollten genau definieren, was Sie mit dem Ausschöpfen aller diplomatischen Mittel meinen«, wich Gomez aus.
»Wirklich? Im vollen Ernst, Ms. Gomez: Sie können diese Frage nicht beantworten?«, provozierte O'Reilly weiter, wozu er einen leicht pikierten Gesichtsausdruck aufsetzte.
Vorsitzender Conner meldete sich wieder zu Wort: »Ich kann Ihnen eine Antwort geben, Bill. Jawohl, ich würde den Iran angreifen, und zwar mit allen Mitteln. Ms. Gomez weiß um die Bedrohungen, die tatsächliche Gefahr für unser Land. Sie nimmt an den Debatten teil, ist also im Bilde, doch was tun sie und ihre Kollegen? Jedes Mal verwenden sie ihre Stimme dazu, unsere Verteidigungskräfte zu schwächen beziehungsweise legen ihr Veto zur Subventionierung von Projekten ein, die unsere Abwehr stärken könnten.«
»Mr. Conner, nennen Sie uns doch beispielhaft eine der Bedrohungen für unser Land, derer sich die meisten Amerikaner nicht bewusst sind«, verlangte O'Reilly, um endlich auf den Punkt zu kommen.
»Zu meinen schlimmsten Befürchtungen zählt ein Angriff vonseiten eines Schurkenstaates oder einer terroristischen Vereinigung mit Mikrowellen- oder Elektroimpulswaffen. Dagegen sind wir nicht gerüstet; unser gesamtes Stromnetz würde zusammenbrechen. Der Iran hat seinerseits durchblicken lassen, diese Schwäche zu kennen, und möchte sie ausnutzen.«
»Nur zu, Mr. Conner, spielen Sie weiter mit den Ängsten der Menschen«, schalt ihn Gomez verächtlich.
»Ängste? Ms. Gomez, Sie haben die Berichte zu dieser spezifischen Gefahr gesehen. Sogar Mitglieder Ihrer eigenen Partei begreifen die Bedrohung und reichten mutig Gesetzesvorschläge ein, die den Ausschuss jedoch nie verlassen haben. Gegenwärtig dränge ich den Abgeordneten Markey dazu, erneut den gleichen Entwurf vorzulegen. Ich bin gewillt, hart auf eine entscheidende Abstimmung darüber hinzuarbeiten, die er auch verdient hat«, spie Conner mit unverhohlenem Zorn zurück.
»Ms. Gomez, das letzte Wort gebührt Ihnen, bitte gehen Sie auf die Ausführungen des Vorsitzenden ein.«
»Mr. O'Reilly, diese Regierung leistet Unglaubliches, um unser Land zu schützen. Nach nahezu zehn Jahren im Krieg ist es an der Zeit, sich der Innenpolitik zuzuwenden und nationale Probleme anzupacken. Wir haben alles unter Kontrolle, was unsere Wehrhaftigkeit betrifft; jetzt gilt es, Bildungs- und Gesundheitspolitik zum Thema zu machen.«
»Also gut, hier muss ich nun einen Schlusspunkt setzen, Ms. Gomez, Mr. Conner, vielen Dank für Ihre Zeit. Unser nächster Gast wird General McCasey sein, der uns über die jüngsten Terroranschläge in Paris und London aufklärt.«
Samantha griff zur Fernbedienung und schaltete ab. »Tut mir leid, ich habe sonst keine Gelegenheit, mir die Nachrichten anzusehen. Was momentan in der Welt abläuft, ist unheimlich, all diese Angriffe im Ausland … ich habe wirklich das Gefühl, es sei nur eine Frage der Zeit, bis es uns hier trifft.«
»Ja, das könnte passieren, aber ich würde mich deshalb nicht verrückt machen. Wir sind immer noch ziemlich sicher hier, finde ich, und was die Schwätzer in der Glotze angeht: höre ich einfach nicht hin. Für mich klingt das nach ganz viel heißer Luft«, meinte Sebastian.
»Darf ich dir ein Bier anbieten?«
»Ich bediene mich selbst. Weiß ja, wo sie stehen; trinkst du eins mit?«, fragte er beim Öffnen des Kühlschranks.
»Gerne, danke.«
»Hol mir auch eins raus!« Das war die Stimme seines Bruders, der über beide Ohren grinste, als er die Küche betrat. Er geriet immer ganz aus dem Häuschen, wenn der Jüngere zu Besuch kam.
»Gordo!«, rief Sebastian und stellte die Biere auf die Arbeitsfläche, um seinem Bruder entgegenzugehen und ihn kraftvoll zu umarmen. »Schön, dich zu sehen, danke für die Einladung.«
»Versteht sich von selbst, junger Mann. Ginge es nach uns, würdest du häufiger hier sein.«
Gordon drehte sich zu Samantha um und fragte: »Wo sind die Kinder?«
»Draußen. Sebastian hat ihnen Spielzeug mitgebracht.«
»Sag bloß … was gibt’s neues bei dir?«, drängte er nach einem Schluck Bier.
»Schätze, das sollte ich dich fragen«, entgegnete Sebastian, indem er auf Gordons Finger zeigte. »Falls du den Dienst wegen der Sittengesetze in der Armee quittiert hast, darfst du jetzt wohl mit offenen Karten spielen.«
»Was?« Gordon wusste zuerst nichts mit der Andeutung anzufangen, doch dann fiel ihm ein, dass seine Fingernägel immer noch rosa lackiert waren.
»War die Kleine«, erklärte er mit einem Achselzucken.
Dann ging er zum Kühlschrank und nahm das Grillfleisch heraus. »Hör mal, Mr. Klugscheißer: Was dagegen, mit etwas von dem hier abzunehmen?«
»Roger.«
»Das war erste Sahne. Ich bin pappsatt«, sagte Sebastian, als er sich im Gartensessel zurücklehnte.
»Schön, dass es dir geschmeckt hat. Ich würde sagen, ich räume auf, während ihr Männer ein Bier zischt und etwas plaudert«, schlug Samantha vor, als sie die Teller stapelte.
»Wenn dir das nichts ausmacht«, erwiderte Gordon und sah zu ihr auf. Er zollte Samantha Respekt und erachtete Beziehungspflege wie Elternaufgaben als wirkliche Partnerarbeit. Niemals hätte er seine Frau für selbstverständlich gehalten.
»Nein, macht es nicht. Macht einfach, was große Jungs so tun: Trinkt Bier, schwingt Reden und löst globale Probleme. Ich kann die Kinder auch mit nach oben nehmen und einen Film anschauen.« Sie drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Hab dich lieb, Großer.«
»Ich dich auch, Schatz.«
Sebastian lächelte über ihren Umgang miteinander. Sobald er die Zeit für reif hielt, sich häuslich niederzulassen, wollte er exakt das Gleiche wie sein Bruder. Natürlich würde dieser Moment noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, da seine Verpflichtung noch ein weiteres Jahr andauerte und das Lotterleben einfach zu viel Spaß machte.
Samantha trug das restliche Geschirr zusammen und kehrte in die Küche zurück. Die Brüder hörten, wie sie mit den Kids sprach. Nach einer Minute Kreischen und Johlen der Kleinen wurde es still im Haus.
»Komm, wir nehmen die übrigen Biere und ziehen auf die Terrasse hinterm Haus um.« Gordon stand auf und Sebastian folgte ihm zum Kühlschrank, ehe sie in den Garten gingen.
»Hier.« Gordon reichte seinem Bruder eine kalte Flasche und ließ sich nieder.
»Danke. Jetzt kannst du erzählen, was du in letzter Zeit so getrieben hast?«
»Ach, das Übliche – und seit Kurzem gehe ich häufiger zum Schießstand.«
»Gut, hast du dir was Neues zugelegt?«
»Ja, auf einer Waffenmesse in Idaho fand ich eine M4 und eine zweite Sig.«
»Du warst schon immer eher ein Sammler als ich. In der Hinsicht siehst du Dad ähnlich«, bemerkte Sebastian und nippte an seinem Bier.
»Jetzt erzähl du mir was über die Kundschafter-Scharfschützen«, bat Gordon, als er die Füße hochlegte.
»Ich will wirklich dort unterkommen. In ein paar Wochen werde ich es versuchen. Habe dafür trainiert, also mal sehen.«
»Solange du weißt, was du tust«, sagte Gordon und senkte den Blick auf die Flasche in seiner Hand.
»Was soll das heißen?«, hakte sein Bruder mit hochgezogener Augenbraue nach.
»Nichts weiter.«
»Hör zu, lass deinen Groll gegen das Korps nicht an mir aus«, stellte Sebastian leicht pikiert klar.
»Ich hege keinen Groll, sondern möchte mich nur vergewissern, dass du die richtige Entscheidung triffst. Davon konnte meiner Meinung nach nämlich keine Rede sein, als du dich gleich für sechs Jahre verpflichtet hast«, erwiderte Gordon. »Vier hätten auch genügt, um dann zu verlängern, falls es nach deinem Geschmack gewesen wäre.«
Sebastian starrte den Bruder ungehalten und enttäuscht an. So sehr er ihn wertschätzte, war ihm aufs Äußerste zuwider, wenn sich Gordon wie sein Erziehungsberechtigter aufführte. Er hatte eigentlich geglaubt, sein Bruder werde ihm vor dem Hintergrund zweier Auslandsaufenthalte – einmal im Irak und später in Afghanistan – endlich Hochachtung entgegenbringen. Dass dem nicht so war, lag an zwei Faktoren, wie er wusste: Erstens waren die Eltern der beiden vor wenigen Jahren gestorben, weshalb es sich Gordon zur Aufgabe gemacht hatte, den Vater für den Jüngeren zu spielen. Das andere Problem bestand in Gordons Wut auf das Marinekorps. Er fühlte sich nach jenem Vorfall in Falludscha vor zehn Jahren verraten.
»Gordo, ich weiß, was ich tue. Die Kundschafter-Scharfschützen sind eine straff organisierte Einheit, professionell und motiviert. Ich wünschte, du würdest aufhören, mein Tun in Zweifel zu ziehen. Sicher, du hast mich gebeten, nicht zur Marine zu gehen, doch ich ließ mich trotzdem rekrutieren, und dann warst du dagegen, dass ich sechs Jahre lang diene, aber auch das war mir egal. Ich musste mir Klarheit darüber verschaffen, welchen Job ich wollte. Erst hast du dich dagegen gesträubt, dass ich Panzerabwehrschütze wurde, und jetzt hinterfragst du diese Stellung. Ich bin erwachsen und kann selbst entscheiden.« Sebastian richtete sich auf und suchte den Blick seines Bruders.
»Ist ja schon gut«, beschwichtigte Gordon, fuchtelte mit dem linken Arm und verdrehte die Augen.
»Ich muss mal für kleine Rekruten.« Sebastian stellte seine Flasche ab und ging ins Haus.
Gordon legte seinen Kopf gegen die Nackenstütze des Sessels und sah hinauf zu den Sternen. Seine Gedanken schweiften zurück zu jenem Tag in der Moschee in Falludscha. In den Jahren darauf war ihm der Vorfall immer wieder durch den Kopf gegangen, doch jedes Mal kam er zu dem Schluss, er würde es genau so wieder tun. Die Häme und der Hass, welchen man ihm entgegenbrachte, frustrierten ihn zutiefst.
Die Untersuchungen der Militärstrafverfolgungsbehörde der Marine zeigten, dass er die korrekte Entscheidung getroffen hatte, doch solche Wendungen waren nicht interessant und landeten stets auf den hinteren Seiten der Zeitungen. Eine Story über Marines hingegen, die unbewaffnete und verwundete Gefangene erschießen, sorgte für Schlagzeilen und politischen Zündstoff. Politik verachtete er am meisten. In ihrer Gesamtheit veränderte die Situation seine Ansichten zu Volk und Vaterland. Als er die Option erhielt, seinen Dienst zu verlängern, nahm er sie nicht wahr. Er konnte sein Leben nicht mehr zur Verteidigung eines Landes aufs Spiel setzen, dessen halbe Bevölkerung ihn entweder hasste oder sich – was nur geringfügig besser war – überhaupt keine Meinung zu ihm bildete.
Gordon hatte sich der Marine gleich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 angeschlossen. Dazu brach er sein Studium an der Universität George Mason im dritten Jahr ab und schlug somit ein Vollstipendium aus, weil er glaubte, es obliege seiner Generation, ihrem Land an erster Front zu dienen. Damals erschien es ihm richtig, doch mittlerweile war die Lage eine andere.
Oft fragte er sich, warum er so viele Opfer gebracht hatte. Warum? Damit die Leute einen Grund dafür fanden, ihn zu hassen? Ihre Freiheit für selbstverständlich halten konnten? Um all den faulen Ärschen und Nichtsnutzen zu ermöglichen, dazusitzen und die Hände in den Schoß zu legen? Scheiß auf sie, dachte er. Nie wieder würde er den Kopf für jemand anderen außer seinen Verwandten und Freunden hinhalten. Jetzt begab sich indes sein Bruder in die Schusslinie, auf dass die gleichen wertlosen Menschen Federn in die Luft blasen durften, ihre Freiheit auskosteten und ihre Rechte missbrauchten.
Sebastian konnte Gordons Gefühle nachvollziehen, war aber im Gegensatz zu ihm kein sonderlicher Idealist. Sicher, er liebte sein Vaterland, doch dies vor allem wegen seiner Abenteuerlust: Ihm ging es um die Action. Sebastian war begeistert davon, dass er dafür bezahlt wurde, Dinge in die Luft zu sprengen. Über Politik machte er sich nicht viele Gedanken, weil er sie für Zeitverschwendung hielt. Gordon hätte gern die gleiche Haltung angenommen, aber wie sollte ein Land auf Dauer bestehen, wenn jeder nur sich selbst der Nächste war? Er steckte in einer ideologischen Zwickmühle, während er – was das praktische Handeln anbelangte – niemand anderen zwischen sich und seine Familie kommen ließ, solange sein Ärger nicht abgeklungen war.
Er wurde von seinem Gedankengang abgebracht, als Sebastian von der Toilette zurückkehrte.
»Hier, Bruderherz.« Sebastian drückte ihm ein neues Bier in die Hand.
Gordon richtete sich im Sessel auf und bedankte sich. »Hör mal, es tut mir leid, wenn es so wirkte, als würde ich dir nicht vertrauen. Ich halte sehr viel von dir und sehe in dir nichts weniger als einen erwachsenen Mann. Du weißt, was ich übers Korps und alles andere denke, was damit zusammenhängt. Ich will wirklich nicht wieder dort hineingezogen werden – und schon gar nicht, dass dir etwas zustößt.«
»Schon verstanden, aber sei dir gewiss: Ich befinde mich in guten Händen. Übrigens habe ich ganz vergessen, dir zu sagen, dass es einen neuen befehlshabenden Offizier gibt«, schob Sebastian mit einem Strahlen im Gesicht hinterher, nachdem er etwas Bier getrunken hatte.
Gordon wurde hellhörig. »Wer ist es?«
»Barone!«
»Major Barone?« Er machte große Augen.
»Ja, aber er ist mittlerweile Oberstleutnant.«
Wieder ließ sich Gordon zurück in die Vergangenheit kurz nach dem Einsatz in Falludscha reißen. Major Barone war einer seiner verbissensten Verteidiger gewesen. Er stand ihm bei, während alle anderen hochrangigen Militärs den Politikern und Medien gefällig sein wollten. Die Presse schlachtete die Story nach allen Regeln der Kunst aus und berichtete auf reißerische Art über den gefallenen Schuss. In der Öffentlichkeit galt er praktisch als verurteilt, noch ehe die Nachforschungen zu Ende gingen.
»Das sind tolle Neuigkeiten«, fand Gordon im Zuge dieser tröstlichen Erinnerung an einen treuen Freund. »Er ist ein großartiger Mann, und bei ihm befindest du dich definitiv in guten Händen.«
»Ich dachte mir schon, du würdest dich freuen, seinen Namen wieder zu hören. Bislang hatte ich noch keine Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen, aber es heißt, er habe eine besondere Vorliebe für Scharfschützen. Ich bin schon ganz aufgeregt; jetzt muss ich nur noch aufgenommen werden.«
»Ich bin ausgesprochen froh darüber, dass er jetzt das Kommando hat und euch Jungs für den nächsten Auslandseinsatz in Erwägung zieht.«
Gordon empfand Erleichterung darüber, dass sein Bruder in so vertrauenswürdige Gesellschaft geraten sollte. Dieses Wissen machte ihn glücklich. Sein Bruder mochte noch so viel Selbstbewusstsein hervorkehren: Gordon würde sich immerzu um ihn sorgen und ihn im Auge behalten.
Was ihm außerdem Kummer bereitete, waren die gehäuft auftretenden Übergriffe von Terroristen auf Militäreinrichtungen rund um den Globus. Ferner verzeichneten seit den vergangenen paar Monaten auch die Anschläge gegen zivile Ziele in Europa einen Aufwärtstrend. Er hatte sich schon oft mit Samantha darüber unterhalten, wie seltsam es war, dass diese Organisationen solche Angriffe bisher nie in den Vereinigten Staaten gewagt hatten. In Anbetracht der arg durchlässigen Südgrenze des Landes hielt er diesen Glücksfall jedoch für zeitlich begrenzt. Über kurz oder lang, das war ihm klar, würden die Terroristen erneut hier zuschlagen, und die nächste größere Aktion könnte so verheerend sein, dass sie die Nation in die Knie zwänge.
Gordon verdrängte das Bild der grausamen Weltbühne und widmete sich wieder seinem Vorsatz, eine angenehme Zeit mit seinem Bruder zu verbringen. Noch einige Biere mehr, etwas Gelächter und ein bisschen Schwelgen in Erinnerungen, dann verabschiedeten sich die beiden voneinander.
Nachdem er Sebastian bis zur Haustür begleitet hatte, drückte Gordon ihn an sich und sagte: »Falls du je irgendetwas brauchen solltest, zögere nicht, mich anzurufen. Wir sind immer für dich da.«
»Das werde ich, Gordo. Bist der Beste, mein Bruder.« Sebastian fühlte sich stets unwohl, wenn er aufbrechen musste. Er hasste dieses Lebewohl-Gehabe.
Als er schon über den Bürgersteig ging, rief Gordon hinterher: »Bleib auf Zack, Marine!«
4. Dezember 2014
Angst ist Schmerz aus der Erwartung des Bösen. – Aristoteles
San Diego, Kalifornien
»Wir unterbrechen das Programm für eine Sondersendung von CNN News. Mehrere Explosionen ereigneten sich im Century Link Field im Zentrum von Seattle, der Heimat des Footballteams Seahawks. Die Zahl der Verletzten bleibt bis auf Weiteres unbekannt. Wir schalten zu unserem Reporter vor Ort, der aus einem Helikopter über dem Stadion berichtet.«
»Oh mein Gott«, schnaufte Samantha und schlug sich entsetzt eine Hand vor den Mund.
»Mama, wo steckt Hunter?«, quengelte Haley.
»Er spielt oben in seinem Zimmer«, antwortete Samantha, ohne das Kind anzusehen. »Bist du mal kurz still, bitte?«
»Mama, Mama, ich will Saft«, bettelte Haley weiter, indem sie an der Hose ihrer Mutter zupfte.
»Sekunde, Kleines«, hielt Samantha sie hin.
Das Kind ging nicht auf die Beschwichtigung ein und gellte: »Mama!«
»Haley, bitte Liebes, nur ganz kurz!« Samantha wurde laut. »Mama schaut sich etwas ganz, ganz Wichtiges an.«
Sie konnte den Blick nicht von den Szenen losreißen, die über den Bildschirm flimmerten. Rauchsäulen schraubten sich über dem Stadion empor. Leider standen solche Bilder nunmehr an der Tagesordnung.
Seit dem 6. September kam es fortwährend an unterschiedlichen Orten im Land zu Anschlägen. Ob Autobomben, Selbstmordattentäter oder Amokschützen in Einkaufszentren – Gewalt war fast zur Normalität geworden. Von Miami ausgehend bis nun nach Seattle schien es in den USA keine sichere Gegend mehr zu geben. Der Präsident hatte noch am vorangegangenen Abend versucht, die Bürger in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehansprache zu beruhigen. Seinem Versprechen zufolge wurden alle verfügbaren Mittel angewandt, um jegliche weiteren Attacken zu vereiteln.
Unglücklicherweise jedoch erfolgten diese Attacken quer durchs Land in so unschöner Regelmäßigkeit, dass nicht wenige Mittel allmählich erschöpft waren. Die verschiedenen Geheimdienste hatten einige wenige Zellen aufhalten können, doch da diese nur sporadisch in Erscheinung traten, war es unmöglich, sie alle zu stoppen. Ganz Amerika war mit den Nerven am Ende. Viele Bürger frequentierten öffentliche Plätze mit möglichem hohen Personenaufkommen überhaupt nicht mehr. Samantha und Gordon zählten zu denjenigen, die das Ausgehen kategorisch mieden. Trauten sie sich dennoch vor die Tür, dann nur zur Beschaffung dessen, was man nicht online bestellen konnte, und niemals in Begleitung der Kinder. Die Lage war zu sehr angespannt, und die Wirtschaft litt unter den wiederholten Attentaten.
»Gordon!«, rief Samantha.
Eine Minute verging ohne Antwort. So erhob sie die Stimme noch lauter: »Gordon, komm her!«
»Was ist los?«, raunte er aus seinem Büro auf der anderen Seite des Hauses. Gordon besaß das Glück, als Webdesigner von daheim aus arbeiten zu können.
Nach seinem Austritt beim Marinekorps hatte er nichts mit sich anzufangen gewusst; wieder die Schulbank zu drücken war ihm zuwider, doch irgendeinem Job musste er nachgehen. Bevor er sich bei der Armee eingeschrieben hatte, studierte er auf einen Abschluss in Informatik hin, weshalb er sich sehr gut mit Computern auskannte. Schon auf dem College entwarf er Internetseiten, um seine Rechnungen bezahlen zu können, also lag es nahe, sich in diese Richtung auszustrecken.