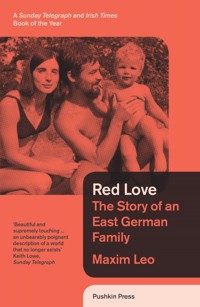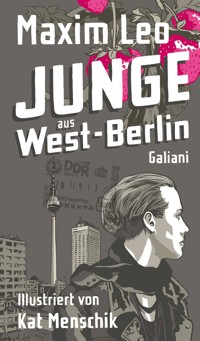14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Voss ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mörderische Mark Brandenburg – zwei Fälle für Kommissar Voss »Waidmannstod« Kommissar Voss ist gerade in sein Heimatdorf zurückgekehrt, als ein Toter im Wald entdeckt wird. Waidmännisch hingerichtet. Der Tote besaß Teile des Waldes, die er an eine Windkraftfirma verpachten wollte. Feinde hatte er viele, aber die Spuren sind verwirrend. Zum Glück für Kommissar Voss gibt es Maja, die polnische Pflegerin seiner Mutter, die ihn regelmäßig aus der Fassung bringt und meistens die richtigen Fragen stellt. Doch dann wird der zweite Tote entdeckt. Wieder wie ein Tier erlegt. Und das verändert alles … »Auentod« Kommissar Voss macht Urlaub in Polen, mit Maja, der Pflegerin seiner Mutter. Doch plötzlich ist Maja verschwunden. Kurze Zeit später stürzt im brandenburgischen Bad Freienwalde ein Software-Entwickler vom Baugerüst seiner Villa und stirbt. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als ein Fall, der alle Gewissheiten in Frage stellt, sogar die Liebe. Auf der Suche nach der Frau, die er zu kennen glaubte, wird Maja für Voss immer mehr zu einer Fremden. Ist sie in kriminelle Machenschaften verwickelt? Ist sie überhaupt, wer sie zu sein vorgibt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 817
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Maxim Leo
Zwei Fälle für Kommissar Voss
Kommissar Voss ermittelt (2in1-Bundle)
Waidmannstod - Auentod
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Leo
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Leo
Maxim Leo wurde 1970 in Ost-Berlin geboren, ist gelernter Chemielaborant, studierte Politikwissenschaften, wurde Journalist. Er arbeitet als Reporter bei der Berliner Zeitung, schreibt mit Jochen-Martin Gutsch Bestseller über sprechende Männer und außerdem Drehbücher für den »Tatort«. 2006 erhielt er den Theodor-Wolff-Preis. Für sein autobiographisches Buch »Haltet euer Herz bereit« wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. 2014 erschien sein Krimi »Waidmannstod. Ein Fall für Kommissar Voss«. Maxim Leo lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mörderische Mark Brandenburg – zwei Fälle für Kommissar Voss
»Waidmannstod«
Kommissar Voss ist gerade in sein Heimatdorf zurückgekehrt, als ein Toter im Wald entdeckt wird. Waidmännisch hingerichtet. Der Tote besaß Teile des Waldes, die er an eine Windkraftfirma verpachten wollte. Feinde hatte er viele, aber die Spuren sind verwirrend. Zum Glück für Kommissar Voss gibt es Maja, die polnische Pflegerin seiner Mutter, die ihn regelmäßig aus der Fassung bringt und meistens die richtigen Fragen stellt. Doch dann wird der zweite Tote entdeckt. Wieder wie ein Tier erlegt. Und das verändert alles …
»Auentod«
Kommissar Voss macht Urlaub in Polen, mit Maja, der Pflegerin seiner Mutter. Doch plötzlich ist Maja verschwunden. Kurze Zeit später stürzt im brandenburgischen Bad Freienwalde ein Software-Entwickler vom Baugerüst seiner Villa und stirbt. Was zunächst wie ein Unfall aussieht, entpuppt sich als ein Fall, der alle Gewissheiten in Frage stellt, sogar die Liebe. Auf der Suche nach der Frau, die er zu kennen glaubte, wird Maja für Voss immer mehr zu einer Fremden. Ist sie in kriminelle Machenschaften verwickelt? Ist sie überhaupt, wer sie zu sein vorgibt?
Inhaltsverzeichnis
Waidmannstod
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch bis Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Zur Handlung
Auentod
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Maxim Leo
Waidmannstod
Der erste Fall für Kommissar Voss
SAMSTAG
Das fahle Licht der Herbstsonne bricht durch die Kronen der mächtigen Buchen, als die Jagdhörner durch den Sternekorper Forst hallen. Die Treiber, die vom Westen her den Wald durchkämmen, gehen los, unter ihren Stiefeln raschelt das Laub. Sie laufen zügig, aber nicht schnell, das Wild soll behutsam in Richtung der Jäger gedrängt werden. Die stehen rundherum auf Anhöhen postiert, von denen sie das Gelände gut überblicken können. Eiszeitrinnen trennen die Hügelketten und führen hinunter ins Brunnental. Wenn das Wild in die alten Flussbetten flüchtet, stehen unten weitere Schützen bereit. Die Jäger laden schweigend ihre Waffen. Nur das metallische Klicken der Büchsenschlösser ist zu hören.
Bald fällt an der Rosskuppe der erste Schuss, ein Reh überschlägt sich im feuchten Laub, bleibt schwer atmend liegen. Im Tiefen Grund wechselt ein Trupp Damwild über eine Schneise. Die Tiere tragen schon ihr dunkles Winterfell. Vorneweg läuft ein alter Hirsch mit prächtigem Schaufelgeweih, gefolgt von jüngeren Hirschen, Kälbern und Jungtieren. Der Althirsch wird über dem linken Lauf getroffen, prescht aber blutend weiter, bis er etwa hundert Meter entfernt zusammenbricht und von einem nahe stehenden Jäger den Fangschuss erhält. Erst jetzt gerät der Trupp in Panik, zwei Kälber versuchen nach den Seiten auszubrechen, schaffen es aber nicht die Böschung hoch und werden gestellt. Die Jungtiere bleiben verschont, aber statt zu flüchten, halten sie inne. So als wüssten sie nicht, wohin. Als warteten sie darauf, dass die Alten sich noch mal aufrappeln und sie in Sicherheit bringen. Endlich springen sie los und verschwinden im Dickicht. Am Silberrücken hetzt eine Rotte Wildschweine vorbei. Vom Hochsitz aus nimmt einer der Jäger die Bache ins Visier. Ein dreijähriger Keiler dreht um und entkommt. Die anderen Tiere flüchten in eine Schlammsenke, wo bereits die Jäger auf sie warten.
Der ganze Wald ist in Aufruhr geraten. Eichelhäher, Buchfinken, Singdrosseln, Kolkraben fliegen rastlos umher, stoßen Warnrufe aus, die untergehen im Gebell der Jagdhunde, im Krachen der Äste, im Geflatter der Blässhühner, im dumpfen Trab der flüchtenden Wildläufe, im Widerhall der Schüsse, im Wehklagen der getroffenen Tiere. Gegen Mittag geben die Jagdhörner das Signal zum Ende des Schießens. Die Jäger eilen herbei, sichten ihre Beute, machen sich daran, das Wild aufzubrechen. Sie arbeiten schnell, mit geübten Handbewegungen, die das Waidmesser durch das noch warme Fleisch fahren lassen. Ein Jäger packt oben an der Rosskuppe das Reh am Kopf, das am Morgen zur ersten Beute wurde, schneidet die Unterseite des Halses auf, zieht Luft- und Speiseröhre heraus und verknotet sie miteinander. Er öffnet vorsichtig die Bauchdecke, zieht mit einem Ruck die Innereien heraus. Er trennt die Beckenknochen auseinander und löst den Enddarm aus. Von den Innereien nimmt er die Leber und das Herz. Die Leber soll später zum Jagdessen gebraten werden, das Herz bekommen die Hunde. Plötzlich zerreißt ein Schuss die Stille, die Jäger halten inne.
Als hätte auch er diesen Schuss gehört, schreckt Hauptkommissar Daniel Voss aus dem Schlaf. Er blinzelt, schnappt nach Luft, gähnt und blickt verwundert um sich. Der Wecker zeigt halb eins. So lange hat Voss schon ewig nicht mehr geschlafen. Er sieht das Depeche-Mode-Poster an der Wand, das Modellflugzeug an der Decke, die Indianerhaube mit der abgeknickten roten Feder auf dem Fensterbrett. Er atmet den süßlichen, schweren Geruch ein, der wahrscheinlich vom Teppichboden kommt. Dann schließt er wieder die Augen. Wie er hierhergekommen ist? Tja, wenn er das so genau wüsste.
Es fing wohl damit an, dass er vor vier Monaten geweint hat. Das war ihm schon sehr lange nicht mehr passiert. Zum letzten Mal bei seiner Jugendweihe, als Tante Hannah aus Hamburg statt des versprochenen Stereorekorders dieses blöde Kofferradio mitgebracht hatte. Verzweifelt war er damals, weil er dachte, niemals mehr einen Stereorekorder aus dem Westen zu bekommen. Später gab es noch ein paar andere Momente in seinem Leben, in denen Weinen vermutlich angebracht gewesen wäre. Aber er konnte nicht. Es war, als gäbe es eine Sperre in seinem Gehirn, die ihn vor zu großer Traurigkeit schützte. Irgendwann dachte er, auch das Weinen sei letztlich eine Frage der Übung, und er habe es wohl verlernt.
Als seine Mutter anrief, um ihm vom Tod des Vaters zu berichten, da spürte er eine seltsame Wärme durch seinen Kopf ziehen. Wie ein Strom, der lange versiegt war und der sich nun mit ungeahnter Kraft seinen Weg bahnte. Voss war überrascht, als ihm die Tränen über das Gesicht liefen. So überrascht, dass es auch gleich wieder vorbei war. Er hat sich seinem Vater nie besonders nahe gefühlt, diesem stämmigen, schweigsamen Bauersmann aus Sternekorp.
Doch nun war der Alte tot, und Voss musste sich um so viele Dinge kümmern. Um die Mutter vor allem, die sich kaum noch alleine bewegen kann. Voss fuhr also von Stuttgart nach Sternekorp, mit Unruhe im Bauch. Zwei Wochen nahm er sich frei, um alles zu erledigen. Er engagierte Maja, eine Krankenschwester aus Polen, die bei der Arbeit einen hellblauen Nylonkittel trägt. Maja verstand sich prächtig mit der Mutter, das war gut. Sie begruben den Vater im Schatten der Sternekorper Feldsteinkirche.
Kurze Zeit später schickte eine LKA-Kollegin in Stuttgart ihm die Stellenausschreibung zu. Gesucht wurde ein neuer Leiter der Mordkommission in Bad Freienwalde, nur zwanzig Minuten von Sternekorp entfernt. Die Kollegin meinte es sicherlich gut mit ihm, sie sagte, so könne er näher bei seiner Familie sein. Er löschte die Mail. Und fuhr dann ein paar Wochen später doch zum Vorstellungsgespräch nach Bad Freienwalde. Etwas zog an ihm, und er gab nach. Wie immer.
Voss hat sich oft gefragt, wie die anderen es schaffen, ihrem Leben eine Form zu geben. Er richtet sich meist in dem ein, was sich gerade so ergibt. Wenn er mal versucht hat, bewusst eine Entscheidung zu treffen, ist alles ganz furchtbar geworden. Er muss nur an die missglückte Verlobung mit Nicole denken oder an dieses seltsame Auto, das er sich gekauft hat. Irgendwann hat Voss gelernt, sich treiben zu lassen. Er folgt den Eingebungen, den stummen Kräften, die ihn mal hierhin und mal dorthin ziehen. Beruflich hat ihm das nie geschadet, beim Landeskriminalamt in Stuttgart rühmen sie seinen vortrefflichen Instinkt. Rein privat hat ihn diese Lebenstaktik allerdings zuweilen in ziemliche Katastrophen geführt.
Er weiß nicht, was diesmal an ihm gezerrt hat. Zwanzig Jahre ist es her, dass er Sternekorp, seine Familie und seine Freunde verlassen hat, um in Stuttgart an der Polizeiakademie zu studieren. Er ist dann dort geblieben, als er das Angebot vom LKA bekam. Voss liebt seine Arbeit, sie hält ihn wach und macht ihn sogar manchmal zufrieden. Er mag es, über andere Menschen nachzudenken, über ihre Abgründe, ihre Ängste, ihre Wut. Wenn Voss sich in die Seele eines Verdächtigen versenkt, bleibt von ihm selbst kaum etwas übrig. Er lebt dann wochenlang, monatelang in der Haut und in den Gedanken der anderen.
Als Kommissar kann er Entscheidungen treffen, mit Leuten umgehen. Erwachsen sein. Was immer das auch bedeuten mag. Wenn Voss über sich nachdenkt, dann sieht er keinen Mann, sondern einen Jungen vor sich. Einen Strich in der Landschaft, wie sein Vater immer sagte. Seine Schultern sind immer noch schmaler als sein Becken. Seine Haut ist hell, fast durchsichtig. Seine ganze Lebendigkeit scheint in den großen, dunklen Augen zu liegen. Diesen Augen, von denen Nicole einmal sagte, sie würden alles aufsaugen und selten etwas zu erkennen geben.
Das Haus der Familie in Sternekorp hat er nie gemocht. Es ist dunkel, verwinkelt, und wenn der Wind in den Schornstein drückt, riecht es nach geräucherter Zeit. Dorthin wollte Voss auf keinen Fall zurück. Er nahm sich ein Zimmer in Bad Freienwalde, im »Hotel Schwarzer Adler«, das vier Wochen nach seiner Ankunft wegen eines Schimmelpilzbefalls im Mauerwerk geschlossen werden musste. Im »Hotel am Markt« gab es darauf einen Kongress von Insolvenzanwälten, dem wahrscheinlich einzigen Berufszweig, dem es in Brandenburg glänzend geht. Das Hotel »Goldener Bär« macht erst wieder im Sommer auf. Maja, die polnische Krankenschwester, schlug vor, ihm für den Übergang seine alte Stube herzurichten. So lange, bis er etwas anderes gefunden habe. Deshalb liegt er nun hier, in den verwaschenen Laken seiner Jugend. Erstaunt, gerührt und ein wenig deprimiert. Der wahrscheinlich einzige Hauptkommissar des Landes, der in einem Kinderzimmer wohnt.
Das Klingeln des Telefons reißt ihn aus seinen Gedanken. Es ist Christian Neumann, sein Assistent. Neumanns Stimme überschlägt sich fast:
»Chef, es gibt einen Toten im Sternekorper Forst. Wissen Sie, wo das ist, oder soll ich Sie abholen?«
Voss schließt die Augen. »Warum müssen die Leute eigentlich immer am Wochenende sterben, Neumann?«
Neumanns Stimme wird noch aufgeregter. »Ich weiß es nicht. Ist mir auch noch gar nicht so aufgefallen. Ich bin in einer Viertelstunde bei Ihnen.«
Voss legt auf. Er weiß genau, was Neumann gerade für ein Gesicht gemacht hat. Wenn Neumann aufgeregt ist, sieht er aus wie ein besorgter Rabe. Das liegt vor allem an seiner großen Nase und den Knopfaugen, die er nervös zusammenzieht. Aber auch an den Panikfalten, die vom Nasensattel bis zu den Mundwinkeln reichen und Neumanns Riechorgan noch imposanter erscheinen lassen.
Hat Neumann ihn wirklich gerade gefragt, ob er weiß, wo der Sternekorper Forst liegt? Nur weil dieser Bremer Kapitänssohn seit zehn Jahren in Bad Freienwalde wohnt, hält er sich wohl schon für einen Einheimischen. Und ihn für einen Fremden. Dabei kennt wahrscheinlich kaum jemand diesen Wald so gut wie Voss. Schon als Kind ist er über die Anhöhen gelaufen, hat sich im weichen Laub die Abhänge hinunterrollen lassen. Auf einem der geschwungenen Hügelzüge war sein Räuber-Hauptquartier, in der Nähe einer umgestürzten Eiche, deren Stamm wie eine Festungsmauer den Blick auf die Höhle verbarg. Dort lagerte er auch seine geheimen Keks-Vorräte, die aber meistens von Ameisen gefressen wurden. Seit seinem Weggang ist er nicht mehr dort gewesen.
Der Geruch des feuchten Laubes, das milde Licht, die Feldsteinhügel, die das Eis vor Tausenden von Jahren zurückgelassen hat, das alles versetzt Voss in einen angenehmen Taumel, als er eine halbe Stunde später im Sternekorper Forst ankommt. Und ausgerechnet hier gibt es eine Leiche. Ausgerechnet hier steht jetzt der aufgeregte Neumann. Weiter hinten sieht er Frau Kaminski, die Chefin der Kriminaltechnik, und Marco Dibbersen, den Rechtsmediziner, der erfreulich wenig spricht. Voss wird nervös, wie immer, wenn er zum ersten Mal an einen Tatort kommt. Er muss dann immer daran denken, was ihm sein Ausbilder in Stuttgart gesagt hat: »In der ersten halben Stunde siehst du am meisten. Was aber auch bedeutet, dass du am meisten übersehen kannst.« Anfangs dachte Voss, diese Nervosität würde sich irgendwann legen. Aber es wird immer schlimmer.
Frau Kaminski, deren Vornamen niemand zu kennen scheint, weshalb sie von allen immer nur Frau Kaminski genannt wird, nickt ihm zu und zeigt wortlos auf eine gewaltige Esche, die in einer Senke steht. Sie begleitet ihn die paar Schritte hinüber, immer noch schweigend, so als würde sie spüren, wie wichtig es ihm ist, diesen ersten Eindruck möglichst ungestört aufzunehmen. Voss tut das gut, diese Ruhe. Er hat das Gefühl, dass Frau Kaminski in ihn hineinblicken kann, dass sie ihn versteht, obwohl sie sich erst seit Kurzem kennen. Dieses stille Verständnis war von dem Moment an da, als sie sich zum ersten Mal die Hand gaben und diese rundliche Frau mit den streng gezupften Augenbrauen ihm ein ermutigendes Lächeln spendierte.
Die Monate, die er jetzt hier ist, hat er genutzt, um sich einzuarbeiten, um anzukommen. Es gab zwei tödliche Autounfälle, drei Ertrunkene und einen Besoffenen, der in einer milden Sommernacht mit fast zwei Promille im Wald erfroren ist. Aber einen Mord gab es bisher nicht. Man hat ihn gewarnt, dass er nicht zu viel erwarten dürfe. Höchstens ein Fall pro Jahr, mehr passiere hier nicht. »Wo wenige Menschen leben, wird wenig getötet«, sagte der Polizeidirektor. Ende der Neunziger habe es sogar mal eine Zeit gegeben, in der drei ganze Jahre lang niemand auf unnatürliche Weise ums Leben gekommen sei. »Das ist schön für die Menschen, aber hart für die Mordkommission«, sagte der Polizeidirektor.
Voss geht um den Baum herum, bleibt stehen. Die Leiche eines Mannes in Jagduniform liegt da, auf Tannenzweige gebettet. Der Körper ruht auf der rechten Seite. Die Knie sind angewinkelt, die Hände mit einem Seil gefesselt und vorgestreckt. Im halb geöffneten Mund des Mannes steckt quer ein schmaler Tannenzweig. Auf der Uniformjacke ist um die linke Brusttasche herum ein großer Blutfleck zu sehen. Auch auf der Wunde liegt ein Tannenzweig. Die Augen des Mannes sind geöffnet und blicken starr, voller Angst. Dibbersen, der Rechtsmediziner, der nach Aussage der Kollegen mal DDR-Jugendmeister im Judo war, wiegt seinen mächtigen Oberkörper vor und zurück, was ziemlich lächerlich aussieht, aber seine Art zu sein scheint, mit schwierigen Situationen umzugehen: »Harro Probst, 64 Jahre alt, Gas-Wasser-Installateur aus Eberswalde. Er wurde wahrscheinlich niedergeschlagen und dann mit einem Schuss ins Herz getötet. Ob das hier passiert ist, müssen wir noch überprüfen.«
Voss überlegt, es sieht wie eine Hinrichtung aus. Eine Inszenierung, die wahrscheinlich etwas sagen soll. Irgendeine blöde Botschaft. Voss findet, dass die Leute zu viele skandinavische Krimis gucken. Wie sonst sollte jemand auf die Idee kommen, so etwas zu veranstalten? Die Krimis verändern die Verbrecher, nicht umgekehrt, davon ist er überzeugt.
»Ich will eine Liste mit allen Jägern und allen Waffen haben. Neumann, Sie klingeln ein paar Kollegen aus dem Wochenende und befragen sämtliche Teilnehmer der Jagd. Keiner geht ohne Vernehmung nach Hause«, sagt Voss.
»Die Jäger sind an der Hubertus-Hütte«, erwidert Neumann. »Wissen Sie, wo das ist?«
Voss überlegt, ob er Neumann sagen soll, wie sehr ihn seine Fragen nerven, aber das ist jetzt nicht der Moment. Er wird ihm das später noch mal in Ruhe erklären. Voss marschiert los, quer durch den Wald, in die Richtung, in der sich in seiner Erinnerung die Hütte der Sternekorper Jäger befindet. Er lässt sich Zeit, versucht, den Zauber des Waldes, der ihn eben so belebt hat, wiederzufinden. Aber es funktioniert nicht. Aus dem Abenteuer-Wald seiner Kindheit ist ein trauriger Arbeitsplatz geworden. Missmutig stapft Voss durch das Laub.
Schon von Weitem hört er die Stimmen der Jäger. Der Geruch von gegrilltem Fleisch steigt ihm in die Nase und erinnert ihn daran, dass er noch nichts gegessen hat. Das kommt davon, wenn man bis mittags schläft. Die Hütte ist aus rohen Baumstämmen gezimmert und steht an einer Lichtung, die zugleich die Kreuzung zwischen dem Sternekorper Forstweg und dem Harnebecker Rundwanderweg ist. Hier wurden auch früher schon die großen Jagdfeste gefeiert. Vor der Hütte sind lange Tische und Bänke aufgebaut, über einer Feuerstelle hängt ein dampfender Suppenkessel, daneben brät das Fleisch. Als Voss die Lichtung betritt, verstummen die Gespräche, und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Sie wissen also schon Bescheid. Ein paar der Jäger kennt er. Den alten Selbmann zum Beispiel mit seinem Rauhaardackel. Und Borkenfeld, der auch, wenn er nicht auf der Jagd ist, am liebsten Tarnkleidung trägt. Mike Fischer, der mit ihm in einer Klasse war, hätte er fast nicht erkannt. Sein weiches, rundes Gesicht ist von einem Vollbart eingerahmt, der ihn erstaunlich erwachsen erscheinen lässt. Voss fühlt sich auf einmal unwohl. Es ist das erste Mal, dass er es bei seiner Arbeit mit Leuten zu tun hat, die er privat kennt. Seine ganze Sicherheit, die ihm seine Rolle als Kommissar normalerweise verleiht, ist verschwunden. Er steht auf dieser Lichtung unter den prüfenden Blicken der Dorfleute und ist wieder der kleine Voss, wie sie ihn immer genannt haben.
Zum Glück scheinen die anderen mehr Respekt vor ihm zu haben, als er gerade vor sich selbst. Wen Voss auch anblickt, der schlägt die Augen nieder. Er macht eine etwas ungelenke Bewegung mit dem Arm, die man vielleicht als Gruß oder auch nur als Beruhigung verstehen könnte, und geht zu der Strecke, wo auf Tannenzweigen ausgelegt die geschossenen Tiere nach Art und Größe aufgereiht liegen. In der ersten Reihe das Rotwild, beginnend mit den stärksten Hirschen, gefolgt von den Rotwildkälbern. In der zweiten Reihe das Damwild, in der dritten das Schwarzwild und in der vierten das Rehwild. Dann folgen die Füchse, mit nach oben gebogenen Schwänzen, und später die Hasen und Kaninchen. In der Schule musste Voss die Reihenfolge der Stücke auf einer Wildstrecke auswendig lernen. Das gehörte für einen Dorfjungen zur Allgemeinbildung. Außerdem war Herr Düssmann, sein Klassenlehrer, Jäger.
Voss fand die Jagd schon immer seltsam. Was reizt die Menschen daran, Tiere totzuschießen? Dass gejagt werden muss, damit das Wild nicht überhandnimmt und Wälder und Felder zerstört, das kann er ja verstehen. Aber wie kann man Freude daran haben? Wie kann man es gar zu etwas Ehrwürdigem verklären? Was ist so toll daran, wehrlosen Geschöpfen mit überlegener Waffentechnik den Garaus zu machen? Und dann diese Zurschaustellung der Tierkadaver, die mit aufgeschlitzten Bäuchen auf dem Tannengrün liegen! Angeblich soll diese Zeremonie ja den Respekt vor der getöteten Kreatur ausdrücken. Aber Voss findet es eher beklemmend, wie die Kadaver hier zum letzten Appell antreten müssen, liebevoll aufgereiht von ihren Bezwingern.
Er tritt näher heran und sieht, dass den männlichen Tieren Tannenzweige ins Maul gelegt wurden. Dabei fällt ihm ein, dass er mal bei Herrn Düssmann in die Ecke musste, weil er sich einfach nicht merken konnte, dass Hirsche kein Maul haben, sondern einen Äser. »Bei Wildschweinen sagt man Gebrech und bei Füchsen Fang. Wann merkst du dir das endlich, Voss?«, hat Düssmann damals vor der ganzen Klasse geschrien. Es kann sein, dass dieser Vorfall seine Haltung zur Jagd ein klein wenig mitgeprägt hat.
Die erlegten Tiere liegen auf der rechten Seite, die Schusswunden sind mit Tannenzweigen bedeckt. Beim männlichen Wild weist das gebrochene Ende des Zweiges zum Kopf. Alles ist genau wie bei dem Toten drüben an der Esche. Sogar die Körperhaltung stimmt überein. Die angewinkelten Beine des toten Mannes und seine vorgesteckten Arme lassen ihn wie ein flüchtendes Tier erscheinen. Der Mörder hat sich wirklich Mühe gegeben. Er wusste genau, wie er die Leiche präsentieren wollte. Er muss solche Wildstrecken oft gesehen haben, sich mit den Jagdbräuchen bestens auskennen. Normalerweise, denkt Voss, versuchen Mörder, überhaupt keine Spuren zu hinterlassen, unsichtbar zu bleiben. Hier drängt sich einer nach vorne, will etwas sagen, womöglich seine Tat erklären.
Mittlerweile steht er nicht mehr allein an der Strecke. Um ihn herum sammeln sich die Jäger. Am Kopf der Strecke stehen der alte Selbmann und zwei andere, die wahrscheinlich zur Jagdleitung gehören. Die drei Männer setzen ihre Hörner an. Wehmütig und stolz klingt ihre Melodie, eine seltsame Mischung der Gefühle, die wahrscheinlich das emotionale Dilemma des Jägers ausdrücken soll, der über seine Beute triumphiert, um den Preis, ihr Leben auszulöschen. Voss ist erstaunt, wie sehr ihn diese Musik berührt. Diese hohen, tanzenden Töne, die immer tiefer in der Traurigkeit versinken. Er sieht die Tränen in den Augen der Jäger.
Der alte Selbmann setzt zu einer Rede an. »Liebe Jagdfreunde, die meisten von euch haben es schon gehört, einer unserer Kameraden ist tot. Ihr kennt Harro Probst seit vielen Jahren. Ihr wisst, was für ein feiner Jäger er ist. Wir wissen nicht, was heute passiert ist. Ob Harro bei einem Unfall starb oder absichtlich getötet wurde. Die Polizei ermittelt schon.« In diesem Moment wandert der Blick des alten Selbmann zu Voss. Sie sehen sich kurz an, dann setzt er seine Rede fort: »Wir, seine Jagdfreunde, können heute nur noch eins für unseren Harro tun. Wir können seiner, wie es Brauch ist, gedenken. Wir blasen jetzt das große Halali. Und ich bitte alle, die ihre Hörner dabeihaben, es mitzutun.« Nun setzen mindestens zehn der Männer ihre Instrumente an. Kraftvoll und klagend schallt die Totenmesse über die Lichtung.
Als die Musik verklungen ist und die Jäger auseinanderlaufen, hat Voss seine ersten Entscheidungen getroffen. Mittlerweile sind auch Neumann, zwei weitere Kollegen der Mordkommission aus Bad Freienwalde und drei Schutzpolizisten aus Wriezen an der Jagdhütte eingetroffen. Voss nimmt sie alle zur Seite. »Ich will, dass diese Wildstrecke hier sofort abgesperrt wird. Sobald Frau Kaminski mit dem Fundort fertig ist, soll sie mit ihren Leuten hierherkommen. Ich muss wissen, ob die Tannenzweige, die wir bei Harro Probst gefunden haben, von denselben Bäumen stammen wie diese hier. Ich will wissen, wo die Bäume stehen. Außerdem müssen wir klären, ob die Zweige möglicherweise von derselben Person abgebrochen wurden.«
Neumann schaut Voss fragend an. »Wie kann man denn so was rausbekommen?«
»Jeder Mensch hat seine eigene Art, einen Zweig abzubrechen. Vielleicht finden wir Muster, irgendwas Vergleichbares.«
Neumann sieht immer noch skeptisch aus. Dieser Typ geht Voss heute wahnsinnig auf die Nerven. Aber er hat jetzt keine Zeit, sich aufzuregen. Sie müssen so schnell wie möglich vorankommen. Spuren im Wald zu sichern, das weiß Voss, ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt. Es gibt Wind und Regen und alle möglichen Tiere, die Leichen anfressen. Außerdem leben auf dieser Welt leider jede Menge Pilzsucher und Spaziergänger, die überall herumtrampeln.
»Frau Kaminski soll sich Verstärkung holen. Die Schusswunden an der Leiche von Harro Probst müssen mit den Wunden der Tiere verglichen werden. Vielleicht wurde ja die gleiche Munition verwendet. Bis Sonnenuntergang müssen wir fertig sein.« Voss überlegt kurz, ob er etwas vergessen hat. »Wenn Sie die Jäger befragen, muss auch geklärt werden, wer welches Tier geschossen hat. Neumann, Sie machen einen Plan von der Wildstrecke, auf dem alles eingetragen wird.« Er weiß, dass er den Kollegen gerade sehr viel Arbeit aufbürdet, aber es geht nicht anders.
Aus den Augenwinkeln sieht er seinen Schulkumpel Mike Fischer, der sich schon die ganze Zeit in seiner Nähe herumdrückt. Voss geht auf ihn zu und gibt ihm die Hand.
»Mann, Vossi, dass du jetzt hier bist, ist ja …« Mike Fischer stockt, hebt die Arme, sucht nach Worten. Eigentlich wie immer. Sie waren als Schüler nicht besonders eng befreundet, aber sie haben sich irgendwie verstanden. Sie konnten zum Beispiel angeln gehen und zwei, drei Stunden am See sitzen, ohne das Gefühl zu haben, jetzt gleich unbedingt etwas sagen zu müssen. Das fand Voss schon damals angenehm. Außerdem war es Mike Fischer, der ihm gezeigt hat, wie Schweine es miteinander treiben. Das war im Stall von Mikes Vater, wo zum Beginn des Winters der Zuchteber Harry in einem abgetrennten Koben mit ausgewählten Sauen zusammenkam. Einen ganzen Nachmittag lang sahen sie Harry bei der Arbeit zu. Das war für Voss damals sehr beeindruckend, zumal ihm Mike Fischer erklärte, dass die Sache bei den Menschen recht ähnlich ablaufe.
Das Erstaunliche an Schulkumpels ist, dass sie einem sofort wieder vertraut sind, denkt Voss. Egal, wie lange man sie nicht gesehen hat. Egal, was man zwischendurch so gemacht hat. Das erklärt wohl auch, warum er sogar Mike Fischers Ellenbogen ergreift, um ihn sogleich wieder loszulassen, von der eigenen Gefühlsaufwallung überrascht.
»Hallo Mike, ich wusste gar nicht, dass du jagst«, sagt Voss und ärgert sich sofort, dass ihm nichts Besseres zur Begrüßung eingefallen ist.
»Na ja, so viel kann man hier nicht machen«, sagt Mike Fischer.
»Tja, das stimmt. Ich musste gerade an Düssmann denken.«
»Du meinst Tschüss-Mann-Düssmann.«
Voss lächelt. Ja, genau so haben sie ihren Klassenlehrer immer genannt. Am liebsten würde er jetzt weiter mit Mike Fischer in alten Erinnerungen schwelgen.
»Kanntest du Harro Probst?«, fragt Voss stattdessen.
Mike Fischers Gesicht verdüstert sich.
»Klar, wie alle hier.«
»Hatte er Feinde?«
»Kann man so sagen. Die ganzen Windkraftgegner …«
»Was hat Probst mit den Windkraftgegnern zu tun?«
»Mann, Voss, ist ja wie früher, du weißt echt gar nichts! Harro Probst war der Besitzer dieses Waldes hier. Hat er, glaube ich, kurz nach der Wende gekauft. Vor einem Jahr wurden neue Gebiete ausgewiesen, in denen Windräder gebaut werden dürfen. Und der Wald von Harro Probst gehörte dazu. Probst hat einen Pachtvertrag mit so einer Windkraftfirma unterzeichnet. Die wollen hier fünf Windräder bauen. 250 Meter hoch, 100 Meter höher als der Kölner Dom. Kannst du dir das vorstellen?«
»Diese Windräder sollen in den Wald gesetzt werden?«
»Ja, für jede Anlage müssten zehn Hektar Wald gerodet werden. Das alles hier soll abgeholzt werden. Ist scheiße, aber ist so.«
»Das ist ja furchtbar«, entfährt es Voss. »Ich meine, ist das alles wirklich schon entschieden?«
»Was ich so gehört habe, sollte Harro Probst für jede Anlage 40.000 Euro jährlich als Pachtgebühr erhalten. Er hätte nie wieder arbeiten müssen, verstehst du, Voss, nie wieder arbeiten. Nur noch Geld zählen, jagen und angeln. Der Harro wollte seine Firma verkaufen, für den war das hier entschieden.«
»Und die Jäger? Ich meine, ihr jagt doch hier seit ewigen Zeiten …«
»Klar, ist blöd.« Mike Fischer stockt, überlegt. »Ist kompliziert, weil Harro ja auch Jäger war, da hält man auch ein bisschen zusammen. Vor allem, wenn diese ganzen Ökos und Tierschützer durchdrehen. Ich meine, die Leute, die hier drum herum wohnen, die kann ich verstehen. Solche Windräder sind ewig weit zu hören und zu sehen. Vor drei Monaten wurde Harros Auto im Wald angezündet, na ja, das fand er dann auch nicht mehr so lustig.«
Voss hört zu, macht sich Notizen. Wahrscheinlich war er schon weg, als die Wälder damals verkauft wurden. Er findet es erstaunlich, dass man einen Wald einfach so besitzen kann. Ob das seine ostdeutsche Erziehung ist, die ihn so etwas denken lässt? Sein Kommunisten-Gen, wie Nicole mal gesagt hat? Seltsam ist auch, dass im Namen der Klima- und Weltrettung dieser wunderschöne Wald zerstört werden soll.
»Weißt du, wo Harro Probst während der Jagd stand?«
»Wie immer in der Senke, bei der großen Esche. Normalerweise hätte noch Thiessen bei ihm sein sollen. Aber Thiessen ist krank.«
»Das heißt, jeder Jagdteilnehmer wusste, wo Harro Probst zu finden sein würde, und dass er allein war?«
Mike Fischer nickt.
»Wahrscheinlich hätte auch jeder andere unbemerkt dorthin gelangen können, oder?«
»Klar, es gibt bei einer Treibjagd keine Einlasskontrollen«, sagt Mike Fischer.
Sie reden noch ein bisschen, dann verabschiedet sich Voss. Er schlägt vor, mal zusammen ein Bier trinken zu gehen. Mike Fischer zuckt mit den Schultern, was hier in der Gegend durchaus als Zeichen der Zustimmung gewertet werden kann.
Auf der Bundesstraße 158 staut sich der Verkehr Richtung Osten. Alle wollen nach Polen, wie an jedem Samstagnachmittag. Am schlimmsten ist es am ersten Wochenende im Monat, wenn die Hartz-IV-Gelder gerade ausgezahlt wurden und die Brandenburger zum Billig-Biertrinken, Billig-Tanken und Billig-Zigarettenholen über die Grenze fahren. Voss hat das wie immer vergessen, so steht er nun nahe Bad Freienwalde in der Autoschlange und kommt erst eine halbe Stunde später als geplant in Wölsingsdorf an. Das Haus der Familie Probst liegt am Ende der gepflasterten Dorfstraße, dahinter beginnen die Wiesen und Felder. Frau Probst kniet im Vorgarten ihres Hauses in einem Beet, als Voss eintrifft. Er bittet sie ins Haus, da scheint sie es schon zu ahnen.
Es gibt nicht viele Dinge, die Voss an seinem Beruf stören, aber das Übermitteln von Todesnachrichten gehört auf jeden Fall dazu. Menschen gegenüberzustehen, ihnen in die Augen zu blicken und mit einem einzigen Satz ihr Leben zu verdunkeln, daran kann man sich nicht gewöhnen. Er hat mal an einer Schulung auf der Polizeiakademie teilgenommen. Ein Psychologe sollte den angehenden Kommissaren beibringen, die Angehörigen, aber auch sich selbst in solchen Situationen emotional zu schützen. Aber letztlich musste sogar der Psychologe zugeben, dass man eigentlich nicht viel machen kann. Ein Mensch stirbt, und irgendjemand muss es dem nächsten Angehörigen sagen. Egal, welche Tricks man kennt, es wird nicht leichter.
Zuerst steht Frau Probst nur ganz ruhig da, mit fragenden, staunenden Augen. Dann beginnt sie zu schluchzen. Voss steht neben ihr, berührt mit seiner Hand ihren Oberarm. Sie zieht ihn an sich, fällt in seine Arme. Er zuckt zusammen, weil er Berührungen mit fremden Menschen nur schwer erträgt. Aber er schafft das, streichelt sogar ein wenig ihren bebenden Rücken. Nach langen Sekunden löst sie sich von ihm, wendet das verweinte Gesicht ab, atmet tief durch. Voss ist erstaunt, wie schön sie ist. Frau Probst hat ein feines, zart geschnittenes Gesicht, das ihr etwas Vornehmes, Besonderes verleiht. Sie sieht nicht aus wie eine Frau vom Land, eher wie eine Zugereiste, die hier aus irgendwelchen Gründen hängen geblieben ist. Und sie ist bedeutend älter als Harro Probst, so viel ist sicher. Mindestens zehn Jahre älter. Das passiert so selten, dass es einem gleich auffällt, denkt Voss. Sie stehen in einer großen, perfekt geputzten und aufgeräumten Wohnküche. Frau Probst schaltet die Kaffeemaschine an, holt Tassen aus dem Schrank, versucht, sich mit gewohnten Handgriffen zu beruhigen.
»War es ein Unfall?«, fragt sie.
»Nein, Ihr Mann wurde wahrscheinlich ermordet.«
»Aber …«
Erneut geht ein Zittern durch ihren Körper, sie setzt sich an den Küchentisch, stützt den Kopf in die Hände, atmet mehrmals tief durch.
»Wir gehen im Moment davon aus, dass Ihr Mann während der Treibjagd erst niedergeschlagen und dann erschossen wurde. Mehr wissen wir noch nicht.«
»Kein Wunder, Sie wissen ja auch nicht, wer Harros Auto angezündet hat. Oder wer vor zwei Wochen die Scheiben hier vorne am Wintergarten eingeworfen hat.«
»Haben Sie einen Verdacht?«
Frau Probst macht eine wegwerfende Handbewegung, so als hätte es wenig Sinn, überhaupt noch darüber zu reden.
»Ich habe Harro gesagt, er soll das mit diesen blöden Windrädern sein lassen. Was nutzt uns das ganze Geld, wenn uns alle dafür hassen? Aber er wollte nicht auf mich hören, hat gesagt, da müssten wir jetzt durch. Und wenn die Windräder erst mal dastehen, dann finden sich die Leute schon damit ab.«
Sie holt ein Taschentuch aus ihrem Gartenkittel, wischt die Tränen ab.
»Hatte er selbst einen Verdacht?«, fragt Voss.
»Es gibt so viele Leute, die sich gegen ihn gestellt haben. Angefangen mit unseren Nachbarn, dann die Leute, die an dem Wald wohnen, in dem die Windräder aufgestellt werden sollen. Sogar der Bürgermeister hat einen bösen Brief geschrieben, dabei war das rechtlich alles in Ordnung, was der Harro machen wollte. Letzte Woche war dann noch so ein Fledermaus-Schützer hier, der wollte mit Harro sprechen, hat ihn aber gar nicht zu Wort kommen lassen. Der war wie besessen, sprang rum wie Rumpelstilzchen, hätte sich am liebsten auf Harro gestürzt.«
»Wie hieß dieser Fledermaus-Schützer?«
»Keine Ahnung, der wohnt in Sternekorp, in dem alten Stall oben an der Kälberweide. Und gebebt hat der vor Wut, als Harro ihn rausgeschmissen hat.«
»Was heißt rausgeschmissen?«
»Na, Harro hat ihn am Kragen gepackt und zum Gartenzaun gebracht. War nur so eine halbe Portion. Ich fand es trotzdem nicht richtig, dass Harro ihn so hart angefasst hat. Aber auf mich hat er ja nicht gehört.«
»Auf wen hat ihr Mann denn gehört? Hatte er enge Freunde?«
»Nicht, dass ich wüsste. Er stand ziemlich alleine da. Deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum er das mit diesen blöden Windrädern nicht einfach sein lässt.«
Voss’ Handy klingelt. Es ist Neumann, die Befragungen im Wald laufen noch, aber den Jägern ist aufgefallen, dass Jürgen Stibbe nicht mehr da ist. Noch am Morgen hat Stibbe mit den anderen auf der Anhöhe gestanden und auf das Wild gewartet. »Seltsamerweise kann sich niemand erinnern, wann er verschwunden ist«, sagt Neumann.
»Ich fahre sofort zu ihm. Was wissen Sie über diesen Stibbe?«
»Offenbar wollte Harro Probst hier im Wald Windräder aufstellen lassen.«
»Ja, das weiß ich.«
»Ach so.«
Neumann klingt beleidigt.
»Neumann! Was wissen Sie über Stibbe?«
»Er ist einer der engagiertesten Windkraftgegner im ganzen Dorf, weil sein Hof nur ein paar Hundert Meter von dem Bereich entfernt liegt, in dem die Windräder gebaut werden sollen. Er wohnt im alten Vorwerk, wissen Sie, wo das ist?«
»Herr Neumann, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich hier geboren wurde! Und aufgewachsen bin! Ich kenne den Sternekorper Forst, ich kenne das Vorwerk, ich kenne hier alles, haben Sie das jetzt verstanden?«
Voss legt auf. So ist das jedes Mal. Vor allem dann, wenn er sich eigentlich gerade Mühe geben will, nett zu sein. Dieses Nettsein kostet ihn einfach zu viel Kraft. Jetzt muss er sich wieder bei Neumann entschuldigen. Das heißt, er muss sich wieder Mühe geben, was unweigerlich zur nächsten Entgleisung führen wird. Wie schön war die Zeit in Stuttgart, als er selbst noch einen Chef hatte – und keiner war.
Voss, der zum Telefonieren nach draußen gegangen ist, schaut durch die gläserne Terrassentür in die Küche. Frau Probst sitzt am Küchentisch mit leeren, stumpfen Augen. Sie blickt ins Nichts, streichelt mit der linken Hand die Tischkante, so als wollte sie sich selbst ein wenig Trost verschaffen. Voss geht wieder hinein und verabschiedet sich von ihr, sie blickt ihn kaum an.
Oben an der Straße, die zum alten Vorwerk führt, steigt Voss aus dem Auto und blickt über das Feld hinüber zum Sternekorper Forst. Er versucht sich vorzustellen, wie es aussehen würde, wenn dort irgendwann diese Windräder stünden. 250 Meter, höher als der Kölner Dom, hat Mike Fischer gesagt. Ein großer Baum ist 20, vielleicht 30 Meter hoch. Das wären dann also zehn Bäume übereinander, und das in einer Gegend, in der eigentlich nichts besonders hoch ist. Brandenburg ist flach gewelltes Land, der höchste Punkt ist der Hagelberg im Hohen Fläming. 201 Meter hoch liegt dieser brandenburgische Gipfel, dreimal hat Voss ihn unfreiwillig bei Schulausflügen erklommen. Es gibt ein Foto von ihm, oben am Gipfelkreuz. Jedes brandenburgische Schulkind hat so ein Foto. Je flacher das Land, desto größer der Bergstolz, denkt Voss. Es könnte sein, dass der Hagelberg durch die ständigen Schulausflüge schon ganz abgelaufen ist und gar nicht mehr so mächtig in den Himmel ragt, wie immer behauptet wird. Auf jeden Fall aber, und da ist sich Voss sicher, wäre es respektlos, hier irgendwelche Türme aufzustellen, die noch höher sind.
Er steigt wieder ins Auto und fährt den geschwungenen Feldweg zum Vorwerk hinunter. Rechts vom Weg, an einem Weiher, stehen zwei Graureiher. Voss muss sich zwingen, jetzt nicht anzuhalten. Graureiher gehören zu seinen Lieblingsvögeln. Er gelangt an eine Scheune, die quer zum Feldweg steht. Wie die meisten Häuser hier in der Gegend ist sie aus unbehauenen Feldsteinen gebaut, die mit flachen Steinsplittern verkeilt wurden. Die Fenster und Türen sind mit roten Backsteinstürzen eingefasst, das Dach ist aus Wellasbest. Das Scheunentor steht offen, Voss sieht einen kräftigen Mann in blauer Arbeitsmontur an einem alten Traktor schrauben.
»Herr Stibbe?«, ruft Voss, seine Stimme hallt in der Scheune wider wie in einem Kirchenschiff. Der Mann schaut kurz hoch und arbeitet dann einfach weiter. Voss geht näher heran.
»Ich bin Hauptkommissar Voss, darf ich Sie kurz stören?«
»Machen Sie doch schon.«
»Herr Stibbe, Sie waren heute bei der Treibjagd im Sternekorper Forst dabei und sind dann plötzlich verschwunden. Dürfte ich wissen, warum?«
»Ich hatte hier zu tun.«
»Haben Sie mitbekommen, dass Harro Probst tot ist?«
Stibbe hält inne, steht auf und wischt sich die Hände an einem Tuch ab. »Ja, habe ich gehört.« Stibbe vermeidet es, Voss anzublicken, er hält den Kopf leicht gesenkt, sein Blick wandert unruhig hin und her.
»Wo waren Sie während der Jagd?«
»Auf dem Ansitz am Tiefen Grund.«
»Wie weit ist der Tiefe Grund von der Stelle entfernt, an der Harro Probst gefunden wurde?«
»Ich weiß nicht, wo Harro gefunden wurde. Ich bin gleich nach dem Abblasen weg.«
»Harro Probst wurde da gefunden, wo er auch während der Jagd gestanden hat, an der großen Esche in der Senke, die zum Brunnentalweg führt.«
»Ja, da stand er immer.«
»Herr Stibbe, es wäre schön, wenn das, was wir hier gerade tun, sich etwas mehr in Richtung eines Gesprächs entwickeln könnte. Erzählen Sie mir bitte ausführlich, was Sie während der Jagd getan haben und welchen Weg Sie wann genommen haben, um wieder nach Hause zu kommen.«
Stibbe blickt ihn zum ersten Mal direkt an. Er wirkt nicht ungehalten, eher erstaunt. »Um halb zehn war ich am Ansitz, dann ging die Jagd los. Gegen halb elf wechselt Rotwild, aber ich komme nicht zum Schuss. Zehn Minuten später habe ich eine Bache, schieße, aber sie flüchtet getroffen ins Dickicht. Halbe Stunde später zwei Ricken, eine habe ich erwischt. Ich bin dann zur Nachsuche wegen der Bache, habe sie aber nicht gefunden. Die Ricke habe ich an den Ansitz gebunden, habe Olli Günther eine SMS geschickt, der am Eschenpfad saß, und bin los. Hinten an der Kiefernschonung lang bis zur Feldkante und dann hier rüber.« Stibbe wird während des Sprechens immer leiser. Er sieht erschöpft aus, als hätte er schon lange nicht mehr so viel am Stück geredet.
»Hat irgendjemand Sie auf dem Weg nach Hause gesehen?«
»Nein.«
Die Antwort kommt schnell und bestimmt. Stibbe versucht nicht, sich zu erklären, sagt kein Wort zu viel. Er klingt überzeugend, findet Voss.
»Sie kämpfen gegen die Windräder, die drüben im Wald gebaut werden sollen.«
»Weil die alles kaputt machen.«
»Was machen die denn kaputt?«
»Vor zwei Jahren haben meine Frau und ich einen Kredit aufgenommen, um die Ferienwohnungen im Schweinestall auszubauen. Alle haben gesagt, das läuft. Die Berliner wollen Landleben und Ruhe. Wir kennen einen Architekten, der hat das alles so auf ursprünglich gemacht. Einmal die Woche kommt eine Bio-Kräutertante aus Frankenfelde her, das finden die Berliner toll. Wir hatten sogar an Pferde gedacht, ist ja Platz genug. Wenn jetzt aber da drüben die Windräder hinkommen, dann können wir das alles vergessen. Wer will denn den ganzen Tag das Heulen dieser blöden Propeller hören?«
»Haben Sie mit Harro Probst darüber gesprochen?«
»Seit er von dem Geld wusste, das er da verdienen kann, konnte man mit Harro nicht mehr reden. Es ist ihm auch scheißegal gewesen, was die anderen von ihm denken. Die Jäger, die Anwohner, die Leute aus Harnebeck. Der war gierig, hat gesagt, das sei die Chance seines Lebens. Dass er den anderen damit ihr Leben versaut, hat ihn nicht interessiert!«
»Ich brauche mal Ihr Gewehr.«
»Ach, Sie denken, ich habe den Harro erschossen?«
»Herr Stibbe, ich muss sicher sein, dass Sie nicht der Mörder sind. Deshalb werde ich Ihr Gewehr mitnehmen und überprüfen lassen.«
Sie gehen schweigend über den Hof, am umgebauten Schweinestall vorbei, der mit seiner rustikal verfugten Backsteinfassade, den dunkelblauen Fensterläden und dem roten Tonziegeldach wirklich genau der romantischen Vorstellung vom Landhaus entspricht, die Leute aus der Stadt so haben. Das Haus von Jürgen Stibbe dagegen, das etwas zurückversetzt steht, ist glatt verputzt, hat Fensterbänke aus falschem Marmor, Fenster mit weißen Plastikrahmen und aufgeklebten Goldsprossen und eine Satellitenschüssel am Giebel. So träumt der Bauer davon, ein Städter zu sein, und der Städter will unbedingt ein Bauer werden, denkt Voss. Aber wahrscheinlich muss das so sein. Die Leute haben immer die größte Sehnsucht nach den Dingen, die sie nicht kennen. Sie malen sich ein schönes Bild vom anderen Leben.
Voss sieht das auch in Sternekorp, wo die Berliner ein Haus nach dem anderen kaufen und schnuckelig zurechtmachen. Die Schicki-Bauern werden sie von den Sternekorpern heimlich genannt. Wenn die Schicki-Bauern ihre Häuser fertig gebaut haben, wenn jeder Holzbalken freigelegt und schön gebeizt ist, die historischen Zinkwannen mit Sonnenblumen bepflanzt sind, die im Garten gefundenen alten Wagenräder an der Hauswand hängen und der Gemüsegarten samt ökologisch korrekter Nacktschnecken-Falle installiert ist, dann freuen sie sich und sind mächtig stolz auf das echte Landleben, das sie hier am Wochenende führen. Die Männer kaufen sich einen alten Deutz-Traktor, die Frauen kochen Konfitüre ein. Die Schicki-Bauern haben dann irgendwann das Gefühl, extrem ursprünglich zu sein und ganz doll in dieses Dorf zu gehören. Und die Sternekorper, die finden das lustig. Weil sie wissen, dass so ein Bauernleben nur für diejenigen romantisch ist, die nie eines führen mussten.
Jürgen Stibbe kommt aus dem Haus, übergibt Voss schweigend sein Gewehr und sieht dabei sehr beleidigt aus. Er wirkt auf Voss nicht wie ein Mann, der mit so großem Aufwand jemanden ermordet. Aber das muss nichts heißen. Genauso wenig, wie es etwas bedeuten muss, dass er kein Alibi hat. Voss hat in all den Jahren, in denen er nun schon Verdächtige befragt, die Erfahrung gemacht, dass es eher die Unschuldigen sind, die bei der Klärung einer sorgfältig geplanten Tat kein Alibi vorweisen können. Der Täter hat immer eine Geschichte parat, und meistens ist diese Geschichte sogar richtig gut.
Voss steigt in den hellblauen Fiat Punto, den er zum Dienstantritt in Bad Freienwalde bekommen hat. Der Polizeidirektor hat ihm gleich am ersten Tag »einen richtigen Wagen« versprochen und ihm dabei entschuldigend die Hand auf die Schulter gelegt, was Voss zusammenzucken ließ, wobei er den Inhalt seiner Kaffeetasse über den hellen Anzug des Herrn Polizeidirektor schüttete. Womöglich ist das der Grund, warum er immer noch keinen richtigen Wagen hat. Ansonsten sind die Kollegen ganz nett. Die meisten im Präsidium halten ihn für einen Westler, weil er aus Stuttgart kommt und gleich Chef der Mordkommission geworden ist. Das hat ihm seine Sekretärin, Frau Mölders, gesagt. Und dann hat sie ihn besorgt angeguckt, so als erwartete sie eine Erklärung. Oder eine Beruhigung. Aber Voss hat erst mal gar nichts erwidert. Was hätte er auch sagen sollen? Er hat diese Frage lange nicht mehr gehört. Ostler oder Westler? In Stuttgart interessiert das niemanden. Hier scheint es immer noch wichtig zu sein.
Voss fragt sich, wann das endlich vorbei sein wird, mit diesen dämlichen Vorstellungen, die die Leute voneinander haben. In Stuttgart hat ihn mal ein Kollege gefragt, ob es eigentlich stimme, dass es in Brandenburg fast nur noch Neonazis gebe, die mit tiefergelegten Autos gegen Bäume fahren. »Ja klar«, hat Voss da gesagt, »genau so ist es.« Am liebsten hätte er diesem Kollegen eine Geschichte von stark tätowierten Nazis erzählt, die in verfallenen Geisterdörfern leben und Sex mit Wölfen haben, weil sämtliche Frauen unter 85 Jahren längst in den Westen gegangen sind. Voss’ Erfahrung ist, dass die Westler so ziemlich alles glauben, was man ihnen erzählt. Es muss nur mit den Vorstellungen übereinstimmen, die sie ohnehin schon haben.
Er startet den Wagen und fährt los. Während der Fahrt versucht er, Frau Kaminski zu erreichen. Er will wissen, wie weit sie mit der Sicherung der Spuren sind. Aber es gibt kein Netz. Das ist etwas nervig hier in der Gegend, man lebt im Grunde in einem riesigen Funkloch, und das nur eine Stunde vom Berliner Stadtzentrum entfernt. Die Schicki-Bauern finden auch das unglaublich entzückend. Wegen der Entschleunigung und der Stille und den schönen Brettspielen, die man mit den Kindern am Wochenende machen kann, in der Zeit, in der man sonst im Internet hängt. Für alle anderen ist es einfach nur anstrengend.
Voss parkt den hellblauen Fiat Punto am Waldrand und geht zur Jagdhütte hoch. Er hat das Gefühl, sein erster Besuch hier sei schon ewig her. Das geht ihm immer so, wenn Ermittlungen beginnen, wenn viele Eindrücke in wenigen Stunden auf ihn einprasseln. Die Sonne ist fast verschwunden, kalte Feuchtigkeit steigt vom Boden auf, das Laub fällt in Klumpen von den Schuhen. Schon von Weitem sieht Voss einen Lastwagen und ein weißes Zelt auf der Lichtung. Frau Kaminski steht an der Laderampe des Lastwagens. Sie sieht müde aus und wirkt trotzdem hoch konzentriert. Voss fühlt sich sofort besser. Er spürt, dass er sich auf diese Frau verlassen kann. Dass sie die Sachen im Griff hat, ohne große Worte darum zu machen. Nichts ist schlimmer, denkt Voss, als Kollegen zu haben, für die man mitdenken muss. So gesehen hat er wirklich Glück mit seinem Job, weil auch Neumann ein richtig guter Polizist zu sein scheint. Wenn er nur nicht so nerven würde. Trotzdem nimmt Voss sich vor, netter zu ihm zu sein.
»Hallo Chef«, sagt Frau Kaminski, »wir bringen jetzt die Wildkadaver ins Kühlhaus, wir hatten nicht die Zeit, die hier zu untersuchen. Über die Wildstrecke haben wir das Zelt gebaut, na ja, der Wald hat leider kein Dach.«
»Wissen Sie schon etwas wegen der Zweige oder der Schussspuren?«
»Nein, wir haben jetzt erst mal nur gesichert. In dieser Jahreszeit gibt es im Wald große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Das bedeutet Nebel und Tau. Das kann Blutspuren zerstören, sogar Faserreste können sich auflösen. Unten am Tatort sind wir so weit fertig, die Leiche ist in der Pathologie. Aber auch da kann ich frühestens übermorgen etwas sagen.«
»Gute Arbeit, Frau Kaminski, wir sprechen uns morgen. Wo ist denn Neumann?«
»Wahrscheinlich im Präsidium, er hat ein paar von den Jägern dorthin mitgenommen, als es hier zu ungemütlich wurde.«
Voss ist erleichtert, er hatte vorgehabt, sich so schnell wie möglich bei ihm wegen des Telefonats vorhin zu entschuldigen. Aber das geht ja nun nicht, tja, kann man nichts machen. Neumann scheint jedenfalls immer noch eingeschnappt zu sein, sonst hätte er ihn zwischendurch schon angerufen. Voss überlegt, wie er weiter vorgehen soll. Schon vorhin hat er daran gedacht, mal zu Förster Engelhardt nach Harnebeck zu fahren. Förster Engelhardt hat ihn schon als Kind in den Wald mitgenommen, hat ihm alles erklärt. Engelhardt hat ihm auch die schönsten Stellen gezeigt. Den Moosgürtel am großen Stein, die Birkeninsel und den Hochstand in der eng bepflanzten Kiefernschonung, die er den »Zauberwald« nannte. Damals hat Voss mit der Vogelbeobachtung angefangen. Es gab den Roten Milan, der seinen Horst in der Astgabel einer toten Kiefer hatte. Und das Kranichpaar, das vor dem Moosgürtel auf der Wiese nistete. Wenn Voss mit dem alten Engelhardt durch den Wald lief, dann spürte er eine nie empfundene Ruhe und Geborgenheit. Es war so, als wäre die Welt außerhalb des Waldes verschwunden.
Das Forsthaus steht ein wenig außerhalb von Harnebeck, vor allem aber ist es tiefer gelegen, mindestens 100 Meter, schätzt Voss. Ein schmaler Waldweg führt in Serpentinen vom Dorf hinunter ins Tal. Der Weg quert die Bahntrasse, auf der früher die Züge nach Seefeld fuhren. Voss bremst, eine Fahrrad-Draisine, die von rüstigen Frührentnern in Goretex-Jacken gesteuert wird, holpert über die verrosteten Schienen. Das sind die touristischen Attraktionen in Brandenburg. Diese Orte, an denen früher noch geschafft wurde. In Eberswalde gibt es ein ehemaliges Fabrikgelände, das heute ein Familienpark ist, in Strausberg kann man auf einem alten Militärflugplatz Skateboard fahren. Die riesigen Gruben des Lausitzer Steinkohletagebaus sind mit Wasser geflutet und sollen demnächst eine Seenkette bilden. Wo früher mal gearbeitet wurde, kann man sich heute nur noch erholen, denkt Voss. Brandenburg ist ein arbeitsloses Wellness-Land geworden.
Unten im Tal ist es dunkel, feucht und auch ein wenig kühler als oben im Dorf. Das Forsthaus sieht aus wie immer. Die grünen Fensterläden, das Hirschgeweih am Giebel, der Holzhaufen auf dem Hof, der Zwinger mit den beiden Langhaardackeln am Eingang. Engelhardt erkennt ihn zuerst gar nicht. Er braucht etwas Zeit, um sich an den Jungen zu erinnern, mit dem er früher umhergepirscht ist.
»Aha, Hauptkommissar Voss, na das ist ja ein Ding«, sagt er dann.
Das Alter hat Engelhardt schmaler werden lassen, aber sehr verändert hat er sich nicht. Es mag daran liegen, dass Engelhardt Voss schon immer alt erschienen ist. Dieser kompakte, kräftige Mann mit dem schlohweißen Haarkranz, dem weichen Kinn und dem hart gerollten R, das er aus seiner schlesischen Heimat mitgebracht hat. Eine Stunde später, nachdem sie im Forsthaus schon zwei Mirabellenschnäpse getrunken haben, sagt der alte Förster einen Satz, den Voss nicht mehr vergessen wird: »Weißt du, Daniel, der Wald ist nicht mehr zum Staunen da.«
Zwischendurch spricht Engelhardt noch von ein paar anderen Sachen. Von den Holzpreisen zum Beispiel, die in den letzten Jahren stark gestiegen seien, weshalb einige Waldbesitzer nun ihre Flächen radikal roden. »Weil sie nur an heute denken, weil sie gierig sind. Weißt du, Daniel, vor 250 Jahren war die Mark Brandenburg kahl, alle Bäume waren abgeholzt und verbrannt. Weil die Menschen nicht wussten, wie man einen Wald gleichzeitig nutzen und erhalten kann. Weil sie auch gierig und ganz schön dumm waren. Die preußischen Gutsbesitzer haben dann gelernt, wie es geht. Die haben die Wälder hier aufgeforstet. Die großen, schönen Bäume, die wir heute sehen, sind alle damals gepflanzt worden. Von Männern, die wussten, dass sie selbst die Ernte nicht erleben werden. Sie haben das Land von Generation zu Generation weitergegeben. Sie haben den Reichtum für ihre Enkel und Urenkel geschaffen. 200 Jahre braucht eine Eiche, bis sie geschlagen werden kann. Eine Buche braucht 130 Jahre. Nadelbäume nur 50. Die Bäume müssen im richtigen Abstand, im richtigen Verhältnis, an den richtigen Stellen gepflanzt werden.«
Voss sitzt da, lauscht der ruhigen, tiefen Stimme des alten Försters. Er könnte stundenlang so sitzen. Auf einmal ist alles genau wie früher, wenn er nach einem Waldspaziergang noch eine Tasse heißen Kakao von Engelhardt serviert bekam. Wenn sie es sich gemütlich machten. Er hört die Buchenscheite im Kamin knacken, er spürt die Wärme, die ihm wohlig in die Knochen kriecht, er riecht den Duft der getrockneten Pfefferminze, die in Bündeln über dem Kamin hängt. Voss hat sich manchmal gefragt, warum sich der alte Förster immer so um ihn gekümmert hat. Vielleicht lag es daran, dass Engelhardt keine Kinder hat. Und Voss gerne einen Vater gehabt hätte, der mit ihm durch den Wald zieht.
»In der DDR wurde es übrigens genauso gemacht«, fährt Engelhardt mit seiner Erzählung fort. »Nach dem Krieg holzten die Leute ab, was sie konnten, dann kam die Bodenreform, und der Wald wurde in Parzellen aufgeteilt, damit auch jeder was abbekam. Später, als jeder in die LPG musste, kam alles wieder zusammen. Und da haben wir es sogar noch besser gemacht als die Preußen. Am Ende der DDR hatten wir 40 Festmeter Holz mehr pro Hektar als am Anfang. Und zwar nicht, weil die DDR so reich war, sondern weil sie es sich im Gegenteil überhaupt nicht leisten konnte, unwirtschaftlich mit ihren Wäldern umzugehen.«
»Da waren wir also preußischer als die Preußen. War eben doch nicht alles schlecht, oder?«, fragt Voss lächelnd. Aber der alte Engelhardt versteht die Ironie nicht. Und zum Lachen ist ihm offenbar erst recht nicht zumute.
»Seit der Wende, mein Junge, ist die Tradition in Gefahr. Der märkische Wald ist jetzt unter Tausenden Besitzern aufgeteilt, und jeder sieht nur seine eigenen Bäume. Und seinen eigenen Profit. Es gibt zum Beispiel ein Gesetz, das es verbietet, mehr als zwei Hektar große Flächen kahl zu schlagen. Und weißt du, was die machen, Daniel? Sie roden die zwei Hektar, lassen drei Baumreihen stehen und roden weiter. Manche unserer Wälder sehen von oben wie Schachbretter aus. Und die Behörden können nichts dagegen tun. Das Privateigentum ist heilig, verstehst du?«
Engelhardt ist jetzt richtig wütend. Er sitzt auf der Kante seines breiten Lehnsessels, fuchtelt mit den Armen, malt die Grenzen der gerodeten Wälder in die Luft. Seine Stimme wird immer höher vor Aufregung, sein Gesicht läuft rot an. Christel, seine Frau, kommt aus der Küche. »Na, nun reg’ dich mal nicht so auf, mein Alter, der Wald ist doch noch da. Und er wird immer da sein, egal, was passiert.«
»Ja, aber er wird kleiner, Christel. Immer kleiner. Und teurer. Erinnerst du dich an die beiden Männer, die neulich hier waren? Die mit den Anzügen?« Engelhardt wendet sich wieder Daniel zu. »Das muss ich dir erzählen. Die kamen hier mit einem dicken Auto an und wollten, dass ich sie berate, weil sie für so einen Finanzfonds arbeiten, der brandenburgische Waldflächen kauft. Ich habe gefragt, warum sie nun unbedingt unsere Wälder hier haben wollen, und die haben mir gesagt, es sei ganz einfach: Die Wälder wachsen, sie überdauern jede Finanzkrise und jeden Weltkrieg und haben seit Jahrhunderten nie an Wert verloren. Die versuchen, uns den Wald abzuschwatzen, und die kommen von allen Seiten. Die Windkraft-Mafia, die Holz-Auktionisten, die Finanzmanager. Alle wittern hier das große Geschäft.«
Voss hört schweigend zu. So hat er den Wald noch nie gesehen. Ihm war nicht klar, dass sich unter diesen Baumkronen, zwischen diesen Hügeln und Lichtungen, die Geschichte dieses Landes abgelagert hat. Dass jede Änderung der Besitzverhältnisse auch diesen Wald verändert hat. Dass dieser Sternekorper Forst im Grunde wie ein riesiges Freiluftmuseum ist, in dem man durch die Jahrhunderte reisen kann. In dem der Wandel der Gesellschaft abzulesen ist. Dabei kennt er das doch alles, die mittelalterlichen Feldsteinkreise, die preußischen Gemarkungszeichen, die im Waldboden verrosteten Wehrmachtshelme, die verwitterten Panzerunterstände der NVA. Und nun also den Schachbrett-Wald und die Windradschneisen. Jede Zeit hinterlässt ihre Spuren.
Aber die Spuren, findet Voss, die werden immer hässlicher. Jetzt haben die Finanzkrise und die Energiewende sogar schon die Birkeninsel und den Zauberwald erreicht. Es sieht so aus, als gäbe es fast nichts mehr auf der Welt, das einfach nur da ist und auch so dableiben kann. Alles ist in irgendwelche komplizierten, globalen Prozesse eingebunden, die kein Mensch mehr versteht, aber deren Auswirkungen dann doch für jeden spürbar werden. Es klingt seltsam, denkt Voss, aber ohne die Klimaerwärmung würde der Gas- und Wasserinstallateur Harro Probst aus Eberswalde jetzt vielleicht noch leben. Weil ohne das Schmelzen der Polkappen wohl niemand auf die Idee gekommen wäre, diese blöden Windräder in das flache Brandenburger Land zu stellen. Und Harro Probst gar nicht erst in Versuchung geraten wäre, den Sternekorper Forst zu opfern, um ein vermögender Frührentner zu werden.
Auf einmal spürt Voss seinen Magen, der ihn schmerzhaft daran erinnert, dass er immer noch nichts gegessen hat. Der Mirabellenschnaps von Förster Engelhardt, der seinen Kopf so angenehm warm und weich gemacht hat, liegt ihm nun brennend im Leib, und er verabschiedet sich, um möglichst schnell nach Hause zu kommen. Engelhardt schenkt ihm eine topografische Karte vom Sternekorper Forst. »Eine genauere Karte wirst du nicht finden, vielleicht hilft sie dir«, sagt er.
Voss’ kleines Auto holpert über den dunklen Waldweg, das Licht der Scheinwerfer tanzt in den Bäumen, und er ist froh, in einer Gegend zu sein, in der Alkoholkontrollen nur sehr sporadisch stattfinden. Nach vier Kilometern in tiefster Finsternis erreicht er die Dorfstraße von Sternekorp, an der sechs Laternen leuchten, was ihm nun fast ein wenig übertrieben erscheint.
Das Haus der Eltern steht direkt an der Straße, wie fast alle Häuser in Sternekorp. Da es auf ihrer Straßenseite keinen Fußweg gibt, ist die Fahrspur gerade mal zwei Meter von der Hauswand entfernt. Wenn schwere Lastwagen vorbeifahren, springen die Gläser im Küchenschrank in die Höhe. Voss hat den Vater mal gefragt, warum sie das Haus nicht weiter hinten gebaut haben. Es war doch Platz da, der Garten hinter dem Haus endet erst am Feldrand, mindestens 100 Meter von der Straße entfernt. Der Vater sagte, das Haus sei schon da gewesen, als er hier ankam. Und dass sie froh gewesen seien, überhaupt etwas zu haben. Und dass es zu der Zeit, als dieses Haus gebaut wurde, noch gar keine Lastwagen gegeben habe, wahrscheinlich noch nicht mal Autos, nur ein paar Pferdekutschen, wenn überhaupt. Die Eltern waren zu geizig, um das Haus nach der Wende zu verputzen, wie es die meisten im Dorf getan haben. So ist die Feldsteinfassade geblieben, und das Haus sieht aus wie eines von den Schicki-Bauern. Mittlerweile findet Voss das ganz gut. Früher hat er sich dafür geschämt, er sah den anderen beim Renovieren zu, und nur bei ihnen daheim blieb alles, wie es war.
Im Haus brennt Licht, was Voss noch immer merkwürdig erscheint. Er muss sich noch daran gewöhnen, mit anderen Menschen unter einem Dach zu wohnen. Das heißt, am liebsten würde er sich gar nicht erst daran gewöhnen, weil er ja hier so schnell wie möglich rauswill. An diesem Wochenende soll er eine Maklerin treffen und zwei Wohnungen in Bad Freienwalde besichtigen, aber daraus wird ja nun nichts. Sobald dieser Fall abgeschlossen ist, wird er auf Wohnungssuche gehen. Bis dahin muss er es eben noch aushalten. Als Voss die Haustür öffnet, weht ihm der Geruch von Bratkartoffeln entgegen. Die Tür, die zum Zimmer der Mutter führt, ist nur angelehnt. Das Licht ist aus, also schläft sie wohl schon. Er geht in die Küche, wo Maja am Herd steht.
»Ich habe im Radio von dem seltsamen Toten im Wald gehört«, sagt sie und wischt die Hände an der Schürze ab.
Auf dem Küchentisch mit der abgewetzten Wachstuchdecke steht ein leerer Teller, daneben eine Flasche Bier. Voss setzt sich auf den Stuhl, sieht Maja beim Kochen zu und spürt die Spannung langsam aus sich entweichen. »Was will denn der Mörder sagen?«, fragt Maja irgendwann, ohne vom Herd aufzusehen. Sie hat eine helle, ein wenig klagende Stimme. Ihr weicher polnischer Akzent klingt beruhigend. Voss ist überrascht, er hätte nicht gedacht, dass sie sich für seine Arbeit interessiert. Und dass sie genau diese Frage stellt. Die Frage, die ihn selbst am meisten beschäftigt. »Ich weiß es nicht«, antwortet er schließlich. Maja tut die Bratkartoffeln auf.
SONNTAG
Kurz nach acht klingelt Voss’ Handy. Es liegt auf dem Nachttisch, etwa 20 Zentimeter von seinem Kopf entfernt, der allerdings unter einem großen Daunenkissen begraben ist, weshalb Voss eine Weile braucht, bis er das Klingeln überhaupt hört. Als er endlich aufwacht, ist das Handy verstummt. Voss lässt sich Zeit, er weiß, dass er schlechte Laune bekommt, wenn er morgens zu schnell aufsteht. Mit dem Schlafen ist es wie mit dem Tiefseetauchen, hat er Nicole mal erklärt. Man darf nicht zu schnell aus der Dunkelheit ans Tageslicht zurückkehren. Man muss sehr langsam nach oben gleiten. Seit er in Sternekorp ist, dauert das Auftauchen allerdings noch viel länger als sonst. Sein Schlaf hier ist fast komatös. Ob das am Teppichboden liegt? Vielleicht ist da irgendein Gift drin, das ihn betäubt?
Er greift nach dem Handy, sieht Frau Kaminskis Nummer und drückt auf Rückruf. Frau Kaminskis Stimme klingt beunruhigt: »Chef, das Zelt, mit dem wir die Wildstrecke gesichert haben, ist abgebrannt.« Jetzt ist Voss wach.
»Was heißt abgebrannt?«
»Ich bin gerade angekommen. So, wie es aussieht, hat hier jemand in der Nacht Benzin reingekippt und alles abgefackelt. Es ist nichts mehr da, nur noch Asche.«
»Verdammt! Ich komme sofort. Rufen Sie Neumann an. Wir treffen uns in 30 Minuten im Wald.«
Als Voss auf der Lichtung vor der Jagdhütte ankommt, ist Frau Kaminski gerade dabei, einige verkohlte Zweige in Klarsichtbeutel zu stecken. Vom Zelt ist nur noch das rußgeschwärzte Gestänge übrig. Voss nähert sich vorsichtig. Wenn der Täter heute Nacht noch mal hier war, hat er vielleicht Fußspuren hinterlassen. Er sieht Frau Kaminski fragend an, aber die schüttelt den Kopf. »Keine neuen Spuren, und die Zweige sind wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen.«
»Das heißt, dass wir auf der richtigen Fährte waren«, sagt Voss. »Es gibt offenbar einen Zusammenhang zwischen dem Tatort und der Wildstrecke, den wir nicht entdecken sollen. Der Täter ist ein großes Risiko eingegangen. Jemand hätte das Feuer sehen können.«
»Der scheint genau zu wissen, was er tut. Um das hier alles abzufackeln, hat er mindestens 30 Liter Benzin gebraucht, eher mehr. Vielleicht ist er mit dem Auto gekommen, aber es gibt keine Reifenabdrücke. Und selbst wenn er zu Fuß das Benzin hergeschleppt hat, wie konnte er in der Dunkelheit seine Spuren beseitigen? Der Boden ist nass und weich, er wird ja nicht geflogen sein.«