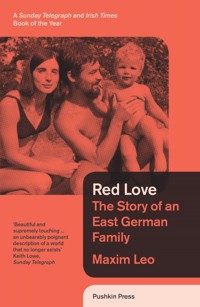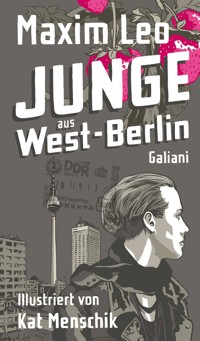9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Die Geschichte der Leos ist ein großer Lebensroman.« Christine Westermann. Wenn vier Menschen um einen Tisch sitzen, dann ist Maxim Leos Berliner Familie schon fast vollzählig versammelt. Die vielen anderen Leos, die in den 30er-Jahren vor den Nazis flohen, waren immer fern, über den ganzen Erdball verstreut. Zu ihnen macht er sich auf, nach England, Israel und nach Frankreich, und erzählt die unglaublichen Geschichten seiner drei Großtanten. Die von Hilde, der Schauspielerin, die in London zur Millionärin wurde. Die von Irmgard, der Jura-Studentin, die einen Kibbuz in den Golanhöhen gründete. Die von Ilse, der Gymnasiastin, die im französischen Untergrund überlebte. Und die ihrer Kinder und Enkelkinder, die jetzt nach Berlin zurückkehren, in die verlorene Heimat ihrer Vorfahren. Auf der Suche nach der Vergangenheit seiner Familie findet Maxim Leo eine Zusammengehörigkeit, die keine Grenzen kennt. Eine wahre, mitreißende Familiengeschichte, spannend, lebendig und herzergreifend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Maxim Leo
Wo wir zu Hause sind
Die Geschichte meiner verschwundenen Familie
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Maxim Leo
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Maxim Leo
Maxim Leo, 1970 in Ost-Berlin geboren, ist gelernter Chemielaborant, studierte Politikwissenschaften, wurde Journalist. Heute schreibt er Kolumnen für die Berliner Zeitung, gemeinsam mit Jochen Gutsch Bestseller über sprechende Männer und Alterspubertierende, außerdem Drehbücher für den »Tatort«. 2006 erhielt er den Theodor-Wolff-Preis. Für sein autobiografisches Buch »Haltet euer Herz bereit« wurde er 2011 mit dem Europäischen Buchpreis ausgezeichnet. 2014 erschien sein Krimi »Waidmannstod«, 2015 »Auentod«. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die unvergessliche Geschichte einer jüdischen Familie, die auf der Flucht vor den Nazis in alle Winde zerstreut wurde und deren Kinder und Enkel zurückfinden nach Berlin, in die Heimat ihrer Vorfahren. Nach Israel gingen Irmgard und Hans, zwei Berliner Jura-Studenten, die 1934 ins Gelobte Land auswanderten und in einem Kibbuz ihre Kinder großzogen. In England trifft Maxim Leo die Familie von Hilde, die als Schauspielerin arbeitete und in jungen Jahren Fritz Fränkel heiratete, Gründer der KPD und Freund Walter Benjamins, mit dem sie nach Frankreich emigrierte. Später floh Hilde mit ihrem Sohn nach London, wo sie es bis zur Millionärin brachte. In Frankreich wohnt Leos Tante Susi, deren Mutter Ilse im Internierungslager Gurs ihre große Liebe kennenlernte und bis zum Kriegsende im Untergrund lebte. Auf der Suche nach der Vergangenheit seiner Familie entdeckt Maxim Leo eine Zusammengehörigkeit, die keine Grenzen kennt. Und auch seine Cousins und Cousinen, die Enkel von Irmgard, Hilde und Ilse, zieht es zurück in die Stadt ihrer Vorfahren, die sie neu entdecken und erfahren.
»Ein packendes Buch, das voller Empathie das Schicksal von drei außergewöhnlichen Frauen erzählt.« Le Monde
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
https://kiwi-verlag.de/zuhause
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Das Fest
Irmgard
Hilde
Ilse
Jardin du Luxembourg
Rue Dombasle
Lyon
Rue Meslay
Ludwigsfelde
Gelobtes Land
Gurs
Christ’s Hospital
Goethehof
Ayelet Hashahar
Magdalen College
Tel Nof
Zu Hause
Danksagung
Quellenverzeichnis
Für Marion, Nina und Clara
Das Fest
An einem warmen Septembertag heiratete mein Bruder in einem brandenburgischen Herrenhaus. Die ganze Familie war eingeladen, auch die aus Israel, England, Frankreich und Österreich. Das Herrenhaus war irgendwann voll von Leos. Und als am Abend im Garten getanzt wurde, als die Cousins und Cousinen, die Onkel und Tanten zu den Klängen einer russischen Gitarrenband umherwirbelten, da dachte ich, wie schön es wäre, immer so viele zu sein.
Es ist nämlich so, dass wir hier in Berlin eine ziemlich kleine Familie sind. Außerdem streiten wir gerne und sind nachtragend, weshalb wir selten alle an einem Ort zusammenkommen. Familie ist für mich, wenn vier Menschen um einen Tisch sitzen. Die vielen anderen Leos waren immer fern, in der ganzen Welt verteilt. Manchmal kamen sie uns besuchen, aber sie blieben nie lange genug, um richtige Verwandte zu werden.
Als Kind habe ich Menschen mit großen Familien beneidet, alles schien mir so warm und selbstverständlich zu sein, wie ein Nest, aus dem man nicht herausfallen kann. Meine eigene Familie kam mir dagegen zerbrechlich vor. Meine Mutter erzählte manchmal von den anderen, von Nina und Hanan in Israel, von Ilse, Heinz und Susi in Wien, von André in London, Hilde in Chicago. Ich fragte, warum sie denn alle so weit weg wohnen. Meine Mutter sagte, früher habe unsere ganze Familie in Berlin gelebt, aber dann seien die Nazis gekommen und hätten alle vertrieben, die jüdisch oder kommunistisch waren. Vom Kommunismus hatte ich schon gehört, schließlich lebten wir in der DDR. Aber was waren Juden?
Meine Mutter erklärte, es klang kompliziert. Sie sagte, das Judentum sei eine Religion, unsere Familie sei zwar nicht religiös gewesen, aber trotzdem verfolgt worden. Ich erfuhr, dass auch ihr Vater Berlin verlassen musste, dass er in Frankreich zur Schule ging und mit sechzehn in der Résistance gegen die Nazis kämpfte. »Dein Großvater kam nach dem Krieg nach Berlin zurück, um den Sozialismus aufzubauen. Die anderen blieben in den Ländern, in die sie geflüchtet waren. Deshalb sind wir heute die Einzigen, die hier leben«, sagte meine Mutter. Ich weiß noch, dass ich damals sauer auf meinen Großvater war. Ich meine, warum musste ausgerechnet er den Sozialismus aufbauen? Ich hätte in London, Wien oder Paris leben können – statt in Berlin-Lichtenberg.
Wobei ich es natürlich auch ganz schick fand, so viele Verwandte in so vielen Ländern zu haben, man konnte andere Leute damit beeindrucken. Unsere in die Welt vertriebene Familie gab uns selbst etwas Weltläufiges. Ich erinnere mich an die Besuche von Ilse, die die gleichen sanften Augen wie mein Großvater hatte, einen schläfrigen Wiener Dialekt sprach und mir jedes Mal Mozartkugeln mitbrachte, was ich ihr bis heute hoch anrechne. André aus London brachte traditionell eine Familienpackung After Eight und mehrere Büchsen Earl-Grey-Tee von Twinings mit. Er trug fleckige, knittrige Hosen, hatte mehr Haare in den Ohren als auf dem Kopf und erzählte jüdische Witze, bei deren Pointe er sich meistens vor Lachen verschluckte.
Einmal brachte André auch seine Mutter Hilde mit, von der es in der Familie hieß, sie sei Millionärin. Es war einige Tage vor Weihnachten, als Hilde uns besuchen kam, und ich war sehr aufgeregt, weil ich noch nie eine Millionärin gesehen hatte. Außerdem hoffte ich natürlich auf ein Weihnachtsgeschenk. Hilde trug einen abgewetzten Mantel, dessen linke Tasche abgerissen war, auf ihrem Kopf saß eine viel zu große Wollmütze. Ich war überrascht, weil die Millionäre, die ich aus dem Fernsehen kannte, anders aussahen. Hilde eilte mit leuchtenden Augen auf meinen Bruder und mich zu. »Ich habe euch ein Geschenk mitgebracht«, rief sie. Dann holte Hilde eine Apfelsine aus ihrer Handtasche, überreichte sie uns mit feierlichem Ernst und mit der Mahnung verbunden, sie gerecht zu teilen.
An all das musste ich denken, als ich meine Familie in dem brandenburgischen Herrenhaus tanzen sah. Viele Jahre sind vergangen, Ilse und Hilde sind schon länger tot, wie auch mein Großvater und der Sozialismus, den er aufzubauen half. Heute kann ich selbst durch die Welt reisen und meine Familie besuchen, aber je näher ich meinen Leuten in der Ferne komme, desto mehr fehlen sie mir hier, zu Hause. Ich fühle mich wie ein Scheidungskind, das immer hofft, eines Tages könnten wieder alle zusammen sein.
Ich war übrigens nicht der Einzige, der an diesem Hochzeitsabend in sehnsüchtigen Gedanken versank. Andrés Sohn Andrew, der etwas jünger ist als ich, sagte irgendwann: »Warum mussten wir eigentlich hier weg? Wir hätten doch alle Berliner sein können.« Plötzlich begriff ich, dass nicht nur mir die Familie fehlt. Ja, dass es für die anderen vielleicht sogar noch schwieriger ist, weil sie so weit von dieser Stadt entfernt leben, aus der sie einst vertrieben wurden. Mein Cousin Amnon, ein Kardiologe und ehemaliger Kampfpilot aus Israel, sagte an diesem Abend, er sei überrascht gewesen, als er vor ein paar Jahren zum ersten Mal nach Berlin kam – und sich sofort heimisch fühlte. Mein Cousin Uri, ein Kinderpsychologe aus Jerusalem, genauso alt wie ich, erzählte, er habe die Berliner Leos immer beneidet. »Warum durftet ihr zu Hause bleiben? Warum müssen wir in diesem irren Land leben, in dem der Krieg nie aufhört?«
An diesem warmen Septemberabend wurde mir klar, wie tief die Sehnsucht der anderen nach ihrer verlorenen Heimat ist. Wie sehr sie die Nähe und Zugehörigkeit brauchen, Erinnerungen suchen. Ich begriff, warum unsere Verwandten aus Israel in letzter Zeit immer öfter nach Berlin kommen. Warum sie so stolz auf ihre deutschen Pässe sind, die sie sich in der Botschaft in Tel Aviv vor ein paar Jahren ausstellen ließen. Ich begriff, warum mein Onkel André letztes Jahr seine Londoner Familie in einen feuchten Keller in der Berliner General-Pape-Straße führte, wo sein Vater im März 1933 inhaftiert und gefoltert wurde. Warum mein Cousin Aron letzten Winter beschloss, zusammen mit seiner Verlobten aus Haifa nach Berlin zu kommen, hier zu studieren und schließlich sogar zu heiraten.
Die Geschichte meiner Familie scheint wie ein Pendel zu sein, das langsam zurückschwingt.
Wobei wohl jede Generation ihre eigene Geschwindigkeit hat. In Teilen der israelischen Familie sorgte die Hochzeit meines Cousins in Berlin für Entsetzen. »Nur gut, dass Hanan und Nina das nicht erleben mussten«, hieß es. Hanan und Nina flüchteten 1936 auf einem Schiff von Amsterdam nach Palästina. Sie waren die Begründer des mittlerweile riesigen israelischen Familienzweiges. Als Hanan und Nina noch in Berlin lebten, hießen sie Hans und Irmgard. Ihre Eltern hatten diese Namen mit Bedacht gewählt, sie sollten deutsch klingen, das war das Allerwichtigste. Irmgard war eine schöne, lustige Frau, die sich auf Fotos gerne als Hexe verkleidete. Sie studierte Jura an der Friedrich-Wilhelms-Universität, wo sie im ersten Studienjahr Hans kennenlernte. Im Oktober 1933 mussten die beiden die Universität verlassen, die deutschen Namen hatten nichts genutzt.
Ninas ältere Schwester Hilde war Schauspielerin, sie arbeitete mit Max Reinhardt am Deutschen Theater, bevor sie im Juni 1929 ihre Stimme verlor und ihren späteren Mann, den Nervenarzt Fritz Fränkel, kennenlernte, der sie nicht nur heilte, sondern kurz darauf auch heiratete. Fränkel, einer der Gründer der KPD, wurde am 21. März 1933 von der SA verhaftet und zwei Tage später nur unter der Bedingung wieder freigelassen, Deutschland umgehend zu verlassen. Am 25. März stieg das Paar mit ihrem zwei Jahre alten Sohn André am Bahnhof Zoo in den Expresszug nach Bern. Es ist der Beginn einer langen Flucht, die Hilde durch halb Europa führen wird.
Ilse, die älteste Schwester meines Großvaters, spielte Klavier, liebte die Malerei und wollte unbedingt Psychologie studieren. Im März 1933 verließ sie das Gymnasium, nachdem ihr Vater von der SA verhaftet und ins KZ Oranienburg gebracht worden war. Als der Vater wieder freikam, flüchtete die Familie nach Paris. Was hatten wir für eine schöne Kindheit, und dann war auf einmal alles vorbei und wir mußten sehr schnell erwachsen werden, schrieb Ilse später in ihr Tagebuch.
Ilse war 15, als sie Deutschland verlassen musste. Irmgard war 22 und Hilde 26. Sie wurden aus ihren Leben gerissen, mussten aufbrechen ins Ungewisse. Ich wollte wissen, wie die drei Frauen in Berlin gelebt haben, wovon sie geträumt haben, wie sie geflohen sind. Wie sahen ihre neuen Leben aus? Was haben sie ihren Kindern von der Vergangenheit erzählt? Und warum kommen jetzt auf einmal ihre Enkel nach Berlin zurück?
Ich bin auf den Spuren dieser drei Berlinerinnen gereist, habe auf Dachböden, in Kellern und Archiven nach Briefen, Dokumenten und Fotos gesucht, habe ihre Familien befragt. Je länger ich mich mit Ilse, Irmgard und Hilde beschäftige, desto mehr bedauere ich, dass ich mich nicht schon eher für ihre Geschichten interessiert habe. Zu der Zeit, als sie noch lebten, gab es so viele andere Dinge, die mir näher und wichtiger waren. Ich bin ihnen begegnet, aber wirklich gekannt habe ich sie nicht. Wie gerne würde ich sie heute alle noch mal treffen und ihnen die Fragen stellen, die ich mittlerweile habe.
Andererseits ist die Geschichte ja noch lange nicht zu Ende, weil wir noch da sind, ihre Kinder, Enkel und Urenkel, die gerade etwas Neues beginnen. Diese Familie, die mir oft wie ein historisches Wachsfigurenkabinett erschien, erwacht zu neuem Leben. Meine Töchter haben eine WhatsApp-Gruppe mit ihren Cousins und Cousinen gegründet. Sie sagen, in Israel seien gerade die gleichen Klamotten angesagt wie hier. Vor ein paar Wochen hat meine Cousine Charlotte aus London bei uns um die Ecke eine Wohnung gemietet. Sie ist nach Berlin gekommen, um Deutsch zu lernen. Seit dem Brexit sei es gut, noch eine zweite Heimatstadt zu haben, sagt sie. Und wie fühlt sie sich in Berlin? Charlotte überlegt und sagt lächelnd: »Im Grunde sind wir doch nur mal kurz weggewesen.«
Irmgard
Die erste Begegnung zwischen Irmgard und Hans wird in der Familie in Israel wie eine Heiligengeschichte erzählt. Bei größeren Familienfesten wird sie sogar als Krippenspiel aufgeführt. Jeder in der Familie kennt den Dialog auswendig, der sich Anfang Mai 1931, zu Beginn des Sommersemesters, im Foyer der Friedrich-Wilhelms-Universität Unter den Linden, zwischen den beiden Jurastudenten entsponnen haben soll. Irmgard war gerade frisch immatrikuliert und auf der Suche nach einer Versammlung der sozialistischen Studentenschaft. Im Foyer traf sie Hans, der ihr nicht nur den Weg zum Ort der Versammlung wies, sondern sie auch gleich dahin begleitete, um sie später zu einer Tasse Kaffee einzuladen, woraufhin die Dinge unweigerlich ihren Lauf nahmen.
Irmgard und Hans, 1932 in Berlin
Irmgard war 19, hatte dichte schwarze Haare, verträumte braune Augen und einen Mund, der in der Familie völlig zu Recht als sinnlich gepriesen wird. Es gibt ein Foto, das ein paar Monate nach ihrem ersten Treffen aufgenommen wurde, es zeigt das junge Liebespaar auf einer Wandertour durch Brandenburg. Irmgard trägt ein helles Sommerkleid mit weißem Spitzenkragen. Sie wirkt kräftig, drall und voller Energie. Neben ihr läuft Hans, ein schmaler, zerbrechlich wirkender Junge in Knickerbockerhosen. Der Legende nach war es Irmgard, die irgendwann Hans an ihre sinnlichen Lippen zog, weil er selbst zu schüchtern war. Im israelischen Krippenspiel heißt es am Ende stets: »Und so lernten sie sich kennen und lieben und gründeten unsere große, schöne Familie.«
Mein Cousin Aron kennt diese Geschichte, seit er denken kann. Diese Fabel aus dem fernen Berlin ist der Gründungsmythos, mit dem alles begann. An einem Tag im Frühjahr 2017 steht er nun zum ersten Mal selbst in dem mächtigen Foyer der Universität. Er betrachtet die mit braunem Marmor verkleideten Säulen und Paneele, die wuchtige Treppe, die sich zu den Ballustraden emporwindet. Aron sagt, er habe sich die Universität anders vorgestellt, leichter, luftiger, heller.
Aron wohnt seit mehr als einem Jahr in Berlin, er ist 22 und bereitet sich gerade auf die deutsche Hochschulzugangsprüfung vor. Dann will er Veterinärmedizin studieren, und es könnte passieren, dass er bald an eben die Universität zurückkehrt, die seine Großeltern vor 80 Jahren verlassen mussten. Ist er ein historischer Wiedergänger? Aron lächelt verlegen, er sagt, er habe kaum Erinnerungen an die Großeltern, die starben, als er noch sehr klein war. Ihre Geschichte erscheint ihm wie eine dunkle, verschlossene Box, die irgendwo steht, wo keiner sie finden muss. Manchmal wurde diese Box ein wenig geöffnet, dann ging ein beklommener Schauer durch die Familie. Aron sagt, er habe dieses Gefühl nie gemocht. Diese leise Verunsicherung, diesen trüben Schatten, diese kaum wahrzunehmende Traurigkeit in den Augen seiner Mutter. Es war etwas Unausgesprochenes, Bedrohliches, das er schnell wieder vergessen wollte.
»Ich bin nicht nach Berlin gekommen, um diese Box zu öffnen«, sagt er mit einer Vehemenz, die ihn selbst zu überraschen scheint. Es sei ihm eigentlich um viel praktischere Dinge gegangen. Er erzählt, wie schwer es in Israel sei, einen Studienplatz als Veterinärmediziner zu bekommen. Er spricht von seinem deutschen Pass, der ihm hier die Türen öffnet. Er sagt, wie wunderbar es sei, ein bisschen Ruhe vor Israel zu haben, einzutauchen in die Berliner Leichtigkeit. »Ich fühle mich hier nicht als Deutscher, aber auch nicht als Fremder. Ich kann einfach ich selbst sein.«
Wir gehen an den Rand des Foyers, dahin, wo früher das Schwarze Brett der studentischen Korporationen und politischen Gruppen hingen. Hier müssen sich Irmgard und Hans begegnet sein. In der Familie wird erzählt, Hans habe Irmgard gleich bei ihrer ersten Verabredung zu einer Demonstration mitgenommen. Hans ist zu dieser Zeit bereits glühender Sozialist, Irmgard interessiert sich nicht besonders für Politik, aber sie interessiert sich für Hans und hört ihm gebannt zu, wenn er vom Kapitalismus und der Ausbeutung der Arbeiterklasse spricht.
Hans ist ein Charlottenburger Notarssohn, er hat mit der Arbeiterklasse genauso wenig zu tun wie Irmgard, deren Mutter aus einer vermögenden Danziger Kaufmannsfamilie stammt. Wobei Irmgard schon als Kind die Armut kennenlernt, als das komplette Vermögen der Mutter in der großen Inflation von 1919 innerhalb von Monaten verschwindet. Der Vater starb im Ersten Weltkrieg an der russischen Front, und so muss die Familie von der kleinen Witwenrente und den Almosen der Verwandten leben. Irmgard wächst in evangelischen Mädcheninternaten auf, sie stopft ihre Kleider selbst und hat nur ein Paar Schuhe für das ganze Jahr. Aber das sei nicht wichtig, erklärt sie Hans, weil letztlich nur die Bildung und der Wille zählten. Und wenn sie in ein paar Jahren eine fertig studierte Juristin sei, dann werde sie auch gutes Geld verdienen, und ihre Kinder müssten nie selbst Kleider stopfen.
»Oder du heiratest einen Juristen und lässt ihn das Geld verdienen«, sagt Hans lächelnd. Irmgard wirft ihm einen wütenden Blick zu und sagt, sie wolle von keinem Mann abhängig sein. Zum Glück wechselt Hans in diesem Moment geschickt das Thema, weil sie sich sonst wohl schon bei ihrer ersten Verabredung gestritten hätten. Wobei es Irmgard nicht um prinzipielle Geschlechterfragen geht, sie betrachtet das alles eher pragmatisch: Sie hat gesehen, wie hilflos ihre Mutter war, als der Vater an der Front fiel, und sie fragt sich, warum denn eine Frau nicht für sich selbst sorgen kann. »Wenn du eine Prinzessin suchst, die dich bewundert, dann bist du bei mir falsch«, sagt sie zu Hans. Und der ist sprachlos und überwältigt von dieser energischen, schönen Frau, die so genau zu wissen scheint, was sie will.
Später reihen sie sich in den Demonstrationszug ein, der Richtung Universität marschiert. Die meisten der Demonstranten sind Studenten, sie tragen rote Fahnen und singen revolutionäre Arbeiterlieder. In der Universitätsstraße treffen sie auf eine Horde vom Nationalsozialistischen Studentenbund. Die Nazistudenten sind zwar zahlenmäßig unterlegen, aber sie greifen mit Gürteln, Totschlägern und Stöcken an. Hans nimmt Irmgards Hand und zieht sie aus der Menge. Er rennt mit ihr in einen Hauseingang, dann weiter in einen Hof. Sie verstecken sich hinter den Mülltonnen, dort kauern sie, schwer atmend. Irgendwann fängt Irmgard an zu kichern, sie fragt Hans, ob seine Verabredungen mit Frauen immer so laufen. Nun muss auch Hans lachen.
Hans wird später sagen, ihm sei schon in diesem Moment klar gewesen, dass sie die Frau seines Lebens ist. Irmgard dagegen wird noch lange brauchen, um sich für ihn zu entscheiden. Ihren Töchtern erklärt sie später einmal, sie hätte kein Problem damit gehabt, alleine zu leben, wenn sie nicht den richtigen Mann gefunden hätte. In der Familie wird Irmgard als warme, großzügige, aber auch sehr eigenwillige Frau beschrieben. Sie tut nichts, nur weil andere es auch tun, sie hört auf ihr Herz, sie vertraut ihren Instinkten. Und die sagten ihr damals wohl, dass sie erst einmal auf eigenen Füßen stehen muss, bevor sie sich bindet.
Auch störrisch ist sie, hält an Ideen und Prinzipien fest, die ihr wichtig sind. Eines dieser Prinzipien ist es offenbar, an allem erst einmal zu zweifeln. Als Hans ihr nach ein paar Wochen seine Liebe gesteht, schaut sie ihn prüfend an und sagt: »Beweise es.« Der arme Hans ist davon so verunsichert, dass er einen Freund um Rat bittet, der ebenfalls an der juristischen Fakultät studiert und Irmgard ein wenig kennt. Der Freund sagt, es sei sicher nicht einfach, mit einer solchen Frau zu leben, aber dafür werde es Hans nie langweilig sein.
Der Sommer, in dem Irmgard und Hans zusammen durch Brandenburg wandern, muss für beide eine wichtige Zeit gewesen sein. Sie laufen querfeldein durch Wälder und Felder, übernachten in Scheunen oder Schafställen, trinken morgens die warme Milch, die der Bauer ihnen bringt. Irmgard erzählt Hans Geschichten, die von zwei Mädchen handeln, die aus einem Pensionat fliehen, eine Bank überfallen und gemeinsam mit anderen Mädchen eine große Räuberbande gründen. Hans fragt, wo sie denn diese unglaubliche Geschichte herhabe. »Na, die habe ich mir gerade ausgedacht«, sagt sie lachend, und dann schaut sie ihn besorgt an, wie einen bedauernswerten Jungen, der offenbar Probleme damit hat, die einfachsten Sachen zu verstehen.
Sie ist frech und schlagfertig und vermutlich auch unglaublich anstrengend, aber je mehr sie Hans herausfordert, je öfter sie ihn piesackt, desto stärker fühlt er sich zu ihr hingezogen. Irgendwann reden sie über die politische Situation und den Aufstieg der Nazis, und Hans sagt, er komme aus einer jüdischen Familie. Irmgard lässt sich ausführlich das Judentum erklären, stellt viele Fragen, die darauf schließen lassen, dass sie von alldem zum ersten Mal hört. Wusste sie damals gar nicht, dass sie selbst aus einer jüdischen Familie stammt?
Irmgard ist evangelisch getauft, die Familie ist nicht religiös, sie selbst begreift sich wahrscheinlich gar nicht als Jüdin. Das klingt zumindest aus einem Lebenslauf heraus, den sie Jahre später im französischen Exil schreiben wird: Ich wurde nicht jüdisch erzogen, weder im Glauben noch in der Tradition. Ich wußte lange gar nicht, was es bedeutet, ein Jude zu sein. Aber immer wieder war es so, daß die anderen es besser wußten. Ob an den Tanzabenden, wo niemand mich auffordern wollte, obwohl ich doch nicht gar so häßlich bin. Oder an den Geburtstagen, zu denen ich nicht eingeladen wurde. Später in Berlin, auch da gab es diese Blicke, diese Ablehnung, die manchmal deutlich und dann wieder kaum zu spüren war.
Woran haben die anderen sie erkannt? Lag es an ihrem Familiennamen? Oder an ihrem Aussehen? An ihren dunklen Haaren und Augen, am matten Teint ihrer Haut? Es gibt ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihrer Schwester Hilde zu sehen ist. Hilde hat blonde geflochtene Zöpfe, Irmgard trägt eine schwarze Schleife im ebenholzfarbenen Haar. Nichts deutet darauf hin, dass die beiden Geschwister sind. Hat Hilde es leichter gehabt, unerkannt zu bleiben? Und was ist mit Hans? Auch er sah nicht besonders jüdisch aus und lebte ohne religiöse Traditionen. Hans erzählte seinen Kindern viele Jahrzehnte später, es habe in Berlin Leute gegeben, »die uns gerochen haben«.
Vielleicht lag es an der Stimmung, die zu dieser Zeit in Berlin herrschte. An der Radikalisierung der politischen Kräfte, der Anspannung, die immer größer wurde und nach Entladung suchte. Die Universität muss wie eine Arena gewesen sein, in der diese Kräfte ungebremst aufeinanderprallten. Denn die Schlägereien zwischen Sozialisten und Nazis fanden nicht nur draußen in den Straßen statt, auch im Foyer der Universität stürzte man sich aufeinander. Auf der einen Seite des Foyers standen die Roten, auf der anderen Seite die Braunen, es kam immer wieder zu Handgemengen und blutigen Schlägereien. Mehrmals musste die Polizei die Universität räumen, die dann für Tage geschlossen blieb. So gesehen erscheint dieses erste Treffen von Irmgard und Hans am Schwarzen Brett der sozialistischen Studentenschaft in einem weniger romantischen Licht. Wie viel Zeit blieb ihnen für ihre Liebe? Wie beschäftigt waren sie mit all dem, was um sie herum geschah?
Hans muss die Gefahr deutlich und früh gespürt haben. Seinen Kindern erzählte er später von der Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz, von den Flammen, die in der Nacht des 10. Mai 1933 die Fassade der Universität erleuchteten. Er beschrieb die johlende Menge auf dem Platz, die Studenten in den braunen Uniformen, die auf Lastwagen standen und die »undeutschen Bücher« aus der Universitätsbibliothek stapelweise ins Feuer warfen. Hans erzählte, es habe in dieser Nacht stark geregnet und die Bücher hätten nicht brennen wollen, weshalb die Feuerwehr mit Benzinkanistern helfen musste, um Marx und Heine und Kästner und all die anderen zu vernichten. Um die riesige Feuerstelle standen Professoren in schwarzen Talaren, die mit erhitzten Gesichtern und glänzenden Augen den brennenden Papierfetzen nachblickten, die in den dunklen Himmel flogen. »Ich habe es nicht gleich verstanden, aber gefühlt habe ich es schon, dass unsere Zeit in Berlin dem Ende zugeht«, sagte Hans. »So viel Hass war da, so viel Wut, so viel Freude an der Vernichtung, das konnte nicht ohne Folgen bleiben.«
Ich gehe zusammen mit Aron zu dem Platz gegenüber der Universität, der heute Bebelplatz heißt. Aron blickt durch die Glasplatte, die in den Boden eingelassen ist, an der Stelle, an der damals das Feuer brannte. Unter der Glasplatte ist ein dunkler Raum mit leeren Bücherregalen zu sehen. Ich denke an die Box, von der Aron gesprochen hat. Diese Box, die er am liebsten verschlossen halten möchte. Aron steht lange schweigend da. Ich frage mich, ob es ein Fehler war, ihn hierherzubringen. Warum konfrontiere ich ihn mit etwas, das er gar nicht sehen will? Warum verscheuche ich die Berliner Leichtigkeit, die er gerade genießt? Aron scheint meine Gedanken zu erraten. Er sagt, er habe vor Kurzem mit seinem Vater telefoniert, dabei habe er ein paar Sätze auf Deutsch gesagt, was für den Vater nicht einfach zu ertragen gewesen sei. Die Sprache der verhassten Mörder aus dem Mund seines geliebten Jungen. »Er hat dann gesagt, ich soll ruhig weiter mit ihm Deutsch sprechen, es sei eine gute Therapie.«
Als wir den Bebelplatz verlassen, sagt Aron, es falle ihm hier leichter als in Israel, sich mit der Geschichte der Familie zu beschäftigen. In Israel fühle er sich beobachtet, beurteilt, verpflichtet. Geschichte sei dort nichts, was hinter einem liege, sie habe eine Moral, sie weise Aufgaben zu. »Wir leben dort nicht, wir haben eine Mission, verstehst du?« Er sagt, in der Familie sei es immer darum gegangen, einen wertvollen Beitrag für das Land zu leisten. Weglaufen gilt nicht.
Und dann ist er doch weggelaufen, direkt nach Berlin. In diese Stadt, in der er sich so beschwingt fühlt, weil ihn die Vergangenheit hier weniger belastet als die Zukunft in Tel Aviv.
Als Irmgard und Hans von der Universität geworfen wurden, brach ihr Leben entzwei. Sie waren 21 Jahre alt und hatten plötzlich keine Zukunft mehr. Vor allem für Irmgard muss es schwer gewesen sein, ihren Traum vom selbstbestimmten Leben einer gut ausgebildeten Juristin so schnell aufzugeben. Wie es eigentlich zu der Exmatrikulation kam und warum sie beide so früh ausgeschlossen wurden, während andere jüdische Studenten noch Jahre an der Juristischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität bleiben durften, darüber haben sie selbst nie etwas erzählt. Deshalb fahre ich an einem windigen Herbsttag zum Archiv der heutigen Humboldt-Universität, ein nüchterner Flachbau in einem Niemandsland aus Brachflächen und vergessenen Industriegebäuden in Berlin-Adlershof. Die Archivarin blättert in dicken Findbüchern, verschwindet lange im Magazin und legt schließlich zwei Dokumente vor mich auf den Tisch. Es sind die von Irmgard und Hans ausgefüllten Immatrikulationskarten.
Irmgards Karte ist rosafarben, die von Hans ist weiß. Irmgard hat eine rundliche Mädchenhandschrift, Hans schreibt raumgreifend, mit großen Schwüngen. Es ist ein seltsames Gefühl, diese Karten in den Händen zu halten, mit den Fingern über das raue Papier zu streichen und mir vorzustellen, dass vor mehr als 80 Jahren die Finger der beiden über dieses Papier geglitten sind. Hans hat sich am 16. April 1930 eingeschrieben, wohnt zu der Zeit in der Innsbrucker Straße 54 in Berlin-Schöneberg. In der Spalte Religion hat er einen Strich gemacht. Der Beruf des Vaters: Rechtsanwalt und Notar. Auf Irmgards Karte ist eine Adresse in Zehlendorf vermerkt, Johannesstraße 13. Ich spüre, wie mir erst jetzt wirklich klar wird, dass die beiden in dieser Stadt gelebt haben, dass sie Berliner waren wie ich. Keine Ahnung, warum ich diese Beweise brauche, aber wahrscheinlich ist es manchmal so, dass zwei Karteikarten überzeugender sind, als eine immer nur von anderen gehörte Geschichte.
Irmgard immatrikulierte sich am 17. April 1931. Ich finde ihr vergilbtes Studienbuch, in dem Seite für Seite die Kurse aufgelistet sind, die sie in den ersten Semestern belegte. Strafrecht für Anfänger, BGB, Zivilrecht. Unten auf den Seiten kleben die Gebührenmarken, die mit dem preußischen Adler abgestempelt sind. Es ist vermerkt, dass Irmgard von den Gebühren befreit ist, was vermutlich damit zusammenhängt, dass ihr Vater im Ersten Weltkrieg in Ostpreußen fiel. Bis zum Sommersemester 1932 belegt Irmgard regelmäßig ihre Kurse, aber bereits mit Beginn des Wintersemesters bleiben die Seiten des Studienbuches leer. »Beurlaubt« ist auf die Seite gestempelt. Auch die nächste Seite, die des Sommersemesters 1933, ist leer und mit einem Urlaubsstempel versehen. Auf der Rückseite klebt ein maschinengeschriebener Vermerk: Inhaber wurde nach Ministerialerlaß vom 16.6.1933 am 3.10.1933 vom Studium an der Universität Berlin ausgeschlossen, weil er sich im marxistischen Sinne betätigt hat.
Das heißt, Irmgard wurde gar nicht exmatrikuliert, weil sie Jüdin war, sondern weil man sie offenbar für eine Marxistin hielt. Ich finde den Ministerialerlass später in den Akten der Juristischen Fakultät. Gelbliches maschinenbeschriebenes Papier. Der Erlass dient der Ausführung des »Gesetzes gegen die Überfüllung der Deutschen Schulen und Hochschulen«. Es sieht vor, die Zahl der Studierenden nichtarischer Abstammung in einer jeden Fakultät auf 5 v.H. zu begrenzen. Die überzähligen Studenten nichtarischer Herkunft sind unverzüglich vom weiteren Studium auszuschließen, sofern die Gebühren von ihnen noch nicht gezahlt wurden. So ist das deutsche Ministerialwesen im Frühsommer 1933, es schreckt nicht davor zurück, Tausende jüdische Studenten zu diskriminieren, aber eine bezahlte Gebühr bleibt dann doch etwas sehr Bedeutendes.
Dieser Erlass kommt einer Zulassungssperre für Juden gleich, weil in kaum einer Fakultät weniger als fünf Prozent der Studenten jüdischer Abstammung sind. Zudem werden alle Studenten und Hochschullehrer angewiesen, einen Fragebogen auszufüllen, der über ihre Abstammung Auskunft gibt. Falsche Angaben führen zu sofortigem Ausschluß von der Hochschule. Ich blättere weiter in dem Erlass, er hat viele Seiten, ich blättere schneller, Staub wirbelt aus der Akte auf, juckt in meinen Augen. Dann finde ich die Verordnung, die Irmgard betrifft, sie stammt vom 9. August 1933. Der Minister weist an, daß alle Studierenden an preußischen Hochschulen, die sich in den letzten Jahren nachweislich in marxistischem (kommunistischem oder sozialdemokratischem) oder sonst antinationalem Sinne aktiv betätigt haben, mit sofortiger Wirkung von dem Universitätsstudium auszuschließen sind. Irmgard muss Mitglied der sozialistischen Studentenschaft gewesen sein, sonst wäre sie nicht so schnell ausgeschlossen worden.
Ich finde in den Papieren des Senats der Universität eine blaue Aktenmappe. Auf dem Deckblatt steht in säuberlicher Sütterlinschrift: »Liste der auf Grund antinationaler Gesinnung von der Hochschule ausgeschlossenen Studenten. Stand 1933«. 124 Namen sind in dieser Aktenmappe alphabetisch aufgeführt. Auf Seite 11 finde ich den Eintrag: Irmgard Leo, 29.8.11, marx. Berlin.
Diese eine Zeile hat Irmgards Leben auf den Kopf gestellt, hat aus einer hoffnungsvollen Jurastudentin eine Ausgestoßene gemacht. Seltsamerweise steht Hans nicht auf der Liste. Auf seiner Immatrikulationskarte ist als Abgangsdatum der 23. Juli 1933 vermerkt. Ist er von sich aus gegangen? Ist er der Ahnung gefolgt, die ihn schon im Mai bei der Verbrennung der Bücher auf dem Opernplatz beschlichen hatte? In den Sitzungsprotokollen der Juristischen Fakultät finde ich eine Meldung darüber, dass am 16. Juni 1933 »die Fragebögen zur rassischen Abstammung der Studierenden« ausgegeben wurden. Vielleicht war das für Hans das Signal zum Gehen.
Später finde ich noch eine in schwarzen Karton gebundene Aktenmappe im Universitätsarchiv. Auch diese Mappe ist sorgfältig mit Tinte beschriftet: »Aufstellung von Nichtariern 1933«. Auf der ersten Seite prangt ein rotes Hakenkreuz. Diese Liste ist nicht so sauber geführt wie die der marxistischen Staatsfeinde. Hier sind einige Namen durchgestrichen, andere wurden handschriftlich ergänzt. Es ist vermerkt, dass eine Kopie der Liste an das Ministerium geht, eine andere an das Reichssicherheitshauptamt in die Prinz-Albrecht-Straße. Es sind nur die Studenten der juristischen Fakultät, die Liste ist lang, Hunderte Namen. Wie viele dieser Studenten konnten fliehen? Wie viele wurden später umgebracht, weil sie auf dieser Liste standen?
Irmgards Name steht auf Seite 10, zwischen einem Fritz Levinsohn und einem Karl-Heinz Leipziger. Wollte man dokumentieren, wie groß das Bedürfnis der jüdischen Bildungselite in dieser Zeit war, die eigenen Wurzeln zu vergessen und so deutsch zu werden, wie es eben ging, dann müsste man eigentlich nur diese traurige, in schwarzen Karton gebundene Liste zeigen, auf der fast alle Studenten typische deutsche Vornamen tragen, während die Nachnamen ach so jüdisch klingen.
Ich verlasse das Universitätsarchiv, fahre zurück nach Hause, durch das kalte, dunkle Berlin, das mir an diesem Abend noch kälter und dunkler erscheint. Es ist schwer, die Bilder loszuwerden, die aus den verstaubten Akten aufgestiegen sind. Noch schwerer ist es, dieses vergangene Berlin mit dem heutigen zusammenzubringen.
Ein paar Wochen nachdem ich zusammen mit Aron durch die Universität gelaufen bin, heiratet er in Berlin. Die Trauung findet im Standesamt Charlottenburg-Wilmersdorf statt, einer weißen Stadtvilla mit verschnörkelten Säulen. Aron sitzt mit Noam, seiner Braut aus Tel Aviv, in einem Erkerzimmer mit schweren Vorhängen, über ihnen glimmt ein Kronleuchter. Die Standesbeamtin sagt, man befinde sich hier im Trauzimmer, weil man sich für eine Hochzeit ja auch trauen müsse. Arons Deutsch ist für solche Wortspiele noch nicht gut genug. Auch sonst versteht er nicht besonders viel von dem, was gesprochen wird. An den wichtigen Stellen übersetzt eine Dolmetscherin. Es geht um Feinheiten des Namensrechts, die internationale Geltung eines deutschen Ehefähigkeitszeugnisses und die Unterscheidung von Wohn- und Aufenthaltsort. Die Stimmung ist ähnlich feierlich wie bei der Ummeldung eines Autokennzeichens. Aron und Noam scheint das nicht zu stören, sie sagen im richtigen Moment »Ja« und geben sich einen flüchtigen Kuss. Später frage ich Aron, ob seine Hochzeit hier ihm nicht zu seltsam und fremd erscheint. Aron antwortet, in Israel hätten sie zu einem Rabbi gehen müssen, um zu heiraten. Sie hätten Gebete auswendig lernen müssen, obwohl sie nicht gläubig seien. »Das wäre seltsam gewesen«, sagt Aron.
Am Abend der Hochzeit gibt es eine Feier in einem italienischen Restaurant. Arons Mutter hält eine Rede, sie erinnert an ihre Mutter Irmgard, die bereits Nina hieß, als ihre Kinder geboren wurden: »Heute Abend schließt sich ein Kreis. Und auch wenn es traurig für mich ist, dass mein Junge nun so weit weg von uns lebt, bin ich doch froh, dass er Berlin gewählt hat, diese Stadt, die für uns alle ein Zuhause geblieben ist.« Arons Mutter weint, die Familie klatscht, auf einmal scheint auch Aron sehr ergriffen zu sein. Er blickt mit großen, fragenden Augen in die Gesichter seiner jubelnden Familie. Womöglich begreift er erst jetzt, welche Bedeutung seine Rückkehr für alle anderen hat.
Ich versuche mir vorzustellen, was es wohl für Irmgard bedeutet hätte, wenn sie an diesem Abend in Berlin dabei gewesen wäre. Ob bei ihr die Wehmut oder die Freude überwogen hätte. Ich vermute, dieses Bild vom sich schließenden Kreis hätte sie so nicht gewählt, weil es ja bedeutet, dass eine Geschichte ihren natürlichen Endpunkt erreicht. Für Irmgard war dieser Endpunkt vermutlich schon vor langer Zeit erreicht, als sie mit ihrer Familie in Israel Ruhe und Zufriedenheit fand. Den Luxus der Nostalgie konnten sich erst ihre Kinder leisten. Und dann brauchte es wohl noch eine weitere Generation, um noch nicht mal mehr nostalgisch zu werden, sondern einfach nur Veterinärmedizin studieren zu wollen, in einem Land, in dem es keinen Krieg gibt.
Aber zurück in die Zeit, als Irmgard selbst noch jünger war, als ihr Enkel Aron es heute ist. In die Zeit, in der auf einmal alles zu Ende schien. Was tat Irmgard, nachdem sie die Universität verlassen musste? Wie verbrachte sie ihre Tage? Wovon lebte sie? Hatte sie irgendeine Idee, was nun kommen würde? Ihre Kinder sagen, sie habe nie über diese Zeit sprechen wollen. Sie habe immer nur gesagt, es sei schwierig gewesen, sie habe sich gefragt, ob das Leben überhaupt noch etwas für sie bereithalte. Irmgard war ehrgeizig und zielstrebig, sie hatte immer einen Plan, steckte voller Energie und Ideen. Auch deshalb war diese unsichere Zeit für sie möglicherweise die schlimmste überhaupt.
Es gibt keine Spuren von ihr aus diesen Wochen und Monaten, niemand aus der Familie weiß etwas über diese Zeit. Ein paar Antworten finde ich erst, als ich einen Monat später nach Israel fahre. Ich besuche Michal, Irmgards jüngste Tochter. Michal wohnt in Hazor, einer kleinen Stadt am Fuße der Golanhöhen, nicht weit von dem Kibbuz entfernt, in dem Irmgard den größten Teil ihres Lebens verbrachte, umgeben von dunklen Bergketten, grünen Avocadohainen und der rötlichen aufgebrochenen Erde der bestellten Felder.
Michal ist eine zierliche Frau mit einer rauen, warmen Stimme. Sie erzählt, wir trinken Tee mit Zitronengras, das auf ihrer Terrasse wächst. Dann führt Michal mich zu einem alten Kleiderschrank, in dem Kisten, Beutel und Dosen übereinandergestapelt sind. »Ninas Sachen«, sagt sie. »Auch aus der Zeit, als sie noch Irmgard hieß.«
Vorsichtig öffne ich die erste Kiste, ich sehe Briefe, Dokumente, alte Zeitungen und Fotos. Irmgard scheint so ziemlich alles mitgenommen zu haben, als sie im Juli 1936 das Schiff in Triest bestieg, das sie nach Palästina brachte. Ich finde ihre Zeugnisse aus der Grundschule, verschiedenfarbige Impfscheine, die bestätigen, dass Irmgard Leo gegen Pocken und Diphtherie immunisiert wurde. Ich finde ein dickes Buch mit dem Titel »Im Hasenwunderland«, das von den Jungen Hansel und Franzel handelt, die in einem Dorf in Bayern Abenteuer erleben. Im Einband des Buches steht in ungelenker Kinderschrift geschrieben: Irmgard Leo 1918.
In einem gelben Umschlag steckt Irmgards Taufbescheinigung, ausgestellt am 21. November 1911 im schlesischen Muskau, wo ihr Vater Erich als Geschichtslehrer am örtlichen Lyzeum arbeitete. Ein Pastor Neitsch bestätigt die Echtheit der Taufpapiere und weist auf den »mosaischen Hintergrund« beider Elternteile hin, »die aber selbst schon vor Längerem den Weg zu Gott gefunden haben«. In dem Umschlag ist auch die Konfirmationsurkunde, geschmückt von einer Kalligrafie, die Jesus bei der Segnung einer blonden Jungfrau zeigt.
In einer Kiste finde ich etliche Papiere, die Irmgards Leben nach dem Abgang von der Universität erzählen. Es gibt da zum Beispiel eine Bescheinigung der Deutschen Buchhändlerlehranstalt in Leipzig, in der bestätigt wird, dass Irmgard sich dort am 16. August 1933 zum Studium einschrieb, die Lehranstalt allerdings bereits am 30. September wieder verließ. Irmgard Leo muß ihr berufliches Studium als Buchhändlerin infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten aufgeben, um in den Broterwerb überzugehen. Ihr Verhalten war ohne jeden Tadel, heißt es in der Bescheinigung.
Wie kam sie vom Jurastudium zur Buchhändlerlehre? Und warum warf sie nach nur sechs Wochen alles hin? Möglicherweise hatte ihre Entscheidung mit Hans zu tun, der kurz zuvor nach Amsterdam aufgebrochen war. In einer der Kisten in Hazor liegt ein Brief, in dem Hans sein Weggehen ankündigt. Auf der Rückseite des Briefes steht Irmgards kurze Antwort: »Warum fragst du mich eigentlich nicht, ob ich mitkommen will? Was soll mich denn hier noch halten? Mehr Hilfe als in der Fremde kann ich auch in Berlin nicht erwarten.« Das klingt traurig und ernüchtert, aber es klingt auch so, als habe Irmgard in ihrem Herzen eine doppelte Entscheidung getroffen. Für Hans. Gegen Berlin.
Irmgard schlägt sich nach ihrer Rückkehr aus Leipzig noch ein paar Monate mit kleinen Anstellungen durch. Sie findet in der Zeitung eine Annonce, ein blinder Mann aus Berlin-Schöneberg sucht jemanden, der ihn gelegentlich durch die Stadt führt. Der Mann ist alt und riecht schlecht. Wenn sie unterwegs sind, hakt er sich bei Irmgard unter, und sie muss ihm zuflüstern, was sie alles sieht. Der Mann interessiert sich besonders für Autos. Wenn ein Auto an ihnen vorbeifährt, muss sie sagen, um welches Fabrikat es sich handelt, welche Farbe es hat und ob es ordentlich gewaschen ist. Irmgard kennt sich mit Autos nicht besonders aus, der Mann schreit, dass sie eine dumme Göre sei und doch ihre Augen benutzen solle, dass man sich frage, wozu sie überhaupt Augen im Kopf habe. Nach ein paar Touren kann Irmgard nicht mehr. Sie denkt, dass es nun wirklich Zeit ist, zu gehen.
Zwei Tage später besteigt Irmgard am Anhalter Bahnhof einen Zug nach Köln, von dort wird sie zu ihrer Schwester nach Paris weiterreisen. Sogar das Zugticket hat sie aufbewahrt, ein Stück blassgrüne Pappe, das zum Aufenthalt in der zweiten Klasse berechtigt. Bei sich trägt Irmgard einen Brief, den ihr die Mutter vor der Abreise zugesteckt hat. Es sind deren Lieblingsverse aus der Bibel, in altdeutscher Schrift auf Büttenpapier. Diese Sprüche waren mir in manchen schweren Stunden Trost und Stütze, schreibt die Mutter. Behüt dich Gott, mein geliebtes Kind, möchte das Schicksal gut machen, was ich, ohne es zu wissen, falsch gemacht habe. Das ist mein heißester Wunsch. Einen Kuß von Mutti.
Das sind die letzten Worte einer Mutter, die nicht weiß, ob sie ihr Kind je wiedersehen wird. Was sie wohl meint, falsch gemacht zu haben? Auf jeden Fall ist Irmgards Mutter Katerina von nun an allein. Die Töchter leben zu dieser Zeit bereits in Paris. Irmgards Bruder Fritz, ein praktischer Arzt, ist wenige Wochen zuvor wegen kommunistischer Untergrundarbeit verhaftet worden. Deshalb will die Mutter Deutschland nicht verlassen, sie will in der Nähe sein, falls ihr Sohn Hilfe braucht. Die Kinder können gehen, wohin sie wollen, die Eltern bleiben da, wo sie vonnöten sind, schreibt sie später an Irmgard, die sie anfleht, aus Deutschland zu fliehen, solange es noch möglich ist.
Einer der Bibelverse, den Irmgard von ihrer Mutter mit auf den Weg bekommt, lautet:
Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt,
der bleibt in Gott. Und Gott in ihm.
Hilde
Auf Fotos sieht Hilde selten zufrieden aus. Meistens hat sie die Lippen zu einer Art Schmollmund zusammengepresst. Mit Mitte 20 trägt sie die Haare kurz und gescheitelt, sie mag Hosenanzüge, wirkt spröde, androgyn, ein wenig dramatisch, auf jeden Fall interessant. Hildes Leben erscheint von Anfang an weniger geordnet und glatt als das ihrer Schwester Irmgard. Sie verlässt die Schule ohne Abitur, weil ihre Leistungen, vor allem in Mathematik, hoffnungslos schlecht sind. Sie hat, so erklärt sie ihrer Mutter, keine Lust auf Arithmetik und irgendwelche Naturgesetze. Hilde will Schauspielerin werden, am liebsten in einem Kabarett. Sie bewundert Marlene Dietrich, die mit schwarzem Zylinder, Frack und Zigarettenspitze verruchte Lieder singt. Hilde mag die grelle Theaterwelt, weil sie so anders ist als das, was sie kennt.
Hilde, 1929
Foto: © Atelier Joël-Heinzelmann, Berlin-Charlottenburg
Hildes Mutter, zwar verarmt, aber aus gutem Hause und mit einer klaren Vorstellung davon, was sich für eine junge Dame gehört, lässt Hilde eine Ausbildung zur Säuglingskrankenschwester im Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin-Schöneberg absolvieren. »Wenn du akademisch nicht interessiert bist, dann bleibt dir nur, einen ordentlichen Beruf zu erlernen, der den Menschen von Nutzen ist«, lässt die Mutter ihre Tochter wissen. Eine größere Bestrafung hätte es für Hilde wohl nicht geben können, sie findet Kleinkinder furchtbar, beim Anblick von Blut wird ihr schlecht.
Hilde folgt den Weisungen der Mutter, zieht ins Schwesternpensionat, beschließt dort jedoch recht bald, ihre Ausbildung selbst in die Hand zu nehmen. Nachts steigt sie aus dem Fenster im zweiten Stock, klettert auf einem Mauersims bis zur Regenrinne, die sie hinunterrutscht. So heimlich wie sie das Pensionat verlässt, geht sie anschließend ins Theater. Hilde schmuggelt sich durch Bühneneingänge und Schauspielerkantinen, sie kennt irgendwann die Garderobengänge und Kulissenräume, den Kleiderfundus und den Schnürboden. Sie taucht ein in die wilde, aufregende Stadt, die nach Alkohol, Parfüm und Ruhm duftet. Sie taucht ein in die schummrige Welt der Künstler und Komparsen, der Magier, Tänzer und Feuerspucker. Sie sieht klassische Stücke im Deutschen Theater und in der Volksbühne und leichte Stücke in den Kabaretttheatern rund um die Friedrichstraße. Sie beobachtet die Schauspieler, studiert ihre Atmung, ihre Pausen, ihre starken und schwachen Momente.
Auch hinter der Bühne kennt sie sich bald gut aus, Hilde bekommt erste kleine Jobs in der Ausstattung und als Kostümassistentin. Irgendwann verdient sie genug, um sich ein Zimmer in der Rosenthaler Straße, nicht weit vom Hackeschen Markt, leisten zu können. Sie verlässt das Schwesternwohnheim, ohne der Mutter etwas zu sagen. Erst als sie ein Jahr später ihre erste Rolle bekommt, wagt sie es, der Familie von ihrem Doppelleben zu erzählen. Die Mutter trägt es mit Fassung, sie verspürt wohl sogar einige Sympathie für Hildes Interessen, die auch mal ihre eigenen waren. Schließlich hat Katerina als junge Frau am Berliner Konservatorium studiert, hat dort gesungen und Klavier gespielt und galt als äußerst talentiert. Diese Zeit ging jäh zu Ende, als sie ihrem Erich in die schlesische Provinz folgte, wo dieser seinen ersten Posten als Gymnasiallehrer bekam. Auf vieles musste sie dort verzichten, die Trennung von der Musik, sagte sie später immer wieder, sei ihr am allerschwersten gefallen.
Sie unterstützt Hilde nun nicht gerade, aber sie hindert die Tochter auch nicht daran, ihrer Begeisterung nachzugehen. Hilde spielt im Kabarett »Die Wespen«, einer Truppe ohne feste Spielstätte, die oft im Restaurant »Hacke Bär« in der Großen Frankfurter Straße 68 gastiert, oder im Mercedes-Palast in Neukölln. Die Wespen verstehen sich als Proletarisches Kabarett und treten vor allem in den Arbeitervierteln auf. Die Truppe gilt als die radikalste und beste der Weimarer Republik, Künstler wie Erich Mühsam, Ernst Busch und Hanns Eisler schreiben, spielen und komponieren für das Ensemble. Hilde kommt hier zum ersten Mal mit linken politischen Ideen in Berührung, wobei es vor allem die menschlichen Tragödien und Abgründe sind, die sie faszinieren.
Später lernt Hilde über den Schriftsteller Erich Weinert den berühmten Theaterregisseur Max Reinhardt kennen. Sie spielt in zwei seiner Produktionen, eine am Deutschen Theater, eine an der Volksbühne. Hilde ist begeistert von der einfühlsamen Art, mit der Reinhardt den Schauspielern ihre Rollen erklärt. Einmal legt der Meister ihr während einer Probe den Arm um die Schultern und flüstert ihr ins Ohr, welche Art von Spiel er in der nächsten Szene von ihr erwartet. Hilde wird durch diese Vertraulichkeit so nervös, dass sie vergisst, was Reinhardt ihr gerade gesagt hat, und prompt die Szene verdirbt.
Im Winter 1929 verliert Hilde auf einmal ihre Stimme. Sie konsultiert verschiedene Ärzte, aber keiner kann die Ursache ihres plötzlichen Verstummens erklären. Einer der Mediziner kommt auf die Idee, sie zum Nervenarzt und Psychologen Dr. Fritz Fränkel zu schicken, der offenbar in dem Ruf steht, schon so manchem Künstler aus einer körperlichen Unpässlichkeit geholfen zu haben. Nach ein paar Besuchen bei Fränkel kann Hilde wieder sprechen, und er fragt, ob sie nun, da sie ja keine Patientin mehr sei, nicht mal zusammen ins Theater gehen wollen.
»So haben sich meine Eltern kennengelernt«, sagt Onkel André, zu dem ich gefahren bin, um mir von Hilde erzählen zu lassen. André sitzt in einem schweren Ohrensessel im Wohnzimmer seines Hauses im Londoner Stadtteil Camden. Er hat einen zerzausten grauen Bart und lustige Augen, die ständig in Bewegung sind. Manchmal trägt er eine russische Schapka aus schwarzem Fell und sieht aus wie Lenin kurz vor dem Ausbruch der Oktoberrevolution. Für mich war Onkel André schon immer sehr alt. Und sehr besonders. Das Erstaunlichste an ihm sind seine Freundlichkeit und die beschwingte Neugier, mit der er die Welt betrachtet. Er ist an allem interessiert, will alles verstehen. Er sagt, Hilde sei sehr beeindruckt gewesen von Fritz Fränkel, nicht nur, weil er so klug und kultiviert gewesen sei, sondern weil er offenbar die Gabe hatte, den Menschen in die Seele zu schauen, sie zu fühlen, sie zu verstehen.
Fränkel ist ein schmaler jüdischer Intellektueller mit einem wild wachsenden Haarkranz und einem Blick, der traurig und spöttisch zugleich ist. Er ist 15 Jahre älter als Hilde, wohnt noch immer mit seiner Mutter und seiner Schwester zusammen, die dem zuweilen verträumten Doktor durch den praktischen Teil des Lebens helfen. Eigentlich passen die beiden überhaupt nicht zusammen. Hilde ist zu jung und zu unerfahren, um Fränkel eine Partnerin zu sein. Aber wahrscheinlich hat er in ihr schon all das gesehen, was sie selbst erst viel später entdecken wird: ihre Kraft, ihre Entschiedenheit, ihren sicheren Instinkt.
Den beiden bleibt kaum Zeit, sich kennenzulernen, da ist Hilde schon schwanger, und es muss geheiratet werden. Hilde zieht zu den Fränkels in die Wilmersdorfer Kaiserallee 207. Sie wohnen im ersten Stock, in einer vornehmen Acht-Zimmer-Etage, wo sich auch Fränkels Praxis befindet. Hilde hat große Schwierigkeiten, ihren Platz in dieser Familie zu finden. Fränkels Mutter führt den Haushalt, die Schwester kocht, das Dienstmädchen Gerda putzt und wäscht. Hilde hat jetzt zwar einen Mann, fühlt sich aber trotzdem nur als geduldeter Gast. Von einem Zuhause, gar von ihrem Zuhause kann keine Rede sein. Hinzu kommt Hildes Beruf, der von Fränkels Familie nicht geschätzt wird. Abends steht sie auf der Bühne, wenn sie spät in der Nacht nach Hause kommt, schlafen die anderen schon. Fränkels Mutter lässt Hilde spüren, dass sie nicht die Richtige für ihren Jungen ist. Erst als André geboren wird, entspannt sich die Stimmung im Hause Fränkel etwas, weil die Großmutter, vom Enkel bezaubert, zuweilen die Abneigung gegen die Schwiegertochter vergisst.
Fritz Fränkel selbst ist kaum da, weil er ohne Unterlass arbeitet. Neben seiner Nervenarztpraxis in Wilmersdorf hat er im Urban-Krankenhaus eine psychosoziale Notfallstelle eingerichtet, die vor allem von Alkoholikern und Drogensüchtigen besucht wird, die er unentgeltlich behandelt. Berlin ist in diesen Jahren überschwemmt von Drogen, in den Klubs und Bars wird in rauen Mengen Kokain geschnupft und Morphium gespritzt. Fränkel gehört zu einer Handvoll Ärzten, die sich mit der Wirkung von Drogen auskennen und Entziehungskuren anbieten. Außerdem findet er es skandalös, wie mit mittellosen Patienten umgegangen wird. Gesundheit dürfe keine Frage des Geldbeutels sein, sagt er immer wieder. Deshalb nehme er absurd hohe Honorare von frustrierten Industriellengattinnen, die ihre Traurigkeit mit Likör vertrieben, und fast nichts von den armen Kerlen, die sich nachts im Hauseingang eine dreckige Nadel in die Vene stießen. »Das ist mein kleiner Sozialismus«, sagt Fränkel.
Darüber reden Hilde und Fränkel oft, über die Gerechtigkeit, und ob es wirklich so gut ist, eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, wie Fränkel es sich wünscht. Hilde sagt, irgendwer müsse doch das Geld verdienen, um es den anderen zu geben. Sie glaubt mehr an christliche Mildtätigkeit als an Gleichheit. Außerdem hat sie in ihrer Kindheit sehr unter der Armut gelitten, die mit der Inflationskrise in ihre Familie kam. Onkel André sagt, dieses Gefühl, alles zu verlieren, habe seine Mutter tief geprägt. Schon damals habe sie beschlossen, eines Tages reich zu werden, um sich und ihrer Familie die Freiheit und Sorglosigkeit zurückzuschenken, die sie selbst so früh verlor.
Fränkels politische Haltung hat viel mit dem Ersten Weltkrieg zu tun, in dem er als Bataillonsarzt Schwerverwundete in Königsberg betreute. Er erzählt Hilde von den Amputationen, die er ohne Narkosemittel vornehmen musste, von den Blutlachen, die in den Sanitätszelten standen, von der Luft, die nach Eiter und Tod stank, vom letzten Wimmern der Sterbenden. Wer solche Kriege künftig verhindern wolle, sagt Fränkel, der müsse die Gesellschaft verändern. Sie nennt ihn deshalb spöttisch »meinen großen Arbeiterführer«, was Fränkel überhaupt nicht lustig findet.
Noch während des Krieges tritt Fränkel dem Spartakusbund bei und ist Delegierter von Königsberg, als am 30. Dezember 1918 in Berlin im Festsaal des Preußischen Landtags die KPD gegründet wird. Fränkel ist 26 Jahre alt und sitzt neben Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Wilhelm Pieck und Hermann Duncker, als der Kommunismus in Deutschland offiziell zu existieren beginnt. Hilde hat also, wie ihre Schwester Irmgard, einen Revolutionär aus bürgerlichem Hause geheiratet. Und genau wie Irmgard wird sie wegen ihres Mannes aus Berlin weggehen.
Fränkel studiert die Wirkung von Drogen nicht nur an seinen Patienten, sondern auch an sich selbst, an Freunden und Kollegen. Tagsüber behandelt er in seiner Praxis im weißen Kittel, nachts experimentiert er am selben Ort mit Morphium, Haschisch und Kokain. Oft bittet er seinen Freund, den Schriftsteller und Philosophen Walter Benjamin, als Versuchsperson in sein Kabinett. Die beiden kennen sich von der Universität, Benjamin interessiert sich schon früh für Fränkels Arbeiten über das menschliche Suchtverhalten, Fränkel ist inspiriert von Benjamins philosophischem Werk. Die beiden verbringen ganze Wochenenden auf den Kaffeehausterrassen am Kurfüstendamm. Sie trinken Mokka und Weißwein, rauchen schwarze filterlose Zigaretten und diskutieren. Für Fränkel sind es Stunden vollkommenen Glücks, die oft noch ihre Verlängerung in seinem Arbeitszimmer finden, wo man es sich in mächtigen Ledersesseln bequem macht und von Fränkel bereits vorbereitete »Haschisch-Zigaretten« raucht.
Walter Benjamin protokolliert die Sitzungen mit Fränkel. Eines seiner ersten Haschischprotokolle stammt vom 18. Dezember 1927, 3.30 Uhr morgens: »Man fühlt im Lächeln sich kleine Flügel wachsen (…) Große Empfindlichkeit gegen offene Türen, lautes Reden, Musik (…) Ofenröhre wird Katze. Als Fränkel von Ingwer spricht, verwandelt sich sein Schreibtisch in eine Bude mit Früchten (…) Die Leute, mit denen man zu tun hat (Fränkel) sind sehr geneigt, sich etwas zu verwandeln, nicht fremd möchte ich sagen zu werden, nicht vertraut zu bleiben, sondern so etwas wie Fremden ähnlich zu sehen.« Die Erfahrung dieser Nacht fasst Walter Benjamin so zusammen: »Man geht die gleichen Wege des Denkens wie vorher. Nur sie scheinen mit Rosen bestreut.«[1]
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: