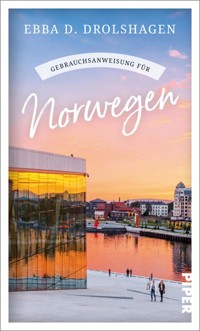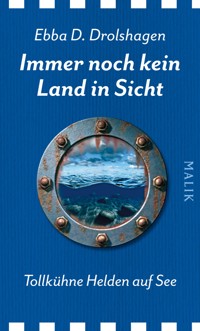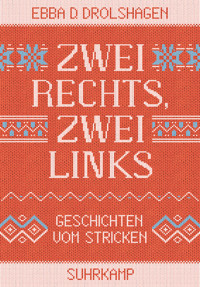
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Norwegerstern ist das weltweit bekannteste Muster auf Winterpullovern. Aber wie ist er entstanden? 1857 wurde er erfunden, und zwar von einer jungen Norwegerin, die beim Ziegenhüten Handschuhe mit zwei verschiedenfarbigen Fäden zu stricken versuchte. Als sie ihre Handschuhe beim Kirchgang trug, fielen sie auf, und bald war der achtzackige Stern ein Markenzeichen für die ganze Region. Im kalten Norwegen trägt er einen poetischen Namen: Achtblattrose.
In vielen solcher Geschichten erzählt Ebba D. Drolshagen vom Stricken: wie und wo es entstand, wie es sich über Jahrhunderte verändert hat, wer strickte und was gestrickt wurde. Sie erzählt von Broterwerb, Zeitvertreib und Guerillastricken, vom Färben und Spinnen, von alten und neuen Techniken, von Strickcafés, Strickgruppen und natürlich auch davon, wie das Internet das Leben der Strickerinnen verändert hat. Sie weiß, wie der Shetlandpullover wirklich entstand, und auch, dass Stricken nicht nur Schals und Mützen, sondern auch die unterschiedlichsten Stimmungen produzieren kann.
Die Regale in den Buchhandlungen sind voll von Büchern mit Strickanleitungen. Und es werden immer mehr. Was es bisher nicht gibt, ist ein Buch über das Stricken. Hier ist es. Es erzählt von den Menschen, Frauen wie Männern, die das Handstricken Masche für Masche zu dem gemacht haben, was es heute ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
EBBA D. DROLSHAGEN
ZWEI RECHTS, ZWEI LINKS
GESCHICHTEN VOM STRICKEN
MIT EINEM VORWORT VON MARTINA BEHM
SUHRKAMP
Inhalt
Vorwort
Links ist rechts — nur umgekehrtDie Maschen
Aus den Tiefen der GeschichteDie Anfänge
Zwei Nadeln und ein FadenDas Material
In der Wolle gefärbtDie Farben
Dafür muss eine alte Frau lange strickenDas Armutsstricken
Blinde Passagiere und willkommene FremdeDie Musterwanderung
Sie sollte mit Verstand strickenDas Salonstricken
Stricken ist nicht allesDie Passform
Mehr Stopfstelle als StrickDie Wertschätzung
Für Geld und ohneDas Hobby und die Heimarbeit
Elisabeth Zimmermann und andere GenialeDie Designerinnen
Wolle zu Geld spinnenDie Kreativen
Wenn da ein Fräulein gesessen hätteDie Männer
Ich stricke, damit ich keinen umbringeDie Gesundheit
Es wird wieder mehr gestrickt und gehäkeltDie Strickwellen
Der globale BauernmarktDie Wundertüte Ravelry
Eine Nachbemerkung
Einige Namen
Einige Buchtitel
Abbildungstexte
Bildnachweise
Hochgelobt sey der Mann oder das Weib, der oder das die Kunst zu Stricken erfand! Sein Andenken verdient gewiß in allen cultivierten Ländern eine Ehrensäule … Seine fünf Stricknadeln wurden Wohltäter der Menschheit! Nährer der Armen und Grundstein der nützlichen Industrie so mancher Stadt, so manchen Landes!
Journal des Luxus und der Moden, 1800
geschoren
gewaschen
getrocknet
gefärbt
getrocknet
gewogen
gekämmt
gesponnen
gespult
gehaspelt
gewickelt und
geschickt verstrickt.
fertig!
Heike Gauch
Vorwort
Ein langer, langer Faden, zwei spitze Nadeln und eine Idee. Mehr brauche ich nicht, um ein Kleidungsstück zu erschaffen oder eine nützliche, wärmende Mütze herzustellen, mit meinen eigenen Händen. Es macht keinen Lärm, es ist manchmal angenehm repetitiv, manchmal komplex und herausfordernd, und ich kann mir aussuchen, nach welchem Schwierigkeitsgrad mir gerade der Sinn steht. Ein einfaches Tuch nur aus rechten Maschen, wenn der Tag anstrengend war und ich Entspannung suche. Eine drei Seiten lange Strickschrift mit Symbolen, die mir noch völlig unbekannt sind, wenn ich gerade Lust habe, etwas Neues zu lernen. Stricken ist komplett logisch, mathematisch nachvollziehbar und kontrollierbar, und allein schon deshalb hilft es, so manches Chaos im Kopf zu beseitigen. Strickanleitungen funktionieren so ähnlich wie Computerprogramme, bei denen statt bunter Pixel auf dem Bildschirm Socken, Pullover oder hauchzarte Spitzentücher entstehen. Der Prozessor bin ich, die Hardware ist ein weiches, freundliches Naturprodukt und komplett absturzsicher. Das fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
Wer strickt, muss gar nicht besonders geduldig sein. Ganz im Gegenteil — Stricken hilft mir, mit meiner Ungeduld zurechtzukommen. Statt im Wartezimmer oder am Flughafen einfach nur auszuharren, kann ich etwas Sinnvolles, Produktives tun. Geduld bräuchte ich, wenn ich mein Strickzeug zuhause vergessen hätte und mich nun mit einem Promi-Klatschblatt langweilen oder mit meinem Smartphone beschäftigen müsste.
Und man stelle sich nur mal vor, wie sich die Welt verändern würde, wenn die Menschen die Zeit, die sie mit Videospielen manchmal zweifelhaften Inhalts oder mit virtuellem Geschwätz verbringen, fürs Stricken nutzten. Ich bin überzeugt, dass manches besser würde, denn die Beschäftigung mit Nadel und Garn lässt uns einsichtiger, klüger und zuversichtlicher werden.
Wer strickt, macht die Erfahrung, dass Kleidung einen Wert hat, dass jede Socke, jeder Schal und jedes T-Shirt menschliche Arbeit, Rohstoffe und viel Zeit kostet. Die Menschen würden das, was sie da tagtäglich am Körper tragen, mehr zu schätzen wissen. Und vielleicht weniger Kleidung kaufen, die unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt und hier bei uns zu Spottpreisen verramscht wird. Etwas Handgestricktes, Handgemachtes ist unendlich wertvoll, denn es hat die Strickerin nicht nur Geld für Garn und Nadeln, sondern auch Liebe und Lebenszeit gekostet.
Stricken schafft Erfolgserlebnisse, die beflügeln können. Ich erinnere mich an meine ersten kleinen Werke: den Puppenschal. Die Mütze. Die erste Socke, die gepasst hat. Erschaffen mit meinen eigenen Händen. Nützlich, schön und warm. Wer in so kleinem Maßstab erfährt, dass er etwas lernen, erschaffen und bewirken kann, fühlt sich gut — und ist wahrscheinlich motiviert, auch andere Dinge konstruktiv anzupacken.
Wer strickt, lernt, komplexe und bisweilen fremdsprachige Anweisungen zu verstehen und umzusetzen, routiniert mit Zahlen und Maßen umzugehen, er erfährt etwas über seltene Schafsrassen, Spinn- und Färbemethoden. Wer strickt, muss sich bisweilen unvorhergesehenen Problemen stellen und sie lösen (hier ist dann tatsächlich manchmal Geduld und Ausdauer gefragt), statt gleich frustriert aufzugeben. Wer strickt, lernt auch, sich im richtigen Moment Hilfe zu holen; er lernt, zuzugeben, dass er nicht alles kann und weiß, und er lernt auch, Fehler einzugestehen und die Konsequenzen zu tragen — denn manchmal hilft alles nichts, und man muss das bisher Gestrickte wieder ribbeln. Alles Fähigkeiten, die auch in anderen Zusammenhängen sehr nützlich sind.
Und, vielleicht am wichtigsten: Wer strickt, hat genug wärmende Kleidungsstücke im Schrank und kann auch Freunde und Familie mit handgestrickten Pullis und Mützen ausstatten. Wer strickt, erfährt Wärme, Freude und Dankbarkeit, die jedem Menschen guttun.
Wer nun eintauchen möchte in die Welt des Strickens, dem empfehle ich dieses Buch: Ebba D. Drolshagen schlägt hier auf vergnügliche Weise einen Bogen von Elizabeth I., die ihren Untertanen tatsächlich vorschrieb, an Sonntagen handgestrickte Wollmützen zu tragen, bis hin zu einer Internet-Datenbank für Strickerinnen, deren Aufbau unter Programmierern, die sonst mit Stricken gar nichts am Hut haben, als vorbildlich gilt. Zwei links, zwei rechts zeigt deutlich, was ich schon immer vermutet habe: Stricken schafft ungewöhnliche Verbindungen, setzt kreative Kräfte frei und macht auf diese Weise die Welt ein kleines bisschen besser. Viel Spaß beim Lesen — und natürlich beim Stricken!
Martina Behm
Links ist rechts — nur umgekehrtDie Maschen
Sie kennen das: Sie sitzen beispielsweise strickend im Zug und Ihr Gegenüber sagt plötzlich, »Also, das ist so kompliziert, ich könnte das nie! Nie!« Vermutlich fühlen Sie sich im ersten Moment ein bisschen geschmeichelt und sagen: »So ein Unsinn, Stricken ist total einfach. Eine rechte Masche und eine linke Masche, das lernt man doch in fünf Minuten.« Nun ja, vielleicht nicht in fünf Minuten, der Anfang kann durchaus etwas holprig sein. Ob man Schreiben oder Skilaufen lernt, den ersten Apfelstrudel backt oder die erste Seminararbeit verfasst: Man muss üben, üben, üben und man braucht Geduld.
Wenn mir das passiert, führe ich meinem Gegenüber in Zeitlupe eine rechte Masche vor — mit der rechten Nadel von vorne in die erste Masche der linken Nadel einstechen, den Faden, der hinter der Arbeit liegt, durch die Masche hindurch zu sich hin ziehen. Dann lasse ich diese Masche auf die rechte Nadel gleiten, noch einmal vorne rein und durch, vorne rein und durch … Irgendwann mache ich auch eine linke Masche, befördere dafür mit einer winzigen Bewegung der rechten Nadel den Faden vor die Arbeit, ziehe ihn mit der rechten Nadel nach hinten und lasse die Masche auf die rechte Nadel gleiten. (Sollte diese Beschreibung Sie irritieren, weil Sie die linke, womöglich sogar die rechte Masche anders stricken als ich — dazu später mehr.) Die linke Masche führe ich rasch und eher beiläufig vor, was ich damit begründe, dass die zunächst nicht wichtig sei, da man mit der Vorne-rein-und-durch-Masche ziemlich weit kommt. (Der wahre Grund ist natürlich, dass linke Maschen etwas mehr Fingerfertigkeit und Vertrautheit mit Nadeln und Faden erfordern.)
Wer jetzt noch lernt, Maschen anzuschlagen und abzuketten, kann ein Rechteck stricken, und das kann alles Mögliche werden: Wärmender Schal oder alltagstaugliche Decke, faltet man das Rechteck auf die Hälfte und näht zwei Seiten zusammen, kann man etwas hineinstecken — Kaffeekanne, Füße, oder auch einen Kopf. So schlicht entstanden beispielsweise die pinkfarbenen Pussyhats, die (nicht nur) Amerikanerinnen im Januar 2017 bei Demonstrationen trugen. Zwei große Vierecke ergeben, an den richtigen Stellen zusammengenäht, eine Weste, mit zwei weiteren Vierecken, lang und schmal, bekommt die Weste Ärmel und wird zum Pullover. Voilà! Schal, Mütze, Pullover und Decke sind ein ordentlicher Schutz gegen Kälte. Sollte das nicht ausreichen, können auf die gleiche Weise noch Rock, Jacke, Mantel, ja sogar eine Hose entstehen.
Das wärmt und verhüllt, doch die konsequente Rechteckigkeit macht keine besonders schöne Silhouette — ehrlich gesagt ist diese Garderobe ein wenig plump. Man sollte vielleicht schon beim Stricken berücksichtigen, dass der menschliche Körper, anders als Mehlsack und Brottüte, kaum rechte Winkel, dafür diese und jene Biegung und Rundung hat. Es handelt sich hier nicht um übertriebene Eitelkeit — selbst die Tracht einer Nonne hat Abnäher.
Biegungen und Rundungen sind beim Stricken zum Glück kein Problem. Sobald man weiß, wie man die Maschenzahl verringert und vergrößert (was sich in einer Minute lernen lässt), können Kleidungsstücke entstehen, die Schultern, Ellbogen, Taille, Hüfte und Bauch berücksichtigen. Schon schmiegt sich auch die Mütze, anders als besagte Brottüte, um Kopf und Ohren und rutscht nicht mehr über die Augen.
Die ersten selbstgestrickten Socken liegen in diesem Stadium noch in einiger Entfernung, was kein Wunder ist, denn Sockenstricken ist der Kunstflug des Strickens, wie Katja Petrowskaja in ihrem Roman Vielleicht Esther bewundernd schreibt. Aber ein hübsches Oberteil ist in Reichweite.
Nur mit rechten Maschen bekommt man also schon recht viel, und rechts Gestricktes — also ›kraus rechts‹ — sieht auch hübsch aus; die Gleichmäßigkeit der horizontalen Rippen und die graphische Knubbeligkeit können sogar elegant wirken. Das schien mir lange unbestreitbar, aber ich musste mich von einer Mannheimer Freundin eines Besseren belehren lassen. Sie nennt kraus rechts wäschlumberechts, also waschlappenrechts, was nicht sehr elegant klingt, außerdem zischt sie das Wort fast, weil es sie an die verhassten Handarbeitsstunden erinnert. Die liegen über ein halbes Jahrhundert zurück, doch ihren ersten Wäschlumbe hat sie noch. Er zeugt von rührendem Bemühen.
Der Beweis, dass es ganz ohne linke Maschen geht, ist, dass sie (angeblich) erst recht spät erfunden — oder soll man sagen: entdeckt? — wurden. (Ich habe auch schon die Behauptung gehört, es gebe nicht zwei Maschenarten, sondern nur eine, weil die linke Masche die Rückseite der rechten Masche sei. Das lasse ich jetzt einmal auf sich beruhen.)
Sehr viele Strickerinnen mögen linke Maschen nicht. Sie finden sie umständlicher und zeitraubender als rechte Maschen und tun nahezu alles, um sie zu vermeiden. Das ›Problem‹ mit linken Maschen ist, dass dafür der Arbeitsfaden vor der Arbeit sein muss, die meisten Strickerinnen ihn aber hinter der Arbeit halten. Der Faden muss also Masche für Masche nach vorne geholt werden, was nicht nötig wäre, wenn er da wäre, wo er gebraucht wird: vorn. Tatsächlich gibt es eine altbewährte Technik, bei der das genau so ist, dafür müssen wir nur ein klein wenig über unseren mitteleuropäischen Tellerrand schauen. Vermutlich wissen Sie, dass Frauen in der Türkei, in Ägypten, Bulgarien, Portugal oder auch Peru den Arbeitsfaden um den Hals führen. Wenn Sie sich das vorstellen oder gleich einmal ausprobieren, sehen Sie, dass er dann zwischen Strickstück und Strickerin, also vor der Arbeit liegt. Ich habe eine deutsche Freundin, die sich den Faden um den Hals legt, wenn sie viel links stricken muss. Aber Sie ahnen es: Bei dieser Technik sind die rechten Maschen ›aufwendiger‹. In den USA stricken manche rechte Maschen mit dem Faden hinter, linke Maschen mit dem Faden vor der Arbeit, bei dieser Technik wird der Faden Masche für Masche mit der rechten Hand um die Nadel manövriert.
Werden die Hinreihen rechts und die Rückreihen links gestrickt, ergibt sich das klassische Maschenbild glatt rechts, das auf einer Seite — der Vorderseite — eine vertikale Struktur hat, die wie kleine, ineinandergestapelte Vs aussieht. Glatt rechts ist (bei gleichem Garn) dünner und weicher als kraus rechts, dem es auf der Rückseite ähnelt, auch wenn die Rippen feiner sind.
Glatt rechts geht indes auch ohne linke Maschen, wenn man die angeschlagenen Maschen zum Rund schließt und dann im Kreis strickt — immer rechts. Das geht schneller als ›flach‹, also hin- und zurückstricken, und wird oft regelmäßiger. Viele Strickerinnen stricken nämlich rechte und linke Maschen mit einer minimal anderen Fadenspannung, was zu den berühmt-berüchtigten Rillen führt.
Lassen Sie mich rasch ein Wort des Trostes für die einfügen, die unter dem ›Rillen-Look‹ ihres Gestricks leiden: Grämen Sie sich nicht! Die geniale Strickerin Elizabeth Zimmermann, von der noch oft die Rede sein wird, sagte, ein handgestrickter Pullover solle ja keinen maschinengestrickten aus dem Laden imitieren. Außerdem wirkten Spannen, Dämpfen und ein paar Wäschen reine Wunder: »Ich dachte lange, dass früher, in der guten alten Zeit, alle phantastisch ebenmäßig stricken konnten, denn wirklich alte Pullover sind völlig glatt und gleichmäßig. Jetzt weiß ich, dass sie damals vermutlich genau so strickten wie ich, also ziemlich unregelmäßig, und dass für die Unterschiede der große Gleichmacher Zeit verantwortlich ist — Zeit und viele Wäschen.«
Rundstricken produziert einen Schlauch, der, je nach Größe, Socke, Mütze, Handschuh, sogar ein Pullover werden kann — Letzteres allerdings nur, wenn man nach Abschluss der Arbeit Armlöcher hineinschneidet. Diesem erschreckenden Aspekt widmen wir uns an anderer Stelle.
Die gerade erwähnte, 1910 in England geborene Amerikanerin Elizabeth Zimmermann war eine glühende Strickerin und eine Frau mit dezidierten Ansichten: Sie verstrickte ausschließlich Wolle, und da sie linke Maschen hasste, konstruierte sie ziemlich raffinierte Strickstücke, die nur aus rechten Maschen bestehen.
Linke Maschen sind also keineswegs unverzichtbar, doch zu ihrer Verteidigung möchte ich anführen, dass sie die Spielwiese, die das Stricken für uns ist, erheblich vergrößern; viele Raffinessen entstehen erst im Nebeneinander und Zusammenspiel beider Maschenarten. Stephanie Pearl-McPhee nennt rechte und linke Maschen »das Yin und Yang des Strickens«. Für mich ist die linke Masche wie die Farbe beim Fotografieren: Schwarz-Weiß-Bilder sind eine eigene, ausdrucksstarke Kunstform, Farbe eröffnet andere Räume, andere Möglichkeiten, eine andere Art des Ausdrucks.
Es fasziniert mich, dass mit minimalsten Veränderungen etwas völlig anderes entsteht. Das einfachste Rechts-links-Muster ist der Wechsel von einer rechten und einer linken Masche. Bei gerader Maschenzahl entsteht so das schlichte Pullover-Bündchen. Bei einer ungeraden Maschenzahl aber wird daraus das Perlmuster, das nicht einmal eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Bündchen hat. Allein die immer neue Anordnung rechter und linker Maschen schafft zahllose interessante Strukturen, die sich mit dem Lichteinfall verändern. Rechts-links-Muster sind auf elegante Weise schlicht, sie haben keine eindeutige Vorder- und Rückseite und sind daher rundum hübsch. Zudem haben sie so schöne Namen wie Waffelmuster, Flechtmuster, Granitmuster, Mosaikmuster, Rautenmuster, Kachelmuster, Weizenmuster, Cloquémuster, Rhombenmuster oder Streupiqué — zehn beliebig herausgegriffene Muster von dreihundert, die ein neueres Buch versammelt.
Die Sequenzen werden ständig wiederholt, das kann man sich leicht merken, doch es wird nicht langweilig, weil man zählen muss. Dieses Quäntchen Konzentration und Aufmerksamkeit ist wichtig, es vergrößert das Vergnügen. Welche erfahrene Strickerin verstünde nicht Stephanie Pearl-McPhees Satz, an einem schwarzen Schal stricke man länger als an einem interessanten Pullover.
Ein ganz und gar schmuckloser Pullover kann allerdings auch zäh werden. Ist der Empfänger obendrein ein geräumiger Kerl, reden wir hier von einem Liebesbeweis, den der Empfänger hoffentlich zu schätzen weiß. Er möge sich diesen jungen Mann aus Goethes Roman Wahlverwandtschaften zum Vorbild nehmen, der widerstrebend einen Ort verlässt, an dem er sich sehr wohl gefühlt hat:
Zu großer Erheiterung dieser halb traurigen Gefühle machten ihm die Damen beim Abschiede noch ein Geschenk mit einer Weste, an der er sie beide lange Zeit hatte stricken sehen, mit einem stillen Neid über den unbekannten Glücklichen, dem sie dereinst werden könnte. Eine solche Gabe ist die angenehmste, die ein liebender, verehrender Mann erhalten mag; denn wenn er dabei des unermüdeten Spiels der schönen Finger gedenkt, so kann er nicht umhin, sich zu schmeicheln, das Herz werde bei einer so anhaltenden Arbeit doch auch nicht ganz ohne Teilnahme geblieben sein.
Nebenbei bemerkt, haben die meisten Männer in unserer Strickwelt sehr genaue Vorstellungen, was für sie tragbar (will sagen: männlich) ist — auch wenn sie das selten in strickmustertaugliche Worte fassen können. Wenn wir sie fragen, »Was für einen Pullover willst du denn, und welche Farbe soll er haben?«, wissen wir, dass Worte wie Birkengrün oder Dottergelb in der Antwort nicht vorkommen werden. Und aussehen? Was heißt ›aussehen‹? Ein Pullover eben. Also glatt rechts in Dunkelblau, Dunkelgrau oder Schwarz. Das in Größe 54 herzustellen, ist so langweilig, dass eine Strickerin, die es dennoch tut, tatsächlich den Goldenen Liebesorden am Bande verdient hat. Vielleicht ließe sich ein dezentes, rechts-links gestricktes Guernsey-Muster oder ein Zopf einschmuggeln (oder gar zwei?). Irische Kunstwerke, die nur aus Zöpfen und Rauten bestehen, bleiben modemutigen und modebewussten Männern vorbehalten.
Nach diesem kleinen Ausflug zu den geschlechtsspezifischen und zwischenmenschlichen Aspekten des Strickens zurück zu rechten und linken Maschen. Ihre Verbindung ermöglicht zahllose Zopf-, Flecht- und Lochmuster, die auch kombiniert werden können. Alte deutsche Handarbeitsbücher nennen Muster mit (beabsichtigten) Löchern »offene Arbeit« oder auch Durchbruchmuster, die in Spitzen- oder Kunststrickerei einerseits und Ajourmuster andererseits unterteilt werden. In der einen Technik entstehen hauchdünne Stolen, Tischdecken, feine Bordüren usw., Ajourmuster sind Zierlöcher, wie man sie beispielsweise in einen Pullover einstrickt. Die Begriffe werden kaum noch gebraucht, denn auch in der Strickwelt setzen sich englische Bezeichnungen durch, nun werden alle Lochmuster unterschiedslos als ›Lace‹ bezeichnet.
Ajour kann in Hin- und Rückreihen rechts gestrickt werden, das wird ein bisschen knubbelig, kann aber ein Stilelement sein. Für die spinnwebgleiche Leichtigkeit und Brillanz einer zarten Strickspitze hingegen braucht es meist die links gestrickten Rückreihen.
Sie haben es vermutlich schon gemerkt: Ich mag linke Maschen, stricke sie sogar gern. Ob das daran liegt, dass ich sie anders stricke als die meisten Deutschen? Meine norwegische Mutter hat mir das Stricken beigebracht und in Norwegen gehen linke Maschen anders als in Deutschland. Ich halte den Faden in der linken Hand, strecke den Zeigefinger aber nicht in die Luft, er liegt parallel zur linken Nadel und dicht dahinter. Der Faden hat nur wenige Millimeter Abstand zur Arbeit und bleibt beim Rechts- wie beim Linksstricken dort. Für eine linke Masche bewege ich nicht das Garn, sondern die Nadel: Ich manövriere es mit der rechten Nadelspitze an der linken vorbei nach vorn und durch die Masche. Falls Sie sich das nicht vorstellen können (was ich sehr gut verstünde), können Sie sich das norwegian purl bei YouTube anschauen. Sollten Sie sich dann kopfschüttelnd fragen, wieso jemand etwas so Futzeliges machen mag, würde ich auch das verstehen. Genau das frage ich mich, wenn ich sehe, wie meine deutschen Freundinnen mit dem Garn hin und her wedeln (was ich im Grunde auch tue, irgendwie muss das Garn ja vor die Nadel, aber bei mir fällt es weniger auf). Und zusammen schütteln wir den Kopf darüber, wie die Engländerinnen und Amerikanerinnen den Faden in der rechten Hand halten und ›werfen‹. Geht es noch umständlicher?
Durchaus möglich, denn es gibt erstaunlich viele Arten, linke und rechte Maschen zu stricken, wobei die meisten Strickerinnen auf die schwören, die sie als Erste gelernt haben und am besten beherrschen. Nur wenige unterziehen sich der Mühe des Umlernens, daher bewundere ich eine Amerikanerin, die schrieb, sie stricke erst gern, seit sie die schnelle europäische Methode gelernt hat, bei der das Garn in der linken Hand gehalten und die Arme weniger bewegt werden.
Eine Freundin, die ›englisch‹ (und ganz fantastisch) strickt, findet sich bei solchen wertenden Beschreibungen »eher in der Abteilung Vorurteile wieder. Ich glaube nicht, dass ich langsamer stricke als die, die den Faden links führen. Beim englischen Stricken gibt es zwei Arten: Die einen halten die Nadel relativ weit hinten und führen den Faden mit der rechten Hand umständlich um die Nadel herum, wobei die Hand die Nadel loslässt. Die anderen Stickerinnen greifen die Nadeln recht weit vorne, behalten Daumen, Mittel-, Ring- und kleinen Finger an der Nadel und schnicken den Faden nur mit dem Zeigefinger um die Nadel. So kenne ich das auch von den Shetlands, wo man ja Strickgürtel benutzt.« Schließen wir uns der klugen Elizabeth Zimmermann an: »Es gibt keine richtige Art zu stricken, es gibt keine falsche Art zu stricken.«
Aber es gibt durchaus eine Art, Tempo in die Sache zu bringen, und zwar mit dem gerade erwähnten Strickgürtel. Das ist ein gepolsterter, um die Taille getragener Ledergürtel, der auf der rechten Seite ein (beispielsweise mit Pferdehaar) gestopftes Kissen hat. In dem Kissen sind verschieden große Löcher, in die man die rechte Stricknadel steckt. Wenn sie im Gürtel arretiert ist, steht sie vom Körper ab und bewegt sich beim Stricken nicht. Die rechte Hand hält Nadel und Faden, der mit dem rechten Zeigefinger in ›Strickposition‹ geschnickt wird. Es ist bekannt, dass früher Berufsstricker den Gürtel benutzten, die unbewegliche Nadel beschleunigt das Stricken enorm, außerdem hat man rasch eine Hand frei.
Der Strickgürtel wird heute vor allem mit den Shetlandinseln in Verbindung gebracht, wo er auch noch benutzt wird. Es dürfte kein Zufall sein, dass der Guinness-Rekord im Schnellstricken von der Shetländerin Hazel Tindall gehalten wird. Sie strickt rund und selbstverständlich mit knitting belt in drei Minuten 262 Maschen. (Zum Vergleich: Elizabeth Zimmermann schaffte maximal 51 Maschen pro Minute und nannte das »ziemlich schnell«.)
Eine Art von Strickgürtel, Strickscheide genannt, gab es in Deutschland schon im 18. Jahrhundert. Das war ein Röhrchen, manchmal nur fest zusammengebundene Stroh- oder Gänsekielbündel, üblicherweise aber verzierte Futterale aus Holz, Kupfer, Zinn, Knochen, Elfenbein, Silber, Leder oder sogar Gold, »welches an dem Leibe befestigt wird, im Stricken die Stricknadeln darin zu stecken«.
Es ist für eine durchschnittliche Strickerin wie mich ein großes Erlebnis, zuzusehen, wie Frauen mit einem Nadelspiel oder einer Rundnadel mehrfarbige Muster stricken und sich dabei lebhaft unterhalten, ohne auf ihr Strickzeug zu blicken. Ich habe Norwegerinnen erlebt, die plaudernd und lachend Pullover mit Einstrickmuster produzieren, ich habe vor vielen Jahren auf den Shetlandinseln mit Strickerinnen zusammengesessen, in deren Händen bunte Rundpassen wuchsen, während wir miteinander sprachen — bei den zweifarbigen Musterreihen hielten sie eine Farbe in der rechten, die andere in der linken Hand. Ich erinnere mich gut, wie verwirrend ich es fand, dass es zwischen Kopf (reden) und Händen (stricken) keine Verbindung zu geben schien. Wie ihre Mütter, Großmütter und Urgroßmütter beherrschten diese Frauen viele verschiedene Motive wie im Schlaf, es schien, als wüssten ihre Hände, in welcher Reihe sie sich gerade befanden und welche Farbe jeweils dran war.
Ich strickte damals schon, natürlich, ich habe es als Kind gelernt, aber für die Geschichte des Strickens und dessen Traditionen interessierte ich mich erst viele Jahre später, und es sollte noch lange dauern, bis das Strickerbe der Shetlands touristisch vermarktet wurde. So ließ ich damals die einzigartige Gelegenheit, etwas über das Leben dieser Strickerinnen zu erfahren, ungenutzt verstreichen. Aber ich bin sicher, dass niemand auf der Welt schneller stricken kann als diese Shetlanderinnen, jedenfalls nicht mehrfarbige Muster.
Eine echte Strickerin beherrscht äußerst komplizierte Dinge, die kein Anfänger schafft. Sehen Sie sich diese Zeilen an:
Row 5 (RS): Using C, k3, *brkyobrk, sl1yo (brk1, sl1yo) 7 times, brRsldec, slm, k14, slm, brLsldec, sl1yo, (brk1, sl1yo) 7 times, brkyobrk, slm, k14, slm repeat from * 3 more times, brkyobrk, sl1yo (brk1, sl1yo) 7 times, brRsldec, slm, k14, slm, brLsldec, sl1yo, (brk1, sl1yo) 7 times, brkyobrk, k3. Do not turn. Slide sts to work the same side with color D.
Das ist eine (!) Reihe aus einer Tuch-Anleitung des amerikanischen Strickdesigners Stephen West. Verstehen Sie, was da steht? Oder geht es Ihnen wie einer Strickerin, die dieses Tuch zusammen mit einer Gruppe strickte und mir schrieb: »Wir zerbrechen uns alle die Köpfe und machen Knoten in die Finger«, nur um begeistert hinzuzufügen, die Anleitung sei »hinreißend wie immer«. Auf mein Bitten schickte sie mir die Erklärung der Abkürzungen. Das brkyobrk beispielsweise erwies sich als genau so furchterregend, wie es aussieht: Three stitches spring out of the center of one stitch with this increase. Work a brkyobrk as follows: brk1 (leave stitch on the needle), yo (yarn forward under needle then over needle to back), then brk1 into same stitch. 2 sts increased. Ja, ein bisschen Englisch sollte man mitbringen …
Erinnern Sie sich an Ihr Gegenüber im Zug vom Anfang des Kapitels und die Bemerkung, Stricken sei so kompliziert, dass er — oder sie — das niemals lernen könnte? Und an meine Antwort, das sei im Grunde Kinderkram? Wie Sie sehen, haben beide Seiten Recht: Es ist im Prinzip sehr einfach und erlaubt mit geringen Vorkenntnissen und geringen Mitteln ein hohes Maß an Kreativität. Das erste Erfolgserlebnis stellt sich rasch ein, und wer mehr möchte als ein Tuch oder einen einfachen Pullover, wird bald entdecken, wie anspruchsvoll und kompliziert Stricken sein kann. Es gibt für Anfängerin wie Könnerin immer noch etwas zu lernen. Es wird nie langweilig, denn es warten immer neue Herausforderungen. Und ich muss meine Aussagen vom Anfang ein wenig korrigieren, vielleicht sollte ich sagen: ergänzen. Wie jedes Handwerk mit langer Tradition, verlangt auch das Handstricken von allen, die es zur Meisterschaft bringen wollen, ein hohes Maß an Präzision, Disziplin und nicht zuletzt Geduld. Erst wer die Anfangsschwierigkeiten gemeistert hat, erkennt den Meister, erst wer sich (halbwegs) erfolgreich durch die erste Socke oder den ersten Schal mit Zopfmuster gekämpft hat, beginnt die unerschöpflichen Möglichkeiten der simplen rechten und linken Maschen zu schätzen, sieht die schwindelerregende Vielfalt, die Stricken zu einer beglückenden, endlos sprudelnden Wundertüte macht.
Aus den Tiefen der GeschichteDie Anfänge
Das mindeste, was man von einem Buch über Handstricken erwarten sollte, ist die Geschichte seiner Entstehung und seiner Anfänge. Wer hat es erfunden? Wann war das und wo? Wer hat gestrickt — Frauen? Männer? Beide? Und was strickten sie? Welches Garn hatten sie zur Verfügung, woher kam es? Wie sahen die Nadeln aus, wie wurden sie hergestellt?
Die enttäuschende Antwort lautet, dass wir über die Anfänge des Strickens gar nichts wissen. Während seit vielen tausend Jahren gewebt wird, deutet bis lange nach Christi Geburt nichts eindeutig aufs Stricken hin. Das ist eigenartig. Für die frühen Nomaden, die mit ihren Tieren umherzogen, wären zwei Nadeln und Garn fraglos einfacher zu transportieren gewesen als ein Webrahmen. Haben unsere Vorfahren wirklich auf der Wanderschaft gewebt und erst zu stricken begonnen, als sie sesshaft wurden? Auch auf antiken Vasen und Reliefs finden wir Darstellungen von Frauen mit Handspindel und Webrahmen, nie aber Strickende.
Eine Zeitlang meinte man ein wenig klüger zu sein, denn bei Grabungen im östlichen Mittelmeerraum wurden Textilien und Textilfragmente aus den ersten nachchristlichen Jahrhunderten gefunden, die man zunächst für Gestrick hielt. Eines dieser Fragmente geistert bis heute als »das älteste bekannte Beispiel von Stricken« durch die (Internet)-Welt. Es stammt aus Dura Europos im heutigen Syrien und wird auf 200-256 n. Chr. datiert. Vor Jahren hat die amerikanische Stricklegende Barbara G. Walker das Muster, ein Bild des Musters, studiert und eine Rekonstruktion ausgetüftelt, Jahre später veröffentlichte auch ein New Yorker Wollladen ein Schalmuster, das dem Original nachempfunden war. Dank neuerer Untersuchungsmethoden weiß man jetzt, dass es sich um ein Nålbinding-Fragment handelt (auf diese Technik kommen wir zurück). Aber die modernen ›Rekonstruktionen‹ sind wirklich sehr schön.
Auch ein prachtvolles Paar orangeroter Socken im Besitz des Londoner Victoria and Albert Museums war zunächst falsch eingeordnet worden. Die Strümpfe entstanden im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. und waren eine Grabbeigabe, ihre zweigeteilte Spitze ist so tief eingeschnitten, dass sie wie Hummerscheren aussehen. Über den Sinn dieser bizarren Form ist viel und bisher ohne schlüssiges Ergebnis spekuliert worden (wären es nicht zwei identische, man könnte meinen, dass sie schlicht misslungen sind). Aber auch sie sind nicht gestrickt, sondern nadelgebunden.
Nadelbinden, meist Nålbinding genannt, ist eine sehr alte Technik und ein Vorläufer des Strickens. Das Wort setzt sich aus nål, dem skandinavischen Wort für Nadel, und binding zusammen, was, wie man gleich vermutet, binden heißt. In manchen Gegenden Skandinaviens bedeutet binde aber bis heute auch stricken. Angeblich wurde das Wort Nålbinding erst in den 1970er Jahren erfunden, um die alte Technik und das moderne Stricken eindeutig zu unterscheiden.
Während man mit einem (theoretisch) endlosen Faden und zwei Nadeln strickt, geschieht Nålbinding mit Fadenstücken von einem, vielleicht zwei Meter Länge und einer großen Nähnadel, die früher aus Holz oder Knochen gemacht war. Die Technik erinnert ebenso an Häkeln wie an Nähen. Zu Beginn macht man Schlingenstiche, die einer Luftmaschenreihe ähneln, dann wird, wie beim Nähen, der Faden komplett durch jede Schlinge gezogen; jede weitere Reihe wird in die Maschen der vorherigen gearbeitet. Nålbinding ist zeitraubender als Stricken, das Gewebe ist robust, aber kaum dehnbar und lässt sich nicht aufziehen.
Fans von Mittelalterkleidung stellen mit dieser fast vergessenen Technik historisch korrekte Haarnetze für ihre Kostüme her, die Frauen des Nantistammes in der peruanischen Camisea-Region arbeiten damit Armbänder. Es galt lange als sicher, dass Nålbinding frühestens im 16. Jahrhundert mit den spanischen Eroberern nach Südamerika kam, in letzter Zeit hat man peruanische Nålbinding-Bänder entdeckt, die erheblich älter sind. Aber warum soll diese Technik, ebenso wie Häkeln und Stricken, nicht an mehreren Orten und unabhängig voneinander erfunden worden sein?
Die zweite Technik, die als Vorgänger des Strickens gilt, ist Sprang. Dafür werden Fäden auf einen (kleinen) Rahmen gespannt und so miteinander verdrillt, dass ein Netz entsteht; Sprang liegt, sehr grob gesprochen, zwischen Flechten und Weben. Das älteste erhaltene Spranggeflecht wurde in einem dänischen Grabhügel aus der Bronzezeit gefunden: Die Frau, die etwa 1350 vor Christus, also vor über dreitausend Jahren, dort bestattet wurde, war in ein großes, zusammengenähtes Stück Stoff gehüllt, sie trug eine kurze Bluse, eine Haube, zwei gewebte Gürtel sowie ein Sprang-Haarnetz. Das wurde kunstvoll aus feiner Wolle gearbeitet; wer das gemacht hat, beherrschte diese Technik souverän. Bei einer anderen Ausgrabung fand man Sprang-Haarnetze aus Pferdehaar.
Dass die Archäologen sich oft irrten, lag nicht (nur) daran, dass sie vom Stricken keine Ahnung hatten, sondern an den Funden selbst. Zum einen sind sie selten, denn Textilien sind Gebrauchsgegenstände, die vom Tragen verschlissen oder von Schädlingen zerfressen werden, was überdauert, zerfällt erheblich schneller als Tonscherben. Gewebtes ist stabiler als Gestricktes, beides verträgt es ausgesprochen schlecht, viele Jahrhunderte in der Erde zu liegen. Überdies sind die Fragmente meist völlig verfilzt und haben durch die Oxidation des Erdbodens einen braunen Farbton angenommen.
Das Aussehen von Sprang, Nålbinding und Stricken ähnelt sich so stark, dass man bei einem Textilstück, das viele hundert Jahre vergraben lag, oft nicht einmal mit dem Mikroskop zweifelsfrei klären kann, worum es sich handelt. Eventuell ließe sich die Technik bestimmen, wenn man die Stücke völlig auseinandernähme. Das würde sie zerstören, was bei alten und kostbaren Funden natürlich undenkbar ist. Und auch Stricknadeln sind nicht einfach zu erkennen. Wie soll man wissen, wozu ein Stöckchen oder zwei benutzt worden waren, die man gerade ausgebuddelt hat. Nähnadeln haben wenigstens eine Öse.
Die ältesten, zweifellos gestrickten Gegenstände, die wir kennen, sind Strümpfe. Doch statt Licht in das Dunkel der Strickgeschichte zu werfen, führen uns diese archäologischen Kostbarkeiten nur ein weiteres Mal unser Unwissen vor Augen. Es handelt sich nämlich keineswegs um windschiefe Probeläppchen, denen man ansieht, dass jemand eine richtig gute Idee, aber keine Ahnung von ihrer Umsetzung hatte. Im Gegenteil. Hier waren Könner am Werk.
Ein solcher Fund sind naturweiße Kniestrümpfe, glatt rechts und offenbar rund gestrickt, mit perfekter Ferse, perfekter Spitze, einer der Wade folgenden Passform und einem präzise gearbeiteten, komplizierten Einstrickmuster in Indigoblau. Sie bestehen, wie ausnahmslos alle sehr frühen Arbeiten, nicht aus Wolle, sondern aus Baumwolle, ihre Entstehung wird auf das 11. bis 13. Jahrhundert n. Chr. geschätzt. Gefunden wurden sie in Ägypten, ob sie dort entstanden, wissen wir nicht. Möglicherweise kamen sie aus Indien.
Ein anderes Fundstück sind Strümpfe, die in kufischer Schrift, eine Form des Arabischen, über Spitze, Knöchel und Schaft das Wort Allah eingestrickt haben. Das Victoria and Albert Museum besitzt ein stark zerstörtes Strickfragment aus dem 14.–15. Jahrhundert mit einem Intarsienmuster aus fünf Farben. Was immer wir aus diesen Exponaten schließen mögen, eines ist sicher: Sie stehen am Ende eines langen Lernprozesses. Das Stricken muss viel, viel älter sein.
Natürlich wurde auch in schriftlichen Quellen nach Hinweisen auf die Anfänge des Strickens gesucht. In den überlieferten Dokumenten der Antike findet sich allerdings rein gar nichts. Das ist nicht erstaunlich, weil Alltagsgegenstände und deren Herstellung generell selten erwähnt werden.
Eine weitere mögliche Quelle sind Sagen, Legenden und Märchen, aber um es gleich zu sagen: Auch da ist nichts zu holen. In der Odyssee, die an der Wende vom 8. zum 7. Jahrhundert v. Chr. niedergeschrieben wurde, webt Odysseus Ehefrau Penelope bekanntermaßen bei Tag ein Tuch, das sie nachts wieder auftrennt. Die Schicksalsgöttinnen der griechischen Mythologie spinnen ebenso wie die Nornen der nordischen Mythologie die »Schicksalsfäden«, in deutschen Märchen wird viel gesponnen und gelegentlich gewebt: In Rumpelstilzchen soll die junge Königin Stroh zu Gold spinnen, die Mädchen bei Frau Holle müssen spinnen, Dornröschen sticht sich im Turmzimmer an der Spindel der bösen Hexe. In Andersens Märchen Die wilden Schwäne kann eine junge Frau ihre verzauberten Brüder nur erlösen, wenn sie Brennnesseln sammelt und jedem Bruder daraus ein Hemd webt. All diese Geschichten wurden jahrhundertelang mündlich überliefert, bevor jemand sie aufschrieb. Dass nirgends gestrickt wird, sehen Volkskundler als Beweis, dass das Stricken nicht sehr alt sein kann.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch die Sprachwissenschaftler. Eine ihrer Grundannahmen lautet, dass jede Sprache eindeutige Wörter für jene Gegenstände und Tätigkeiten ausbildet, die für ihre Sprecher wichtig sind. Zumindest im Altgriechischen und im Lateinischen gibt es offenbar kein Wort für Stricken, es scheint also im alten Griechenland und im Römischen Reich keine Rolle gespielt zu haben. Das Englische und das Deutsche haben erst seit dem 16. Jahrhundert ein eigenes Wort. Das englische Verb cnyttan bedeutete ursprünglich (etwas) knoten, später auch weben und knüpfen, die Bedeutung stricken kam erst um 1520 hinzu. Purl stitch, das englische Wort für die linke Masche, ist sogar erst ab 1825 belegt. (Ausgesprochen klingt purl fast wie pearl, also Perle, und ist möglicherweise davon abgeleitet.)
Auch im Deutschen bedeutete knytte neben stricken lange Zeit binden und knüpfen. Ein Wörterbucheintrag von 1868 erklärt erst, »Knütte« sei »das stricken und das strickzeug bei nordd. schriftstellern«, dann, »man findet [knütten] oft knitten geschrieben, woran haupts. das engl. knit schuld sein mag«. Dort steht auch, dass es einen »gemeinsprachlichen gebrauch des wortes« Stricken schon vor 1300 gab, was »seit dem 16. jh. erheblich zugenommen« habe. Dem sollte man vielleicht misstrauen, denn diese Behauptung findet sich nur dort.
Wir wissen also nicht, wer wann zum ersten Mal mit zwei Nadeln und einem Faden die erste Masche strickte, ebenso wenig wissen wir, wo das geschah und wie man es nannte. Da die erwähnten Strümpfe eine arabische Inschrift tragen, liegt die Vermutung nahe, dass die Anfänge im Mittleren Osten lagen. Eine amerikanische Strickbloggerin untermauert diese Vermutung mit einer hübschen Beobachtung, dass wir von rechts nach links stricken und Arabisch von rechts nach links geschrieben wird, und meint, dass »die Art, wie wir heute stricken, ein Überbleibsel davon ist«. Ist das möglich? Es ist jedenfalls ein origineller Gedanke, nicht zuletzt, weil wir genügend Beweise dafür haben, dass es spätestens seit dem 12. Jahrhundert im östlichen Mittelmeer eine hochentwickelte Strickkultur gab.
Doch wie gelangte das Wissen nach Europa? An dieser Stelle fallen meist vage Begriffe wie Handelswege und Handelsbeziehungen, was klingt, als habe jemand eine Kiste voll Stricksachen gepackt, mitgenommen und verkauft — was natürlich durchaus möglich ist. Aber die Technik des Strickens reist in einer solchen Kiste nicht mit. Wer vom Stricken keine Ahnung hat, kann die kufischen Strümpfe bis ans Ende seiner Tage inspizieren — und doch niemals ergründen, wie sie gemacht wurden. Dazu braucht es einen Menschen, der stricken kann. Der es lehren kann. Lehren will