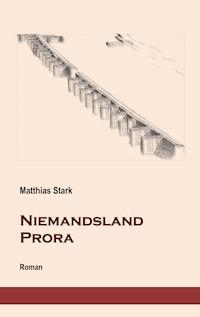Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Selbst Erlebtes und Widerfahrenes aus sechzig Jahren reflektieren auf mal humorvolle, mal nachdenkliche und gelegentlich traurige Weise, was einem schreibenden Menschen begegnen kann. Umbrüche und Wendungen, Skurriles aus dem Alltag, politische Ereignisse und Naturbeobachtungen sind das Material, aus dem sich die Geschichten dieses Buches speisen. Ein nachdenklich machendes Buch eines nachdenklichen Zeitgenossen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Manchmal ist der Blick zurück der bessere Blick nach vorn.“
Gerhard Gundermann
Matthias Stark, Jahrgang 1963, wurde in Radeberg geboren und lebt in Stolpen. Er ist Autor von Prosa und Lyrik. Bisher veröffentlichte er in zahlreichen Anthologien sowie als Autor und Herausgeber mehrere Bücher.
Inhalt
Kreuzende Wege
Radeberg, mein Kindheitsort
Vom Schlitten gefallen
Erdbeeren mit Milch
Abenteuer Schienenbus
Literarische Spuren
Christstollen
Mann mit Bart
Den Wünschen gewachsen sein oder die Geschichte einer Vase
Russisch – wofür?
Den „Findling“ wiederentdecken
Dem Kosmos ein Stück näher – Gedanken eines Sternfreundes
Aus Küche und Keller
Reichsbahner hinter den Kulissen
Pferde fressen keinen Gurkensalat
Reise nach Prora
Sport frei – unsportliche Erfahrungen
Das Ding aus einer anderen Zeit
Schneewittchen und die sieben Gründe oder Was Kunst ist
Ein Jahr
Der mahnende Trümmerberg
Aus Posteas Tagebuch
Am Fluss entlang
Aufschauen zu den Sternen
Mein Goethe
Was Lesen macht
Zweifel und Vergewisserung
Das dritte Buch
Über die Philosophie des Dao
Was mich Strittmatter lehrte
Vernünftig handeln
Spuren im Schnee
Alle Jahre wieder
Ein ganz gewöhnlicher Abend
Winterende
Neujahrsmorgen bei den Wasseramseln
Frühlingsduft im Schlosspark
Störenfried
Vernetzt
Stelldichein am Morgen
Allein im Wald
Das verschwundene Huhn
Hasentanz am Kranichsee
Glockenklingen überm Teich
Über das Staunen und das Glück
Was wir viel zu selten machen
„Was machen Sie beruflich?“
Was uns fehlt
Ja, wer kommt denn nun?
Stille Minuten
Über die Lügenpresse und andere Märchen
Post-Possen
Herr S. macht Pause
Herr S. wundert sich
Herr S. denkt nach
Reifenwechsel
Drei Dinge
Liebes Kind
Eigener Nachruf
Was ich liebe
Kreuzende Wege
Mit meiner Frau stehe ich in Schöneck im Vogtland vor einem Klinkerbau. Nach einigem Suchen hatten wir das Haus gefunden. Über der Toreinfahrt ist in Stein gehauen zu lesen: „F. Sch. 1901“.
Die Initialen stehen für Friedrich Schuster. Der Mann war mein Urgroßvater, kennengelernt habe ich ihn nicht mehr. Aus Erzählungen im Familienkreis weiß ich, dass er sich aus kleinen Verhältnissen hochgearbeitet hat und eine Zigarrenfabrik gründete. Friedrich Wilhelm Schuster war ehemaliger Weber und Zigarrenarbeiter. Bereits im Jahr 1896 begann er mit einer eigenen Zigarrenproduktion.
Nun stehen wir hier vor dem einstigen Familienbetrieb. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise Ende der 1920er Jahre ging die Firma Schuster in Konkurs. Seitdem gehörte der Betrieb nicht mehr der Familie. Schon mein Großvater, der noch in der Fabrik seines Vaters den Beruf des Kaufmannes erlernt hatte, suchte sich anderweitig eine Anstellung, kam ins Sachsenwerk nach Radeberg, lernte meine Großmutter kennen und beide bekamen ein Kind, meine Mutter.
Zur Konkursmasse gehörte eine Villa in Langebrück. In der wohnten die Exschwiegereltern meiner Frau aus erster Ehe. Das Leben hält unglaubliche Zufälle bereit. Das Garnknäuel unseres Schicksals spult den Faden ab und oftmals ist schwer zu erkennen, von wo nach wo dieser Faden läuft, welche Lebensläufe sich kreuzen.
An einem anderen Tag stehen wir in Nordböhmen auf dem Marktplatz von Bilina. In dieser Stadt, die damals noch Bilin hieß und am gleichnamigen Flüsschen liegt, wuchs mein Vater auf. Sein Vater, mein Großvater Ferdinand, spielte Schlagzeug. Mein Vater war sechzehn Jahre alt, als der großdeutsche Adolf den Krieg verlor. Die Familie musste, wie so viele aus dem Sudetenland, aufgrund der Beneš-Dekrete die Heimat verlassen. Ihnen blieben nur ein paar Stunden, um ein wenig vom Hab und Gut zu packen und ins Unbekannte zu flüchten. Sie ließen ein Haus in der damaligen Prokopigasse zurück. Die Vertreibung blieb zeitlebens eine dunkle Erinnerung meines Vaters. Meine Großeltern fanden eine neue Heimat in Freital. Mein Vater arbeitete später im Sachsenwerk Radeberg, fuhr täglich mit dem Zug von Freital in die Röderstadt. Dann lernte er meine Mutter kennen.
Als meine Frau und ich in Bilina standen, wussten wir nicht, wo das ehemalige Haus unserer Familie zu finden ist. Mittlerweile weiß ich es. Aber es ist mir egal. Genauso egal wie das Haus im Vogtland. Es gehört mir nicht, gehörte mir nie. Ich habe damit nichts zu tun. Und doch gehört es zu meiner Geschichte dazu.
Was wäre mit mir, wenn es weder die Weltwirtschaftskrise, noch den Krieg oder die Vertreibung der Sudeten gegeben hätte? Wäre ich heute Zigarrenfabrikantensohn oder würde ich in Bilin wohnen? Wäre ich überhaupt „Ich“? Meine Mutter hätte meinen Vater nie kennengelernt, hätte er nicht seine Heimat verlassen müssen. Mein Großvater hätte die Fabrik in Schöneck nicht verlassen, gäbe es sie noch. Er wäre Buchhalter gewesen, so wie er es viele Jahre lang war. Aber eben nicht in Radeberg, sondern im Familienbetrieb.
Unser Leben ist das Resultat von ganz unglaublichen Zufällen, von Ursachen, die weit jenseits des Persönlichen liegen. Gesellschaftliche Umstände bedingen Handlungen, die wiederum zu Lebensläufen führen, die wir oft nur in der Rückschau erkennen können. Wie oft glauben wir, wir hätten mit freiem Willen Entscheidungen getroffen? Und wie oft sind diese nur das Resultat der Umstände, in denen wir zu leben gezwungen sind?
Die Spuren unserer Vergangenheit führen in eine unbestimmte Zukunft.
Radeberg, mein Kindheitsort
Wenn es hieß, wir gehen in die Stadt, dann war das jedes Mal eine Freude. In die Stadt gehen bedeutete, nach einem längeren Fußweg durch die stillen Vorstadtstraßen unseres Städtchens Geschäfte zu besuchen, Verkehrslärm zu hören und vielleicht sogar etwas zu bekommen. Es war ja nicht selbstverständlich, dass dem Jungen, der ich damals war, jedes Mal was gekauft wurde. Aber manchmal klappte es.
Die richtige Stadt nahm aus meiner Sicht in Höhe der Brauerei ihren Anfang. Bis hierher war Radeberg mehr dörflich und still. Auf dem Weg lagen ein paar Bäcker- und Fleischergeschäfte, die für mich keinen Reiz hatten. An der Brauerei aber fing das städtische Leben an. Da war zunächst mal eine Imbissbude im Buswartehäuschen. Hier war es möglich, Bockwurst, Bier, Schokolade und alles andere, was ein Busreisender eventuell so brauchen könnte, zu kaufen. Denn hier war der städtische zentrale Busbahnhof ansässig. Entlang der Bahnhofstraße verteilten sich die Haltestellen für die unterschiedlichen Buslinien. Von hier aus fuhr man nach Bischofswerda oder Bautzen, nach Stolpen, Kamenz oder Dresden. Der „Kraftomnibus“ war neben der Eisenbahn das häufigste Verkehrsmittel der damaligen Zeit. Und die Imbissbude war nicht minder wichtig.
So passierte es gelegentlich, dass wir nach dem gefühlt langen Fußweg aus der Südvorstadt zunächst eine Pause einlegten, um uns zu stärken. Eine Bockwurst zu fünfundachtzig Pfennig mit Senf und einem Brötchen vertrug ich Halbwüchsiger immer. Die Buswartehalle lud wenig zum Verweilen ein. Nicht nur der allgegenwärtige Dreck, auch die Anwesenheit von zwielichtigen Gestalten ließen uns den Aufenthalt so kurz wie möglich ausfallen.
Danach liefen wir den Brauereiberg hinunter. Wenn mein Großvater dabei war, wurde meist erst mal die Post besucht. Die riesige schwere Eingangstür hatte für mich den Anschein eines Zugangs zu einer anderen Welt. Meist stand eine Schlange vor den Schaltern. Gleich links beim Eingang war Lotto spielen möglich. Mein Opa versuchte es jahrelang mit 6 aus 49, gewann neben Erfahrung meist nichts, spielte aber eisern weiter. War mein Vater mit mir unterwegs, dann passierte es, dass er telefonieren wollte. Das war zur damaligen Zeit ein Vorgang, der eingeplant und gewissenhaft ausgeführt werden musste. Meine Tante, die in Dresden wohnte, war per Fernsprecher zu erreichen. Mein Vater meldete ein Ferngespräch an. Je nach Auslastung dauerte es eine ganze Weile, bis wir aufgefordert wurden, in eine der beiden Fernsprechzellen einzutreten. Das waren kleine Buchten, mit Holz ausgekleidet, vor denen eine gewichtige Holztür angebracht war. Die ganze Konstruktion war halbwegs schalldicht, sodass der Nachbar das Telefongespräch nicht mitzuhören gezwungen war. Diejenigen, die dies aus dienstlichen Gründen taten, waren dazu gar nicht auf körperliche Nähe angewiesen. Nach Betreten der Fernsprechzelle sprang gewöhnlich das Licht an, was über einen im Boden eingelassenen Schalter bewerkstelligt wurde. Dann nahm mein Vater den Hörer des Fernsprechers ab, der an der Wand hing. Hatte man Glück, und meistens hatten wir es, dann war Tantchens Stimme in dem Apparat zu vernehmen und mir kam das vor, als wäre es ein Wunder.
Kamen wir hernach aus dem Postgebäude heraus und setzten unseren Weg über die Straße weiter stadteinwärts fort, liefen wir bei Schuh-Winkler vorbei. Ein düsterer Laden, angefüllt mit einer Unzahl an Fußbekleidung, gestapelt bis unter die Decke. In meiner Erinnerung waren neue Schuhe immer zu eng, drückten und wurden erst durch Einlaufen brauchbar.
In Höhe der Röderbrücke liefen wir dann an der einzigen öffentlichen Bedürfnisanstalt vorbei. War es nicht vermeidbar, hatte man hier Gelegenheit zum Erledigen gewisser Geschäfte. Betrat ich den übelriechenden Raum, verschlug es mir den Atem. Nur in dringenden Fällen war das Benutzen dieser Anstalt zu empfehlen. Erleichtert führte uns unser Weg weiter in Richtung Innenstadt.
Für mich eines der faszinierendsten Geschäfte war ein kleiner Laden mit Büchern gleich neben den HO-Lebensmitteln, dessen Filiale von den Einheimischen „Tschackerts“ genannt wurde. Krügers Buchgeschäft war immer ein Erlebnis. Hier standen in alten Regalen Bücher über Bücher. Schon damals war ich fasziniert von Druckwerken jeglicher Art. Die Inhaber und die Regale schienen für mich aus derselben Zeit zu stammen. Frau Krüger und ihre Tochter steuerten dieses Geschäft durch die Zeiten, handelten mit neuen und älteren Druck-Erzeugnissen, verkauften aber auch Kalender und Schreibwaren. Als der Laden geschlossen wurde, gaben die beiden ihre Bücher zu Sonderpreisen ab. Ein paar meiner Lieblingsbücher stehen noch heute im Regal und stammen aus diesem ganz besonderen Fundus.
An der Ecke zur Röderstraße gab es die „Tausend kleinen Dinge“. Vom Plastelöffel bis zum Schnippsgummi war es hier möglich, alles zu erstehen, was ein Haushalt in der damaligen Zeit nötig hatte. Beim Betreten des Geschäfts wurde ein Einkaufskörbchen genommen, in das man dann all die Sachen legte, die man glaubte zu brauchen. Für mich als Dreikäsehoch war es ein Laden voller Wunder.
Ein paar Meter hin in die Röderstraße lag ein kleines Fischgeschäft. In der Zeit des Jahreswechsels drückte ich mir an der Fensterscheibe dort die Nase platt. Was gab es zu sehen? Karpfen schwammen in einem viel zu kleinen Becken in viel zu großer Anzahl herum. Im Minutentakt wurde mittels eines Keschers eines der Tiere herausgefischt und mit einem Holzhammer ins fischige Jenseits befördert. Auf eine merkwürdige Art war das Töten und Verkaufen dieser Tiere für mich ein schaurigschönes Erlebnis. Komme ich heute an diesem Geschäft vorbei, sehe ich noch immer die Karpfen schwimmen. Manche Erfahrungen sind für ein ganzes Leben prägend. Aber ich schweife ab, die Weihnachtszeit ist nicht heran und unser Weg führt uns die Hauptstraße weiter in Richtung Innenstadt.
Gleich oberhalb der tausend Dinge gab es ein Rundfunkgeschäft. Hier wurde manches erstanden, was den Fortschritt zu jener Zeit anzeigte. Mein größtes Erlebnis hier war der Kauf meines ersten Kassettenrekorders. „Sonett“, „Minett“ oder „Mira“ hießen die Gerätschaften damals, mit denen wir Jugendliche Musik aufnahmen und insbesondere die aus westlicher Herkunft von einem Gerät auf das andere überspielten. Die Qualität wurde dabei von Mal zu Mal bescheidener, aber unsere Ansprüche damals waren es auch.
Wir kommen ans Kino. Dieser Ort war wichtig für mich zu jener Zeit. Die erste Berührung mit der Filmkunst erlebte ich hier. Ob es „Der kleine Muck“ oder die „Olsenbande“, ob es der „Gendarm von Saint Tropez“ oder die „Söhne der großen Bärin“ war, hier gab es fast immer was zu sehen. Draußen bewunderte ich die Filmplakate. Stand „P6“ dran, erlaubte man mir, schon mal allein ins Kino zur Nachmittagsvorstellung zu gehen. Die Anfangszeiten für die Vorstellungen waren jeweils auf 14:30, 17 und 20 Uhr festgelegt. Am Nachmittag passierte es manchmal, dass sich nur zwei Zuschauer einfanden, gespielt wurde aber erst ab drei Besucher. Öffnete man die gewaltige Doppelschwingtür am Haupteingang, stieg der Geruch von Fleisch- und Wurstwaren in die Nase. Kein Wunder, lag doch der dienstliche Zugang zur benachbarten Fleischerei auf dem Flur zum Kino. Nach links führte der Weg zu den Filmvorstellungen. Hinter der Glasscheibe an der winzigen Kasse saß während meiner Kinderjahre stets dieselbe kleine Frau. Sie achtete streng auf das Alter der jungen Besucher. Hier entschied sich auch, ob man Parkett oder Sperrsitz wählte. Der Sperrsitz war den vorderen drei Reihen zugeordnet. Wer auf ihnen saß, renkte sich während der Vorstellung den Hals aus beim Hochgucken. Es waren die billigsten Plätze im Kino, manchmal aber die einzig verfügbaren. Die teuersten Karten waren dem Balkon vorbehalten. Dort hinaus führte eine steile Treppe. Aber als Kind war mir fast immer ein Platz im Parkett sicher. Damals gab es zu fast allen Filmen ein Programmheft, das den Film, die Schauspieler und die anderen Beteiligten vorstellte. Es gehörte dazu, ein solches Heft zu erwerben.
Bevor ich zum Kinogänger wurde, existierte in der Röderstadt ein zweites Filmtheater. Dieses war im damaligen Saal des Kaiserhofes untergebracht. Aus den Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass es Vorstellungen gab, die so gefragt waren, dass die Filme zeitversetzt hintereinander in beiden Sälen gezeigt wurden. Die Filmrollen sind nach dem Abspielen einzeln von einem zum anderen getragen worden.
Gegenüber vom Kino gab es einen Gemüseladen mit einer der originellsten Verkäuferinnen der Stadt. Eine schon betagte, aber umso resolutere Frau führte hier das Kommando. Hier wurde Handel der ganz speziellen Art betrieben, offenbar war die Dame die Erfinderin der Kompensationsgeschäfte, zumindest im Radeberger Raum. „Was, Äppel willste, dann musste een Pfund Sauerkraut mit koofen.“ In Zeiten des nicht üppigen Angebotes an Obst und Gemüse war das ein durchaus lohnendes Geschäftsmodell.
Genau wie in diesem Gemüseladen war es damals auch bei Frau König im Kurzwarengeschäft daneben noch Brauch, dass es keine Selbstbedienung gab. Ein Ladentisch trennte den Kundenbereich vom Rest des Geschäfts ab. Die Kunden wurden bedient und standen meist in einer Warteschlange an. Ich erinnere mich, wie ich einmal die ganze Kundschaft zum Lachen brachte. Ich fragte meine Mutter ganz unbekümmert, wo denn Frau König ihre Krone hätte.
Schon habe ich gedanklich fast den Marktplatz erreicht. Auf der rechten Seite kurz vorm Markt gab es die „Kaffeestube“. Hier schmeckte der Kakao in höchstem Maße lecker. Voraussetzung war, einen Platz zu bekommen. Es gab nur etwa zehn bis fünfzehn Stühle an kleinen Tischen. Erhaschten wir welche, gab es zum Kakao meist ein Stück Sahnetorte. Das war eine mit drei Schichten: Boden, Schoko- und Sahneschicht. Im Sommer noch ein Eis am Stil dazu, für zwanzig Pfennige und mit Schokolade drum herum.
An der Ecke zum Marktplatz dann die Drogerie Schumann. Das war kein Laden, das war eine Institution. Hier war vieles vorrätig, was der Mensch in Bad und Küche benötigte. Es roch nach Seifen und Waschmittel, alles wohlgeordnet und gut sortiert. Mindestens zwei oder drei Verkäuferinnen bedienten hier bienengleich die Kundschaft. Ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher in diesem Geschäft mal fälschlicherweise ein Fußpilzmittel erstand, welches ich für Shampoo hielt, weil sich die Flaschen ähnelten. Ich wunderte mich nur, warum das Zeug nicht wie gewöhnlich schäumte, selbst bei höherer Dosierung nicht. Ich glaube aber nicht, dass dieses Mittel Schuld an meiner heutigen Frisur ist.
Der für einen Jungen im Vorschulalter schönste Laden der Stadt befand sich an der Ecke zur Niederstraße. Spielwaren-Böhme war ein Paradies für Kinder. Autos, Baukästen, Puppen, Bälle, Zündplättchenpistolen, es gab nichts, was ein Kinderherz nicht höherschlagen ließ. Ich erinnere mich an Herrn Böhme als einen großen und hageren Mann, etwas ernst, aber immer freundlich zu den Kindern. Die größte Faszination, der ich damals erlag, war ein Kaleidoskop, das man bei ihm erwerben konnte. Schüttelte man die Metallteile darin, ordneten sie sich in bestimmter Weise. Schaute man durch ein Okular am Ende hindurch, wurde durch ein findiges Spiegelsystem die entstandene Figur vervielfacht. Das regte meine Fantasie ungemein an. Dieses Ding gehört mit in die Kiste der Kindheitserinnerungen, die ich schon ein Leben lang mit mir herumschleppe.
Manchmal begleitete ich meine Mutter zum Friseur. Insbesondere dann, wenn auch bei mir mal wieder ein Haarschnitt fällig war. Der „Salon Bach“ lag zur damaligen Zeit in der Röderstraße. Oft nahm ich ein Buch mit, um die Wartezeit zu verkürzen. Die Anfertigung einer Welle von einiger Dauer benötigte schon mal gefühlte halbe Tage. Nachdem mir zunächst die Haare gestutzt worden waren, setzte ich mich auf einen der Warteplätze und schaute dem Getriebe zu. Herr Bach und seine Frau wuselten emsig. Trockenhauben wurden hierhin und dorthin geschoben, deren Temperatur geregelt, Friseurumhänge herumgewirbelt und ausgeschüttelt, Haare auf dem Fußboden zusammengekehrt und Lockenwickler auf Damenköpfen befestigt. Das wurde aber schnell langweilig. Abwechslung kam auf, wenn ein Eiswagen Kühleis anlieferte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite betrieb ein Molkereigeschäft seinen Handel. Elektrische Gefrierschränke hatten noch lange nicht überall Einzug gehalten. Um die frische Ware zu kühlen, gab es sogenannte Eisschränke, das waren quasi Kühlschränke ohne elektrischen Antrieb. In die wurden Eisblöcke gelegt, die das Kühlgut frisch hielten. Wir hatten im Keller ebenfalls so ein Monstrum von Schrank stehen. Dieser hatte aber seine aktive Dienstzeit schon lange hinter sich und diente jetzt zum Aufbewahren von allerlei Kleinigkeiten, die man ja noch mal brauchen könnte.
Es gab in der Radeberger Innenstadt eine ganze Anzahl von originellen Geschäften und Einrichtungen. So beispielsweise „Farben-Zier“, das Fachgeschäft für Anstriche und Tapeten aller Art, gleich neben dem damals geschlossenen Kaiserhof.
An der Ecke zur Röderstraße gab es das „Modehaus Carl Schulze“, ein privat geführtes Bekleidungsgeschäft, dessen Inhaber Hofmann hieß. Hier arbeitete meine Mutter viele Jahre als Verkäuferin. Ein privat geführtes Unternehmen war die Ausnahme in der damaligen DDR-Zeit. Manches war ein wenig schnurrig dort. So wurde aus Kostengründen auf Toilettenpapier verzichtet. Stattdessen waren die Angestellten gehalten, das nach dem Auspacken von Anzügen und Mänteln nutzlos gewordene und kostenlos verfügbare Seidenpapier zu verwenden. Wer den Härtegrad des mausgrauen DDR-Klopapiers kennt, wird die Benutzung dieses Papiers für gewisse Zwecke zu schätzen wissen. Ich hielt mich nach der Schule oft im Laden auf und habe manches aufgeschnappt. In der Mitte des Geschäfts stand eine viereckige Spiegelsäule, für den Fall, dass sich ein Kunde aus allen Himmelsrichtungen zu betrachten wünschte. Bediente der Inhaber selbst, legte er das typische Geschäftsgebaren an den Tag, welches auch heute Verkäufern und Vertretern eigen ist und das manchmal zumindest ein Lächeln hervorruft. An der Wand hing ein Werbeschild des Inhabers, dessen Text ich so oft gelesen habe, dass ich ihn auswendig wiederzugeben vermag: „Es ist nicht nötig, zur Großstadt zu laufen, hier kann man gut und preiswert kaufen. Dazu findet man hier alles, was gefällt, hat große Auswahl und spart Geld.“ Na ja.
Auf der Röderstraße fristete eine Drogerie ihr Dasein, die man nur über eine Treppe erreichte, welche für mich damals einer Himmelsleiter glich. Betrat man das Geschäft, knarrten die Dielen, das Parkett war offenbar Vorkriegsware und hatte schon einiges erlebt. Hier arbeitete eine Frau, die ich in meiner Erinnerung als Riesin abgespeichert habe. Ich glaube, ich bin nie wieder einer so hochgewachsenen Dame begegnet.
Im Radeberger Kulturhaus, dem ersten seiner Art in der sowjetischen Besatzungszone, erlebte ich so manchen kulturellen Höhepunkt. In der Gaststätte im Erdgeschoss gab es eine von den damals in vielen Kneipen vorhandenen Musikboxen. Gegen einen kleinen Obolus wählte sich der interessierte Gast eine Singleschallplatte aus und auf Knopfdruck spielte der Automat die dann ab. Schon ertönte dann „Blau ist die Nacht, und der Mond am Himmel, schau wie er lacht.“ Diese Gaststätte hatte einen Eigengeruch, dem ich nur selten anderswo begegnet bin. Möglicherweise handelte es sich um eine Mischung aus kaltem Zigarettenrauch, Küche, Möbelpolitur und Auslegware. Würde ich ihn heute irgendwo riechen, stünde das alte Kulturhaus in alter Schönheit vor mir.
Hier im Kulturhaus feierten wir den Abschluss der 10. Klasse, hier gab es Brigadefeiern, Frauentagsveranstaltungen, Konzerte und alles weitere an Kultur. Zahlreiche künstlerische Zirkel hatten hier ihr Zuhause. In der Bar im Obergeschoss wurde so manche „Grüne Wiese“ gemäht. Hier begegnete ich dem ersten „richtigen“ Schriftsteller in meinem Leben. Herbert Jobst las damals aus seinem Buch „Der Findling“, welches die Kindheitserlebnisse als Findelkind in der Röderstadt zum Inhalt hat. Radeberg heißt im Buch Rabenberg und die Röder ist die Eder. Ansonsten ist meine Heimatstadt gut wiederzuerkennen. Ich war als Jugendlicher fasziniert davon, dass Radeberg literarisiert worden war. Herbert Jobst signierte mir mein Buch und freute sich darüber, dass ich eines mit Illustrationen besaß. Er wie auch das Buch sind weithin vergessen.
Manchmal war der Gang in die Stadt für mich, das Südvorstadtkind, mit dem Besuch des Heimatmuseums verbunden. Für einen abenteuerlustigen Jungen war das stets etwas Besonderes. Schon der Anblick des Gemäuers von „Schloss Klippenstein“ erregte meine Fantasie. Im Hof war bereits die Vergangenheit zu spüren. Kühle umfing uns. Nie wieder war die Magie des Schlosses so groß wie in Kindertagen. Den Eingang zum Museum erreicht man über eine Treppe, deren Stufen schon von abertausenden Schuhen und Stiefeln zertreten worden war. Wie ich heute weiß, würde auch ich diese Treppe noch unzählige Male hinauf- und hinabsteigen.
Unsere Schritte hallten im Vorraum. Die Tür schlug hinter uns zu. Wir wurden von einem Herrn freundlich begrüßt. In meiner Vorstellung wohnte der schon immer hier, gehörte zum Inventar des Hauses. Mein Vater bezahlte das übliche Eintrittsgeld. Dann begleitete uns das Faktotum durch die Räume des Museums. Es gab ein paar Ausstellungsstücke, an die ich mich nach fast einem halben Jahrhundert lebhaft erinnere.
Türschlösser, riesige Dinger, die an so mancher Radeberger Tür über viele Jahre hinweg ihren Dienst versehen hatten, waren zu besichtigen. Unser Begleiter führte uns deren Mechanik vor. Schlüssel, die in keine Hosentasche passen, wurden benutzt, um die Schließwerke zu bedienen. Im Stillen verglich ich diese Monsterschlüssel mit jenem Ding, welches uns Zugang zu unserer Wohnung verschaffte. Es stimmte mich froh, dass es jetzt wesentlich kleinerer Schlüssel bedurfte. Offenbar versahen noch immer einige dieser unhandlichen Riesen ihren Dienst. Wenn wir einen Raum verließen, um den nächsten zu besuchen, verschloss unser Führer die Tür mit einem solchen Monstrum von Schlüssel.
Mehr beeindruckte mich aber eine kleine Holzkiste. Die enthielt Geheimfächer. Uns wurde vorgeführt, wie an die heranzukommen war. Äußerlich unscheinbar, bot das Kästchen in seinem Inneren Platz für verborgene Dinge. Vielleicht hatten unsere Vorfahren darin Geld aufbewahrt, verbotene Liebesbriefe oder gar ihr Testament. Jedenfalls hatte dieses Schatzkästchen ein Geheimnis. Und die sind für achtjährige Knirpse mehr als anziehend.
Das Schloss unseres Städtchens beherbergte für lange Zeit das Amtsgericht und damit ein Gefängnis. Gefängnisse und die Geschichten, die sich darum ranken, bieten Stoff für jene Abenteuer, die sich ein Junge auszudenken vermag. Die Gefängniszellen in der Vorburg des Schlosses umrankte geheimnisvoller Zauber. Während meiner Kindertage waren sowohl Gefängnis wie Amtsgericht längst ausgezogen. Die Arrestzellen wurden als Ausstellungsräume des Museums benutzt. Aber es war erahnbar, dass hier einst Gefangene einsaßen. Die Türen mit Gucklöchern zeugten davon. Meine Fantasie wurde angestachelt. Wer sind die Bösewichte und Verbrecher gewesen, die man hier eingesperrt hatte? Ich sah sie vor mir, wie sie mit ihren Ketten rasselten, um Gnade bettelten und sich nachts, wenn der volle Mond schaurig durch die Gitterstäbe der winzigen Fenster hereinsah, schlaflos auf ihren Lagern wälzten. Und gab es den Geheimgang wirklich, der vom Schloss zur Schlossmühle führen soll und durch den die Bösewichte möglicherweise hätten zu fliehen vermocht?
All das gab es nur in meiner Vorstellung. In Wirklichkeit waren interaktive Ausstellungsstücke in den ehemaligen Zellen zu bewundern. Ausstellungstafeln zur Geschichte des Radeberger Landes beispielsweise. Die Interaktion bestand darin, einen Knopf zu drücken und an einer Stelle der Tafel leuchtete ein Lämpchen auf. Das faszinierte den Knirps, der ich war, ebenfalls ungemein und es war für mich das Beste am ganzen Museum. Die Vorburg hatte es mir angetan.
Umso enttäuschte war ich wenig später. Die Räume waren wegen Baufälligkeit für lange Zeit nicht mehr zugänglich. Und mir blieb es versagt, jemals wieder die Knöpfe und Tasten zu drücken. Manche Enttäuschung aus Kindertagen trägt man ein ganzes Leben lang mit sich herum. Die gesperrten Räume heizten die Fantasie aber zusätzlich an. Was passierte nun in den Zellen? Welche finsteren Gestalten hausten hier, auf wen würde ich treffen, wenn ich wieder einmal hineinkäme? Es waren banale Gründe, die zur Sperrung geführt hatten. Es fehlte, wie so oft, am Geld für die Sanierung. Selbst die große Freitreppe, heute der offizielle Zugang zum Museum, war schon gesperrt, nachdem ein Teil eingestürzt war. Ein Holzdach über der Zugangstreppe mit den halsbrecherisch ausgetretenen Stufen schützte vor herabfallenden Dachziegeln. Ein Provisorium, das, wie man weiß, am längsten hält. Und es hielt bis zum Verschwinden der DDR.
Der Mann mit der Geduld und dem fundierten Wissen, der meinen Vater und mich viele Male durch die Ausstellung des Heimatmuseums geführt hat, war der damalige Museumsleiter Rudolf Limpach. Er war ein großer Kenner der Radeberger Stadtgeschichte und maßgeblich am Aufbau des Museums beteiligt, welches im Jahr 1953 eröffnet wurde. Ich lernte den 1920 geborenen Museumschef als Vorsitzenden der Kulturbund-Ortsgruppe später kennen und schätzen. Er starb fünfundsiebzigjährig im Jahr 1995.
Zur jährlich stattfindenden Weihnachtsfeier der damaligen Kulturbund-Ortsgruppe, die in den Räumen des Jugendklubs durchgeführt wurde, gestaltete Rudolf Limpach meist ein kleines Kulturprogramm. Geschichten aus der Heimat oder Gedichte und Anekdoten wurden gelesen. Bei einer dieser Gelegenheiten rezitierte er „Die Vögel warten im Winter vor dem Fenster“ von Bertolt Brecht. Darin werden die Tiere der Reihe nach aufgerufen, vorzutreten und den Dank für das im Jahr Geleistete entgegenzunehmen. „Sperling, komm nach vorn, Sperling, hier ist dein Korn und besten Dank für die Arbeit.“ Weil wir schon ein paar Glühweinchen intus hatten und weil der Alkohol, in geringen Mengen genossen, bekanntlich die Denkzellen anregt, fiel mir plötzlich die folgende, nicht von Brecht stammende Zeile als Fortsetzung des Gedichtes ein: „Schluckspecht, komm nach vorn, Schluckspecht, hier ist dein Korn.“ Rudolf Limpach schaute mich verständnislos an, als ich in einen Lachkrampf verfiel, der so gar nicht zu seinem ernsten Vortrag zu passen schien. Später lachten wir dann beide über die zusätzliche Gedichtzeile.
Da das ehrwürdige Gebäude von „Schloss Klippenstein“ damals auch die Räume des örtlichen Jugendklubs beherbergte, wurde mir und vielen anderen meiner Generation dieser Ort eine Zeit lang zum zweiten Zuhause. Es gibt keine Tages- oder Nachtstunde, zu der wir nicht die Stufen hinauf ins alte Schloss benutzt hätten.
Anfang der Achtzigerjahre gründete eine Gruppe interessierter Jugendlicher im „Schloss Klippenstein“ den „Astronomischen Jugendclub Radeberg“ (AJC). Die neben dem eigentlichen Jugendklub bestehende Gruppe hatte die Vorstellung, Jugendliche für naturwissenschaftliche Fragestellungen zu begeistern und das mit Geselligkeit zu verbinden. Zahlreiche Veranstaltungen und Vorträge wurden organisiert mit zum Teil namhaften Referenten der URANIA. Eine kleine Veranstaltungsreihe hieß „Ach so – Wissenschaft im Gespräch“. Wissenschaft unterhaltsam und erlebnisreich darzustellen, war unser Ziel.
Zum Fasching wurde einmal das Thema „Geisterstunde in der Galaxis“ gewählt und ein großes Wandbild mit astronomischen Motiven in vielen Malstunden selbst gestaltet. Für die Mitglieder der AJC waren sowohl der Klub wie das „Schloss Klippenstein“ ihre Heimstatt, bot sich doch hier die Möglichkeit zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Und Familie Limpach, die im Erdgeschoss des alten Gemäuers wohnte, unterstützte uns uneigennützig und mit viel Geduld und Verständnis. Ein besonderer Höhepunkt war es, wenn ausländische Gäste den Klub besuchten. So kamen beispielsweise polnische Jugendliche zu Besuch und am Ende der Achtzigerjahre auch junge Menschen aus der alten Bundesrepublik. Lange Gespräche bildeten so den Beginn einer damals noch kaum zu glaubenden Annäherung von Ost und West. Aus heutiger Sicht lächerlich erscheint das Verbot für die Ost-Jugendlichen, den Westreisebus, der auf der Langbeinstraße parkte, zu betreten. Noch heute lebende Mitmenschen wachten mit geübtem Blick auf die Einhaltung des Verbotes.
Um die Veranstaltungen der beiden Jugendklubs gastronomisch abzusichern, galt es, einen relativ großen logistischen Aufwand zu betreiben. So wurden bis zu zwanzig Getränkekästen vom Lebensmittelgeschäft auf der Oberstraße mit einem Handwagen zum Schloss befördert und dann ins Obergeschoss hinaufgetragen. Wir besaßen offenbar zu jener Zeit eine große Energie und waren mit Leidenschaft bei der Sache.
Dass ich wie viele andere Radeberger Jugendliche hier zur Musterung herbestellt wurde, gehört zu den weniger erinnernswerten Erlebnissen. Dieser Ort, der uns Heimat war, wurde plötzlich von ganz anderen Mächten beherrscht. Das fühlte sich schon ein wenig merkwürdig an. Eben hatten wir hier noch getanzt und gefeiert, und nun wurden wir schmalbrüstige Jungs militärisch begutachtet. Für viele war der „Ehrendienst“ in der NVA später zugleich das Ende ihrer Jugend.
Zeiten und Menschen ändern sich, nur Orte lassen die Dinge eine Weile lang weiterleben. Die Jugendzeit in „unserem“ Schloss ist bleibende Erinnerung.
Vom Schlitten gefallen
Als ich ein Kind war, das noch nicht zur Schule ging, hatte meine Familie kein Auto. Wir hatten es auch später nicht, sodass wir stets auf öffentliche Verkehrsmittel oder auf die eigenen Füße angewiesen waren. Mein Vater hatte kein Interesse an Autos und später durch eine Staroperation das räumliche Sehen eingebüßt, sodass für ihn das Führen eines Automobils nicht mehr in Frage kam. Und meine Mutter traute sich das erst recht nicht zu. So blieben wir unmotorisiert, was mich nie störte, da ich es nicht anders kannte.
Für den normalen Alltag war ein Auto, im Gegensatz zur heutigen Zeit, auch gar nicht nötig. Einkaufen konnte man zu Fuß gehen, die damaligen Kaufhallen lagen in erreichbarer Nähe. Ansonsten gab es Bus und Eisenbahn zu erschwinglichen Reisepreisen und auf die Fahrpläne war, auch im Gegensatz zu heute, sogar Verlass. Wollten wir nach Dresden, fuhren wir gewöhnlich mit der Eisenbahn, die gelegentlich sogar noch von einer Dampflok gezogen wurde, was mich als Kind unwahrscheinlich beeindruckt hat. Ich hielt das Fahren mit dem Zug für völlig normal, ein eigenes Auto jedoch für abgehoben, solange ich selbst keins besaß.
Manchmal besuchten wir meine Tante, die Schwester meines Vaters, in Dresden. Als wir das wieder einmal vorhatten, war es Winter geworden, der Schnee lag zentimeterhoch auf den Straßen und Gehwegen. Meine Eltern entschieden sich zu einer Winterwanderung samt Schlitten durch die Dresdner Heide bis Bühlau. Dort wollten wir mit der Straßenbahn zur Tante fahren und zurück mit dem Zug. Gesagt, getan. Es war Vorweihnachtszeit, die Wälder sahen märchenhaft weiß aus.
Wir besaßen nur einen kleinen, ziemlich kurzen Schlitten, ohne Hörner. Vermutlich deshalb, weil Schlitten möglicherweise zu den rareren Artikeln des DDR-Einzelhandels gehörten. Meine Freunde hatten damals fast alle die größeren Gefährte fürs Rodeln, nur ich musste mich mit dem kleinen Ding begnügen. Für unsere Winterwanderung wurde also dieser Schlitten aus dem Keller geholt. Vorn wurde ein Paket, welches für die Tante bestimmt war, festgezurrt. Dahinter kam ein Kissen auf den Schlitten, festgebunden mit einem Ledergürtel und darauf wurde ich platziert. Vater war das Kutschpferd, Mutter lief neben ihm und ich saß vergnügt hinter der Kiste. Die verschneiten Bäume regten meine Fantasie an. Es war zauberhaft, durch diese Stille gezogen zu werden. Manchmal rieselte Schnee von den Fichten, zerstäubte in der kalten Luft, dass die Kristalle funkelten. Der märchenhafte Wald ließ mich Geschichten ausdenken. Ich sah die Figuren aus meinem Märchenbuch durch den dunklen Tann huschen, sah die alte Hexe und den bösen Wolf, sah Rumpelstilzchen im Wald tanzen und Rotkäppchen mit ihrem Korb. Ja, die Fantasie eines Fünfjährigen kennt keine Grenzen. Wirklichkeit und Wahrheit vermischen sich zu dem, was wir später „unsere Kindheit“ nennen und was wir irgendwann unwiederbringlich verlieren.
So wurde ich also durch den Wald chauffiert und hatte meine Freude daran. Irgendwann vergaß ich offenbar, mich richtig festzuhalten auf meinem kleinen Kufenfahrzeug. Vater und Mutter unterhielten sich vorn, der Schlitten durchfuhr eine Bodenwelle und ich saß mit einem Mal im Schnee. Ich blickte zunächst erstaunt, wie mein Schlitten mehr und mehr kleiner wurde, das Lachen meiner Mutter leiser und die Stimme meines Vaters kaum noch zu hören war. Ich war allein, würde verlassen im Wald liegenbleiben und für alle Zeit vergessen sein. Offensichtlich war ich von dem Vorgang so überrascht, dass ich zunächst zu keinerlei Lautäußerung fähig war. Als aber meine Eltern noch immer keine Notiz von meinem Absturz nahmen und mir die vollkommene Tragweite meines Alleinseins bewusst wurde, fiel mir dann doch ein, was zu tun war. Ich fing an, aus Leibeskräften zu schreien und zu heulen, was letztlich zu meiner Rettung führte. Aber ich lernte an diesem Tag, dass man manchmal lautstark auf sich aufmerksam machen muss, wenn man nicht zurückbleiben will.
Erdbeeren mit Milch
In der Kleinleutewelt meiner Großeltern war es vollkommen unüblich, im Sommer Kaltgetränke im Laden einzukaufen. Dazu war besonders mein Opa, der als Buchhalter arbeitete und auch so lebte, niemals bereit. Stattdessen wurde Malzkaffee gekocht und in eine Blechkanne gefüllt. Diese Kanne stand dann tagsüber in der Küche und jeder, der Durst hatte, bediente sich daran. Die Sparsamkeit des Großvaters ging so weit, dass er auch das Trinkgefäß wegließ und direkt aus dem Schnäuzchen der Kanne trank. Und wenn überhaupt Becher zum Einsatz kamen, waren es ausgediente Senfgläser. Ich fand das Trinken aus der Kanne immer ein bisschen eklig und der Durst musste schon heftig werden, um von dem Gebräu etwas zu mir zu nehmen. Doch je heißer der Sommertag war, umso eher war ich bereit, mich zu überwinden und das kalte, braune Gesöff löschte meinen Kinderdurst.
Meine Oma wurde krank, sehr krank. Ich war etwa fünf Jahre alt und verstand nicht, was vorging. Eine Tasche wurde gepackt, es wurden Telefonate geführt, wozu meine Mutter zu einer Telefonzelle laufen musste, und schließlich warteten wir auf einen Krankentransport, der die Großmutter in ein Krankenhaus bringen sollte. Um mir den ganzen Abschiedsschmerz zu ersparen, gingen mein Großvater und ich in den Wald, wir wollten einen Spaziergang machen. Der Wald lag nicht weit entfernt, vielleicht ein halber Kilometer war bis zu den ersten Bäumen zurückzulegen. Wir hatten aber bereits einen Weg eingeschlagen, der uns tiefer in den Wald führte. Mich beschlich ein komisches Gefühl, dass ich damals nicht deuten konnte. Heute weiß ich, dass ich es als Vorahnung bezeichnen würde. Ich riss mich von der Hand meines Großvaters los, rannte, rannte und rannte, wollte zur Großmutter zurück. Mein Opa ging wegen einer Kriegsverletzung am Stock. Er hatte einen Durchschuss in Adolfs Krieg erlitten und es war aussichtslos für ihn, mir zu folgen. Er rief – umsonst. Ich rannte um mein Leben und erwischte meine Oma gerade noch auf der Treppe, als sie eben abreisen wollte. Auf die erstaunte Frage meiner Eltern wo ich denn herkäme und was ich hier machte, sagte ich: „Ich wollte Oma noch mal sehen.“ Ich drückte sie ganz fest an mich. Sie stieg dann in das Krankenauto ein. Meine Eltern sind mit in die Klinik gefahren.
An diesem Abend gab es Erdbeeren mit Milch, die meine Oma noch zurechtgestellt hatte. Erdbeeren mit Milch sind das letzte gewesen, was ich von meiner Oma bekam. Sie starb nach wenigen Tagen im Krankenhaus.
Abenteuer Schienenbus
„Irgendwann fahren wir mal mit dem Ding“, sagte mein Vater. Ich drängelte ihn, ich wollte mit diesem roten Gefährt, dieser Schachtel auf Schienen, einfach mal fahren. Als Kind hat man Wünsche. Wünsche, die erfüllt werden wollen. Von der Erfüllung solcher Wünsche hatte der Junge, der ich war, eine ganz bestimmte Vorstellung. Nicht nur, dass es feststand, ich würde später Lokführer einer Dampflok werden. Das war ja bereits ausgemachte Sache. Die Dampflok war damals noch etwas fast Alltägliches, sie zog die Züge nach Dresden und in die Gegenrichtung, es roch nach Kohle und Dampf, wenn die Ungetüme am Bahnsteig zum Stehen kamen. Es zischte und knackte, es brummte und summte, es war ein beunruhigendes Ungeheuer, das da in den Bahnhof der Kleinstadt hineinfauchte. Nein, mit einem Zug, der von einer Dampflok gezogen wurde, hatte ich schon genug an Erlebnisvorrat gespeichert. Ich wollte unbedingt mit dem Schienenbus fahren. Die auch manchmal als Ferkeltaxe bezeichneten Triebwagen verkehrten zwischen Pirna und Arnsdorf. Ich sah sie oft, nur damit fahren, das war mir nicht vergönnt. Es lag einfach an der falschen Strecke, die Ziele, welche an dem Bahngleis lagen, waren nicht unsere Ziele und so konnte ich den kleinen, roten Flitzern immer nur zuschauen. Sie verließen den Bahnhof in Arnsdorf in Richtung eines mir unbekannten Landes, welches eben nie zu unseren Reisezielen gehörte. Ich stellte es mir abenteuerlich vor, wie ich in diesem Gefährt säße, in die Landschaft schaute und nicht von einem dampfenden Riesenross gezogen würde. Ein sanftes Brummen des Dieselmotors wäre das Geräusch, welches mich auf der Fahrt begleiten würde. Ich schaute wehmütig auf die Reisenden, die in die roten Wagen stiegen und davonbrausten, während ich in einem stinknormalen Zug saß, der von einem dieser Dampfrösser gezogen wurde.
Schon seit dem Jahre 1875 verkehrten Züge zwischen Pirna und Arnsdorf, dreißig Jahre nach Eröffnung der Bahnstrecke zwischen Dresden und Görlitz fuhren hier die ersten Bahnen. Vorrangig zum Gütertransport, insbesondere von böhmischer Kohle bestimmt, verlor die fast 21 Kilometer lange Strecke schon bald an Bedeutung und wurde bereits nach dem Ersten Weltkrieg zur Nebenstrecke erklärt. Aber das interessierte den Jungen damals alles nicht. Viel mehr war interessant, dass hier die Schienenbusse fuhren, jene Fahrzeuge, die immer ohne ihn losbrummten und mit denen er doch so gern einmal mitgereist wäre.
Die Zeit verging mit Geduld üben. Geduld, ein fast ausgestorbenes Wort in einer Welt der Eile und Hektik, Geduld haben und auf etwas warten können sind nicht gerade die Stärken unserer Tage. Der Junge von damals hatte Geduld und die sollte belohnt werden. Eines Tages war es soweit. Wir kamen von einem Tagesausflug aus der Schweiz, der Sächsischen, versteht sich. Die andere war unerreichbar in jenen Zeiten, als der Junge jung war. Also kamen wir mit dem Zug aus der Schweiz gen Dresden gefahren. „Wir könnten in Pirna aussteigen und mit dem Schienenbus über Arnsdorf nach Hause fahren.“ Die Idee meines Vaters elektrisierte mich. Na klar, das war es, worauf ich hoffte. Endlich sollte es mir gelingen, sollte mein Wunsch wahr werden. Wir stiegen also in Pirna aus. Wir suchten und fanden den richtigen Bahnsteig. Es war noch eine reichliche Dreiviertelstunde Zeit bis zur Abfahrt. Wir gingen in das Bahnhofsgebäude und wollten Fahrkarten kaufen.
Falls jüngere Menschen diesen Text lesen sollten: Ein Bahnhofsgebäude ist ein Haus, in dem Menschen arbeiteten, die bei der Eisenbahngesellschaft angestellt waren und manchmal gar dort auch wohnten. Sie verkauften Fahrkarten, nahmen Reisegepäck auf, verluden selbiges, gaben Auskunft zu den Fahrplänen, stellten Weichen, begrüßten Reisende per Lautsprecherdurchsage und schlussendlich waltete da auch jene Person, die mit roter Dienstmütze, einer Pfeife und einer sogenannten Signalkelle die Züge abfahren ließ. In einem Bahnhofsgebäude gab es, selbst auf kleineren Bahnhöfen, meist eine Bahnhofswirtschaft, eine Kneipe also, in der man sein Bierchen trinken oder etwas essen konnte. So ließ sich die Wartezeit bis zur Ankunft des Zuges gut überbrücken. Außerdem stand der Reisende bei Regen oder Schnee trocken und vor Wind geschützt in so einem Haus.
Heute sind Bahnhofsgebäude meist verschlossen und ruinös oder haben mit dem Bahnhof gar nichts mehr zu tun. Der Reisende kauft sich an einem Automaten seine Fahrscheine, die neudeutsch Tickets genannt werden, und bei Regen, Schnee und Wind helfen warme Gedanken weiter. Lautsprecherdurchsagen kommen von einem ferngesteuerten Automaten, der aus, meist von weiblichen Menschen gesprochenen, Sprachschnipseln ganze Sätze baut und diese per lautsprechendem Gerät unter die Reisenden bringt.