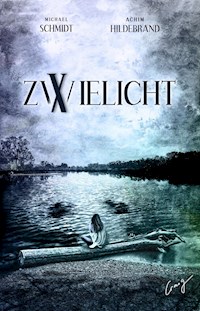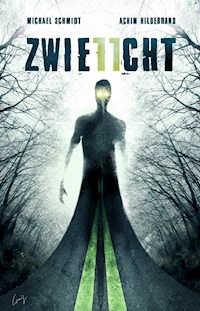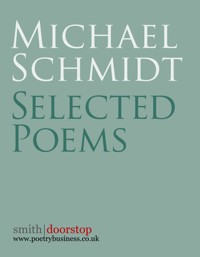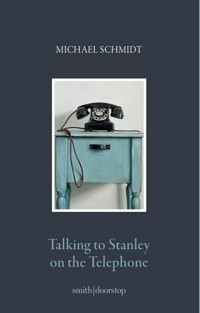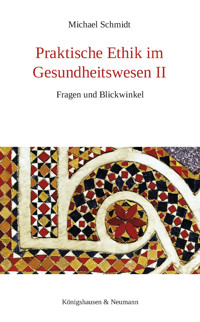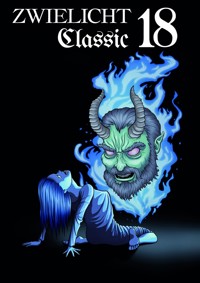
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die 18. Ausgabe von Zwielicht Classic. Das Titelbild ist von Oliver Pflug. Die Illustrationen sind von Adrian van Schwamen. Harald A. Weissen - Türen (2015) Yvonne Tunnat - Morsche Haut (2022) Silke Brandt - Schmutziger Donnerstag (2021) Peter Schünemann - Hello, Weenie (2024) Andreas Tillmanns - Wie viele Tage … (2006) Michael Tillmann - Der Lakonische Cowboy trifft Metal Magnus (2023) Martin Ruf - Fallen (2001) Marianne Labisch - Kandel (2011) Torsten Scheib - Schiff der Spione (2019) Karin Reddemann - Hässlich (2020) Uwe Voehl - Warteschlange (2025) Erik Hauser - Die Abstellkammer (2024) Michael Schmidt - Schwarz wie Blut (2011) Artikel: Silke Brandt - Exklusionszonen am Wegesrand: Zwischen Dystopie und Nostalgie (2023)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zwielicht Classic
18
Das Titelbild stammt von Oliver Pflug
Illustrationen von Adrian van Schwamen
Magazin für phantastische Literatur
Horrormagazin Zwielicht Classic
Band 18
Herausgegeben von Michael Schmidt
Kontakt: [email protected]
Das Titelbild stammt von Oliver Pflug.
Die Illustrationen sind, wenn nicht anders angegeben, von Adrian van Schwamen.
Das Copyright der einzelnen Texte liegt beim jeweiligen Autor.
Das Copyright der Zusammenstellung liegt beim Herausgeber.
Januar 2025
Inhalt
Vorwort
Geschichten
Harald A. Weissen – Türen (2015)
Yvonne Tunnat – Morsche Haut (2022)
Silke Brandt – Schmutziger Donnerstag (2021)
Peter Schünemann – Hello, Weenie (2024)
Andrea Tillmanns – Wie viele Tage … (2006)
Michael Tillmann – Der Lakonische Cowboy trifft Metal Magnus (2023)
Martin Ruf – Fallen (2001)
Marianne Labisch – Kandel (2011)
Torsten Scheib – Schiff der Spione (2019)
Karin Reddemann – Hässlich (2020)
Uwe Voehl – In der Warteschlange (2025)
Erik Hauser – Die Abstellkammer (2024)
Michael Schmidt – Schwarz wie Blut (2011)
Artikel
Silke Brandt – Exklusionszonen am Wegesrand: Zwischen Dystopie und Nostalgie (2023)
Quellennachweise
Mitwirkende
Vorwort
Liebe Leser,
die letzte Ausgabe Zwielicht Classic erschien im September 2022. Ob die Reihe fortgesetzt wird, stand damals in den Sternen. Doch konsequentes Nachfragen der Autoren hat dafür gesorgt, dass es eine neue, achtzehnte Ausgabe gibt und es sieht nicht danach aus, als ob es die letzte bleiben würde.
Zwielicht Classic erscheint seit 2012 und versammelt in den jetzt achtzehn Ausgaben Geschichten und Artikel aus den Jahren 1811 bis 2024. Ein Schwerpunkt sind natürlich moderne Geschichten und so ist das Jahr 2011 Rekordhalter und mit insgesamt achtzehn Stories in der Reihe vertreten. In der vorliegenden Ausgabe spannen wir einen Bogen vom Jahr 2001 bis zum aktuellen Jahr 2025.
Viele der Autorinnen und Autoren kennen Sie schon aus anderen Zwielicht Classic Ausgaben oder der regulären Zwielicht Reihe. Einzig Andrea Tillmanns und Peter Schünemann sind zum ersten Mal vertreten. Beide sind jedoch alles andere als unbeschriebene Blätter und dem interessierten Leser phantastischer Literatur ein Begriff.
Dieses Mal haben wir uns im Gegensatz zu den Ausgaben ab Zwielicht Classic 13 nur auf Geschichten der Neuzeit konzentriert und die Klassiker ruhen lassen. Schreiben Sie uns ruhig, ob das Ihre Erwartungen trifft oder wir das für zukünftige Ausgaben überdenken sollten.
Die hier enthaltenen Geschichten sind querbeet erschienen. In Druckwerken, die deutliche Spuren in der Szene hinterlassen haben, aber auch in Zeitschriften, die abseits bekannter Pfade veröffentlicht wurden. Ziel war es von Anfang an, auch diese Werke ins rechte Licht zu rücken.
Die Illustrationen sind von Adrian van Schwamen, bei denen es sich teilweise um Wiederveröffentlichungen handelt, aber auch um Originalabdrucke, die aber nicht eigens für die Geschichten in Zwielicht Classic 18 erstellt wurden.
Wir wünschen Ihnen ein angenehm schauriges Lesevergnügen. Bleiben Sie uns gewogen!
Herzlichst,
Geschichten
Harald A. Weissen – Türen (2015)
Da war sie also, die unscheinbare Metalltür mit der reliefartig vorstehenden Nummer 607. Ich stand am dunklen Ende eines langen Korridors im dritten Stockwerk und zerbrach mir den Kopf darüber, was wohl hinter ihr sein mochte, welches Geheimnis da verborgen lag. Ich wusste nur eines: Die Tür und alles, was sie symbolisierte, war gefährlich.
Aber der Reihe nach. Seit fast einer Woche arbeitete ich nun bereits hier in dieser Firma, die Verpackungen für die unterschiedlichsten Produkte – angefangen bei Spielzeugen, endend bei Pharmaerzeugnissen – entwirft und herstellt, und ich hatte noch immer nichts Konkretes zu tun.
Keinen ernstzunehmenden Auftrag, keinen Kunden, den ich mit meinem Wissen betreuen konnte. Ich war beinahe ein Jahr arbeitslos gewesen und gierte nun danach, Produktivität an den Tag zu legen, meine Fähigkeiten als Grafiker in eine Firma einzubringen. Nicht, dass ich ein Arbeitstier bin, aber wenn ich schon etwas machen muss, will ich es wenigstens richtig machen.
Jeden Morgen finde ich auf meinem Schreibtisch einen einzigen einfachen Auftrag vor, für dessen Erledigung ich bestimmt nicht mehr als drei, vier Stunden benötige. Wer ihn dorthin legt, ist mir schleierhaft. Wenn ich morgens ins Büro komme, liegt er schon dort und wartet begierig darauf, erledigt zu werden. Danach bleibt es mir überlassen, wie ich die Zeit bis zum Feierabend totschlage. Niemand wendet sich an mich, niemand beachtet mich. Es ist fast so, als ob ich gar nicht existieren würde.
So wanderte ich schon am ersten Nachmittag neugierig durch die hallenden Korridore des mehrstöckigen Gebäudes, deren weißen, leeren Wände mich an Krankenhäuser erinnerten.
Lediglich der typische unterschwellige Geruch nach Medikamenten und Desinfektionsmitteln fehlte. Beim Fax- und Kopierraum angelangt, blieb ich stehen und beobachtete, wie eine junge Frau – hellbraunes, gewelltes Haar; gekleidet in Bluejeans und einen roten Rollkragenpullover – ihre Hände kopierte. Immer und immer wieder. Ich stand bestimmt fünf Minuten unter dem Türrahmen, aber sie kopierte mit einer beängstigenden Monotonie weiter ihre Hände. Der Lichtbalken fuhr von rechts nach links, erlosch, fuhr erneut von rechts nach links, erlosch abermals … scheinbar endlos. Gerade als ich weitergehen wollte, musste ein leises Rascheln meiner Kleidung oder ein Luftzug sie aufmerksam gemacht haben. Ohne mit dem Kopieren inne zu halten, wandte sie sich um und blinzelte mich an. Nach einem Augenblick, der sich anfühlte, als ob die Zeit stillstehen würde, flüsterte sie: „Gehen Sie nicht zur Tür. Fassen Sie sie nicht an … denken Sie nicht einmal an sie.“
„Kann ich irgendwie behilflich sein?“, fragte ich, weil mir keine bessere Frage einfiel.
„Ich habe die Tür angefasst. Und jetzt vergesse ich ständig meine Hände. Oft finde ich sie nicht mehr. Daher mache ich Kopien von ihnen, die ich überall an die Wände hänge. Zuhause, im Büro, im Wagen. Überall.“
„Damit Sie sich an sie erinnern“, schlussfolgerte ich und hatte durchaus Verständnis für die Logik hinter ihren Worten.
„Nehmen Sie sich eine Kopie. Bitte“, flehte sie mich mit zusammengekniffenen Augen an.
Langsam betrat ich den fensterlosen Raum und zog vorsichtig eine Kopie vom Stapel, der auf dem Bürotisch neben dem surrenden Apparat lag. „Danke“, sagte ich und betrachtete eingehend ihre bleichen Gesichtszüge von der Seite. Sie hatte kleine, hübsche, formvollendete Ohren, die zwischen dem schulterlangen Haar hervorguckten, eine zierliche Nase und hohe Wangenknochen, deren schwach angedeutete Rundung einen veranlasste, ein zweites Mal hinzugucken. Außerdem war sie wesentlich jünger, als sie auf den ersten Blick gewirkt hatte. Die Angst um ihre Hände hatte offenbar etwas mit ihrem Gesicht angestellt. „Danken Sie mir nicht. Erinnern Sie sich einfach an meine Hände.“
Ich nickte und betrachtete das dünne Papier, das ich ergriffen hatte. Darauf waren Hände – was sonst –, ganz normale, feingliedrige Hände, sauber geschnittene Nägel und am rechten Mittelfinger ein filigraner Ring. „Ich erkenne nichts, das falsch wäre“, sagte ich und studierte weiterhin die Kopie. Die junge Frau hatte wirklich schöne Hände.
„Im Moment sind sie ja auch da.“
„Hören Sie. Ich kenne Sie nicht … aber kann ich wirklich nichts für Sie tun? Wenn Sie ein Problem haben …“
„Bitte gehen Sie! Lassen Sie mich alleine. Es ist gefährlich, mit mir zu sprechen.“
Ihrem flehentlichen Wunsch entsprechend, verließ ich kommentarlos den Faxraum, faltete die Kopie zusammen und steckte sie in die Gesäßtasche meiner Hose. Dann machte ich mich daran, die restliche Zeit mit Nichtstun zu verbringen.
*
Der Abend, der diesem ersten Arbeitstag folgte, war nicht weniger aufwühlend. Yumiko, meine japanische Ex-Freundin, kam vorbei, um die wenigen Kleider zu holen, die noch immer in meinem Schrank darauf warteten, dass endlich etwas mit ihnen geschah. Weshalb Yumiko, nachdem wir nun seit über vier Monaten getrennte Wege beschritten, sich gerade diesen Abend für den Besuch ausgesucht hatte, war mir ein Rätsel.
Während sie in aller Seelenruhe, und scheinbar von der ganzen Sache komplett unberührt, ihre Sachen in Plastiktüten packte, ging ich in die Küche und beschloss spontan zu kochen: Spaghetti alla Carbonara. Ich hatte gar keinen Hunger, aber wenn ich aufgewühlt bin, koche ich immer Pasta. Natürlich wusste das auch Yumiko und fragte mich, was denn los sei.
„Yumiko, ich kann dich nicht aufgeben. Komm zurück zu mir“, sagte ich, rührte die Sauce um und erinnerte mich sehnsüchtig an ihren schlanken Körper. An ihren Geruch. An ihre Art zu lachen, wenn sie glücklich war.
„Das geht nicht. Du weißt es doch.“
Sie holte Teller und Besteck aus den Schubladen und platzierte alles auf dem Esstisch. Danach suchte sie den Pfeffer im Gewürzschrank, stellte ihn ebenfalls auf den Tisch und drehte das Radio an. Leise klassische Musik erklang.
„Warum? Weil du mich betrogen hast? Das ist kein Problem, wirklich.“ Und das entsprach der Wahrheit. Ich konnte tatsächlich damit leben.
„Das ist es nicht.“
„Was dann? Bitte sag mir doch, was der Grund ist. Du hast selbst gesagt, dass du ihn nicht liebst, du magst ihn nicht einmal.“ In meinem ganzen Körper schienen die Nerven wie Fische an Land zu zappeln. „Seit Monaten drückst du dich davor, mir die Wahrheit zu sagen.“
„Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich bin schlecht und verdorben, glaub es mir doch.“
„Man wird nicht schlecht. Man ist es, oder man ist es nicht. Aber man wird nicht einfach über Nacht schlecht. Nahrungsmittel verderben, aber nicht Menschen.“
So ging es noch eine ganze Stunde weiter, während wir aßen, Rotwein tranken und stritten. Schlussendlich hatte sie Tränen in den Augen und nuschelte angetrunken: „Na gut. Wenn du es wirklich wissen willst. Sein Kater ist an dem Abend gestorben.“
Ich war verblüfft. „An dem Abend, an dem du mit ihm ins Bett gestiegen bist?“
„Ja.“
„Und?“ Die Verblüfftheit wich Verwirrtheit. Die Verwirrtheit Verständnislosigkeit. Und letztendlich bildete alles ein heilloses Durcheinander in meinem Schädel.
„Nichts ‚und’. Der Kater starb, einfach so. Peng! Er fiel neben dem Bett um und war auf der Stelle tot. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen.“ Yumiko atmete erschöpft auf, kämpfte um Beherrschung.
Ich war sprachlos und versuchte angestrengt, einen Sinn in diese Sache zu bringen, aber immer wenn ich glaubte, ich hätte es, fiel alles wie lose Klötze auseinander. Schließlich legte ich Gabel und Löffel auf den Teller und sagte: „Wahrscheinlich war er schon alt.“
„Wahrscheinlich? Wahrscheinlich …
Bei dir ist immer alles wahrscheinlich oder vielleicht oder was weiß ich.“ Ihre Augen blitzten mich an.
„Hör zu … danke für die Spaghetti.
Aber ich muss jetzt gehen. Wie sind geschiedene Leute am Ende unserer gemeinsamen Reise. Begreife es endlich. Du wirst mich nie mehr wiedersehen. Ich verschwinde.“
Und das war es dann auch schon. Yumiko erhob sich, griff nach ihren mit Kleidern prall gefüllten Plastiktüten und hetzte aus der Küche, ohne noch einen letzten Blick zurück auf ihre Vergangenheit zu werfen. Ich hörte, wie einige Sekunden später die Haustür zuschlug, und war unfähig, mich zu rühren. Wie eine angeklebte Holzpuppe saß ich am Tisch, blickte in den Teller, der langweilig, leer und rund vor mir stand, und dachte an den toten Kater.
Irgendwann, es musste wohl schon kurz vor Mitternacht gewesen sein, zog ich aus einem Büchergestell ein Fotoalbum hervor, setzte mich deprimiert auf den Wohnzimmerboden und schlug es auf. Yumiko. Auf jeder Seite. Mindestens auf jedem zweiten Bild. Warum quälte ich mich bloß damit? Stumm und bedächtig blätterte ich die Seiten durch – ein Sammelsurium längst vergangener Zeiten, so weit entfernt, dass sie wie Träume anmuteten – und verharrte reglos, als ich ziemlich genau in der Mitte des dicken Albums anlangte. Da waren Hände. Es handelte sich um einen unscharfen Schnappschuss vom letzten Sommer, als ich Yumiko dabei überrascht hatte, wie sie mit kritischem Blick vor dem Spiegel im Schlafzimmer stand und ihre nackten, kleinen Brüste und ihren flachen Bauch musterte. Sie hatte nicht bemerkt, dass ich sie schon seit einigen Minuten amüsiert von der Türe her beobachtete. Als ich das Foto schießen wollte, konnte sie jedoch in allerletzter Sekunde die Hände hochreißen. Und so waren es eben ihre Hände, die ich abgelichtet hatte.
Nachdem ich mich vom Anblick dieser eigenartigen Aufnahme losgerissen hatte, erinnerte ich mich an das Blatt Papier, das zusammengefaltet in der Gesäßtasche meiner Hose steckte. Ich zog es hervor, faltete es auseinander und legte es neben das Foto von Yumikos Händen.
Die kopierten schönen Hände der jungen Frau, obwohl in Grautönen festgehalten, glichen in verblüffender Art und Weise Yumikos fleischfarbenen Händen.
Ich musste wissen, wer diese junge Frau aus dem Faxraum war.
*
Nach einer unruhigen, kurzen Nacht betrat ich am nächsten Morgen das Büro, in dem mein Schreibtisch stand. Darauf fand ich einen Umschlag, meinen handgeschriebenen Namen auf der Vorderseite, in dem der Auftrag für den heutigen Tag steckte. Ein Kinderspiel. Bereits kurz vor Mittag war alles erledigt und ich musste mir ernsthafte Gedanken darüber machen, wie ich bis 18.00 Uhr durchhalten wollte.
Als erstes holte ich mein Sandwich aus dem Kühlschrank im Pausenraum und setzte mich an einen runden Holztisch. Er stand unter einer Fensterfront, die einen herrlichen Ausblick auf eine hügelige Waldlandschaft bot. Aber ich nahm nichts von draußen wahr, war nur auf das Innere fixiert: identische Hände und ein toter Kater und geplatzte Träume. Sie geisterten wie Schreckgespenster durch meine Gedanken und verdrängten den ganzen Rest.
„Ist hier noch ein Platz frei, Kumpel?“, ertönte plötzlich eine krächzende Altmännerstimme und riss mich aus der Grübelei.
„Klar.“ Ich betrachtete neugierig die Gestalt, die sich neben mich setzte und dabei leise, komische Laute von sich gab. Der kleine Körper wurde von einem dunkelblauen, ölfleckigen Overall komplett verdeckt. Auf einem dürren, faltigen Hals befand sich ein Kopf, in dem zwei tiefliegende, kleine Augen unter buschigen Brauen steckten, die mich eindringlich anstarrten. Ein grauer Haarkranz umfasste eine glänzende Glatze, und seine Lippen waren so dünn, dass man beinahe glauben mochte, er habe gar keine.
„Ich bin der Hauswart“, krächzte der Alte und stellte ein rostiges Bügeleisen auf den Tisch.
„Aha ... ich bin der neue Grafiker.“ Ich reichte ihm meine Hand, aber er ergriff sie nicht, neigte lediglich seinen Kopf zur Seite und fixierte sie mit seinen Habichtaugen. „Ähm, gibt’s hier viel zu tun? Für einen Hauswart, meine ich.“
„Aber sicher doch“, er blinzelte und blickte mir wieder ins Gesicht. Dabei strich er sanft, ja fast liebevoll, mit einem Finger über sein Bügeleisen. „Ich tausche die Glühbirnen aus.“
„Ich hab noch keine hier gesehen. Birnen meine ich. Alles ist voll von Fluoreszenzröhren – ich mag ihr Licht nicht. Es ist grell und bereitet mir Kopfschmerzen.“
„Bist du ein Klugscheißer oder was?“ Er kniff ein Auge zusammen und rümpfte die Nase. „Hör mal zu, Kumpel. Wenn ich sage, dass ich Glühbirnen ersetze, dann tue ich es auch. Und wenn ich sie ausgewechselt habe, schlage ich sie tot. Bamm!“ Das erhobene Bügeleisen donnerte laut auf den Tisch. „Bamm! Bamm! Bamm! Immer wieder, Kumpel! Voll drauf. Bis nur noch tausend Splitter und ihre stinkenden, verrottenden Eingeweide übrig sind. Kapiert?“
„Wahrscheinlich“, sagte ich vorsichtig.
„Wahrscheinlich? Hör mal, bist du normal? Entweder kapiert man was, oder man tut es nicht. In dieser Sache verstehe ich keinen Spaß.“
„Es ist nur so, dass ich mir nicht vorstellen kann, weshalb man Glühbirnen, die bereits kaputt sind, noch ...“, ich zögerte und suchte nach dem richtigen Wort „vernichten muss.“
„Kumpel, ich habe nie gesagt, dass sie kaputt sind. Ich wechsle sie bloß aus und mach sie tot.“ Er zögerte, leckte sich über die nicht vorhandenen Lippen und starrte mich eingehend an. Nach einer Weile nickte er einmal, als habe er einen Entschluss gefasst, und sprach weiter. „Ok. Du bist neu hier, Kumpel. Also kennst du die Täuscher nicht. Oder?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Die Täuscher leben in den Wänden. Überall hier. Und immer wenn niemand hinguckt, kommen sie hervor und stehlen Glühbirnen, die älter als eine Woche sind. Sie brauchen sie, um ihre finsteren, kalten Höhlen zu beleuchten. Dort unten ist es wirklich scheiß kalt und so feucht, dass dir der Schimmel an den Füssen wächst. Weil die Täuscher aber Pläne zum Sturz der Regierung schmieden, dürfen sie niemals und unter keinen Umständen Licht haben. Also tausche ich die Birnen aus, bevor sie älter als eine Woche werden.“
„Wie sehen die Täuscher denn aus?“
„Na, das weiß keiner, weil sie ja nur hervorkommen, wenn niemand hinguckt.“
Das machte durchaus Sinn. Gedankenverloren biss ich in mein Sandwich und wiederholte die Worte des runzligen Alten langsam in meinem Kopf. Dann hatte ich eine Eingebung. „Ich hab da mal eine Frage“, sagte ich vorsichtig und legte das Brot zurück auf den Tisch. „Stehlen diese Täuscher manchmal auch Hände?“
„Hände?“
„Ja, ich meine, ob sie anstelle von Glühbirnen menschliche Hände stehlen.“
Er dachte nach und rieb sich die Schläfen. „Nee, davon weiß ich nichts. Warum fragst du?“
„Ich hab gestern jemanden im Faxraum angetroffen. Eine junge, hübsche Frau. Sie kopierte ihre Hände und ich dachte ...“
„Die ist verrückt“, unterbrach er mich brüsk. „Lass die Finger von ihr, Kumpel. Klar? Sie bringen alle nur Unglück ... die Frauen meine ich.“ Er räusperte sich lautstark und erhob sich. „Ich muss jetzt weiter.“ Seine Hand schloss sich fest um den Griff des Bügeleisens. „Pass auf dich auf, Kumpel. Kann gut sein, dass wir uns nie mehr sehen werden.“
„Wie heißt sie?“, fragte ich, noch bevor er verschwinden konnte.
„Keine Ahnung.“ Er zuckte mit den Schultern, drehte sich um und schlurfte, abermals leise Geräusche von sich gebend, davon und um die nächste Ecke. Und fort war er.
Die nächste halbe Stunde verbrachte ich damit, eine Amsel zu beobachten, die sich auf dem Fenstersims gleich vor mir niedergelassen hatte.
Sie war ein ausgesprochen hübsches Exemplar und schien sich dessen bewusst zu sein. Wie sie von links nach rechts stolzierte, den Kopf immer wieder drehte und mit dem Schnabel im Gefieder wühlte. Abermals erinnerte ich mich dabei an Yumiko, wie sie vor dem Spiegel gestanden hatte, wie sie kritisch ihre kleinen Brüste gemustert hatte, während ich mich mit dem Fotoapparat anschlich. Amsel und Frau, Frau und Amsel – ich wollte an nichts denken, und bei dem anstrengen-den Versuch, genau das zu tun, verwickelte ich mich immer tiefer in meine Gedanken, die ihre Krallen wie Geier in mich stießen und sich von meinem Innersten ernährten.
Ich spürte es am ganzen Körper, fühlte mich ausgelaugt und ausgesogen. Dann muss ich wohl eingeschlafen sein.
*
Es war eigenartig. Eigenartig daher, da ich wusste, dass ich gerade träumte, obwohl es sich überhaupt nicht wie ein Traum anfühlte.
Auf jeden Fall lag ich in einer gewölbeartigen Höhle. Ein spärlicher Lichtschimmer kam von einer einzelnen Glühbirne, die direkt über mir an einem Kabel hing, das seinerseits in der Decke verschwand. Irgendwo in der undurchdringlichen Dunkelheit, außerhalb des bleichen Lichtkreises, tropfte Wasser, etwas flatterte hektisch in der Ferne davon und ich hörte eine Katze miauen – es war der tote Kater, da war ich mir absolut sicher. Ich wollte mich umdrehen und nachsehen, aber es war mir nicht möglich. Mein Körper war zu schwach, zu ausgelaugt, zu verbraucht. Ich lag reglos auf dem kalten Boden, atmete gleichmäßig die schale Luft ein und aus und erhaschte aus dem Augenwinkel unzählige Schatten, die mich belauerten. Die nur auf den richtigen Moment warteten, um über mich herzufallen. Dann hörte ich Schritte, leise tapsende Schritte, und sah, wie die Höhle, in der ich lag, noch etwas heller wurde.
„Endlich habe ich dich gefunden“, hörte ich Yumiko erleichtert flüstern, und kurz darauf rückte sie in mein Blickfeld. Sie war nackt, bis auf einen gelben Helm, an dessen Front eine starke Lampe angebracht war. „Komm schon, steh auf. Wir müssen verschwinden, solange die Batterien noch funktionieren.“
„Ich kann nicht, unmöglich“, sagte ich, weiterhin wie gelähmt am Boden liegend. „Ich bin zu schwach.“
„Na gut, dann nimm halt meine Energie. Ich brauche sie ja ohnehin nicht mehr.“ Sie bückte sich zu mir herunter, öffnete die Hose und griff sachte nach meinem Glied. Danach machte sie sich entschlossen daran zu schaffen.
Schwer atmend, aber zur Reglosigkeit verdammt, spürte ich, wie ihre schönen Hände wie durch ein Wunder an zumindest einem Ort Kraft in mich rieben. Mein Prachtstück wurde hart wie Stein. In einer flüssigen, anmutigen Bewegung setzte sie sich auf mich und ich spürte, wie ich in sie eindrang, wie die feuchte Wärme ihres vertrauten Geschlechtes mich umschloss und wir eine Einheit wurden.
„Hör gut zu“, sagte sie keuchend und bewegte sich rhythmisch auf mir, klammerte sich an mich, als wäre ich ein Rettungsanker im endlosen Ozean der Angst, „wenn du meine ganze Energie hast, nimmst du den Helm und verschwindest. Der Kater wird dir den richtigen Weg weisen, da ich nicht mehr hier sein werde.“ Sie küsste mich sanft, bewegte sich etwas stärker und ich roch ihren honigsüßen Atem.
„Wo wirst du sein?“
„Na, in dir, Dummkopf. In deinem Herzen. Und bitte ... denk nicht schlecht über mich. Ich wollte das alles nicht. Aber es ließ sich eben nicht vermeiden.“ Sie legte ihren Oberkörper auf mich und ich schloss sehnsüchtig die Augen. Oh, wie gerne hätte ich sie umarmt, wie gerne wäre ich mit meinen Händen über ihren wundervollen Rücken geglitten, hätte jeden einzelnen Wirbel ertastet, ihre zarte, weiße Haut gefühlt, die Rundung ihres Hinterns gestreichelt ... aber ich konnte nur steif daliegen und abwarten, was geschehen würde.
„Was ist mit dem Kater?“, fragte ich leise und wünschte mir, dieser Moment würde niemals enden, würde uns beide verschlucken und in seinem transzendenten Magen verdauen.
„Er ist unser Sohn“, hauchte Yumiko in mein Ohr.
„Unser Sohn? Wie kann das sein?“ In diesem Moment spürte ich, wie Kraft erst in meine Füße, dann in meine Beine floss. „Wie können wir einen Sohn haben, und du verlässt mich?“
„Schicksal.“
„Schicksal?“ Ich verstand es nicht, spürte aber, wie neue Kräfte meine Lenden und meinen Bauch, meinen Torso durch-drangen. Bis hoch in die Schultern krochen diese käfergleichen Energien und erfüllten meine Arme und Hände mit Kraft. Ich griff nach Yumiko, sehnte mich danach, mit meinen Fingern über ihre leicht geröteten Wangen zu streicheln, doch ich glitt einfach durch sie hindurch. Sie löste sich auf, während der Orgasmus krampfartig durch mich raste. Ihre Gestalt verblasste immer mehr und ich konnte nichts dagegen tun, wollte sie festhalten, an mich krallen. „Bleib bei mir!“, wollte ich schreien, aber selbst dieser Aufschrei wurde mir verwehrt. Er blieb wie ein staubtrockener Klumpen in meiner Kehle stecken und drohte, mich zu ersticken.
Dann war sie fort, eine Erinnerung, ein Gedanke, ein Traum, und ich war alleine. Aber ist der Mensch nicht ohnehin alleine? Alles was man hat, ist sich selbst, und sogar das kann man manchmal verlieren oder vergessen. Erschöpft blieb ich in der Höhle liegen.
„Yumiko“, flüsterte ich irgendwann und griff erneut ungläubig ins Zwielicht, das von der einzelnen Glühbirne über mir und der starken Lampe an dem gelben Helm herrührte. Aber mein Mädchen war nicht mehr bei mir.
Ein hallendes Miauen erklang und der Kater schlenderte gelassen in den Lichtkreis. Wie er so in der kalten Luft schnupperte und sich umsah, glich er Fred Astaire, der von der Bühne her sein Publikum musterte, nur Sekunden bevor er mit seiner wilden Tanznummer loslegen und die Menschen verblüffen würde. Dann sah mich der Kater an, blinzelte mit einem Auge und drehte sich gemächlich um. Diese Geste schien eindeutig zu sagen: „Komm endlich, vertrau mir“. Und ich erhob mich, griff nach dem Helm und setzte ihn auf.
Gemeinsam – der Kater vorneweg, ich hinterher – gingen wir gelassen in die Dunkelheit vor uns. Was hatten wir schon zu verlieren?
*
Ein sachtes Klopfen auf meiner rechten Schulter riss mich aus dem Traum, der sich überhaupt nicht wie ein Traum angefühlt hatte. Der Schlaf wich sofort, aber nicht die Gewissheit, dass Yumiko weg war. Ich würde sie nie mehr wieder sehen.
Abermals berührte jemand meine Schulter.
„Was denn?“, keuchte ich und schrak auf. Meine rechte Gesichtshälfte fühlte sich taub und gefühllos an, als hätte jemand pausenlos und schwungvoll mit einem Baseballschläger drauf gehauen. Ich musste wohl lange auf ihr gelegen haben. Immerhin war es draußen vor dem Fenster bereits pechschwarz und finster. So finster, dass man glauben mochte, dass lediglich dieser eine Pausenraum noch existierte. Darum herum nur endloses, verstörendes Nichts.
„Pssst.“ Eine thailändische junge Frau – sie mochte 18 oder 28 Jahre alt sein, das war schwer zu sagen – bückte sich von der Seite langsam zu mir herunter. Sie legte eine Hand – die in einem engen, gepuderten Latexhandschuh steckte, wie ihn sonst nur Chirurgen trugen wenn sie operierten – auf meine Schulter. Mit vor Angst vibrierender Stimme flüsterte sie nahe an meinem Ohr: „Es ist schon nach acht. Du solltest gehen.“
„Oh, Mist“, murmelte ich verwirrt und gähnte. Die Einzelheiten des Traumes standen mir nach wie vor klar und deutlich vor Augen und trübten meinen Sinn für das Reale. Ich schaute das gut gekleidete Mädchen genauer an, dann mich selbst im reflektierenden Fensterglas vor mir, und wieder sie. Seltsam, eine richtige und eine seitenverkehrte Welt, die doch beide dieselbe Quelle, denselben Ursprung hatten: mich. War es also möglich, dass mein Spiegelbild gerade jetzt dasselbe dachte? Dass es die Quelle war und ich das Spiegelbild? Ich – wie auch mein anderes Ich in der Scheibe – schüttelte meinen Kopf um die verwirrenden Gedanken abzuwerfen und konzentrierte mich auf die junge Frau.
Ihr ängstlicher Gesichtsausdruck sandte Zeichen von Panik aus, ihre gesamte Gestik wirkte ziellos und verloren, und sie schaute sich gehetzt im Pausenraum um. Abermals flüsterte sie direkt in mein Ohr: „Bitte, nicht so laut. Du solltest jetzt wirklich von hier verschwinden. Und wenn du gehst ... um Gottes Willen schleiche ... und berühre keine Wände. Um diese Zeit ist es hier sehr gefährlich. Manchmal verschwinden Menschen.“
„Weshalb?“
„Die Welt ist hungrig, darum.“
„Verstehe.“
„Nein, tust du nicht.“ Die Angst in ihren dunklen Augen wich nackter Verzweiflung und sie ballte die gehobenen Hände zu Fäusten. Schließlich schüttelte sie den Kopf und hastete aus dem Raum, ohne sich noch einmal umzusehen.
„He!“, rief ich ihr nach. Aber mein Ruf verhallte wie der Schrei einer Eule im nächtlichen Wald. Ich rieb mir gähnend die Augen und erhob mich vom Stuhl. Stundenlang hatte ich hier geschlafen und niemand – bis auf das thailändische Mädchen – hatte es für nötig befunden, mich aufzuwecken. Konnte also gut sein, dass ich morgen anstelle eines neuen Auftrags die Kündigung oder zumindest eine Verwarnung auf dem Schreibtisch liegen hatte. Und das nach zwei Tagen! Beeindruckende Leistung.
Unentschlossen schaute ich mich um, doch so sehr ich auch schaute, es änderte sich nichts. Das Gebäude strömte eine totalitäre Stimmung der Leere aus. Keine Stimmen, keine Schritte, keine Zeichen von Leben. Da war nur das leise Summen der Beleuchtung über mir und die bedrückende Gewissheit, der Nachhall des Traumes, dass Yumiko weg war. Verschwunden. Von der Welt mit Haut und Haar verschlungen.
Ich steckte die Hände in die Vordertaschen meiner Hose und verließ den Pausenraum, trat auf den Flur und schlenderte gemächlich in Richtung des Großraumbüros, wo ich meinen Arbeitsplatz hatte.
Nachdenklich betrachtete ich die schneeweißen, kahlen Wände – links, rechts, dann wieder links – und achtete instinktiv darauf, dass ich sie nicht berührte. ‚Die Welt ist hungrig’ hatte das thailändische Mädchen gesagt. Und ja, ich glaubte ihr. Das Gefühl der Bodenlosigkeit war ein guter Bekannter von mir. Ob das mit den Täuschern in Zusammenhang stand, die offenbar immer dann aus den Mauern kamen, wenn gerade niemand hinsah? Gut möglich. Man konnte die Sache definitiv nicht widerlegen.
Aufmerksam ging ich weiter. Die weiß getünchten Wände wurden regelmäßig von grünen Türen unterbrochen. Türen ... welche mochte wohl diejenige sein, von der die junge Frau aus dem Faxraum gesprochen hatte? Was mochte dahinter verborgen sein? Und wie passte die ganze Geschichte mit den identischen Händen dazu?
Vor dem Büro blieb ich einige Sekunden stehen und zögerte, die Klinke zu berühren. Dann fasste ich mir ein Herz, griff danach und betrat den Raum. Es brannte noch immer Licht. Flink schnappte ich meine Sachen und machte mich auf den Nachhauseweg.
Etwa eine halbe Stunde später öffnete ich die Haustür meiner 3-Zimmer-Wohnung, die sich im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Wohnblocks befand. Ich hängte Jacke und Tasche an den Kleiderständer, zog die Schuhe aus und schlenderte in die Küche. Aus dem Kühlschrank nahm ich ein Ananas-Joghurt und verschlang es förmlich. Danach folgten zwei trockene Semmeln vom Morgen und einige Aprikosen aus der Dose. Eine Tafel Schokolade aus dem Lebensmittel-schrank. Eine Aufbackpizza aus dem Tiefkühlfach. Bier.
Als alles weg war, überlegte ich mir, was ich noch unternehmen würde. Ich beschloss, dass ich nicht mehr ausgehen wollte ... mit wem auch. Anstelle dessen griff ich nach dem Telefon und versuchte, Yumiko zu erreichen. Ich musste mehr über den Kater und den Traum wissen. Und ich wollte ihre Stimme hören. Aber sie nahm auch nach mehrmaligem Läuten nicht ab. Enttäuscht legte ich den Hörer zurück auf die Gabel und blieb regungslos neben dem Apparat sitzen.
Zehn Minuten später wählte ich erneut ihre Nummer, doch das Ergebnis war dasselbe. Tief in mir wusste ich, dass ich sie nie mehr wieder erreichen würde. Yumiko war weg.
Schließlich holte ich mir ein Buch von Bukowski aus dem hölzernen Wandgestell, das ich schon lange im Kopf hatte. Eigentlich wollte ich mich nur für eine Stunde ablenken, aber ich las ... und las ... und las ... Und als ich damit fertig war, graute der Morgen und ich klappte das Buch zu und fühlte mich elend.
*
„Du siehst echt Scheiße aus“, sagte der Typ, der mir gegenüber seinen Schreibtisch hatte. Ich vergaß ständig seinen Namen. Insgeheim nannte ich ihn aber Fanta-Lemon, weil er ein hässliches Hemd anhatte, dessen Farbe dieser Bezeichnung durchaus entsprach.
„Danke.“
„Hast ‘ne harte Nacht hinter dir, was? Ich sehe das. Weiber?“
Er sprach das Wort Weiber langsam aus, mit einem Glitzern in seinen Schweinchen-Augen, und Speichel lief ihm aus dem Mundwinkel über sein kantiges, unrasiertes Kinn.
Ich schüttelte schwach den Kopf und betrachtete den jungfräulichen Umschlag, der auf der Tischplatte vor mir lag. Auftrag oder Kündigung? Positiv oder negativ? Ja, das war eine gute Frage. Wenn nur das enervierende Hämmern und Poltern in meinem Schädel nicht wäre. Ich verfluchte Bukowski und seine Schreibe. Ich verfluchte meine Schlaflosigkeit.
„Wenn ich mal mies geschlafen habe“, brüstete Fanta-Lemon sich lautstark, „lass ich mich massieren. Stundenlang. Ich hab da so eine Adresse. Tolle Frauen! Willst du sie?“
„Nein, danke.“
„Bist du zu feige, um dich vor Frauen auszuziehen?“
Gute Frage. Ich hatte mir nie Gedanken darüber gemacht. War ich feige? Nun ja, ich suche ganz bestimmt keine Konfrontationen. Aber wenn sie unausweichlich sind, stehe ich meinen Mann. Mit Nacktheit hatte ich bisher auch noch keine Schwierigkeiten gehabt. „Nein, ich bin nicht feige“, sagte ich und setzte mich hin.
„Dann isses ja gut. Dachte schon, du bist ‘ne Schwuchtel oder so.“ Er stand da und stützte sich mit den Fäusten auf die Tischplatte seines Arbeitsplatzes, als wäre er der Renegat von Rom. „He! Jetzt sag schon ... weshalb bist du so mies drauf? Ich meine ... he! Die Sonne brennt einem förmlich die Haare vom Arsch, die Weiber tragen kurze Röcke. Macht dich das nicht glücklich? Ein klein wenig vielleicht?“
„Wahrscheinlich schon. Hör mal“, begann ich und schloss meine Augen für einen Moment, „ich hab was Dringendes zu erledigen.“
„Na klar. Hab schon verstanden.“ Er zögerte, gab aber noch nicht auf. „Ich weiß, was du brauchst. Hier.“ Ein Blatt Papier flatterte zu mir herüber. „Lies das mal, vielleicht interessiert es dich ja.“ Dann setzte er sich ebenfalls und starrte auf den Bildschirm seines Computers.
Desinteressiert griff ich nach Fanta-Lemons Blatt, drehte es um und las, was darauf stand:
EINLADUNG ZUR WÖCHENTLICHEN SCHREITHERAPIE.
MITTWOCH, 14.00 UHR.
BÜRO 71.
SCHREI DICH GESUND!
Ich las den Text ein zweites Mal sorgfältig durch und legte das Papier anschließend neben den Umschlag, der nach wie vor unberührt dalag. Das klang interessant. Und außerdem bestand die Möglichkeit, dass die junge Frau im roten Rollkragenpullover auch anwesend sein würde. Ich beschloss, hinzugehen ... das heißt, falls ich am Nachmittag noch ein Angestellter dieser Firma sein würde.
„Kommst du auch?“, rief Fanta-Lemon von der anderen Seite und ich hob den Blick.
Wortlos nickte ich, zögerte einen Augenblick und griff dann nach dem weißen Umschlag. Ich riss ihn auf, und ... Es war ein Auftrag! Erleichterung durchflutete mich wie eine frische Brise am Morgen, wenn noch keine Autos auf den Straßen sind und die ersten Vögel lauthals ihren unschuldigen Morgengesang anstimmen.
So verbrachte ich die Zeit bis zur Mittagspause, schüttete Unmengen von starkem Kaffee in mich hinein und versuchte angestrengt, mein penetrantes Gegenüber zu ignorieren. Als der Mittag endlich kam, war der Auftrag erledigt und ich ebenfalls. Erschöpft setzte ich mich an den Tisch im Pausenraum, an dem ich schon gestern gesessen und geträumt hatte. Tatsächlich verging keine Minute, und Fanta-Lemon gesellte sich zu mir.
„Jetzt sag schon ... was bedrückt dich?“, begann er von neuem und klopfte kumpelhaft auf meine Schultern. „Wer den Kummer zurückhält, wird im Alter blind. Das ist eine Weisheit meiner Oma. Und sie hat echt Ahnung von so was.“ Er lachte laut auf und rückte näher.
Ich dachte nur einige Sekunden darüber nach und die Worte begannen aus mir zu sprudeln. Wie Wasser, das unaufhaltbar durch einen gebrochenen Damm strömt. Ich erzählte ihm von der Begegnung mit der jungen Frau im Faxraum, und dass ich sie dringend sehen musste. Von Yumiko, die mich verlassen hatte, die ich aber gleichfalls wieder sehen musste. Die Hände und den Kater allerdings verschwieg ich.
„Oha, du bist scharf auf sie“, stellte Fanta-Lemon genüsslich fest, nachdem ich geendet hatte. Er rieb sich das kantige Kinn mit dem rechten Handrücken. Ein schmieriges Grinsen gedieh gleich einer giftigen Dschungelpflanze in seinem Gesicht.
„Kennst du sie?“
„Tja, ich hab sie schon mal gesehen. Muss aber eine Weile her sein. Gutes Fahrgestell.“ Er biss gedankenverloren in eine Banane und schaute – wenn das bei ihm wirklich möglich war – nachdenklich in die Runde. „Ein seltsames Mädchen, die Kleine. Sehr seltsam.“
„Weshalb?“
„Nun, es gibt da so eine Geschichte. Wirklich unheimlich, wenn man darüber nachdenkt.“
„Lass hören“, bat ich und knüllte das Cellophanpapier zusammen, in dem mein Sandwich eingewickelt war. Dann faltete ich die Hände auf dem Tisch und räusperte mich.
„Also gut. Ich weiß leider nicht alles, also entschuldige, wenn es Lücken in der Erzählung gibt. Lass mal sehen ...“ Erneut schien er angestrengt im überfüllten Mülleimer zu wühlen, der sein Gedächtnis war. „Ah ja, jetzt hab ich’s wieder. Ihr Name ist Six.“
„Six? Du meinst wie das englische Wort ‚Six’ für ‚sechs’?“
„Ja, jeder nannte sie so und tat alles, um in ihrer Nähe zu sein. Von Anfang an. Mit ihrer gutmütigen Art und dem Fahrgestell war es wohl auch kein Wunder. Alle, wirklich alle – egal ob Mann oder Frau –, waren verrückt nach ihr. Es spielte auch keine Rolle, ob jemand verlobt oder bereits verheiratet war. In ihrer Gegenwart war es unmöglich, sie nicht zu begehren, als wäre sie ein Magnet für Begierden. Ich kann’s nicht besser erklären.“