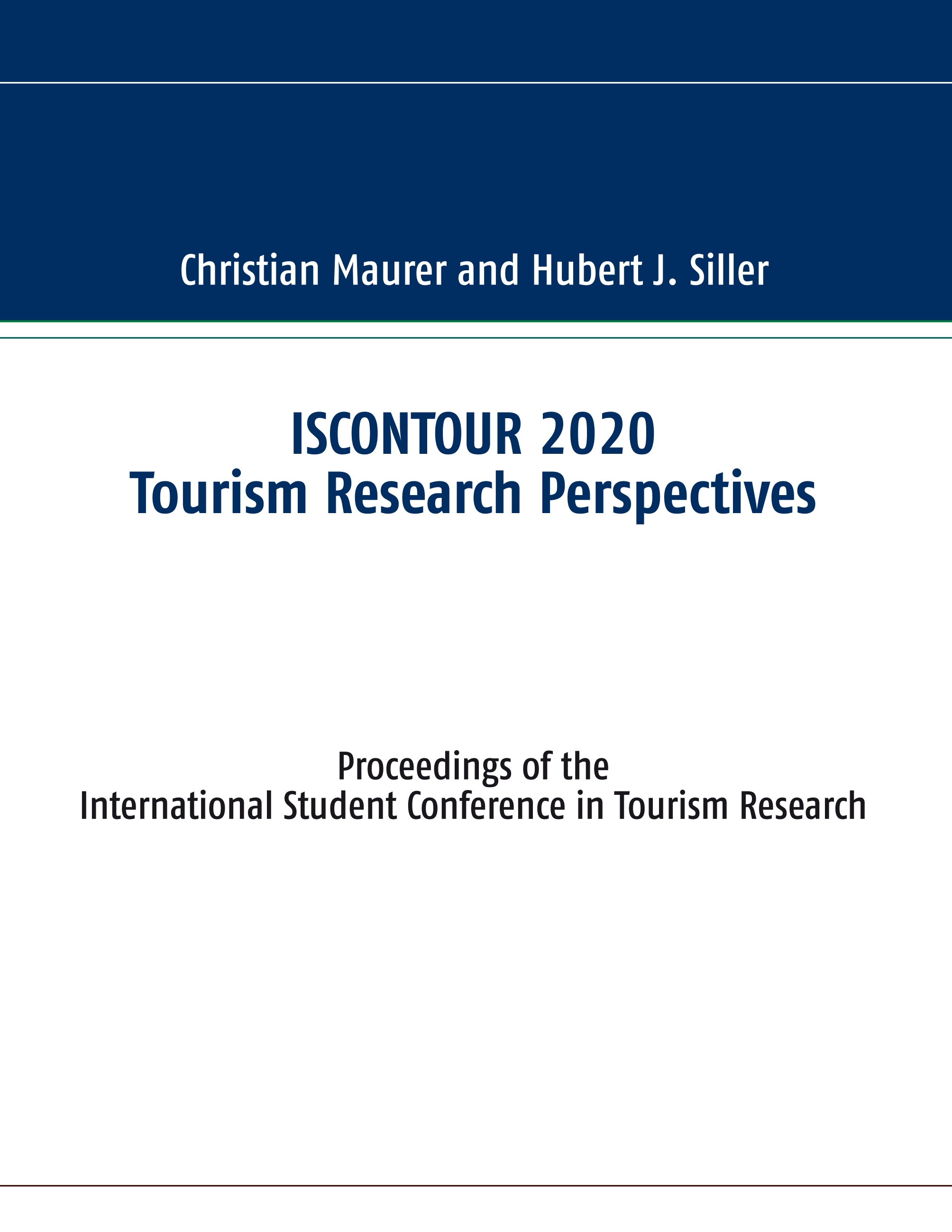Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dr. Fritz Pausenhofer und Martin Pichler, österreichische Exilanten in Berlin, sind ein ungleiches Paar. Idioten, Spinner, Epileptiker und Neurologen machen der Koryphäe zu schaffen, während Martin im Museum Touristen beaufsichtigt und Inspiration für seinen Roman sucht. Zweisamkeit finden sie beim Beobachten von Autounfällen, wenn Fritz von früher erzählt und Martin seine Wahnvorstellungen vergessen kann. Berlin ist im Niedergang, das Spiel geht dem Abpfiff entgegen. Zudem hat Fritz Leichen im Keller, an die er sich fast nicht mehr erinnert, bis sein Lebensgefährte sie literarisch ans Tageslicht holt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Gert
Ich bedanke mich bei Martin Hils und Tom Ehringer
„Feuriger Nuttenschmus im Charlottenburger Sportwettenmilieu, auf Bestseller hinfrisiert“. Was von Fritz nur als „zärtliche Spöttelei“ gemeint ist, trifft bei Martin einen wunden Punkt. Sein Ziel ist ein Roman mit Anspruch, ein „bleibendes“ Werk. Der Arbeitsplatz ist für den Museumsaufseher Fluch und Segen zugleich. Genau wie die Beziehung zur neurologischen Koryphäe, die Neurologen verachtet, ohne ihre Spinner, Epileptiker und Idioten aber nicht leben kann. Die gemeinsame Herkunft aus der österreichischen Provinz übertüncht mehr als sie verbindet. Wenn beide von ihrer Picknickdecke aus Autounfälle beobachten, erzählt Fritz aus seinem Chefarztleben und liefert seinem Lebensgefährten Stoff, der Martins Fantasie endlich auf die Sprünge hilft. Was Pausenhofer zu lesen kriegt, trifft ihn wie ein Schlag.
Christian Maurer, geboren 1966 in Leoben/Österreich, bricht das Kunststudium in Wien ab und zieht im Sommer 89 nach Berlin, wo er als Bildender Künstler tätig ist. Der Entschluss das Metier zu wechseln, fällt 2016 endgültig. 2018 erscheint ein Bilderbuch für Erwachsene und 2020 ein Schauspiel. Zwischen allen Lappen ist Ruh‘ ist sein erster Roman.
Ein Überblick über seine bisherige Arbeit ist im Internet unter http://www.christianmaurer-berlin.de/ abrufbar.
Inhalt
Prolog
1 Zur Kontrolle
Die Begegnung
Die Baracke
2 Neuanfang
Der Aufseher
Der Schriftsteller
Unfälle
Hackbrettlehrer Krause
Gerhard
Selzthal
Palo Alto
Marian
3 Fantasie
Das Land
Die Fachleute
Der Buchhändler
4 Stanford
Wien
Stockholm
Berlin
5 Abgesang
Déjà-vu
Prolog
Das Wort Mauerfall wurde von irgendwelchen Zeitungen erfunden, noch am Abend, der die Welt überrascht und die geteilte Stadt, eben noch ein schmutziger Flecken Erde, mit einem Schlag doppelt so groß gemacht hat. Bis dahin hat Berlin niemanden interessiert. In den Geschichtsbüchern findet sich allerlei Geschwätz über den Kalten Krieg, russische Panzer am Checkpoint Charlie und den amerikanischen Präsidenten, der sich ihnen entgegenstemmte. Jenseits der Grenze existierte ein sozialistischer Staat auf deutschem Boden, dessen Probleme schon bei seiner Gründung abzusehen waren. Das Wort Freiwillig, ebenfalls eine Erfindung irgendwelcher Zeitungen, wurde aus dem Verfassungsentwurf gestrichen und Sozialismus durch Demokratie ersetzt. Politiker, die den Namen verdienten, gab es in den Entscheidungsgremien nicht mehr, als sich eine Hand voll Agitatoren und Sekretäre in der Kaserne der russischen Besatzungsarmee zu einem Umtrunk einfanden, um die letzten Formalitäten zu erledigen.
Durch geschicktes Umdefinieren abgenutzter Fachvokabeln haben es die Anwesenden geschafft, eine Verfassung zusammenzuschustern, die immerhin vierzig Jahre lang ein Staatsgebilde aufrechterhalten und Millionen von Optimisten mit naiven Kriegsheimkehrern zusammensperren konnte. Obwohl es genug Menschen gibt, die von der DDR erzählen können, verlässt sich die Wissenschaft auf manipulierte Akten, Tonbänder und Gerüchte. Ich selbst kenne Zeitzeugen und habe mir schildern lassen, wie es wirklich zugegangen ist. Der Stoff reichte völlig aus, um die Karikatur eines Staates literarisch nachzuzeichnen. Es wurde mir Einseitigkeit vorgeworfen, Naivität und Parteinahme für meine Freunde und Berichterstatter, deren Identität ich zu ihrem Schutz nicht preisgegeben habe. In sozialen Medien werde ich bis heute mit Dreck beworfen. Ein Beweis dafür, dass ich nicht allzu falsch lag.
„Sie haben nicht dort gelebt“, sagen evangelische Pfarrer, Knastbrüder, Dissidenten, Sekretäre, Punkmusiker, Soldaten, Majore, Taxifahrer und Journalisten. Sie alle waren Staatsdiener mit solidem Einkommen, von dem ich als Museumsaufseher nur träumen kann und als Schriftsteller erst recht. Ich habe den Abend, der die Welt überraschte, in meinem Kellerloch verbracht, das zu der Zeit noch nicht ordentlich zugenagelt war. Zu einem Prolog habe ich mich entschlossen, um den folgenden Text für den Leser chronologisch einzuordnen. Mein Aufenthalt in der Stadt begann längst vor dem ersten Kontakt mit dem Neurologen Dr. Fritz Pausenhofer und meine Epilepsie war nicht unter Kontrolle zu bringen. Von Hirnlappen und ähnlichen Dingen erfuhr ich erst aus den Arztbriefen, die ich bis heute in den Schubladen habe.
Als viertes Kapitel habe ich meinen literarischen Versuch eingefügt, den ich Zwischen allen Lappen ist Ruh‘ genannt habe – er war als Hommage an Fritz Pausenhofer gedacht. Er tritt darin als zwielichtiger Held auf, der Weltgeschichte geschrieben hat, ohne es zu wollen. Seine präzisen Schilderungen waren schon immer mit Vorsicht zu genießen, umso größer war meine Sorgfalt bei Durchsicht und chronologischer Einordnung des verwendeten Materials. Ich habe es als brisanten Stoff in Erinnerung, der genug Platz für Interpretationen ließ und genau das bot, was gute Literatur ausmacht.
Sein Lebensweg führte ihn über Stanford, Wien und Stockholm direkt nach Berlin, wo ihm sein Status als Koryphäe lästig zu werden begann. Bescheidenheit und Unschuld musste er ablegen „wie einen Arztkittel“. Pausenhofer hat mir versichert, es sei alles genau so und nicht anders abgelaufen. Ich hatte keinen Grund, ihm zu misstrauen, zumal er ein enger Freund war. Da ich mich nicht immer auf seine Schilderungen verlassen konnte, habe ich mir die Mühe gemacht, seriöse Quellen ergänzend zu nutzen. Tragischerweise hat er mir später vorgeworfen, „den Weg der Seriosität verlassen“ zu haben, ihm etwas angedichtet zu haben, was ihn derart erschüttert und enttäuscht habe, dass er sich vor kurzem das Leben genommen hat. Ich habe beschlossen, ihm mein Werk zu widmen, in ehrlicher Zuneigung und Dankbarkeit.
Ein paar Figuren musste ich erfinden, damit meine Geschichte nicht zu trocken und somit überhaupt erst zu einem Roman werden konnte. Als Ich-Erzähler fühle ich mich dazu verpflichtet, nicht zu unterschlagen, wo ich herkomme, dass ich seit Jahrzehnten in der Stadt lebe und fast alles, wovon ich berichte, mitgemacht habe. Vieles habe ich anders gesehen und überkommene Mythen korrigiert, wo es nötig war.
Zum Beispiel wurde in den frühen Neunzigerjahren bei der Abwicklung der Spanplattenkombinate, wie sie im Ostberlin überall herumstanden und sofort nach der Schließung verrotteten, alles stehen und liegen gelassen. Aus den Konkursmassen der verfallenden Betriebe wurde alles verschenkt, was bewegt und abtransportiert werden konnte. Die damals scharenweise zugereisten Schnorrer, zumeist Komödianten und Philosophen aus den Nachbarländern, begannen mit den giftigen, unglaublich haltbaren Trümmern ihre ebenso verfallenden Kellerlöcher billig umzunageln. Als Individualisten sind sie gekommen, aus Not oder Versehen, absichtlich oder zufällig. Ich kann es bezeugen, weil ich einer von ihnen war.
Die schmerzhafte Erkenntnis, nur einer von vielen zu sein, war zweifellos besser als nichts und von großem Wert für einen jungen Menschen. Ich konnte mich monatelang nicht entscheiden, ob ich Philosoph oder Tänzer werden wollte. An die Schriftstellerei habe ich damals nicht zu denken gewagt. Vom Prioritätensetzen sprachen die Philosophen, die von der Radikalität ihres Denkens überzeugt waren. Die Gesundheit zum Beispiel müsse einem egal, die „philosophische Praxis“ mit Radikalität und Denken zwingend in Einklang zu bringen sein.
Meinen Platz fand ich letztlich bei den Malern, die ohnehin noch Leute brauchten, um die Stapel beschichteter Platten nach Hause zu tragen. Die eigene Zukunft wollten die meisten nicht wahrhaben, am wenigsten die Poeten. Tänzer waren leidensfähig und zweifelten an fast nichts. Rückschläge gab es nie genug um aufzuhören.
Womit man aufhören solle?, fragten sich zuerst die Maler und fingen bald zu tanzen an. Ich erinnere mich an die Platten, mit denen ich mein Kellerloch zunagelte, um das Gesinge und Gemale ertragen zu können. Verlegenheit brachte uns zusammen und wir fanden immer einen, wenn es nötig war. Geteilt wurde alles und gefrühstückt mit denen, die wir im Bett fanden beim Aufstehen. Die Stadt war verwahrlost, riesig und hat uns alle überfordert. Jeden Tag sind Leute einfach gegangen und nie wieder gesehen worden.
Ostdeutsche gab es schon, gekannt haben wir sie nicht. Die einen hatten gar kein Gesicht, waren nur in den Nachrichten und von weitem zu sehen, mit Jacken über dem Kopf, wie sie aus den Ämtern getrieben und in Polizeiwagen gesteckt wurden. Es hieß, sie würden auf die noch warmen Pritschen der Schriftsteller, Pfarrer und Dissidenten gebunden, die aus den Zellen herausgetragen und vor die Kameras gesetzt wurden. Sie waren beliebt bei den Kameraleuten, weil sie alles mit sich machen ließen. Sie beschwerten sich nicht über den Lippenstift und die Hitze in den Studios. Angesehen waren sie auch, solange sie sich benahmen und ihr Schicksal beklagten. Jeder zweite ging schnellstmöglich in die Politik und saß bald an sogenannten runden Tischen, wo er sich in Sicherheit wähnte. Die Zeitungen erfanden das Wort Wendehals, um Pfarrer und Dissidenten brandmarken zu können, die wieder zurückgebracht und auf die Pritschen gebunden werden mussten, im Namen des Volkes und somit der Leser.
Man konnte sich nie sicher sein, wer eingesperrt und wer interviewt werden sollte. Majore der Staatssicherheit, die in Hinterhöfen Uniformen verbrannten und die Krusten pedantisch zusammenkehrten, wurden für Reinigungspersonal gehalten, bevor sie in ihren Dynamo-Berlin-Trainingsanzügen nach Hause gingen und auf die Dachböden stiegen.
Oft sind sie wieder herunter, wenn sie vom Aufhängen nichts verstanden, die Handgriffe längst vergessen haben und Fertigkeiten, die im operativen Dienst aus dem Effeff hatten beherrscht werden müssen, völlig verschwitzt haben. Manche sperrten sich noch schnell ein, hatten aber Angst nicht gefunden zu werden, ließen Schlüssel innen stecken und verhungerten aus Verzweiflung in den dunklen Löchern der Haftanstalten.
So gut wie alle Beamten wollten im Familien-, Eisenbahn- oder Agrarministerium gearbeitet haben und wurden erst an Trainingsanzügen, Ausweisen und an der gestelzten Bürosprache erkannt, die in den Fünfzigerjahren aus Sachsen in die Hauptstadt geholt worden war. Sprachverpflanzung, Kollektivierung der Kinderaufzucht, sowie der von den Russen abgeschaute, in den Folterkellern der Lubjanka entwickelte und über die Jahrzehnte erfolgreich angewandte Gliedmaßentausch haben in kürzester Zeit ein ganzes Volk entstellt und gefügig gemacht, und zwar für immer.
Das Ministerium für Staatssicherheit hatte nicht jeden genommen damals, war immer sehr wählerisch bei der Auswahl der Angestellten gewesen, die man vom ersten Tag der Ausbildung an mit den Härten ihrer zukünftigen Aufgaben hatte konfrontieren müssen. Sie seien nicht mehr Teil des Volkes, hatte man ihnen gesagt, sondern elitärer Volksersatz. Bei Kundgebungen, Massenveranstaltungen und dort, wo der Bürger gebraucht, gleichzeitig aber durch und durch unerwünscht gewesen war. Wahlen seien ohne sie nicht durchführbar, hieß es, lästige Auszählungen würden die abenteuerlichsten Ergebnisse zeitigen, die Urnenfertigung den Staatshaushalt belasten, würden Arbeitern und Bauern den Wahltag verderben, der für die Pflege der Schrebergärten dringend gebraucht wurde. Dachziegel hatten nur an Sonntagen gestohlen werden können und Handwerker hatten den Tag des Herrn geschätzt, weil sich jeder Handgriff lohnte.
Bevor der Anwärter für die Büroarbeit qualifiziert gewesen war, für die saubere Arbeit eine Eignung hatte vorlegen können, hatte klein angefangen, das Handwerk in der Elektronik oder im Straßendienst ordentlich gelernt werden müssen. Die Ungeschicktesten hätten sich mit Zuverlässigkeit und stenografischer Exzellenz immer noch Chancen ausrechnen können, bei der Verwaltung von Prügelkabinen Karriere zu machen. Psychologie war dort auf einmal gefragt gewesen, das Anschreien war in Bunkern geübt worden. Plastikuniformen waren zugeteilt worden und an das Schwitzen hatte man sich schnell gewöhnt. Es hatten schließlich alle geschwitzt und gestunken, bis zur Sekretärin hinunter.
Kollegial war man bis dorthinaus und gemocht hat man sich bis zum letzten Tag, bis alles vorbei war mit dem Mögen. Gemocht hat sie dann niemand mehr, die Majore, und gekonnt haben sie auch nichts. Kein Wirt hat sie reingelassen. Sie starben auf Pritschen, Betten und Mülldeponien, wurden von Insolvenzhausmeistern gefunden, in Säcken zusammengetragen und eingeheizt.
Ich bewunderte die Entschlossenheit der Menschen, das Zukunftsvertrauen, das einen völlig illusorischen Neuanfang garantieren sollte. Allein das Wort kannte ich nicht, las es zum ersten Mal auf Flugblättern, die evangelische Pfarrer verteilten. Vertraut haben irgendwann alle und tatsächlich geglaubt, es würde aufwärtsgehen. Die Naivität der Leute war unbeschreiblich, als sie vor den Trümmern standen, den Arbeiter- und Bauerntrümmern, mitgebracht von den Russen damals und nie weggeschmissen aus Angst.
Zusammenbruch stand jeden Tag in der Zeitung. Zusammenbruch und Zukunftsvertrauen. Keiner ahnte, was werden würde, nur das Schlechte sollte verschwinden. Rathäuser und Ministerien wurden gestürmt, die wildesten Zeitungen massenhaft gedruckt und gern gelesen. Spekulation wuchs aus allen Ritzen heraus, obwohl nur mit dem Zufall spekuliert werden konnte. Die Plattenlager waren auf einmal leer, Insolvenzhausmeister die ersten, die im Arbeitsamt Arbeit fanden und zu Amtsleitern aufstiegen.
Die leidigen Debatten über Täter, Opfer, Himmelbetten und Handschellen konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass nichts so zusammenschweißt wie die Empörung. Im Suff wurden Parteien gegründet und am nächsten Tag wieder abgewickelt. Was von der Lyrikerpartei „das bittere Brot der Erwerbslosigkeit“ genannt wurde, hieß in der Proletenunion „Schweinerei“, während im Diskussionsforum über die Anzahl an Mikrofonen abgestimmt wurde. Nicht jeder Redner konnte schreiben und Fairness war ein hohes Gut damals. Man einigte sich auf das Wort Massenentlassungen, was den Lyrikern nicht und den Proleten schon gar nicht gefiel. Immerhin kamen alle zu dem Schluss, dass das Ministerium für Staatssicherheit lange Zeit ein zuverlässiger Arbeitgeber und Stasi ein Kosenamen war, den man dringend gebraucht hatte, um nicht verrückt zu werden. Eigentlich hätte es so weitergehen können mit der Zuverlässigkeit, wenn sie nicht teuer geworden und das Geld noch was wert gewesen wäre.
Die inhaftierten Sekretäre wurden von Dissidenten und evangelischen Pfarrern durchgefüttert, was zum Streit über Moral und Gnade führte, der bis heute andauert.
Es war die Zeit der Mahnmale, zweiundneunzig, dreiundneunzig. Überall wurden Säulen und Platten eingelassen, hingestellt oder aufgebaut. Wo kein Platz für Steine und Tafeln war, ließ man hinmalen oder einmeißeln. „Traktorenfriedhof Treptow“ stand auf der langen Liste des Denkmalpflegeamts, „kein Platz zum Aufstellen“ als Randnotiz, „vielleicht noch zu gebrauchen“ als Vermerk dazu gekritzelt, kaum lesbar.
„Niemals vergessen!“ ließ der Bürgermeister in einen Traktor einritzen, feierlich. „Niemals vergessen!“. Dann setzte er sich ins Auto und vergaß sofort alles. Den Pestgestank der Zuchthäuser, den ätzenden Kalk auf den Leichen, die Brutalität des verrückten Regimes. Niemals vergessen hätte man das sollen, sofort vergessen hat man es. Auf den ersten Blick konnte man die rostigen Trümmer für Grabsteine halten, umstanden von Unkrautrabatten.
Martin Pichler, 2023
1
„Die Schwachsinnigen sind eigentlich die Raffiniertesten! Nur kommen sie nicht aus der Station raus ohne die Epileptiker, die wiederum nicht raffiniert genug sind.
Zur Kontrolle
„Schau‘n Sie! Schau‘n Sie! Dort!“, Fritz stand am Fenster des Chefarztzimmers und zeigte hinüber zu der Gruppe von Laubbäumen. „Schau‘n Sie, Herr Pichler! Ein Eichkatzerl, dort! Sie werden durch den Winter gemästet. Es wird nicht geruht und geknausert. Was die Ratten ihr Lebtag lang nicht berücksichtigt haben, ist ihr Erscheinungsbild. Freundliches Auftreten reicht nicht. Man lässt sich einen buschigen Schweif wachsen, gepflegt und frisiert, oder wird zur Arbeit verurteilt, in den Kanal geschickt, auf die Müllhalden. Anpassung, Evolution heißt das offiziell, ich nenne es Anbiederung. Mit Natur hat das nichts zu tun“.
Jeder Baum auf dem Gelände sei Statist in einem Theaterstück, das jeden Tag uraufgeführt und von ihm dramaturgisch betreut würde. Bis in die scheinbar unwichtigsten Abläufe hinein. Das Schuhwerk des Küchenpersonals müsse auf die Farbe des Essens abgestimmt und die Haare der Schwestern an Feiertagen gefärbt werden. „Meinen Schauspielern lasse ich Spielräume, die sie für Improvisationen nutzen sollen. Nur so kommt man ihnen auf die Spur.“
Das Frühstück zum Beispiel würde von den Schwachsinnigen eingesteckt und im Stiegenhaus den Idioten übergeben. „Sie binden sich die Schuhbänder in Sekunden zusammen, wofür sie sonst eine halbe Stunde brauchen, und laufen in den Hof.“ Die Beute würde von den Spinnern aus dem Klofenster geschmissen, von den Idioten sortiert, bevor die von den Epileptikern herausgebrachten Schwachsinnigen sich in Kohorten formierten und synchron ausschwärmten. Und das in jede Richtung, die sie jeden Tag ändern würden.
„Unmöglich einzufangen!“ Das gleichzeitige Ausschwärmen habe sich etabliert, als er einige Pfleger zur Ergreifung des Anführers abgestellt habe, „den es natürlich nicht gibt! Schon lang nicht mehr! Beim späten Homo sapiens nicht mehr nachweisbar. Ich sag Ihnen was, Herr Pichler: Wir scheitern am Primitiven und denken über Krankenversicherungen nach“.
Während die Schwachsinnigen alles an die Eichkatzen verfütterten, seien die Spinner wieder zurück und jammerten, dass sie nichts gekriegt hätten, kein Frühstück ausgeteilt gekriegt hätten, angeblich. Nachweisen könne man nichts, solange Hunger nicht messbar sei. Die Ratten hätten schon lange resigniert und fielen den Füchsen zum Opfer, die sich nur noch in Gruppen aus dem Gebüsch trauen würden, ständig auf der Hut.
„Nein, Herr Pichler, die Füchse sind nur mehr die zweiten in der Nahrungskette, haben sich vom Fressfeld gemacht, die Waffen gestreckt. Erzählen Sie mir nichts! Gratuliere! Sie waren einer der Geschicktesten im Ensemble, Hauptdarsteller! Sie haben nur den Dramaturgen unterschätzt, mich unterschätzt! Dabei sind Sie schon vor Jahren entlassen worden. Drei, vier Jahre sind das jetzt. Was Sie hier sehen sind die Früchte Ihrer Arbeit.“
„Wo Sie hinschau‘n, Erbrochenes der Eichkatzerln, Eichkatzen inzwischen, Eichhunde“. Ein Veterinär, der sich immer um den Streichelzoo gekümmert habe, sei mittlerweile allein für die Lösung des Eichkatzenproblems abgestellt worden, während der Streichelzoo, „für die Psychopathen überaus wichtig“, von einem Aushilfstierpfleger betreut und immer mehr verwildern würde.
„Dilettantisch gepflegt, überhaupt nicht gepflegt!“ Er sprach zum Fenster hinaus, zum Öffnen war es zu kalt. „Schau‘n Sie! Da drüben!“ Auch der Gärtner sei überfordert, meinte er. Früher habe er die Eichkatzen beobachtet, gesichtet, ab und zu, bis er dann Baumschäden festgestellt habe, wie er sie nur aus Elchgehegen im Berliner Tierpark gekannt habe. Fritz gestikulierte und drehte sich zu mir um. „Wie geht‘s Ihnen, Herr Pichler? Keine Anfälle?“
„Glaub‘ ich Ihnen, glaub ich, erstklassiges Medikament!“ Es dauere nur immer viel zu lang mit den Gesundheitsbehörden. Er drehte sich wieder zum Fenster, „Krankheitsbehörden, eigentlich!, immer schon! Studien, Studien, ja!, da sind sie die Korrektheit selber“.
„Was glauben die überhaupt? Da können Sie gleich einen Lastwagenfahrer hier reinstellen, Volksschullehrer, an meinen Schreibtisch setzen, hier!“ Er gestikulierte und zeigte im Zimmer herum. „Einen Kammerjäger!“. Wobei die Kompetenz eines Kammerjägers nicht zu unterschätzen sei, „bei Gott nicht!“, aber „Ich geh‘ doch auch nicht in den Keller und misch‘ mich ein“.
„Wenn mir die Krankheitsbehörden vorkauen, was ich zu tun habe, hätt‘ ich doch schon tausende Idioten unters Messer legen müssen!“ Man warte, bis der Zug abgefahren sei und dränge sich dann auf die Trittbretter, wenn die Wirkstoffe schon viel zu teuer seien. „Viel zu teuer! In der Pharmaindustrie sitzen Betriebswirte, und das ist gut so!“
„Schwein gehabt haben Sie!, Herr Pichler! Den Schädel hätt‘ ich Ihnen aufschneiden müssen, eigentlich. Auf der Liste sind Sie schon gestanden, ich hab‘ Sie durchgestrichen. Auf gut Glück den Schädel aufmachen und schau‘n was drin ist, was raus muss. Ausmisten hätt‘ ich sollen, so heißt das, wenn der Krankenbeamte neben einem steht, einem auf die Finger schaut. Mir natürlich nicht, dem Professor auf seine Koryphäenfinger schauen traut er sich doch nicht. Niemand traut sich das!“
Viel zu spät habe er verstanden, wer hier die Drahtzieher sind. „Nicht der Betriebswirt, die Krankenkassen, nein! Krankenbeamte! Alle aus Chemnitz, Karl-Marx-Stadt noch immer! Jung! Dynamisch hätt‘ ich fast gesagt. Tragisch!“ Wenn er sich nur hinsetzen würde, dachte ich, einfach hinsetzen, und dieses Gefuchtel …
„Den Bürokratismus mit der Muttermilch aufgesogen, Beamtenblut väterlicherseits, aufgeschwemmt vom Beamtenblut! Ich sag‘ Ihnen eins: Karl Marx hat die deutsche Krankheit auf dem Gewissen, verstaatlicht. Die Krankheit darf nicht krank und Gesundheit um Himmels willen nicht gesund werden, Herr Pichler! Dann rollt der Rubel nicht. Er hat die Börse nicht verstanden, der Kaffeehausökonom aus Trier, von Engels ausgehalten sein Lebtag lang, alimentiert! Kruzifix!, wie Lenin ein Kaffeehausrevolutionär war, vom Revoluzzern keine Ahnung und groß geredet. Heute kümmern sich die Arbeitsämter um solche Leute, Fortbildungen für nichts und wieder nichts.“
„Glauben Sie, Herr Pichler, Sie könnten sich Ihre Tabletten leisten? Sozialhilfe, ha!, zum Sterben zu viel. Draufgegangen wären Sie, schon längst nicht mehr da stehen würden Sie!“
Chemnitz wäre Chemnitz geblieben und die DDR hätte man sich auch gespart, den Hunger nicht auch noch verstaatlicht. Krankheit sei ein hohes Gut, meinte er, das gescheit anzulegen sei. Er setzte sich endlich und griff nach einem Kugelschreiber im Marmeladeglas. Er wollte irgendwas aufzeichnen, eine Straßenkreuzung offenbar, mit dem dritten Stift. Angetrocknet, hoffentlich schreibt der, dachte ich mit Blick auf das Laubgrün draußen.
„Epileptiker und Arbeitslose sind das Geschmeide im Tresor der Krankenkassen. Neurologen, speziell die Koryphäen, nur Sand im Getriebe. Die Betriebswirte mussten von vorn anfangen vor zwanzig Jahren. Die Krankheit wieder aufwerten, ordentlich spekulieren und arbeiten lassen. Wenn die Leute in Gesundheit investieren, haben sie gleichzeitig in Idioten investiert“. Er stand längst wieder. „Ach!“
Er drehte sich zu mir um und wieder zum Fenster. „Man braucht Leute wie Sie, Herr Pichler. Dauergäste, Pfleglinge, Kunden. Genauso die Gefängnisse und Arbeitsämter. Wie die Luft zum Atmen braucht man Sie in Wahrheit. In Chemnitz leben die Leute von Ihnen und renovieren ihre Burg, die Zugbrücken. Mir geben sie jetzt Medikamente, die ich gebraucht hätte, die ganze Zeit. Viel zu spät natürlich.“
„Jetzt dürfen Sie, Herr Pausenhofer, nehmen S‘ nicht zu viel! Könnt‘ ja einer gesund werden!“ Der Idiotenpool dürfe nicht austrocknen, sagen sie. „Wie ein Goldesel werden Sie gemolken“, das Abstillen müsse er um jeden Preis verhindern. „Freigelassen dürften Sie nicht werden und absterben schon gar nicht. Jeder Spinner, den ich auf der Straße verliere, der unter die Taxiräder kommt, wird mir vom Gehalt abgezogen, das ja viel zu hoch, eigentlich eine Frechheit ist.“
„Den Pausenhofer müssen wir haben, bei uns! Als Schaufensterkoryphäe! Das Geld stopfen sie mir rein vorn und hinten, machen kann ich, was ich will, Hauptsache ich arbeite nicht! Könnt‘ ja was kosten. Patientendiebstahl! Verstehen Sie das, Herr Pichler? Was das heißt? In Berlin werden Leute wie ich zum Da Sein bezahlt. Ethische Standards?, wozu?! Umwegfinanziert werd‘ ich! Monatelang in den Weltbibliotheken, New York, Tokio gewohnt, ein Pausenhofermuseum in Boston, Wachsfiguren und so weiter. Und hier in Berlin? Meine Doktorarbeit ökonomisiert und die Kloschüssel runter!“
„Verantwortungslos, Herr Pausenhofer! Wir können das nicht unterstützen, Herr Pausenhofer! So leid es uns tut. Niemandem zumuten.“ Tausende epileptische Hamster hätten seit Jahren keine Anfälle mehr, das schon, aber dem Pichler könnten sie das nicht zumuten.
In Wahrheit könnten sie es dem Krankenbeamten aus Chemnitz nicht zumuten. „Die Chemnitzer Beamtenburg ist uneinnehmbar! Kaserniert sind sie da! Aufgewachsen, abgerichtet und zuständig für die deutsche Krankheit. Krankheitswesen! Unwesen!“
„Und dann der Ethikrat. Ethikratten sind das! Keine Ahnung von Tuten und Blasen, aber dreinreden überall! Was glauben die denn, warum meine Arbeit so viel losgetreten hat, damals? Weil die Neurologie dahingedümpelt ist, die Psychiatrie ein Biotop für Quacksalber war. Was Spinner so gefährlich macht, ist ja die Tarnproblematik. Wir haben heute weltweit Idioten in prekärster Weise auf wichtigen Posten sitzen. Es ist so gut wie unmöglich, die wieder da wegzubringen, einzufangen. Sitzt ein Präsident einmal auf seinem Posten, ist es unmöglich, ihn psychiatrisch zu behandeln. Denken Sie an die ganzen Immunitätshürden, man kommt an die Patienten nicht mehr ran. Und das nur, weil Krankheitsbehörden so sind, wie sie sind. Heilung unerwünscht!, jedes Irrenhaus ein Lager für Biowaffen! Drum ist eine Kenntnis der Symptomatik so wichtig.“
„Ich war der Einzige, der Einzige in Stanford, ich erinnere mich genau, der überhaupt davon geredet hat! Von Ethik, ethischen Standards! Alles andere wären ja höchstens bürokratische Standards gewesen, wo sie alle herum geforscht hätten. Die genialsten Köpfe waren gleichzeitig die bürokratischsten Köpfe. Ein Trauerspiel war das! Ein Wunder, dass ich mit meiner Arbeit tatsächlich an die Oberfläche, die Öffentlichkeit gekommen bin! Ich weiß bis heute nicht, wie es mich da hingeschwemmt hat. Genauso gut hätten sie mich für immer wegsperren können. Heute können sie mir nichts mehr, die Beamten. In jedes Parlament könnt‘ ich gehen und mich wählen lassen. Fritz Pausenhofer, Professor Fritz Pausenhofer, Ethikrat auf Lebenszeit, unangreifbar, bis zum Tod eine Gefahr! Weltgefahr!“
„Die Schwachsinnigen sind eigentlich die Raffiniertesten! Nur kommen sie nicht aus der Station raus ohne die Epileptiker, die wiederum nicht raffiniert genug sind. Sie müssen ein kompliziertes, durch jede kleine Erschütterung gefährdetes System aufbauen. Eigentlich der Kern meiner Arbeit, damals. Ein sich selbst regulierendes Konstrukt, ethisch bis zum Gehtnichtmehr ausbalanciert. Sie können eine Neurologische, sogar eine Psychische, völlig autonom laufen lassen. Minimalinvasiv. Nehmen Sie einen Idioten raus, entlassen Sie einen Epileptiker und alles fällt zusammen.“
„Kommen Sie, Herr Pichler, wir gehen auf einen Kaffee. Kommen Sie!“ Seine erste Amtshandlung sei es gewesen, den Leuten zu erklären, was ein ordentlicher Kaffee sei. „Ich wäre keinen Tag länger geblieben! Die Leute glauben, mit ein bisschen Cafeteria, Caprifischer, Mona Lisa können sie einen Kaffee vorgaukeln. Vorspielen! In Berlin kann man sich alles erlauben was Mehlspeisen und Kaffee betrifft. Da wird einem alles abgekauft von irgendwem. Kaffee ist für Epileptiker sowieso Gift, hat man mir gesagt. Mir hat man das erzählen wollen! Ausgerechnet mir! Kommen Sie, gehen wir.“
Ein Bau stand mitten auf der Wiese zwischen der Neurologischen und der Notaufnahme. Ein Trampelpfad führte schräg über den Rasen. Hier würden sie sich zusammenrotten, die Eichkatzen. Es erinnere ihn an ein Hyänenrudel, das sich einen Fuchskadaver aufteilt. Wobei man auf den ersten Blick gar nicht sehen könne, was jetzt überhaupt der Fuchs sei. „Eichkätzchen zu Fleischfressern mutiert!“, hieß es in der B.Z., im Tagesspiegel. Sie würden einem nicht über den Weg springen, wie im Tiergarten, jedem anderen Park in der Stadt.
„Man trifft sie an! Begegnet ihnen!, auf Augenhöhe, sagt man heute gern, face to face! Als ich mit meinem Vater in die Kirche bin als Kind, hat man den Bürgermeister angetroffen. Grüß Gott sagen!, hieß es. Sag schön Grüß Gott, Herr Bürgermeister! Grüß Gott, Herr Pfarrer!“ Hier treffe man die Eichkatzen an.
„Schau‘n Sie, da, da! Wieder eins! Auf den Baum? Lachhaft! Übergewichtig, hochgradig adipös!“ Auf den Baum gingen sie schon lange nicht mehr, „viel zu fett, aufgeschwemmt wie die Chemnitzer Beamten“. Erdhöhlenbewohner seien sie geworden, die „Erdhörnchen, Erdhörner!“ Wenigstens sei es ein Spektakel für seine Patienten. Immerhin habe alles zwei Seiten. „Die Baumschadenseite für den Förster, die Spektakelseite für meine Spinner!“ Ich habe längst vergessen, was ich überhaupt von ihm wollte.
Damals habe man noch gewusst, wie eine Klinik aussehen soll. Ende neunzehntes Jahrhundert. „Will man gesund werden, dann hier. Sie natürlich nicht. Vergiftet über Jahrzehnte mit Pulver aus dem Mittelalter.“ Mit der Epilepsie sei es so eine Sache, mit oder ohne Anfälle. „Es geht um die Potentialität, Herr Pichler, wir sprechen von Gewitterzellen, nonkausalen Interferenzen. Wir können vermuten, mehr nicht. Permanente Bedrohung heißt das für Sie. Dabei sind Sie eine Melkkuh für die Apotheken, ein Geschenk des Himmels. Was sind Sie? Künstler? Na ja! Sicher, Epileptiker, alle hochbegabt, sagt man. Straßenkehrer brauchen auch Leute, die auf den Gehsteig scheißen. Schau‘n Sie! Da! Man muss sie wegtreten, wenn man hier durchwill. Zusammentreten. Schon wieder einen Fuchs zerlegt. Erbrochenes, hier!, dort auch!“
Auf seinem Tisch, voll mit Fachzeitschriftenstapeln und Marmeladegläsern, haufenweise Zettel: „Milch, Italienisch, Brot, Bananen, Thomas 14:30, Stadtautobahn, zweispurig ab Schöneberg“.
„Hilfsarbeiter werden!, nichts anderes! Bei der Bahnmeisterei Schotter schaufeln, Streusand. Streckenläufer, Gleise kontrollieren und am Abend ein Bier. Vielleicht ein paar Kinder. Und jetzt? Epileptologe! Koryphäe, schwul noch dazu. Nichts mit Kegeln und Tennisspielen. Dafür im Fernsehen über die Idioten reden, die Sie hier sehen. Meine Idioten! Hirnkranke! Und Sie, Herr Pichler?!, ehrlich gesagt, ein Wunder, einmalig, wie die Eichkatzen.“
Dass wir den Kaffee vergessen haben, bemerkten wir beide nicht. Dafür immerhin ein Spaziergang übers Gelände. Hier die Notaufnahme, dort die Werkstatt der Tischler, die ohnehin niemand mehr brauche. „Alles aus Plastik inzwischen! Ein Tisch aus einem Guss, Giftsessel!, von jedem Wind davon geblasen, der Kellner geht sie abends einsammeln auf dem Gelände.“
„Wenn ich nicht Professor Pausenhofer, Herr Professor Pausenhofer wäre, sie hätten mich schon längst eingeliefert, garantiert!“ Bevor sich jemand mit einer astronomischen Rente ins Private verziehe, mache man ihn zum Patienten. Offiziell gäbe es das nicht, dennoch sei es gängige Praxis. „Schnell krankgeschrieben, per Attest zum Idioten erklärt, alles durchgerechnet. Seine Frau auch gleich mit. Ein paar Jahre durchgefüttert, vielleicht ein paar Studien. Versuchsrentner!, bringt auch nochmal was. Die Eigentumswohnung zum Wohnheim, ordentlich Miete von den Leuten kassiert, die für sieben Euro die Stunde U-Bahnhöfe sauber machen. Blitzsauber, sonst werden sie abgeschoben. Wären Sie nie drauf gekommen?! So funktioniert das. Ganz Deutschland lebt davon.“
„Was machen Sie am Wochenende? Die Baustelle an der Frankfurter Allee verschwindet. Übermorgen, wenn‘s mich nicht täuscht. Beliebt bei den Motorradfahrern, glauben Sie mir.“
Die Begegnung
Er sei als Dorftrottel vorgesehen gewesen. Aufgewachsen sei er in der Steiermark, wo man sich in Bauernfamilien noch heute nach dem dreizehnten Kind mit den Großeltern zusammensetzt, um sich ernsthaft über die Zukunft zu unterhalten. Es seien nicht nur Kosten-Nutzen-Rechnungen gewesen, die eine Rolle gespielt hätten. Hätte man den Pfarrer gefragt, wäre immer das gleiche herausgekommen, hätte man ihn nicht gefragt, hätte man auf der Stelle einpacken können.
Weil fast alle Pausenhoferkinder Töchter und die Buben unbrauchbar gewesen seien, habe man beschlossen, es noch ein-, zweimal zu versuchen. Der Großvater habe eine Messe lesen lassen, für ein paar hundert Schilling, die er vom Feuchtlerbauer für das Abstellen seines Jauchewagens hinterm Stall immer verlangt habe. Geweint habe er, zum ersten Mal in seinem Leben, als Alois und letztendlich er, Fritz, gekommen seien.
Er habe das Pech gehabt, nicht nur der Jüngste gewesen zu sein, sondern auch noch eine Schwester gehabt zu haben, die die Aufmerksamkeit der Eltern ganz und gar beansprucht habe. Von Fürsorge habe man damals nicht reden können. Roswitha sei aufsässig und laut gewesen und wenn sie, wie sehr oft, vom Vater geschlagen worden sei, sei sie tagelang in den umliegenden Wäldern verschwunden. Sie sei dann von Holzknechten aufgegriffen und dem Förster übergeben worden. Dieser habe Roswitha zurückgebracht, der Vater habe sich reuig und einsichtig gezeigt. Es komme „nie wieder vor“. Seine Versprechungen hätten sich spätestens dann als völlig leer herausgestellt, wenn er im Gasthaus zu viel getrunken, viel zu viel getrunken, Karten gespielt und dabei verloren hätte.
Er, Fritz, sei ein völlig normales Kind gewesen, etwas ungeschickt vielleicht. Er sei über das wenige Spielzeug seiner Geschwister gestolpert und habe oft geweint, in sich hinein. Während die älteren ihre Schulaufgaben gemacht hätten, sei ihm ein Schnapstuch in den Mund gesteckt worden. Im Gegensatz zu Alois seien bei ihm ein Hang zu Melancholie, Anzeichen von Sensibilität zu erkennen gewesen, wenn man sie hätte erkennen wollen. Als unerwünschte Weichlichkeit wäre sie ihm bestimmt mit väterlicher Gewalt ausgetrieben worden. Seiner Leidensfähigkeit sei es zu danken gewesen, dass er heute überhaupt hier sitzen könne.
Als er mit sechs Jahren eingeschult worden sei, habe man schnell gemerkt, dass er es in der Schule wahrscheinlich schwer haben würde. Man hätte ihn am besten gleich nach der Volksschule, wo er noch irgendwie hätte mitgeschleppt werden können, in die Sonderschule schicken sollen. Ein glückliches Kind hätte man damals gar nicht sein können. Man hätte froh sein können, überhaupt ein Kind zu sein. Nutzkinder seien damals die Regel gewesen, Gebrauchskinder, die gleich hätten im Stall wohnen und die Mistgabel gar nicht erst aus der Hand legen sollen.
Die Wärme der Kühe sei ohnehin besser gewesen als die Herdhitze. Wärmen und Heizen seien grundverschieden gewesen, damals. Der Mistgeruch habe niemanden gestört, bevor die Nutzkinder ins Schulalter gekommen seien. Dort hätten sie nur auf der linken und nicht auf der rechten Klassenzimmerseite sitzen dürfen, wo die Eisenbahnerkinder im Lokomotivenölmuff gesessen seien. Das Wort Gymnasium habe man gar nicht auszusprechen gelernt, vom Wort Universität gar nicht zu reden.
Dass sich Lehrer oft täuschen ist bekannt, wenn nicht gar die Regel. Fritz sei, von seinen schlechten Leistungen im Rechnen abgesehen, der beste Schüler gewesen, der die Dorfschule je verlassen habe und der Lehrer habe, um sich nicht vollends blamieren oder gar sein Gemeinderatsamt hätte loswerden wollen, mit Fritz ins Leobener Gymnasium fahren müssen, um ihn zu empfehlen.
Sein Studium in Wien und Stanford habe er mit seiner Doktorarbeit Zu den ethischen Standards in der klinischen Gehirnforschung abgeschlossen, die bereits vor ihrer Veröffentlichung in der Fachwelt diskutiert worden sei. Wer die Blätter aus seiner Schreibmaschine herausgenommen und fotokopiert habe, sei nie bekannt geworden. Ethische Standards, selbst klinische Gehirnforschung habe es damals gar nicht gegeben. Man sei froh gewesen, wenn man den Epileptikern das höchst problematische Umsichschlagen hätte austreiben können. Lederriemen seien damals noch angelegt, Zaumzeuge ohne die geringste Elastizität an den Betten befestigt worden. Muskelrisse hätten die Menschen verkrüppeln lassen, die blaue Gesichtsfarbe sei nie wieder weggegangen.
Freunde habe Fritz sich nicht gemacht in der Fachwelt, das sei abzusehen gewesen. An Symptomen habe man damals herumgedoktert, in den USA habe man damals noch von Epileptics Handling gesprochen. Umgang mit Hirnkranken sei damals Pflegersache gewesen, bis weit in die Achtzigerjahre hinein. Aus heutiger Sicht würden die Ethischen Standards als wegweisend betrachtet. Was damals den Forschern einen Schub gegeben habe, sei in der klinischen Praxis noch längst nicht angekommen gewesen.
Zurück in Österreich habe er von der Neurologie vorerst nichts mehr hören wollen und sei in die Steiermark zum Schwammerlsuchen gefahren. Außerdem habe er, weil der Großteil seiner Schwestern inzwischen weggeheiratet habe, beim Heueinfahren helfen müssen. Eine Handvoll Briefe von der Ärztekammer, dem AKH Wien, dem Berliner Rudolf-Virchow-Krankenhaus und dem Karolinska Universitätsklinikum in Stockholm seien auf dem Küchentisch gelegen, bis die Mutter sich daran gewöhnt habe, die Leberknödelsuppe darauf abzustellen. Die kleine Nichte, deren Name ihm noch nicht geläufig gewesen sei, habe den Karolinskabrief mit Elchen verziert. In Wirklichkeit habe sie ihn völlig zerknittert und verkritzelt, letztendlich unleserlich gemacht. Der Brief aus Berlin habe sich viel später beim Einheizen des Küchenherds zwischen den Spanhölzern angefunden.
Die Anrufe aus der Hauptstadt seien von höchster Stelle gekommen. Fachpolitiker und Rektoren hätten ständig ins Postamt telefoniert, einen eigenen Anschluss habe man am Hof noch nicht gehabt. Der Chefarztposten im AKH sei gerade vakant geworden. Die Worte Händeringend und Dankbar seien ständig gefallen.
Eilig habe Fritz es damals nicht gehabt. Zurecht, die Neurologie sei damals noch gar nicht bereit für ihn gewesen. Schon gar nicht in Wien, wo der letzte Nobelpreisträger hundert Jahre tot gewesen sei. Sein Vater, von Suff, Arthrose und Arbeitsunfällen gezeichnet, habe dringend einen Helfer gebraucht, der wohl hätte ausgesucht werden müssen, bevor Fritz guten Gewissens nach Wien habe gehen können. Alois, so der Großvater, sei „für nix“.
Vom Fenster des Chefarztzimmers aus habe man alles, nur keine Eichkatzen, keine Laubbäume, nur das Grau der Achtzigerjahre sehen können, das sogenannte Wiener Grau. Er habe es gerade bezogen, da seien schon Gerüchte aufgekommen, er würde in der Neurologischen so einiges vorhaben. Neue Saiten würde er aufziehen wollen, mit Antragsformularen würde er sich ungern aufhalten. Liebgewordene Gepflogenheiten habe man alles genannt, was Schlampigkeit und Dummheit gewesen sei und das unappetitliche Cremeweiß der Zimmer habe er sofort übermalen lassen.
„Besonders!, die wirklich Großen, eigenwillig!“, habe es geheißen. Das habe man in Kauf zu nehmen, wenn man Leute wie Fritz Pausenhofer kriegen könne. Sicher, das Wort Ärztematerial, von Fritz oft und gern gebraucht, sei damals nicht gut angekommen.
Dass Epileptiker und Schwachsinnige auch sterben, hätte er wissen müssen. Eigentlich habe er jeden Tag mit dem Tod gelebt, zusammengelebt, der im ganzen Krankenhaus herumgehangen sei. Verblödungen erster Ordnung hätten jeden treffen, jeden auf einen Schlag zum Pflegefall machen oder gleich umbringen können, unblutig. Synaptoiden Kernhirnexplosionen habe er in den Ethischen Standards ein eigenes Kapitel gewidmet und wäre fast daran zerbrochen, so habe es ihn gequält in der Nacht. Als drückend und bedrohlich habe er die ersten Tage und Wochen noch heute in Erinnerung, bei jeder noch so belanglosen Entscheidung sei ihm unwohl gewesen.
Zuerst sei Professor Wirnsberger abgeholt worden. Die zwei Männer seien unauffällig gekleidet und geradezu übertrieben höflich gewesen. Einer habe ein unsympathisches Vogelgesicht gehabt. Niemand habe gewusst, was sie mit Professor Wirnsberger gesprochen hätten, während sie zügig die langen Gänge durchmessen und hinten am Stiegenhaus noch laut gelacht hätten. Ein Bett sei noch schnell herausgeschoben worden, bevor die drei mit dem Lastenaufzug ins Untergeschoss gefahren seien. Dort sei Professor Wirnsberger in einen dunklen VWKombi eingestiegen. Das habe eine Mitarbeiterin der Wäscherei beobachtet, die mit ihren Kollegen um diese Zeit die Berge von Bettwäsche und Arztkittel in einen Abstellraum gestapelt habe. Die beiden Männer hätten sich auf sie Rückbank links und rechts von ihm gesetzt, bevor der Wagen durch die West-Auffahrt die Tiefgarage verlassen habe. Ein VW-Kombi habe damals noch recht gerußt und die Frau von der Wäscherei habe die Gesichter nicht beschreiben können. Nur, dass einer ein unsympathisches Vogelgesicht gehabt habe. Herr Professor Wirnsberger jedenfalls sei nie wieder gesehen worden.
Das alles sei sehr traurig gewesen und habe tiefe Wunden hinterlassen. Alle seien geschockt und verzweifelt gewesen. Er, Fritz, habe größte Mühe gehabt, wieder Frieden in die Neurologische zu bringen. Er sei oft an seinem großen Fenster gestanden und habe an nichts anderes als das Hinausspringen gedacht, auf den Betonparkplatz. Ein Hinausspringen sei das einzig mögliche, habe er gedacht, ins Wiener Grau hinein. Er habe an das Vogelgesicht gedacht, das er gar nicht gesehen habe am fraglichen Tag. Pockennarbig, aschfahl habe er es sich vorgestellt, wie den Tod selber. An seine Mutter, das Heueinfahren, die Leberknödelsuppe habe er gedacht, als er am Fenster gestanden sei und hinuntergeschaut habe. Und an den Brief von der Karolinska Universitätsklinik. Eine Karriere sei ihm wurscht gewesen. Zumeist habe dann das Telefon geklingelt oder ein Epileptiker sei zusammengefallen auf dem Gang, den auch das Vogelgesicht mit Dr. Wirnsberger lachend zum Lastenaufzug hinübergegangen sei, Tage und Wochen zuvor. An die Spinner und Schwachsinnigen habe er gedacht, die er immer ernst genommen habe. In Wirklichkeit, so sei ihm mit einem Schlag klargeworden, habe er sich immer gern von den Idioten anspucken, anschreien, mit Kamillenteetassen bewerfen lassen. Ausbrecher habe er von den Epileptikern im Hof oder der Straße einfangen lassen.
Hirnkranke seien grundsätzlich unberechenbar, davongelaufen seien sie bei fast jeder Gelegenheit und eingefangen hätten sie nur von Hirnkranken werden können. Die Drähte von Spinnern zu Schwachsinnigen, Epileptikern und Idioten seien die stabilsten gewesen. Das Lügen sei ihnen fremd, die Gemeinheit sei einfach zu durchschauen, sei eigentlich gar keine und völlig unwirksam gewesen. Das habe er schon in den Ethischen Standards herausgearbeitet, mit der größten Präzision, wie es seine Art war.
Trotzdem, es sei nicht zu leugnen gewesen, dass die Verjüngung der Belegschaft gewisse Entwicklungen erleichtert und zum guten Ruf des AKH Wien beigetragen habe. Das habe nichts an dem schlechten Gewissen geändert, das Fritz bis heute, wohl auf immer und ewig begleite. Er habe viel zu oft an den Tod gedacht in dieser Zeit, viel zu oft. Dass einem jeden Tag einer wegsterben könne, unter der Hand wegsterben könne, sei ihm naheliegend und unwirklich zugleich vorgekommen.
Als Dr. Hofstätter irgendwann nicht mehr gekommen sei, hätte nicht viel gefehlt und er hätte das letzte Kapitel der Ethischen Standards herausgestrichen, herausgefetzt, wo es um die Endgültigkeit geht. Gibt es die Schuld an der Endgültigkeit? In der klinischen Gehirnforschung habe das Thema keinen Platz gehabt.
Fritz habe mit dem Tod nie etwas zu tun haben wollen. Als Neurologe und Psychiater, habe er gedacht, werde er das am ehesten können. Nur kein Messer in die Hand nehmen, herumoperieren auf dem viel zu schmalen Grat. Unfallkrankenhäuser, ein Schlachtfeld! Wie die sogenannte Gastarbeiterroute, die Fritz immer zu überqueren gehabt habe auf dem Schulweg. Dort seien die Fetzen geflogen, habe er immer wieder Motorradhelme auf den Wiesen gefunden, Gaspedale und einmal eine Armbanduhr auf einem Handgelenk im Kukuruzfeld. Abgehärtet habe ihn das nicht, im Gegenteil. Der Pausenhoferopa wird irgendwann nicht mehr sein, das habe er von der Mutter gesagt gekriegt, bis es dann soweit gewesen sei, wenn auch viel später. „Der Tod kommt so oder so, aber er kommt“, habe der Opa gesagt. Es gebe keinen Umgang mit dem Tod, er mache, was er wolle, der Tod.
Bei Dr. Hofstätter sei das ganz anders gewesen als bei Professor Wirnsberger, der ein Prominenter gewesen sei. Keine Nachrufe habe man finden können, nicht einmal im Wiener Ärzteblatt. Irgendwo sei dann wohl etwas abgedruckt worden, viel zu spät. Und das auch nur, weil er, Fritz, einen Nachruf geschrieben habe, der dann noch um die Hälfte gekürzt worden sei. Wenigstens habe es bei ihm noch ein Begräbnis gegeben auf einem Ottakringer Friedhof. Mit Frau Dr. Ferstl und Hofstätters Schwester sei er fast allein dagestanden. Nur der Heri und der Manni vom Brigitte am Lerchenfelder Gürtel seien da gewesen. Geweint hätten sie alle, nur Frau Dr. Ferstl nicht. Tagelang habe ihn niemand vermisst, nur der Pförtner vom Haus A habe nach Dr. Hofstätter gefragt.
Was damals in seiner Wiener Zeit noch geschehen sei, war ihm nicht mehr gut in Erinnerung. Das Einzige, woran er sich erinnerte, sei der Unfall von Frau Dr. Ferstl ein paar Tage später gewesen. Erzählen wollte er mir das aber nicht. Er hatte bestimmt schon einiges getrunken, bevor ich ihn damals in einem Schwulen-Café in Schöneberg allein am Tisch sitzen gesehen und von weitem gegrüßt habe. Herr Professor Pausenhofer war er damals noch. Respektabel war er. Geglaubt habe ich ihm alles. Er hätte auch zahlen und gehen können, wegschauen und schnell hinaus. Das Wetter war nicht danach, ich erinnere mich. Bis dahin war unser Verhältnis professionell, soweit ein Neurologe überhaupt private Beziehungen pflegen kann. Das Wort Privat habe ich aus seinem Mund nie gehört in den ganzen Jahren, die ich ihn inzwischen kenne. „Privatlich wäre etwas“, meint Fritz, „oder gar nichts“. Natürlich wisse er, was die Leute meinen, aber „warum sagen sie es dann nicht?!“
Die Frage, was ich beruflich machen würde, hat mich immer ins Stottern gebracht, mir die Sprache verschlagen, bis ich aus der peinlichen Lage mit irgendeiner Antwort herausgekommen bin. Außer Fritz kenne ich niemanden mit einem Beruf und leben tun sie alle ganz gut. Sicher, manche existieren eher, sind einfach da. Fritz braucht nur einen Zuhörer, ab und zu ein paar neue Felgen für den Porsche, seine Spinner, Psychopathen und Epileptiker. Sein Geld verdient er mit der Demütigung einer Kollegenschaft, die es in Wahrheit nicht gäbe, nirgendwo gäbe. Professor Wirnsberger, sein geschätzter Vorgänger im AKH Wien, sei der Letzte gewesen, der ihm auf Augenhöhe begegnet sei. Seither habe er es nur noch mit Unterärzten zu tun, lästigen Kretins, die er täglich an der „kürzestmöglichen“ Leine durch die Neurologische führen müsse.
Er sei heilfroh gewesen, mich im Krankenhaus kennengelernt zu haben. Dass ich nie ein Auto besessen, meinen Führerschein zurückgegeben, von Autoverkehr in der Großstadt nie etwas gehalten hätte, sei ihm sofort sympathisch gewesen. Ich sei von Anfang an sein Lieblingsepileptiker, Lieblingsschauspieler gewesen. Ein Glücksfall, ein Trost, den er zu dieser Zeit besonders nötig gehabt habe. Es fasziniere ihn, dass es Menschen in meinem Alter gebe, die sich noch immer nicht über ihr Leben im Klaren seien. Er hat mich deshalb schon mit Reinhold Messner verglichen, der einfach lebe, bis er erfrieren, abstürzen, verhungern oder austrocknen würde.
Er habe mir bis heute nicht vergessen, dass ich ihm damals im Café den Autoschlüssel abgenommen und ihn bis vor seine Haustür gebracht habe. Erst vor kurzem hat er mir vorgeworfen, ihm das Chefarztleben gerettet, die „elendige Professorenexistenz“ vorsätzlich aufrechterhalten zu haben. „Ohne Rücksicht!, wie immer, Selbstsucht! Schriftsteller!, ein Witz!“ Heute sei er auf mich angewiesen, von mir abhängig. Er wisse überhaupt nicht, was er machen solle, wenn er, zumeist erst am späten Nachmittag, das Gelände der Klinik verlassen und in seine Fünfzimmerwohnung zurück flüchten müsse.
Die Baracke
Der Dozent ist fett und immer völlig verschwitzt unter dem karierten Flanellhemd, das nur dort keine Falten schlägt, wo der nasse Stoff eine Hügellandschaft formt, sanft und von beruhigender Schönheit. Wenn da nicht ein Kopf an höchster Stelle herausschauen und Bewegungsfreiheit einfordern würde, könnten wir uns nicht beschweren. Atemberaubende Idyllen entlarven sich mit jedem Finger, der zwischen Baumwipfeln auftaucht und sie verdächtig macht. Nichts ist brutaler als ein Etwas, das sich als Jemand herausstellt beim zweiten Hinschauen. Landschaften wollen kein Mitleid, strotzen vor Selbstvertrauen, während der Mensch in größter Not doch Schwäche zeigt, wenn er sich rühren will und nicht mehr weiterweiß, sein Atem flacher wird.
Jetzt stirbt er, denke ich oft, aber es passiert nicht. Das Platzen hängt wie ein drohendes Gewitter über dem Mann, dessen unförmiger Körper mich von Anfang an beeindruckt hat. Bei Sonnenaufgang wirft er einen immensen Schatten über uns und schräg auf die schlampig abgewischte Tafel mit den weißrosa Kreidestrichen, die an das Gelernte von gestern und mehr noch an das Vergessene von vorgestern erinnern. Grafiken und Textfetzen holen uns zurück auf den Boden einer trostlosen Realität, die sich Vernunft anmaßt, Sinn und Nutzen vorgaukelt.
Der Raum ist für sensible Menschen ungeeignet, nichts als eine lebensfeindliche Umgebung, vollgestellt mit unglaublich billigen Schulzimmermöbeln. Mein erstes Hereinkommen werde ich nie vergessen.
Er wolle mit Rechenschiebern aus dem Neolithikum ein breites Fundament zum Verständnis des Rechnens im Allgemeinen legen, wodurch sich der Siegeszug sowjetischer Mathematik im Speziellen von selbst erkläre. Mit dem erstmals auf der Leipziger Messe vorgestellten Omikron700, so der Dozent, sei die digitale Maschinisierung abgeschlossen gewesen. Mitte der Siebzigerjahre soll die Messestadt Leipzig das technologische Zentrum des demokratischen Deutschland gewesen sein. Danach seien die Amerikaner aufs Trittbrett gesprungen. Vorweggenommen habe man alles längst gehabt, vorhergesehen auch. Dass alles nicht gut gehen und der Nachwuchs verblöden würde, habe man damals schon erkannt, gleich alles weggestellt und sich auf den Wohnungsbau verlegt. Die Worte Silicon Valley und Hotspot hat er irgendwo aufgeschnappt, wahrscheinlich in einem dieser Klatschblätter, die nach den Revolutionswirren bei erstbester Gelegenheit für den neudeutschen Markt produziert wurden. Er könne von der „durch und durch faschistischen BRD“ keine Rente erwarten, was ihn nicht überraschen würde.
Die auf einem ehemaligen Parkplatz für DDR-Traktoren wie tot herumstehende Baracke kann man nicht beschreiben. Die Schulkinder zeigen mit filzstiftverschmierten Fingern auf uns, wenn wir um halb vier im Gleichschritt vom Geländesammelplatz auf das Gebäude zumarschieren und hinter fensterlosen Mauern verschwinden. Durch den Stacheldraht höre ich das schadenfrohe Lachen aus den frechen Schandmäulern, die noch vor dreißig Jahren brutal gestopft worden wären. Vergehen wird ihnen das, ganz schnell vergehen, das Lachen. Spätestens, wenn sie selbst hier einrücken müssen, irgendwann. Bevor sie die Milchzähne verlieren, werden sie von den Taschen der Eltern direkt auf die Steuerkasse hinübergeladen werden. In die Mühlen der Sozialämter werden sie kommen, zu Gericht sitzen wird man über sie.
Gerechtigkeit hat immer zwei Seiten, erfuhren wir gleich am ersten Tag. Arbeitsämter werden schon wissen, was sie tun, dachte ich damals, werden schon wissen, warum wir uns mitten in der Nacht am Geländesammelplatz einzufinden haben. Sie werden wissen, warum Pünktlichkeit das halbe Leben und jede Sekunde Verspätung mit einer Stunde Karzer zu vergelten ist. Warum wir nackt in eisigem Wasser stehend aus vibrierenden Lautsprechern nordkoreanische Kampflieder hören müssen, die alle paar Minuten von Durchsagen unterbrochen werden. Eine Dame mit nordkoreanischem Akzent, dachte ich, kann uns nicht oft genug daran erinnern, dass wir dem Arbeitsamt viel zu verdanken haben.
Meine Meinung habe ich schon geändert, seitdem ich erlebt habe, wie es ist, zwei oder drei Minuten zu spät zu kommen. Wir sind alle disziplinierter geworden über die Jahre. Wir unterschreiben Listen und Formulare, legen Geständnisse ab, bezichtigen irgendwen irgendwelcher Verbrechen und schauen aus dem Fenster. Vor Tagen gab es noch ein paar davon im Erdgeschoss. Wie die Zeit vergeht, denke ich immer, wenn wieder eines zugenagelt wird. Zuerst zugenagelt und dann zubetoniert. Es wird schon was dran sein am Wesen der Gerechtigkeit, genau wie beim Butterbrot, das auch zwei Seiten hat.
Die Augen des Dozenten haben etwas Treuherziges, was in seiner Tätigkeit als Major sicher nicht von Nachteil war. Man könnte ihn sich in der Geschäftsführung von UNICEF oder der Caritas vorstellen, wenn man nicht wüsste, dass er im Friedensdeutschland für die Zerreißung subversiver Familien verantwortlich war. Während die Väter in der Haftanstalt Hohenschönhausen bleiben durften, hat man die Mütter ins Frauenlager nach Rostock verbracht. Säuglinge wurden in der Regel in einer Kiste nach Zwickau geliefert, wo man ihnen die Stimmbänder herausgezogen und angezündet, die Ohren abgeschnitten und den Ratten vorgeworfen hat.
Der Geruch russischer Kasernenputzmittel hat dreißig Jahre überdauert in den Barackenböden. Ob man vier oder fünf Tage die Woche interniert ist, spielt keine Rolle. Die Türen sind nur von außen zu öffnen und an Flucht zu denken wäre Zeitverschwendung, die wir uns nicht leisten können. Das Leben des Einzelnen ist nichts wert. Freunde gibt es hier nicht. Wir sind Häftlingskollektiv und sonst nichts. Was aufgebaut werden soll, ist Misstrauen, wenn es nicht schon da ist. Nach kürzester Zeit bin ich Verbrecher, Kapo und schon längst von meinen Genossen zum Tod oder sonstwas verurteilt.
Vorgestern habe ich einen Kollegen in der Besenkammer gefunden. Wahrscheinlich hat er gestanden, irgendjemandem Sabotage angehängt. Kugelschreiber waren ihm unter die Haut geschoben, Büroklammern durch den Hodensack gestoßen und säuberlich wieder zusammengebogen worden. Die Kammer kann nicht der Tatort gewesen sein, es gab keine Blutspritzer, nur rötliche Schleifspuren, die abrupt endeten zur Tür hin. Sicher war er hineingeworfen worden. Sein Mund war aufgerissen, Kiefer und Nasenbein bestimmt gebrochen. Gewimmert hat er noch ganz leise, kaum hörbar geatmet, mit bläulichen Fingern die Besenhaare zärtlich gestreichelt, das letzte Mal wahrscheinlich.
„Liegenlassen!“ Ich konnte mir bis dahin nicht vorstellen, wie schmerzhaft eine Stimme sein kann. Die Frau mit dem zerknitterten Gesicht ist in Lichtenberg Chefsekretärin und mit dem Kopieren der Verhörprotokolle betraut gewesen. Das Stammhaus der Staatssicherheit in der Normannenstraße sei ihr Lebensmittelpunkt, die Belegschaft ihre Familie gewesen. Jeder habe jeden gekannt, die Weihnachtsfeiern seien bis heute unvergesslich. Man sei abends ungern nach Hause gegangen, habe die Atmosphäre nicht missen mögen. Die Verhörzimmer aus Plastik und Trockenbauplatten seien mit Asbestschaum schalldicht gefüttert gewesen, um in Ruhe dreschen und ohrfeigen zu können. Gelacht worden sei gern und oft. Spitzelwitze seien besonders gefragt gewesen damals, weil sie alle paar Wochen ausgegangen seien. Man habe dort seit den Siebzigerjahren Geständnisse für die Ewigkeit archiviert, die Bosheit mit Rollenspielen eingeübt. Der Bau ist heute ein Museum und jeder Besuch unvergesslich.
Gestern ist mir zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass die Baracke nicht der Ort zum Sterben sein kann. Es war nicht nur ein Vorkommnis, ein Geschehen. Ich habe mich auf einmal als handelnde Person, überhaupt als Person gefühlt nach so langer Zeit. Ich weiß nicht, ob es Jahre oder Jahrzehnte waren.
Ich habe mich in den Türstock zur Dozentenkammer gestellt mit dem Besen in der Hand. Eigentlich wollte ich nur die Sekretärin erschlagen und wieder gehen. Sie hatte mir in die Ohren geschrien kurz vorher. Es muss heraus geblutet haben auf den Kragen und die Ärmel. Sie hat es mehr als verdient, dachte ich.
„Da drüben“, habe ich gesagt, mit aller Kraft auf den Turm gezeigt. „Im Suff Traktoren angeschossen damals!“ „Dann sind Sie nach Hause und haben Westfernsehen geschaut! Rudi Carrell, Am laufenden Band, gelacht wahrscheinlich und geklatscht!“
Sofort hat mich der Mut verlassen, als ich Rudi Carell ins Spiel gebracht hatte. Ich wusste, dass er mich irgendwann das Leben kosten würde, der Mut. Jeder Moment hätte der letzte sein können in der Baracke. Ich habe mich schnell umgedreht und bin zur Besenkammer zurück. Wenn ich nicht zum Hofkehren dran gewesen wäre, hätte ich den Kollegen nicht gefunden, mich nicht in Gefahr bringen müssen. Ich hätte den Schädel nur ein paar Zentimeter wegschieben, hinüberkippen, den Besen nehmen und gehen müssen. Jetzt war es zu spät, ich habe sie gedemütigt, sie fertiggemacht, alle zusammen. Sie werden mich umbringen, noch heute, habe ich gedacht. Sie werden mich in die Kammer hineinziehen, mich an den Haaren reißen und zusammentreten. Ich wollte in den Hof mit der Schaufel, dem Besen, dem großen Kübel. Ich war der Beste im Hofkehren, das Blut hat mir nichts ausgemacht, weil es trocken war. Beliebt wollte ich mich auch immer machen aus Angst. Not macht beliebt bei Dozenten, die an allem gescheitert sind damals. Am Aufhängen, dem Strick und Rudi Carell. Die Traktoren haben sie auch nicht totgekriegt, die Schweine. Säuglinge gerade noch, verschickt irgendwohin, kraft des Amtes natürlich. An der Kammer hätte ich noch vorbeikommen und dann rennen müssen, als mich der Dozent am Kragen gepackt und hineingezogen hat.
Sie haben die Tür zugemacht, mich an den Haaren gerissen und zusammengetreten. Die Zerknitterte hat mir noch schnell ins Ohr geschrien, während der Kollege über den Gang gezogen wurde. Er ist noch am selben Abend gestorben.
Beim nächsten Freigang werde ich zur Polizei gehen und mich stellen, werde alles gestehen, was mir einfällt. Fritz wird mich abholen, pflegen und füttern. Ich denke an das „Niemals vergessen!“ des Bürgermeisters, an das „Zeichen setzen“, den „mutigen Vorstoß“, das „Engagement und die Initiative“ seinerseits, bevor er in der Limousine