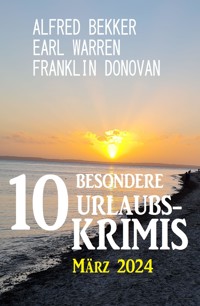Commissaire Marquanteur
und die Bestie von Marseille: Frankreich Krimi
von Alfred Bekker
Der Auftragskiller Metais kann aus Polizeigewahrsam
entfliehen. Doch die Polizisten sind nicht echt, sein Auftraggeber
will ihn ausschalten. Aber es gelingt Metais zu entkommen, und nun
beginnt er einen blutigen Rachefeldzug. Er ist zu schlau, um der
Sonderabteilung FoPoCri noch einmal ins Netz zu gehen, und er
schießt, sobald er glaubt, in Gefahr zu sein. Commissaire
Marquanteur und seine Kollegen aus Marseille müssen ihr ganzes
Können aufbieten, um es mit Metais aufzunehmen.
Man nennt ihn nicht umsonst ‘die Bestie’.
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen,
Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb
er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry
Cotton, Cotton Reloaded, Kommissar X, John Sinclair und Jessica
Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick,
Jack Raymond, Jonas Herlin, Dave Branford, Chris Heller, Henry
Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Ron Metais starrte grimmig vor sich hin. Die drei Polizisten,
die ihn bewachten, waren bis an die Zähne bewaffnet. Das war selbst
für einen Mann etwas viel, den man Die Bestie nannte und der wegen
fünfundzwanzigfachen Auftragsmordes seinem Prozess
entgegensah.
Metais saß angekettet im hinteren Bereich des
Gefangenentransporters. Die Hände waren mit Handschellen gefesselt,
an den Fußgelenken trug er ebenfalls Ketten. Zwei Uniformierte
saßen auf der Bank ihm gegenüber, einer neben ihm. Er sollte in die
Gefängnisanstalt Les Baumettes verlegt werden.
»War doch ganz nett im kleinen Vorortknast von Auriol«, sagte
Metais. »Ich weiß gar nicht, wieso ich nicht dort auf meinen
Prozess warten kann.«
Der Transporter fuhr eine scharfe Rechtskurve. Die Straße war
übersät mit Schlaglöchern. Die Stoßdämpfer des Transporters wurden
auf eine harte Probe gestellt. Der Wagen fuhr an Industrieruinen
vorbei, die sich in dieser Gegend meilenweit erstreckten.
Verfallene Schlote, baufällige Fabrikhallen und ein wilder
Autofriedhof. Metais spürte das Rumpeln und Stoßen, mit dem der
Gefangenentransporter über die Schlaglöcher fuhr.
Das war nicht der Weg nach Marseille!
Wo brachten diese Kerle ihn hin?
Sein Instinkt für Gefahr meldete sich. Er atmete tief durch
…
Der Transporter erreichte den Autofriedhof. Hunderte von
Fahrzeugen rosteten hier vor sich hin. Die Besitzer hatten sie
einfach abgestellt. Alles, was noch irgendwie brauchbar an ihnen
gewesen war, war ausgeschlachtet und der Rest sich selbst
überlassen worden.
»Fahr irgendwo hin, wo man uns von der Straße aus nicht sieht,
Bert!«, sagte der Mann auf dem Beifahrersitz zum Fahrer.
Der lachte heiser. »Hier fährt sowieso niemand her, der bei
Trost ist!«
»Trotzdem. Ich will, dass die Sache ordentlich zu Ende
gebracht wird!«
Metais, der im Gefangenenraum des Transporters saß, begriff,
dass hier eine verdammte Sauerei ablief.
Der Kerl, der ihm direkt gegenübersaß, hatte eine MPi in den
Händen und verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. Sein
Sitznachbar tat dasselbe, nur etwas zeitverzögert. Ein Goldzahn
blitzte dabei auf.
»Was ist hier los?«, zischte Metais.
Das Gesicht des Killers war kreideweiß geworden.
»Wart‘s doch einfach ab!«, antwortete der MP-Mann.
Der Wagen kam mit einem Ruck zum Stehen.
Metais zog mit Daumen und Zeigefinger der Rechten heimlich ein
nagellanges Drahtstück hinter seiner Armbanduhr hervor. Es war
nicht das erste Mal, dass er mit so einem Hilfsmittel ein paar
Handschellen öffnete.
»Ihr seid keine Polizisten, was?«, sagte er. »Wer schickt
euch? Irgendjemand von denen, die Angst haben, dass ich ihre Namen
im Prozess erwähnen könnte?«
»Erraten, Bestie!«, grinste der Mann mit der MP.
Der Kerl mit dem Goldzahn stieß die Hecktüren des Transporters
auf, und Metais konnte die Autowracks sehen.
»Wer hat euch geschickt?«, wiederholte er seine Frage.
»Denk nach! Vielleicht kommst du in den letzten Sekunden, die
dir bleiben, noch selbst drauf.«
Die Mündung der Heckler & Koch-MP zeigte jetzt direkt auf
Metais' Kopf, während sich gleichzeitig der dritte Polizist an
seinen Fußfesseln zu schaffen machte und sie ihm abnahm.
»Los, raus jetzt mit ihm!«, befahl der Mann mit dem Goldzahn.
Metais stand auf, drehte sich zur offenen Hecktür um. Er
erhielt einen brutalen Stoß in den Rücken und stolperte aus dem
Wagen, fiel hart zu Boden.
Zwei weitere Männer in Uniform, der Fahrer und der Beifahrer
des Transporters, traten auf ihn zu, packten ihn an den Oberarmen,
zerrten ihn wieder auf die Beine. Seine Wächter sprangen aus dem
Gefangenenraum ins Freie.
»Am besten packen wir ihn in eines dieser Autowracks«, meinte
der Goldzahn. »Da findet ihn in hundert Jahren niemand.«
»Bringen wir‘s hinter uns!«, sagte der Kerl mit der MPi.
Sie bildeten nun einen Halbkreis um Metais, den sie
losgelassen hatten und der ein paar Schritte zurückgestolpert
war.
Ohne dass die falschen Polizisten es bemerkten, stocherte er
mit dem Drahtstück im Schloss einer der Handschellen herum.
»Nimm‘s nicht persönlich, Bestie! Du kennst das doch. Es ist
nur ein Job. Mehr nicht. Außerdem würdest du wohl sowieso im
Gefängnis verrotten, bei dem, was du auf dem Kerbholz hast. Für
einige Leute macht es aber einen kleinen Unterschied, ob du vorher
noch in aller Öffentlichkeit das Maul aufreißen kannst oder
nicht.«
Metais hatte es inzwischen geschafft, die Hände zu befreien,
und nun …
Plötzlich stürmte er vor, ließ sich nach vorn fallen, rollte
über den Rücken ab und schnellte wieder hoch. Ein fassungsloser
Ausdruck gefror im Gesicht des falschen Polizisten, als Metais ihn
mit einem mörderischen Handkantenschlag am Hals traf. Der
Uniformierte verdrehte die Augen und schwankte. Metais zog ihn zu
sich heran, benutzte ihn als Deckung und riss dabei die SIG Sauer P
226 aus dem Holster – die Standardwaffe aller Marseiller
Polizeieinheiten.
Metais ließ sich zusammen mit dem Toten seitwärts fallen,
während die MP losratterte. Mehrere Dutzend Geschosse knatterten
dicht über ihn hinweg und perforierten die Seitenfront eines halb
verrosteten Lieferwagens.
Auf dem Boden riss er die Waffe in seiner Faust empor und gab
einen einzigen Schuss ab, traf den Kerl mit der MP mitten in die
Stirn.
Metais wirbelte herum, drehte den Lauf der SIG ein paar Grad
und feuerte noch einmal. Er erwischte den Kerl mit dem Goldzahn am
Oberkörper, und ein ächzender Laut kam über die Lippen des
Getroffenen, während er zusammenklappte wie ein rostiges
Taschenmesser.
Metais warf sich zur Seite, während links und rechts von ihm
Projektile in den staubigen Boden schlugen. Er hechtete hinter
einen Ford, der irgendwann einmal blau lackiert gewesen war.
Noch zwei Gegner waren übrig, und er hatte noch vierzehn
Patronen im Magazin, eine im Lauf. Im Gegensatz zu den falschen
Polizisten besaß er keine Reservemunition und konnte sich daher
nicht auf langwierige Schießereien einlassen.
Aber als Profi-Killer der Sonderklasse war er es gewöhnt,
präzise zu arbeiten. Mit einem Minimum an Aufwand.
Er nahm die SIG mit beiden Händen und tauchte vorsichtig
hinter dem Schrottwagen hervor. Ein Hagel von Geschossen empfing
ihn. Metais zuckte wieder zurück.
Hinter einem Renault hatte er eine huschende Bewegung
registriert. Einer der falschen Polizisten hatte offenbar einen
Bogen geschlagen, um Metais von der anderen Seite zu
erwischen.
Der Uniformierte feuerte seine Pistole zweimal kurz
hintereinander ab. Metais aber hatte sich zur Seite geworfen. Die
Geschosse schlugen Löcher, so groß wie eine Daumenkuppe, in das
rostige Blech des Wagens hinter ihm.
Metais riss seine Waffe hoch und feuerte. Der erste Schuss
traf den falschen Polizei im Oberschenkel, der zweite durchschlug
seinen Hals.
Im nächsten Moment hörte Metais, wie der Motor des
Gefangenentransporters gestartet wurde. Mit durchdrehenden Reifen
brauste der Wagen davon.
Metais schnellte hoch, versuchte mit einem Schuss die Reifen
zu erwischen und ließ dann die Waffe sinken.
Feigling!, dachte er.
2
Mein Name ist Pierre Marquanteur. Ich bin Commissaire und
arbeite in einer auf organisiertes Verbrechen spezialisierten
Sondereinheit mit der Bezeichnung Force spéciale de la police
criminelle, kurz FoPoCri.
Zusammen mit meinem Kollegen François Leroc hatte ich mich im
Büro von Monsieur Jean-Claude Marteau, Commissaire général de
police zur Besprechung eingefunden.
Um ein Haar hätte ich mich an Melanies vorzüglichem Kaffee
verschluckt, als ich an diesem Morgen in Monsieur Marteaus Büro saß
und an einer eiligst einberufenen Besprechung teilnahm.
Was Monsieur Marteau, der Chef unserer Abteilung, uns
Ermittlern mitzuteilen hatte, verschlug uns allen die
Sprache.
Ron Metais – in der Boulevardpresse und in der Unterwelt auch
als Die Bestie bekannt – war aus der Vollzugsanstalt Lübeck
entkommen.
Erst vor gut drei Monaten war dieser Mann, bei dem es sich um
einen der gefährlichsten Lohnkiller in der Geschichte des
organisierten Verbrechens handelte, ins Netz der FoPoCri gegangen.
Commissaire François Leroc und ich hatten daran nur mittelbaren
Anteil. Unser Kollege Commissaire Fred Lacroix hatte bei der
Verhaftung die Einsatzleitung gehabt. Ein Tipp aus Gangster-Kreisen
hatte dafür gesorgt, dass Metais in Auriol im Gefängnis gelandet
war. Eine ganze Abteilung der Staatsanwaltschaft arbeitete
inzwischen an der Anklageschrift.
Ich tauschte einen kurzen Blick mit François. Er war ebenso
erstaunt wie ich. Als ich ihn vor einer halben Stunde an unserer
bekannten Ecke abgeholt hatte, war von Metais' Ausbruch noch nichts
in den Radionachrichten gewesen. Aber vielleicht wurden die
Informationen auch aus fahndungstaktischen Gründen noch
zurückgehalten. Länger als ein paar Stunden würde das aber aller
Erfahrung nach nicht klappen. Irgendwo gab es immer eine undichte
Stelle.
Außer François und mir waren noch ein halbes Dutzend weiterer
Ermittler im Raum, darunter auch Fred Lacroix.
»Wie konnte das nur passieren?«, fragte Fred. »Ich dachte, ein
Ausbruch aus der Anstalt in Auriol sei so gut wie unmöglich!«
Monsieur Marteau zuckte die Schultern. Sein Gesicht wirkte
sehr ernst.
»Wie man sieht, geht es doch«, sagte er. »Allerdings wohl
nicht ohne fremde Hilfe. Ein Computer-Dossier liegt noch nicht vor,
aber die Einzelheiten sehen zusammengefasst so aus: Ein Kommando
von angeblichen Beamten der Polizei wird im Gefängnis in Auriol
vorstellig, um Metais nach Les Baumettes zu verlegen. Sie legen die
richtigen Papiere vor, es kommt die telefonische Bestätigung aus
Marseille und von der hiesigen Justiz …«
»Das heißt, die konnten völlig unbehelligt mit ihm
davonfahren«, stieß unser Kollege Boubou Ndonga hervor.
Monsieur Marteau nickte.
»Das ist leider der Fall. Dieser Coup ist perfekt eingefädelt
worden. Die Täter müssen über Verbindungen verfügen, die es ihnen
erlaubt haben, die fingierten Nachrichten abzusenden.
Möglicherweise hatten sie Unterstützung von Hackern, um sich in die
entsprechenden Datensysteme einzuloggen. Und der Zeitpunkt war auch
geschickt gewählt.«
»Inwiefern?«, hakte François Leroc nach.
»Weil es seit einigen Wochen ein juristisches Hin und Her um
eine mögliche Verlegung gab, über das auch die Medien hinreichend
berichtet haben. Es dürfte so ziemlich jeder davon erfahren haben.
So schöpfte auch bei den Verantwortlichen niemand Verdacht, als es
dann tatsächlich zu einer Verlegung des Gefangenen kam.«
»Jetzt werden einige Gangster-Größen bestimmt erleichtert
aufatmen«, war Stéphane Caron überzeugt. Er stellte den
Kaffeebecher auf den Tisch und beugte sich etwas vor. »Als Erstes
würde mir da zum Beispiel der Belloque-Clan einfallen …«
»Das sind nicht die einzigen, die froh sind, dass Metais jetzt
wohl kaum noch einen Deal mit dem Staatsanwalt schließen und
auspacken wird«, erklärte der Chef. »Es gibt da wirklich genug
Adressen für Sie alle, und ich kann Ihnen die mühsame Aufgabe
leider nicht ersparen, sie der Reihe nach abzuklappern.«
Ich sah, dass François die Augen verdrehte. Das war genau die
Art von Sisyphus-Arbeit, nach der wir uns alle sehnten.
»Die Chancen stehen schlecht, Metais wieder einzufangen«, war
Fred Lacroix überzeugt. »So viel Glück wie beim letzten Mal werden
wir kaum noch einmal haben.«
Monsieur Marteau sah Fred an.
»Dieser anonyme Informant, der Ihnen vor drei Monaten den
entscheidenden Tipp gegeben hat …«
»… ist leider immer noch so anonym wie ein Schweizer
Nummernkonto«, sagte Fred. »Aber möglicherweise bekommt der Kerl
jetzt kalte Füße. Schließlich könnte ja Metais wissen, wer für
seine Verhaftung verantwortlich ist.«
»Dann wird er sich an dem Verräter rächen wollen«, sagte
ich.
»Eben.«
In diesem Moment meldete Melanie, die Sekretärin unseres
Chefs, über die Gegensprechanlage: »Chef, die Mitarbeiter der
Staatsanwaltschaft warten hier.«
»Gut, Melanie. Sie möchten hereinkommen!« Monsieur Marteau
wandte sich wieder uns zu. »Die Staatsanwaltschaft wird Sie jetzt
gleich auf den letzten Stand ihrer Prozessvorbereitungen bringen.
Vielleicht ergeben sich daraus ein paar Anhaltspunkte, wo wir bei
der Fahndung nach Metais am sinnvollsten ansetzen können.«
Die Staatsanwaltschaft erschien in Gestalt eines grauhaarigen,
blassen Mannes mit kantigem Gesicht und einer jungen Frau im
adretten Kostüm und seriös wirkender Steckfrisur. Unter dem
biederen Kostüm zeichneten sich allerdings deutlich prächtige
Kurven ab, die geeignet waren, die männliche Hälfte jedes Gerichts
völlig aus dem Häuschen zu bringen.
Sie hieß Gina Lavalle und hatte durch ihre akribische
Arbeitsweise von sich reden gemacht. Der Grauhaarige war der
Staatsanwalt persönlich. Jonah Garteau würde bei den kommenden
Wahlen ganz sicher nicht wieder antreten, sondern sich in den
verdienten Ruhestand zurückziehen. Ziemlich offen favorisierte er
Gina Lavalle als seine Nachfolgerin. Der Ausbruch eines Verbrechers
wie Metais konnte die Stimmung natürlich gegen diese Pläne kippen
lassen, auch wenn keiner der beiden etwas dafür konnte.
Entsprechend nervös waren sie.
»Vor einem halben Jahr wurde Victor Mintscheff, der Boss der
Müll-Mafia, ermordet«, erinnerte uns Gina Lavalle. »Dank der Arbeit
Ihres Präsidium, Monsieur Marteau, hatten wir in dem Fall die
besten Aussichten, Metais die Tat nachzuweisen und ein Todesurteil
zu erwirken.«
»Und der mutmaßliche Auftraggeber war der Belloque-Clan«,
ergänzte Fred Lacroix.
Gina Lavalle nickte ihm zu.
»Die direkte Konkurrenz – Sie sagen es!«
Jonah Garteau ergriff das Wort: »Auf Initiative von Madame
Lavalle haben wir Ron Metais einen Deal vorgeschlagen. Die
besonders verschärften Haftbedingungen wären ihm erspart geblieben,
wenn er uns endlich etwas gegen Karim Belloque in die Hand gegeben
hätte. Der tanzt uns schon seit Jahren auf der Nase herum.
Irgendwann wird er es schaffen, sein illegal erworbenes Vermögen in
legale Geschäfte zu transferieren. Dann kommt niemand mehr an ihn
heran.«
»Wie war Metais’ Reaktion auf das Angebot?«, fragte ich.
Garteau zuckte die Achseln.
»Sein Anwalt bat für ihn um Bedenkzeit.«
»Wenn er dem Deal nicht sofort zustimmte, scheint ihm sein
Leben nicht besonders wichtig zu sein«, warf Boubou Ndonga
ein.
»Um ehrlich zu sein: Ich habe mich auch gewundert«, sagte
Jonah Garteau. »Jedenfalls wird Monsieur Belloque jetzt wieder
besser schlafen können, nehme ich an. Und er ist nicht der einzige,
für den das gilt. Wir haben Ihnen eine Namensliste mit Personen
zusammengestellt, die an einer Befreiung Metais' interessiert sein
müssten.«
Er reichte uns die Liste.
Wir würden uns diese Ganoven alle vornehmen müssen …
3
Zwei Stunden später fuhr ich meinen Sportwagen an den
Straßenrand. François und ich stiegen aus. Ich blickte in die
Richtung, aus der wir gekommen waren.
Karim Belloque kontrollierte das ganze Gebiet. Es gab keine
Kebabbude, keinen Friseurladen und keine Pizzeria, an der er nicht
wenigstens beteiligt war. Die meisten Läden befanden sich ganz in
seinem Besitz. Aber das war nur die Oberfläche von Belloques
Geschäften. Sein Geld machte er in anderen Bereichen. Vor allem mit
illegaler Giftmüllentsorgung. Das pfiffen mittlerweile die Spatzen
von den Dächern, auch wenn es noch kein Staatsanwalt geschafft
hatte, diese Pfiffe in eine wirksame Anklageschrift zu
übertragen.
Wir hatten die unangenehme Aufgabe, uns mit Belloque zu
unterhalten. Niemand hatte sich darum besonders gerissen. Belloque
pflegte kein Wort ohne Gegenwart kampflustiger Anwälte zu äußern,
und schon so mancher Polizist war aus einem Treffen mit ihm selbst
als Angeklagter wegen Hausfriedensbruch, Verleumdung oder anderer
Kleinigkeiten hervorgegangen. Haltlose Anschuldigungen, aber
Belloque ging nach der Devise vor, dass immer etwas hängen bleibt,
wenn man mit genug Dreck nach jemandem wirft.
Fred Lacroix und unser Kollege Sylvain Lemonesse von der
Fahndungsabteilung versuchten unterdessen doch noch etwas über den
geheimnisvollen Informanten herauszubekommen, der Metais ans Messer
geliefert hatte. Und die anderen Kollegen klapperten den Rest der
Namensliste ab, die die Staatsanwaltschaft uns gegeben hatte.
Selbstverständlich wurden auch alle sonstigen Fahndungsinstrumente
eingesetzt, zum Beispiel die Kontrolle von Flughäfen und
dergleichen. Aber es war kaum anzunehmen, dass Ron Metais so dumm
war, sich in diesem Netz für gewöhnliche Kriminelle zu verfangen.
Metais war eine Klasse für sich.
François und ich standen vor einem mindestens achtstöckigen
Komplex. Das war Belloques Residenz. Verglichen mit den anderen
hohen Gebäuden in Marseille war dieses Haus natürlich winzig. Als
Domizil eines einzelnen Mannes allerdings recht beachtlich.
Vor der Tür aus Panzerglas zeigten wir den finster
dreinblickenden Wächtern unsere Ausweise. Die Männer trugen dunkle
Anzüge. Die Jacketts wurden von ihren Waffen ausgebeult.
»Warten Sie!«, wies uns einer der Männer an und griff zum
Walkie-Talkie. Anschließend erklärte er uns, dass Monsieur Belloque
nicht die Absicht habe, mit uns zu sprechen.
»Wir können ihn auch offiziell vorführen lassen«, stellte
François klar. »Ich weiß nicht, ob es Ihrem Boss recht ist, wenn er
auf diese Weise in die Schlagzeilen kommt.«
Der Bodyguard grinste. In der oberen Zahnreihe glänzte ein
viel zu weißes Inlay.
»Du kannst jederzeit einen Termin mit Monsieur Belloques
Anwalt bekommen. Maximilien Salvére. Er hat sein Büro einen Block
weiter!«
»Richte deinem Boss aus, dass wir mit ihm jetzt und hier
sprechen wollen – und zwar über Ron Metais!«
»Hast du schlechte Ohren, Ermittler?«, zischte der Bodyguard
meinem Partner ins Gesicht. »Mein Boss ist an einem Gespräch nicht
interessiert!«
Ich trat einen Schritt an ihn heran.
»Dein Boss wird dir den Kopf abreißen, wenn du ihm die Worte
meines Partners nicht ausrichtest!«
Der Bodyguard war einen Augenblick lang verunsichert. Er
wechselte einen ratlosen Blick mit seinen Kollegen, dann griff er
noch mal zum Walkie-Talkie – und zwei Minuten später trug uns ein
Aufzug in den obersten Stock.
Wir wurden in einen Raum geführt, der mit kostbaren
orientalischen Teppichen so überladen war, dass man sich wie in
einem türkischen Bazar vorkam. Ein Springbrunnen plätscherte. Und
auf einer Couch räkelte sich eine Blondine, deren prächtige Kurven
das hautenge Kleid, das sie trug, zu sprengen drohten.
Der Bodyguard, der uns bis hierher begleitet hatte, postierte
sich an der Tür. Die junge Frau erhob sich, als sie uns sah.
»Mit wem habe ich das Vergnügen?«, hauchte sie.
»Pierre Marquanteur, FoPoCri«, stellte ich mich vor und
deutete dann auf François. »Dies ist mein Kollege François Leroc.
Wir hatten eigentlich erwartet, mit Monsieur Belloque sprechen zu
können.«
»Es tut mir unendlich leid, aber heute werden Sie mit mir
vorlieb nehmen müssen.« In ihren Augen blitzte es. Sie näherte sich
mit katzenhaften, geschmeidigen Bewegungen. »Ich bin Monsieur
Belloques Schwiegertochter Adeline, und er vertraut mir in allen
Dingen vollkommen.«
Wir hatten davon gehört, dass der große Karim Belloque einen
Sohn namens Tarik hatte, von dem er nicht sonderlich viel hielt.
Niemand traute Tarik zu, eines Tages die Familie führen zu können.
Er galt als Trinker und als spielsüchtig. Offenbar hatte das seiner
Anziehungskraft auf Frauen aber keinen Abbruch getan.
»Hören Sie«, sagte François, »wir sind nicht wegen irgendeiner
Lappalie hier, sondern …«
»Wegen Ron Metais!«, unterbrach Adeline ihn. Zwei Reihen
makelloser Zähne blitzten auf. »Er soll aus dem Gefängnis entkommen
sein.« Ihrem Gesichtsausdruck nach genoss sie François‘
Verblüffung.
»Ach, davon wissen Sie?«, fragte ich, ebenfalls
erstaunt.
»Nun, wie soll ich mich da ausdrücken?« Sie begann am Revers
meines Jacketts herumzunesteln und sah mich mit ihren himmelblauen
Augen an. »Wissen Sie, einige gute Freunde unserer Familie sitzen
dort ein. Und Neuigkeiten sprechen sich dort schnell herum. Dort –
wie auch hier.« Sie lachte. »Marseille ist in dieser Beziehung ein
Dorf, Monsieur Commissaire.«
»Es besteht der Verdacht, dass Ihr Schwiegervater etwas mit
Metais' Befreiung zu tun hat. Wo ist er jetzt?«
»Er ist nicht hier«, antwortete Adeline. »Mein Schwiegervater
leidet unter Asthma. Er ist für ein paar Tage ans Meer
gefahren.«
»Wohin?«
»Cassis.«
»Adresse?«
»Er besitzt dort eine Villa. Adresse und Telefonnummer
schreibe ich Ihnen auf.«
»Okay.«
Ich blickte ihr fest in die Augen und hatte plötzlich den
Eindruck, eine Spielerin vor mir zu haben. Sie spielte mit allem.
Mit der Wahrheit genauso wie mit mir. Ich nahm mir vor, Adeline
nicht zu unterschätzen.
François reichte ihr einen Notizblock, den er bei sich
trug.
»Außerdem brauchen wir den Namen Ihres Informanten in der
Vollzugsanstalt.«
»Es gibt keinen Informanten«, behauptete sie. »Nur Gerüchte,
die Bekannten von uns zu Ohren gekommen sind. Und dass diese
Gerüchte stimmen, beweist Ihr Auftauchen hier!« Ihr Augenaufschlag
war gekonnt. Sie atmete tief durch, wobei sich die straffen Brüste
noch deutlicher unter dem Stoff ihres Kleides hervorhoben. »Sie
wollen mir doch daraus keinen Strick drehen?«
»Den dreht sich jeder selbst«, erwiderte ich.
In diesem Moment meldete sich mein Handy. Es war Monsieur
Marteau, der mich anrief.
Auf einem wilden Schrottplatz waren vier Leichen in Uniformen
der Polizei gefunden worden. Es sprach viel dafür, dass es sich
dabei um jene Männer handelte, die Ron Metais befreit hatten.
4
»Ob es klug war, diese Polizisten zu empfangen?«
Der große, dunkelhaarige Mann nippte an seinem Glas. Er hatte
Ringe unter den Augen und sah aus, als hätte er mehrere Nächte
hintereinander durchgezecht.
Adeline verschränkte die Arme unter den Brüsten.
»Welche Wahl hatte ich denn?«, fauchte sie gereizt.
»Wir hätten es wissen müssen …«
»Was? Dass die FoPoCri zuerst hier auftaucht, wenn sich Metais
vom Acker macht?«
»Ja, das auch.«
Sie ging auf ihn zu, nahm ihm das Glas aus der Hand, leerte es
in einem Zug. Dann sah sie ihn mit funkelnden Augen an.
»Wir sitzen ganz schön in der Klemme, Tarik. Aber wenn wir
jetzt die Nerven behalten, dann …«
»Was dann?«, grinste Tarik Belloque und legte beide Hände auf
ihre geschwungene Hüfte.
»Lass das jetzt!«, zischte sie. »Wir können froh sein, wenn
wir aus dieser Sache mit heiler Haut herauskommen.«
Tariks Grinsen zog sich über das ganze Gesicht.
»Ich dachte, du liebst Spiele genauso wie ich!«
Ihr Blick wurde abschätzig.
»Im Gegensatz zu dir stehe ich mehr auf die Art von Spielen,
bei denen es auch eine reelle Gewinnchance gibt!«
Der Summton der hausinternen Sprechanlage unterbrach ihren
Disput. Adeline ging zum Apparat.
»Ja?«
»Ein Anruf für Sie, Madame Belloque«, sagte eine sonore
Männerstimme.
»Wer ist es?«
»Ein gewisser Ron Metais. Auf welchen Apparat soll ich
durchstellen?«
5
Der Ort des Gemetzels war ein wilder Schrottplatz inmitten
einer Industriebrache.
Unsere Kollegen Boubou Ndonga und Stéphane Caron waren schon
dort, als wir ankamen. Außerdem unser Arzt Doktor Neuville und
unsere Erkennungsdienstler Pascal Montpierre und Jean-Luc
Duprée.
Normalerweise ist an einem Tatort auch immer der
Erkennungsdienst anzutreffen, der zentrale Erkennungsdienst aller
Marseiller Polizeieinheiten. Daneben haben wir allerdings auch
unsere eigenen Spezialisten, die in Fällen wie diesem zum Einsatz
kommen. Les Crottes gehört ebenfalls zum Zuständigkeitsbereich des
FoPoCri-Präsidiums Marseille.
»Die vier starben durch Schussverletzungen«, berichtete Doktor
Neuville. »Sehr präzise Treffer. Der Täter muss ein erstklassiger
Schütze gewesen sein. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Du musst
schon auf meinen Bericht warten, Pierre.«
»Trotzdem danke«, sagte ich.
Ich beobachtete unseren Kollegen Jean-Luc Duprée dabei, wie er
die Gesichter der Toten fotografierte. Wir würden die Bilder durch
unsere Datenbanken jagen und diese auf Übereinstimmungen hin
abfragen. Es musste schon mit dem Teufel zugehen, wenn dabei nichts
zutage kam. Wer es schaffte, einen Gefangenen aus der
Vollzugsanstalt herauszubekommen, konnte kein blutiger Anfänger
sein.
Ich sprach mit Pascal Montpierre, der mich auf ein paar Spuren
hinwies. Auf dem Boden waren Abdrücke von Schuhsohlen zu sehen und
der Abdruck einer Hand. Es war die linke Hand.
»Hier hat jemand Deckung gesucht«, stellte Montpierre
fest.
»Ich frage mich, weshalb Metais seine Befreier umgebracht
hat«, murmelte ich.
»Vielleicht haben die ihn nur befreit, um ihn endgültig zum
Schweigen zu bringen«, überlegte François.
Ich nickte düster.
Wieder ein Punkt, der in Richtung jener Leute wies, die eine
Heidenangst davor haben mussten, dass Ron Metais den Mund
aufmachte. Jemand hatte ihm vor Prozessbeginn das Lebenslicht
ausblasen wollen. Aber da hatte sich dieser jemand gründlich
verrechnet!
6
»Hier hast du dich also verkrochen, Bert«, zischte eine
unangenehm hohe Fistelstimme.
Bert hatte sich gerade über einen der Billard-Tische in
Jeannots Taverne gebeugt, als der hagere Mann mit dem knochigen
Totengesicht auftauchte.
Bert schluckte.
Einen Augenblick lang überlegte er, die Automatik unter dem
weiten Hemd hervorzureißen, das er über der Hose trug.
»Tu nichts Unüberlegtes!«, zischte das Totengesicht. Er trat
näher. Seine rechte Faust steckte in der linken Jacketttasche. Der
Lauf eines Revolvers drückte sich durch den Stoff.
»Was willst du von mir, Ibrahim?«, fragte Bert. Er warf einen
Blick zur Tür.
Der überbreite Kleiderschrank, der sich dort mit verschränkten
Armen aufgebaut hatte, musste zu dem Bleichgesichtigen gehören. Und
ein schmächtiger Mittvierziger, der nun an die Bar trat und den
Kellner verscheuchte, gehörte offenbar auch dazu.
Verdammt, dachte Bert, ich stecke in der Falle!
In Berts Kopf rasten die Gedanken.
So wie er Ibrahim und seine Meute kannte, hatte auch am
Hinterausgang noch einer seiner Männer Posten bezogen.
»Hör mal, Ibrahim, wir können uns bestimmt irgendwie einigen«,
sagte Bert.
Er wollte Zeit gewinnen.
Der Bleichgesichtige strich sich mit einer fahrigen Geste der
linken Hand über das dunkle, nach hinten gekämmte Haar. Ibrahims
Augen waren wässrig-blau. Und sie fixierten Bert auf unangenehme
Weise.
»Red keinen Stuss, Bert! Du weißt, was ich jetzt tun muss.
Fällt mir nicht leicht, aber …«
Die letzten Gäste von Jeannots Taverne verließen den
Schankraum. Der Muskelmann, der sich an der Tür postiert hatte,
winkte sie durch.
Ibrahim trat nahe an Bert heran.
»Erzähl mir, was mit Metais ist!«
»Keine Ahnung.«
»Was soll das heißen, keine Ahnung?«
»Die Sache ist schief gegangen!«
»Was du nicht sagst!«
»Ich bin mit knapper Not entkommen. Der Mann ist ein
Teufel!«
Ibrahim schüttelte den Kopf.
»Dein Pech, Bert! Die anderen haben‘s ja wohl schon hinter
sich.«
»Wovon sprichst du?«
»Von der großen Überfahrt«, höhnte der Schmächtige an der
Theke.
»Ihr wollt mich wirklich … umlegen? Das … das ist doch nicht
euer Ernst!«
Ibrahim zuckte die Achseln.
»Du weißt einfach zu viel. Und außerdem – wie sieht das aus?
Du hast einen Auftrag erhalten, ihn verpatzt und es nicht mal für
nötig befunden, uns davon in Kenntnis zu setzen, geschweige denn
dein Geld zurückzugeben.«
»Das wollte ich ja!«
Blitzschnell hatte Ibrahim die Waffe herausgerissen. Es war
eine Automatik, Kaliber 45. Der Lauf war auf Berts Oberkörper
gerichtet.
»Du begleitest uns jetzt auf einer Spazierfahrt«, zischte
er.
Bert taumelte zurück, griff unter sein Hemd. Ein Akt der
Verzweiflung. Er riss seine Pistole hervor, eine Beretta. Aber er
war nicht schnell genug. Ibrahim drückte ab, traf Bert in die
Schulter. Die Wucht des Treffers ließ Bert nach hinten taumeln. Er
versuchte sich an einem der Billard-Tische festzuhalten.
Der zweite Schuss traf Bert in die Brust. Aufstöhnend ließ er
die Beretta fallen, rutschte zu Boden und blieb reglos
liegen.
»Los, weg hier!«, knurrte der breitschultrige Kleiderschrank
an der Tür.
7
Zusammen mit unseren Innendienstfahndern Maxime Valois und
Sylvain Lemonesse versuchten François und ich die Identität der
Toten vom Schrottplatz herauszukriegen.
Die vermeintlichen Polizisten hatten außer einem Handy nichts
bei sich gehabt, was ihre Identität hätte verraten können. Der
Führerschein, den der Fahrer in der Tasche gehabt hatte, war eine
plumpe Fälschung. Die Kerle waren auf Nummer sicher gegangen.
Die Handy-Lizenz lautete auf den Namen Lorant Oreche, geboren
am 14. April 1969. Wir stellten fest, dass Oreche schon seit fünf
Jahren auf dem Friedhof lag. Unser Mann hatte die Identität eines
Toten verwendet.
Seinen wahren Namen bekamen wir dann über den Abgleich der
Bilddateien heraus.
Der Kerl mit dem Handy hatte Vincent Duquesne geheißen und war
einschlägig vorbestraft gewesen. Es gab mehrere Verurteilungen
wegen Körperverletzung und außerdem einen Freispruch aus Mangel an
Beweisen in einem Mordprozess.
Die anderen waren von ähnlichem Kaliber.
Tom Valois, Claude-Eric Dechamps und Patrick Ramin waren immer
wieder mit der Justiz in Konflikt geraten. Valois war sogar noch
auf Bewährung draußen gewesen. Und Dechamps hatte Verbindung zu
Ibrahim Toureque gehabt, der als Mann fürs Grobe im Belloque-Clan
galt. Dechamps hatte als Rausschmeißer in Toureques Nachtclub
FIEVRE DE LA NUIT gearbeitet.
»Toureque ist eine Nuss, die schwer zu knacken sein wird«,
meinte Sylvain Lemonesse. »Der hat sich bislang immer schön im
Hintergrund gehalten, damit er nicht in die Schusslinie gerät. Er
stand zwar in zwei Mordfällen vor Gericht, allerdings nur als
Mittäter, und beide Male reichten die Indizien nicht für eine
Verurteilung.«
»Wenn man die Anwälte der Belloque-Familie an seiner Seite
hat, lässt sich wohl so manche Anklage überstehen«, kommentierte
François.
Sylvain Lemonesse blickte auf die Uhr.
»Toureques Nachtclub müsste bald öffnen. Ihr könntet dem Kerl
ja mal ein bisschen auf den Zahn fühlen.«
Ich nickte.
»Bringt wahrscheinlich mehr, als dieser aalglatten
Schwiegertochter des großen Karim Belloque noch einmal
zuzusetzen.«
»Fragt sich, wer da wem zusetzen würde«, stichelte
François.
Ich sah ihn an.
»Was soll das denn heißen, Alter?«
»Nur, dass ich deine Konzentrationsschwierigkeiten in
Gegenwart dieser Spitzen-Lady sehr wohl bemerkt habe.«
»Du vergisst, dass ich seit einiger Zeit in festen Händen bin,
mein lieber François.« Ich wandte mich an Sylvain. »Ich möchte
wissen, worum es in dem Mordprozess ging, in den dieser Vincent
Duquesne verwickelt war.«
»Kein Problem«, meinte Sylvain, und seine Finger klapperten in
rasendem Tempo über die Computertastatur.
Der Mordfall, in dem Duquesne angeklagt gewesen war, lag schon
ein paar Jahre zurück. Eine junge Börsenmaklerin namens Rosa
Pelletier war in ihrem Apartment umgebracht worden. Den Akten nach
ein Raubmord. Mitangeklagter war damals ein gewisser Robert Bert
Rainard gewesen.
Beiden hatte die Tat letztlich nicht nachgewiesen werden
können, obwohl es eine Reihe belastender Indizien gegeben hatte.
»Hat dieser Bert Rainard vielleicht auch irgendeine Verbindung
zu Toureque oder den Belloques?«, fragte ich.
Er durchforstete das Datenmaterial. Und da war tatsächlich
eine Verbindung: Ein Anwaltsbüro, das normalerweise für Toureque
tätig war, hatte damals Rainards Verteidigung übernommen.
»Ich brauche die gegenwärtige Adresse von diesem Bert«, sagte
ich.
François hob die Augenbrauen.
»Hast du eine Eingebung, oder habe ich da irgendetwas nicht
mitgekriegt?«
»Robert Bert Rainard könnte der fünfte Mann sein,
François.«
»Der Überlebende.«
»Ja.«
Eine Viertelstunde später machten wir uns auf den Weg zu Berts
letzter Adresse.
Ich saß am Steuer meines Sportwagens, und François hatte auf
dem Beifahrersitz Platz genommen. Es dauerte nur wenige
Straßenzüge, und wir steckten mitten in der dicksten Rushhour. Die
Fahrt dorthin wurde zu einer halben Weltreise.
»Metais ist eine Mordmaschine«, sagte François irgendwann in
mein Fluchen hinein. »Ein Mann, der ohne Bedenken jeden Mordauftrag
ausführt.« Er machte eine Pause und atmete tief durch. »Was würdest
du an seiner Stelle tun, Pierre?«
Ich zuckte die Achseln.
»So weit wie möglich flüchten!«
»Er sitzt in der Falle und kann das Land nicht
verlassen.«
»Wieso nicht?«
»Weil die Leute, die ihm dabei helfen müssten, versucht haben,
ihn umzubringen.«
»Dann wird er sich an andere wenden.«
»Wenn wirklich die Belloques hinter der Sache stecken, dann
dürfte es kaum einen anderen geben, der es wagen würde, ihm zu
helfen.«
Die Fahrt zog sich hin. Inzwischen erreichte uns ein Anruf aus
dem Hauptquartier. Monsieur Marteau war am Apparat. Die Kollegen in
Cassis hatten Karim Belloque in seiner Villa aufsuchen wollen.
Vergeblich! In die Villa war eingebrochen worden, und das offenbar
schon vor einiger Zeit, wie die Ergebnisse der Spurensicherung
ergaben. Dass keiner der Nachbarn davon etwas bemerkt hatte, war
nicht verwunderlich, da das Anwesen auf einem recht weiträumigen
Gelände lag. Aber ich erfuhr, dass es eine Alarmanlage gab, von der
die Täter offenbar sehr genau gewusst hatten, wie man sie außer
Betrieb setzen konnte. Und Belloques Bodyguards, die normalerweise
den Besitz ihres Bosses kompromisslos schützten, waren offenbar
nicht anwesend gewesen, als der Einbruch geschah. Das alles war
schon sehr verwunderlich.
»Wir werden der schönen Adeline noch ein paar unangenehme
Fragen stellen müssen«, stellte François fest.
Aber zuerst stand dieser Bert auf unserer Liste. Mein Instinkt
sagte mir, dass wir uns beeilen mussten, wenn wir Bert noch in die
Finger bekommen wollten. Wenn er der fünfte Mann war, dann musste
er seinen Auftraggebern erklären, wieso er und seine Komplizen
versagt hatten. Gut möglich, dass eben diese Auftraggeber Bert nun
als gefährlichen Mitwisser ansahen und auszuschalten versuchten.
Möglicherweise war Bert daher inzwischen untergetaucht.
Wir fuhren von der Schnellstraße ab, bogen dann in eine kleine
Straße in einem Wohngebiet ein, um schließlich unser Ziel zu
erreichen.
Das Mietshaus, in dem Bert wohnte, war ziemlich
renovierungsbedürftig. Graffiti-Sprayer hatten sich an der
Hausfront ausgetobt. Schön oder nur halbwegs gelungen war das
Geschmiere nicht.
Berts Wohnung lag im dritten Stock.
»Immerhin ist sein Namensschild noch an der Tür«, kommentierte
François, als wir vor der Wohnung standen.
»Das muss nichts heißen«, erwiderte ich.
Ich klopfte.
»Monsieur Rainard?«, rief ich.
Keine Antwort.
»Scheint, als wollte Bert nicht mit uns reden«, raunte
François.
Ich versuchte es noch einmal.
»Monsieur Robert Rainard! Hier ist die FoPoCri! Machen Sie die
Tür auf!«
Ein Geräusch war von der anderen Seite der Tür zu hören.
François und ich griffen in derselben Sekunde zu den Dienstwaffen,
traten zur Seite.
Ein wummernder, ohrenbetäubender Laut ertönte. Projektile
nagelten durch die Tür, rissen faustgroße Löcher in das Holz. Dann
begann eine MP zu knattern. Ein Cluster von deutlich kleineren
Löchern entstand.
François und ich befanden uns rechts und links der Tür. Wir
duckten uns weg, um nicht von Querschlägern getroffen zu
werden.
Die Kugeln sprengten auf der gegenüberliegenden Seite des
Flurs den Putz von der Wand, kleinere Brocken schossen regelrecht
durch die Luft.
Wir warteten das Ende des wütenden Bleihagels ab.
Es mussten zwei Gegner sein.
Mindestens.
Auf jeden Fall war aus zwei verschiedenen Waffen geschossen
worden, mit unterschiedlichem Kaliber. Sie mussten verdammt nervös
sein. Anders war diese Kurzschlussreaktion nicht erklärbar.
Der Geschosshagel brach endlich ab. Aus der Wohnung drang das
Geräusch von Schritten. Etwas wurde umgestoßen, schlug scheppernd
auf den Boden.
»Gib mir Feuerschutz!«, rief ich François zu.
Ein Tritt, und das, was von der Tür übrig geblieben war,
sprang zur Seite. Ein Scharnier brach dabei heraus. Ich ging in die
Hocke, die SIG im Beidhandanschlag, den Körper so ausgerichtet,
dass er möglichst wenig Zielfläche bot.
»Waffen weg! FoPoCri!«, schrie ich.
Niemand zu sehen.
Mein Blick taxierte die Wohnung.
Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Eine Couch war
umgestoßen worden, die Kissen aufgeschlitzt.
Ein Mann tauchte plötzlich hinter der umgestoßenen Couch
hervor, schnellte hin zur Tür auf der linken Seite. Dabei richtete
er den Lauf seiner MPi in meine Richtung. Die Waffe knatterte
los.
Ich feuerte ebenfalls, warf mich seitwärts, rollte herum und
schoss wieder.
Aber mein Gegenüber war bereits durch die Tür in den
Nachbarraum verschwunden, hatte die Tür hinter sich
zugeworfen.
Ich wollte darauf zulaufen, doch mein Gegner musste das geahnt
haben. Er feuerte eine MPi-Salve durch die Tür. Ich rettete mich
mit einem langen Satz neben den Türrahmen, presste mich an die
Wand.
Als das Feuer endete, tauchte ich hervor, trat die Tür auf,
feuerte die SIG dreimal kurz hintereinander ab, stürzte dann in den
Nachbarraum.
Das Fenster stand offen. Mein Gegner war bereits draußen auf
der Feuerleiter. Er trug eine Baseballkappe und eine Sonnenbrille.
Und er ließ die MPi erneut losknattern.
Ich warf mich zur Seite, rollte auf dem Boden ab, und die
Projektile verfehlten mich um Haaresbreite.
Ich feuerte zurück, fehlte aber. Gerade noch sah ich, wie mein
Gegner sich über die Brüstung schwang. Dann war er
verschwunden.
Ich schnellte hoch, stürzte mit der SIG in der Faust hinaus
aus dem Fenster und blickte hinab.
Der Kerl mit der Baseballkappe war nirgends zu sehen.
Marseiller Feuertreppen führten auf dieser Seite des Hauses
die Fassade hinunter in einen Innenhof. Es gab nur eine schmale
Ausfahrt zur Straße, ansonsten war der Hof von allen vier Seiten
durch Häuserfronten begrenzt.
Genau unter mir befanden sich überquellende Müllcontainer,
daneben ein großer Haufen von Pappkartons unterschiedlicher Größe
mit der Werbeaufschrift einer großen Supermarktkette.
»Alles klar, Pierre?«, hörte ich François. Er erreichte das
offene Fenster.
»Mit mir ja«, antwortete ich, »aber unser Mann hat sich in
Luft aufgelöst!«
Ich starrte auf den Kartonhaufen.
Der Mann mit der Baseballmütze war vielleicht einfach
hinuntergesprungen. Stuntmen benutzten solche Kartonhaufen, wenn
sie zu einem Freiflug über mehrere Stockwerke ansetzten.
Ich sah mich um. Und ich machte eine Entdeckung.
Auf dem Absatz der Feuerleiter, auf dem ich stand, lag ein
messingfarbenes Feuerzeug. Ich hob es auf. Die Initialen L.S. waren
eingraviert, außerdem ein Totenkopf. Sah aus wie eine
Sonderanfertigung. Vielleicht hatte der Kerl mit der Baseballkappe
es verloren. Ich steckte es in eine Plastiktüte, die ich bei mir
trug.
François forderte unterdessen Verstärkung an; sowohl unsere
Leute als auch Kollegen der Polizei, die sich in der Nähe befanden
und schnell am Tatort sein konnten.
Ich stieg inzwischen die Außentreppe hinunter. Ein
durchdringendes, schepperndes Geräusch entstand dabei.
Aus einem der gegenüberliegenden Fenster blickte jemand hinaus
und stierte mich an.
Verdammter Narr!, dachte ich. Wenn der Kerl mit der
Baseballkappe noch irgendwo in der Nähe lauerte, konnte es für
diesen Zuschauer gefährlich werden.
Schließlich stand ich im Innenhof, blickte mich um. Die SIG
hielt ich schussbereit in der Rechten, den Lauf leicht nach oben
gerichtet.
Mein Instinkt meldete sich. Ich konnte die Gefahr geradezu
körperlich spüren. Der Kerl war hier und beobachtete mich.
Ich umrundete die Container und den Kartonhaufen. Auf der
anderen Seite des Innenhofs waren einige Pkws abgestellt. Auch dort
sich konnte unser Mann verkrochen haben. Aber waren es nicht
eigentlich zwei gewesen? Hatte Baseballkappe den Rückzug seines
Komplizen gedeckt?
In der Ferne hörte man die Sirenen der sich nähernden
Fahrzeuge der Polizei.
Und dann sah ich aus den Augenwinkeln heraus eine Bewegung.
Ein Karton hob sich, ganz leicht nur. Einen Sekundenbruchteil
später zuckte darunter etwas grell hervor.
Das Mündungsfeuer einer MP.
Ich warf mich zur Seite, hechtete hinter einen der Container.
Die Kugeln der MP-Salve nagelten auf dem Metall. Querschläger
jaulten schrille Arien.
Ich wartete, bis der Geschosshagel endete.
Der Kerl musste in heller Panik sein. Er war in die Kartons
gesprungen, hatte sich in den Haufen regelrecht hineingegraben.
Vielleicht war er auch verletzt.
»Hier spricht Commissaire Marquanteur, FoPoCri!«, rief ich zu
ihm hinüber. »Sie haben keine Chance! Kommen Sie mit erhobenen
Händen aus Ihrem Versteck! Sie sind verhaftet!«
Das einzige, was unser Gegenüber tun konnte, war, uns mit
seiner MP eine Weile in Atem zu halten. Aber davonkommen würde er
nicht.
François konnte von oben den Hof überblicken. Sobald sich der
Kerl zeigte, befand er sich im Schussfeld meines Kollegen. Aber wo
sein Komplize geblieben war, das mochte der Teufel wissen.
Ich hörte ein Stöhnen.
»Nicht schießen!«, krächzte eine heisere Stimme.
»Die Waffe zu uns herüber!«, befahl François.
Er gehorchte, arbeitete sich unter den Kartons hervor und
schleuderte die MP im hohen Bogen davon.
Ich tauchte hinter dem Container hervor, François kam die
Feuertreppe hinunter.
Der Kerl mit der Baseballkappe sah bleich wie die Wand aus. Er
steckte immer noch bis zur Brust in den Kartons.
»Kommen Sie raus!«, befahl ich.
»Ich kann nicht!«, rief er. »Ich bin verletzt. Mein Fuß! Ich
glaub, da ist was gebrochen!«
»Wenn das ein Trick sein soll, dann wird er dir wenig nutzen,
Freundchen!«, rief François.
Ein Teil seiner Worte ging im Sirenengeheul der Einsatzwagen
unter, die durch die enge Einfahrt zum Innenhof schossen. Zwei
Fahrzeuge der Polizei. Die Türen öffneten sich, die Polizisten
sprangen heraus und brachten ihre Waffen in Anschlag.
François arbeitete sich durch die Kartons hindurch auf den
Gangster zu, der inzwischen die Hände gehoben hatte.
Die Männer der Polizei bildeten einen Halbkreis.
In diesem Moment bellte ein Schuss auf.
Ein Schrei folgte.
Ein Ruck ging durch den Mann mit der Baseballkappe.
Die Kugel hatte ihn in den Kopf getroffen. Blut rann unter dem
Mützenschirm hervor, und er sank in sich zusammen!
8
Ich wirbelte herum, riss den Lauf der SIG in jene Richtung,
aus der der Schuss gekommen sein musste.
Den Rost eines Kellerfensterschachts hatte jemand zur Seite
geschoben. Zuvor war mir das nicht aufgefallen.
»Lasst das Haus umstellen!«, rief ich den Polizisten zu und
spurtete dann los, die SIG in der Faust.
Schlagartig wurde mir alles klar.
Der zweite Mann!
Er hatte dort unten im Schacht gekauert und abgewartet, was
geschehen würde. Sein Komplize war nicht so schnell gewesen wie
er.
Der Mann im Schacht hatte unbedingt verhindern müssen, dass
sein Partner lebend in unsere Hände fiel und dann womöglich
ausplauderte, was er wusste. Darum hatte der Kerl mit der
Baseballkappe sterben müssen.
Ich erreichte den Kellerschacht. Das Kellerfenster war
eingeschlagen. Ich stieg durch das Fenster, sprang und federte in
die Knie. Ich befand mich in einem Heizungskeller. Die Tür stand
einen Spalt offen, und vom Flur her drang Neonlicht herein.
Innerhalb einer Sekunde war ich dort, riss die Tür vollends auf und
stürzte in den Flur. Kahle Betonwände, an denen die Leitungen offen
verlegt worden waren. In regelmäßigen Abständen hingen Neonröhren
an der Decke. Eine davon war nicht mehr in Ordnung, sie
flackerte.
Zur Linken befand sich eine feuerfeste Stahltür. Zu meiner
Rechten ging der Flur etwa zehn Meter weiter, bevor eine Biegung
kam.
Einer der Polizisten war mir gefolgt. Er hielt die Dienstwaffe
in der Faust.
Ich machte ihm ein Zeichen. Er verstand und ging auf die
Stahltür zu, dann drückte er die Klinke nach unten.
Abgeschlossen.
Der Killer musste in die andere Richtung geflüchtet
sein.
Ich hoffte, dass die Kollegen der Polizei inzwischen den Block
abgeriegelt hatten, so dass der feige Mörder nicht abhauen
konnte.
Ich pirschte mich hin zu der Stelle, wo der Kellerflur eine
Biegung machte. Der Polizist war wieder hinter mir, um mir
Feuerschutz zu geben.
Ich machte ihm erneut ein Zeichen. Er nickte. Dann stürzte ich
vor, duckte mich dabei und riss den Lauf meiner SIG hoch.
Der Polizei folgte.
Ein Schuss, und eine Kugel jagte dicht an meinem Kopf
vorbei.
Ich hörte einen Aufschrei hinter mir. Der Kollege war von der
Kugel getroffen worden.
Mein Zeigefinger krallte sich um den Abzug der SIG, aber ich
konnte unmöglich abdrücken.
Vor mir stand ein Mann Mitte fünfzig in grauem Kittel, die
Augen vor Angst weit aufgerissen. Angstschweiß perlte auf seiner
hohen Stirn. Er musste so eine Art Hausmeister sein. Ein Arm lag um
seine Kehle. Der Kerl, der den Mann im Hausmeisterkittel wie einen
lebenden Schild vor sich hielt, war gut anderthalb Köpfe größer als
sein Opfer. Seine Rechte hielt einen 45er Magnum. Der Lauf zielte
auf mich.
Der Mistkerl bleckte die Zähne. Sein blondes Haar war kurz wie
englischer Rasen.
»Bleib ja stehen, du Ratte!«, zischte er. »Und rühr dich
nicht!«
Mir blieb nichts anderes übrig. Schießen konnte ich nicht,
denn die Gefahr, die Geisel zu treffen, war zu groß.
»Sie kommen hier nicht raus«, knurrte ich, um ihn zum Aufgeben
zu bewegen.
Ich wandte den Kopf, sah den Polizisten reglos am Boden
liegen, und kalte Wut stieg in mir auf.
Aber ich konnte nichts tun.
»Die Waffe auf den Boden!«, befahl der Blonde. Er setzte den
Lauf des Magnum-Revolvers an den Kopf seiner Geisel, verzog das
Gesicht dabei zu einem zynischen Grinsen. »Mach schon, Bulle, oder
willst du für den Tod dieses Mannes verantwortlich sein?«
Ich beugte mich langsam nieder, um meine SIG vorsichtig auf
den Boden zu legen.
»Gut so!«, knurrte mein Gegner. »Und nun kick das Eisen zu mir
rüber!«
Ich gehorchte, gab der SIG einen Stoß mit der Fußspitze, so
dass sie über den Betonboden rutschte.
Der Blonde drückte seine Geisel brutal gegen die Wand. Den
Lauf des Magnum-Revolvers presste er dem Mann in den Rücken. Dann
beugte er sich nieder und hob meine SIG auf, steckte sie in den
Hosenbund, lachte heiser.
Einen Augenblick lang erwog ich, mich auf ihn zu stürzen. Aber
das Risiko für die Geisel war einfach zu groß.
Der Blonde zerrte den Hausmeister wieder von der Wand weg,
legte erneut den linken Arm um ihn und hielt ihn wie einen
Schutzschild vor sich. Er grinste mich an, und eine geradezu
sadistische Freude glitzerte in seinen Augen, als er sagte: »Au
revoir, Commissaire!«
Mit provozierender Langsamkeit hob er den Magnum-Revolver, bis
ich direkt in die Mündung blicken konnte, in das hässliche
kreisrunde Loch, aus dem mir gleich der Tod entgegen jagen
würde.
Und dann – wummerte die Waffe los!
9
Adeline Belloque lag nackt auf dem großen Wasserbett.
Spärliches Licht herrschte in der Penthouse-Wohnung in dem
Hochhaus. Leuchtreklamen auf der gegenüberliegenden Straßenseite
warfen ihren Schein durch die Jalousien und erzeugten mal rote, mal
blaue, dann wieder gelbe Streifenmuster auf Adelines ungemein
attraktiven Körper. Sie sah aus wie der Star einer Peepshow.
Adeline war noch immer leicht außer Atem von dem wilden
Liebesspiel mit Michel Galingré. Der schlanke Mann saß in Shorts
und T-Shirt am anderen Ende des Ein-Zimmer-Apartments auf einem
Bürostuhl. Das bläuliche Licht eines Computerschirms strahlte sein
Gesicht an.
Galingrés Augen blickten starr auf den Monitor. Er war hoch
konzentriert.
Adeline lächelte. So war Galingré nun einmal. Aber da es im
Wesentlichen nur guter Sex und ein paar wenige gemeinsame
Interessen waren, die sie beide miteinander verbanden, ärgerte sie
sich nicht darüber.
Galingré war Börsenmakler. Seine Wohnung lag am Stadtrand. Ein
eigenes Auto besaß er nicht, weil er keines brauchte. Adeline war
sich nicht einmal sicher, ob Galingré überhaupt eine Fahrerlaubnis
hatte.
Der Aktienhandel lief rund um die Uhr, unabhängig davon, ob
die Börse in Marseille, in London oder Tokio gerade geöffnet hatte.
Deshalb war Galingré ständig online. Er wollte keine wichtige
Entwicklung verpassen.
Adeline erhob sich von dem Bett, streckte sich und ging mit
katzenhaften Bewegungen zu Galingré hin. Neben seinem Bürostuhl
blieb sie stehen, doch im Moment hatte Galingré keinen Blick übrig
für die aufregenden Rundungen ihres unverhüllten Körpers.
»Ich hoffe doch nicht, dass du in der letzten Stunde
irgendetwas Weltbewegendes verpasst hast«, sagte sie
spöttisch.
Er wandte den Kopf, ließ seinen Blick über ihre festen runden
Brüste gleiten, über ihren flachen Bauch und weiter hinab.
»Manchmal muss man eben etwas riskieren«, fand er.
»Wem sagst du das«, schnurrte sie und strich ihm durch das
dichte schwarzbraune Haar. Ihre Brüste stießen dabei gegen seine
Schulter.
Er blickte zu ihr auf.
»Vermisst dich dein Mann nicht, wenn du so lange bei mir
bleibst?«
»Tarik?« Adeline lachte. Es war ein freudloses Lachen, hart
und kalt. »Tarik verzockt wahrscheinlich gerade in irgendeinem
Nachtclub unser Geld.«
Galingré bleckte die Zähne.
»Kann dir doch egal sein – jetzt, da euch der alte Big Boss
Karim Belloque die Cents nicht mehr einzeln zuteilt.«
Sie verzog das Gesicht.
»Immer auf dem Teppich bleiben, Baby – das ist meine Devise
…«
»Ach, wirklich?« Galingré schlug ihr mit der flachen Hand auf
den Po. »Dann hättest du nie versucht, diesen Wahnsinnsplan in die
Tat umzusetzen.«
Adeline zuckte die Achseln. Sie strich Galingré über die
Schultern, ging dann mit federnden Schritten auf das Fenster zu,
schaute durch die Lamellen. Die gegenüberliegende Kirche wirkte
klein und unbedeutend zwischen den gewaltigen Komplexen, die man
hier errichtet hat.
»Eigentlich sind wir alle Zocker«, meinte Galingré, der sich
wieder dem Bildschirm zuwandte und dann hektisch mit der Maus
herumzuklicken begann. »Du genauso wie dein schlafmütziger
Ehegatte.«
»Und was ist mit dir?«, fragte Adeline.
»Ja, ich auch«, sagte Galingré. »Und ich bin in dieser
Hinsicht fast genauso süchtig wie dein Mann. Aber da ist ein
Unterschied. Ich machte nur bei solchen Spielen mit, bei denen sich
das Risiko lohnt.«
»Michel …«, begann Adeline. Sie wartete, bis er sie
ansah.
»Was ist?«
»Wir können uns für ‘ne Weile nicht sehen. Kein
Telefonkontakt, gar nichts.«
»Völlige Funkstille?«, fragte Galingré überrascht.
Sie nickte. »Ja.«
»Was soll das?«
Sie verschränkte die Arme unter ihren blanken Brüsten.
»Die FoPoCri war bei mir. Ein Commissaire namens Marquanteur
und sein Kollege haben mir ziemlich zugesetzt.«
»Weswegen?«
»Wegen der Sache mit Metais. Weswegen wohl sonst?«
»Du hast gesagt, man könnte sich auf Toureque und seine Leute
verlassen!«
»Kann man auch, Michel.«
»Dann sollen sie das in Ordnung bringen!«
»Sie tun, was sie können. Metais hat sich gemeldet. Er will
Geld von mir. Immerhin wird er sein Wissen nicht an die FoPoCri
weitergeben, solange er glaubt, mich damit in der Hand zu haben und
erpressen zu können.«
»Du denkst nicht daran zu zahlen, richtig?«
»Jedenfalls nicht auf Dauer. Metais könnte sich als Fass ohne
Boden entpuppen. Aber was dich betrifft …«
Galingré stand jetzt auf, trat auf sie zu. Das Börsengeschehen
in Tokio interessierte ihn plötzlich nicht mehr.
»Es führt doch keine Spur zu mir, oder?«
»Ich denke nicht. Du solltest aber trotzdem vorsichtig sein.
Wer weiß, was dieser Teufel rausgekriegt hat. Ich traue Ron Metais
mittlerweile alles zu.«
»Du hättest ihn niemals engagieren dürfen.«
Adeline lachte kurz auf.
»Hinterher ist man immer schlauer.«
»Verdammt, es hätte dir doch klar sein müssen, dass der Mann
nicht so leicht zu kontrollieren ist wie die Grobiane, die dein
Schwiegervater anzustellen pflegte, um seine Organisation
zusammenzuhalten!«
Adeline atmete tief durch.
»Ich brauchte einen Killer der Spitzenklasse. Das weißt du
genau. Und jetzt nachzukarten hat sowieso keinen Zweck.«
Galingré sagte darauf nichts. Er besah sich ihren aufregenden
Körper, seine Blicke tasteten ihre Kurven ab.
»Der Sex mit dir wird mir fehlen«, sagte er schließlich.
Adeline deutete auf den flimmernden Computerschirm.
»Red keinen Unsinn, Michel! Du hast genug Beschäftigung. Deine
Börsengeschäfte erregen dich fast noch mehr als Sex.«
Sie ging durch den Raum und sammelte ihre Klamotten auf.
»Warum schickst du Tarik, diesen Trottel, nicht einfach in die
Wüste, Adeline?«, fragte Galingré plötzlich.
»Ich brauche ihn noch«, erklärte sie.
»Und was ist mit Big Boss Karim Belloque? Wie lange gedenkst
du den Schwindel noch aufrecht zu erhalten?«
»So lange es irgend geht, Michel.«
Galingrés Augen wurden schmal, während er ihr beim Anziehen
zusah.
»Überspann den Bogen nicht, Adeline!«
»Um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen«, versicherte
sie.
10
Es war mir klar gewesen, dass der Blonde versuchen würde, mich
abzuknallen. Aber dadurch, dass er den Revolver so langsam hob, gab
er mir die Chance, mein Leben zu retten – auch wenn es nur eine
sehr geringe Chance war.
Neben mir, zu meiner Rechten, befand sich eine weitere
Kellertür, und ich hatte mich so hingestellt, dass ich mich nur
dagegen werfen und die Klinke hinunterdrücken musste, um aus der
Schusslinie zu kommen. Vorausgesetzt, die Tür war nicht
abgeschlossen. Dann wäre ich geliefert. Dann wäre alles aus.
Er hob den Revolver, zielte direkt auf meinen Kopf und …
Kurz bevor er den Abzug ganz durchgezogen hatte, warf ich mich
nach rechts gegen die Tür, schlug mit der Hand auf die
Klinke.
Der Revolver in seiner Faust wummerte, die Tür sprang auf, und
ich flog in den Raum dahinter, während die Kugel an mir vorbei
senkte. Ich rollte mich über die Schulter ab, fand mich in einer
Art Abstellraum wieder. Hohe Metallregale standen hier, und überall
lag Plunder herum.
Ich hechtete hinter eines der Regale.
Dann wartete ich mit angespannten Nerven, dass der Killer kam,
um mich fertig zu machen. Ich musste versuchen, ihn zu
überwältigen. Auch ohne Waffe. Das war meine einzige Chance.
Aber er kam nicht. Er wollte sich nicht weiter mit mir
abgeben. Er wollte so schnell wie möglich raus aus diesem Haus, das
für ihn zur Rattenfalle werden konnte.
Er zerrte seine Geisel mit sich, entfernte sich mit ihr, wie
ich an den schleifenden Schritten hören konnte.
Ich hörte auch eine Eisentür zuschlagen.
Ich trat wieder hinaus auf den Kellergang. Der feige Mörder
war mit seiner Geisel verschwunden.
Neben dem am Boden liegenden Polizisten ging ich in die Knie,
drehte ihn auf den Rücken und sah den hässlichen Blutfleck, der
sich auf seinem Uniformhemd ausbreitete. Die Kugel hatte ihn in die
linke Brust getroffen. Es gab nichts mehr, was ich für ihn tun
konnte. Er war tot.
Wut keimte in mir auf.
Ich nahm seine Dienstwaffe. Am Ende des Ganges befand sich
eine feuersichere Eisentür. Ich schlich darauf zu, packte das
Schießeisen mit beiden Händen.
Schritte hinter mir.
Ich wirbelte herum, hob die Waffe zum Schuss und …
Es war François, mein Freund und Partner.
Beide ließen wir die Waffen sinken.
»Unser Mann ist blond, mindestens ein Meter neunzig groß, sehr
kräftig, und er hat eine Geisel«, sagte ich.
»Und er hat einen Kollegen getötet«, sagte François düster,
wandte dabei den Kopf hin zu dem toten Polizisten.
»Ja«, sagte ich nur.
François sah mich wieder an und informierte mich: »Das Haus
ist umstellt. Er kann hier unmöglich rauskommen.«
»Das wird ihm klar sein«, meinte ich. »Aber denk daran, dass
er jetzt eine Geisel hat!«
Wir postierten uns links und rechts der Eisentür. Vorsichtig
öffnete ich sie. Mit der SIG in der Rechten peilte ich den Raum,
blieb halb hinter der Tür, denn ich erwartete, dass mir im nächsten
Moment heißes Blei um die Ohren flog.
Doch nichts geschah. Trotzdem blieb ich vorsichtig.
Ich sah eine Treppe, die nach oben führte, und neben ihr, in
der Wand rechts davon, befand sich wieder eine Eisentür.
Dann hörte ich ein Quietschen, und im nächsten Moment öffnete
sich die Tür.
»Nicht – nicht schießen!«, erklang eine dünne, zittrige
Stimme.
Ich erkannte den Mann, der mit erhobenen Händen durch die Tür
wankte. Es handelte sich um den Hausmeister, den der Killer als
Geisel genommen hatte.
»Wo ist er?«, rief ich.
Der Mann starrte mit leeren Augen durch mich hindurch. Er
hatte einen Schock.
Wir liefen an ihm vorbei durch die Tür, aus der er gekommen
war, und fanden uns in einer Waschküche wieder.
Im Boden befand sich ein Abflussschacht, dessen Abdeckung
beiseite gestemmt worden war. Der Schacht führte tief hinab.
Dort jemanden aufzuspüren war so gut wie unmöglich.
François und ich stiegen trotzdem hinab, gelangten in einen
Kanal, der sich mehrfach verzweigte.
Es war aussichtslos.
Neben jeden Gullydeckel in Marseille City einen Polizei zu
postieren, damit dieser darauf aufpasste, ob der gesuchte Killer
wieder der Tiefe entstieg, das war schlicht und ergreifend
unmöglich. Wir mussten uns auf die Kanalzugänge im näheren Umkreis
beschränken.
François und ich stiegen wieder nach oben und forderten die
Kollegen vom Erkennungsdienst an. Sie sollten Robert Bert Rainards
Wohnung unter die Lupe nehmen. Die beiden Kerle, die François und
ich überrascht hatten, waren nicht ohne Grund dort eingedrungen.
Entweder waren sie hinter Bert selbst her gewesen, oder sie hatten
etwas in seiner Wohnung zu finden gehofft. Der Zustand, in dem sich
das Apartment befand, sprach für die zweite Möglichkeit.
Zwei Kollegen nahmen den Hausmeister mit zu unserer
Dienststelle. Ein Psychologe würde sich um ihn kümmern müssen,
bevor wir brauchbare Aussagen von ihm erhalten konnten.
François und ich kehrten ebenfalls ins Präsidium zurück. Nach
unseren Angaben erstellte Perouche ein Phantombild des blonden
Hünen. Die Fahndung musste schnell eingeleitet werden. Boubou
Ndonga und Stéphane Caron vertraten uns unterdessen am
Tatort.
Von Sylvain Lemonesse erfuhren wir später, dass die Leiche von
Bert Rainard in einer düsteren Gasse aufgefunden worden war. Man
hatte ihn wie Abfall in einen Müllcontainer geworfen.
Verdammt – es sah ganz danach aus, als hätte jemand einen
lästigen Zeugen aus dem Weg geschafft.
11
Die Dämmerung legte sich bereits über Marseille, und François
und ich saßen immer noch in unserem Büro.
Doch endlich stellten sich ein paar handfeste Ergebnisse
ein.
Der Komplize des Hünen, den dieser eiskalt und ohne Skrupel
erschossen hatte, war anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert
worden. Er hieß Harry Sterne und hatte schon wegen Totschlages
gesessen. Er hatte einen Gast im Nachtclub FIEVRE DE LA NUIT derart
zusammengeschlagen, dass dieser den Folgen der brutalen
Misshandlung erlegen war. Und das FIÈVRE DE LA NUIT war der Laden
von Ibrahim Toureque, dem Handlanger der Belloques.
So schloss sich der Kreis.
Auch die Identität des blonden Hünen hatten wir ermitteln
können, indem wir sein Phantombild durch unsere Dateien gejagt und
elektronisch abgeglichen hatten. Sein Name war Etienne Hervé, und
unsere Computerbildschirme zeigten uns sein beachtliches
Vorstrafenregister.
François blickte auf die Uhr.
»Das FIEVRE DE LA NUIT dürfte bald öffnen, Pierre. Ich schlage
vor, wir schauen uns dort einfach mal um.«
Ich nickte.
»Ja, das sollten wir tun. Und wir werden auch ein Foto von
Etienne Hervé mitnehmen und es herumzeigen. Auch wenn ich nicht
glaube, dass man uns Auskunft geben wird.«
»Wir werden sehen.«
Das Telefon auf meinem Schreibtisch schlug an. Ich nahm den
Hörer ab, und als ich ihn wieder aufgelegt hatte, informierte ich
François: »Unser Nachtclubbesuch muss noch warten. Der Chef will
uns sprechen.«
Ein paar Minuten später saßen wir in Monsieur Marteaus Büro.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie noch zu mir gerufen habe,
Pierre und François«, sagte er. »Ich weiß, wie spät es ist.«
Ich erwiderte, dass wir ohnehin noch nicht vorgehabt hatten,
Feierabend zu machen, sondern Toureque in seinem Nachtclub einen
Besuch abstatten wollten.
Monsieur Marteau nickte.
»Tun Sie das, aber nehmen Sie besser noch ein paar Kollegen
mit.«
»Nichts dagegen, Chef«, sagte ich.
»Scheuchen Sie Toureque ein bisschen auf! Ich kämpfe gerade
darum, dass wir die Telefone einiger Belloque-Leute überwachen
können. Wenn wir Glück haben, erhalten wir das Okay des
Staatsanwalts noch heute Abend.«
»Hervorragend«, meinte François.
»Ich wollte Ihnen noch zwei Neuigkeiten mitteilen, die Sie
unbedingt wissen sollten«, fuhr Marteau fort. »Erstens: Karim
Belloque ist weiterhin nicht aufzufinden. Zweitens habe ich hier
einen Bericht über den Mord an einem vorbestraften Passfälscher,
der nach unseren Erkenntnissen auch schon für Leute der
Belloque-Familie tätig war. Das Besondere an diesem Mord ist das
Projektil, mit dem der Fälscher getötet wurde. Es stammt aus einer
SIG Sauer P 226 – aus genau der Waffe, mit der Ron Metais auf dem
Schrottplatz in Les Crottes seine Befreier erschoss.«
»Die Bestie hat also wieder zugeschlagen«, murrte
François.
»Sieht so aus, als wolle er sich absetzen«, meinte ich. »Er
hat den Mann erschossen, nachdem dieser für ihn einen Pass
gefälscht hat.«
»Ja, so wird es gewesen sein«, sagte Marteau. »Aber ich bin
sicher, Metais wird noch seine offenen Rechnungen hier in Marseille
begleichen wollen, bevor er die Stadt verlässt. Also müssen Sie
diesen Fall möglichst schnell lösen, Pierre und François, sonst
wird es weitere Tote geben.«
12
Der Blonde stieß die Tür zu Ibrahim Toureques Büro auf, dann
hielt er keuchend inne. Ein Bodyguard im dunklen Anzug war
herumgewirbelt und hatte seine Waffe aus dem Schulterhalfter
gerissen, richtete sie auf den Eindringling.
Der Blonde erstarrte zur Salzsäule.
»Monsieur Toureque, ich brauche Ihre Hilfe!«, brachte er noch
immer außer Atem hervor.
Schweiß perlte auf Etienne Hervés Stirn, und sein Gesicht war
so weiß wie die Wand. Seine Klamotten waren ramponiert, die Jacke
an der rechten Schulter angerissen, und das Hemd trug er über der
Hose. Seine Waffe steckte im Hosenbund, und der Griff drückte sich
durch den Stoff ab.
Der Bodyguard sah es sofort, schnellte vor und riss die Kanone
an sich.
»Merken Sie eigentlich gar nicht, wie ungelegen Sie kommen,
Hervé?« Ibrahim Toureques hagere Gestalt saß hinter einem protzigen
Schreibtisch. Er lehnte sich im Sessel zurück. Auf der
Schreibtischecke hockte ein junges, gutgebautes Girl im knappen
Kostüm, wie es die Bedienungen im FIEVRE DE LA NUIT trugen.
Toureques Nachtclub befand sich ein Stock tiefer.
Das Girl war vor Schreck wie erstarrt.
Toureque tätschelte mit einem überlegenen Lächeln ihren
Schenkel.
»Wir sprechen gleich über ein höheres Gehalt weiter und wie du
es dir verdienen kannst, Baby. Jetzt geh! Hier wird‘s jetzt
unangenehm!«
Sie sprang auf, huschte an Etienne Hervé und dem Bodyguard
vorbei. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss.
Toureque öffnete eine Schublade seines Schreibtischs. Eine
Pistole mit Schalldämpfer lag dort griffbereit, daneben eine Kiste
Havannas. Toureque griff nach den Havannas, warf eine davon Hervé
zu.
»Fang!«, rief er. »Und dann schalt besser einen Gang runter,
damit du wieder klar denken kannst, Hervé!«
Toureque machte dem Bodyguard ein Zeichen, der daraufhin seine
Pistole wegsteckte. Er bezog Posten neben der Tür.
»Komm, setz dich!«, sagte Toureque und deutete auf einen Stuhl
vor seinem Schreibtisch. Genüsslich steckte er sich die Havanna an,
und als Hervé Platz genommen hatte, blies er ihm den Rauch ins
Gesicht.
»Hören Sie, ich sitze in der Klemme!«
»Ich habe von deinem Missgeschick gehört. Traurig, aber
…«
»Sie müssen dafür sorgen, dass ich untertauchen kann!«
Toureque lachte eisig.
»Muss ich das? Etienne, war ich nicht immer gut zu dir? Habe
ich nicht immer die Hand über dich gehalten, wenn du zu dämlich
warst, dir dein Koks bei einem Dealer zu besorgen, der dich nicht
an die Polizisten verpfeift? Habe ich nicht immer jeden Anwalt
bezahlt, den du gebraucht hast?«
»Monsieur Toureque …«
»Nein, hör mir zu, Etienne!«, unterbrach Toureque den Blonden
hart. »Ich habe ein ziemlich hässliches Bild von dir in den
Lokalnachrichten im Fernsehen gesehen. Meiner Meinung nach hast du
keine Chance, Etienne.«
Hervé sah Toureque ernüchtert an.
»Sie lassen mich fallen?«
»Ich schütze mich selbst«, sagte Toureque kalt.
Hervé schnellte hoch.
»Ich werde auspacken, wenn die FoPoCri mich in die Finger
kriegt! Und dafür, dass das nicht passiert, müssen Sie sorgen,
Toureque!«
»Okay, okay!« Toureque hob beschwichtigend die Hände. Seine
eisgrauen Augen musterten den Blonden eingehend. Dann wandte er
kurz den Blick zu seinem Bodyguard. »Entspann dich, Tino!«,
schnarrte er. »Ich komm hier schon zurecht!«
»Wie Sie meinen, Boss«, murmelte der Angesprochene.
»Lass uns in Ruhe über alles reden!«, wandte Toureque sich
wieder Etienne Hervé zu. »Vielleicht kommen wir doch noch auf einen
Nenner.«
Seine Hand schnellte vor, griff nach dem Feuerzeug und hielt
es Hervé hin. Die Flamme blitzte hoch.
Hervé zögerte, dann hob er die Havanna an, die Toureque ihm
zugeworfen hatte, und hielt die Spitze an die Flamme.
»Vor der FoPoCri brauchst du keine Angst zu haben, Etienne«,
sagte Toureque. »Und Fehler machen wir alle.«
»Allerdings.«
»Was ist mit Harry?«
»Den habe ich erledigt, als die Polizei ihn schnappten. Der
singt nicht mehr.«
»Ich habe dich wohl doch falsch eingeschätzt, Etienne. Du bist
wirklich loyal.«
»Das sollten Sie nie vergessen, Monsieur Toureque – nie!«,
sagte der Blonde. Er lehnte sich zurück, zog an der Havanna, deren
Spitze rot aufglühte. »Ich brauche neue Papiere und … Geld!«
»Sicher.«
»Was … ist …« Der Blonde sprach schleppend, seine Augen
weiteten sich. Er stierte Toureque ungläubig an. Seine Muskeln
spannten sich, verkrampften sich regelrecht, dann kippte er vom
Stuhl und blieb reglos auf dem Boden liegen.
Toureque lächelte zynisch.
»Das wäre erledigt!«
Der Bodyguard trat herbei, nahm dem toten Hervé die brennende
Zigarre aus der Hand und zerdrückte sie im Aschenbecher. »Sie
sollten die präparierten Havannas deutlicher markieren, sonst
verwechseln Sie sie eines Tages mit denen, die Sie selbst nehmen,
Boss!«
In diesem Moment schrillte das Telefon auf Toureques
Schreibtisch. Toureque nahm ab.
Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau.