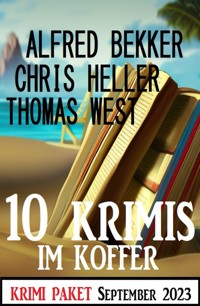
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Von Alfred Bekker, Chris Heller, Thomas West (999) Dieses Buch enthält folgende Krimis: Thomas West/Chris Heller: Kommissar Jörgensen und der nächtliche Albtraum Alfred Bekker: Tote Bullen Alfred Bekker: Wettlauf mit dem Killer Alfred Bekker: Killer ohne Skrupel Alfred Bekker: Doppeltes Mörderspiel Alfred Bekker: Verschwörung der Killer Alfred Bekker: Ein Sarg für den Prediger! Alfred Bekker: Satansjünger Thomas West: Milo muss sterben Alfred Bekker: Commissaire Marquanteur und die Schüsse auf Monsieur Marteau Ein Berliner Kriminalbeamter wird in der Nähe des Westhafens von Moabit umgebracht. Kommissar Harry Kubinke vom BKA und sein Team von Spezialisten übernehmen den Fall. Die Ermittler finden schnell heraus, dass der Ermordete in dunkle Geschäfte verwickelt war. Da stirbt ein weiterer Kommissar und die Spur des Killers führt in einen Club, der unter der Kontrolle krimineller Banden steht... Für Kubinke läuft die Zeit weg, denn auf der Todesliste des Mörders stehen offenbar noch weitere seiner Kollegen! Alfred Bekker schreibt Fantasy, Science Fiction, Krimis, historische Romane sowie Kinder- und Jugendbücher. Seine Bücher um DAS REICH DER ELBEN, die DRACHENERDE-SAGA,die GORIAN-Trilogie und seine Romane um die HALBLINGE VON ATHRANOR machten ihn einem großen Publikum bekannt. Er war Mitautor von Spannungsserien wie Jerry Cotton, Kommissar X und Ren Dhark.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1412
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Thomas West, Chris Heller
10 Krimis im Koffer September 2023: Krimi Paket
Inhaltsverzeichnis
10 Krimis im Koffer September 2023: Krimi Paket
Copyright
Kommissar Jörgensen und der nächtliche Albtraum: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Tote Bullen
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Wettlauf mit dem Killer
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Killer ohne Skrupel
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Alfred Bekker: Doppeltes Mörderspiel
Alfred Bekker: Verschwörung der Killer
Alfred Bekker: Ein Sarg für den Prediger
Alfred Bekker: Satansjünger
Milo muss sterben
Commissaire Marquanteur und die Schüsse auf Monsieur Marteau
10 Krimis im Koffer September 2023: Krimi Paket
Von Alfred Bekker, Chris Heller, Thomas West
Dieses Buch enthält folgende Krimis:
Thomas West/Chris Heller: Kommissar Jörgensen und der nächtliche Albtraum
Alfred Bekker: Tote Bullen
Alfred Bekker: Wettlauf mit dem Killer
Alfred Bekker: Killer ohne Skrupel
Alfred Bekker: Doppeltes Mörderspiel
Alfred Bekker: Verschwörung der Killer
Alfred Bekker: Ein Sarg für den Prediger!
Alfred Bekker: Satansjünger
Thomas West: Milo muss sterben
Alfred Bekker: Commissaire Marquanteur und die Schüsse auf Monsieur Marteau
Ein Berliner Kriminalbeamter wird in der Nähe des Westhafens von Moabit umgebracht. Kommissar Harry Kubinke vom BKA und sein Team von Spezialisten übernehmen den Fall. Die Ermittler finden schnell heraus, dass der Ermordete in dunkle Geschäfte verwickelt war. Da stirbt ein weiterer Kommissar und die Spur des Killers führt in einen Club, der unter der Kontrolle krimineller Banden steht... Für Kubinke läuft die Zeit weg, denn auf der Todesliste des Mörders stehen offenbar noch weitere seiner Kollegen!
Alfred Bekker schreibt Fantasy, Science Fiction, Krimis, historische Romane sowie Kinder- und Jugendbücher. Seine Bücher um DAS REICH DER ELBEN, die DRACHENERDE-SAGA,die GORIAN-Trilogie und seine Romane um die HALBLINGE VON ATHRANOR machten ihn einem großen Publikum bekannt. Er war Mitautor von Spannungsserien wie Jerry Cotton, Kommissar X und Ren Dhark.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Kommissar Jörgensen und der nächtliche Albtraum: Mordermittlung Hamburg Kriminalroman
Krimi von Thomas West & Chris Heller
Kommissar Uwe Jörgensen hört die Hilfeschreie einer Frau. Er geht der Sache nach und trifft auf eine Rockerbande, die dabei ist, eine gefesselte Frau zu vergewaltigen. Allein stellt er sich der Übermacht …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A. PANADERO
Kommissar Jörgensen wurde erfunden von Alfred Bekker
Chris Heller ist ein Pseudonym von Alfred Bekker
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Wir sind gerade dabei, einen Drogenschmugglerring zu sprengen. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass ein Frachter aus Südamerika unterwegs ist, um in den Hamburger Hafen zu gelangen. Wir vermuten, dass auf dem Schiff Drogen versteckt sind.
Also machen wir uns auf den Weg und treffen den Frachter an der Elbe flussaufwärts. Sobald er anlegt, gehen meine Kollegen und ich an Bord und suchen nach den Drogen. Und tatsächlich finden wir sie! Wir verhaften die Schmuggler und nehmen die Drogen in Besitz.
Das war ein toller Erfolg für unsere Ermittlungen - und auch eine gute Warnung für alle anderen, die es auf ähnliche Weise versuchen mögen! Heute sind meine Kollegen und ich auf einem Frachter, der die Elbe flussaufwärts quält, in Richtung Hamburger Hafen. Es ist neblig und ich kann kaum etwas sehen.
Aber dann höre ich Stimmen und merke, dass wir nicht alleine sind. Wir stellen uns den Drogenschmugglern entgegen und verhaften sie. Der Captain des Frachters ist überrascht, als er erfährt, was wir getan haben. Aber er ist froh, dass wir da waren und ihn vor den Schmugglern gerettet haben.
Ich bin stolz darauf, für die Sicherheit in Hamburg zu sorgen und solchen Schurken das Handwerk zu legen!
Mein Name ist Uwe Jörgensen. Ich bin Kriminalhauptkommissar und Teil einer in Hamburg angesiedelten Sonderabteilung, die den etwas umständlichen Namen ‘Kriminalpolizeiliche Ermittlungsgruppe des Bundes’ trägt und sich vor allem mit organisierter Kriminalität, Terrorismus und Serientätern befasst.
Die schweren Fälle eben.
Fälle, die zusätzliche Resourcen und Fähigkeiten verlangen.
Zusammen mit meinem Kollegen Roy Müller tue ich mein Bestes, um Verbrechen aufzuklären und kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. “Man kann nicht immer gewinnen”, pflegt Kriminaldirektor Bock oft zu sagen. Er ist der Chef unserer Sonderabteilung. Und leider hat er mit diesem Statement Recht.
*
Frage: Herr Kriminalhauptkommissar Jörgensen, wir möchten Sie bitten, uns einige Fragen für die Leser unserer Zeitung zu beantworten. Zunächst einmal: Wie ist es Ihnen gelungen, in Ihrem Beruf so erfolgreich zu sein? Wie haben Sie es geschafft, so viele Kriminalfälle aufzuklären?
Antwort: Sorgfältige Arbeit. Da ist kein Geheimnis dabei. Einfache, sorgfäktige und geduldige Arbeit. Man darf nie aufgeben.
Frage: Also kann das eigentlich jeder?”
Antwort: Ja.
Frage: Aber auch interessieren uns Ihre persönlichen Erfahrungen: Wie ist es, mit dem Bösen zu tun zu haben?
Antwort: Ich weiß nicht, ob es das Böse wirklich gibt. Ich versuche, dem Recht zur Geltung zu verhelfen. Damit bin ich schon zufrieden.
Frage: Ganz der trockene Hamburger!
Antwort: Genau.
Frage: Wie gehen Sie damit um, dass Sie jeden Tag mit Verbrechen konfrontiert werden?
Antwort: Verbrecher sind auch nur Menschen.
Frage: Natürlich wollen wir auch wissen, ob Sie in Ihrem Job auch mal Fehler machen. Und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Antwort: Damit muss man klarkommen. Wenn ich jemanden in den Knast bringe, der unschuldig ist oder im Dienst jemanden erschieße, weil ich eine Situation falsch eingeschätzt habe, ist das furchtbar. Aber soll ich deswegen aufhören? Glücklicherweise arbeite ich ja nicht allein, sondern bin Teil eines Teams. Das schützt einen vor den schlimmsten Irrtümern.
Frage: Haben Sie sich schonmal so richtig in einem Menschen getäuscht?
Antwort: Wie meinen Sie das?
Frage: So, wie ich es sage. Dass Sie gedacht haben, Sie kenen jemanden und in Wahrheit ist diese Person jemand ganz anderes…”
Antwort: Ja, so etwas passiert.
Frage: Können Sie mir ein Beispiel geben?
Antwort: Dann müsste ich jetzt persönlich werden.
Frage: Und persönlich werden, das wollen Sie nicht?
Antwort: Nein.
Frage: Ist das eine Art Berufskrankheit?
Antwort: Was?
Frage: Dass Sie nichts Persönliches zulassen.
(Pause)
Antwort: Ich glaube, wir machen Schluss für heute.
Frage: Wenn Sie meinen.
Antwort: Ich nin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob das wirklich eine gute Idee war.
Frage: Was soll keine gute Idee gewesen sein?
Antwort: Das mit dem Interview.
*
Musik strömte aus den Boxen am Heck. Stairway to Heaven von Led Zeppelin. Alexander Theissen stand auf Musik dieser Art. Jimmy Pages wehmütige Gitarre und der magische Tenor Robert Plants hüllten das Hausboot ein wie Weihrauchschwaden den Chorraum einer Kathedrale.
Eine warme Sommernacht – wir feierten Alexanders Fünfzigsten. Der zunehmende Mond spiegelte sich in der Elbe. Irgendwo am Ufer lachte eine helle Frauenstimme. Christine Johannsens Stimme vermutete ich. Zusammen mit Oliver und ein paar anderen stand sie um ein Feuer. Ich glaube, sie grillten Maiskolben dort. Vielleicht auch die Fische, die Tobias und Ludger im Lauf des Abends aus dem Fluss geholt hatten.
Der Schein des Feuers tanzte flackernd auf den Uferweiden. Am Heck des Hausbootes, beleuchtet von Lichterketten, wiegten sich Tänzer im ekstatisch anschwellenden Rhythmus der Musik. Stimmen drangen aus der offenen Tür zu den Deckaufbauten.
Ich stand an der Reling und blickte zum Ufer. In Gedanken saß ich schon in meinem Sportwagen und fuhr Richtung Norden zum Helmut Schmidt Airport. Dort würde ich nicht ankommen. Heute nicht und morgen nicht. Vor mir lag die längste Nacht meines Lebens.
Es war kurz vor Mitternacht, ein Freitag. Ich trat auf den Laufsteg, der das Hausboot mit dem Ufer verband. Die Weiden rechts und links des Feuers sahen aus wie Elefanten, die der Musik lauschten, die Tänzer beobachteten und vor lauter Wohlgefallen mit Rüsseln und Ohren wedelten.
Eine halbe Stunde noch, bis Roys Maschine landete. Ich rechnete mir gute Chancen aus, in weniger als zwei Stunden zurück zu sein, zusammen mit Roy.
Vier Tage Wiesbaden hatte mein Partner sich gegönnt. Ein Fortbildungskurs auf der BKA-Akademie: Terrorismusbekämpfung vor dem Hintergrund der deutschen Außenpolitik im Nahen und Mittleren Osten. Komisch, dass ich mir das Thema gemerkt habe.
Jedenfalls wollte Roy wenigstens die zweite Hälfte von Alex‘ Geburtstagsfete noch miterleben. Immerhin waren er und ich gute Freunde des Chefpathologen.
„Setz das Blaulicht aufs Dach, Uwe“, dröhnte ein Bass hinter mir. „Und nimm die Autobahn. Mit Blaulicht und Sirene schaffst du‘s um die Zeit in fünfzig Minuten bis nach Fuhlsbüttel. In deinem Schlitten sogar in vierzig.“
Ich drehte mich um. Die massige Gestalt des Geburtstagskinds löste sich aus dem Türrahmen und schaukelte über das Außendeck zum Laufsteg.
„Frühstück gibt‘s zwar nicht vor Sonnenaufgang, aber vorher will ich mit euch zwei Helden endlich mal ungestört plaudern.“ Er lehnte seine dreihundert Pfund neben dem Laufsteg über die Reling und grinste. „Ich meine, ohne dass uns eine Leiche zuhört.“
Das klingt makaber, zugegeben. Tatsache aber ist, dass Roy und ich den übergewichtigen Pathologen fast ausschließlich an irgendwelchen Tatorten bei irgendwelchen Erschossenen, Erstochenen oder Erschlagenen trafen. Oder an seinem Arbeitsplatz: In der pathologischen Abteilung des Zentrallabors des Hamburg Polizei-Präsidiums; an einem Obduktionstisch oder in der Leichenhalle.
„Kein Problem, Alex. Spätestens um zwei Uhr stoßen wir mit einem Budweiser auf dich an.“
„Ich werd zusehen, dass es kaltgestellt ist, bevor du kommst, Uwe. Aber vorher schwimmen wir über die Elbe.“
Ich zog die Brauen hoch. Alexander Theissen neigte nicht zu übertriebenem Ernst, ganz gewiss nicht. Ohne seinen berüchtigten Humor – einen Humor mit einer ausgeprägt sarkastischen Note – hätte er seinen Job vermutlich nicht einundzwanzig Jahre ertragen.
In diesem Moment aber sah er nicht aus, als wäre ihm nach Witzen zumute: Kein Lächeln spielte um die Lippen seines breiten Mundes, keine Spur von Spott auf seinem großen, von Pockennarben übersätem Gesicht. Eher ein wenig besorgt wirkte er auf mich.
„Wer schwimmt über die Elbe?“ Ich hatte schon verstanden, aber irgendwie hoffte ich, mich verhört zu haben.
„Nun ja …“ Er lächelte gequält und zog eine Schachtel Benson & Hedges aus dem Jackett. „Ich dachte, es wäre ein schönes Ritual, die zweite Lebenshälfte mit einem sportlichen Abenteuer zu beginnen. Ich schwimm ans Westufer und zurück zum Hausboot und lach den Tod aus, so ungefähr, weißt du? Wie der selige Mao eben.“
Alex zündete seine Zigarette an und grinste, wie ein kleiner Junge grinst, den man mit Papas Whiskyflasche ertappt hatte.
„Zweite Lebenshälfte?“ Ich betrachtete seine massige, fast zwei Meter hohe Gestalt. Um ganz ehrlich zu sein: Alexander war wirklich fett. So fett, dass irgendein Spaßvogel im Zentrallabor ihm den Spitznamen Doktor Doppelmann angehängt hatte.
Außerdem hatte ich nie gehört, dass der Mediziner und Anthropologe irgendeinen Sport trieb. Soviel ich wusste, erschöpfte sein Bewegungsdrang sich darin, in seinen Wagen zu steigen oder aus ihm heraus zu klettern oder sich dreißig bis vierzig Zigaretten am Tag anzuzünden.
„Du willst allen Ernstes hundert Jahre alt werden?“ Ich klopfte ihm auf die breite Schulter und seufzte. „Dann vergiss lieber die Elbe-Überquerung.“ Der Fluss war über einen Kilometer breit an dieser Stelle. „Du kannst dir ja den Rettungsring umlegen und einmal um das Hausboot schwimmen, wenn du dir unbedingt was beweisen willst.“
Die Schlussakkorde von Stairway to Heaven verloren sich in der Dunkelheit über dem Fluss. Irgendwo in der Ferne hämmerten die Rotoren eines Helikopters.
Ein Ausflugsdampfer, erleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, zog vorbei. Auch von seinem Außendeck klang Musik herüber. Alexanders Partygäste auf der Tanzfläche am Heck winkten ihm zu. Im Norden, etwas mehr als einen Kilometer entfernt, schimmerte die Beleuchtung einer Brücke über die Elbe.
„Auch nicht schlecht“, sagte Alexander. „Das Problem ist nur: Ich hab mit eurem Chef gewettet.“ Meine Brauen wanderten noch höher. Ich konnte mich nicht erinnern, Jonathan Bock jemals beim Wetten beobachtet zu haben.
Alex sah sich um und senkte die Stimme. „Wenn ich‘s nicht tue, schulde ich ihm und seiner Sekretärin ein Essen im Vier-Jahreszeiten. Wenn ihr beide mitschwimmt, würde ich mich etwas sicherer fühlen.“ Er zuckte mit den Schultern. „Und irgendwie jünger auch.“
Das Vier-Jahreszeiten ist ein ziemlich teures Restaurant in der Mönckebergstraße. Aber es sah dem Doc eigentlich nicht ähnlich, nur um einer Menge Euros Willen unbedingt eine Wette gewinnen zu wollen. Noch dazu so ein gefährliche. Immerhin war er Mediziner, er hätte eigentlich wissen müssen, worauf er sich einließ.
Die Ehre, schoss es mir durch den Kopf. Ach du Schande! Es geht ihm um die sogenannte Mannesehre!
Mich trennen noch etliche Jährchen vom Vierzigsten, ich kann also nicht mitreden. Aber nach allem, was man hört, ist es nicht nur lustig, fünfzig zu werden.
Das Hausboot schaukelte unter der Bugwelle des Ausflugsdampfers. Musik perlte wieder aus den Boxen, Obladi, oblada von den Beatles, auch so eine Musik, auf die Alex stand. Die Tänzer klatschten in die Hände und schüttelten ihre Körper im Rhythmus der Musik.
Was für eine kindlich leichte Melodie, was für ein beschwingter Rhythmus. Ich mag das Stück auch, es klingt nach heiler Welt und so, als gäbe es nichts Einfacheres als das Leben. Im Schein des Bordlichts sah ich Stefan Czerwinski mit einer Frau tanzen, die ich nicht kannte.
Ich schwimm nicht mit dir, wollte ich sagen, und du wirst auch nicht schwimmen, aber jemand rief meinen Namen. „Uwe, sind Sie noch da?“
Der Chef kam aus dem Deckhaus, in der Rechten einen Gurt mit einem Pistolenholster. „Sie haben Ihre Dienstwaffe vergessen.“
Bei der Begrüßung seiner Geburtstagsgäste hatte sich Alexander Theissen einen speziellen Gag geleistet: Er klopfte uns nach Waffen ab. Wer eine trug – und fast die Hälfte seiner Gäste arbeitete für das BKA oder die Hamburger Polizei – musste sie in einer der Schlafkajüten auf die Koje legen.
Der Pathologe hasste jedes Gerät, das zur Tötung von Menschen gebaut worden war.
Etwas schrullig, sicher, aber verständlich vielleicht, wenn man bedenkt, was Alex Tag für Tag auf seinem Obduktionstisch zu sehen bekam.
„Danke, Chef.“ Ich nahm dem Chef meine Walther P99 ab, bedachte den Gastgeber mit einem skeptischen Blick, und ging über den Laufsteg ans Ufer. „Bis später.“ Oliver, Christine und die anderen winkten mir vom Feuer aus zu.
Der Parkplatz lag im Dunkeln. Mein Sportwagen stand neben einem roten Kombi, einem Volvo, Baujahr 1966 oder 67. Doktor Doppelmanns Fahrzeug. Den Waffengurt warf ich auf den Beifahrersitz. Ich drehte den Zündschlüssel um, und mit dem Motor meines Sportwagens sprang auch das Autoradio an. Eine Sprecherin von Radio Hamburg verlas die Mitternachts-Nachrichten.
2
„… kostete zwölf Menschenleben. Dreiunddreißig werden noch vermisst. Über siebentausend Bewohner der Küstenstadt wurden obdachlos …“
Mit unbeteiligter Stimme verkündete die Nachrichtensprecherin die großen und kleinen Katastrophen des zu Ende gegangenen Tages: Bombenanschlag in Kabul, Mord an einem Physiker, Flugzeugabsturz in Peru, Doppelmord an einem Liebespaar, Sturmflut vor der Küste von Bangladesh, und so weiter, und so weiter. Nichts, was ich unbedingt hören musste.
Links und rechts rauschten Konturen von Gebäuden vorbei, und Straßenlaternen, Zäune und Wiesen. Sternklar war die Nacht. Noch – erst einmal in Hamburg würde der Sternenhimmel schnell verblassen.
Ein besonders heller Stern leuchtete westlich des zunehmenden Mondes. Vielleicht der Saturn. Ich erinnerte mich dunkel in der Hamburg Post gelesen zu haben, dass er Anfang des Monats um Mitternacht in der Nähe des Mondes zu sehen sein würde. Dessen Halbkreis stand ungefähr in der Mitte der Windschutzscheibe.
Die Linke am Steuer, die Rechte am Suchknopf des Tuners suchte ich einen Musiksender, und fand Radio 21. Ein Sender, der rund um die Uhr Rockmusik brachte. Nachts meistens Oldies.
Musik der Stones füllte bald meinen Sportwagen aus. Auch nicht sehr verheißungsvoll, aber dem Doc hätte der Uralt-Song sicher gefallen.
Ich dachte an seine kleine Tischrede. Schon wieder zwei Stunden her. Von einem Stundenglas hatte er gesprochen, vom Stundenglas seines Lebens, in dem der Sand zur Hälfte durchgerieselt sei.
Ich musste lachen: Doktor Doppelmann schien wirklich zu glauben, mit fünfzig in der Mitte des Lebens zu stehen. Wäre er fünfunddreißig geworden, hätte das ungefähr hingehauen. Statistisch gesehen, meine ich.
Ein dunkler Wall näherte sich, ein Waldstück. Mit fast fünfundsechzig Kilometern pro Stunde raste ich über eine kleine Straße im Süden von Hamburg. Natürlich ohne Blaulicht und Sirene. Noch drei oder vier Kilometer bis zur Auffahrt auf die Autobahn. Über sie würde ich spätestens viertel vor eins Fuhlsbüttel und den Helmut Schmidt Airport erreichen.
Der Stern, den ich für den Planeten Saturn hielt, hing knapp unter dem oberen Rahmen der Windschutzscheibe. Als würde er sich nicht bewegen. Der Gedanke, dass er sich in Wirklichkeit schneller bewegte als ich in meinem Sportwagen, amüsierte mich.
Genau wusste ich es nicht, aber hatte mein Physiklehrer mir vor drei Leben nicht erzählt, dass so ein Planet an die vierzig Kilometer pro Sekunde zurücklegte?
Vierzig Kilometer pro Sekunde, das muss man sich mal vorstellen! Und ich fuhr nicht einmal siebzig pro Stunde! Und hatte noch knapp zehn Kilometer vor mir. Der Saturn zog seine Bahn um die Sonne in millionenfacher Entfernung von mir. Wie relativ alles ist! Und welche Gedanken einem während einer mitternächtlichen Autofahrt kommen …
Ein zweiter, ungewöhnlich heller Lichtpunkt am Nachthimmel fiel mir auf. Ganz in der Nähe des Saturns. Und anders als er, bewegte sich der Lichtpunkt. Das Positionslicht eines Flugzeugs wahrscheinlich.
Es war warm im Auto. Ich lockerte den Krawattenknoten und senkte das Fenster auf der Fahrerseite herab. Rotorengehämmer in der Ferne. Kein Flugzeug also, ein Helikopter. Vielleicht der Bürgermeister von Hamburg auf dem Rückweg von Bremen nach Hamburg. Oder sonst ein Politiker.
Die Straße mündete in das Waldstück. Ein Blick auf die Borduhr: Neun Minuten nach Mitternacht. In fünfundzwanzig Minuten würde Roys Maschine landen. Wenn er den Taxistand vor der Flughalle erreichte, würde ich schon auf ihn warten. Dass alles auch ganz anders kommen könnte, rückte mir nicht in den Sinn.
Schnurgerade zerschnitt die Straße den Wald. Ich gab Gas, mit fünfundachtzig Kilometer pro Stunde und mehr glitt mein Sportwagen jetzt dahin. Ich fuhr nicht, ich flog. Manchmal brauch ich diesen Geschwindigkeitsrausch.
Ein Licht leuchtete auf, ein paar hundert Meter vor mir, ganz kurz nur. Am Straßenrand? Oder im Wald?
Vielleicht ein Tier. Vorsichtshalber trat ich auf die Bremse. Und gleich darauf wieder das Licht. Es flackerte ein paar Sekunden lang zwischen den Bäumen, bevor es wieder erlosch.
Ich schaltete das Fernlicht aus, ging vom Gas und schaltete herunter. In diesem Augenblick erfasste mein Scheinwerferkegel den Rückstrahler eines Motorrads. Sechzig, siebzig Meter vor mir stand es irgendwo zwischen den Büschen und Bäumen am Straßenrand. Und schon im nächsten Moment lag es hinter mir.
Und dann ein Schrei. Nur undeutlich hörte ich ihn, der Motor sang ja sein kraftvolles Lied, immerhin fuhr ich noch mit fast fünfzig Stundenkilometern durch die Nacht.
Ein Tier, beruhigte mich eine Stimme in meinem Kopf, ein Kauz oder eine Wildkatze.
Ein Mensch, behauptete eine andere Stimme. Ich wusste genau, welche Stimme Recht hatte.
Raus mit dem Gang, auf die Bremse getreten – mein Sportwagen rollte an den Straßenrand. Durch das offene Seitenfenster lauschte ich in den Wald.
Und dann hörte ich es wieder: Jemand schrie; eine Frau, ein Kind – schwer zu sagen. Mein Nackenhaar richtete sich auf.
Wer auch immer da schrie: Er tat es nicht zum Spaß. Der Schrei klang gequält, als befände sich dort im dunklen Wald jenseits der anderen Straßenseite jemand in höchster Not. Alle möglichen Fantasien schossen mir durch den Kopf.
0.13 Uhr, sagte die Borduhr. In zwanzig Minuten würde Roy landen. Doch wie hätte ich weiterfahren können? Dort drüben im Wald geschah etwas Hässliches, gar keine Frage, irgendjemand befand sich dort in allergrößten Schwierigkeiten.
Ich musste aussteigen und nachschauen, ich konnte nicht anders …
Manchmal, wenn ich mich an diese Nacht erinnere, denke ich: Es war ein Fehler gewesen.
Ja, vielleicht war es wirklich ein Fehler anzuhalten und auszusteigen. Dennoch: Ich würde diesen Fehler jederzeit wieder machen!
3
Ich hatte schon fast die Straße überquert, als ich mir plötzlich wie nackt vorkam. Also zurück zum Sportwagen und die Fahrertür aufgezogen. Das Holster mit meiner Walther P99 lag noch auf dem Beifahrersitz. Ich zog die Waffe aus dem Holster und steckte sie in den Hosenbund unter die Lederjacke, die ich in dieser Nacht trug.
Ich überquerte die Straße ein zweites Mal. Am Waldrand entlang lief ich ein Stück gegen die Fahrtrichtung. Bis ich die Maschinen zwischen den Bäumen entdeckte.
Nicht nur eins, sechs Motorräder waren es: Vier Harley Davidson, eine Moto Guzzi und eine schwere BMW mit Soziuswagen. Alle so geparkt, als hätten ihre Besitzer größten Wert darauf gelegt, nicht von vorbeifahrenden Fahrzeugen entdeckt zu werden. Reiner Zufall, dass ich den Rückstrahler der Moto Guzzi hinter dem lichten Buschwerk in meinem Scheinwerferkegel hatte aufleuchten sehen.
Vor den Maschinen ging ich in die Hocke und hielt die Handfläche über den Motorblock einer Harley Davidson. Der strahlte Hitze aus. Lange konnten die Motorräder noch nicht hier stehen.
Ich lauschte. Irgendwo im Wald knackten Äste. Mindestens sechs Motorradfahrer stampften dort durch die Dunkelheit. Wahrscheinlich mehr. Ich glaubte Männerstimmen zu hören. Die Frau schrie nicht mehr.
Für Sekunden stand ich vor der schwarzen Wand aus Buschwerk, Gestrüpp und Baumstämmen, unschlüssig und misstrauisch. Sechs Motorräder, ein Licht, Schreie und Schritte im Wald – keine Mischung, die eine romantische Mondnacht verhieß.
Und überhaupt: Auch ohne Schreie, Motorräder und Schritte im Unterholz hat so ein nächtlicher Wald nichts Einladendes. Gefahr und Schrecken schienen mich aus der dunklen Wand anzuglotzen.
Der Gedanke an Roys bevorstehende Landung in Fuhlsbüttel schob sich in mein Hirn; als wollte ich mich selbst zurück zum Wagen locken.
Ich gab mir einen Ruck und schlich in den Wald hinein. Alle sechs Schritte blieb ich stehen und orientierte mich: Das Brechen von Ästen und die Männerstimmen wiesen mir den Weg. Weit konnten sie nicht sein, die Motorradfahrer.
Etwa fünfzig oder sechzig Schritte weit war ich in den Wald eingedrungen, als erneut ein Licht aufflammte. Zwischen dem Laub tief hängenden Eichen- und Buchengeästs sah ich einen Lichtkegel. Knapp hundertfünfzig Meter entfernt leuchtete jemand den Wald mit einer Taschenlampe aus. Und plötzlich wieder der Schrei. „Hilfe!“
Ich rührte mich nicht, lauschte mit angehaltenem Atem.
„Hilfe …!“
Eine Frauenstimme, kein Tier, kein Spaß – eine Frauenstimme, die so klang, als bliebe ihr nicht mehr viel Zeit, um Hilfe herbeizuschreien.
Dann fluchte eine Männerstimme, eine andere rief etwas, das sich wie „Halt‘s Maul!“ anhörte, und schließlich kurz hintereinander drei oder vier Geräusche, die wie Schläge klangen.
Während ich weiter schlich, machte ich mir klar, dass ich mich einer mindestens sechsfachen Überzahl näherte. „Mist!“
Falsch! Ich griff zum Kolben meiner Walther P99: Wir waren zu zweit. Also nur eine dreifache Übermacht. Und wenn ich die sechzehn Patronen im Magazin mitrechnete, lag die Überlegenheit schon auf meiner Seite.
In Gedanken segnete ich meinen Chef, der mir zwanzig Minuten zuvor die Waffe hinterher getragen hatte.
Schritt für Schritt näherte ich mich den Motorradfahrern und ihrem Opfer. Glücklicherweise überlagerten deren Schritte und Stimmen das Geräusch meiner eigenen Schritte. Ich zweifelte nicht mehr daran, dass ich es mit gewalttätigen Männern zu tun hatte.
Gut achtzig Meter entfernt sah ich die Männer im Licht von zwei oder drei Taschenlampen auf einer kleinen Lichtung vor einem Farnfeld stehen. Es waren mehr als sechs; neun oder zehn schätzte ich, die meisten mit Helmen und in schwarzem Lederzeug.
Einer packte den Helm einer auffallend zierlichen und kleinen Person und riss ihn ihr vom Kopf. Blonde Locken fielen auf schwarzes Leder. Eine Frau! Ein Knebel steckte in ihrem Mund. So, wie sie sich wand und den Kopf hin und her warf, schien sie auch gefesselt zu sein.
Der Kerl, der ihr den Helm abgezogen hatte, riss ihr den Knebel aus dem Mund. Mit dem Handrücken schlug er ihr ins Gesicht. „Wo ist das verdammte Ding?“ Immer wieder schlug er zu. Sie stöhnte auf. „Wo ist es?“
Ein anderer löste ihr die Fesseln und zerrte ihr die Lederjacke von den Schultern. Und ein dritter stieß sie ins Unterholz und öffnete seinen Hosenbund.
Tue was, Uwe! Meine innere Stimme rüttelte mich auf. Und tu es jetzt gleich!
4
Zurück zu meinem Sportwagen! Wenn ich mich schon auf einen Kampf mit mindestens acht Männern einließ, wollte ich das Risiko wenigstens so gering wie möglich halten. Es war unkalkulierbar genug – wusste ich denn, ob die Kerle im Wald nicht bewaffnet waren?
Ich rannte über die Straße, riss die Wagentür auf, beugte mich hinein. Meine Rechte riss das Handschuhfach auf und tastete nach einer kleinen Taschenlampe, die ich irgendwann dort verstaut und vergessen hatte. Auch ein Streichholzbriefchen fand ich. Meine Linke hielt schon den Hörer des Autotelefons fest und wählte die 110.
„Jörgensen, BKA!“, rief ich. „Überfall in Winterhude Stadtpark! Auf dem Südring Richtung Flughafen! Im Waldstück vergewaltigen acht oder neun Kerle eine Frau! Ich bin allein!“
Die Reaktion der Telefonistin in der Notrufzentrale wartete ich nicht ab. Ich spurtete über die Straße, und dann zurück zu den Motorrädern.
Keine Ahnung, wie weit entfernt das nächste Polizeirevier lag. Eine abgelegene Gegend war das, und wenn die Polizisten in zehn, zwölf Minuten hier sein würden, konnte ich von Glück reden.
Ich – nicht die Frau dort drinnen im Unterholz des nächtlichen Waldes! Für sie konnte es schon in zwei Minuten zu spät sein.
Vor einer Harley Davidson ging ich in die Hocke. Irgendwo im Osten schon wieder das ferne Gehämmer von Rotoren. Mit der Taschenlampe leuchtete ich den Motorblock aus. Die Benzinleitung! Im Gewirr von Kabeln, Schläuchen entdeckte ich sie.
Aus einer Handbreite Entfernung zielte ich mit meiner Walther P99 auf die Leitung. Der Schuss zerriss die Stille der Nacht. Gut so! Sollten sie erschrecken, diese Scheißkerle! Jetzt würden sie ablassen von ihrem Opfer. Für ein paar Minuten wenigsten.
Drei, vier Schritte war ich von der Maschine zurückgesprungen. Doch anders als erwartet, entzündete der Schuss das Benzin nicht. Ich kramte ein Papiertaschentuch aus der Hose, tränkte es mit auslaufendem Treibstoff und zündete es an. Als die Flamme loderte, warf ich es unter das Motorrad; und mich selbst ins Unterholz zwischen den Buchen am Waldrand.
Erst zischte es, fast gleichzeitig erhellte eine Stichflamme sekundenlang Gestrüpp, Bäume und Buschwerk; dann – dumpf und fauchend – explodierte der Tank. Die Maschine brannte lichterloh.
Ich sprang auf. Zurück in den Wald! Schon hörte ich Äste unter schweren Stiefeln brechen.
Ich schätzte, mindestens die Hälfte der Kerle würde nach dem Brandherd schauen. Vier Gegner – immer noch drei zu viel, aber die Chance, sie in den Griff zu kriegen, näherte sich wenigstens dem realistischen Bereich. Und außerdem waren wir ja zu zweit: Meine Walther P99 und ich; und die sechzehn Schuss nicht zu vergessen.
Männerstimmen fluchten und schrien Namen, Stiefel brachen durchs Unterholz. Die Burschen veranstalteten so viel Lärm, dass ich mich nicht groß bemühen musste, leise zu sein. Nur als sie wenige Schritte von mir entfernt Richtung Straße rannten, und ich sogar zwei, drei Gestalten sehen konnte, blieb ich für einen Moment stehen und wartete ab.
Bei dem brennenden Motorrad angekommen brüllten sie ihren Zorn hinaus. „Deine Maschine brennt, Micky!“, rief einer.
Ich schlug einen Bogen durchs Unterholz zurück zu der Stelle wo sie die Frau festhielten. Dort erhellten noch immer zwei Taschenlampen die kleine Lichtung vor dem Farnfeld.
Noch vier oder fünf Schritte entfernt kauerte ich mich neben einem Eichenstamm. Zwei knieten im Farn und hielten die Frau fest. Einer hockte auf ihr, und versuchte ihr die Hose auszuziehen. Sie warf sich hin und her, blutete aus der Nase und spuckte ihn an. Der Mann auf ihr schlug sie ständig ins Gesicht.
Zwei weitere standen breitbeinig im Gestrüpp – sie waren mit Pumpguns bewaffnet – und lauschten den Flüchen ihrer Komplizen am Straßenrand. Alle trugen sie Motorradhelme.
In Bruchteilen von Sekunden analysierte ich die Situation: Sie war brandgefährlich und kaum kalkulierbar. Das größte Risiko stellten die beiden Kerle mit den Pumpguns dar.
Meine Walther in beiden Händen sprang ich aus dem Unterholz. „BKA! Waffen weg!“ Ich zielte auf die Pumpgun-Träger. Hinter einem hochgeklappten Visier sah ich ein schwarzes Gesicht.
„Runter von der Frau!“ Ich schoss zweimal – den Bewaffneten zwischen die Füße. Die Lichtkegel der Lampen erloschen schlagartig. Alles weitere spielte sich blitzschnell ab …
5
… Mündungsfeuer blitzte vor mir auf und erhellte die Umrisse des Schützen. Im Fallen drückte ich ab.
Schüsse krachten im Sekundentakt. Links und rechts raschelten Schritte. Jemand schrie, ein Körper schlug im Laub auf. Ich rollte mich ab, robbte durch Moos und Gestrüpp, um in die Nähe der Frau zu gelangen. Den Kerl, der auf ihr saß, den wollte ich packen.
Wieder schrie eine Männerstimme, ein Körper fiel über mich. Ich sah die Umrisse einer schmalen Gestalt neben mir auftauchen. „Schweinehund!“, zischte eine Frauenstimme.
Fäuste flogen, der Schatten eines Armes sauste auf den Körper über mir nieder, etwas Langes, Spitzes ragte aus den Konturen einer Faust. Dann das hässliche Geräusch reißenden Fleisches, ein Stöhnen, der Körper über mir erschlaffte.
Licht flammte auf, neben mir kniete die blonde Frau mit einem blutigen Messer in der Faust, geblendet schloss ich die Augen und schoss gleichzeitig auf die Lichtquelle. Sie erlosch, ein Fluch, der Aufschlag eines schweren Körpers.
Ich stieß den Toten von mir, packte die Frau, schoss um mich und zerrte sie hinter mir her ins Farnfeld und dann zwischen die Bäume. Sie keuchte, und ihre Hand fühlte sich kalt und feucht an. Irgendetwas Kantiges, scharfes bohrte sich in meinen Handballen, sie schien einen Ring mit einem großen Stein zu tragen.
Äste peitschten mir ins Gesicht, Dornen krallten sich an meinen Hosenbeinen fest. Die Kerle auf der Straße brüllten, von fern näherten sich Sirenen.
Wir stolperten über einen umgestürzten Baum, blieben liegen und lauschten in die Dunkelheit. Der Wald um uns herum schien von Schritten und Rufen erfüllt zu sein.
„Micky und Hepp hat‘s erwischt!“, rief einer, und ein anderer: „Die Schlampe hat Micky ein Messer ins Herz gestoßen! Der Wichser ist mit ihr in den Wald gerannt! Lasst sie nicht entkommen!“ Und ein dritter schrie: „Bullen! Hört ihr die Bullen?“
6
Liegen bleiben, verschnaufen, abwarten – das schien mir für den Moment die einzig sinnvolle Taktik zu sein.
Seite an Seite lagen die Fremde und ich hinter dem Baumstamm im Gestrüpp. Ich spürte die Wärme ihres Körpers, sogar den Galopp ihres Herzens meinte ich zu fühlen, es kann aber auch mein eigenes gewesen sein. Genau wie ich versuchte auch sie, sich zu tiefen, geräuschlosen Atemzügen zu zwingen.
Schritte und Stimmen verstummten. Gespenstisch still wurde es um uns herum. Nur die Sirenen der Streifenwagen näherten sich rasch. „Sie werden sie töten!“, zischte die Frau neben mir.
Ich begriff nicht sofort, wer ihrer Meinung nach wen töten würde. Aber als ich in die plötzliche lauschte und das Heulen der Sirenen näher kommen hörte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen.
Mehr als zwei Sirenen konnte ich nicht von einander unterscheiden. Viel zu wenig für diese bewaffnete und zum Äußersten entschlossene Schlägertruppe. Ich musste die Polizisten warnen.
„Was sind das für Kerle?“, flüsterte ich. Ich tastete die Taschen meiner Lederjacke nach meinem Handy ab. Es war nirgends zu finden – während des kurzen Kampfes aus der Tasche gerutscht, schätzte ich.
„Hast du doch gesehen“, kam es leise zurück. Ihre Stimme zitterte. „Ein gottverdammte Rockerbande ist das!“
Obwohl sie flüsterte und ihre Stimme nach jedem Wort zu brechen drohte, hörte ich eine Härte und Entschlossenheit heraus, die ich nicht erwartet hätte.
Ich dachte daran, wie sie auf den Kerl losgegangen war, der sie vergewaltigen wollte. Kaum hatten die anderen ihre Hände freigegeben, schon griff sie ihn an. Wie ein Profi. Sie musste den Mann mit den Beinen von sich gestoßen haben. Doch wo hatte sie das Messer her?
Ob sie aus dem gleichen Holz war wie ihre Peiniger?
Ich schob die Gedanken beiseite. Eins nach dem anderen, erst einmal musste ich zusehen, wie wir mit halbwegs heiler Haut aus diesem Wald heraus kamen.
„Das war ein Bluff, nicht wahr?“, flüsterte sie. „Du bist nicht vom BKA.“
„O doch. Wie heißt du?“
„Regina. Und du?“
„Uwe Jörgensen.“
Das Feuer bei den Motorrädern brannte noch immer. Blaulichter flackerten zwischen den Bäumen, die Streifenwagen hielten an. Ich schoss in die Luft, um die uniformierten Kollegen zu warnen. Einen Augenblick später krachten Schüsse. Ich sprang auf. „Warte hier! Ich muss den Polizisten helfen!“
„Du spinnst ja total!“ Sie hielt meinen Arm fest und rannte hinter mir her. Wir liefen durchs Farnfeld, der Schusswechsel vorn bei der Straße riss nicht ab.
Ich knipste meine Taschenlampe an. Der Lichtschein fiel auf drei Männer mit Motorradhelmen. Sie lagen reglos im Unterholz.
Regina sprang über den hinweg, den sie erstochen hatte und bückte sich nach dem, der mich mit der Pumpgun bedroht hatte. Meine Kugeln hatten ihn tödlich erwischt. Die Frau nahm ihm die Pumpgun ab. Das Feuergefecht am Waldrand wollte kein Ende nehmen.
Zwei Atemzüge lang stand ich wie festgewachsen. Der Lichtkegel meiner Lampe lag auf dem Gesicht unter dem Motorradhelm, ein blutjunger Bursche, höchstens zwanzig Jahre alt. Das Weiße in seinen gebrochenen Augen reflektierte den Lichtschein.
Von dem zweiten, den meine Kugel getroffen hatte, konnte ich das Gesicht nicht sehen, sein Visier war geschlossen. Auf der Haut seines rechten Handrückens war eine Rose eintätowiert.
Mir wurde übel.
Auf meiner inneren Bühne lehnte Alex über der Reling und fantasierte davon, die Elbe zu durchschwimmen, und der Chef streckte mir mein Dienstwaffenholster entgegen.
Eben noch Gast einer ausgelassenen Geburtstagsfete – war es eine halbe Stunde her oder schon eine ganze? – eben noch in meinem Sportwagen unterwegs und in Gedanken bei Roy, fand ich mich plötzlich im größten Schlamassel wieder; und hatte zwei Menschen getötet …
„Worauf wartest du, Jörgensen?“ Die schmale Gestalt der Frau war nur noch ein undeutlicher Schatten zwischen den Bäumen. Ich richtete den Lichtkegel auf sie. Sie hatte einen breiten, schmallippigen Mund und ein ziemlich markantes Gesicht, hager, mit ausgeprägten und hochstehenden Wangenknochen, ein herbes, fast strenges Gesicht. Das blonde Haar war schwarz an den Wurzeln.
Sie trug nur noch ein graues Unterhemd mit Spaghettiträgern über der Hose. In der Rechten die Pumpgun fummelte sie mit der Linken die Knöpfe ihres Hosenbundes zu.
Jetzt sah ich den Ring, den ich vor ein paar Minuten schmerzhaft in meinem Handballen gefühlt hatte. Im Licht meiner Lampe leuchtete ein großer, blauer Stein auf. Die Frau trug eine dunkle Wildlederhose mit Fransen an den Seitennähten.
Auf der Straße explodierte Schuss um Schuss. „Mach das verdammte Licht aus!“, zischte die Frau namens Regina. „Oder willst du ums Verrecken eine Zielscheibe abgeben?“ Sie drehte sich um und lief Richtung Straße in den Wald. Ich knipste die Lampe aus und folgte ihr.
Sie verblüffte mich, ganz ehrlich. Mit jeder Geste, die ich an ihr beobachtete, mit jedem Wort, das sie sagte, ein Stück mehr. Ein unschuldiges Opfer grausamer Vergewaltiger? Schon zu diesem Zeitpunkt, als die Polizisten sich die Schießerei mit den Rockern lieferten, glaubte ich selbst nicht mehr daran.
Vermutlich gehörte sie ebenfalls zur Szene, nein: ganz sicher gehörte sie dazu. Der Henker mochte wissen, wie sie sich in diese Lage manövriert hatte.
Aber egal, selbst wenn Regina sich als weiter nichts als ein gerissenes Flittchen erweisen sollte – ich würde mir morgen früh trotzdem im Spiegel in die Augen schauen und gratulieren, dass ich sie herausgehauen hatte.
Wie geräuschlos und flink sie sich bewegte – ich hatte Mühe sie einzuholen. „Ich hab einen Wagen dabei“, flüsterte ich, als ich endlich dicht hinter ihr lief. „Einen Wagen mit Autotelefon. Wir müssen Hilfe holen.“
Sie antwortete nicht, blieb stehen und spähte in die Dunkelheit zur Straße. Der Schusslärm hatte aufgehört. Motoren brüllten los.
Ein einzelner Scheinwerfer flammte auf, und gleich darauf ein zweiter und ein dritter. Und etwas weiter links ein Scheinwerferpaar. Mein Sportwagen, ich hörte das vertraute Geräusch seiner Maschine aus dem Gebrüll der Motorräder heraus.
„Mist!“ Ich spurtete los.
„Bleib hier, Jörgensen!“, rief sie. „Du rennst den Schweinehunden vor die Läufe!“
Das Scheinwerferpaar bewegte sich, beschleunigte und erlosch. Nur den Lichtkegel, den es auf Wald und Straße warf, sah ich noch ein paar Sekunden lang. Kraftvoll dröhnte der Motor, als würde er nach mir rufen. Ich rannte und fluchte. Doch mein Sportwagen entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit.
Die vereinzelten Motorradscheinwerfer am Waldrand strahlten in den Wald hinein. Fünf kalte, grelle Augen, als würden Monster uns mit bösen Blicken mustern. Wie Panzer donnerten die Motoren. Sie pflügten in den Wald hinein.
Regina tauchte neben mir auf. „Sie suchen nach uns! Weg hier!“
7
Dornen drangen in meine Hose ein, hartes Gehölz zerkratzte mir Gesicht und Hände. Von drei Seiten brummten die Maschinen durch den Wald auf uns zu. Sie hatten Fernlicht eingeschaltet.
In der Hocke und auf Knien pirschten wir uns durch dichtestes Gestrüpp an die Straße heran. Die Polizisten – warum hatten sie aufgehört zu schießen? Nur ein einziger Grund leuchtete mir ein: Die Polizisten konnten nicht mehr schießen. Die Polizisten waren tot.
Aber die beiden Streifenwagen mussten noch am Waldrand stehen. Hoffentlich hatte die Mörderbande nicht daran gedacht, die Funkgeräte unbrauchbar zu machen.
Manchmal mussten wir uns aufrichten, um über lichte Stellen zur nächsten Deckung zu laufen. Und manchmal erwischte uns dann ein Scheinwerferkegel – fast gleichzeitig bellte dann jedes Mal eine großkalibrige Waffe los. Kugeln pfiffen über uns hinweg, ein schlug in einen Baumstamm neben uns ein. Regina schoss jedes Mal zurück. Bis das Magazin der erbeuteten Pumpgun leer war.
Bald hatten uns die fünf Maschinen eingekesselt. Näher und näher krochen die grellen Scheinwerfer, in immer kürzeren Intervallen explodierten Schüsse. Ich selbst wusste genau, wie viele Kugeln noch im Magazin meiner Walther P99 steckten: Elf.
Wenn mein Mündungsfeuer schon unseren Standort verraten würde, wollte ich wenigstens möglichst gezielt schießen. Also hielt ich mich zurück.
Irgendwann lagen wir flach auf dem Waldboden. Zwei Maschinen wühlten sich unserem Versteck aus Richtung der Straße entgegen, eine aus der entgegengesetzten Richtung, und zwei von rechts und links. Ihre Scheinwerfer strichen in kurzen Intervallen über die Baumstämme, das Gestrüpp und den Waldboden ab. Das Gebrüll der Motoren zerrte an meinen Nerven. Der Belagerungsring zog sich enger und enger.
Regina drängte sich an mich. „Wir müssen ausbrechen“, keuchte sie in mein Ohr. Ich spürte die Hitze ihres Körpers dicht an meinem – sie zitterte. „Wir müssen es wenigstens versuchen, wenn sie uns erwischen, machen sie kurzen Prozess. Und sie erwischen uns, wenn wir wie die Hasen im Gebüsch hocken.“
Sie wollte aufstehen, prompt fiel ein Schuss. Ich packte ihren Arm und zerrte sie wieder zu mir herunter. Ein Motor heulte auf, der Scheinwerferkegel einer Maschine schien sich aufzubäumen, bohrte sich ins dichte Buchengeäst über uns, glitt am Stamm entlang wieder hinab und tauchte das Gestrüpp links von uns in grelles Licht.
Ich rollte mich zur Seite, zog die Frau mit mir, robbte der Maschine entgegen. Wie ein Blitz traf mich die Erleuchtung – das war unsere Chance, unsere einzige.
„Jörgensen, du Narr! Was tust du?“
„Still!“, fuhr ich sie an.
Die Maschine schob sich näher und näher, Mündungsfeuer blitzte über dem Scheinwerfer auf, ein paar Schritte hinter uns splitterte Holz.
„Komm schon!“ Statt zu fliehen, robbte ich der Maschine entgegen. Regina blieb an meinen Schuhsohlen. Sie schien zu kapieren.
„Hierher!“, brüllte eine Männerstimme. „Hier irgendwo sind sie! Schnappen wir sie, und dann nichts wie weg!“
Als der Scheinwerfer nur noch zwanzig oder dreißig Schritte vor mir durch das Unterholz pendelte, zog ich meine Lederjacke aus. Ich nahm Dienstmarke und -ausweis, Schlüsselbund, Lampe, Brieftasche und Streichhölzer heraus und wickelte die Jacke zu einem baseballgroßen Knäuel zusammen.
„Wenn ich jetzt sage, wirfst du das Ding in den Scheinwerferkegel.“ Ich drückte Regina die zusammengerollte Jacke vor die Brust, und nahm den Kolben meiner Walther P99 in beide Hände.
„Okay, Jörgensen, okay …“ Ihre Stimme vibrierte. Diese Frau fürchtete sich nicht allein vor ihren Vergewaltigern, sie fürchtete sich vor ihren Mördern.
Es war nicht einfach, im Dunkeln zu zielen. Ich zog meine Sonnenbrille aus der Hemdtasche und setzte sie auf. So hielten meine Augen dem Fernlicht des Motorrads einigermaßen stand. Zunächst zielte ich in den Scheinwerfer.
Im grellen Licht zeichneten sich Kimme und Korn ab. Als sie einander deckten und nur noch einen einzigen Punkt bildeten, zog ich die Waffe behutsam ein Stück nach oben.
„Jetzt!“
Regina holte aus, ächzte kurz und schleuderte das Lederknäuel in die Dunkelheit. Die Jacke flog über Büsche und Gestrüpp ins Unterholz – genau in den Scheinwerferkegel.
So hatte ich es mir vorgestellt.
Keine Sekunde später Mündungsfeuer schräg über dem Scheinwerfer. Ich drückte ab, der Scheinwerferkegel wankte, ich schoss ein zweites und ein drittes und viertes Mal – bis der Scheinwerfer zur Seite kippte und aus dem Gehölz am Waldboden in die Baumkronen leuchte.
„Aus dem Schussfeld!“, zischte sich. Wir hechteten zu Seite, rollten uns ab, und der Kugelhagel von den anderen Maschinen schlug an der Stelle ein, von der aus ich eben noch gefeuert hatte.
„Los! Zur Maschine!“, zischte ich.
Als hätte sie eine Ausbildung bei der Sondereinheit KSK der Bundeswehr absolviert, robbte Regina neben mir her – flink, fast geräuschlos. Binnen Sekunden erreichten wir die ins Unterholz gestürzte Maschine.
„Ich mach sie startklar, gib mir Feuerschutz!“ Ohne Widerspruch nahm Regina meine Waffe. Ich setzte längst voraus, dass sie damit umgehen konnte. „Noch sieben Schuss – schieß nur, wenn es gar nicht mehr anders geht.“
Auf allen vieren kroch ich um die Maschine herum, sodass ich sie von hinten erreichte und erst im letzten Moment in den Lichthof ihres Scheinwerfers geriet. Der Motor brummte noch, der Fahrer lag rücklings über dem Motorblock, es stank nach verbranntem Leder.
Keine Frage, der Kerl war tot. Der dritte, den ich innerhalb einer knappen Stunde erschossen hatte. Nur nicht daran denken, nur nicht daran denken …
Neben dem Hinterrad wälzte sich ein zweiter Mann in Lederkluft und Helm. Er hörte mich, drehte sich um und versuchte seine Pumpgun hochzuziehen.
Ich setzte alles auf eine Karte – ich musste: Mir blieb gar nichts anderes übrig: Ich hechtete aus der Deckung, sprang ihn an, wie eine Raubkatze sein Beute anspringt.
Dem Angeschossenen blieb keine Chance zur Gegenwehr: Der Aufprall meiner hundertsiebzig Pfund pressten ihn ins Unterholz. Ich riss ihm die Waffe aus der Hand, dachte daran, dass er mich töten wollte und schlug ihm den Kolben zweimal ins Visier.
Kunststoff splitterte, der Mann seufzte kurz, und rührte sich nicht mehr.
Motorengebrüll erfüllte den Wald, fast gleichzeitig begannen vier oder fünf Schusswaffen Feuer und Blei zu spucken. Halb auf dem Bauch liegend zerrte ich den Fahrer vom Motorblock. Ein paar Schritte tiefer im Wald blitzte das Mündungsfeuer meiner Walther P99 auf. Regina feuerte auf die Angreifer, in Gedanken zählte ich die Schüsse mit, während ich nach dem Lichtschalter des Motorrads suchte.
Endlich erlosch das Fernlicht, ich bockte die Maschine auf, ging hinter ihr in Deckung und schob sie gleichzeitig aus der Schusslinie. Ein metallenes Klicken und ein Fluch ganz in meiner Nähe verrieten mir das Unabwendbare: Keine Patrone mehr in meinem Magazin.
„Her mit dir, Regina!“ Ich schwang mich auf den Sattel. „Versuchen wir es!“
8
Noch zweihundert Meter bis zur Straße! Die Maschine – eine der vier Harley Davidson – holperte über Baumstrünke, durch Büsche und Erdlöcher. Es war, als würde ich einen Traktor über noch unerschlossenes Land steuern.
Ich fuhr ohne Licht, anders wären wir selbst für schlechte Schützen ein leichtes Ziel gewesen. Hinter uns schrien sie sich an, was, konnte ich nicht verstehen, der Motorenlärm war zu laut.
„Schneller!“, rief Regina. „Sie kommen näher!“ Schüsse peitschten durch den nächtlichen Wald. Ungezielt hielten die Burschen in die Richtung, in der sie uns vermuteten. Ich gab mir alle Mühe, die Finger von der Bremse zu lassen, um den Angreifern kein Ziel zu bieten. „Fahr doch schneller, Jörgensen, fahr schneller!“
„Hast du etwa Lust, an einem Baum zu landen?“ Dazu hatte Regina keine Lust, also gab sie Ruhe.
Aus den Augenwinkeln sah ich selbst, dass sie an uns vorbeizogen. Es war klar, was sie vorhatten: Vor uns auf der Straße sein und uns aufs Neue in die Zange nehmen.
Ich wartete, bis die zwei Maschinen links von uns fast den Waldrand erreicht hatten, dann riss ich das Motorrad herum und pflügte parallel zur Straße durch den Wald.
Was für ein Glück, dass der Halbmond hoch am Himmel stand! So ahnte ich wenigstens die Baumstämme, Büsche und entwurzelten Bäume. Dennoch peitschten uns Äste um Ohren und Knie. Manchmal hob es mich aus dem Sattel, und ich klammerte mich an den Griffen der Lenkstange fest. Die fremde Frau, die sich Regina nannte, umschlang mich von hinten, um nicht von der Maschine zu stürzen. Es war schon ein paar Monate her, dass eine Frau mich umarmt hatte.
Hundertfünfzig Meter weiter brüllten Motoren und blendeten Scheinwerfer auf. Dort auf der Straße folgten sie dem Gebrumm unseres Motors. Drei Minuten später erreichten wir einen Forstweg, der von der Straße wegführte.
Ich zog die Maschine nach links, stützte sie mit dem rechten Bein ab, und drehte den Gashahn auf. Aufs Geratewohl raste ich in die Dunkelheit. Weg von der Straße, egal wohin, nur weg von der Straße!
Das matte Licht des zunehmenden Mondes entriss der Nacht weiter nichts als verschwommene Konturen von Bäumen, Grasnarben und Gestrüpp. Zwei dunkle Wände huschten rechts und links vorbei, der Wald.
Ich versuchte mich an der Grasnarbe in der Mitte des Hohlweges zu orientieren. Keine Ahnung, wie schnell ich fuhr, keine Ahnung, wohin der Weg führte – ich dachte nichts mehr, mein Instinkt steuerte mich und die Maschine.
„Schalt das Licht an!“, schrie Regina hinter mir. „Schalt es an, solange sie nicht hinter uns her sind!“
Sie hatte Recht, aber es dauerte ewig, bis ich den Lichtschalter fand. Wie lange war es eigentlich her, dass ich auf einer Maschine saß?
Endlich fand ich ihn: Ein Scheinwerferkegel tauchte Büsche, Fallholzstapel und Gestrüpp am Wegrand in helles Licht. Ich drehte den Gashahn auf.
Jegliches Zeitgefühl schien mir abhanden gekommen. Kämpfte ich mich seit einer Stunde durch diese Hölle oder schon die ganze Nacht? Keine Zeit darüber nachzudenken, im Rückspiegel flammten Scheinwerfer auf.
Regina hatte sie auch gesehen. „Gib Gas, Jörgensen! Sie kommen!“
Das Licht wieder auszuschalten hieße mit der Geschwindigkeit herunter gehen zu müssen. Also ließ ich es an, schaltete sogar das Fernlicht ein, und beschleunigte.
Der Weg durchschnitt den Wald wie eine Diagonale ein Rechteck: kerzengerade, ohne Kurve, ohne Abzweigung. Auf beiden Seiten spritzte Gras und Dreck zur Seite. Der Balken des Tachometers zitterte zwischen der Sechzig- und Siebzig-Kilometer-Marke.
Eine halsbrecherische Fahrt, weiß Gott, aber was sollte ich tun? Hinter mir eine mindestens vierfache Übermacht, im Magazin meiner Walther P99 nicht eine einzige Kugel mehr: Flucht war die einzig vernünftige Alternative.
Nicht lange, und ich sah alle vier Scheinwerfer im Rückspiegel. Sie rückten näher und näher. Diese Höllenbrut beherrschte ihre Maschinen besser als ich meine. Sie waren es gewohnt, mit einem brüllenden Motor zwischen den Beinen durch die Weltgeschichte zu jagen.
Und ich? Ich vermisste meinen Sportwagen.
„Sie kriegen uns!“ Reginas Faust bearbeitete meinen Rücken. „Verdammt, Jörgensen, sie kriegen uns! Lass mich nach vorn!“
Keine schlechte Idee an sich. Wenn sie zur Szene gehörte, konnte sie wahrscheinlich auch eine Maschine reiten. Aber anhalten, die Plätze wechseln und Zeit verlieren? Nein.
Außerdem spielte mein Stolz nicht mit. Ich drehte den Gashahn auf und trieb das Gerät bis auf fast achtzig Kilometer pro Stunde.
Wir wurden durchgeschüttelt, bis uns unsere Mägen sich umzustülpen drohten. Aber die Verfolger kamen nicht mehr näher, wenigstens das.
Dann eine Kurve. Ich bremste ab, legte mich in die Biegung, gab wieder Gas. Reginas Fingernägel bohrten sich schmerzhaft in meine Brustmuskulatur. Der Scheinwerferkegel traf eine Schranke. Und dahinter auf den Asphalt einer Straße.
Ich musste scharf bremsen, steuerte die Harley Davidson in den Wald hinein und bretterte durch Büsche und kniehohes Gras um die Schranke herum. Sekunden später die Straße.
Ein kühler Wind wehte durch die Waldschneise, beiläufig registrierte ich, dass ich schweißnass war. Ich schaltete das Licht aus, riss die Maschine nach links und drehte den Hahn auf. Keine Ahnung, auf was für einer Straße ich fuhr, keine Ahnung, welche Himmelsrichtung ich wählte.
Das Vorderrad bäumte sich auf, der Hinterreifen quietschte, meine Handgelenke und Ellenbogen stachen, als der vordere Teil der Harley Davidson wieder auf den Asphalt knallte. Fast rutschten meine Hände von den Lenkradgriffen ab, so kraftvoll beschleunigte das Gerät.
„Jörgensen, du Wahnsinniger!“, brüllte die fremde Frau hinter mir. Sie bohrte ihre Stirn zwischen meine Schulterblätter.
Ich widerstand der Versuchung das Licht einzuschalten. Tief über den Lenker gebeugt beschleunigte ich. Der Fahrtwind zerrte an meinem Hemd und zerwühlte mein Haar. Ein Auge im Rückspiegel, das andere auf der Straße raste ich Minuten später aus dem Wald. Oder waren nur Sekunden vergangen?
Ein sternklarer Himmel wölbte sich über uns, der Mond stand im Zenit – wie friedlich, wie höhnisch! – im Rückspiegel zwei Scheinwerfer, dann ein dritter, dann ein vierter.
Sie lagen jetzt viel weiter hinter mir, als auf dem Forstweg kurz vor der Schranke. Die Ahnung, es schaffen zu können, beflügelte mich; und die Hoffnung, sie würden die falsche Richtung wählen, auch. Siebenundachtzig Stundenkilometer zeigte der Tacho. „Schneller, Jörgensen, schneller!“
Todesangst schien die Frau hinter mir im Griff zu haben; die Frau, mit der mich ein merkwürdiges Schicksal zusammengeschmiedet hatte. Aber klar, ich verstand sie gut; auch ich wollte in diesen Sekunden nur eins: überleben.
Meine Hoffnung wurde enttäuscht – die Scheinwerfer im Rückspiegel näherten sich wieder. „Mist!“ Ich brüllte meinen Frust und meine Panik heraus. „Der Teufel soll diese Scheißkerle holen!“
Eine Kurve, nicht scharf aber langgezogen. Ich nahm Gas weg, trat kurz und kräftig auf die Bremse – Reginas Körper schob mich fast auf den Tank. In bedenklicher Schräglage fegten wir in die Kurve. Ich gab wieder Gas.
Schnell gerieten wir aus dem Blickfeld der Verfolger, ihre Scheinwerfer verschwanden aus dem Rückspiegel. Ich drehte den Gashahn auf und schaltete das Licht an. Der Scheinwerferkegel riss ein Maisfeld aus der Dunkelheit. Zu beiden Seiten säumte es die Straße, mehr als mannshoch standen die Halme.
Hinein!, raunte meine innere Stimme. Nichts wie hinein!
Die Einmündung eines Feldweges tauchte im Fernlicht auf. Hart bremste ich ab, Regina schrie hinter mir. Sie schien in mein Hemd und meinen Rücken zu beißen, denn mir wurde seltsam warm zwischen den Schulterblättern.
Ich musste den rechten Fuß auf den Asphalt setzen, so schräg lag die Harley Davidson für Augenblicke auf dem Asphalt. Als hätte ich mein Leben lang ein Motorrad gesteuert, drehte ich das Gas auf: Die Maschine machte einen Satz, richtete sich wieder auf und flog in den Feldweg hinein.
Wir wurden durchgeschüttelt, Schlaglöcher und Feldsteine rasten mir so rasch entgegen, dass ich nicht ausweichen konnte. Bald ein schmaler Grasstreifen, links zwischen zwei Maisfeldern. Das Blau von Kornblumen und das Rot von Klatschmohn leuchtete im Scheinwerferkegel auf.
Wieder auf die Bremse, weg mit dem Gas und herum mit der Maschine. Schon pflügten wir über den Grasstreifen. Hundert, hundertfünfzig, vielleicht auch zweihundertfünfzig Meter weit – was weiß denn ich! Irgendwann jedenfalls drückte ich den Lenker nach rechts, im nächsten Moment klatschten uns Blätter und harte Halme ins Gesicht, und Maiskolben knallten uns an Knie und Stirn.
Ich ging vom Gas, drehte den Zündschlüssel um, und ließ die Maschine ausrollen.
9
Sie fuhren vorbei, einer nach dem anderen. Atemlos vor Anspannung hockten wir zwischen den Maishalmen, lauschten dem an- und abschwellenden Motorenlärm. Das Gebrüll der vier Maschinen hörte sich an, als wären gigantische Hornissen auf nächtlichem Beutezug; sehr, sehr wütende Hornissen. Nach und nach verlor sich ihr Brummen in der Ferne.
„Jesus“, stöhnte Regina neben mir. „Wir haben es geschafft … ich glaub es nicht, wir haben es tatsächlich geschafft …“
Ihre Stimme brach. Sie drängte sich an mich, klammerte sich an mir fest und weinte in mein Hemd.
„Ist ja gut“, flüsterte ich. „Ist ja gut …“ Ich hielt sie fest und streichelte ihr Haar. Es fühlte sich weich und feucht an.
Was für eine absurde Situation: Stand ich nicht gerade eben noch auf dem Außendeck eines Hausbootes? Saß ich nicht gerade eben noch in meinem Sportwagen und fuhr Richtung Fuhlsbüttel, um meinen Freund vom Flughafen abzuholen? Erzählte mir nicht vor wenigen Augenblicken ein fünfzig Jahre alt gewordener Mann, er wolle durch die Elbe schwimmen und ich solle ihn bitteschön begleiten, damit er nicht absoff?
Und nun lag ich in einem Maisfeld, hielt eine wildfremde, weinende Frau in den Armen und kam mir vor, als wäre ich bis weit über die Mitte des Jordans geschwommen und im allerletzten Moment doch noch umgekehrt.
Eine Zeit lang lagen wir im Maiswald und hielten uns fest. Regina weinte, ich schwieg und streichelte sie. Langsam, ganz langsam erfasste mein Bewusstsein, was geschehen war. Was mir wie ein böser Traum erschien, wurde allmählich zur Wirklichkeit. Mein Verstand begann wieder zu arbeiten, ich sondierte die nackten Fakten.
Jemand hatte meinen Sportwagen gestohlen. Das Magazin meiner Dienstwaffe war leer. Ich hatte mein Handy verloren. Ein paar Kilometer entfernt – ich hoffte, dass ich mich darin nicht täuschte – ein paar Kilometer entfernt raste eine Motorradgang durch die Nacht und suchte mich und die Frau mit den blond gefärbten Haaren.
Von dieser Frau in meinen Armen wusste ich wenig mehr, als dass sie Regina hieß, eine vermutlich einfach gestrickte Rockerseele war, und nur durch einen lächerlichen Zufall noch lebte.
Roy fiel mir ein. War er schon gelandet? Stand er vor der Flughalle und wartete auf mich? Ohne Regina loszulassen, knipste ich die Zifferblattbeleuchtung meiner Armbanduhr ein, beugte mich über die Schulter der Frau, und blickte auf die Uhr: kurz vor zwei.
Himmel! Schon zwei Stunden war es her, dass ich meinen Sportwagen von der Elbe weg Richtung Flughafen steuerte? Ich konnte es kaum glauben.
Anderthalb Stunden her also, dass Roy gelandet war. Und über eine Stunde, dass er aus der Flughalle trat, um auf mich zu warten. Besonders geduldig war er nicht, mein Partner. Wenn es hochkam, hatte er zwanzig Minuten gewartet, bevor er zum Telefon griff.
Regina löste sich von mir, schniefte und kramte ein Taschentuch aus ihrer Wildlederhose. Sie schnäuzte sich. In der Dunkelheit sah ich nur die scharf geschnittenen Konturen ihres Gesichts. Das Mondlicht glänzte in ihren feuchten Augen.
Auch sie sah mich an, jedenfalls kam es mir so vor. Ihre Hand fuhr flüchtig über meine Wange. „Danke“, sagte sie. „Danke, Jörgensen.“
Was hätte ich antworten sollen? Dass es mir lieber gewesen wäre, ihren Schrei aus dem nächtlichen Wald nicht gehört zu haben? Ich sagte gar nichts.
Wenn es jetzt also kurz vor zwei und Roys Maschine pünktlich gelandet war, dann hatte mein Partner längst auf dem Hausboot angerufen. Irgendjemanden, Oliver, Tobias, den Chef, ganz egal.
Und weiter: Dann würden meine Kollegen inzwischen wissen, dass ich nicht beim Flughafen angekommen war. Also suchten sie nach mir.
Natürlich, ganz klar: Die Polizisten in Hamburg-Mitte hielten längst Ausschau nach einem Sportwagen. Vielleicht fuhren Alex und der Chef sogar die Strecke zum Flughafen ab.
So musste es sein, ganz bestimmt! Auch wenn es mir im Moment nichts nützte: Der Gedanken allein setzte meine Kraftreserven frei. „Hast du ein Handy?“, fragte ich Regina.
„Nein. Hast du eine Zigarette?“
„Nein.“ Zum ersten Mal fiel mir ihr Akzent auf. Sie sprach besseres Deutsch, als ich es von einer Rockerbraut erwartet hätte, kein Dialekt, kein armseliger Wortschatz oder so. Aber dennoch: Der harte Akzent war nicht zu überhören.
„Schade“, sagte sie.
Ich dachte nach. Ein Maisfeld – wo ein Maisfeld war, konnte ein Bauernhof nicht weit sein, und wo ein Bauernhof war, musste es auch ein Telefon geben …
„Komm.“ Ich stand auf. „Wir sind hier zwar nicht in Mitte, aber die Gegend ist dicht besiedelt. Irgendwo in der Nähe muss es ein Anwesen, ein Haus, einen Hof geben.“
Ich richtete die Maschine auf. In der Ferne hörte ich wieder das Gehämmer von Rotoren. Wer war nicht alles unterwegs in dieser Nacht …
Ich warf die Harley Davidson an, Regina schwang sich widerspruchslos auf den hinteren Sattel. Wir fuhren aus dem Maisfeld, und dann den Feldweg entlang von der Straße weg. Irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl!
10
Ich weiß nicht mehr, wie lange wir bereits unterwegs waren, als ich das Licht entdeckte. Nicht lange jedenfalls, vielleicht fünfzehn oder zwanzig Minuten. Es sah aus wie ein erleuchtetes Fenster oder die Außenlaterne eines Hauses.
„Siehst du‘s auch?“ Über meine Schulter hinweg deutete Regina auf den matten Lichtschein in der Ferne. Ich nickte. „Vielleicht ein Bauernhof oder ein Wochenendhaus!“ Sie musste schreien, um sich gegen den Motorenlärm durchzusetzen.
Weiter ging es, vorbei an Getreidefeldern und Weiden. Die Harley Davidson schaukelte über den holprigen Weg, schneller als zwanzig, höchstens fünfundzwanzig Kilometer konnte ich nicht fahren.
Manchmal huschte ein Tier durch den Scheinwerferkegel über den Weg, Kaninchen meistens, einmal auch ein Fuchs. Der Mond hatte den Zenit längst überschritten und wanderte dem westlichen Horizont entgegen. Dort irgendwo musste der Elbe strömen.
Der Saturn leuchtete als hellster Stern am Himmel. Ich fragte mich, wie viele Hunderttausend Kilometer er zurückgelegt hatte, seit ich ihn vor etwa zwei Stunden zuletzt bewusst wahrgenommen hatte, unter dem oberen Rand meiner Windschutzscheibe. Und ich fragte mich, wohin diese Mistkerle meinen Sportwagen entführt hatten.
Das Licht war inzwischen ausgegangen, vielleicht ein Bewegungsmelder. Der Weg aber führte ungefähr in die Richtung, in der ich es zuletzt gesehen hatte.
Eine dunkle Linie schälte sich aus der Nacht, eine Mauer, kaum hüfthoch, ziemlich verwittert und mit Unkraut und Gras bewachsen. Ich steuerte die Maschine dicht heran und stellte den Motor ab. Nirgends ein Gatter, nirgends eine Lücke. Dafür flammte das Licht wieder auf.
Wir stiegen vom Sattel. „Das Licht ist nicht mehr weit entfernt“, sagte Regina. „Höchstens einen halben Kilometer.“
Die alte Mauer friedete eine Viehweide ein. Hinter ihr, nicht weit entfernt, sahen wir dunkle Schatten unter Bäumen liegen: Kühe.
Ich rieb mir meine schmerzenden Handgelenke. Es war kein Vergnügen gewesen, die schwere Maschine über Feldsteine und durch Schlaglöcher zu steuern. „Also los, gehen wir den Rest zu Fuß.“ Wir kletterten über die Mauer.
Der Boden war weich, das Gras knöchelhoch, immer wieder blickte Regina zurück. Sie zog die Schultern hoch und rieb die nackten Oberarme.
Wahrscheinlich fröstelte sie nicht nur wegen des spärlichen Stoffs auf ihrer Haut und der frischen Nachtbrise: Angst plagte diese Frau. Doch wen konnte das wundern nach der extremen Bedrohung, der sie ausgesetzt gewesen war?
Irgendwo aus dem Westen hörten wir Rotorenlärm eines Helikopters. Regina blickte in den Nachthimmel. Ich konnte nirgends ein Positionslicht entdecken.
„Hast du Angst, dass sie dich schon mit einem Hubschrauber suchen?“
Sie schüttelte sich, als würde sie frieren. Den Blick auf ihre Stiefelspitzen gesenkt stapfte sie neben mir her. Sie trug Motorradstiefel über den Wildlederhosen. „Ich hab Angst, geht das nicht in deinen Bullenschädel rein?“
Wieder fiel mir ihr harter Akzent auf. „Was ist das für Akzent?“
„Meine Großeltern stammen aus Warschau. Meine halbe Kindheit habe ich bei ihnen verbracht. Sie sagen, ich würde Deutsch mit polnischem Akzent sprechen.“
„Und diese Rockerbande? Wie bist du in diese Kreise geraten, Regina?“
„ In diese Kreise geraten.“ Sie lachte bitter auf. „Ich gehöre eben dazu, schon immer.“
„Die Kerle trugen kein Emblem oder was auf dem Rücken. Normalerweise führen doch diese Motorradbrüder immer ihr eigenes makabres Wappen?“
Sie zuckte nur mit den Schultern. Merkwürdig wortkarg blieb sie. Hatte sie irgendetwas zu verbergen?
Ich betrachtete sie von der Seite. Ihre Gesichtszüge waren nicht zu erkennen, aber ihre Kaumuskulatur sah ich zucken. Abgesehen von den hochgezogenen Schultern ging sie auffällig gerade, etwas Lauerndes, Angespanntes lag in ihrer Art, sich zu bewegen; und im Minutentakt blickte sie sich um.
„Hey, Mädchen! Lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen – ich will wissen, was die Burschen gegen dich haben. Wenn ich dich richtig verstanden habe, glaubst du, dass sie dich nicht nur vergewaltigen wollten?“
Sie nickte grimmig. „Stimmt.“
„Sie wollten dich töten?“
„Stimmt genau.“ Sie kickte einen vertrockneten Kuhfladen in die Dunkelheit.
„Warum, zum Henker?“ Schon wieder erlosch unser Licht. Aber ich ahnte schon die Konturen eines Gebäudekomplexes, zu dem es gehörte, vielleicht drei-, vierhundert Meter entfernt.
„Und was für ein Ding wollte der Kerl von dir? Er hat dich geschlagen und nach einem verdammten Ding gefragt, ich habe es gehört.“
„Sie wollten mich töten. Deswegen trugen sie auch schwarze Lederjacken über den Westen mit ihrem Emblem. Sie wollten nicht erkannt werden.“ Wich sie aus? Wenigstens bemühte sie sich um einen zusammenhängenden Satz. „Die Totenjäger tragen einen goldenen Totenschädel als Wappen.“
„Paradiesisch, und sehr interessant. Nur war das nicht meine Frage. Was für ein Ding wollten sie von dir, und warum wollten sie dich töten?“
„Ach, Mist!“ Wieder flog ein Kuhfladen in hohem Bogen durch die Dunkelheit. „Ich ging mit Micky, weißt du? Ziemlich lang schon, fast zwei Jahre. Und dann habe ich mich in Jacko verknallt.“
„Jacko?“
„Jacko Kämmerer, einer der beiden Bosse der Evil Angels drüben in Langenhorn. Die Totenjäger betrachten Fuhlsbüttel und Niendorf als ihr Revier. Das grenzt südlich an Langenhorn an, du weißt doch.“
Ich nickte. Anders als Hamburg-Mitte kannte ich Langenhorn zwar nicht halb so gut wie meinen Kühlschrank, aber das wusste ich. „Na und?“
„Beide Gangs führen einen Dauerkrieg. Nie davon gehört? Und ich blödes Weib verknall mich also in Jacko, den Häuptling der Angels. Selbst Schuld.“
„Und deswegen wollte dieser – wie hieß der Scheißkerl gleich? – dieser Micky dich umbringen?“ Ihre Story klang ein bisschen nach Kindergartengequengel.
„Er hat mich mit Jacko im Bett erwischt.“
Kurz vor uns zeichneten sich Konturen einer Art Turm im Mondlicht ab, ein Silo, wie sich bald herausstellen sollte.
„Jacko ist Muskelpaket, weißt du? Ein baumlanger Schwarzer. Er ist aus dem Bett gesprungen und hat Micky windelweich geprügelt. Dabei hätte es umgekehrt laufen müssen.“
Tatsächlich Kindergartengeschichten also. Sie schienen mir irgendwie nicht zu dieser Frau zu passen. Wir erreichten das Silo. Kurz davor ein Holzzaun mit einem Gatter.
„Ich hatte eine zweiundzwanziger auf dem Nachttisch liegen.“ Einmal beim Erzählen, fand Regina offenbar Spaß an ihrer Story. „Nach Mickys Meinung hätte ich Jacko umlegen müssen. Hab ich natürlich nicht getan. Also war ich für Micky und seine Leute nicht nur eine Hure, sondern auch eine Verräterin. Auf Verrat steht der Tod. Ist das im deutschen Gesetz nicht genauso?“
„Nicht ganz.“
Ich öffnete das Gatter. Ein Hof weitete sich vor uns: Flache Gebäude, wahrscheinlich Stallungen, und ein zweistöckiges Gebäude, das schon im Halbdunkeln viel zu prächtig für ein simples Farmhaus wirkte. Zwei Wagen standen neben dem Eingang.
„Sie haben mich gestern Abend vor einer Kneipe in Langenhorn gegriffen. Und dann gefesselt und geknebelt in den Beiwagen gesteckt und rüber nach Mitte und hinauf nach Fuhlsbüttel verfrachtet. Den Rest kennst du ja.“
Und ob ich den kannte. „Eine ganz banale Motorradgang-Story also.“ Seite an Seite schritten wir über den Hof.
„Kann man so sagen, ja. Aber eine ziemlich blutige, find‘st du nicht?“
„Ich sag doch: banal.“
„Er wollte, dass mich die ganze Gang durchbumst. Und dann wollte er mir eigenhändig die Kehle durchschneiden.“ Sie zog ein Stilett aus der Hosentasche. Ein Daumendruck, und die Klinge sprang aus dem Griff. „Damit.“
An der Klinge und am Griff klebte noch Blut. Das Blut ihres im doppelten Wortsinn verflossenen Liebhabers. Mich fröstelte.
„Okay, Regina. Jetzt weiß ich, warum sie dich töten wollten. Und jetzt verrätst du mir noch, was das für ein Ding ist, das sie dir abnehmen wollten. Immerhin hab ich meine Haut für dich riskiert …“
Über der Vortreppe zum Eingang flammte Licht auf und tauchte den Hof, ein paar Blechtonnen, einen weißen Audi und einen roten Ford in helles Licht – und eine Jugendstilfassade, die ich unter anderen Umständen vermutlich wunderschön gefunden hätte. Wir blieben stehen, als hätte uns jemand ein Stopp! zugerufen.
„Ein Bewegungsmelder“, flüsterte Regina.
„Braucht man, wenn man so abgelegen wohnt.“
An die anderen Dinge, die man braucht, wenn man so abgelegen wohnt, dachte ich nicht. Wie dumm! Denn eines davon brachte sich Sekunden später mit einem Geräusch in Erinnerung, das mir den Atem in den Lungen gefrieren ließ: Es knurrte.
Regina griff nach meiner Hand. Langsam drehten wir uns um – sehr langsam, als würden wir auf viel zu dünnem Eis stehen.
Und genau das taten wir, wenn auch nur bildlich gesprochen. Was heißt hier: nur. In diesem Augenblick wäre ich gern auf zu dünnem Eis gestanden. Denn drei oder vier Schritte vor uns senkte ein Rottweiler seinen breiten Schädel, ein schwarz-braunes, massiges Kraftpaket. Der Hund fletschte die Zähne und knurrte böse …
11
„Entspann dich, Kumpel, okay? Atme dreimal tief durch und entspann dich …“
Ich redete mit Engelszungen, sanft und mit meinem einfühlsamsten Don-Juan-Bariton. Aber das Biest dachte nicht dran, sich zu entspannen: Es knurrte nur noch mehr.
Schleim triefte von seinen Lefzen. Die feucht-roten Ränder seiner gleichgültig starrenden Augen glänzten im Schein der Außenbeleuchtung. Immer wieder duckte der Hund sich wie zum Sprung. Dieser verdammte Rottweiler schien zu der Sorte Hund zu gehören, die keinen Spaß verstanden. Wir wagten nicht, uns zu rühren.
„Ganz ruhig bleiben, Hund, ganz cool, ja?“ Ich bildete mir ein, der Hund würde auf keine dummen Gedanken kommen, solange ich nur redete. Also redete ich, ließ heraus, was mir gerade in den Sinn kam. Ich schätze, es beruhigte mich mehr als den Rottweiler.
Stocksteif stand Regina neben mir. Sie biss sich auf die Unterlippe, ihre feuchte Hand war eine Klammer um mein Handgelenk. Sie sprach kein Wort.
„Es ist gar nichts, Hund, damit wir uns recht verstehen, überhaupt nichts. Wir lieben dich, ganz im Ernst.“
Stillstehen war angesagt, ganz still – so viel wusste ich noch aus meiner Kindheit über Wachhunde: Ja keine abrupten Bewegungen, und schon gar nicht versuchen wegzulaufen.





























