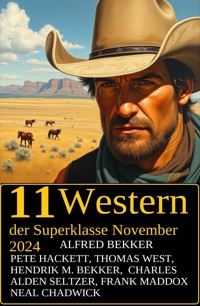
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Dramatische Geschichten aus der Zeit des Wilden Westens – harte Männer, aufregegende Saloongirls, blutige Fehden und eiskalte Gunslinger – darum geht es in den Geschichten dieses Buches. Dieses Buch enthält die Western-Geschichten: Pete Hackett: Todestrail Hendrik M. Bekker: Das blutige Gold der Kowaja-Berge Pete Hackett: McQuade – auf Gedeih und Verderb Alfred Bekker: Die wilde Brigade Pete Hackett: Jim Garretts tödlicher Schwur Pete Hackett: Gefährliche Erbschaft Thomas West: Der Rächer von Carson City Charles Alden Seltzer: Als das Gesetz kam Frank Maddox: Grainger und die Wüstenratten Neal Chadwick: In Abilene ist der Teufel los! Neal Chadwick: Die Bankräuber von Mesquite
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1079
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
11 Western der Superklasse November 2024
Inhaltsverzeichnis
11 Western der Superklasse November 2024
Copyright
Todestrail
Das blutige Gold der Kowaja-Berge
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
McQuade – auf Gedeih’ und Verderb
Über den Autor
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Die wilde Brigade
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Jim Garretts tödlicher Schwur
Gefährliche Erbschaft
Der Rächer von Carson City
Als das Gesetz kam
Grainger und die Wüstenratten
In Abilene ist der Teufel los!
Die Bankräuber von Mesquite
11 Western der Superklasse November 2024
Von Frank Maddox, Neal Chadwick, Alfred Bekker, Pete Hackett, Hendrik M. Bekker, Thomas West, Charles Alden Seltzer
Dramatische Geschichten aus der Zeit des Wilden Westens – harte Männer, aufregegende Saloongirls, blutige Fehden und eiskalte Gunslinger – darum geht es in den Geschichten dieses Buches.
Dieses Buch enthält die Western-Geschichten:
Pete Hackett: Todestrail
Hendrik M. Bekker: Das blutige Gold der Kowaja-Berge
Pete Hackett: McQuade – auf Gedeih und Verderb
Alfred Bekker: Die wilde Brigade
Pete Hackett: Jim Garretts tödlicher Schwur
Pete Hackett: Gefährliche Erbschaft
Thomas West: Der Rächer von Carson City
Charles Alden Seltzer: Als das Gesetz kam
Frank Maddox: Grainger und die Wüstenratten
Neal Chadwick: In Abilene ist der Teufel los!
Neal Chadwick: Die Bankräuber von Mesquite
Copyright
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Todestrail
Pete Hackett
Der Kopfgeldjäger Band 47:
Todestrail
Western von Pete Hackett
Unter dem Pseudonym Pete Hackett verbirgt sich der Schriftsteller Peter Haberl. Er schreibt Romane über die Pionierzeit des amerikanischen Westens, denen eine archaische Kraft innewohnt, wie sie sonst nur dem jungen G.F.Unger eigen war – eisenhart und bleihaltig. Seit langem ist es nicht mehr gelungen, diese Epoche in ihrer epischen Breite so mitreißend und authentisch darzustellen.
Mit einer Gesamtauflage von über zwei Millionen Exemplaren ist Pete Hackett (alias Peter Haberl) einer der erfolgreichsten lebenden Western-Autoren. Für den Bastei-Verlag schrieb er unter dem Pseudonym William Scott die Serie „Texas-Marshal“ und zahlreiche andere Romane. Ex-Bastei-Cheflektor Peter Thannisch: „Pete Hackett ist ein Phänomen, das ich gern mit dem jungen G.F. Unger vergleiche. Seine Western sind mannhaft und von edler Gesinnung.“
Hackett ist auch Verfasser der neuen Serie „Der Kopfgeldjäger“. Sie erscheint exklusiv als E-book bei CassiopeiaPress.
Ein CassiopeiaPress E-Book
© by Author www.Haberl-Peter.de
© der Digitalausgabe 2013 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
Der Bluebird Saloon in Lowell war brechend voll. Der Lärm, den die zum Teil stark angetrunkenen Gäste verursachten, war nahezu unerträglich. Um die Lampen wogte dichter Tabakqualm. Einige grell geschminkte Girls animierten die Männer in ausgesprochen freizügiger Art zum Trinken und versprachen ihnen mit gekonntem Augenaufschlag für ein paar Dollar den Himmel auf Erden.
Der Saloon glich einem Hexenkessel. Nur einen Steinwurf von der mexikanischen Grenze entfernt gab sich hier eine Reihe zwielichtigen Gesindels gewissermaßen die Klinke in die Hand. Glücksritter, Abenteurer, Banditen und Huren lieferten sich in der Stadt ein Stelldichein, viele auf der Flucht vor ihrer Vergangenheit, andere auf der Flucht vor dem Gesetz.
Lowell war ein Sündenpfuhl, ein Sodom und Gomorrha an der mexikanischen Grenze, in dem der Dollar locker saß und ein Menschenleben nichts wert war.
McQuade saß an einem der runden Tische, vor ihm stand ein halb geleertes Glas Wasser. Gray Wolf lag zu seinen Füßen auf dem Fußboden. Der graue Wolfshund hatte den mächtigen Kopf mit dem Achtung gebietenden Fang zwischen die Vorderläufe gebettet und hielt die Augen geschlossen.
McQuade kümmerte sich nicht um das Treiben um ihn herum. Das Johlen, Grölen und brüllende Lachen der Angetrunkenen sowie das gezierte Kichern und Girren der Animiergirls erreichten lediglich den Rand seines Bewusstseins. Die ungeteilte Aufmerksamkeit des Kopfgeldjägers galt einem dunkelgesichtigen, indianerhaften Mann, der ein paar Tische weiter an einem Pokerspiel teilnahm. Sein Name war Black Steward. McQuade wusste, dass Steward zweiunddreißig Jahre alt war. Er hatte in Tubac einen Mann erschossen und wurde deshalb wegen Mordes gesucht. Dem Sheriff des Santa Cruz Countys war er fünfhundert Dollar wert.
McQuade war sich jedoch nicht sicher. Er war einige Tage nach der Schießerei zufällig nach Tubac gekommen und hatte sich ein wenig umgehört. Der überwiegende Teil der Einwohnerschaft Tubacs hielt Black Steward nicht für einen Mörder. Diese Leute waren vielmehr der Überzeugung, dass er sich lediglich seiner Haut wehrte. Allerdings war der Mann, den er tötete, der Sohn eines angesehenen Bürgers der Stadt.
Hier, in Lowell, hatte der Kopfgeldjäger den Gesuchten eingeholt. Nun versuchte er, sich ein Bild von ihm zu machen.
Black Steward verhielt sich unauffällig. Hin und wieder nippte er an seinem Bier. Er verströmte ein hohes Maß an Ruhe, und McQuade kam zu dem Ergebnis, dass es sich bei Steward um einen stillen Mann handelte, der nur schwer zu durchschauen war.
Gegen Mitternacht stieg der Geächtete aus dem Spiel aus, bezahlte seine Zeche und verließ den Saloon.
McQuade folgte ihm nach draußen. Steward stand am Geländer des Vorbaus. Die Luft war kühl und frisch. McQuade atmete tief durch. Steward wandte ihm den Rücken zu. Die rechte Hand des Kopfgeldjägers legte sich auf den Knauf des schweren, langläufigen Coltrevolvers, der tief an seinem Oberschenkel im Holster aus schwarzem Büffelleder steckte. Seine Stimme klirrte: „Deine Flucht ist zu Ende, Steward. Keine falsche Bewegung. Vergiss nicht, dass auf deinem Steckbrief tot oder lebendig steht.“
Black Steward stand steif wie ein Pfahl und schien den Worten hinterherzulauschen. Einige Sekunden verstrichen, in denen nichts geschah. McQuade war angespannt und wachsam, und von ihm ging die kalte Bereitschaft aus, notfalls den Revolver zu ziehen und zu schießen. Er hatte Black Steward in die Enge getrieben. Das machte diesen möglicherweise unberechenbar und tödlich gefährlich.
Jetzt ließ Steward seine Stimme erklingen, indem er hervorstieß: „Kommst du aus Tubac? Gehörst du zum Büro des Sheriffs?“
„Mein Name ist McQuade. Heb die Hände, Steward, und rühr dich nicht. Ich werde dir den Revolver wegnehmen und dich dann fesseln. Morgen früh brechen wir auf. Ich bringe dich nach Nogales zum County Sheriff.“
Langsam wanderten die Hände Stewards nach oben. Er hatte begriffen, dass er chancenlos war. Das Schicksal wollte er nicht herausfordern. Der Mann hinter seinem Rücken hatte keinen Zweifel offen gelassen, dass er kein Risiko eingehen würde.
McQuade trat hinter ihn und zog ihm den Sechsschüsser aus dem Holster, schob ihn hinter seinen Hosenbund und holte dann ein Paar Handschellen aus der Tasche seines zerschlissenen, braunen Staubmantels. Er bog erst Stewards linken, dann seinen rechten Arm nach unten, die Stahlsprangen klickten, McQuade sagte: „Sehr vernünftig von dir, dass du es nicht versucht hast. Es hätte mir widerstrebt, auf dich schießen zu müssen. Vorwärts, wird gehen zum Hotel.“
„Bist du McQuade, der Kopfgeldjäger?“, fragte Steward nun und drehte sich herum. Das Licht, das aus den beiden großen Frontfenstern des Saloons fiel, spiegelte sich in seinen Augen.
„Ja.“
„Ich habe von dir gehört. Man sagt, du seist ein Bluthund, der bisher noch jeden Mann gestellt hat, auf dessen Fährte er sich setzte.“
„Mag sein, dass man das sagt. Ich denke, den Weg zum Hotel kennst du. Also …“
Steward schritt vor dem Kopfgeldjäger her die Straße hinunter. Unter den Sohlen der beiden Männer knirschte der knöcheltiefe Staub der Main Street. Von irgendwo her wehte das Klimpern einer Gitarre. Der Lärm aus dem Saloon war zurückgeblieben und nur noch als fernes Summen vernehmbar.
Im Hotelzimmer kettete McQuade seinen Gefangenen an einen der Bettpfosten. Black Steward sagte: „Kennst du meine Geschichte, McQuade, oder hast du dich nur von dem leiten lassen, was auf dem Steckbrief steht?“
„Ich habe mich umgehört, Steward. Nicht alle Menschen in Tubac sind von deiner Schuld überzeugt.“ McQuade zuckte mit den Achseln. „Nun, es ist nicht mein Job, Schuld oder Unschuld eines Mannes festzustellen. Wenn du Norman Baxter in Notwehr getötet hast, wird dies das Gericht sicherlich feststellen und dich laufen lassen.“
„Baxter war ein dreckiger Bastard!“, erregte sich Black Steward. „Er wollte mich fertig machen. Als er seine schmutzigen Hände nach Mona ausstreckte, habe ich ihm eine gehörige Tracht Prügel verpasst. An dem Abend, als es zu der verhängnisvollen Schießerei kam, lauerte er auf mich. Er hatte ein Gewehr und drohte, mir das Hirn aus dem Kopf zu schießen …“
„Erzähl das alles dem Sheriff und gegebenenfalls auch dem Richter sowie der Jury, Steward. Ich bringe dich nur nach Nogales zum County Sheriff.“
„John Blackwell, der Sheriff, ist ein guter Freund von Sam Baxter. Und Sam Baxter will den Mann, der seinen Sohn getötet hat, hängen sehen. Blackwell wird wegschauen, wenn mich Baxters Kettenhunde aus dem Jail holen und mir einen Strick um den Hals legen.“
„Es gibt Männer in Nogales, die das nicht zulassen werden, Steward. Ich kenne Sam Baxter nicht, und ich habe keine Ahnung, wie einflussreich und mächtig dieser Mann ist. Wie auch immer – auch er wird sich nicht über das Gesetz hinwegsetzen können.“
Steward lachte sarkastisch auf. „Wenn du mich nach Nogales bringst, dann bin ich so gut wie tot. Von Tubac aus bis nach Nogales sind es nur etwas mehr als zwanzig Meilen. Baxter wird seine Mannschaft in die Sättel jagen und nach Nogales kommen. Und kein Mensch in Nogales wird einen Finger krumm machen, wenn mich diese Aasgeier unter den Galgenbaum zerren.“
*
McQuade und sein Gefangener befanden sich in der Felswildnis. Sie hatten etwa die Hälfte der Strecke nach Nogales hinter sich gebracht. Vor Ihnen lagen noch fünfzig Meilen. Das Land, das sie umgab, war von der sengenden Sonne ausgebrannt und staubig, die Vegetation bestand in dornigem Gestrüpp, Büschelgras und genügsamen Kakteen. Die Felsen waren vom Zahn der Zeit zerfressen und wiesen bizarre Formen auf. Gleißender Sand floss von den Abhängen in die Tiefe, der Boden war von Geröll übersät. Der Satan persönlich schien dieses Land geschaffen zu haben. Nur Eidechsen, Skorpione und Klapperschlangen trieben hier ihr Unwesen.
Es war um die Mitte des Nachmittags. Die Hitze war mörderisch und machte das Atmen zur Qual. Tags zuvor waren sie am frühen Morgen in Lowell aufgebrochen. Hinter ihnen lagen tausend Strapazen. Müde zogen die Pferde die Hufe durch den Staub. Der heiße Wind trieb Staubspiralen über den Boden. Die Luft flirrte und ließ die Konturen verschwimmen.
Plötzlich fiel McQuade dem Falben in die Zügel. Auch Black Steward parierte sein Pferd. Der Klang von Schüssen wehte heran. Weit vor ihnen schien ein heftiger Kampf ausgefochten zu werden. Die Detonationen verschmolzen ineinander und rollten heran wie fernes Donnergrollen, wie eine Botschaft von Untergang und Tod.
„Sehen wir nach!“, stieß McQuade entschlossen hervor.
Sie trieben die Pferde an und galoppierten in die Richtung, aus der der Kampflärm heransickerte. Im Hufgetrappel ging das ferne Grollen unter. Aber nur für kurze Zeit. Dann wurde es wieder deutlicher und übertönte schließlich die hämmernden Hufschläge. Außerdem wurde schrilles Geschrei vernehmbar; spitzes, durchdringendes und abgehacktes Geheul von heidnischer Grausamkeit, das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ.
McQuade zerrte sein Pferd in den Stand. Black Steward hielt ebenfalls an. Seine Hände waren vor dem Leib gefesselt. Die Handschellen hinderten ihn nicht, die Zügel zu führen. „Absitzen!“, gebot McQuade und zog mit einem Ruck die Henrygun aus dem Scabbard. Sie liefen den Hang hinauf, über den der Kampflärm herantrieb, und warfen sich oben zu Boden.
In der Ebene, die sich vom Fuß des Hügels aus nach Norden erstreckte, waren fünf Conestoga-Schoner zu einer Wagenburg zusammengefahren. Sie hob sich wie eine kleine, verlorene Insel in der Weite des Ozeans aus dem Grasland ab.
Etwa drei Dutzend Apachen jagten auf ihren Mustangs im Kreis herum. Langes, strähniges Haar flatterte blauschwarz im Wind, Gewehrläufe blinkten, Pfeile zogen eine flirrende Bahn. Die Krieger brüllten barbarisch und feuerten die Rohre heiß. Einige tote Indianer und Pferde lagen im Gras. Die Verteidiger der Wagenburg kämpften mit zäher Verbissenheit. Aufgewirbelter Staub und Pulverdampf vermischten sich und wölkten nebelhaft. Das gellende, markerschütternde Geheul erhob sich über das Tal und verschmolz mit schrillem Gewieher und rasendem Hufgetrappel zu einem höllischen Choral.
Hinter den schweren, eisenbereiften Rädern hervor verteidigten sich die Belagerten mit dem Mut der Verzweiflung. Mustangs brachen zusammen, überschlugen sich, und bildeten mit ihren Reitern ein wildes Durcheinander. Die Auswanderer jagten ihre Schüsse einfach in die heranwogenden Masse der Pferde und Reiter hinein, die einen geradezu lähmenden Eindruck von Wucht und Stärke vermittelten, den nur ein Mann mit starken Nerven ertrug. Aber der Kreis der Apachen lichtete sich nicht. Er zog sich im Gegenteil immer enger zusammen.
Hinter einem der Gefährte taumelte eine hagere Gestalt hervor. In ihrer Brust steckte ein Pfeil. Der Mann hielt das Gewehr im Hüftanschlag, schoss einen heranpreschenden Angreifer vom Pferd, kippte schließlich selbst vornüber und begrub die Waffe unter sich.
„Das sind Chiricahuas“, raunte Black Steward, und seine Stimme vibrierte vor Entsetzen. „Und sie werden erst aufhören, wenn sie alles Leben in der Wagenburg ausgelöscht haben.“
„Darum können wir nicht seelenruhig zusehen, wie sie sie abschlachten“, flüsterte McQuade.
„Schließ mir die verdammten Stahlbänder auf, McQuade!“, verlangte Black Steward mit gefestigter, entschlossener Stimme. „Und gib mir mein Gewehr.“
Der Kopfgeldjäger warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. „Wer garantiert mir, dass du mir nicht eine Kugel zwischen die Schulterblätter jagst und das Weite suchst?“, fragte er.
Black Stewards Mundwinkel verzogen sich. Er wischte mit dem Ärmel über die heiße Stirn. „Ich bin kein Mörder!“, fauchte er.
„Es gibt eine Reihe von Leuten, die anderer Meinung sind, allen anderen voran der Sheriff des Santa Cruz Countys.“
Black Stewards Augen funkelten. Aber er verbiss sich eine scharfe Antwort, denn McQuade kramte in seiner Tasche, und als seine Hand zum Vorschein kam, hielt sie den Handschellenschlüssel. Wortlos öffnete er die Fesseln. Sie fielen ins Gras. „Hol dein Gewehr, Steward“, gebot er. „Aber denk ständig dran, dass ich ein Auge auf dich haben werde. Vor allen Dingen solltest du nicht vergessen, dass auch Gray Wolf auf dich aufpasst.“
Black Steward rutschte ein Stück zurück, und als er von unten nicht mehr gesehen werden konnte, erhob er sich und rannte mit langen Sätzen zu den Pferden. Sein Gewehr steckte in McQuades Deckenrolle. Mit der Henrygun in der Armbeuge kam er nicht einmal eine halbe Minute später zurück.
Sie schoben die Läufe über den Rand des Hügels und zogen die Kolben an die Schultern. Über Kimme und Korn hinweg starrten sie hinunter in die Senke auf das um die zusammengefahrenen Schoner flutende, vom Vernichtungswillen beseelte Rudel. Ihre Finger krümmten sich, Feuer, Rauch und Blei stießen aus den Mündungen.
Black Steward sah einen der Mustangs vorn einbrechen, sein Reiter machte den Rücken hohl und warf die Arme hoch. Die folgenden Pferde prallten gegen das niedergehende Tier, und im Nu bildete sich ein Pulk ineinander verkeilter Pferde und Krieger. Und in dieses Knäuel hinein feuerten sie mit der Präzision von Maschinen. Mustangs stiegen, schlugen mit den Hufen, brachen aus und rasten mit wehenden Mähnen und gestreckten Schweifen in alle Himmelsrichtungen davon. Ihr angstvolles, panisches Wiehern gellte wie das Schmettern von Fanfaren an den Berghängen empor.
Wutgeschrei drang den Hang hinauf und ging den beiden Männern durch Mark und Bein. Ihre Schüsse fielen schnell und sicher. Ein wahres Bleigewitter prasselte in die Reihen der Apachen. Ihr mörderischer Angriff war ins Stocken geraten. Chaos und Panik griffen um sich.
Plötzlich aber schwärmten sie auseinander. Irgendeiner von ihnen hatte wohl seinen klaren Kopf behalten und einen entsprechenden Befehl hinausgeschrien. Wie ein Orkan kamen sie in einer auseinander gezogenen Linie die Hügelflanke herauf. Dort, wo die Schüsse der überraschend aufgetauchten unsichtbaren Gegner ihren Angriff gestoppt hatten, lagen tote Pferde und Krieger. Gnadenlos holte sie das heiße Blei aus der Wagenburg ein, unerbittlich raste ihnen von der Kuppe der Tod entgegen.
Eine gutturale, sich überschlagende Stimme war zu hören. Plötzlich rissen sie ihre Mustangs herum und flohen in östliche Richtung auf die nahen Hügel zu.
Wütendes Gewehrfeuer folgte ihnen, und der eine oder andere wurde noch vom Pferd geholt. Schließlich aber waren sie außer Schussweite, und die letzten Detonationen verebbten mit geisterhaftem Geflüster.
*
Die Apachen verschwanden zwischen den Hügeln im Osten. McQuade und Black Steward luden ihre Gewehre nach. Ihre Gesichter waren verschmiert vom Pulverschmauch, und das Weiße ihrer Augen bildete einen scharfen Kontrast dazu.
Aus der Wagenburg unten traten einige Männer. Hart umklammerten ihre Fäuste Gewehre und Revolver. Die Mündungen der Waffen zeigten auf den Boden.
„Reiten wir hinab?“, fragte Black Steward.
„Klar.“
Sie erhoben sich, rannten zu ihren Pferden und schwangen sich in die Sättel. Gleich darauf jagten sie über den Kamm und den Abhang hinunter. Drüben, zwischen den Hügeln und Felsen, rührte sich nichts - noch nicht. Aber sie wussten, dass hasserfüllte, glitzernde Augen jede Bewegung in der Ebene registrierten.
Die Männer vor den Wagen rissen die Waffen in die Höhe und winkten ihnen zu, vereinzelte Rufe wurden laut, mit denen sie ihre Retter begrüßten.
Sie waren noch gute hundertfünfzig Yards von den Prärieschonern entfernt, als aus einer Hügellücke die Apachen brachen. Ihr wütendes, zorniges und nervenzerrendes Kampfgeschrei stieß wie satanisches Gelächter über die Grasebene. Schüsse peitschten, Kugeln jaulten heran.
Ohne das Tempo ihrer Pferde zu drosseln feuerten McQuade und Black Steward zurück. Sie lenkten die Tiere mit den Schenkeln. Gray Wolf schnellte kraftvoll neben den Pferden her, seine Pfoten schienen kaum den Boden zu berühren.
Die Männer des Wagenzugs sprangen fluchend hinter ihre Deckungen.
Heiß streifte ein Projektil McQuades Oberarm, ein anderes strich über die Kruppe des Falben. Er vollführte einen erschreckten Satz und der Kopfgeldjäger hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten und nicht vom Pferd zu stürzen. Mit Windeseile näherten sie sich der Wagenburg. Das Wutgeheul der Apachen hallte in ihren Ohren wider und jagte ihnen eisige Schauer den Rücken hinunter.
McQuade und Black Steward lagen jetzt fast auf den Hälsen ihrer Pferde und feuerten nicht mehr.
In der Wagenburg schrien die Menschen und schossen, was das Zeug hielt.
„Zur Seite!“, brüllte ein mittelgroßer, bärtiger Mann. „Macht den Weg frei!“
Männer hasteten auseinander.
Die Fuhrwerke schienen auf McQuade zuzufliegen. Er stob auf eine Lücke dazwischen zu. Da war eine Deichsel. McQuade zerrte an den Zügeln, der Pferdeleib streckte sich, hing einen Moment in der Luft, und schon kam der harte Aufprall der Hufe, der Ruck, der durch Mann und Pferd ging. Dicht neben ihm setzte das Pferd Black Stewards auf. Sie preschten über den Platz zwischen den Schonern und schlugen einen Bogen, warfen den Oberkörper zurück und stemmten sich mit aller Kraft gegen die Zügel. Doch das Tempo war zu groß. Die bremsenden Hufe des Pferdes zogen tiefe Furchen in den Boden.
Die Apachen schwenkten mit kehligem Wutgeschrei ab und sprengten zurück zu den Bergen.
McQuade wischte sich über die Augen, dann ließ er sich aus dem Sattel rutschen.
Menschen kamen heran. Auch Black Steward saß ab. Sie sahen Rührung und Freude in den Augen der Leute, die noch vom Grauen gepackt waren, und mussten viele Hände schütteln.
„Bei allen Heiligen“, sagte der bärtige Mann, der wohl der Treckführer war, „nie zuvor in meinem Leben habe ich mich über das Auftauchen Fremder mehr gefreut als in dieser Stunde. Mein Name ist Shadoe Carson. Ihr habt uns das Leben gerettet.“
„Warten wir es ab“, entgegnete McQuade dumpf, und sofort erlosch die Freude in den pulvergrauen Augen Carsons. Die drei Worte beinhalteten eine düstere Prophezeiung.
„Sie haben recht“, bestätigte Carson mit rauem Tonfall. „Die Rothäute stecken drüben zwischen den Felsen und Hügeln und warten nur darauf, uns doch noch den Garaus machen zu können. Sie sind wie die Flöhe im Fell eines Hundes. Wenn sie dir mal auf dem Pelz sitzen, bringst du sie erst wieder los, wenn du sie zerdrückst.“
McQuades Blick glitt über die Männer, Frauen und Kinder hinweg, die sich um sie scharrten. „Ich frage mich“, begann er, „was ein Wagentreck in dieser gottverlassenen Gegend zu suchen hat, weitab von jedem Trail.“
Ein bitteres Lächeln kerbte sich in die Mundwinkel Shadoe Carsons. „Ihre Frage ist berechtigt, Mister. Es war mehr oder weniger meine Schuld. Wir kommen von Fort Bliss. Zunächst möchten wir hinauf nach Tucson, um uns von dort aus nach Nordwesten zu wenden. An der Grenze nach Utah hoffen wir auf den Oregon Trail zu stoßen. Natürlich hätten wir diese Route an der mexikanischen Grenze entlang nicht genommen, wenn sich nicht alle hier damit einverstanden erklärt hätten. Nun, um ein Haar hätte es unseren Untergang bedeutet, denn wir rechneten nicht mit den aufrührerischen Apachen.“
McQuade atmete scharf ein. „Das war der pure Leichtsinn, Mr. Carson“, erklärte er ohne die Spur von Freundlichkeit im Tonfall. „Sie haben mit Ihrer Wahnsinnsidee das Leben all dieser Menschen hier aufs Spiel gesetzt.“
Carson errötete. „Ich weiß, Mister“, gab er kleinlaut zu. „Aber ohne das Einverständnis aller …“
McQuade winkte ungeduldig ab. „Für Rechtfertigungen ist jetzt keine Zeit“, stieß er schroff hervor. „Cochises wilde Jungs können jeden Augenblick zurückkommen. Wir sollten uns auf ihren Angriff vorbereiten.«
Die Gesichter ringsum drückten Angst und Schrecken aus. Irgendwo weiter hinten weinte und schluchzte eine Frau.
Black Steward musterte McQuade von der Seite. Dessen Züge waren wie versteinert. In Stewards Miene arbeitete es. Vielleicht fragte er sich, was wohl im Kopf dieses eisenharten Kopfgeldjägers vor sich gehen mochte. Langsam wandte er sich ab.
McQuades Stimme holte ihn ein.
„Du bleibst in meiner Nähe, Steward! Wenn du dich weiter als zwei Schritte von mir wegbewegst, kannst du damit rechnen, dass ich es als Fluchtversuch deute.“
Black Steward vollführte eine halbe Körperdrehung, nahm den verdutzten Carson wahr und meinte kratzend, zugleich aber hohnvoll: „Keine Sorge, McQuade. Ich bin dir sicher. Ich ziehe nämlich deine Gesellschaft dem Abgeschlachtet werden durch die Chiricahuas vor. Was dagegen, wenn ich mich nun um mein Pferd kümmere?“
McQuade sah ihn nur durchdringend an, und so ging Black Steward endgültig davon.
„Ist der Mann Ihr Gefangener?“, erkundigte sich Carson.
„Ja“, antwortete McQuade knapp, ließ den Treckführer stehen und stapfte ebenfalls zu seinem Pferd.
*
Das Land wirkte leer, aber die scheinbar so friedliche Stille war trügerisch und gefährlich. Eine unheilvolle Spannung füllte die Atmosphäre. Der Hauch von Gefahr, Gewalt und Tod lag in der Luft.
Zwischen den vom Sonnenlicht überfluteten Hügeln und Felsen im Osten regte sich keine Spur von Leben. Es war, als wären die Apachen vom Erdboden verschluckt worden.
Die Verteidiger der Wagenburg warteten in dumpfer Anspannung. Sie unterhielten sich - wenn überhaupt - nur noch unterdrückt und flüsternd. Niedergeschlagenheit und die Furcht vor dem Ungewissen, vor den kommenden Stunden, prägten ihre Gesichter und flackerte tief im Hintergrund ihrer Augen.
In den Schatten der Prärieschoner standen Posten mit den schussbereiten Gewehren in den Händen.
Die Minuten verrannen in zäher Langsamkeit.
Außerhalb des Camps lagen verstreut die getöteten Apachen und einige Pferdekadaver. Schwärme von Mücken, angezogen vom süßlichen Blutgeruch, hatten sich auf sie gestürzt. Hoch oben zogen Geier ihre lautlosen Bahnen.
Zur Bedrücktheit im Lager gesellte sich mehr und mehr die Ungeduld. Die Stimmung wurde gereizt. Es war, als fieberten die Eingeschlossenen der Entscheidung entgegen.
McQuade ging durchs Camp, wechselte mit diesem oder jenem Mann einige Worte und bemühte sich, Ruhe und Besonnenheit zu vermitteln. Shadoe Carson trat an ihn heran und sagte mit brüchiger Stimme: „Diese roten Bastarde wollen uns mürbe machen, McQuade.“ Er schniefte. „Was denken Sie, wann werden sie kommen?“
„Spätestens mit der Abenddämmerung“, gab der Kopfgeldjäger verdrossen Auskunft. Gerade verschwand auf der anderen Seite Black Steward hinter einem der Fahrzeuge. McQuades linke Braue zuckte in die Höhe, der Kopfgeldjäger erhob sich ruckartig.
Carsons belegte Stimme erklang: „Was hat der Mann verbrochen. Wieso ist er Ihr Gefangener? Ich sehe keinen Stern an Ihrer Brust.“
McQuade zögerte kurz, dann knurrt er. »Er hat einen Mann erschossen. Das Gesetz sucht ihn. Ich habe ihn gestellt und bin auf dem Weg nach Nogales zum County Sheriff. Zufrieden?«
Carson schaute betreten zur Seite. Dieser hohlwangige, wortkarge Mann verunsicherte ihn.
Nun tauchte Black Steward wieder auf und näherte sich ihnen. Der Schaft der Henrygun lag in seiner Armbeuge, den Kolben hatte er sich unter die Achsel geklemmt. Ein trübes Grinsen zog über sein Gesicht, als er heran war, dann sagte er: „Keine Spur von den Rothäuten. Wahrscheinlich hocken sie zwischen den Steinklötzen und lecken sich ihre Wunden.“
„Vielleicht sind sie auch schon längst fort!“ Eine fast verzweifelte Hoffnung schwang in Carsons Tonfall.
McQuade lachte klirrend auf. „Sie sind da. Und ihren Spähern entgeht keine unserer Bewegungen.“
„Hatten Sie schon mal mit den Apachen zu tun?“ fragte Black Steward und fixierte Carson.
„Nein.“ Der Treckführer schüttelte den Kopf. „McQuade meint, dass sie in der Abenddämmerung zuschlagen“, fügte Carson hinzu.
„Sicher ist, dass sie angreifen werden wenn sie uns ihrer Meinung nach genügend weich gekocht haben. Wann das sein wird, das weiß nur der Satan.“
„Wie schätzen Sie unsere Chancen ein?“ Carsons Stimme vibrierte.
Black Steward zuckte vage mit den Achseln. Er bemerkte den verstörten Gesichtsausdruck Carsons und antwortete vorsichtig: „Ich denke, dass wir eine Chance haben.“ Es klang nicht sehr überzeugend. Etwas gefestigter sprach er weiter: „Die Chiricahuas haben sich beim ersten Ansturm blutige Köpfe geholt, und das wird sie das nächste Mal Vorsicht walten lassen. Außerdem handelt es sich nur um eine kleine Gruppe von etwas mehr als dreißig Kriegern, die sich zwischen die Felsen retten konnten. Wenn sie angreifen, müssen sie etwa zweihundert Yards flachen Terrains überwinden. Das heißt, sie können uns nicht überraschen. Und das ist unsere Chance.“
„Es fragt sich nur, wie lange wir standhalten können“, mischte sich McQuade ein. „Wie viele Männer befinden sich im Lager?“, wandte er sich an Carson.
„Mit Ihnen beiden dreizehn. Insgesamt sind wir siebenundzwanzig Leute.“
„Notfalls müssen eben auch die Frauen und Halbwüchsigen Waffen nehmen und die Wagenburg verteidigen“, sagte der Kopfgeldjäger nicht ohne Besorgnis.
Da sah Black Steward über einem der Wagendächer in der Ferne eine Rauchsäule emporsteigen. Seine Brauen zogen sich zusammen. Und das erregte die Aufmerksamkeit McQuades. Sein Kopf ruckte herum und seine Züge verkniffen sich.
Die Rauchsäule brach jäh ab, wölkte am Himmel auseinander und zerflatterte. Eine neue schmale Säule stieg auf, kerzengerade und dunkel, wurde unterbrochen, kam erneut …
Sie zählten viele Rauchfahnen, die in gewissen Abständen zum Firmament aufstiegen und sich zu einer dichten Schwade vereinten, die trage nach Süden trieb.
„Rauchzeichen!“, flüsterte Carson geradezu ehrfürchtig. „Was haben sie zu bedeuten?“
„Genau weiß ich das auch nicht“, antwortete Black Steward. „Aber ich kann mir denken, dass sie damit ihre Stammesbrüder, die in größeren und kleineren Horden durch das Land streunen, anlocken wollen.“
„Yeah“, bestätigte McQuade mit gepresst klingender Stimme. „Der Meinung bin ich auch. Das heißt, dass die Chiricahuas noch einige Tage mit uns diesen Nervenkrieg führen können, bis sie sich stark genug fühlen, uns zu überrennen.“
„Jemand müsste versuchen, nach Nogales durchzubrechen“, schlug Black Steward vor, ohne auf McQuades Worte einzugehen. „Aus der Stadt könnte man uns Hilfe schicken.“
Der Kopfgeldjäger blickte ihn an, als zweifelte er an seinem Verstand und entgegnete schließlich bissig: „Derjenige, der versucht, das Lager zu verlassen, kann sich gleich eine Kugel durch den Kopf schießen. Das wäre die gnädigere Art von Selbstmord.“
Weitere Männer kamen heran. Auch ihnen waren die Rauchzeichen nicht verborgen geblieben. Einige von ihnen hatten McQuades Worte vernehmen können. Einer rief kummervoll: „Warum versuchen wir nicht, uns mit den Apachen friedlich zu einigen? Geben wir ihnen alles, was wir entbehren können. Soviel ich gehört habe, sind die Rothäute doch ganz wild auf Geschäfte mit den Weißen.“
Black Steward lachte krampfhaft und sarkastisch auf.
„Nicht jene Rothäute, die sich Cochise angeschlossen haben. In ihren Herzen sitzt nichts anderes als der mörderische Hass auf alles, was eine weiße Haut hat. Was diese Burschen in ihren Herzen tragen, ist schlimmer als die Waffen in ihren Händen. Das einzige, was sie von uns wollen, sind unsere Skalps. Um sie zu bekommen, setzen sie sogar ihr Leben ein. Den Plunder, den Sie ihnen bieten können, Mister, bekommen sie mit ziemlicher Sicherheit sowieso, wenn ihre Rauchzeichen weitere Kriegerbanden anziehen wie das Licht die Motten.“
Der Mann erbleichte bis in die Lippen, die Angst und das Entsetzen zeichnete sich in den Zügen der anderen ab.
McQuade starrte in die Ferne, wo wieder Rauchzeichen zum Himmel stiegen. Und er sagte sich, dass es sicherlich nicht falsch war, diese Leute mit der unbarmherzigen Wahrheit zu konfrontieren. Andererseits aber überwog in ihm die Besorgnis, dass Black Stewards schonungslose Offenheit die würgende Furcht der Siedler nur noch schürte und sie kopflos und undiszipliniert werden ließ, wenn die Apachen zum alles vernichtenden Schlag ausholten.
*
Die Sonne stand weit im Westen. Die Schatten wurden länger. Die Menschen in der Wagenburg bereiteten sich auf den Angriff der Chiricahuas vor. Die Männer knieten hinter den dürftigen Deckungen der hohen Wagenräder, lagen unter den Fahrzeugen oder duckten sich hinter den provisorisch errichteten Barrikaden aus Fässern, Kisten und Truhen.
Die Nervosität schien sogar auf die Pferde und Maultiere in der Mitte der Wagenburg übergegriffen zu haben. Sie drängten sich ängstlich zusammen, schnaubten erregt, schlugen mit den Schweifen und rollten die Augen.
Im Übrigen herrschte eine sonderbare, unheimliche Ruhe, wie vor einem mörderischen Blizzard, der alles hinwegfegte, was sich ihm in den Weg stellte.
McQuade lag neben Shadoe Carson unter einem der Schoner. Gray Wolf lag neben ihm.
Am Ende des Wagens kniete Black Steward hinter der Deichsel.
Die Sonne sank tiefer und tiefer, über den Felszacken im Osten trafen die ersten grauen Schleier der Abenddämmerung zusammen und schoben sich langsam in die Senke. Die Abendsonne begann das Land in blutiges Rot zu tauchen.
Plötzlich tauchte auf einem der Felskegel ein Indianer auf. Reglos wie eine Statue blickte er auf das Camp der Siedler.
Ein peitschender Knall hallte über das Grasland und fing sich in den Felsen, zur gleichen Zeit, als sich der Apache aufbäumte, sich halb um seine Achse drehte um schließlich nach hinten zu kippen und mit ausgebreiteten Armen in die Tiefe zu stürzen.
Einer der Auswanderer, der über ein Weitschussgewehr verfügte, hatte den Krieger in Scharfschützenmanier vom Felsen geschossen.
Ein schriller Schrei gellte durch die Dämmerung. Wut, Enttäuschung, Hass - das alles lag in diesem durchdringenden Aufheulen, das sich nach kurzer Zeit wiederholte und dann aus vielen Kehlen vervielfältigt wurde.
Die Menschen in der Wagenburg ängstigten sich, das Geheul ließ sie frösteln und ihre Herzen erbeben. Das Entsetzen griff nach ihnen. Denn aus den Hügeln lösten sich die Apachen. Staub wallte unter den unbeschlagenen Hufen ihrer Mustangs auf und hüllte sie ein. In einer breiten Front nahmen sie vor der Felskette Aufstellung. Es waren an die sechzig Krieger. Der Staub senkte sich.
Markerschütterndes Geheul trieb heran, und plötzlich hoben die Indianer die Waffen und schwenkten sie drohend über ihren Köpfen. Die Reiterkette setzte sich in Bewegung. Staub wogte unter annähernd zweihundertfünfzig Hufen. Die Apachen erreichten den Rand des Graslandes und hielten an. Wie Reiterstandbilder verharrten sie.
Es hatte den Anschein, als ob die Chiricahuas eine richtige Schlacht schlagen wollten. Entgegen ihrer sonstigen Taktik, überfallartig aus dem Verborgenen zuzustoßen, Tod und Verderben zu bringen und blitzschnell wieder unterzutauchen. Rotes Sonnenlicht zeichnete scharf die Konturen ihrer untersetzten, gedrungenen Gestalten nach.
McQuade hörte Shadoe Carson erregt atmen. Hinter ihm raschelte ein Kleid. Carsons Tochter hatte sich dort postiert. Ihr Auftrag war es, McQuade und ihren Vater mit geladenen Gewehren zu versorgen, wenn sie die Magazine ihrer Waffen leergeschossen hatten. Im ganzen Lager hatten Frauen und Halbwüchsige diese Aufgabe übernommen.
Die Linie der Apachen setzte sich in Bewegung, zunächst ganz langsam. An den Spitzen ihrer Lanzen brach sich das Abendrot. Nur wenige waren mit Gewehren bewaffnet. Einer der Krieger stieß seine Faust mit dem veralteten Karabiner unvermittelt in die Höhe. Sein kehliger, gellender Befehl übertönte sekundenlang das Stampfen der Hufe, und im nächsten Moment begann die Erde unter pochenden Hufschlägen zu dröhnen. Spitzes, abgehacktes Geschrei, triefend vor heidnischer Grausamkeit, ließ den Hufschlag fast versinken. Der Tod donnerte heran – personifiziert in einigen Dutzend Chiricahuas, die nur vom Willen zum Kämpfen und Töten beseelt waren.
In der Wagenburg brüllten heisere Stimmen durcheinander, ein hartes, metallisches Knacken lief durch die Reihe der Siedler, als sie die Hähne ihrer Waffen spannten oder repetierten.
„Haltet euch mit dem Schießen zurück, bis ich es anordne!“, rief McQuade den Männern zu.
Er übernahm einfach das Kommando. Denn ohne organisierte Verteidigung waren sie rettungslos verloren.
Wieder brüllte er: „Und zielt ruhig! Jeder Schuss muss sitzen. Im Kampf Mann gegen Mann erdrücken sie uns!“
Gebannt blickte er den in wilder Karriere heransprengenden Apachen entgegen. Und er ahnte, dass die meisten Siedler Mühe hatten, den Anblick der heranwogenden wilden Schar zu ertragen.
*
Ruhig schob der Kopfgeldjäger den Lauf seines Gewehrs zwischen den dicken Speichen des Wagenrades hindurch und zielte.
Kugeln jaulten heran, Pfeile zogen flirrende Bahnen. Das Wummern vermischte sich mit dem durchdringenden Kriegsgeheul zu einem ohrenbetäubenden, nervenzermürbenden Lärm. Die trockenen Detonationen rollten über die Ebene und trieben über die Planwagen hinweg. Schließlich waren die Apachen so nahe, dass McQuade deutlich ihre breitflächigen, vom Vernichtungswillen und der tödlichen Leidenschaft verzerrten Gesichter erkennen konnte.
„Feuer!“, brüllte McQuade und zog durch, repetierte, schoss erneut. Er feuerte in rasender Folge.
Pfeile trafen die Bordwände und Segeltuchplanen der Wagen, Lanzen beschrieben weite Flugbahnen und bohrten sich knirschend in die Erde. Die Wagenplanen schlugen und knatterten unter den Einschlägen. Die ersten Tomahawks wirbelten heran. Überall war Krachen, Splittern und Schreien. Irgendwo brüllte ein Mann seinen Schmerz hinaus. Ein Todesschrei, der jäh abbrach.
McQuade schoss und schoss, Pferde brachen zusammen, Indianer starben. Einer der Siedler taumelte aus seiner Deckung und stürzte aufs Gesicht. Der beißende Geruch von Pulverdampf breitete sich schnell aus und reizte die Schleimhäute.
Ein Pfeil strich niedrig über McQuade hinweg, eine Kugel prallte mit infernalischem Heulen vom Eisenreifen des Wagenrades ab, und er konnte das grässliche Quarren nahe an seinem Ohr hören.
Die Pferde und Maultiere zerrten wie verrückt an den Leinen und versuchten voll Panik, sich loszureißen.
Es war die Hölle.
Die Linie der Apachen riss, zwei Gruppen schwärmten in entgegengesetzte Richtung auseinander. Einige Verteidiger der Wagenburg wechselten hastig ihre Stellung, um das Lager nach zwei Seiten zu verteidigen.
Die Krieger jagten wie heulende Derwische vorbei, schleuderten Lanzen und Äxte.
Die junge Frau hinter dem Kopfgeldjäger arbeitete wie besessen. Mit fliegenden Fingern drückte sie die Patronen in den Ladeschlitz und lud durch. Das Gewehr wurde ihr aus den Händen gerissen, sofort füllte es das Magazin des heiß gefeuerten Gewehrs nach.
Dann waren die beiden Reiterpulks vorbei. Weit hinten sammelten sie sich. Zwischen den Wagen lagen vier tote Männer und eine Frau. Verwundete stöhnten und ächzten. Bei den getöteten Männern knieten weinende Frauen. Die Verletzten wurden hastig und notdürftig versorgt. In den Wagen schrien die Kinder.
Die Verteidiger hatten ein wenig Zeit, Luft zu holen. In fieberhafter Eile wurden alle verfügbaren Waffen nachgeladen.
Dann kamen die Apachen zurück. Ein neuer Kugelhagel empfing sie. Reiterlose Pferde irrten umher. Einige der Apachen erreichten die Schoner und versuchten, ihre Mustangs durch die Lücken zu drängen. Die mörderische Besessenheit verzerrte ihre breitflächigen, knochigen Gesichter, und in ihren dunklen Augen brannte der tödlich Hass.
Heftiges Gewehr- und Coltfeuer trieb sie zurück.
Plötzlich brüllte ein Mann mit sich überschlagender Stimme: „Seht! Dort vorn! Bei allen Heiligen, ich kann es nicht glauben! Das sind ja …“ Seine Worte endeten in einem Röcheln, als er getroffen wurde und starb.
McQuade rollte sich unter dem Wagenkasten hervor und lief zu der Stelle, von der die Stimme gekommen war. Ein jäher Glückstaumel erfasste ihn.
Aus einer Hügellücke im Norden galoppierten blauuniformierte Reiter. Sie stießen aus dem dunklen Schattenfeld des Einschnitts und sprengten in direkter Linie auf das Wagencamp zu. Eine Trompete schmetterte, und der Trupp fächerte auseinander.
Wutgeheul kam von den Apachen. Sie fluteten zurück. Nur noch vereinzelte Mündungsblitze zerschnitten das Grau, das mittlerweile zwischen den Fahrzeugen wob. Sehnige Gestalten schnellten aus dem Gras in die Höhe, hetzten hinter ihren flüchtenden Brüdern her, sprangen pantherhaft geschmeidig auf vorbeirasende, reiterlose Mustangs und hieben ihnen die Fersen in die Seiten.
Die Soldaten versuchten jetzt, den Apachen in schräger Linie den Weg in die Felswildnis abzuschneiden. Und sie schafften es. Sie stießen auf ihren schweren Kavalleriegäulen in das entsetzte Knäuel der Fliehenden wie ein Keil hinein. Die blanken Klingen ihrer Säbel reflektierten das purpurne Licht. Der Hall von Coltschüssen wehte heran.
„Ich glaube, wir haben es geschafft“, rief jemand nahe bei McQuade erregt.
Der Kopfgeldjäger schwang herum. Er nickte dem Mann zu, dann suchte sein Blick Black Steward. Der Geächtete kniete noch immer bei der Deichsel und verfolgte den Kampf drüben vor der bizarren Kulisse der Felskette.
McQuade wandte sich ab und sagte zu Shadoe Carson: „Sieht in der Tat so aus, als wären wir gerettet. Die Patrouille ist gewissermaßen im letzten Moment aufgetaucht. Lange hätten wir uns nicht mehr halten können.“
Mit einem Ruck setzte sich Black Steward sich in Bewegung. Seine Schritte waren sicher und ausgreifend. Der Kopfgeldjäger ahnte nichts von der Gefahr, die hinter seinem Rücken erwuchs. Und als er sie wahrnahm, war es zu spät.
Hart drückte ihm Black Steward die Mündung der Henrygun zwischen die Schulterblätter. „Lass fallen, Menschenjäger!“, befahl er mit stählern klingender Stimme, in der eine tödliche Drohung mitschwang.
McQuade erstarrte. Aber schnell kam seine Fassung zurück, und er drehte den Kopf.
„Ich hätte wissen müssen, dass ich mich mit einer Klapperschlange eingelassen habe“, presste er zwischen den Zähnen hervor, und seine Hände spreizten sich. Das Gewehr fiel ins zertretene Gras.
„Du irrst dich, McQuade“, gab Black Steward kühl zurück. „Ich möchte nur nicht unschuldig in Nogales aufgehängt werden. Und das blüht mir, wenn du mich dorthin bringst.“
Gray Wolf knurrte bedrohlich und zeigte sein gefährliches Gebiss, seine Nackenhaare stellten sich auf und er legte die Ohren an. Zeichen dafür, dass er im nächsten Moment angreifen würde.
Blitzschnell richtete Steward das Gewehr auf den Hund. „Gebiete ihm, dass er sich ruhig verhält!“, knirschte der Geächtete. „Oder ich knalle ihn ab.“
„Ruhig, Partner!“, stieß der Kopfgeldjäger hervor. „Sitz!“
Gray Wolf gehorchte. Sein Knurren endete, er ließ sich auf die Hinterläufe nieder, die Haare seines Kammes legten sich. Aber er ließ Steward nicht aus den Augen.
„Steh auf, McQuade!“ befahl Black Steward, und nachdem der Texaner dem Befehl nachgekommen war, knurrte er: „Gut so. Stell dich neben das Wagenrad!“ Er wies mit dem Kinn die Richtung. Dann langte er mit der Linken in die Tasche, ohne dass sich der Gewehrlauf auch nur einen Millimeter von McQuades Gestalt entfernte. „Deine eigenen Handschellen!“, bemerkte Black Steward. „Ich habe sie mitgenommen, nachdem du sie mir aufgeschlossen hast, weil ich ahnte, dass ich sie noch brauche.“ Er grinste. Dann fesselte er den Kopfgeldjäger mit beiden Händen an das Wagenrad, und zwar so, dass die Felge mit dem Eisenreifen zwischen seinen Handgelenken war und er nicht in die Tasche greifen konnte, um den Handschellenschlüssel herauszunehmen.
„Beantworte mir eine Frage, Steward“, sagte McQuade. „Ich erwarte eine ehrliche Antwort. Hast du Norman Baxter ermordet, oder war es tatsächlich Notwehr, als du ihn getötet hast?“
„Er war ein Dummkopf“, antwortete Black Steward. „Ich weiß nicht genau, ob er mit dem Gewehr, das er in den Händen hielt, auf mich schießen wollte. Er war voll Hass. Und ich wollte kein Risiko eingehen.“
McQuade schwieg.
Einige Männer und Frauen hatten alles beobachtet, aber niemand schritt ein.
Black Steward holte seinen Colt aus McQuades Satteltasche, holsterte ihn, dann ging er zu seinem Pferd, das noch unter dem Sattel stand, stieß die Henrygun in den Scabbard und saß auf. Im Schritt ließ er das Tier durch eine Lücke zwischen den Wagen gehen. Draußen trieb er es mit einem rauen Zuruf an.
Drüben vor den Felsklippen wogte der Kampf zwischen den Apachen und Kavalleristen. Die Siedler waren aus ihren Deckungen getreten und blickten hinüber.
Ungeschoren ritt Black Steward davon.
*
Shadoe Carson hatte McQuade befreit. Black Steward war zwischen den Hügeln im Norden verschwunden. Der Kampf am Rand der Ebene war entschieden. Einige Apachen waren geflohen, einige waren gestorben, ein halbes Dutzend wurde gefangen genommen.
Drei Soldaten näherten sich der Wagenburg. Männer, Frauen und Kinder erwarteten sie. Der mittlere der Reiter war ein Captain. Er tippte mit dem Zeigefinger seiner Rechten gegen die Krempe seines Hutes, an dessen Krone das Emblem mit den gekreuzten Säbeln befestigt war, dann sagte er: „Wir sind in Camp Huachuca stationiert. Ich bin Captain Hank Weaver. Ich schätze, ich bin mit meinen Leuten gerade noch rechtzeitig aufgekreuzt.“
„Sie hat der Himmel geschickt“, rief Shadoe Carson und stellte sich dann dem Captain vor. Nachdem er ihm erklärt hatte, dass sie zunächst nach Tucson wollten, um von dort aus nach Nordwesten zu ziehen, sagte der Offizier: „Die Entfernung nach Tucson beträgt an die hundert Meilen. Und viele solcher Kriegshorden wie die, mit der Sie es heute zu tun hatten, können Ihren Weg unsicher machen. Es kann ein Todestrail werden. Haben Sie denn einen erfahrenen Führer? Einen Mann, der die Apachen kennt?“
Carson schüttelte den Kopf. „Ich hielt mich für erfahren genug. Vieles von dem, was man über die Chiricahuas erzählt, habe ich nicht geglaubt. Ich ging davon aus, dass Cochise mit einer Handvoll Krieger vor dem Gesetz und der Armee auf der Flucht ist. Wenn ich geahnt hätte, dass sich das Land im Aufruhr befindet …“
„Ich kann leider keinen erfahrenen Mann abstellen, der Sie nach Tucson führt“, gab der Captain zu verstehen. „Seien Sie auf der Hut, und legen Sie die Waffen keinen Moment aus der Hand. Die Apachen sind gefährlicher als Klapperschlangen. Ein Ehrenkodex ist ihnen fremd. Mir bleibt es nur, Ihnen viel Glück zu wünschen.“
Der Captain zog das Pferd um die linke Hand und trieb es an. Seine beiden Begleiter folgten ihm.
McQuade, der wortlos dabeigestanden hatte, während der Captain und der Treckführer miteinander sprachen, wandte sich ab, flankte über eine Deichsel und stapfte zu seinem Pferd, das er an ein Wagenrad gebunden hatte. Shadoe Carsons Stimme holte ihn ein: „Warten Sie, McQuade.“
„Was ist?“ Der Kopfgeldjäger drehte sich um und sah den bärtigen Treckführer auf sich zukommen.
„Irre ich mich, wenn ich annehme, dass Sie tausend Erfahrungen in diesem Land im Allgemeinen und mit den Chiricahuas im Besonderen gesammelt haben, McQuade?“
McQuade ahnte, worauf der Treckführer hinaus wollte. „Nun, ja …“
„Ich denke, Sie sind der Mann, den wir suchen“, sagte der Treckführer und hielt einen Schritt vor McQuade an. „Ich bin nicht in der Lage, all diese Männer, Frauen und Kinder sicher nach Tucson zu bringen. Sie aber, McQuade, besitzen das nötige Format. Ich bitte Sie: Führen Sie diesen Wagenzug als Scout nach Tucson. Sie müssen es auch nicht umsonst tun. Wir …“
McQuade winkte ab. „Ich bin kein Kundschafter, Carson. Schon gar nicht möchte ich die Verantwortung für all diese Leute übernehmen. Außerdem muss ich Black Steward wieder einfangen. Tut mir leid, Carson, aber ich kann Ihr Angebot nicht annehmen.“
„Wenn Steward der kaltblütige Mörder wäre, für den er hingestellt wird, dann hätte er Sie sicher nicht am Leben gelassen, als er Sie vor der Mündung hatte, McQuade.“
Der Kopfgeldjäger zuckte mit den Schultern. „Er selbst ist sich nicht sicher, ob er Norman Baxter in Notwehr erschoss. Wie auch immer: Er hat ein Menschenleben ausgelöscht, und das Gericht hat darüber zu befinden, ob er dafür gehängt werden muss, ob er eine Zuchthausstrafe zu verbüßen hat, oder ob er freizusprechen ist von aller Schuld.“
„Heute sind einige unserer Leute gestorben, McQuade“, murmelte Carson und seine Stimme klang belegt. „In den nächsten Tagen werden wahrscheinlich weitere sterben. Sie könnten es vielleicht verhindern. Wie hoch ist die Prämie, die für die Ergreifung Black Stewards ausgesetzt wurde?“
„Fünfhundert Dollar.“
„Diesen Preis zahlen wir Ihnen, wenn Sie uns führen.“
„Es geht nicht um das Geld“, knurrte McQuade. „Es geht um Gerechtigkeit.“
„Ist es gerecht, wenn die Apachen unsere Frauen und Kinder massakrieren?“
McQuade presste die Lippen zusammen, so dass sie nur noch einen dünnen, blutleeren Strich bildeten. In ihm war ein Zwiespalt aufgerissen – der Zwiespalt eines Mannes, der sich nicht entscheiden konnte. Der Verstand riet ihm, nicht von seiner Entscheidung abzuweichen. Das Gefühl aber mahnte ihn dazu, diesen Menschen, die ohne ihn vielleicht verloren waren, zu helfen.
Das Gefühl siegte schließlich. „In Ordnung“, erklärte er. „Ich führe Sie. Ich schätze, wir brauchen eine Woche. Während dieser Woche gilt nur mein Wort. Ist das in Ordnung, Carson?“
„Der Himmel wird es Ihnen danken, McQuade. Ich werde die Leute in Kenntnis setzen.“
Carson wollte sich abwenden.
McQuade sagte: „Noch etwas, Carson: Ich arbeite als Scout für Sie, weil ich es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, Sie sich selbst zu überlassen. Darum will ich kein Geld von Ihnen. Ich verlange lediglich, dass sich jeder meinen Anweisungen fügt.“
„Sie haben mein Wort darauf, McQuade. Aber jetzt wollen wir uns um die Verwundeten kümmern. Die Toten begraben wir morgen Früh, ehe wir aufbrechen.
*
McQuade hatte sich sein Nachtlager unter dem Fuhrwerk des Treckführers eingerichtet. Seinen Sattel benutzte er als Kopfkissen. Die Nacht war kühl. Nur das leise Säuseln des Windes war zu hören, manchmal auch der Jagdschrei eines Kauzes. Der Kopfgeldjäger fand keinen Schlaf. Unruhig wälzte er sich von einer Seite auf die andere. Neben ihm lag Gray Wolf. Auch der Hund schlief nicht. Hin und wieder hob er den Kopf, um zu lauschen.
Gefahr und Tod waren allgegenwärtig.
McQuade hatte Doppelwachen ausgestellt. Alle zwei Stunden wurden die Männer abgelöst. Irgendwann rollte sich der Kopfgeldjäger aus seiner Decke und kroch unter dem Schoner hervor. Über der Ebene spannte sich ein sternenklarer Himmel. Der Mond hing halbvoll im Südwesten über den Graten und Zinnen der Sierra Madre. McQuade richtete sich auf. Gray Wolf drängte sich gegen sein Bein und fiepte leise. Der Texaner kraulte das Tier zwischen den Ohren.
Langsam schritt McQuade um das Lager herum. Aus dem einen oder anderen Fuhrwerk waren Schnarchtöne zu vernehmen. Das brüchige Leder seiner Stiefel knarrte bei jedem Schritt, leise und melodisch klirrten die Sporen, unter seinen Sohlen raschelte das verdorrte Gras.
Aus dem Schlagschatten eines der Conestoga-Schoner löste sich eine Gestalt. „Wer ist da?“ Der Lauf des Gewehres in den Händen des Wachpostens schimmerte matt im Mond- und Sternenlicht.
„Ich bin es – McQuade. Ist alles in Ordnung?“
In dem Moment waren dumpfe Hufschläge zu vernehmen.
„Bis jetzt schon!“, stieß der Auswanderer hervor. „Doch nun …“
„Das ist nur ein einzelnes Pferd“, gab McQuade zu verstehen. „Um einen Apachen dürfte es sich wohl kaum handeln.“
Die beiden Männer lauschten und warteten. Die Hufschläge wurden deutlicher. Der zweite Wachposten rief: „He, Hal, hörst du das? Da nähert sich ein Pferd.“
„Ich glaube nicht, dass wir uns Sorge machen müssen“, erwiderte an Stelle des Auswanderers, der auf den Namen Hal hörte, McQuade.
Ein Wiehern erhob sich. Und nach kurzer Zeit schälte sich das Pferd aus der Nacht. Der Reiter saß zusammengekrümmt im Sattel. McQuade ging ihm entgegen. Das Pferd prustete, als er es am Kopfgeschirr nahm. „Es war ein Fehler, abzuhauen“, krächzte der Mann auf dem Rücken des Tieres. „In Richtung Grenze wimmelt es nur so von Rothäuten. In – in meiner Schulter steckt ein Pfeil. Ich – ich …“
„Ah, du bist es, Steward“, entfuhr es dem Kopfgeldjäger. „Wirst du von den Apachen verfolgt? Müssen wir mit ihnen rechnen?“
„Keine Ahnung. Ich bin geritten, als säße mir der Leibhaftige im Nacken. Du siehst diese roten Parasiten nicht, sie kommen völlig lautlos, und sie schneiden dir den Hals durch, ehe du zum Denken kommst. Ich werde verrückt vor Schmerzen. Und ich fühle mich wie eine hohle Nuss.“
McQuade führte das Pferd in die Wagenburg und half Black Steward beim Absteigen. Dann weckte er Shadoe Carson und sagte, nachdem er ihn mit knappen Worten aufgeklärt hatte: „Es ist nicht auszuschließen, dass auf Stewards Fährte eine Horde Apachen kommt. Wir müssen die Wachen verdreifachen, außerdem muss sich jemand um Steward kümmern. Er hat viel Blut verloren und das Stück Pfeil muss aus seiner Schulter.“
„Um ihn werden sich meine Frau und Kitty, meine Tochter, kümmern.“
Bald waren sämtliche Männer in der Wagenburg in Alarmbereitschaft versetzt. Die Nacht schien Unheil zu verkünden. McQuade spürte den Pulsschlag der tödlichen Gefahr, die in der Dunkelheit lauerte. Nach einiger Zeit begab er sich um Fuhrwerk Carsons. Unter der Plane brannte eine Laterne. Black Steward saß, mit dem Rücken gegen eine Truhe gelehnt, am hinteren Rand der Ladefläche. Sein Oberkörper war nackt, um Brust und Schulter lag ein weißer Verband. Schweiß rann über sein Gesicht, seine Augen glitzerten fiebrig, in ihnen wühlte der Schmerz.
„Du wolltest dich nach Mexiko absetzen“, konstatierte McQuade.
„In Arizona kriege ich doch keinen Fuß mehr auf den Boden“, versetzte Steward und seine Stimme klang schwach. „Meine Chancen hier sind die eines Schneeballs in der Hölle.“
„Als ich dich gefragt habe, ob du Norman Baxter in Notwehr getötet hast, ist deine Antwort recht zweideutig ausgefallen. Erzähl mir, was sich an jenem Abend zugetragen hat, als der junge Baxter starb.“
„Warum interessiert es dich, McQuade? Für dich ist doch nur maßgeblich, dass ich dir fünfhundert Bucks bringe, wenn du mich beim County Sheriff ablieferst.“
„Du irrst dich, Steward.“
Das trübe Licht vertiefte die Linien in den Gesichtern der beiden Männer.
„Na schön“, murmelte Black Steward nach einiger Zeit. „Ich betreibe in Tubac eine Kunstschmiede. Das Geschäft geht nicht schlecht. Aus der Stadt und dem Umland kommen die Menschen mit Aufträgen zu mir. Das hat Sam Baxter nicht gefallen. Er ist der große Mann in der Stadt, und er will an jedem Cent, der in Tubac umgesetzt wird, mitverdienen. Es gibt kaum ein Geschäft, in dem er nicht Teilhaber ist. Auch mir unterbreitete er ein Angebot. Es wäre darauf hinausgelaufen, dass ich für ihn gearbeitet hätte. Ich habe abgelehnt.“
„Das hat dir die Feindschaft der Baxters zugezogen, wie?“
„Ja. Norman tat sich ganz besonders hervor. Ich habe seine Provokationen und Beleidigungen ignoriert, bis zu dem Punkt, an dem er versuchte, mir Mona auszuspannen. Mona und ich sind so gut wie verlobt. Baxter hat ihren Vater – den Futtermittelhändler – gegen mich aufgehetzt und auf seine Seite gezogen. Mir platzte der Kragen und ich habe Norman verprügelt. Einige Tage später sprach er mich, als ich abends auf dem Nachhauseweg war, aus der Dunkelheit einer Gasse an. Er meinte, dass die Schmach, die ich ihm zugefügt habe, nur mit Blut abgewaschen werden könne. Und als er das Gewehr durchlud, zog ich den Revolver.“
„Musstest du ihn töten?“
„Ich habe ihn nur schemenhaft ausmachen können. Und ich muss gestehen, dass ich mir keine Mühe gab, ihn nur auszuschalten. Norman hat mich lange genug herausgefordert, und ich verschwendete keinen einzigen Gedanken daran, ihn auf irgendeine Art zu schonen. Als ich schoss, habe ich seinen Tod billigend in Kauf genommen. Und als ich vor seinem Leichnam stand, fühlte ich nicht die geringste Gemütsregung.“
„Wenn deine Geschichte stimmt, dann wird dir jedes Gericht der Welt Notwehr zubilligen“, gab McQuade zu verstehen.
„Das mag sein. Für Sam Baxter aber gilt nur, dass ich seinen Sprössling erschossen habe. Die Umstände interessieren ihn nicht. Er hat über meinem Kopf den Stab gebrochen. Und wenn er mich in die Hände bekommt, ist mein Schicksal besiegelt.“
McQuade ging weiter. In der Wagenburg war Ruhe eingekehrt. Die Männer lagen mit schussbereiten Waffen auf der Lauer. Die Frauen und Kinder hatten sich in den Fuhrwerken verkrochen.
McQuade postierte sich im Schatten eines der Fuhrwerke. Er dachte über Black Steward nach. Die Geschichte, die Steward ihm erzählt hatte, klang glaubwürdig. Und sie deckte sich mit den Aussagen einer Reihe von Leuten, mit denen der Kopfgeldjäger in Tubac gesprochen hatte.
*
Sie zogen in nordwestliche Richtung, hinein in die Ödnis der Canelo Hills. Zurück blieben einige Grabhügel, in die die Auswanderer grobe Kreuze aus zusammengebundenen Ästen gerammt hatten. Namenlose Gräber am Rand eines mörderischen Trails.
McQuade ritt voraus, Gray Wolf wich nicht von der Seite des Falben. Der Kopfgeldjäger erkundete den Weg. Er wollte zum Santa Cruz River, um an ihm entlang nach Norden bis Tucson zu ziehen. Es ging durch weitläufige Ebenen, die mit Kreosot bewachsen waren, über Höhenzüge, durch Schluchten und Canyons und durch staubige Täler. Die Hitze setzte Mensch und Tier zu und machte den Marsch zur Tortur.
Aber die Auswanderer trotzten allen Strapazen und Unbilden. Sie schafften an diesem Tag fünfzehn Meilen. Und die Apachen ließen sie ungeschoren. Nicht einmal ein Rauchsignal war zu sehen gewesen.
Sie lagerten an einem schmalen Creek. Die Sonne war untergegangen. Innerhalb des Wagenkreises brannten einige Kochfeuer. McQuade ging zum Fuhrwerk der Carsons. Black Steward empfing ihn mit ernstem Gesicht. Er sah etwas erholter aus als am Morgen. „Wie geht es?“, fragte McQuade.
„Ich denke, dass ich in zwei oder drei Tagen wieder auf dem Damm sein werde“, antwortete Steward. „Mrs. Carson hat mir erzählt, dass du den Santa Cruz River hinauf ziehen willst.“
McQuade nickte.
„An dem Trail liegt Tubac“, murmelte Steward.
McQuades Blick kreuzte sich mit dem des Geächteten. „Du befürchtest, dass ich dich Sam Baxter ausliefere, nicht wahr?“
Steward schwieg und starrte den Kopfgeldjäger an.
McQuade ergriff wieder das Wort, indem er sagte: „Mach dir keine Sorgen, Steward.“
„Du glaubst mir also meine Geschichte?“
„Ja. Du wirst allerdings ein riesiges Problem haben, zu beweisen, dass du in Notwehr gefeuert hast. Es ist für dich nicht ratsam, in der Gegend zu bleiben.“
„Ich glaube, die Carsons haben nichts dagegen, wenn ich mit ihnen nach Oregon ziehe.“
„Was ist mit dieser Mona? Du liebst sie doch.“
Steward nagte sekundenlang an seiner Unterlippe, dann antwortete er: „Ihr Vater ist gegen mich. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist, die Strapazen eines Trails nach Oregon auf sich zu nehmen. Wenn ich in Oregon angekommen bin, werde ich ihr einen Brief schreiben. Von ihrer Antwort wird es abhängen, ob ich sie nachhole – oder ob ich sie vergesse.“
Kitty Steward kam um das Fuhrwerk herum. Die Tochter des Treckführers war blond, mittelgroß und ausgesprochen hübsch. Ihr Alter schätzte McQuade auf Mitte zwanzig. Sie trug eine dampfende Schüssel, in der ein Löffel steckte. Kitty lächelte. „Ich habe dir eine kräftige Fleischbrühe gekocht, Black“, sagte sie und schaute den Kopfgeldjäger an. Ihr Lächeln gerann. „Hat Black mit Ihnen gesprochen, McQuade?“
Ihre Stimme klang kühl.
Steward enthob den Kopfgeldjäger einer Antwort, indem er sagte: „Er wird mich in Tubac nicht an Sam Baxter ausliefern, Kitty. McQuade weiß, dass deine Eltern nichts dagegen haben werden, wenn ich mit euch nach Oregon auswandere.“
McQuade zeigte ein hartes Grinsen. „Ich verstehe. Lass dir die Suppe schmecken, Steward, damit du bald wieder auf die Beine kommst. Ich schätze, ab Tucson wirst du meine Rolle als Scout dieses Wagenzugs übernehmen. Denn völlig umsonst werden dich diese Leute gewiss nicht mit nach Oregon nehmen.“
Jetzt grinste auch Black Steward. „Sicher, McQuade, sicher. Ich muss mich auf dem Trail nützlich erweisen. Bringe du uns nur gut nach Tucson. Und dann übernehme ich.“
McQuade ging zum Feuer, um sich eine Portion des Essens, das Mrs. Carson zubereitet hatte, zu holen.
Er beobachtete, wie ein junger Bursche an Kitty Carson herantrat, als sie zum Feuer zurückkehren wollte, sie am Arm packte und heftig auf sie einsprach. Kitty erwiderte etwas, riss sich los und ließ den Burschen einfach stehen. Dieser starrte ihr finster hinterher …
Als der Morgen graute, ging es weiter. Die Sterne waren verblasst, im Osten färbte sich der Horizont schwefelgelb, auf den Gräsern glitzerte der Tau. Der Morgendunst war Vorbote der kommenden Hitze.
Sie durchquerten den Creek, an dem sie gelagert hatten. Drüben setzte sich die Ebene etwa eine halbe Meile fort, dann begann wieder felsiges Terrain. Den roten und gelben Sandstein hatten Wind, Sonne und Regen zu bizarren Gebilden geformt. Bei den dunklen Einschnitten zwischen den Felsen handelte es sich um Risse und Spalten, manchmal aber auch um richtige Schluchten, die einen Durchlass boten.
Die Fuhrwerke rumpelten, die Achsen quietschten in den Naben, Peitschen knallten, Hufe stampften. Einige Männer und Halbwüchsige trieben die Rinderherde, andere kümmerten sich um die kleine Herde aus Ziegen und Schafen.
Vor ihnen lagen die Santa Rita Mountains. McQuade hatte vor, einige Meilen östlich an Tubac vorüberzuziehen. Der Weg durch die Santa Rita Mountains ersparte ihnen um die fünfundzwanzig Meilen. Er hatte sich aber auch im Hinblick auf Black Stewards Sicherheit dazu entschieden. Der Treck hätte Neugierige aus der Stadt angelockt, und möglicherweise wäre Steward entdeckt worden. McQuade wollte jeglichen Ärger von vorne herein ausschließen.
Mühsam arbeitete sich der Wagenzug steil nach Nordwesten. Höhenzüge mussten überwunden werden, was Mensch und Tier oftmals das Letzte abverlangte. Bergab mussten die Männer Stangen in die Speichen der Wagenräder klemmen, um zu verhindern, dass die schweren Gefährte die Zugtiere überrollten und in die Tiefe rissen.
Gegen Mittag dieses Tages erhoben sich östlich ihres Trails Rauchsignale. Bald wurden sie im Norden beantwortet. Und auch im Süden begannen sich dunkle Rauchsäulen zu erheben. McQuade, der dem Treck etwa fünfhundert Yards vorausritt, registrierte es sorgenvoll und kehrte um. Rumpelnd und in den Aufbauten ächzend kamen ihm die Schoner entgegen. Die Spitze bildete Shadoe Carson mit seinem Wagen. McQuade zügelte bei ihm das Pferd, vollführte mit dem linken Arm eine ausholende Bewegung und sagte mit kratzender Stimme: „Haben Sie die Rauchzeichen vor uns, hinter uns und östlich von uns gesehen, Mr. Carson? Das Kommunikationssystem in der Wildnis funktioniert wieder einmal vorzüglich. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir von kriegerischen Chiricahuas eingekesselt sind.“
Carson hatte das Fuhrwerk angehalten. Auch die anderen Wagen, die folgten, kamen zum Stehen. Shadoe Carson schwenkte den Blick in alle Himmelsrichtungen, als wollte er sich davon überzeugen, dass McQuade nicht übertrieb, nickte und sagte: „Sicher, sie sind mir nicht entgangen. Aber die Kriegshorden scheinen noch ziemlich weit von uns entfernt zu sein. Uns bleibt es nur, zügig weiterzumarschieren und uns auf die Gefahr einzustellen.“
Einige Männer kamen nach vorn. McQuade sagte: „Wir sollten versuchen, nach Westen auszuweichen. Wenn wir den Santa Cruz River erreichen, dürfte für uns die Apachengefahr gebannt sein. Denn den Fluss hinauf gibt es immer wieder Ansiedlungen, und die Bürgermilizen fackeln nicht lange, wenn sich die Rothäute zu nahe an die Ortschaften heranwagen.“
„Und wenn uns die Chiricahuas auch den Weg nach Westen verlegen?“, rief ein Mann.
„Dann wird Kampf unvermeidbar sein“, antwortete der Kopfgeldjäger.
Gemurmel erhob sich. Die Männer gestikulierten heftig. Vorwürfe wurden laut.
Carson erhob die Stimme: „Wir folgen McQuades Rat und wenden uns nach Westen. Wenn wir Glück haben, dann ist der Weg bis zum Santa Cruz River frei. Und in die zivilisierte Gegend wagen sich diese Wilden nicht.“
McQuade ritt an. Die Männer rannten zu ihren Fuhrwerken, und wenig später rollten die schweren Wagen wieder.
Um die Mitte des Nachmittags - sie zogen durch eine Ebene, die im Westen von lang gezogenen Hügelketten begrenzt wurde -, erschienen auf einer Anhöhe fünf berittene Apachen. Wie Statuen verharrten sie auf ihren Mustangs und starrten in die Tiefe, wo sich die fünf Conestoga-Schoner einen Weg durch die mit kniehohen Kreosotsträuchern bewachsene Senke bahnten.
McQuade zerrte an den Zügeln und brachte den Falben zum Stehen. Und jetzt erschienen auch auf den Hügelrücken im Süden und Norden Apachen. Der Kopfgeldjäger drehte seinen Oberkörper und schaute zurück. Auch im Osten zeigten sich berittene Apachen.
McQuade atmete tief durch. Der Anblick brachte seine Nerven zum Schwingen. Sie waren von Chiricahuas eingekreist. McQuade schätzte, dass es sich um vierzig bis fünfzig Krieger handelte, in deren Gemütern der Hass und in deren Herzen ein mörderischer Vernichtungswille wütete.
McQuade kehrte um. „Wir sind von den Apachen eingeschlossen!“, schrie er. „Fahrt die Fuhrwerke zu einer Wagenburg zusammen, nehmt die Gewehre zur Hand und macht euch bereit!“
Und während sich die Auswanderer auf Verteidigung einstellten, sich mit Zuversicht wappneten und sich gegenseitig Mut machten, zogen sich die Apachen von den Hügelkämmen zurück. Es war, als hätte es sie nie gegeben. McQuade sagte zu Shadoe Carson: „Ich kann nicht einschätzen, welche Taktik die Rothäute anwenden. Möglicherweise sind sie vorsichtig geworden und verzichten zunächst auf einen blindwütigen Angriff.“
„Sie meinen, dass sie uns nur belagern und versuchen, uns auf diese Weise mürbe zu machen.“
„Möglich. Ich weiß es nicht.“ McQuade machte eine hilflos wirkende Handbewegung. „Wir müssen es auf uns zukommen lassen.“
*
Es war Nacht. Im Camp der Auswanderer schlief niemand. McQuade lag neben Shadoe Carson unter dessen Fuhrwerk. Hin und wieder erklang der Jagdschrei eines Coyoten, manchmal auch der schrille, durchdringende Schrei eines geflügelten Nachtjägers. Niemand in der Wagenburg konnte ausschließen, dass sich auf diese Art und Weise die Apachen untereinander verständigten. Und jeder Schrei, der erklang, nährte die Angst.
Bei den Siedlern regierte die Furcht. Mit der Intensität von Menschen, nach denen der Tod die knöcherne Klaue ausstreckte, fühlte jeder von ihnen das Unheil tief in der Seele.
McQuade sagte: „Black Steward wird mit Ihnen nach Oregon gehen, Carson. Ihre Tochter kümmert sich ziemlich intensiv um ihn. Aber es scheint einen jungen Mann zu geben, dem das nicht so gut gefällt. Er stritt sich gestern Abend mit Kitty, nachdem sie Steward das Abendessen brachte.“
„Das ist Cole Willard. Er ist hinter Kitty her. Doch meine Tochter hat kein Interesse an ihm. Er will es einfach nicht einsehen. Cole hat sogar das Gerücht verbreitet, dass er und Kitty in Oregon heiraten werden.“
McQuade wechselte das Thema. „Ich vermute, dass im Morgengrauen ein Angriff erfolgt. Vielleicht ist es nur ein Scheinangriff, mit dem uns die Apachen zeigen wollen, dass sie noch da sind. Es kann aber auch sein, dass sie uns zahlenmäßig so sehr überlegen sind, dass sie versuchen, uns zu überrennen.“
„Wir sind nur wenig Meilen von Tubac entfernt“, murmelte Shadoe Carson. „Wenn jemand versuchen würde, die Stadt zu erreichen und die Bürgerwehr zu mobilisieren.“
„Jeder, der sich dazu bereit erklärt, begibt sich auf ein Himmelfahrtskommando“, versetzte McQuade.
„Aber unsere Chance, hier nicht vor die Hunde zu gehen, würde sich um ein Beträchtliches erhöhen“, wandte Carson ein.
„Das ist richtig. Ich könnte es versuchen …“
„Nicht Sie, McQuade. Sie benötigen wir hier. Ich will mit den Männern sprechen. Vielleicht erklärt sich einer bereit, den Versuch zu wagen.“
Carson kroch davon.
Die Natur schien den Atem anzuhalten. Die Stille war geradezu erdrückend. Sie zerrte an den Nerven. Manchmal glitten Schatten über das Land, wenn sich Wolken vor den Mond schoben. Etwas Beklemmendes lag in der Luft: Tod und Unheil. Es war beinahe körperlich zu spüren.
Zwanzig Minuten später kehrte Carson zurück. „Cole Willard hat sich bereit erklärt, denn Versuch zu wagen“, murmelte er.
„Haben Sie ihm klar gemacht, was ihn erwartet, wenn er den Chiricahuas in die Hände fällt?“
„Ja. Er will es trotzdem versuchen. Ich denke, Willard möchte Kitty beeindrucken. Ich ermahnte ihn, seinen Entschluss sorgfältig zu überdenken, aber er beharrte auf seiner Entscheidung.“
„Ich will mit ihm sprechen, ehe er das Lager verlässt“, knurrte McQuade.
Er traf Cole Willard bei den Pferden. Zwei Männer halfen ihm, ein Pferd zu satteln und zu zäumen.
„Du weißt sicher, worauf du dich einlässt, Willard“, sagte der Kopfgeldjäger.
„Sicher. Wenn ich diesen Heiden in die Hände falle, massakrieren sie mich. Ich werde aber auch sterben, wenn ich hier bleibe. In den Hügeln rundum wimmelt es von Kriegern. Und sie werden über uns kommen wie ein Bussard über eine Feldmaus. Wenn es mir gelingt, die Bürgermiliz von Tubac zu aktivieren, ist das vielleicht unsere Rettung. Wenn ich den Versuch erst gar nicht unternehme, sind unsere Chancen die eines Regentropfens im Ozean.“
McQuade versuchte nicht mehr, den Burschen aufzuhalten. Wenig später führte Cole Willard sein Pferd am Kopfgeschirr in die Nacht hinein. Sie hatten die Hufe des Tieres mit Stofffetzen umwickelt, die sie aus einer Decke geschnitten hatten.
„Wenn alles gut geht, kann er morgen bei Sonnenaufgang mit Hilfe anrücken“, murmelte einer der Männer, die ihm geholfen hatten, das Pferd reitfertig zu machen.
„Beten wir, dass er durchkommt“, knurrte der andere. „Wenn Gott uns gnädig gesonnen ist …“
Der Mann brach ab und schritt davon. Der andere entfernte sich ebenfalls, und auch McQuade kehrte zu seinem Platz unter Carsons Fuhrwerk zurück.
Als ein heller Schein über dem östlichen Horizont den Sonnenaufgang ankündigte, griffen die Apachen an. Sie jagten von allen Seiten auf die Wagenburg zu, schrien wie besessen und feuerten aus allen Rohren. Die Erde schien unter den trommelnden Hufen zu erbeben.
Unter den Fuhrwerken zuckten Mündungsblitze aus den Gewehrläufen. Der Lärm war infernalisch. Das spitze, abgehackte Geheul der Chiricahuas und das rasende Gewehrfeuer, gellendes Gewieher und die Todesschreie vermischten sich zu einem höllischen Crescendo, das das Sterben auf beiden Seiten begleitete.
Die Apachen fluteten zurück, als sie feststellen mussten, dass der Blutzoll, den sie ihrem Hass und ihrer tödlichen Leidenschaft zu entrichten hatten, zu hoch war. Jetzt aber zerschnitten auf den Hügelrücken Mündungsfeuer die sich lichtende Dunkelheit. Von zwei Seiten griffen die bleiernen Finger des Todes nach den Chiricahuas.
„Das ist die Bürgermiliz aus Tubac!“, brüllte jemand wie von Sinnen. „Zur Hölle mit dem roten Gesindel! Gebt es den verdammten Hurensöhnen!“
Die Apachen flohen kopflos. Viele von ihnen starben. Es gab weder Gnade noch Erbarmen. Das Blut der Getöteten und Verwundeten versickerte im Boden des Landes, das die Apachen als ihr Eigentum betrachteten, das aber die Weißen für sich beanspruchten.
Als der Tag endgültig anbrach, war der Kampf zu Ende. Überall lagen reglose Krieger und tote Pferde. An die fünfzig Reiter trieben ihre Pferde die Abhänge ringsum hinunter. Es waren die Männer aus Tubac, die nicht gezögert hatten, in die Sättel zu steigen und den Auswanderern zu helfen. Der tödliche Hass beruhte auf Gegenseitigkeit; er kannte kein Verständnis, keine Zugeständnis und keine Versöhnung.
Ein halbes Dutzend Reiter kamen zur Wagenburg. Die Auswanderer erwarteten sie. McQuade sah den jungen Cole Willard, der aufrecht im Sattel saß und seinen triumphierenden Blick schweifen ließ. Der Reiter neben ihm war Mitte fünfzig. Sein Gesicht war wie versteinert. McQuade sah ihn und verspürte ein ungutes Gefühl. Er wusste nicht, worauf es sich bezog, aber es war da und es ließ sich nicht verdrängen.





























