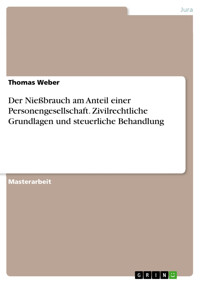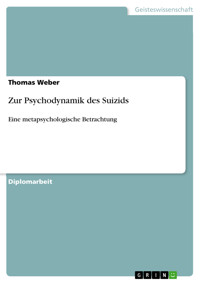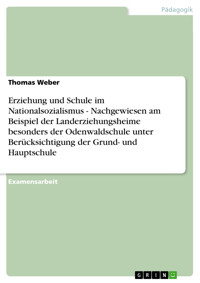Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Je weniger Punkte ein Produkt hat, desto besser für den ökologischen Fußabdruck - und für unser Wohlbefinden. Wie verbessert man seinen ökologischen Fußabdruck und lebt dabei trotzdem gut? Wie sieht ein bewusster und schonender Umgang mit der Umwelt aus? Thomas Weber gibt konkrete Antworten auf diese Fragen und beschreibt Konzepte, die für jeden realisierbar sind. Mit Initiativen wie "Miete ein Huhn!"' "Hack die Thujen klein!" und "Lass deine Sklaven frei" sind ungewöhnliche Ideen dabei, die sich alltagstauglich umsetzen lassen. Nach dem großen Erfolg von "Ein guter Tag hat 100 Punkte" stellt dieser Band weitere Möglichkeiten vor, das Leben nachhaltiger zu gestalten. Thomas Webers Vorschläge sind kreativ, manchmal provokant und immer eine Bereicherung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 270
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Weber 100 Punkte Tag für Tag
Thomas Weber
100 Punkte Tag für Tag
Miethühner, Guerilla-Grafting und weitere alltagstaugliche Ideen für eine bessere Welt
Residenz Verlag
Für Adrian und Klara
Inhalt
Die Pizza, der Papst und ich. Eine Erklärung vorab
Trink Kaffee aus dem Pool
Lass den Zucker mitgehen
Kauf bio, nicht regional
Iss wie Obelix
Bestell Soda
Löffle Haselherzen
Grill nicht nur die Henne, sondern auch den Hahn
Teile eine Kuh
Miete ein Huhn
Pflanz Feigen
Werde Guerilla-Grafter
Hack die Thujen klein
Schütte den Pool zu
Flute deinen Keller
Reiß das Styropor aus der Fassade
Zieh in eine WG oder tausch deine Wohnung
Segle nach Amerika
Reise als Post-Tourist
Bestell online
Lass deine Sklaven frei
Werde Bürgermeisterin
Reservier dir einen Platz im Waldfriedhof
Merci beaucoup!
»Du sitzt auf deinem Thron und schaust auf diesen Schrottplatz dort hinaus das Durcheinander macht dir Spaß«
Das Trojanische Pferd, Lied für S.
Die Pizza, der Papst und ich Eine Erklärung vorab
Im Grunde ist es ganz einfach: Dieses Büchlein soll zum Nachmachen animieren, dich zum Weiterdenken anregen und insgesamt inspirieren. Deshalb freue ich mich auch über Widerspruch, über deine Einwände und weiterführenden Gedanken. Denn keiner von uns hat die Wahrheit gepachtet, auch ich nicht. Und allein wäre die Sache ohnehin aussichtslos. Da gehe ich ausnahmsweise sogar mit dem Papst d’accord, der mich immerhin dazu brachte, erstmals eine Enzyklika zu lesen, eine päpstliche Verlautbarung. Aus Neugier, und auch, weil ich wissen wollte, ob Franziskus wirklich ein »grüner Papst« ist und als Mitstreiter zu erachten wäre. Die frohe Botschaft lautet: Ja, das ist er!
Für uns aufgeklärte Menschen bleibt der Papst – wie jede andere real existierende Gestalt mit Rechtfertigung von »oben« auch – eine eher ambivalente Figur. Herr und Herrscher über einen weltlichen Verein, der zwar in Rückzugsgefechte verstrickt, in vielem aber eben doch nah dran an realen Problemen und Nöten der gemeinen Existenz ist. Auch in seiner schwülstig betitelten Schrift Über die Sorge für das gemeinsame Haus, die vordergründig von Umwelt, Klimawandel und seinen sozialen Auswirkungen handelt, sich letztlich aber unserer Lebensgrundlage widmet, unserem einzigen Habitat, dem gemeinsamen Haus eben.
Neu ist das freilich nur aus vatikanischer Sicht. Denn die Enzyklika beruft sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns seit Jahren nicht gerade vorenthalten werden. Dass der Papst in seinen Ausführungen allerdings das Anthropozän anerkennt – das vom Menschen geprägte Erdzeitalter, in welchem die Menschheit zum dominierenden Einflussfaktor geworden ist, der Veränderungen selbst geologischer Reichweite verursacht hat –, das kommt einer Revolution gleich. Aufs Individuum heruntergebrochen, heißt das nichts weniger, als dass sich kein Mensch aus seiner Verantwortung stehlen kann. Handeln im Hier und Jetzt, das ist das Gebot der Stunde.
Was kann ich tun? Das haben sich viele von uns lange vor dem Papst gefragt. Möglichkeiten und Antworten möchte ich auf den folgenden Seiten aufzeigen. Wobei der Papst dabei nicht die geringste Rolle spielt.
Wenn man will, kann man die folgenden 23 Kapitel als Fortsetzung meines 2014 erschienenen Buchs Ein guter Tag hat 100 Punkte lesen, in dessen Untertitel ich nicht weniger als alltagstaugliche Ideen für eine bessere Welt versprochen habe. Dem folgend handelt es sich hier einfach um weitere Ideen. Band eins gelesen zu haben, ist keine Voraussetzung. Wobei er als ergänzende Lektüre durchaus zu empfehlen ist. Die Reihenfolge ist allerdings unerheblich, und auch die Kapitel in diesem Buch bedürfen keiner chronologischen Vorgangsweise. Beginne einfach dort zu lesen, wo dich deine Neugierde hinführt, wo du Anknüpfungspunkte zu deinem eigenen Leben zu entdecken meinst. Schließlich sind meine Vorschläge für den Alltag gedacht.
Wie gehabt bewege ich mich im Koordinatensystem, das die Creative-Commons-Kampagne EinguterTag.org aufgezogen hat. Ganz einfach, weil es sich als leicht fassbares und einfach verständliches Bezugssystem bewährt hat. Die Idee mit den 100 Punkten hatte also nicht ich. Sie stammt von Wirkungsforschern und Designern aus Vorarlberg und der Schweiz. Der Satz »Ein guter Tag hat 100 Punkte« ist einprägsam und entspricht unserer Art zu denken. Und einen Referenzrahmen von 100 Punkten, den kapiert jeder. Diese 100 Punkte entsprechen jenen 6,8 Kilogramm CO2, die statistisch jedem einzelnen Erdenbürger zur Verfügung stehen, damit wir global betrachtet nicht über unsere Verhältnisse leben. Käme jeder Einzelne mit 100 Punkten aus, dann würden wir gemeinsam nicht auf Ressourcen zurückgreifen, die in Folge unseren Kindern, Enkeln und Enkelskindern abgehen werden. Genau: 100 Punkte Tag für Tag – das wäre nachhaltig.
Unter www.eingutertag.orgund auch als App stellen das Unternehmen Kairos und die Agentur integral ruedi baur dieses Koordinatensystem der Allgemeinheit zur Verfügung. Alltagsaktivitäten, Grundnahrungsmittel und weitverbreitete Gewohnheiten sowie der Gebrauch von Konsumartikeln werden dort in einer Datenbank mit Punkten bewertet. 100 Punkte hast du an jedem einzelnen Tag zur Verfügung. Liegst du darüber, dann verbrauchst du mehr Ressourcen, als dir von Natur aus zustehen.
Praktisch bedeutet das: Kaufst du dir in der Früh einen Coffee to go, dann bemisst sich etwa ein Cappuccino mit 3 Punkten. Schlürfst du ihn im Einwegbecher, dann kommen je nach Ausführung oder Beschichtung noch einmal 0,5 bis 2,5 Punkte dazu. Die Hebel, um hier Ressourcen zu sparen, sind offensichtlich: Trinkst du den Kaffee zu Hause, auf der Uni oder im Büro oder hast du unterwegs gar einen Mehrwegbecher dabei, lässt sich ohne Einschränkung gleich einmal der halbe Punkteverbrauch einsparen. Trinkst du den Kaffee allerdings auf dem Weg zur Arbeit und alleine im Kleinwagen sitzend, verbraucht allein die Fahrt über zehn Kilometer 17 Punkte. Lenkst du einen SUV, sind es 53 Punkte. Bist du in Begleitung auf dem Elektromoped unterwegs, dann braucht jeder von euch nur 0,1 Punkte.
Du siehst schon: Die Auswirkungen deines Alltags sind beachtlich, aber letztlich leicht beeinflussbar. Die Schwierigkeit liegt eher darin, dass in unseren Breiten im Schnitt jeder und jede Einzelne täglich auf 450 Punkte kommt. Auch kleine Taten sind dabei keinesfalls unnütz. Gerade unser aller Lebenswandel ist ein überdurchschnittlich großer Teil des globalen Problems. Dementsprechend wirkt sich jede Veränderung, die von uns ausgeht, von dir, auch überdurchschnittlich aus.
Trotzdem wäre es ein Trugschluss, zu glauben, dass sich die Lösung dieses Problems privatisieren und aufs Individuum abwälzen lässt. Klar ist: Auch wenn du als Einzelner dein Möglichstes tun sollst – wirklich weitreichende Auswirkungen haben vor allem politische Entscheidungen. Ein ganzes Kapitel widme ich folglich der Vergrößerung deines Wirkungskreises, deiner höchstpersönlichen Hebel: Das Kapitel »Werde Bürgermeisterin« ist unmissverständlich als Aufforderung gedacht, in die Politik zu gehen. Ja, ich habe das selbst durchaus auch schon in Erwägung gezogen. Doch letztlich ist das mit meiner Profession als Publizist schwer kompatibel.
Darüber hinaus erachte ich mich selbst aber eindeutig nicht als das, was manche vielleicht etwas abfällig einen »Schreibtischtäter« nennen. Von mir Vorgeschlagenes habe ich größtenteils selbst ausprobiert, vieles praktiziere ich gewohnheitsmäßig – und wenn nicht, dann verschweige ich das auch gar nicht.
Dass das Überthema Ernährung einen beträchtlichen Teil dieses Buches ausmacht, hat gleich mehrere Gründe. Zuallererst ist es pures Kalkül – essen muss jeder, mehrmals täglich, egal in welchem Alter, in welcher Lebensphase und mit welchem verfügbaren Budget. Außerdem erfasst der Megatrend #Food längst als Lifestyle alle Schichten. Foodies gibt es quer durch die Bevölkerung. Warum also nicht der wachsenden Zahl derer, die wissen wollen, was sie essen, auch reichlich Wissen um Zusammenhänge servieren, das hilft, Dinge zum Besseren zu bewegen? Eben.
Denn dass sich möglichst viele von uns fundiert mit Ernährung beschäftigen und dabei zur Erkenntnis gelangen, dass es sich beim Essen zwar um Genuss, aber eben auch um einen politischen Akt handelt, das ist dringend nötig. Schließlich beginnt Ernährung nicht am Teller. Produktionsbedingungen, Landwirtschaft, Ökologie, Soziales, Mobilität und Verkehr, Welthandel und Tierwohl – all diese Bereiche und noch viele mehr werden beim Essen erfasst. Folglich sollten wir sie möglichst oft durchkauen.
Bei den unzähligen Gesprächen, die sich nach Erscheinen meines Buches Ein guter Tag hat 100 Punkte ergeben haben – nach Lesungen, am Podium oder bei Diskussionen im kleineren Kreis –, bewegten wir uns fast immer irgendwann im Spannungsfeld Bio vs. Regional. Egal, ob in der Stadt oder auf dem Land, egal, ob ich mit Schülergruppen, mit meinen Studierenden an der Fachhochschule, vor jungen Müttern oder vom Pensionistenkränzchen geladen diskutierte – immer tauchte die Frage auf, was denn wirklich besser wäre: Biolebensmittel oder doch regional Produziertes? Ganz einfach lässt sich das nicht allgemeingültig beantworten. In einem der folgenden Kapitel versuche ich, der Komplexität des Themas gerecht zu werden.
»Such dir einen Bauern«, habe ich in meinem ersten Buch geraten. Diese Aufforderung möchte ich an dieser Stelle noch einmal mit Nachdruck wiederholen. Denn das Hinausgehen, das Nachfragen, das eigenhändige Ausprobieren – all das wird Tag für Tag wichtiger. Mit jedem Bauernhof, den unsere Gesellschaft verliert, wird nämlich die Entfremdung größer – und damit auch die Wolke der Unwissenheit, die sich nur durch Aufklärung wieder vertreiben lässt.
Als ich in den Neunzigerjahren Skifahren lernte, war das noch eine ziemlich bodenständige Angelegenheit. Nicht nur, weil ich damals, im alten Jahrtausend, öfters im Schnee lag. Stürze bleiben Anfängern auf Skiern auch heute nicht erspart. Sondern weil uns Neulingen mit einem ganz einfachen Vergleich verdeutlicht wurde, wie wir bergab langsam bleiben und einfach bremsen konnten. Die Skilehrerin, eine junge Bauerntochter, bezeichnete die vorne zugespitzte Stellung der beiden Skier völlig selbstverständlich als »Pflug«. Nicht nur in ihrer Bergbauernwelt, auch in unserem kollektiven Bilderschatz war das landwirtschaftliche Ackerwerkzeug zur Bestellung des Bodens von Kindesbeinen an vertreten. Meine Skikursgruppe war da keine Ausnahme. Ganze Generationen lernten Skifahren in der »Pflug«-Stellung – so wie sie in der Steinzeit mit dem zugespitzten Faustkeil talwärts gebrettert wären.
Heutigen Kindern erscheinen Pflug wie Faustkeil als Bildnis aus einer anderen, fernen Welt. Dieselbe Stellung wird heute als »Pizza« oder ob ihrer Keilförmigkeit oft auch als »Pizzaschnitte« bezeichnet. Nur um nicht missverstanden zu werden: Das ist nicht schlecht. Ich bin kein Kulturpessimist und finde es auch gut, dass wir den Soundtrack unseres Lebens heute nicht mehr auf Musikkassetten oder Compact Discs durch die Gegend tragen. Doch dass aus dem Pflug die Pizzaschnitte wurde, das veranschaulicht eindrucksvoll, wie sich unsere Welt binnen weniger Jahrzehnte weitergedreht hat – und mehrheitlich wohl weiterdrehen wird.
Wenn allerdings alle Welt weiß, was eine Pizza ist – die viele ja als Fertigprodukt oder die Pizzaschnitte als Fastfood essen –, vielen aber der Pflug mittlerweile kein geläufiger Begriff ist, dann wird es umso wichtiger, dass wir wissen, wie der Belag eigentlich auf den Germteig gelangt.
Weil ich immer wieder gefragt werde, auf wie viele Punkte ich selbst an einem durchschnittlichen Tag komme: Genau kann ich das nicht sagen; wirklich nicht. Außerdem bin ich weder ein pedanter Erbsenzähler, noch möchte ich päpstlicher sein als der Papst. Auch meine Tage sind Annäherungen an die 100-Punkte-Grenze – und fast immer aus dem dreistelligen Bereich kommend. Den Erfindern von EinguterTag.org ging es aus gutem Grund nicht ums dauernde Durchzählen von allem und jedem. Eher geht es der Initiative um Größenordnungen, ums Herstellen von Relationen – und darum, uns zur Erkenntnis zu verhelfen, dass ausgerechnet jene Tage, an denen wir auf sehr wenige Punkte kommen, die sind, bei denen wir uns abends rückblickend sicher sind: Ja, das war ein guter Tag.
Wobei da oft auch die Politik weiter ist, als wir wahrnehmen: »Kürzlich habe ich mit einem Berater der chinesischen Regierung gesprochen. Dort wird ganz intensiv über Maßnahmen nachgedacht, den Ressourcenverbrauch zu senken, zum Beispiel Dinge zu mieten statt zu kaufen«, erzählte vor einiger Zeit Jakob von Uexküll, der Gründer des Alternativen Nobelpreises und des World Future Councils, der Süddeutschen Zeitung. »Auf meine Frage, was die Sparmaßnahmen konkret für das Leben der nächsten Generationen bedeuten, hat er gesagt: weniger Autorennen, mehr Tanzwettbewerbe. Ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt.«
Pizza hin, Papst her – das glaube ich auch.
Thomas Weber
Wien, im Februar 2016
www.eingutertag.org
Trink Kaffee aus dem Pool
Nichts gegen Coffee to go. Der Koffeinkick unterwegs gehört – zu Recht! – zum urbanen Lebensgefühl. Statt aber den Becher nach dem Austrinken wegzuwerfen, nimm deinen persönlichen Kaffeebecher mit. Oder besser noch: Gib Pfandbechern eine Chance!
»Issst dasss schööön«, schwärmt der Führer, als er sich auf einer Anhöhe einen kurzen Moment der Ergriffenheit gönnt. Der Blick noch über die deutschen Lande schweifend, kommt Hitler wieder zu sich, macht kehrt – und wirft beim Abgang einen leeren Pappbecher in die Botanik. Ratlos klaubt sein Lakai diesen auf – und eilt ihm zum Auto nach.
Es ist eine der vielen absurden Szenen, mit denen David Wnendt in seiner Verfilmung von Er ist wieder da spielt. Wie auch der Romanbestseller von Timur Vermes gewinnt der Film seine Komik aus Missverständnissen. Erinnern wir uns: Das Buch lässt plötzlich und völlig unerklärt im Berlin der Gegenwart in einer Baulücke einen verwirrten Adolf Hitler auftauchen. Der wirkt zwar schrullig und aus der Zeit gefallen, hält seine Gesinnung aber nicht zurück und wird – unaufhörlich gegen Migranten und die liberalen Gepflogenheiten wetternd – für eine gnadenlose Parodie gehalten. Mit seiner vermeintlich ironischen »Türkennummer« gerät er rasch zum Gesamtkunstwerk und gefeierten Talkshow-Skurrilo, der nie aus seiner Rolle fällt. Eben nicht einmal, wenn er drüben auf dem Feldherrnhügel in Naturromantik schwelgt und im selben Moment ohne Genierer den leeren Kaffeebecher in die Landschaft wirft. Befremdend konsequent, der Typ! Also unglaublich – und natürlich unfreiwillig – komisch.
Die Botschaft dieser lächerlich großen Geste lautet: Man gönnt sich ja sonst nichts – außer einem kurzen Blick in die Landschaft und einem Coffee to go. Und der ist im Nu getrunken, Müll, Geschichte.
Damit ist Hitler in der Karikatur von Timur Vermes wahnsinnig zeitgemäß und ein wunderbarer Repräsentant unserer Wegwerfgesellschaft – eben weil er die gängige Praxis des schnellen Verbrauchens plakativ bricht. Doch auch ganz ohne Ironie betrachtet sind die realen Zahlen gewaltig: Im Deutschland dieser Tage werden stündlich 320 000 Coffee-to-go-Becher weggeschmissen. Allein die deutsche Hauptstadt kommt laut Stiftung Naturschutz Berlin auf jährlich 170 Millionen Coffee Cups aus Plastik oder beschichteter Kartonage – das sind fast eine halbe Million Wegwerfbecher, die dort täglich im Müll landen oder auf öffentlichen Plätzen und in Parks liegen bleiben. Plastikdeckel aus Polystyrol und Trinkhalme, papierene Isoliermanschetten und Kunststoff-Rührstäbchen, die beim schnellen Koffeinkick oft ebenfalls zum Einmal-Einsatz kommen, fallen da vergleichsweise kaum ins Gewicht.
Theoretisch ließe sich zumindest ein Teil der Becher recyceln. Allerdings sind die Becher zwar aus Papierfasern, innen aber hauchdünn mit Kunststoff beschichtet, um beim Auffüllen mit heißen Getränken nicht gleich aufzuweichen und undicht zu werden. Sie können also allerhöchstens zu minderwertigstem Recyclingpapier verarbeitet werden. Meistens werden sie in der Papierverwertung als sogenannte »Spuckstoffe« abgesondert und verbrannt. Fast alle in Bäckereien und Stehcafés, von Coffeeshops, McDonald’s und Starbucks, aber auch die von Street-Food-Koffeinrollern vor Unis und Hochschulen verkauften To-go-Kaffeehüllen landen ohnedies nach 15 Minuten direkt im städtischen Müll. Der dann im Idealfall »thermisch entsorgt« wird – was nichts anderes bedeutet, als dass er ebenso verbrannt wird. Mit seinen 15 Minutes of Fame ist die durchschnittliche Lebensdauer eines To-go-Bechers damit noch kürzer als die einer Plastiktüte. Die bleibt immerhin 25 Minuten im Einsatz.
Da Recyclingpapier durch die Belastung mit Schwermetallen in der Regel nicht für Lebensmittelverpackungen verwendet wird, kommt für fast jeden dieser Becher Neumaterial ins Spiel. Das heißt: Da werden für Papierfasern ganz klassisch Bäume genutzt. »Für die Herstellung der in Deutschland pro Jahr verbrauchten Coffee-to-go-Becher werden etwa 43 000 Bäume gefällt«, heißt es in einem Hintergrundpapier der Deutschen Umwelthilfe. Zu den 64 000 Tonnen Holz und 29 000 Tonnen Papier kommen weitere 11 000 Tonnen Kunststoff und ein Verbrauch von 1,5 Milliarden Litern Wasser und von 320 Millionen Kilowattstunden Energie hinzu. Wie gesagt: gewaltige Zahlen.
Coffee-to-go-Becher
Was also wären mögliche Lösungen dieses Problems? Die Umwelthilfe macht in ihrem Papier diesbezüglich individuelle, systemische und politische Vorschläge.
Der erste Ratschlag – »Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und trinken Ihren Kaffee vor Ort aus einer Tasse!« – wird tatsächlich bereits von manchen Zeitgenossen beherzigt. Glauben wir der Statistik, dann vor allem von Frauen. Männer trinken doppelt so häufig Getränke to go, während Frauen dem klassischen Coffee to stay treu bleiben – und generell weniger Kaffee trinken. »Frauen genießen bewusster und nutzen Kaffee häufiger als eine Auszeit vom Alltagsstress. Zudem achten Frauen mehr auf ihre Gesundheit und vermeiden in der Regel exzessiven Kaffeekonsum«, erklärt Thomas Fischer, bei der Deutschen Umwelthilfe für Kreislaufwirtschaft zuständig.
Kaffee superentspannt aus dem Porzellan trinken – kann man, muss man aber nicht. Und die Vorstellung von Hitler als herrischem Slow-Food-Genussmenschen hat zwar ebenso Witz. Aber machen wir uns nichts vor: Als Alltagsparodie auf den gesellschaftlichen Zeitgeist taugt sie nicht – oder höchstens im Hinblick auf Nischen und das entspannte Frühstück am Wochenende. Der Regelfall bleibt eher die Getriebenheit des »to go«. Auch bei mir.
Der zweite Ratschlag – »Lassen Sie sich Ihren Kaffee für unterwegs in Ihren persönlichen, wiederverschließbaren Mehrwegbecher abfüllen!« – ist machbar, bedeutet allerdings ein Umdenken und einigen persönlichen Aufwand. Das Praktische am Becher ist ja eben, dass man ihn nicht mehr in der Hand hat, wenn man ihn nicht mehr braucht. Nichtsdestotrotz: Wer auf Street-Food-Messen flaniert oder gezielt im Netz nach Mehrwegbechern sucht, wird eine nicht geringe Auswahl an herzeigbaren, hochwertigen und gut verschließbaren Refiller Cups finden. Aus der Erfahrung weiß man, dass sich die bis zu tausend Mal und öfter befüllen und im Anschluss recyceln lassen. Nicht zu vernachlässigen: Mitunter hilft das Mitbringen des eigenen Mehrwegbechers auch dabei, Geld zu sparen. Einige Ketten und Coffeeshops geben Mehrwegrabatte. Diese Vergünstigungen sind allerdings ausbaufähig.
Tasse Espresso
Am effizientesten wäre jedoch eine systemische oder aber eine politische Lösung des Müllproblems. Angeregt vom Erfolg der Erfahrungen mit einer Abgabe auf Plastiktüten in Irland – diese hat den Pro-Kopf-Verbrauch von Plastiksackerln von jährlich 328 auf 16 Stück gesenkt –, fordert die Deutsche Umwelthilfe deshalb die Einführung einer Abgabe von 20 Cent pro Einwegbecher to go. Laut Umfrage des Forschungsinstituts TNS Emnid würden diese beispielsweise 75 Prozent aller Berliner gutheißen. Rechtlich beruft sich die Umwelthilfe dabei auf das deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz, welches ausdrücklich den Einsatz ökonomischer Lenkungsinstrumente zur Vermeidung unnötiger Abfälle legitimiert.
Kaffee mit Milch
Eine solche Abgabe wäre jedenfalls ein weniger drastischer Schritt als jener der New Yorker Stadtbehörden. »In New York lag schließlich so viel Polystyrol-Abfall in den Straßen herum, dass das Einweggeschirr kurzerhand verboten wurde«, erzählt Kreislaufwirtschaftsexperte Fischer. »Mehrwegbecher, die vom Verbraucher mitgebracht und wiederbefüllt werden, sind seitdem eine ernsthafte Alternative.« Durch die Einführung einer Wegwerfbecherabgabe könnte jeder, der seinen Mehrweg-to-go-Becher mitbringt, die Steuer einfach vermeiden, so Fischer. Eine Verbrauchersteuer auf Coffee-to-go-Becher müsse also nicht zwangsläufig vom Kunden gezahlt werden.
In New York gescheitert ist vor dem Verbot hingegen ein Versuch, den die Experten der Deutschen Umwelthilfe ebenfalls als gangbaren Weg erachten – und der sich womöglich leichter umsetzen lässt als gesetzliche Regelungen: das Kaffeetrinken aus dem Pool.
Cappuccino
Das Prinzip hinter sogenannten Pool-Systemen ist einfach – und im Grunde vielfach bewährt, etwa bei Pfandflaschen. Auf das Prinzip »to go« umgelegt bedeutet das, dass eine oder mehrere Kaffeehausketten in ihren Filialen dieselben Mehrwegbecher verwenden. Diese können mitgenommen und in anderen Filialen oder Partnerbetrieben zurückgegeben werden. Ein Becherpfand, das bei Rückgabe wieder ausgezahlt wird, garantiert, dass die hochwertigen Thermobecher möglichst häufig wiederverwertet und abgegeben werden. Was wir dabei vom Scheitern in New York lernen können: Dort nahmen erstens deutlich zu wenige Coffeeshops am Pool-System teil, weshalb es kaum bequeme Rückgabemöglichkeiten gab. Zweitens, so Thomas Fischer, »war der eingesetzte Mehrwegbecher nicht wiederverschließbar und somit eingeschränkt praktikabel«.
Latte macchiato
In geschlossenen, räumlich überschaubaren Systemen funktionieren Pool-Lösungen für Mehrwegbecher bereits problemlos – etwa wenn bei Großveranstaltungen Bier, Cola und andere Softdrinks ausgeschenkt werden. Über den Erfolg von städtischen Mehrwegbecher-Pools entscheiden wohl zwei Faktoren: einerseits die »Convenience« – also die bediente Bequemlichkeit beziehungsweise die Annehmlichkeit, das Becherpfand an möglichst vielen Orten wieder auslösen zu können. Andererseits natürlich: die Qualität des angebotenen Kaffees. Denn ein möglichst flächendeckendes Mehrwegbechersystem wäre zwar eine Riesenchance für die traditionelle Gastronomie, die zuletzt allerorts Geschäft an Fastdrink- und Street-Food-Anbieter verloren hat. Auch das beste Bechersystem kann allerdings mangelnde Kaffeequalität nicht wettmachen, an welcher etwa die Attraktivität so vieler altehrwürdiger Wiener Kaffeehäuser leidet. Die zahllosen, oft liebevoll und mit Leidenschaft für ihr Produkt betriebenen Coffeeshops haben uns Konsumenten mittlerweile gezeigt, wie richtig guter Kaffee schmecken kann. Mit liebloser Koffeinbrühe braucht uns keiner mehr kommen.
Nichtsdestotrotz: Wenn er dir angeboten wird, versuch es! Trink deinen Kaffee aus dem Pool! Wenn sich das Problem ohne Verbot lösen ließe: Wär’ das schööön.
Tipps
In ihrer Hashtag-Kampagne #Becherheld versucht die Deutsche Umwelthilfe seit einiger Zeit, Bewusstsein für das Bechermüllproblem zu schaffen. Der Claim der Superhelden-Kampagne: »Sei ein Becherheld! Trink Kaffee aus Mehrweg &schütze die Umwelt!«
www.becherheld.de
Das größte regelmäßig stattfindende Open-Air-Musikfestival der Welt, das jährliche Donauinselfest in Wien, setzt seit Jahren auf Mehrwegbecher. 2015 wurden über drei Tage hinweg 3,3 Millionen Besucher via Pfandbecher mit Getränken versorgt. Die Becher stammen von Cup Solutions.
Lass den Zucker mitgehen
Zum Kaffee oder Tee bekommst du meistens Zucker serviert. Steck ihn einfach ein. Erstens hat ihn der Wirt in seine Rechnung mit einkalkuliert – du hast ihn also bezahlt. Zweitens landet er sonst nicht selten im Müll.
Beim Tee ist es leichter. Aber beim Kaffee ist es eine Glaubensfrage und somit eine Art religiöses Bekenntnis, wie wir ihn trinken: die einen tiefschwarz als Espresso oder doppelten Mokka. Andere »verlängert« – mit brühheißem Wasser aufgegossen – oder als Kleinen Braunen mit einem Schuss Milch. Mancher bevorzugt Cappuccino oder trinkt den Milchkaffee aus Gründen der Gesundheit (Unverträglichkeit) oder aber Gesinnung (Veganismus) mit gewärmtem Soja- oder Reissaft. Ich selbst erfülle das Klischee des Wieners und trinke nichts lieber als eine Melange – halb Kaffee, halb heiße, aufgeschäumte Milch. Zucker wäre da für meinen Geschmack vollkommen fehl am Platz. Reicht mir jemand versehentlich bereits gezuckerten Kaffee, dann muss ich den leider weiterreichen oder wegschütten. Mit Zucker wird das köstliche Koffein plötzlich zur scheußlichen, ungenießbaren Plörre. Wie gesagt: eine Geschmacks- und Glaubensfrage.
Trotzdem bekomme ich zu meiner Melange zumindest im Kaffeehaus jedes Mal unaufgefordert Zucker serviert – ebenso wie das obligate Gläschen Wasser, das ich allerdings selten stehen lasse. Kommt der Zucker im sogenannten Portionsspender – so nennt sich das meist aus festem Glas mit Stahlkappe und herausragendem Dosierrohr bestehende Gastro-Gebinde –, dann ist die Sache nicht der Rede wert. Wie Salzstreuer oder Pfeffermühle kannst du ihn nach Belieben verwenden oder er wartet unberührt auf den nächsten Gast. Meist kommt der Zucker allerdings ungefragt in kleinen Säckchen oder manchmal gar lose als Würfel.
Natürlich wäre das bisschen Zucker am Kaffeetablett vollkommen egal. Schließlich spricht nichts dagegen, ihn gleich unberührt zurückzuschicken oder aber einfach übrig zu lassen. Wäre da nicht die Gepflogenheit vor allem gehobener Kaffeehäuser und Gaststätten, ihn nicht mehr zu verwenden, sobald er auch nur in Sichtkontakt mit der Kundschaft gelangt ist. Ich habe in zig Lokalen nachgefragt: Zwar nicht überall, aber überwiegend wird der Zucker – ward er erst einmal serviert – entsorgt. Und wenn die Packung angepatzt ist mit ein paar Tropfen Kaffee oder vom nassen Teebeutel, dann landet er auch in jenen Lokalitäten im Müll, die ihn sonst, ohne groß darüber zu reden, einfach wiederverwendet hätten. Schade drum, in jedem Fall.
1 kg Bio-Rohrzucker aus Paraguay
Deshalb stecke ich die Zuckersäckchen mittlerweile einfach ein. Anfangs kam ich mir dabei noch reichlich blöd vor, den Zucker mitgehen zu lassen, vor allem meinen Gesprächspartnern gegenüber. Ich sitze selten allein im Kaffeehaus. Und niemand möchte wie ein Schnorrer wirken – auch ich nicht, wenn ich nach einem Kaffeeplausch beim Abservieren oder kurz vor dem Aufbrechen noch zum Zucker greife, ihn in meiner Tasche verschwinden lasse. Ich kläre mein Gegenüber deshalb auf, dass dieser sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit weggeworfen, also vergeudet würde. Und dass so ein handelsübliches Papierbriefchen mit vier Gramm Feinzucker zwar natürlich lächerlich wenig ist. Es entspricht in etwa einem Teelöffel. Dass ich aber, da erfahrungsgemäß meist gleich zwei Briefchen – also acht Gramm – serviert werden, mit meinem werktags wohl täglichen Kaffeehaustermin auf 40 Gramm Zucker pro Woche komme. Dass ich also, aufs Jahr hochgerechnet, über zwei Kilogramm Zucker nach Hause trage. Das ist nicht nichts. Zumal mir manchmal auch noch mein Gesprächsgegenüber den bei ihm übrig gebliebenen zum Einsacken reicht.
Da ich zwar gerne Süßes esse, ich Zucker in Reinform aber – außer beim Keksebacken vor Weihnachten – nur in die Vinaigrette oder Salatmarinade einrühre und meinen Tee am liebsten mit Honig trinke, komme ich mit dem heimgetragenen locker durchs Jahr. Für Holundersirup oder wenn die Kirschen reif sind, kaufe ich zum Einkochen ein paar Kilo Bio-Gelierzucker zu, klar. Darüber hinaus aber habe ich in den vergangenen fünf Jahren keinen Zucker gekauft. Und habe ich selbst Gäste zum Kaffee zu mir geladen, kann ich denen den Zucker stets im Röhrchen wie in der Cafeteria anbieten.
1 kg Rübenzucker
Nur für den Fall, dass du selbst ein Café betreibst: Gescheiter wäre es natürlich, du stellst deiner Kundschaft zum Süßen einen Spender zur Verfügung. Handelt es sich nicht zufällig um eine Konditorei in einem auf Pensionisten spezialisierten Kurort – denn Zucker ist ja bekanntlich das Heroin der Senioren, du brauchst dann also Unmengen davon, hast es dafür aber wenigstens mit einer wiederkehrenden Dauerkundschaft zu tun –; handelst du also nicht ganz gezielt mit der Droge Zucker, dann ist so ein Zuckerspender die sparsamste Art der Verabreichung. Und die Differenz zu dem, was du sonst wegschmeißen müsstest – denn die Papierröhrchen bekommen ja wirklich oft Flecken ab –, steckst du guten Gewissens in den im Vergleich zur konventionellen Ware etwas teureren Bio-Zucker.
Als Gast jedenfalls braucht dich keinesfalls das Gewissen zu plagen, wenn du die Zuckersäckchen einpackst. Erstens hat der Wirt in seiner Kalkulation berücksichtigt, dass der Zucker verbraucht wird. Zweitens bekommt er mit Logos und Werbeaufschriften bedruckte Päckchen manchmal auch geschenkt. Oder er wird – was selten vorkommt, aber doch – womöglich sogar dafür bezahlt, dir die Werbeaufdrucke auf den Zuckerbriefchen ins Blickfeld zu servieren. Und sei es nur, wenn er dafür bei seinem Großhändler bessere Einkaufspreise auf andere Ware bekommt. Jeder an den Tisch gebrachte Zuckerbeutel bedeutet dann schließlich einen Werbekontakt. Deshalb: Keine falsche Scham! Lass den Zucker mitgehen!
Filmtipp
Nichts gegen Zucker! Wie und wo du dir allerdings im Alltag versteckten Zucker schenken kannst, zeigt der australische Regisseur Damon Gameau in seiner aufopferungsvollen Doku That Sugar Film (erhältlich auf DVD). Durchtrainiert, fit und bislang bewusst ohne raffinierten Zucker auskommend, lässt sich Gameau auf einen Selbstversuch ein: 60 Tage lang nimmt er gezielt jeweils 40 Teelöffel zu sich – was genau der Menge an Zucker entspricht, die jeder seiner Landsleute täglich, teils versteckt in Joghurts, Müslis, Softdrinks und Fertiggerichten, verdrückt. Negative Auswirkungen auf seinen Körper zeigen sich schnell …
Kauf bio, nicht regional
Kauf bio und regional, aber keinesfalls regional statt bio. Denn die Idee der Regionalität allein ist keine ernst zu nehmende Lösung für die komplexen Probleme des 21. Jahrhunderts. Mach dir nichts vor: Nur Bioprodukte geben dir Gewissheit, dass Tiere halbwegs gut gehalten werden und kein Gift zum Einsatz kommt. Soziale Standards gewährleisten per se leider weder biologische noch regionale Lebensmittel.
Nein, natürlich ist nichts Schlechtes am Regionalen, ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Auch ich achte darauf und gebe im Umkreis meines Wohnorts Gewachsenem, dort Gehaltenem, dort Hergestelltem gern den Vorzug. Auch auf Reisen trachte ich danach, in der jeweiligen Gegend Produziertes zu essen.
Ich habe es mir außerdem angewöhnt, von fast überall her Honig mitzubringen, also: regionalen Honig. Ja, ich liebe Honig. Wobei ich ganz klar Bio-Honig bevorzuge. Und das im vollen Bewusstsein, dass es – selbst in der konventionellen Bienenhaltung – durch eingeschleppte Krankheiten und radikal verschlechterte Umweltbedingungen heute kein Leichtes ist, Bienenvölker ohne Gift und den heftigen Einsatz von Chemikalien halbwegs gesund über den Winter zu bringen. Natürlich gibt es umsichtige Imker – wahrscheinlich gar nicht wenige –, die, auch ohne sich dem Reglement der EU-Bioverordnung zu unterwerfen, achtsam mit ihren Insekten umgehen; Imker, die Wert darauf legen, für die Waben, in welchen später Honig eingelagert wird, Wachs zu verwenden, das garantiert frei von Pestizidrückständen ist; in dem sich keine Gifte, die beschönigend »Pflanzenschutzmittel« genannt werden, nachweisen lassen. Natürlich gibt es auch konventionelle Imker, die tatsächlich danach trachten, ein reines Naturprodukt in Gläser abzufüllen.
Wird es alles geben, keine Frage. Aber Garantie habe ich als Konsument eben keine.
Wie kommt es also, dass selbst solchen Zeitgenossen, die mit ihrem Kaufentscheid möglichst auch Ansprüchen der Nachhaltigkeit Genüge tun wollen, mittlerweile Regionalität bei der Auswahl ihrer Lebensmittel manchmal wichtiger ist als der Bio-Gedanke? »Gerade bei frischen Lebensmitteln wie Eiern, Obst und Gemüse, aber auch bei Brot und Bier spielt Regionalität bei der Kaufentscheidung eine wichtigere Rolle als Bio.« Zu diesem Schluss kam im Juni 2014 die Lebensmittel-Trendstudie von A. T. Kearney für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der Studientitel fasst die Einsichten der Unternehmensberater unmissverständlich zusammen: Regional ist keine Eintagsfliege. Bereits 2013 hatte das »Ökobarometer«, eine repräsentative Bevölkerungsbefragung im Auftrag des deutschen Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, bescheinigt: »Regionalität liegt im Trend: 92 Prozent aller Befragten bevorzugen Lebensmittel – egal ob aus konventionellem oder ökologischem Anbau –, die aus der Region stammen.«
1 kg Trauben aus der Region
Wie konnte das passieren? Wie lässt sich erklären, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung – vor die Wahl gestellt – eher für konventionelle regionale Produkte entscheidet als für Bioware, die vielleicht aus dem Nachbarbundesland stammt? Nicht regional bedeutet ja nicht immer gleich Neuseelandhirsch oder Äpfel aus Peru.
Nun, diese bedauernswerte Entwicklung kann nur mit uninformierten, gleichermaßen gut- wie leichtgläubigen Konsumenten erklärt werden. Denn statt sich auf strenge Bio-Kriterien und Fakten zu verlassen, vertrauen diese Konsumenten ihrem Gefühl und einem romantisch ins Nebulose hineinprojizierten Prinzip »Heimat«. Nirgendwo steht nämlich festgeschrieben, was wirklich unter »regionalen« Produkten zu verstehen ist. Eine ernst zu nehmende rechtsverbindliche Definition gibt es ohnehin nicht. Laut Ökobarometer nimmt jedenfalls »mit steigendem Alter und Bildungsniveau sowie Höhe des Haushaltseinkommens die Wertschätzung für Lebensmittel aus regionaler Erzeugung zu«.
Dabei kann nicht einmal der Handel, wo sich sonst jeder Quadratzentimeter rechnen muss, wo man möglichst nichts dem Ungewissen überlässt, genau sagen, welche Umsätze er mit Regionalem macht. Einmal mehr das Problem: das »uneinheitliche Verständnis von Regionalität« (A. T. Kearney) – diesmal bei den unterschiedlichen Handelsunternehmen. Jedes von ihnen definiert Regionalität so, wie es ins jeweilige Gesamtkonzept passt. Unleugbar allerdings hat sich die Erkennbarkeit regionaler Produkte verbessert: Die Rewe-Gruppe, deren österreichisches Tochterunternehmen Billa etwa, hat eigene Regional-Regale eingeführt, in welchen die Produkte kleiner lokaler Erzeuger angeboten werden. Manche Handelsketten bilden die Belegschaft mittlerweile gar zu »regionalen Fachverkäufern« aus, Schulungen in regionaler Warenkunde inklusive. Seit vielen Jahren schon propagiert die Vorarlberger Supermarktkette Sutterlüty ihre »Ländle-Produkte«: Nach jedem Einkauf sieht die Sutterlüty-Kundschaft am Kassazettel aufgelistet, welcher Prozentsatz des gerade ausgegebenen Geldes im eigenen Bundesland bleibt.
1 kg Bio-Trauben aus der Region
Deutschlandweit wiederum tauchen seit Anfang 2014 auf Verpackungen immer öfter sogenannte »Regionalfenster« auf. Dabei handelt es sich um eine – optisch etwas altvaterisch anmutende, im Grunde aber begrüßenswerte – freiwillige Kennzeichnung. Angaben über Herkunft, Hauptzutat und Verarbeitungsort des Produkts sind im Regionalfenster ebenso angeführt wie eine neutrale Prüfstelle. Über Hackfleisch aus Hessen ist da etwa zu lesen, dass die dafür faschierten Zutaten »Schwein und Rind komplett aus Hessen« stammen, dass die Tiere »in 36251 Bad Hersfeld geschlachtet und zerlegt« wurden und der »Anteil regionaler Rohstoffe am Gesamtprodukt 92 %« ausmacht. Unaufgeregt, in unaufdringlichem Hellblau-Weiß gehalten, steht das im Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft entwickelte Regionalfenster Bioproduzenten gleichermaßen offen wie konventionellen Erzeugern. Alles einerlei also.
Aussagekräftig ist dabei eine offensivere Verlautbarung auf der Website des Regionalfenster-Vereins. Die Antwort auf die allererste der Frequently Asked Questions – nämlich: »Warum kein neues Gütesiegel?« – behandelt, warum das Regionalfenster explizit nicht als Gütesiegel zu verstehen ist. Klare Ansage: »Gütesiegel machen Aussagen über die Qualität der Erzeugung und/oder Verarbeitung eines Produktes. Sie sollen eine Mindestqualität garantieren. Dies trifft zum Beispiel auf die Bio-Siegel zu. Für ein Regionalsiegel müssten komplexe Richtlinien als Hintergrund für eine Qualitätsaussage entwickelt, evaluiert und ständig weiterentwickelt werden, um ein glaubwürdiges Siegelsystem nachhaltig aufbauen zu können. Die Aussagen zur regionalen Herkunft passen nicht in dieses System hinein.«
250 g Erdbeeren in der Saison
Anders ausgedrückt: Im Gegensatz zu zertifizierten Bioprodukten (die zumindest für eine bestimmte Mindestqualität bürgen) sagt Regionalität genau nichts über die Güte eines landwirtschaftlichen Produkts aus. Dazu ist die Sache viel zu komplex. Wirklich sinnvoll wäre folglich einzig und allein, unter den Bioprodukten jene regionalen Ursprungs zu bevorzugen. Nicht zufällig heißt in Österreich eine der erfolgreichsten Biomarken der vergangenen Jahre – die Eigenmarke der Aldi-Schwester Hofer – »Zurück zum Ursprung«.
250 g Erdbeeren im Winter