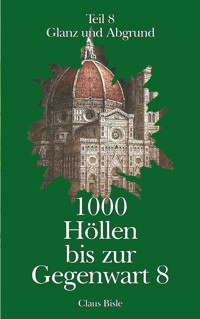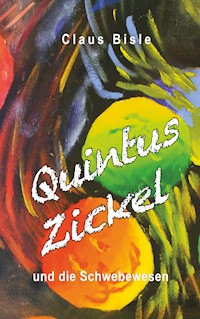Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: 1000 Höllen bis zur Gegenwart
- Sprache: Deutsch
Manuel Jebich ist durch einen Fluch verdammt, die Menschheitsgeschichte durchleben zu müssen. In atemberaubender Weise werden historische Fakten aufgearbeitet und in ein abenteuerliches Kleid gesteckt. In Band IV des gewaltigen Projekts stellt sich der Held der römischen Geschichte von Domitian bis zum Hunneneinfall. Dramatik pur ist garantiert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROMAN FÜR DIE JUGEND UND MENSCHEN, DIE DIE GESCHICHTE NEU ERLEBEN WOLLEN.
INHALTSVERZEICHNIS
Esche (93 n. Chr.)
Seifenkraut (116 n. Chr.)
Antinoos‘ Rose (130 n. Chr.)
Speick (166 n. Chr.)
Schwarzer Nachtschatten (197 n. Chr.)
Herbstzeitlose (260 n. Chr.)
Strand-Levkoje (303 n. Chr.)
Granatapfel (350 n. Chr.)
Alraune (397 n. Chr.)
Zunderschwamm (451 n. Chr.)
Stichworte
Zum Autor
ESCHE (93 N. CHR.)
Ein greller Blitz schmetterte mich auf die harte Erde. Ich zitterte am ganzen Leib, als ob mich ein Stromschlag durchzuckt hätte. Als ich die Augen öffnete, sah ich zunächst gar nichts. Instinktiv drängte sich die Erinnerung an das Etruskergrab auf. Damals war ich in einem verschlossenen Grab erwacht, die Luft war muffig und abgestorben gewesen. Das war jetzt nicht der Fall. Ein feuchter Herbstwind berührte mich, zudem spürte ich leichten Nieselregen.
Erst langsam erholten sich meine Augen. In der Jahreszeit hatte ich mich nicht getäuscht. Durch das Astwerk des dichten Waldes stahlen sich Nebelschleier. Zu meiner Seite lag der Speer, der mir diesen Wandel beschert hatte. Ich setzte mich auf. Üppiger Laub- und Nadelwald, bunt gemischt, erinnerte mich an meine Heimat. Wo war ich? Im östlichen Frankreich? Deutschland, Böhmen? Polen? Natürlich konnte ich die skandinavischen Länder, Kanada und Russland, nicht ausschließen.
Die Erinnerung schmerzte. War ich doch gerade knapp dem Tode entronnen. Titus hatte Jerusalem in Asche gelegt. Uns war die Flucht gelungen: Chen Lu, der meine ganze Liebe gehörte, Ning, dem rührigen Wissenschaftler, und vor allem Atid, meiner Tochter. Wie hart der Entschluss war, mich von ihnen zu trennen, ist kaum vorstellbar. Da ich aber in ständiger Lebensgefahr durch die Zeiten irrte, war es nur so möglich, sie einigermaßen in Sicherheit zu wissen. Trotz allem brannte in mir das Verlangen, sie bald wiederzusehen. Würde es geschehen und wenn ja, wo? In welchem Land? In welcher Zeit? Ich hatte keine Ahnung, wer Einfluss darauf haben konnte.
Es regnete nur noch leicht. Ich fror. Nach der heißen Steppe Israels belastete mich das raue Klima. Die Stofffetzen, die ich trug, waren kein Schutz gegen die Kälte. Was war meine Aufgabe? Menschen finden, den Ort, die Zeit ergründen, diese neue Phase irgendwie meistern.
Gebeutelt stand ich auf, griff nach meiner Waffe und zwängte mich durch das Geäst und Wurzelwerk, das sich mir entgegenstellte. Vielleicht war ich doch in Mitteleuropa? Ich wünschte es mir. Das war meine Heimat.
Bald kam ich an einen Bach. Der Verlauf des Wassers erleichterte mein Fortkommen nicht im Geringsten. Auch dieses Flüsschen verlor sich aufgrund der barschen Steinformationen ständig in eine andere Richtung, hielt inne, bildete kleine Seen, um dann einige Meter senkrecht abzustürzen. Mich zwangen diese Stellen zu Umwegen. Immer wieder rutschte ich aus, landete auf dem Hinterteil und glitt abwärts. Nach ungefähr zwei Stunden fand ich aus dem Dickicht. Vor mir lag ein breites Tal. Der düstere Wald wich zur Seite. Die Sonne versuchte, die Nebel etwas aufzuhellen. Mit dem Ergebnis war ich zufrieden.
Durch den willkürlichen Verlauf des Flusses war der Untergrund sumpfig. Bei jedem Schritt sank ich tief ein, ohne in Gefahr zu kommen. Zugegeben, mir war es unheimlich. Meine Stimmung bekam einen weiteren erheblichen Dämpfer, als ich auf Figuren stieß, die aus Aststücken geschnitzt waren und deren unteres Ende im Boden steckte. Drohende, hilflose, ängstliche Gesichter schauten mich an. Es musste hier Menschen geben.
Direkt vor mir, in einer kleinen Ebene, war ein großer Fels, der als Resultat geologischer Aktivitäten vor Jahrmillionen hier Platz gefunden hatte. Langsam umrundete ich ihn. Hinter seiner Rückseite entdeckte ich unzählige Spuren. Eine Ansiedlung musste nahe sein.
Ein querliegender Baumstamm lud mich zur Rast ein. Durchnässt war ich ohnehin, sodass es mir nicht schwerfiel, die widerlichen Umstände zu ignorieren. Was erwartete mich hier? Mit welchen Menschen bekäme ich es zu tun?
Den Mut, mich zu erheben, aufzustehen, mich der Situation zu stellen, brachte ich kaum auf. Ein Grauen hielt mich zurück.
Nach einiger Zeit bildete ich mir ein, ein Wimmern zu hören, das in einem kraftlosen Stöhnen abbrach. Die Töne kamen aus dem wenige Meter entfernten Wald. War jemand verletzt? Vielleicht von einem Tier angefallen?
Meine Lanze senkte ich in Abwehrstellung und tastete mich vorsichtig in die Richtung. Die Dunkelheit spielte mir einen Streich. Es war unter dem Blätterwerk so gut wie nichts zu erkennen. Ich sah Geäst, einen kleinen Steinhaufen, aber kein menschliches Wesen.
Wieder war der schmerzerfüllte Ton zu hören. Vorsichtig fühlte ich die Erde ab. Blätter, Steine, Wurzelteile … ein Arm? Ich zuckte zusammen. Zweifellos, ich spürte einen Menschen. Er reagierte nicht. Mir rutschte das Herz in die Hose. Stille.
Aufgewühlt schaute ich um mich. Hätte ich doch etwas Licht gehabt, um die Situation einschätzen zu können! Mit dem Wenigsten wäre ich zufrieden gewesen. Eine Chance sah ich. Ich stand auf und riss das Blätterwerk auseinander, brach Äste von den Bäumen. Endlich traf ein schwacher Schein an den unheimlichen Ort. Neben einer kleinen Erhebung, die mit Felsstücken bestückt war, steckten ähnliche Holzfiguren, wie ich sie auf meinem Weg zu diesem mysteriösen Ort gefunden hatte. Der Arm, den ich gefühlt hatte, war zwischen Steinen eingekeilt. Zweifellos war ein Mensch darunter begraben und zudem mit allem möglichen Astwerk, sogar Felstrümmern bedeckt.
Als Erstes hob ich das schwere Gestein zur Seite, bis der Rücken des Opfers deutlich zum Vorschein kam. Ich fühlte, dass Leben in der armen Kreatur steckte. Ein weiterer Schrecken folgte: Er war mit Holzkeilen in die Erde genagelt. Ein Schauder überlief mich. Ich biss die Zähne zusammen und riss mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit die Holznägel aus dem Grund und seinen Gliedern. Wahrscheinlich strömte Blut über den Körper des Opfers. Selbst konnte ich es nicht sehen, wollte es auch nicht, doch spürte und roch ich es.
Nachdem ich diese scheußliche Arbeit hinter mich gebracht hatte, legte ich mich an die Seite des Unbekannten und flüsterte ihm einige Dinge zu. Ich hoffte, dass er ein weiteres Lebenszeichen von sich gäbe. Weit gefehlt. Der Tod war ihm längst näher als das Leben.
Für einen Moment resignierte ich. Es war nicht allein das vor mir liegende Elend, das mich überwältigte. Ähnliche Situationen hatte ich in den verflossenen Monaten zuhauf erlebt. Es waren die ganzen Umstände, die mir das Gefühl der Sinnlosigkeit gaben. War ich doch bisher in der Zeitgeschichte tapfer vorwärts gestiefelt, war ich mir jetzt sicher, in die finstere Vergangenheit zurückgeworfen worden zu sein. Womöglich in die Steinzeit? Fing alles wieder von vorne an? Das, was sich vor meinen Augen auftat, konnte ich nicht im Geringsten mit irgendeiner Zivilisation in Einklang bringen. Zudem war der arme Mann nackt.
Nackt. Diese Entdeckung riss mich aus meiner Benommenheit. Wie ich doch selbst fror! Er musste sich längst neben allen anderen Schmerzen eine ordentliche Unterkühlung zugezogen haben. Seine Überlebenschancen sah ich bei null. Trotzdem hob ich ihn vom Boden hoch, stemmte ihn auf meinen Rücken und arbeitete mich in eine Richtung, in der ich Menschen erhoffte.
Schon stockte ich. Waren es nicht Menschen, die ihm das angetan hatten? Womöglich diese, die sich in nächster Nähe befanden? Wenn es so war, lief ich einer doppelten Gefahr entgegen. Wie so oft schob ich die Bedenken zur Seite und hielt mich nur an der Tatsache fest, dass diesem armen Kerl geholfen werden musste. Bei all dem hatte ich Glück, da der Mensch zwar groß, doch schlank und ein Leichtgewicht war. Nach einigen hundert Metern revidierte ich die unbedarfte Feststellung. Tapfer kämpfte ich mich weiter.
Bald roch ich Rauch. Der kalt wehende Wind blies ihn mir in die Nase. Ich hielt stur auf die Richtung zu. Auf einer kleinen Anhöhe erkannte ich einen Flechtzaun. Gewaltsam trat ich mit dem Bein gegen ein Tor, das daraufhin aufschwang. Noch schaffte ich es, meine Last einige Meter weiter zu stemmen, bis ich mit ihr zusammenbrach und auf der Erde landete.
Mit dieser Aktion hatte ich Aufsehen erregt. Aus den wenigen Häusern aus urwüchsigem Fachwerk und strohgedeckten Dächern eilten Menschen hervor und bauten sich vor uns auf. Die wilden Rufe ließen nichts Gutes ahnen. Dass allen der Schrecken im Auge saß, war offensichtlich. Keiner traute sich mit einer Frage an mich heran. Sie stierten erwartungsvoll in eine Richtung. Aus ihr kam eine große Person, ein Blondschopf, der in der Hand eine Fackel trug. Mit schnellem Schritt trat er uns entgegen, warf mit dem Bein meinen Begleiter auf den Rücken und leuchtete uns beiden ins Gesicht.
„Er braucht Hilfe, er liegt im Sterben“, flehte ich, bevor Vorwürfe laut werden konnten.
„Wodan wartet auf ihn“, wurde ich angefahren. „Du hast ihm sein Geschenk entrissen. Er wird dich zerschmettern.“
„Kein Toter darf zurückkommen!“, warf ein junger Kerl ein, dessen Funktion ich nicht zuordnen konnte. Krieger? Bauer? Es passte kaum eines meiner Schemen.
„Er ist nicht tot.“
„Er war es!“, wurde ich angefahren. Diesmal bekam ich den Fuß des Häuptlings zu spüren.
„Eben nicht!“, bestand ich.
„Und wenn schon. Erik ist Wodan versprochen. Der Gott beschützt uns im Gegenzug für dieses Geschenk. Seine Wut wird uns nicht verfehlen.“
„Tötet sie“, klang es wütend aus allen Kehlen.
Dass die Lage wieder einmal nahezu hoffnungslos war, da musste ich mir nichts vormachen. Gegen diese Übermacht hatte ich keine Chance. Wie wollte ich bestehen? In der Todesangst sprang ich auf, fasste meinen Speer und erhoffte mir durch eine andere göttliche Hilfe ein kleines Wunder.
„Ihr fühlt euch Wodan verpflichtet, meinetwegen. Ich bin der Sohn Erdas, Freijas oder Friggs, wählt selbst“, brüllte ich sie an. Dass ich bei einem Germanenstamm gelandet war, konnte ich leicht aus Wodans Existenz erraten. Ich bediente mich der Frauennamen, ohne zu wissen, ob ich mit der Aufzählung richtig lag.
Das allein war es nicht, was Eindruck auf meine Gegner machte. Ich schlug verzweifelt mit dem Speer auf einen Stein, und nun passierte genau das, was ich vor wenigen Stunden in Judäa erlebt hatte: Ein Blitz schoss aus der Waffe.
Die Meute zuckte zusammen. Todesstille. Ich begriff selbst nicht, was geschehen war. Doch es zählte nur, was die Bewohner bewegte: Ich hatte mich als Bote der Götter vorgestellt und das mit einem Zauber unterstrichen. Blitzschnell hatte ich eine Anhängerschaft gewonnen. Unversehens kümmerte sich jeder um den todkranken Mann. Die Aufregung steigerte sich in einen regelrechten Tanz. Den armen Kerl trugen sie in das größte Haus. Es wurde von einem Seher gesprochen, nach dem man auf der Stelle schickte. Schon steckte in meiner Hand ein Stierhorn voller Bier. Ausgebrannt von der Belagerung durch das römische Heer des Feldherrn Titus stürzte ich das Nass in mich hinein. Mich schüttelte es nach wenigen Zügen. Dem süßlichen Gebräu konnte ich nichts abgewinnen.
An jenem Tag geschah nicht mehr viel, der Seher war wohl nicht zu finden. Bezüglich des verletzten Kriegers machte ich mir berechtigte Sorgen. Zwar war er am Leben, doch wurde, was die Behandlung betrifft, von Zaubersprüchen gesprochen. Einer der hellhäutigen Bewohner tröstete mich auf seine eigene Weise: „Wenn ihn Wodan nicht will, bleibt er uns ohnehin.“ Wahrscheinlich war es auf das Getränk zu schieben, dass ich an jenem Abend bald einschlief, allerdings auch wieder früh auf die Beine kam.
Der Junge atmete noch immer. Das war das Erste, was mir am Morgen Zuversicht schenkte. Die Menschen selbst waren mir weiterhin nicht geheuer. Sie waren aus grobem Holz geschnitzt und hatten eine kriegerische, aggressive Art. Es wurde von einem Nachbarstamm gesprochen, mit dem man derzeit in Fehde läge. Eine raubeinige Gangart ergab sich aus den widrigen Lebensumständen und den festen Glaubensvorstellungen. Wodan sollte die geplante Auseinandersetzung zum eigenen Wohle lenken, so war das Opfer zu erklären. Nach diesem Abend begriff ich auch, warum der Todgeweihte festgepflockt und mit Steinen bedeckt wurde: Diese Menschen glaubten an die Wiedergeburt und fürchteten die Rache des Opfers. Durch die Verankerung sicherten sie sich ab. Von den Pfählen konnte er sich nicht lösen und in dieser Situation schon gar nicht die großen Steine von sich heben. Aus mit Wiedergeburt.
Im Morgengrauen sah ich mir die wenigen aus Weidenholz geflochtenen Häuser an, die in ihrer Gesamtheit von einem hölzernen Zaun geschützt wurden. Die aus Dreck getretenen Straßen waren durch den nächtlichen Regen kaum passierbar.
Hier konnte der Junge nicht überleben. Ich sah es klar vor Augen. Gab es eine Alternative? Mehr instinktiv wandte ich mich an eine Frau, die an mir vorbeigehen wollte, um Wasser zu besorgen. „Wo ist das nächste Römerlager?“
„Römer? Was willst du von ihnen?“
„Sie werden doch bestimmt Ärzte haben.“
„Mag sein. Sie haben alles. Wir wollen nichts mit ihnen zu tun haben.“
Wie ich aufatmete! Römer waren bekannt. Also war ich nicht in die frühe Vergangenheit zurückgekehrt.
„Welcher Cäsar regiert?“
Sie spie vor mir voller Verachtung aus. „Domitian.“
„Nicht Vespasian oder Titus?“
„Beide tot. Domitian hat das Erbe seines Bruders längst angetreten.“
Titus war tot, der Schänder Jerusalems. Mit der Erkenntnis begann der Tag in einem neuen Licht. Weiterhin befand ich mich auf dem Weg in meine geliebte Gegenwart.
„Wie weit ist es zu den Römern?“
„Wenn du auf den Berg steigst, siehst du ihre Türme.“
„Du meinst, wir sind dicht bei ihnen?“
„Mit den Türmen haben sie eine Grenze gezogen, und das ist gut so.“
„Und eine Stadt oder Befestigung gibt es ebenfalls?“
„Jenseits der Türme hat es Straßen, die zu Kastellen führen.“
Ich rannte in den kargen, großen Raum, wo der arme Wicht behandelt wurde, schulterte ihn bedachtsam und zog los, der Grenze entgegen, die mir beschrieben worden war. Nur so sah ich eine Möglichkeit, ihm das Leben zu retten.
Die gastfreundliche Sippe warf mir sonderbare Blicke nach. Ich ging unbeirrt meinen Weg und verließ mich darauf, dass die Türme nah waren. Regelmäßig setzte ich den Verletzten ab, schnaufte aus und kämpfte mich darauf erneut ein- oder zweihundert Meter weiter. Zu meinem Leidwesen war die Steigung zur freien Hochfläche äußerst kräfteraubend. Wie atmete ich auf, als ich die beiden Türme, die in einem beträchtlichen Abstand standen, vor mir sah. Den Nächsten steuerte ich an. Auf seiner Aussichtswarte waren zwei Personen zu sehen, die auf mich zeigten. Wieder setzte ich den armen Kerl ab, um ein weiteres Mal Kraft zu tanken. Meine Anstrengungen blieben den Fremden nicht verborgen. Wahrscheinlich sandten sie mir aus diesem Grund einen Krieger entgegen.
„Alles klar?“, wunderte der Soldat sich, dessen Ausrüstung eindeutig das Römertum verriet.
„Ave“, grüßte ich ihn. „Ich habe dieses Opfer in den Wäldern gefunden und brauche dringend einen Arzt. Gibt es einen Ort oder ein Kastell, wo uns jemand helfen kann?“
Ein kurzer Blick des Legionärs genügte, um die Situation zu erfassen. „Unsere Ärzte heilen Freunde, die von solchen Typen niedergemetzelt wurden. Jeder von ihnen, der in seine Heimstatt fährt, ist uns recht.“
„Ist das auch dein Wille?“ Mit dieser Gegenfrage überforderte ich ihn. Natürlich war es seine Ansicht. Was sollte er mit meiner Entgegnung anfangen? „Ich werde ihn nicht totschlagen“, trotzte ich demonstrativ. „Deine Vorstellung mag das überfordern. Dieser Streich wäre allerdings unfair und unserer nicht würdig.“
„Was weiß ich“, wich er aus.
„Hilfst du mir?“
„Auch das noch!“
Nach kurzem Zögern hob er den Verletzten gemeinsam mit mir hoch. Zusammen trugen wir ihn zu seinem Turm. Mein sonderbares Anliegen stieß bei der Besatzung, die aus vier Legionären bestand, auf wenig Verständnis. Diese Anzahl von Personen war angeblich die übliche Besetzung für so einen Tower. Meine Befürchtung, dass Menschlichkeit in diesen Kampfmaschinen nicht zu erwarten war, bestätigte sich nicht. Ehrlichkeit, Offenheit, Milde, aber auch Einfühlungsvermögen halfen mir, den Zugang zu ihnen zu finden.
„Bist wohl Philosoph“, sprach der Wortführer der vier mich an. „Nimm dich da in Acht. Unser großer Gebieter hält nicht viel von Wissenschaftlern und wirft sie bestenfalls aus dem Land.“
Wir wurden in den Turm gebracht und der Verletzte im untersten Stockwerk des Steinturmes auf weichem Stroh gebettet. Immer wieder kam er zu sich, schrie wirre Sätze heraus, schlug manchmal gar um sich und verfiel dann erneut in einen Dämmerzustand. Die Legionäre tauschten eindeutige Blicke aus, die sagen wollten: Was will er mit diesem Kerl, da ist doch nichts mehr zu machen. Sie waren trotz allem so freundlich, mich bis zur Mittagszeit zu vertrösten. Dann sollte eine Kutsche vorbeikommen, die uns unter den glücklichsten Umständen in ein nahes Kastell bringen konnte. Währenddessen wurde mir erlaubt, durch ein weiteres Stockwerk, in dem sich die Soldaten vorwiegend aufhielten und sich mit Spielen oder kleinen Arbeiten beschäftigten, zur obersten Ebene aufzusteigen. Auf einer Balustrade, die rings um das Bauwerk führte, bewunderte ich die weite Sicht in alle Richtungen. Ein einfallender Feind war von hier aus früh zu erkennen.
„Die Landesgrenze?“, stellte ich bei meinen Betrachtungen fest.
„Da liegst du richtig. Unser Herr hat an der Stelle einen Limes beschlossen.“
„Limes? Das hier soll der Limes sein? Ich sehe nur Türme, keinen Zaun und keinen Schutz.“
„Reicht das nicht? Wir Wächter sehen uns gegenseitig und können die Kohorten schnell zu Hilfe rufen, wenn ein Einfall dieser wilden Germanen droht. So schlagen wir sie problemlos zurück.“
Ich hatte andere Bilder im Kopf. Die Römer würden bald erfahren, dass dieser Schutz nicht genügte. Die Grenzmarkierung würde sich nach Jahren zunächst zu einem Palisadenzaun entwickeln, und irgendwann würden an vielen Bereichen massive Mauern stehen, die auch nicht ewig sein konnten. Einem Völkersturm war keine Absperrung gewachsen. Der allerdings war längst nicht vorauszusehen.
„Ich trauere dem alten Vespasian nach“, bemerkte einer der Legionäre, während er sich an seinem Helm zu schaffen machte.
„Weshalb? Haben wir Soldaten zu klagen? Mit dem Senat soll Domitian, unser neuer Herr, seine Probleme haben. Was kümmert uns das im weiten Norden?“
„Habe ich das recht verstanden?“, mischte ich mich ein. „Auch er ist ein Sohn Vespasians?“
„Warst wohl lange in den Herkynischen Wäldern, was? Jeder weiß über diese Flavier Bescheid.“
„Ging an mir vorbei“, stellte ich mich dumm.
„Na ja, Domitian stand immer im Schatten seines Bruders Titus. Man sagt, er wäre nie in politische Entscheidungen eingebunden gewesen. Was willst du sonst noch wissen? Nachdem der Bruder den Tod fand, kam er, der jüngste Flavier an der Reihe.“
„Titus lebt also nicht mehr, wie auch der Vater Vespasian?“
„Das waren noch Feldherren! Junge, von denen kann man nur träumen. Nicht umsonst hat sich Titus einen Triumphbogen verdient.“
„Vermutlich, weil er das jüdische Volk zerstört hat.“
„Vernichtet! Zerstört ist zu wenig.“
Mir wurde vor dem Bauwerk übel. Die Erinnerungen stachen mit scharfen Klingen in meine Seele.
Wie vorhergesehen, traf nach einiger Zeit ein Gespann ein, das Lebensmittel für die Besatzung mit sich führte. Mit etwas Überredung willigte der Kutscher ein, uns einen kleinen freien Flecken auf der Pritsche zur Verfügung zu stellen. Wir machten es uns bequem, während er ein Kastell anvisierte. Die Schmerzen meines Anvertrauten waren unüberhörbar.
Durch ein großes Tor wurden wir in die Garnison eingelassen, die mehr an eine kleine Stadt erinnerte. Ich hatte ein Legionslager erwartet, in dem ein Zenturio vorstand, Befehle gab und das Leben nach einem festgeschriebenen System vor sich ging. Das Gegenteil war der Fall. Statt römischen Legionären sah ich als Erstes einige spärlich bekleidete Germanen, die unterschiedliche Erzeugnisse auf einem Markt erworben hatten. Sie zeigten sich gegenseitig die Schmuckstücke und Waffen, die sie erstanden hatten. Ein römischer Soldat saß vor einer Baracke und schlug Nägel in einen seiner Schuhe.
„Jeder ist für seine Ausrüstung selbst verantwortlich“, erfuhr ich dabei.
In der Folge durchquerten wir den Markt, in dessen Bild die germanischen Blondschöpfe einen festen Platz hatten. Teilweise trugen sie merkwürdige Haarknoten an der Kopfseite.
„Der Suebenknoten“, ließ ich mir erklären. „Es müssen aber keine Sueben sein. Dieser Haarknopf ist Mode der Wilden. Dass man sie überhaupt unterscheiden kann, ist ein Wunder.“
Mit heftigen Schlägen trieb ein Schmied Metall. Ein Römer warf eine Rüstung vor ihm auf die Erde.
„Macht mir einen Helm daraus!“
„Was ist mit deinem alten?“
„Beim letzten Ausritt fiel er mir vom Kopf.“
„Hast deinen Skalp vor einem Blondköpfigen retten können?“
„Wird wohl so sein. Mein Begleiter braucht den Panzer nicht mehr.“
Der Schmied nahm das Eisenstück und warf es zum Einschmelzen in einen Tiegel. „Sie gehören alle in den Hades“, murrte der Handwerker, wobei er verächtlich in die Menge schaute. „Man weiß bei denen nie, wann sie uns den Hals umdrehen.“
„Unser Zenturio hat es in der Hand. Er sorgt für den nötigen Respekt. Nicht umsonst macht er dieser Tage einen Ausflug in die Herkynischen Wälder. Er wird diesen Germanen das Fürchten lehren.“
Wir kamen in dem wilden Gedränge nur langsam voran. Vor einem größeren, aus Stein gemauerten Gebäude mit weiß getünchten Wänden, dem Magazin, stoppte der Kutscher das Gespann. Vor dem Eingang saßen einige Legionäre, die mit Würfelspielen beschäftigt waren. Das Lagerleben musste wohl öd und langweilig sein.
„Den Arzt findest du dort. Lass dich überraschen, was er mit deinem Kerl anstellen wird. Erwarte keine Wunder.“
Ich bedankte mich und ließ mir dabei helfen, ihn über meinen Rücken zu legen. Ein Klopfen am Eingang sparte ich mir. Selbstbewusst trat ich ein.
„Was bringst du mir?“, fragte der verwunderte Mediziner, während er von seinem grobgezimmerten Stuhl aufstand.
Anstatt einer Antwort ließ ich meinen Schützling auf den Tisch gleiten. Ein mächtiges Stöhnen offenbarte die Not.
„Was soll ich mit ihm?“, fuhr er mich an.
„Bist du in der Lage, ihm zu helfen?“, blieb meine Erwiderung. Den Zynismus des Arztes ignorierte ich. Mit bedachten Worten schilderte ich den Zustand, wie er geschändet war und wo sich die Verletzungen befänden.
Instinktiv untersuchten seine Augen den Wunden, und längst überlegte er, wie eine Lösung anzupacken wäre.
„Meinst du, er überlebt?“
Eine Antwort blieb aus. Es war mir gleich, Hauptsache, er lehnte sich nicht gegen eine Behandlung auf. Währenddessen schaute ich aus dem kleinen Fenster auf den Markt. Nie hatte ich mich an den Anblick der entsetzlich klaffenden Wunden gewöhnt. Diesem Grauen wich ich aus. Der Germane stöhnte. Bislang hatte er kein Fieber, das einen Wundbrand angezeigt hätte. Er war wohl ein robuster Kerl. Der Arzt versah die Verletzungen mit heilenden Salben und bandagierte sie tapfer.
So lange lief alles zu glatt über die Bühne. Das sollte sich in den nächsten Augenblicken ändern. Die Tür flog auf. Ein Soldat, die Brust gespickt mit Auszeichnungen, trat ein. Sein erster Blick fiel auf den Verwundeten, den er gleich als Barbaren erkannte.
„Du heilst Feinde?“
Etwas hilflos sah der Medikus den Eindringling an. „Vermutlich ist er ein Freund der Römer. Viele der Legionäre wurden als Barbaren geboren und dienen inzwischen unserem Kaiser und verteidigen das Reich.“
Das Ganze klang mehr wie eine Entschuldigung, keinesfalls wie eine gestandene Rechtfertigung. Ich ahnte, was passieren musste. Schon hatte der Soldat sein Schwert gezogen, und mit dem unbeherrschten Satz „die Arbeit kannst du dir sparen“ hätte er das arme Opfer in der Mitte gespalten, wäre mein Speer ihm nicht ebenso schnell durch den Oberarm gedrungen, sodass seine Waffe nach einem entsetzlichen Aufschrei auf der Erde zu liegen kam.
Was sich nun abspielte, kann ich selbst nicht vollständig abrufen. Der Arzt ergriff pflichtbewusst Partei für seinen Kollegen und wurde mir gegenüber handgreiflich, während der verletzte Römer aus dem Zimmer stob, wilde Flüche und Befehle brüllend. Derweil ich Mühe hatte, mich von dem Mediziner zu befreien, entbrannte im Außenbereich eine Auseinandersetzung zwischen Römern und den germanischen Gästen. Natürlich wurde die Lage außen falsch interpretiert. Wir wurden als Teil des barbarischen Volkes angesehen, und die Germanen selbst vermuteten eigene Stammesgenossen hier im Krankenzimmer in Gefahr. Die Konsequenzen waren bitter: Zwei Blondschöpfe brachen in unser Zimmer ein und enthaupteten kurzerhand den hilflosen Arzt. Ich nutzte das Chaos, zog den Verletzten ins Freie und hievte ihn auf eine Kutsche, in der wir gemeinsam mit dem germanischen Heer entkamen. Welches Glück, dass die Garnison so gut wie leergefegt war. Denn bei mäßiger Besatzung hätten die Römer uns Aufrührer, trotz des gnadenlosen Kampfwillens der Germanen, in alle Einzelteile zerlegt.
Selbst nachdem wir eine beachtliche Wegstrecke zurückgelegt hatten, klang das Kriegsgeschrei nicht ab. Die Begeisterung, einen kleinen Sieg davongetragen zu haben, heizte die Menschen derart auf, dass man die Realitäten verkannte. Keiner hinterfragte, warum es zu der Prügelszene gekommen war. Mein verletzter Freund und ich waren im Schatten der Geschehnisse untergetaucht. Nur einer fragte nach, wer wir seien.
„Zufällige Besucher“, sagte ich. „In dem ganzen Getümmel haben wir uns in Gefahr gesehen. Ich entschied daher, mit meinem Freund zu verschwinden. Bestimmt hätten sie uns ansonsten erschlagen.“
„Klug gedacht“, erhielt ich zur Antwort, und schon gehörten wir zur Gemeinschaft. Wie einfach es sich dieses Volk machte!
Wir verbrachten die kommenden Tage in einem germanischen Dorf. Aus Steinen und Holz erstellte Langhäuser mit Strohdächern waren auf einem Bergrücken erbaut worden. Am ersten Abend wurde ich vor einen großen Kessel geführt, den ich mit Zaubertränken in Verbindung brachte. Aus ihm erhielt ich eine Portion eines Gebräus, das aus Emmer, Feldbohnen, Speck, Wasser und Essig gebraut wurde. Es sättigte. Damit war ich zufrieden. Meinen Freund hatte ich in einem Zimmer untergebracht, wo er die nötige Ruhe fand. Seine Wunden begannen zu heilen. Nach einer guten Woche war er in der Lage, sich aufzusetzen, wobei er ängstlich und scheu jeden Gast empfing. Zumindest kannte ich jetzt seinen Namen: Gunthwald.
Dass es bei dem Frieden, der sich in den ersten Tagen eingestellt hatte, nicht bleiben konnte, war klar. Die aus verschiedenen Richtungen zurückkehrenden Legionärseinheiten trafen in ihrer Garnison die erschlagenen Freunde an. Von einem Boten wurde uns zugetragen, dass zur Vergeltung für dieses Vergehen Reitereinheiten angefordert worden waren. Der zuständige Prätor durfte den Vorgang nicht ignorieren. Der Häuptling unseres Germanenlagers, der selbst nicht bei den Ausschreitungen zugegen gewesen war und von all dem ebenfalls überrascht wurde, erhielt nur spärliche Auskünfte über die Geschehnisse. Eine Auseinandersetzung mit den Römern lag keinesfalls in seiner Absicht. In seiner Bedrängnis rief er einen Seher zu sich. Dieser ließ sich die Lage schildern.
Sein Vorschlag war wenig erbaulich: Er beabsichtigte mit den Römern in Verhandlungen zu treten, sie von einem Einmarsch abzubringen und als Dank für ihr Verständnis die Schuldigen Wodan zu opfern. Die Köpfe der Betroffenen wollte er den Anklägern schenken. Offenbar hatte der Gott keine Verwendung für dieses Körperteil.
Die Schuldigen? Das war zweifelsohne ich. Durfte ich mich hinter anderen verstecken, die mir durch ihre Raserei das Leben gerettet hatten? Der Entschluss des Häuptlings traf mich wie ein Faustschlag. Die ganze Misere war dabei, sich zu einem Drama zu entwickeln. Um einen Todgeweihten zu retten, waren 15 bis 20 Römer getötet worden. Ein Germanendorf stand vor einer Totalzerstörung, und ich selbst hatte es am Ende zu verantworten. Wo begann mein Fehler, wo meine Schuld? Ich hatte in die uraltgermanischen Riten eingegriffen und den Kreislauf ihrer Gerechtigkeit gestört. Die Sitte hätte von mir gefordert, Gunthwald elendiglich verrecken zu lassen. An dieser Stelle musste ich mich bremsen. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Meine Hilfe zu verweigern war ein Ding der Unmöglichkeit. Stand mein Rechtsempfinden gegen das der Barbaren? Eindeutig ja.
Etwas anderes wurde mir bei der Betrachtung bewusst. Es war nicht meine Tat, die zum Chaos führte, es war die Gewalt, die vor meinem Erscheinen ausgeübt worden war. Wird eine solche gesät, trägt sie bittere Früchte. Erlebte ich das nicht ständig und überall?
Den Seher hatte ich bislang gemieden. Ich hielt mich im Wesentlichen in dem Gebäude auf, in dem auch Gunthwald untergebracht war. Die Menschen in diesem Sippenhaus waren freundlich und fürsorglich. Natürlich half ich bei verschiedenen Arbeiten, holte beispielsweise mühsam Wasser aus einem nahen Bach, der über einen leichten Abstieg erreichbar war. Der Häuptling scherte sich wenig um mich. Er beriet die meiste Zeit mit dem Seher. Einige Male sah ich jenen aus der Ferne, hätte aber allein aus der Erscheinung schwer seine Funktion erraten. In braunen Hirschlederkleidern mit unterschiedlichem Schmuck, der auch von den Römern zu stammen schien, stach er deutlich heraus.
Mit der Suche nach den Verantwortlichen begannen für mich trostlose Stunden. Natürlich war nie auszuschließen, dass der Verdacht am Ende automatisch auf mich fiele. Ich hatte keine Ahnung, wie sich die Abläufe vor dem Arztgebäude zugetragen hatten. So blind konnten die Beteiligten nicht gewesen sein, dass ihnen dieses Gebäude als Quelle des Problems verborgen blieb, zumal Todesangst die Erinnerung wachrufen musste.
Meine Beine zitterten, als ich in den Raum des Sehers trat. An seiner Seite saß der Häuptling, dessen Redefluss ich unterbrach.
Nach einer Entschuldigung kam ich sofort auf den Kern des Problems zu sprechen. „Herr, wenn Ihr einen Schuldigen für die Ereignisse in dem Rö-merlager sucht, so müsst Ihr mich anhören, bevor Unschuldige getötet werden.“
„Du kannst dazu etwas sagen?“ Der Seher sah mich erstaunt an. Er war relativ jung, vielleicht knapp über 30 Jahre. Seine stahlblauen Augen warteten auf meine Antwort.
„Die Gewalt ging nicht von unseren Kriegern aus, sondern von den Römern selbst.“
Stirnrunzeln. Erwartungsvoll wurde einer Begründung entgegengesehen.
„Ich hatte einen Schwerverletzten ins römische Lager gebracht. Die einzige Hilfe, die ich mir für ihn erhoffte, war die des Legionsarztes. Dieser lehnte den Dienst auch nicht ab. Allerdings trat ein hoher Offizier ins Zimmer, der wenig Verständnis zeigte, dass ein Barbar, wie er ihn nannte, behandelt wurde und entschied, meinen Freund zu erschlagen. Ich nahm ihn in Schutz. Durch den Tumult kam es zu den Exzessen. Keinem Krieger deines Volkes kann ein Vorwurf gemacht werden.“
„Was soll ich mit dem Gerede anfangen?“, warf der Häuptling dazwischen, während er einen großen Schluck eines Gebräus aus einem Horn in sich hineinschüttete. „Meinst du, ein Römer findet jemals eine Schuld bei sich?“
„Wohl kaum“, bestätigte der Weise. „Entweder finden wir Verantwortliche auf unserer Seite, oder es wird ein blutiges Spiel.“
Die Aussage brannte wie Gift in meinen Gliedern, doch verstand ich die Problematik.
Der Weise wandte sich mir zu. „Ich will deine Worte bei den Gesprächen mit Bedacht anführen. Vielleicht können wir ein Blutbad verhindern. Junge, was spricht für deine Geschichte?“
Mit der Frage wollte er wohl nach Beweisen forschen. Der Häuptling verstand ihn sofort und meldete sich zu Wort. „Der Verletzte liegt im Nebenhaus. Du kannst ihn selbst befragen.“
Beide erhoben sich auf der Stelle und suchten Gunthwald auf. Er empfing sie aufgestützt auf den Armen. Kaum erkannte der Germane die Hereinstürmenden, verfiel er in panische Angst, zitterte am ganzen Leib, schrie ohne jegliche Kontrolle auf und schlug um sich. Ich hatte keine Chance, ihn zu beruhigen.
„Siehe“, rief ich bei dem Lärm dem Seher entgegen, „wie krank er ist! Ihm muss unbedingt geholfen werden.“
„Wo ist dein Speer?“
Ich verstand nicht.
„Wo ist dein Speer?“, brüllte der Medizinmann mich an.
„Dort in der Ecke“, antwortete ich verwundert.
Er griff ihn sich, knallte die Spitze auf den harten Boden, und es geschah … nichts.
„Mir wurde berichtet, du wärst ein Gott.“
Er warf mir den Speer entgegen und befahl, zu zeigen, wozu ich fähig wäre. War er jener Seher, der von der Sippe gerufen wurde, auf die ich zuerst getroffen war? Nur so konnte ich mir diese Aktion erklären. Sie hatten ihn von meiner göttlichen Sendung unterrichtet. Ich ahnte, dass mich der Blitz dieses Mal im Stich lassen würde. Einen Versuch wagte ich daher gleich gar nicht.
„Es wird manches gesprochen. Oft findet man für Erscheinungen schwerlich Deutungen“, umging ich die Aufgabe.
„Ich war es, der Wodan diesen Narren schenkte. Du hast dich dem Gott widersetzt. Und sieh, was daraus entstand! Die himmlischen Mächte wüten.“
„Gib mir nicht die Schuld“, verteidigte ich mich. „Ich habe einen um sein Leben kämpfenden Menschen gefunden und geholfen. Ich sehe es als meine Aufgabe, Leben zu retten, nicht zu zerstören. Der, der den Grundstock für die Gewalt gelegt hat, der trägt die Verantwortung.“
„Und wer ist das deiner Meinung nach?“
„Das Gesetz, das eine solche scheußliche Tat rechtfertigt.“
„Sprichst du von den Göttern?“
Ich schwieg. Wieder einmal hatte ich mich in naiver Weise selbst in die Enge getrieben.
Zum Häuptling gewandt fragte der Seher: „Er ist dein Gast?“
„Ja, Herr. Das Gastrecht schützt ihn.“
„Bis zum Morgen. Nach dem Gesetz der Natur ist diese Nacht sein. Sobald die Sonne sich erhebt, erwarte ich ihn mit den Kriegern auf dem Thingplatz. Sein Blut soll uns mit den Göttern versöhnen.“
Wutentbrannt stürmte er aus dem Zimmer. Der Häuptling folgte ihm, wobei dieser nicht ganz begriffen hatte, wovon wir gesprochen hatten. Ich stand wie versteinert an Ort und Stelle, betrachtete meinen Speer und Gunthwald.
Es konnte nur einen Weg geben: die Flucht.
„Gunthwald, wie stark sind deine Schmerzen? Kannst du stehen? Wir werden fliehen müssen.“
Der arme Kerl stellte sich wackelig auf seine Beine. Besser als tragen, sagte ich mir.
„Weit wirst du so nicht kommen.“
Angst zeichnete sich in seinem Gesicht ab.
„Wir werden es aber versuchen müssen.“
Die kommende Stunde verbrachten wir mit Gehversuchen. Mein Freund wurde immer sicherer, doch waren die Grenzen klar erkennbar.
Die Hoffnung, dass alles doch noch zu meistern wäre, brach in dem Moment zusammen, als sich Wachen vor unsere Türe stellten. Eine Flucht, zumal mit dem behinderten Freund, schminkte ich mir ab. Mit einem furchtbaren Gefühl in der Magengrube ließ ich mich in der Ecke nieder und vergrub meinen Kopf.
An Schlaf war nicht zu denken. Gähnend starrte ich ins Leere. Zum Aufstehen fehlte mir die Energie. Ich gab uns auf. Bei einer Bewegung stieß ich mit der Hand gegen meinen Speer. Er war mir geschenkt worden. Was sollte ich mit ihm? In der Verzweiflung rappelte ich mich hoch und schlug mit ihm auf die Erde, um mich zu vergewissern, dass er nutzlos war. Ein dumpfer Schlag. Keine Erscheinung. Er steckte mit seiner Spitze in dem hartgetretenen Erdenboden.
Spitze – Flintstein! Mit Flintstein verband ich eine der ersten Erfahrungen auf meiner Reise: Feuer. Aufgeregt küsste ich den dürren Holzschaft. Das war die Lösung.
Auf der Stelle zertrümmerte ich den Stiel der Waffe, um möglichst geschickt mit dem Stein hantieren zu können. Zwar war es in dem Raum dunkel, doch ertastete ich Strohhalme und Mauerstein. Ob ich an ihm einen Funken aus meiner Flintspitze zaubern konnte? Die Fertigkeit war mir eigen. Ich warnte Gunthwald, ehe ich mit den ersten Schlägen ansetzte. Seine Antwort blieb aus.
Unmittelbar nach einigen gezielten Hieben stellte sich der Erfolg ein. Gunthwald ließ sich von dem zarten Funkenflug begeistern. Sofort strich er selbst Strohhalme zusammen und hielt sie direkt an meine Schläge. Nun wusste ich, wir waren ein Team. Es fühlte sich gut an. Die dürren Halme begannen zu glimmen. Gunthwald blies mit sanftem Druck in die Glut und brachte so eine kleine Flamme zustande, die wir nährten.
Mein Ziel war es, das Gebäude in Brand zu setzen und Chaos zu stiften, um hoffentlich im Durcheinander und mithilfe der Dunkelheit zu entkommen.
Alles, was sich brennbar anfühlte, trugen wir auf die dem Eingang entgegengesetzten Seite und positionierten die Ästchen, die inzwischen wie Fackeln brannten, dazwischen. Es gelang. Bevor uns der Rauch zur Gefahr wurde, rissen wir die Türe auf und legten mit wilden Rufen und Gesten den Keim zu der darauffolgenden Panik. Natürlich waren unsere Wächter mit der unerwarteten Situation überfordert. Der Gedanke an die zerstörerische Gewalt des Feuers drängte sofort jede andere Verantwortung zur Seite, und schon explodierte das Lagerleben. Häuser waren existenziell und die Rettungsaktion aus diesem Grund elementar. Der Übergriff auf weitere Gebäude musste vermieden werden.
Unsere Flucht gelang währenddessen. Gunthwald kämpfte sich die erste Stunde tapfer vorwärts. Wie viel Strecke wir dabei gutmachten, kann ich nicht sagen. Sie war nicht die Welt, doch jeder Kilometer zählte. Mein Freund hielt sich dicht hinter mir. An beschwerlichen Stellen, und die gab es zuhauf, ließ ich ihm Zeit und half beharrlich über diese und jene Barriere. Straßen wie auf der römischen Seite fanden wir hier nicht. Schluchten, Bäche, einbrechendes Unterholz, dunkle Nadelholzwälder, all das bremste uns ungemein und schützte uns doch gleichzeitig vor Verfolgern. Sie mussten mit denselben Unwägbarkeiten kämpfen und hatten zudem den Nachteil, dass sie nicht wussten, wohin wir geflohen waren.
Das dachte ich jedenfalls.
Als der neue Tag längst angebrochen war und die Sonne unsere Flucht erheblich erleichterte, wählten wir den Pfad über eine Anhöhe. Gunthwald und ich hatten keinen Grund, uns in Sicherheit zu fühlen. Eine unterschwellige Angst war mehr als begründet. Noch am selben Abend hörten wir die Gefahr: Hunde. Mein Freund begriff ebenso schnell wie ich. Die Sippen hetzten ihre Köter auf uns! Wir durften nicht entkommen. Ihr Leben war von dem Erfolg, uns Wodan zu opfern, abhängig. Gab es eine Möglichkeit zu entkommen? Wege im Wasser zurücklegen, kam mir in den Sinn, doch die Bäche waren reißend und gefährlich. Mit ständigem Bangen hofften wir, dass sich das Geheul in einer anderen Richtung verlöre. Dem war nicht so. Feuer legen? Uns fehlte die nötige Zeit, um damit etwas zu erreichen. Zudem war meine Flintspitze in dem Dorf zurückgeblieben.
Gunthwald war am Ende. Er hatte alles gegeben. Erschöpft sackte er in sich zusammen und blieb zwischen einigen vermoderten, längst abgestorbenen Baumstämmen liegen. Es hatte keinen Sinn, ihn weiterzutreiben. Die Meute würde uns finden. Warum sollte ich mir etwas vormachen? Auch ich setzte mich zu den verfaulenden Bäumen. Mit einem festen Händedruck signalisierten wir uns, die letzten Augenblicke zusammen durchzustehen.
Konzentriert starrte ich in die Richtung, aus der die Hunde auftauchen müssten. Hatte es einen Sinn, sich gegen sie zu stellen? Ganz sicher würden sie uns in Windeseile zerfetzen. Die Anspannung stieg. Der Lärm war inzwischen so groß, dass sie jeden Moment durch das Dickicht brechen mussten. Zwei, drei Bestien schossen durch das Blätterwerk. Fast gleichzeitig fegte aus einem Wurzelstück ein anderes Tier hervor.
Barak!
Mein Fuchs jagte quer an den keifenden Ungetümen vorbei und abwärts in eine Mulde. Sie waren derart irritiert, dass sie dem Rotfell nachsetzten. Welche Last fiel von mir ab! Die nachfolgenden Jäger folgten mit Gewissheit dem Gebell, das sich jetzt im Tal verteilte. Wir waren zumindest für eine kurze Zeit in Sicherheit.
„Aufwärts!“, befahl ich Gunthwald. Am ganzen Leib zitternd schloss er sich an.
Bald wieder außer Atem erreichten wir eine Höhe. Der Lärm der Hunde hatte sich in der Ferne verloren.
Was für ein Ausblick! Direkt vor uns wand sich ein Fluss durch ein weites Tal. Neckar, Main, vielleicht gar die Donau. Ich konnte das Gewässer nicht zuordnen, war mir jedoch sicher, dass wir vor einem dieser Flusssysteme standen. Kein gezähmter Flusslauf breitete sich vor uns aus, nein, ein wildes, mit Stromschnellen gespicktes Wasser, das unmöglich zu durchqueren war.
„Wohin soll es gehen?“, ertönte aus dem Halbschatten einer Buche eine Stimme.
Wir zuckten zusammen. Aus dem Dunkel trat eine hohe, rüstige Gestalt.
„Keylam?“ Fassungslos starrte ich den weisen Freund an, dem ich vor ewig langer Zeit am Luvavo begegnet war. Ihn verband ich mit meinen Erlebnissen bei den Kelten.
„So kannst du mich nennen.“
„Du lebst?“, stammelte ich hilflos, wobei mir Tränen aus den Augen liefen.
„Warum sollte ich es nicht?“
„Keylam, es sind Jahrhunderte vergangen.“
„Junger Freund, du irrst, wenn du glaubst, den Menschen von damals vor dir zu sehen.“
„Wer bist du dann?“, fragte ich verwirrt.
„Die Sorge.“
„Du bist ein Gefühl?“
„Sieh in dich. Was bist du?“
„Kein Mensch?“
Keylam durchbohrte mich mit seinem Blick und zögerte mit einer Antwort.
„Bitte sage es mir“, flehte ich ihn an. „Als was siehst du mich?“
„Du bist die Menschlichkeit und damit verbunden die Liebe und die Hoffnung.“
„Willst du daher mein Leben schützen? Keylam, was redest du? Ich bin ein Mensch. Sieh her, meine Hände, meine Beine, meine Arme ...“
„Es sind die Werkzeuge, die uns geschenkt wurden und mit denen wir die Aufgabe erfüllen müssen.“
„Welche Aufgabe? Woher haben wir sie bekommen?“
„Sie ist der Weltwille. Der Wunderstoff der Menschlichkeit muss für das allentscheidende Gleichgewicht sorgen.“
„Nein, lieber Keylam. Das hast du dir gut erdacht. Alles um mich ist nur ein böser Fluch. Ich selbst habe keine Bedeutung. Ich bin ein junger Mensch und werde das alles kaum überleben.“
„Wir unternehmen alles, um dich zu erhalten.“
„Wer ist wir?“
„Die Weisheit, die Vorsicht, die Sorge.“
„Sieh doch selbst: Wieder bin ich hier in einem Land, das nur Grausamkeiten kennt. Dieser Barbarei sind wir hilflos ausgeliefert.“
„Du sprichst von den vielen Stämmen der Germanen, wie sie Julius Cäsar einst taufte?“
„Zählst du dich nicht zu ihnen?“
Keylam lächelte. „Diese Völkergruppe schob sich wie ein Keil zwischen das gewaltige, unüberschaubare Volk der Skythen im Osten und den Galliern oder Kelten, wie du sie nennen magst, im Westen.“
„Und steht jetzt vor den Grenzen des Römischen Reichs.“
„Ja, mein Junge. Zeit ist Veränderung. Nie wird ein Land, ein Reich so erhalten bleiben, wie du es zu deiner Geburt antriffst. Ewig ist alles im Fluss.“
„Diese germanischen Stämme treffen wie eine Speerspitze auf das Weltreich.“
„Ist es so?“ Keylam runzelte die Stirn. „Können diese kleinen, wilden Haufen eine Gefahr für das organisierte Großreich werden?“
Nun war ich verunsichert. Wusste dieser weise Seher nichts von der Zukunft? Ich sah meine Aufgabe nicht darin, ihn aufzuklären, und blieb eine Erklärung schuldig. Ein kräftiger Windstoß ließ das Blätterwerk schwerer Buchen aufbrausen, die unweit von uns standen. Keylam schaute sich verstört um und zog mich ein Stück abwärts in den Wald hinein.
„Witterst du Gefahr?“, wunderte ich mich.
„Du nicht?“
„Nein ... Oder doch? Ich weiß nicht“, antwortete ich zögerlich.
„Ich dachte, du hättest schon längst den Instinkt für sie gefunden.“
„Zugegeben, nicht immer. Diese ganze Welt ist für mich grausam. Gefahr ist ständig und überall.“
Keylam ließ nicht locker und zog mich noch weiter in das immer dichter werdende, widerborstige Geäst.
„Was hast du vor?“ Ich widersetzte mich, erkannte aber schnell, dass wir in der Düsternis sicherer waren. „Wir können Gunthwald nicht im Stich lassen.“ Er war zurückgeblieben. Erst jetzt wurde es mir bewusst.
„Ich werde mich um ihn kümmern. Es ist dir auferlegt, deines Weges zu gehen“, drängte er in einem merkwürdigen Ton.
Beim Weitergehen stolperte ich über eine Wurzel und wollte mich erheben.
„Schütze dich mit einem Speer!“, zischte er mir zu.
„Keylam, ich sehe keinen Feind.“
„Doch ist er hier. Ganz nah. Wir vermögen nicht auszuweichen. Es ist sinnlos.“
Aufgeregt versuchte ich rings um uns, den Grund zu finden. Er sah die Hilflosigkeit in meinen Augen.
„Germanen?“, flüsterte ich.
„Es ist nie ein Volk, das dir schaden muss, es sind immer Mächte.“
„Das ist doch Wahnsinn! Ich werde mich nicht 2.000 Jahre gegen diese ständigen Attacken wehren können.“
Keylam schwieg. Angst zeichnete sich in seinem Mienenspiel ab.
Ohne Unterbrechung suchten meine Blicke in dem dichten Grün nach Anzeichen einer Bedrohung. Feine Nebelschwaden, die aus dem feuchten Laub schwebten, verzerrten die Perspektive.
„Es war die Not, die die germanischen Stämme zu uns trieb“, wisperte Keylam mir leise ins Ohr, wobei ich einen Zusammenhang der angesprochenen Themen suchte. „Klimatische Veränderungen, Unwetterkatastrophen und die kalten, nordischen Winter. Die Wärme des Südens zog sie betörend an.“
Während er mir etwas zu erklären versuchte, zog mich das Blätterspiel immer mehr in den Bann. Die winzigen Nebel verdichteten sich, das Blattwerk fing an zu wispern. Kein Wort verstand ich, doch aus dem Dunst wuchsen Bewegungen, und am Ende war es mir, als laufe ein wundersamer Film vor mir ab.
„Es ist die Kunst der Nornen“, flüsterte Keylam mir zu. „Die Schicksalsfrau ist uns sehr nahe.“
Es hatten sich Tropfen gebildet, die auf feine, blühende Äste fielen. In ihnen erkannte ich die hochzivilisierte Kultur der Kelten. Nun passierte etwas Sonderbares: Die Dünste ballten sich zu Wolken, senkten sich ebenfalls und drückten die gesunden Zweige zur Seite. Sie wichen aus.
„Siehst du, wie das neue Volk in diese Welt eindringt?“, kommentierte Keylam. „Ihre handwerkliche Kunst und der Prunk und Reichtum des Keltenvolkes wurden zum Vorbild der Germanen. Auseinandersetzungen waren an der Tagesordnung. Die Kelten waren dieser Grobheit nicht gewachsen und mussten den neuen Einwanderern Platz schaffen.“
„Wohin wollen sie ausweichen, wenn im Süden das Römische Reich eine eiserne Mauer bildet?“
„Es ist keine eiserne Mauer. Rom ist ein Reich hunderter Kulturen. Viele keltische oder gallische Völker sind längst Teil Roms geworden. Sieh zu, was passiert.“
Die gesunden Äste waren inzwischen unumkehrbar auf beide Seiten gedrückt worden. Lediglich ein dicker Ast wich nicht. Vor ihm stoppte die Wolke.
Keylam kommentierte weiter: „Die germanischen Sippen trafen auf die blühende Kultur der Römer. Ein neues Vorbild entstand. Die Kunst der Kelten verblasste dagegen, und die Neugierde auf das südliche Volk, das in milderen Gegenden wohnte, wuchs.“
„Seltsam, ich kann die Veränderungen aus diesem Geäst lesen.“
„Urd vermag uns im Eschenstamm nur das Vergangene aufzuzeigen. Die germanischen Stämme der Teutonen, Ambronen und Kimbern, sie verschlug es in den geheimnisvollen Herkynischen Wald. Obwohl sie friedlich nahten, mussten sie erfahren, dass sie dort nicht willkommen waren. Die keltischen Boier überließen ihnen kein Land. Die Noriker, auf die sie in der Folge stießen, zeigten sich genauso wenig erbaut. Diese standen gar in engem Kontakt zu Rom. Wie ein Blitz schlug die Nachricht dort ein. Man erinnerte sich an den Galliereinfall in der Hauptstadt. Vorsorge war angebracht. Der damalige Konsul Carbo wurde mit der Aufgabe betraut, jede Gefahr abzuwehren. Seine Entscheidung wurde zu einer Blamage für Rom. Die friedfertig erscheinenden Nordländer wurden überrumpelt. Ein Überfall, der nicht fair war, und der Sieg, der so sicher schien, missglückten. Das germanische Heer setzte sich vehement zur Wehr, und bestimmt hatten die Römer die hellhaarigen Frauen falsch eingeschätzt. Als die Schlacht auf der Kippe stand, griffen auch sie zu den Waffen. Wenige Römer konnten sich dank einer stürmisch einbrechenden Gewitternacht retten.“
„Am Ende steht dann doch ein Sieg Roms?“
„Über zehn Sommer vergingen, bis man der Raserei Herr wurde. Die germanischen Heere zogen im Norden der Alpen entlang. Viele keltische Stämme ließen sich mitreißen und schlossen sich ihnen an. Am Ende brachen Lawinen von Menschen in Richtung Süden auf und standen eines Tages in Gallia Narbonensis. Unter ihrem König Bojorix verwüsteten sie das Tal der Rhodanus. Der Gegenschlag blieb nicht aus. Aber auch der scheiterte. Die Führer der zwei römischen Heere, die aufgestellt wurden, waren sich uneinig und gerieten untereinander in einen Zwist. In Arausio kam es zur Katastrophe. In einer Schlacht wurden die römischen Heere vernichtend geschlagen und alle Gefangenen den Göttern geopfert. Angst und Schrecken verbreitete sich über Rom, als die Berichte von aufgeschlitzten Legionären an Bronzekesseln bekannt wurden. Dieser Schauder prägte das Bild von den nördlichen Barbaren für alle Zeit.“
„Der Weg nach Rom war somit geebnet.“
„Fürwahr, obwohl ein Gefangener vor dem Süden warnte. Die Warnung wurde nicht nur überhört, sie spornte das Heer an. Die Germanen agierten planlos, zogen zur Mittelmeerküste und teilten sich. Du hast schon von den Mariuskriegern gehört?“
„Ja, ich erinnere mich. Lebte Marius, dieser Feldherr, nicht vor Cäsars Zeit?“
„Oh, er war sogar ein angeheirateter Onkel des Imperators. Seine Stärke hatte er seiner Klugheit zu verdanken. Er schuf ein Berufsheer voller Spezialisten, die mit dem Pilum und der Spartha umzugehen wussten. Panzerhemden mit Eisenplatten schützten sie. Mit ihnen stand kluge Organisation gegen Chaos, denn eines musst du wissen, das germanische Heer hatte keine strenge Führung. Die Häuptlinge überließen vieles der Willkür und handelten untereinander Maßnahmen aus, wie zu verfahren wäre. Eine grundsätzliche Strategie fehlte. Marius hatte das Glück, dass er den Teutonen und Ambronen allein begegnete, da sich die Kimbern entlang des Nordrands der Alpen zurückzogen, um dann an anderer Stelle in Italien einzufallen. Viel gäbe es von der Begegnung der Heere zu erzählen. Die Streitkultur der Germanen war auf Zweikampf getrimmt, die der Römer auf taktisches Vorgehen. Allein der bloße Anblick der Hellhäutigen brachte die Herren des Landes zum Zittern. In Aque Sextiae kam es schließlich zu der entsetzlichen Auseinandersetzung, die Marius gewann.“
„Es folgte die übliche Feier und Triumphzug in Rom?“
„Nein. Marius wusste, dass die Geschichte nicht ausgestanden war. Konsul Catulus hatte seine liebe Not mit den Kimbern, die zwischenzeitlich den Fluss Athesis überrannten. Ihm zu Hilfe zu eilen, daran lag dem Feldherrn. Es war die richtige Entscheidung. Er traf gerade noch rechtzeitig ein und besiegte auch dieses germanische Volk. Es war kein Pappenstiel. Allein die Berichte, dass am Ende der Schlacht die fliehenden Krieger von den eigenen Frauen, Schwestern oder Töchtern erschlagen wurden, sie selbst dann den Tod durch die eigene Hand nicht scheuten, zeigt, welch gnadenlosem Volk man gegenüberstand.“
Keylam schwieg einen Moment. Bei der ganzen Erzählung entging mir die Veränderung an dem Gehölz nicht. Ich starrte auf eine Kerbe, die sich in den unbeugsamen Stamm gefressen hatte. Zwar sorgte das Harz für Heilung, doch eine beträchtliche Narbe quoll auf.
„Keylam, ich will dir nichts vormachen. Solche Geschichten sind mir zu geläufig. Ähnliche Schreckensbilder spielten sich, ich weiß nicht wie oft, vor meinen Augen ab.“
„Du siehst, wie nötig diese Welt die Menschlichkeit braucht?“
„Da will ich nicht widersprechen. Aber den Schlüssel dazu findest du nicht in mir. Ich bin ein unscheinbarer Junge, der in diesen ganzen wilden Begebenheiten die Hose heftig voll hat. Von den Germanen war mir bislang nur Arminius der Cherusker bekannt. Er schlug, so lernte ich es, eine römische Legion unter dem Feldherrn Varus im Teutoburger Wald.“
Ein Beben brauste bei meinen Worten durch das Blattwerk. Ein gerade noch frisches Grün verdorrte und fiel als Asche herab.
„Es ist keine Ruhmesgeschichte. Erkennst du, wie die Natur die Freveltat verabscheut? Nie wieder wird Grün aus dem Ast wachsen.“
„Du siehst den Erfolg kritisch?“
„Erfolg hin oder her, ich habe mich damit abgefunden. Es gibt ständig Kriege, Schlachten, Auseinandersetzungen. Was spielt es für eine Rolle, wer gewinnt? In dem Fall hatten die Römer die schlechten Karten. Meinetwegen.“
„Was schmerzt dich an dieser Konfrontation?“
„Arminius‘ Vater, der Unterhäuptling Sigimer, war ein Freund der Römer, und er schickte seine Kinder Arminius und Flavius zu ihnen in die Ausbildung. Beide absolvierten sie mit Auszeichnung, erhielten gar römisches Bürgerrecht. Senator und Feldherr Publius Quinctilius Varus sah das Gebiet rechts des Rhenus längst als werdende Provinz Roms an. Er war zwar nicht unbedingt gerecht mit allem, was er tat, aber hatte durchaus eine sanfte Ader und vertraute auf ein friedliches Zusammenspiel. So war Arminius ihm lieb und teuer, ein Freund der Familie. Dass dieser drei Legionen in Richtung des Waldes von Osning leitete, einen Hinterhalt vorbereiten ließ und die ungeordneten Römer vernichtete, war von niemand zu erwarten. Was ihn dazu trieb, ist schleierhaft. Wahrscheinlich steckte zu viel Liebe zum Germanentum in ihm. Wollte er römische Größe und Glanz in die raue Welt seiner Vorfahren bringen oder sehnte er sich nach alten schlichten Ordnungen unter den Regeln seiner Götter? Ich kann es nicht sagen. Der erste germanische König konnte er nicht mehr werden.“
„Es gab bereits einen König? Einen mächtigen Germanenführer vor Arminius?“
„Kraftvolle Führer gab es schon immer, die in der Lage waren, Stämme zu bündeln und so ihre Gefährlichkeit zu stärken. Ich spreche von einem der geschicktesten, Marbod. Wenn du von hier die unüberschaubaren Herkynischen Wälder durchwanderst, kommst du in ein Land mit dem Namen Boihaemum. Er, der Fürst der Markomannen, hatte diese Reise mit seinem Volk unternommen, unterwarf die keltischen Stämme der Boier, schmolz Sippen der Langobarden, Goten, Lugier und viele mehr zusammen und errichtete ein Reich mit Regeln, die den Germanen im Grunde fremd und verhasst waren. Dort findest du Gesetzbücher und Strukturen, die er von Rom abgekupfert hatte. Rom sah dieses Zentrum mit großem Missmut. Ein geplanter Angriff der Weltmacht scheiterte, da andere Brandherde dringlicher wurden. Arminius schickte Marbot den Kopf des Varus‘. Auf diese Weise zeigte er, ihm ebenbürtig zu sein.“
Der Ast mit dem verwelkten Blätterwerk brach ab und donnerte auf die Erde. Der Aufschlag erschütterte den gesamten Baum.
„Der Respekt der Römer vor Arminius‘ Sieg war gewaltig. Er selbst verwüstete in der Folge Ländereien rechts des Rhenus und machte römische Kastelle dem Erdboden gleich. Germanicus, der Großneffe Augustus‘, unternahm Rachefeldzüge, doch von einem Erfolg kann man kaum sprechen, eher von einer blutigen Nase. Tiberius, der inzwischen herrschte, untersagte jede weitere Aktion. Wie gefährlich dieses Volk hier werden konnte, zeigte eine Situation, als Rom die Kaiserwirren nach Neros Tod erlebte. Damals erhob sich ein Aufstand, dem sich unzählige Stämme anschlossen. Den Anfang setzten die Bataver, zu denen sich selbst die romfreundlichen Friesen gesellten und so nach und nach die Canninefaten, Chauken, Brukterer, Tenkterer und gar gallische Völker, wie die Treverer. Ihr Anführer Civilis war ein treuer Anhänger des damaligen Feldherrn Vespasian. Es lag Civilis daran, seinem Herrn mithilfe der nordischen Liga einen Dienst zu erweisen. Wie gerne hätte er ihn als Kaiser gesehen. Die Motivation der Mitstreiter war eine gegensätzliche, das spielte aber keine Rolle, zumal man sich regelmäßig durch erfolgreiche Kämpfe selbst feiern konnte. Es gibt dazu viele Geschichten zu erzählen.“
„Sie werden alle nicht amüsant sein.“
„Wie man es nimmt. Zu der Zeit herrschte eine außergewöhnliche Trockenheit, und der Rhenus führte kaum Wasser. So fuhr sich ein Getreideschiff fest. Allein daraus entfachte eine Schlacht. Eine Auseinandersetzung um das Korn. Von links und rechts des Ufers wurde aufeinander eingedroschen. Die Beute blieb bei den Blondschöpfen.“
„Die Wirren fanden ein Ende?“
„Die weise Seherin Veleda trug zu einer friedlichen Lösung bei. Ich will auf die letzte blutige Begegnung Roms und der Germanen zu sprechen kommen. Sie gab es zwischen dem derzeit herrschenden Kaiser Domitian und dem Stamm der Chatten. Rom zog aus dieser ebenfalls negativen Erfahrung Konsequenzen und entschloss sich, einen Limes zu ziehen. Er verläuft dicht hinter unserem Rücken.“
„Ich sah diese Grenze. Meinst du, sie wird die germanische Neugierde auf Rom bremsen?“
Ein Sturmwind brach los. Die Bilder, die ich weiterhin verfolgt hatte, waren wie weggeblasen. Äste splitterten.
Keylam verfiel in Aufregung, die ich nicht verstehen konnte. Von Anfang an war hier in dem Wald, der sich mehr und mehr verdüsterte, alles beklemmend und unheimlich gewesen, doch eine Gefahr ...?
„Ich wage es!“, schrie er voller Panik. „Mein Speer wird gegen deine Brust knallen. Habe keine Angst. Drei!“, rief er am ganzen Leib zitternd in die Wildnis.
„Drei“, ertönte ein fernes Echo wie eine Bestätigung zurück.
„Verschwinde!“, fuhr er mich an. „In den nächsten drei Phasen haben wir einen Schutz um dich gelegt. Fühle dich aber nicht zu sicher. Es gibt Kräfte, denen widersteht kein Bann.“
„Du meinst, ich kann da nicht sterben?“
„Das kannst du immer und überall.“
Der Sturm steigerte sich zu einem Orkan. Bäume brachen auseinander. Auf allen Seiten stürzten Stämme zur Erde.
„Sag mir, wer sind meine Feinde? Woran erkenne ich sie?“, brüllte ich in das Inferno.
„Alle diejenigen, die in der Menschlichkeit eine Gefahr sehen.“
„Gefahr? In der Menschlichkeit? Das kann sie niemals sein.“
„Von wegen! Güte zerstört Hass, und Liebe unterspült jeden Egoismus!“
Ein Luftwirbel tobte in die Enge der Äste. Zweige wehrten sich, indem sie Blüten schoben und Blätter in Sekundenschnelle sprießen ließen. Der Wind heulte.
„Was passiert hier?“, rief ich aus.
Keylam konnte mich unmöglich verstehen. Gleich mehrere Stämme entwurzelten vor meinen Augen und wankten mit einem erschütternden Krachen und Ächzen.
„Es sind die Menschen, die mir gefährlich werden“, brüllte ich in das Inferno.
„Täusche dich nicht“, hörte ich einen Nachhall. „Drei Lebensphasen seist du geschützt!“
Die übergroßen Buchen und Eschen verloren das Gleichgewicht. Ich sah mich bereits unter ihnen begraben. Ein heftiger Schlag auf meine Brust …
SEIFENKRAUT (116 N. CHR.)
Der Sturm jagte an meinen Ohren vorbei, Staub wurde aufgewirbelt …
„Heureka!“ Ein Mensch nieste in höchster Not und schrie entsetzt: „Hilfe, die Hölle ist erwacht!“
Im Nu flaute das Sturmgebraus ab. Ich saß neben Säcken, Pfeffer in der Nase. Von dem Niesen, das weitere Personen um mich ergriff, blieb ich ebenfalls nicht verschont. Wie war ich in dieses Ladengeschäft gekommen?
Bunte Gewürzmischungen türmten sich in Säcken, Schüsseln und kleinen Schälchen. Der Sturm, der mich hierher geworfen hatte, hatte alles heftig durcheinandergewirbelt. Die Aufregung war entsprechend. In dem Chaos, das in wenigen Sekunden unversehens zuschlug, fiel mein Erscheinen kaum auf. Kunden wischten sich Paprika und andere pulverisierte Kräuter aus den Augen. Eine Dame versuchte, sich wieder in Form zu bringen, und zupfte Lorbeerblätter aus ihrem Gewand, die sich im Stoff verfangen hatten. Sklavinnen gingen ihr emsig zur Hand.
Der Verkäufer war hin- und hergerissen, ob er die auf der Erde liegenden Verwehungen aufgeben sollte. Jetzt entschied er, die eigenen Sklaven in die Pflicht zu nehmen. Gehorsam, aber planlos vermehrten sie durch eine konfuse Kehraktion das Chaos. Kreuzkümmelsamen, Ingwerwurzeln, Knoblauchkränze, Pfefferkörner, Pulver in vielen Farben, alles wanderte in farbenprächtig gemischte kleine Häufchen. Dass der arme Herr dem Weinen nahe war, konnte ihm niemand verdenken. Ich stahl mich langsam aus dem Wirrwarr.
Es war ein sonderbares Gefühl, aus dem Ladengeschäft zu treten. Ich gelangte nicht etwa auf eine Straße, sondern auf einen langen Flur in einem Gebäude. Geschäft an Geschäft reihte sich innerhalb des Mauerwerks aneinander. Wie ich bald erfuhr, nannte man sie Tabernas. Seltsamerweise waren außerhalb des Verkaufsraums keine Anzeichen des Sturms zu erkennen. Die Naturgewalt hatte nur in meinem kleinen Umfeld gewütet. Hier draußen lief alles in Ruhe und Gelassenheit ab. Die Menschen, die ich musterte, waren zum großen Teil Sklaven, manche mochten auch Bürger mit römischem Rechtsstatus sein. Vornehme Adlige waren nicht auszumachen. Wie gewöhnlich hatten die Untertanen deren Einkäufe zu erledigen.
Keylams Worte hallten nach. Geschützt. Durfte ich mich erstmals seit Langem unbeschwert und ohne jede Angst bewegen? Die Unsicherheit saß mir weiterhin tief in den Knochen.
Es war ein seltsamer Ort. Ein gestreckter Flur führte an Räumlichkeiten vorbei, die aus gewölbten Zellen bestanden. Nach außen hatten sie Fenster oder besser gesagt große Öffnungen. Durch sie erblickte man eine Straße, auf deren gegenüberliegender Seite sich ein weiterer gigantischer Bau anschloss.
Jede dieser Zellen war nichts anderes als eine Taberna. Ich schlenderte langsam an ihnen vorbei. Vorwiegend Gewürzhändler hatten sich hier niedergelassen. Auch Geschäfte, in denen Öl und Wein angeboten wurden, fehlten nicht. So ungewöhnlich es sich auch anhörte, ich durchstrich ein Kaufhaus der Antike.
Gemütlich bummelte ich von Öffnung zu Öffnung, schaute in jeden Raum, genoss die fantasievollen Auslagen und die liebevoll zur Schau gestellten Waren. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, und ich verspürte ein ätzendes Hungergefühl. Zehn Läden zählte ich auf dieser Ebene. Obst, Gemüse, Melonen, Weizen und Getreide fand ich in dem Stockwerk darunter. Elf Tabernas waren es dort. Mit schreiendem Magen trieb es mich über eine gewaltige Terrasse, die sich auf der nächsthöheren Fläche auftat. Staunend betrachtete ich die Kolonnaden. An beiden Enden des Gebäudes schlossen sich bestechende Ziegelbauten an, die Kuppelsäle beherbergten. Eine große Halle wurde offenbar für Vorträge und Konzerte genutzt. Ich staunte über andere Tabernas in Querbauten. Mehr als 100 Läden auf engstem Raum überschlug ich. Alles war hier zu bekommen: Kleider, Kosmetika, Schmuck. Ein staatliches Lebensmittellager garantierte eine Basisversorgung. Weitere drei Stockwerke türmten sich im Anschluss an die beschriebene Terrasse in die Höhe. Büroräume und Gaststätten waren dort zu finden.
„Wer hat das geschaffen?“, fragte ich.
„Apollodor von Damaskus“, erklärte mir ein Sklave.
„Und wer gibt so etwas in Auftrag?“
„Der erhabenste aller Cäsaren. Trajan.“
„Was steht ihr so tatenlos herum?“ Ein Schuster kam aus seinem Gewölbe und hielt einige Briefe in der Hand, während er in der anderen ein Stück vorgeschnittenes Leder schwang, das er vermutlich für die Herstellung von Sandalen benötigte. „Kommt einer von euch zum Forum? Diese Schreiben sollten nach Alexandrien.“
„Ich stehe nicht zur Verfügung“, entschuldigte sich der Sklave. „Mein Herr wartet längst auf mich.“
„Wie ist es mit dir?“, fuhr der Schuster mich an. „Es soll mir nicht um ein Ass schade sein.“
Geld, Essen, ein kleiner Dienst, das waren Stichworte, mit denen ich mich anfreunden konnte. Zu entscheiden gab es am Ende nichts, denn er presste mir die Schriftstücke und die Münze in die Hand und verschwand in seine Höhle.
„Wie soll das funktionieren?“, zweifelte ich. Die Adresse war knappgehalten: Ein Name – Alexandria – und eine kaum lesbare Gebäudebezeichnung.
„Das klappt schon. Gib das Zeugs einem Händler, der zum Hafen fährt. Es wird ankommen.“
„Gibt es eine Poststelle oder so etwas?“
„Keine Ahnung, wovon du redest. Die Schreiben muss jemand mitnehmen, sonst kommen sie nie an.“
„Irgendjemand?“
„Wie soll es sonst funktionieren? Einen Brief zu überbringen ist Ehrensache. Es wird sich kein Schiffsmann verweigern und auch kein Händler.“
Ich hatte begriffen. Fahrende Händler gab es auf dem Forum. Dort würde ich meine Aufgabe erledigen können. Noch bewegte ich mich in einem Gewimmel von Menschen und lief an einer satten Anzahl von Tabernas vorbei. Ein Friseursalon erweckte mein Interesse. Der Meister zog ein hohles Metallrohr, das ‚calamistrum‘, aus einem erhitzten Aschehaufen, griff zu einem schlichten Metallbügel und drehte einer Dame Locken in die Haare. Über die aktuelle Mode war ich somit informiert. Nebenbei berichtete er seiner Kundin, dass die Asche aus Seifenkraut, die er zum Färben der Haare verwendete, in Verbindung mit Ziegenfett eine auserlesene Seife ergäbe.
Das Ass in meiner Hand fühlte sich gut an. Wo gab es etwas zu essen? Hier war ich an der falschen Stelle. Ich sah nur Ohrringe, Armbänder, Gemmen, Medaillons und Ketten für Arme und Fußgelenke. Zwei Damen ließen sich beraten, ihre Sklaven versteckten die Ungeduld. Neben dem Schmuck wurden Kosmetikartikel angeboten. Alabastertöpfe und zierliche Glasphiolen stachen ins Auge, ebenfalls Lippenstifte aus Ocker, Ficus oder Mollusken. 500 Zutaten würden für die Parfümherstellung zur Verfügung stehen, schnappte ich auf. Auf Hochglanz polierte Metallplatten wurden als Spiegel genutzt. Kleiderläden befriedigten mich