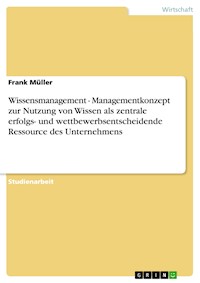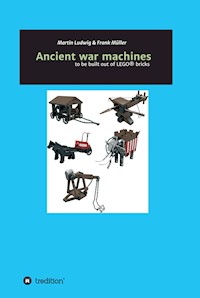6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Als Apple 1976 mit einem Startkapital von nur 1.300 US-Dollar gegründet wurde, hätte sich wohl nicht einmal Steve Jobs träumen lassen, dass das Unternehmen einmal so groß und bekannt werden würde. Heute versuchen Kleinkinder, Zeitschriften wie ein iPad zu 'bedienen'. Die ehemalige Computerklitsche hat sich zum weltweit bekannten Multimedia-Konzern ausgewachsen, der in den letzten Jahren immer wieder ganze Märkte revolutioniert, neu definiert oder sogar erst geschaffen hat. Der einstige Underdog ist inzwischen ein marktbeherrschender Player, der Liebe, Hass und angeblich sogar religiöse Gefühle hervorruft. Apple verkauft Rechner, Musicplayer, Smartphones, Tablets, Musik und Filme. Aber vor allem verkauft Apple ein Lebensgefühl. Es gibt Tausende von Gründen, Apple zu lieben - hier sind schon einmal 111. EINIGE GRÜNDE Weil Apple Geschmack hat. Weil Apple revolutionär ist. Weil Apple vs. den Rest der Welt immer wieder Spaß macht. Weil ein Apfel einfach liebenswerter ist als ein Androide. Weil Apple auch bei der Werbung Maßstäbe setzt. Weil Apple auch mal Fehler macht. Weil Apple mobiles Arbeiten für alle ermöglicht hat. Weil man sich bei Fragen an ein Genie wenden kann. Weil Apple ein ganz neues Einkaufserlebnis schafft. Weil Apple die Gerüchteküche anheizt. Weil Apple langweilige Präsentationen wieder sexy gemacht hat. Weil Apple nicht auf die Technik, sondern auf den Nutzen fokussiert. Weil Apple jetzt am Katzen-Smartphone arbeitet. Weil Apples iPhone mit dem richtigen Zubehör auch zur Selbstverteidigung taugt. Weil Apple Musikgeschmack beweist und Songs in die Charts bringt. Weil es für jedes Problem die passende App gibt. Weil Apple trotz Streit der größte Fan der Beatles ist. Weil Apple sich immer wieder neu erfindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 303
Ähnliche
Frank Müller
111 GRÜNDE, APPLE ZU LIEBEN
Eine Verbeugung vor der coolsten Marke der Welt
Aus der Garage in die Herzen
VORWORT
Als Steve Jobs seinen Freund Steve Wozniak 1976 dazu überredete, gemeinsam mit ihm Apple zu gründen, ging es nicht darum, das wertvollste Unternehmen der Welt zu werden. Die ersten Rechner löteten sie mit ein paar Freunden in der Garage von Steve Jobs’ Adoptiveltern zusammen. Aber die ehemalige Computerklitsche hat sich zum weltweit bekannten Multimedia-Konzern ausgewachsen, der in den letzten Jahren immer wieder ganze Märkte revolutioniert, neu definiert oder sogar erst geschaffen hat.
Ob Hardware oder Software – an Apple kommt man kaum vorbei. Sogar hartnäckige Windows-Nutzer kaufen Musik oder Filme bei iTunes oder verwalten ihre Mediathek mit dem kostenlosen Programm. iPod, iPhone, und iPad haben ihr jeweiliges Marktsegment komplett neu definiert. Der einstige Underdog hat sich zum marktbeherrschenden Player entwickelt, der Liebe, Hass und angeblich sogar religiöse Gefühle hervorruft. Apple verkauft Rechner, Mediaplayer, Smartphones, Tablets, Musik und Filme. Aber vor allem verkauft Apple ein Lebensgefühl. Es gibt 1.000 Gründe, Apple zu lieben – hier sind schon einmal 111.
Aber das Besondere an Apple lässt sich kaum mit Zahlen fassen, besser gelingt es mit Anekdoten. Warum fordert das New York City Police Department die Bürger dazu auf, ihre iPhones auf iOS 7 zu aktualisieren? Warum darf man als Superschurke bei der Arbeit keine Musik über iTunes hören? Und wieso leben ausgediente Macs als Katzenkörbchen oder Aquarien weiter? In 111 Kapiteln beantwortet das Buch diese und andere Fragen.
Außerdem gibt es Tipps zur Verwendung des Terminals, interessante Fakten über Apples soziale Verantwortung, kuriose Storys und vieles mehr.
Und es kommen alle auf ihre Kosten, die Apple-Hasser genauso wie die Apple-Jünger. Die Gegner können sich herrlich aufregen und erhalten Einblicke in die verschrobene Geisteswelt derjenigen, die Apple für das Größte halten. Die Apple-Fanboys und -girls können nicken, schmunzeln und staunen. Denn selbst eingefleischte Fans werden in diesem Buch spannende und interessante Fakten über ihr Lieblingsunternehmen finden, die ihnen vielleicht noch nicht bekannt waren. Zum Beispiel, dass ein iMac nicht nur gut aussieht, sondern auch im Fall einer Hausdurchsuchung klar im Vorteil gegenüber anderen Rechnern ist …
Das Manuskript für dieses Buch habe ich übrigens auf iPhone und MacBook geschrieben. Seit den Neunzigerjahren arbeite ich am Mac und habe seit System 6 kaum ein Update ausgelassen. Trotzdem überrascht mich Apple immer wieder. Dabei bin ich kein strenggläubiger Jünger, der einen stilisierten Apfel am Autoheck spazieren fährt wie andere einen Fisch. Es gibt genug Dinge, die mich den Kopf schütteln lassen. Aber wenn man sich die Alternativen so anschaut … Wie heißt es so schön? Once you go Mac, you’ll never go back. In diesem Sinne: Viel Spaß beim Lesen.
Frank Müller
1
Unternehmen
»Der Name Apple entstand aus einer Laune heraus, ungeplant. Steve Jobs hatte gerade auf einer Apfelplantage gearbeitet und ernährte sich ausschließlich von Früchten, am nächsten Tag sollten die nötigen Papiere für die Firmengründung unterschrieben werden und den beiden Firmengründern war kein besserer Name eingefallen. ›Apple‹ war einfach und eingängig, in Verbindung mit dem Wort ›Computer‹ aber äußerst ungewöhnlich. Und außerdem stand die Firma mit diesem Namen im Telefonbuch vor Jobs’ altem Arbeitgeber Atari.«
(aus Grund 4: »Weil ein Apfel einfach liebenswerter ist als ein Androide«)
1. GRUND
Weil Apple Geschmack hat
Das soll jetzt kein billiges Wortspiel sein nach dem Motto »Beißen Sie mal in einen Apfel oder in ein Fenster – was schmeckt besser«. Gemeint ist wirklich Geschmack, Stil, Sinn für Ästhetik.
Steve Jobs hat in der Dokumentation Triumph of the Nerds: The Rise of Accidental Empires 1996 im Interview gesagt: »Das einzige Problem an Microsoft ist, dass sie keinen Geschmack haben. Sie haben absolut keinen Geschmack. Und ich meine das nicht nur im Detail, ich meine das im Allgemeinen, in dem Sinne, dass sie keine eigenständigen Ideen haben und dass sie ihren Produkten keine eigene Kultur geben.« (Im englischen Original: »The only problem with Microsoft is they just have no taste. They have absolutely no taste. I don’t mean that in a small way, I mean that in a big way, in the sense that they don’t think of original ideas, and they don’t bring much culture into their product.«)
Zu Microsoft will ich mir kein Urteil erlauben, aber eines ist sicher: Apple hat Stil, hat Geschmack und eine ganz eigene Kultur. Wenn ich Microsofts E-Mail-Programm Outlook mit Apples Mail vergleiche, weiß ich sofort, welches Programm von Apple ist. Nämlich das Programm, das schon auf den ersten kurzenBlick deutlich besser aussieht.
Das Aussehen einer Software mag zunächst einerlei erscheinen, aber zumindest ich entdecke bei mir, dass ich bestimmte Programme auch wegen ihrer Ästhetik lieber nutze als andere der gleichen Gruppe, die vielleicht sogar mehr können oder andere Vorzüge haben. Es handelt sich dabei meist um Programme zur Textverarbeitung; zum Schreiben muss man in der richtigen Stimmung sein, sich wohlfühlen (oder den nötigen Zeitdruck haben, dann ist das [fast] egal). So gesehen erhöht das richtige Design auch die Produktivität.
Wobei sich das für mich hauptsächlich auf Software-Design bezieht. Ich arbeite vor allem darum am Mac und mit iOS-Geräten, weil es bestimmte Programme gibt, die ich in diesem Design und dieser Funktionalität, konsequent für iOS und OS X entwickelt, nirgendwo sonst finde. Das hat auch mit den Entwicklern zu tun, die selbst Fans sind und darum besonders liebevoll für Apple entwickeln, aber das ist ein anderes Kapitel in diesem Buch.
Apples viel gescholtene Kontrollsucht führt jedenfalls dazu, dass bestimmte Standards eingehalten werden. Und dass Entwickler Programme für OS X und iOS schreiben, die so durchdacht, ästhetisch und funktional sind, wie man sie auf anderen Plattformen nicht findet. Gelungene Beispiele dafür sind unter anderem Day One und Byword.
Day One ist eine Tagebuch-App mit einer schlichten und sehr schönen Oberfläche, die zu benutzen ein reines Vergnügen ist. Man kann sich Einträge geordnet nach Ort, Zeit oder Schlagworten ansehen, Bilder und andere Daten hinzufügen. Der Abgleich zwischen OS-X-App und iOS-App erfolgt über Dropbox oder Apples iCloud.
Byword ist ein Textprogramm, mit dem man Texte im RTF- oder Markdown-Format (mehr dazu im eigenen Kapitel) schreiben und als HTML, PDF, Word und sogar LaTeX exportieren kann. Gegen eine Sonderzahlung von 4,99 Euro kann man Byword sogar benutzen, um seine Texte ins eigene Blog oder für Evernote zu exportieren.
Das hört sich relativ unspektakulär an, zeigt aber sehr schön, worauf es ankommt. Hat man eines der Programme mal ausprobiert, merkt man, welchen Unterschied die Benutzeroberfläche und die Beschränkung auf wesentliche Funktionen ausmachen kann. Was diese Apps von anderen abhebt, sind ihr Stil, ihre Ästhetik und ihre Funktionalität, Dinge, die für Apple Hand in Hand gehen müssen.
2. GRUND
Weil Apple revolutionär ist
Revolutionär im Sinne von: sich nicht um Konventionen scheren, den eigenen Weg gehen. Den Weg, von dem man glaubt, dass er der richtige ist. Das ist wahrscheinlich auch einer Gründe, weshalb Apple so polarisiert. Wie jeder Revolutionär hat Apple wegen dieses Denkens und dieser Art, die Dinge zu sehen und anzupacken, glühende Verehrer und erbitterte Gegner.
Schauen wir uns nur mal den unscheinbaren kleinen Lightning-Anschluss an, den Apple am 12. September 2012 vorgestellt hat. Nach neun Jahren sollte dieser Anschluss den 30-poligen ablösen, den Apple 2003 eingeführt hatte und der sich durch die Masse an Zubehör zu einem eigenen Quasi-Standard entwickelt hatte.
Natürlich gab es am neuen Lightning-Anschluss jede Menge zu kritisieren, und ich stellte mir die gleichen Fragen wie viele andere: Warum muss das denn jetzt sein? So viel Platz kann man mit dem kleineren Stecker doch nicht sparen. Und wenn schon ein anderer Anschluss, warum dann nicht der Micro-USB-Anschluss, den die Europäische Union als einheitlichen Anschluss für alle Hersteller fordert?
Klarer Fall für viele Kritiker: Apple wollte sicher einfach mal wieder obszön viel Kohle machen und seine Nutzer schröpfen, mit überhöhten Preisen für Adapter, für neues Zubehör etc. Jetzt musste man ja alles wegwerfen, was man so an Docking-Stationen, Zubehör und Kabeln im Haus hatte.
Was die meisten dabei übersahen: Neun Jahre sind in der Computerbranche eine lange Zeit. Da tut sich einiges, und wenn man sich den 30-poligen Stecker jetzt so anschaut und mit dem neuen Lightning-Stecker vergleicht, sieht man ihm sein Alter schon an. Und warum kein Micro-USB-Anschluss? Das versteht man sofort, wenn man die beiden Anschlüsse miteinander vergleicht. Der Micro-USB-Anschluss ist zwar auch kleiner als der 30-polige und annähernd so groß wie der Lightning-Anschluss, aber unendlich fummeliger. Man muss jedes Mal genau hinschauen, ob man den Stecker richtig herum hält. Und besonders stabil ist die Verbindung zwischen Stecker und Buchse bei Micro-USB aufgrund der geringen Größe auch nicht gerade. Nach einer Weile wird es gerne mal ein bisschen wackelig.
Apples Lightning-Stecker dagegen ist ganz anders konstruiert. Er lässt sich ohne hinzusehen mit der Buchse verbinden, ganz egal, wie herum man ihn hält. Und er ist viel robuster. Wie Wikipedia hervorhebt, ist der Lightning-Stecker selbstreinigend. Beim Einstecken wird der Schmutz von der Buchse abgestreift. Führt man ihn in die Buchse ein, spürt man deutlich, wie die Federn im Anschluss in die Vertiefungen im Stecker einrasten und ihn sicher halten. Ein Gefühl von höchster Qualität, wie ihn auch der satte Klang der Autotüren luxuriöser Limousinen vermittelt. Durch diese Konstruktion war es auch möglich, genau zu definieren, wie stark das Gerät mit dem Stecker verbunden sein soll. So kann man sein iPhone relativ leicht aus dem Apple Dock entfernen, während das Original-Ladekabel fester mit dem iGerät verbunden ist, damit der Stecker nicht versehentlich aus der Buchse rutscht.
Der Lightning-Anschluss ist – meiner bescheidenen Meinung nach – momentan allen anderen proprietären Anschlüssen überlegen und zeigt deutlich, wie Apple denkt. Das Unternehmen kümmert es nicht, ob eine Europäische Union den Micro-USB-Anschluss bevorzugt, weil dieser Anschluss seinen eigenen hohen Standards nicht genügt. Der Lightning-Anschluss macht schon jetzt Schluss mit dem Hin-und-her-Wenden und dem Gefummel. Zwar soll laut BBC auch ein neuer USB-C-Anschluss von der Größe eines Micro-USB-Steckers entwickelt werden, der beidseitig einsetzbar ist, aber das kann noch dauern. Erst Mitte 2014 sollen die Spezifikationen endgültig festgelegt sein, und die ersten Produkte werden nicht vor 2016 erwartet. Und natürlich hat die Entwicklung nichts mit Apples Lightning-Anschluss zu tun.
Apple ist das höchstwahrscheinlich egal. Das Unternehmen hat schon jetzt einen kleinen, eleganten, drehbaren, robusten und zukunftssicheren Anschluss für mobile Geräte entwickelt, den andere Hersteller gegen eine Lizenzgebühr gerne nutzen und für den sie Zubehör entwickeln dürfen. Es ist vielleicht kein Standard, auf den sich ein Konsortium von Herstellern in langen Sitzungen geeinigt hat, aber es ist auf dem Markt und die im Moment bestmögliche Lösung.
Dieses revolutionäre Denken, das sich nicht um Konventionen schert, ist für die einen ein Grund, Apple zu hassen, und für die anderen, es zu lieben.
3. GRUND
Weil Apple vs. den Rest der Welt immer wieder Spaß macht
Betrachtet man Apples Werbegeschichte, dann stößt man immer wieder auf Phasen, in denen sich das Unternehmen an Wettbewerbern rieb. Die Einführung des Macintosh zum Beispiel startete gleich mit einem großen Knall – mit dem berühmten Super-Bowl-Spot 1984 unter der Regie von Ridley Scott. Eine junge Frau zertrümmert mit einem Vorschlaghammer eine riesige Leinwand, auf der der »Große Bruder« aus George Orwells Roman 1984 eine Rede vor den Massen hält. Die Werbebotschaft: »1984 wird nicht wie 1984«, der Macintosh befreit die Massen von der Herrschaft des Großen Bruders IBM.
Vor der aktuellen Kampagne, die sehr emotional das Produkt und seinen Nutzen für die Menschen inszeniert, produzierte Apple die TV-Spot-Serie Get a Mac, bei der PC und Mac personifiziert wurden. Der PC wurde dabei vom Autor und Humoristen John Hodgman gespielt, der privat eigentlich Mac-Fan ist. Justin Long spielte den Mac.
Auf www.applewerbung.de/mac/getamac/ kann man sich die (zumindest für Mac-Fans) sehr amüsanten Spots noch einmal ansehen. Der coole, ganz entspannte und lässige Mac unterhält sich mit dem leicht dicklichen, Brille, Anzug und Krawatte tragenden PC über alltägliche Dinge. Ob er sich mit der niedlichen japanischen Kamera bestens versteht, während der PC hilflos mit Englisch- und Italienisch-Brocken um sich wirft, oder ob er sich im Gegensatz zum PC als virenresistent erweist – immer steht der Mac am Ende besser da, und der PC wird zur Witzfigur. Wirklich sehr unterhaltsam, zumal es sich stets um relevante Themen handelte, die allerdings natürlich überzeichnet dargestellt wurden.
Übrigens ließ es sich Microsoft nicht nehmen, darauf mit der Kampagne I’m a PC zu antworten, bei der Nutzer sich stolz zum PC bekannten. Dumm nur, dass anhand des digitalen Fingerabdrucks der Bilder auf der dazugehörigen Website herauskam, dass die Kampagne auf Apple-Rechnern entstanden war. Eigentlich klar, schließlich arbeiten die meisten Werbeagenturen mit Macs, da dürfte auch Microsofts Werbeagentur Crispin Porter + Bogusky keine Ausnahme sein. Jedenfalls beseitigte Microsoft nach Bekanntwerden schnell alle digitalen Spuren und gab eine Pressemitteilung heraus, in der man darauf hinwies, dass bei den Arbeitsabläufen einer Kampagnenentwicklung alle möglichen Rechner eine Rolle spielten, neben PCs natürlich auch Macs.
Aber diese Kampagnen sind Vergangenheit. In den letzten Jahren hat sich Apple zu einem der Big Player entwickelt, da zeigt man besser seine eigenen Stärken, als sich über die echten oder aufgeblasenen Fehler der Konkurrenz zu amüsieren.
Samsung hat das entweder nicht mitbekommen oder sieht es ein wenig anders. Denn obwohl Samsung einerseits für Apple arbeitet, sind die Unternehmen andererseits Konkurrenten, die sich vor Gericht bekriegen – und eben auch in der Werbung. Vor Gericht klagt Apple gegen Samsung, bei den TV-Spots gehen die Sticheleien von Samsung aus und werden von Apple vornehm ignoriert.
Allerdings greift Samsung mit seiner The next big thing-Kampagne für das Galaxy S II auch weniger das iPhone direkt an, sondern stellt eher die vor einem Apple-Store wartenden Fans als dumme Schafe dar, denen man zeigen muss, wie wenig das Produkt eigentlich kann, für das sie da Schlange stehen.
Für Samsung-Besitzer vielleicht unterhaltsam, aber wenn man als iPhone-Nutzer als Depp dargestellt wird, überlegt man es sich wohl zweimal, ob man ein Samsung-Smartphone kauft. Da wäre es eleganter gewesen, auf die durchaus vorhandenen Vorteile der Samsung-Geräte hinzuweisen, statt die Konkurrenz zu dissen. So etwas macht man eigentlich nur als eindeutig kleineres Unternehmen – oder viel amüsanter.
Trotzdem – Apple gegen den Rest der Welt hat auch in der Zukunft noch viel Potenzial und Unterhaltungswert. Zwar ruht sich Apple momentan noch auf seinem Erfolg aus und produziert souveräne, lässige Spots ohne Seitenhiebe, aber das muss ja nicht so bleiben. Wenn Android-Smartphones und Windows Phones weiter an Marktanteilen gewinnen, besinnt sich Apple vielleicht mal wieder auf seine Wurzeln und zeigt der Konkurrenz, wo der (Vorschlag-)Hammer hängt.
4. GRUND
Weil ein Apfel einfach liebens-werter ist als ein Androide
Was könnte natürlicher und alltäglicher sein als ein Apfel? An diesem Wort und an dem Bild, das es hervorruft, ist nichts Technisches, nichts Unbekanntes oder Ungewohntes. Nichts, was man fürchten müsste. Ein Androide dagegen ist menschgewordene Technik, ein Kunstwesen in Menschenform. Da kann Googles Android-Maskottchen noch so niedlich aussehen, es ändert nichts an den Tatsachen.
Im Gegensatz Apfel – Androide zeigt sich auch die unterschiedliche Philosophie der beiden Unternehmen, die hinter den beiden großen mobilen Betriebssystemen stehen.
Der Name Apple entstand aus einer Laune heraus, ungeplant. Steve Jobs hatte gerade auf einer Apfelplantage gearbeitet und ernährte sich ausschließlich von Früchten, am nächsten Tag sollten die nötigen Papiere für die Firmengründung unterschrieben werden und den beiden Firmengründern war kein besserer Name eingefallen. »Apple« war einfach und eingängig, in Verbindung mit dem Wort »Computer« aber äußerst ungewöhnlich. Und außerdem stand die Firma mit diesem Namen im Telefonbuch vor Jobs’ altem Arbeitgeber Atari.
Und während bei Android-Smartphones vor allem die technischen Daten zählen, um jedes Pixel Bildschirmauflösung und jedes Megahertz Prozessortaktung gerungen wird, steht bei Apple der Nutzen für den Menschen im Vordergrund. Apple-Nutzer interessiert in der Regel nicht, wie der Prozessor ihres Gerätes getaktet ist und wie viele Kerne er hat (Wen interessieren auch beim Apfel schon die Kerne?).
Für Apple-Nutzer steht das Erlebnis im Vordergrund, das sie bei der Benutzung ihres Gerätes haben. Der erste Apple iPod wurde nicht damit beworben, dass er 5 GB Speicherplatz bereitstellte. Nein, die Aussage des Werbespots lautete: »1.000 Songs in deiner Hosentasche.« Das war es schließlich, worauf es ankam. (Ganz nebenbei: eine kleine Webdesign-Agentur in Mumbai hat eine Simulation dieses iPods ins Netz gestellt. Unter inventikasolutions.com/demo/iPod/ können Sie mit der Maus das Klickrad bedienen, Musik abspielen und so ein bisschen das Gefühl nachvollziehen, das die ersten iPod-Nutzer hatten.)
Gut möglich, das ein iPhone beim direkten Vergleich mit einem Android-Flaggschiff nicht immer die Nase vorn hat, wenn es allein um die technischen Details geht, um Pixeldichte und Prozessorkerne. Aber im Zusammenspiel von Soft- und Hardware, im rundum gelungenen Erlebnis für den Nutzer wird es trotzdem überzeugen.
Wen interessieren schon die Gigahertzraten der Prozessortaktung und das Fachchinesisch der Technik-Freaks, die in jedem Prozentpunkt bei einem Benchmark-Test einen Beleg für die Qualität eines Smartphones sehen? Apple-Nutzer in aller Regel nicht. Denen ist vor allem wichtig, dass alles einfach funktioniert und sie jeden Tag ein rundes Smartphone-Erlebnis genießen (um mal die schreckliche Werbesprache zu bemühen).
Apfel gegen Androide – das heißt Natur gegen Technik. Und Natur liegt den Menschen einfach näher, wenn es ums Lieben geht.
5. GRUND
Weil Apple auch bei der Werbung Maßstäbe setzt
Apple wusste schon immer, wie man gute Werbung macht. Im 3. Grund, »Weil Apple vs. den Rest der Welt immer wieder Spaß macht«, haben wir ja bereits gesehen, wie das Unternehmen sich in seinem 1984-Spot gekonnt als Alternative und Gegenpart zum Big Brother IBM in Szene setzte oder in der Get a Mac-Reihe die eigenen Stärken den Schwächen des Konkurrenten gegenüberstellte – im Gegensatz zu Samsung heute aber nie gemein, sondern einfach witzig.
Aber sehen wir mal von den Werbespots der Vergangenheit ab. Vergleichen wir stattdessen die (im Dezember 2013, während ich dies schreibe) aktuellen Spots von Nokia, Samsung und Apple miteinander. Da fällt die Wahl des Unternehmens mit dem besten Werbespot ganz leicht. Zur Auswahl stehen Nokias For Work. For Play, für das Nokia Lumia 2520 Tablet, Samsungs Are You Geared Up? für das Galaxy Note und die Smartwatch Galaxy Gear sowie Apples Misunderstood.
For Work. For Play ist zumindest noch interessant, wenn auch offenbar unter dem Einfluss halluzinogener Drogen entstanden.
Die Story: Ein schmierig grimassierender Friseur mit gelben, hornigen Fingernägeln hält seinem Kunden verschiedene Frisurschablonen an den Kopf, bis dieser sich zögerlich für eine Vokuhila-Frisur entscheidet, was den Friseur fast zum Höhepunkt bringt. Eine Assistentin in Krankenschwester-Uniform reicht dem Kunden ein Nokia Lumia Tablet auf einem Silbertablett unter einer Glocke, der Friseur fordert ihn auf, es zu berühren. Man hört das Geräusch einer Schere und sieht Haare zu Boden fallen. Während der Kunde nun auf dem Nokia Lumia Tablet Fotos und Filme des Friseurs und seiner Assistentin betrachtet, wächst ihm ein Vokuhila, wie man ihn von Wolfgang »Wolle« Petry aus seinen besten Zeiten kennt und fürchtet. Der Kunde ist glücklich und antwortet auf die Frage des Friseurs, der, nun im Tennis-Outfit, herangesprungen kommt: Nice. All set for business. Worauf der Friseur, mit seinen hornigen Nägeln in den Haaren des Kunden herumspielend, meint: »All set to party.«
Das Ganze dauert zwei Minuten und wird untermalt von mysteriöser Spieluhrmusik, dann folgen noch 15 Sekunden mit dem Bild des Tablets.
Unterhaltsam ist der Spot schon, wenn auch auf eine gruselige Art. Man fragt sich die ganze Zeit, welche Drogen so etwas mit den Köpfen von Kreativen in Werbeagenturen anrichten können – und mit denen der Verantwortlichen beim Werbekunden, die das durchgewunken haben. Was man sich auch fragt: Was hat das mit dem Tablet zu tun? Versinkt man so in die Beschäftigung damit und hält der Akku so lange, dass einem ein Vokuhila wächst? Und wieso soll ausgerechnet diese Ausgeburt des schlechten Geschmacks die richtige Frisur für Geschäfts- und Partyleben sein? Man sieht förmlich die schnauzbarttragenden Hipster mit ihren dicken Hornbrillen im Meeting sitzen und schon mal ihre Auszeichnung in Cannes feiern, die sie für dieses Meisterwerk erwarten.
Samsungs zweieinhalbminütiges Meisterwerk für die Smartwatch Galaxy Gear dagegen ist an Peinlichkeit und Plattheit kaum zu überbieten und schreit, wie das (zugegebenermaßen parteiische) Online-Magazin iPhone-Ticker schreibt, nach einem Eimer neben dem Rechner. Die Story hier:
Ein Skigebiet. Eine Blondine sitzt zwischen zwei jungen Männern im Sessellift, offensichtlich finden beide sie interessant. Der eine nimmt einen Anruf mit seiner Galaxy Gear entgegen, die er natürlich über dem Handschuh trägt.
Nach dem kurzen Gespräch hält er seine Uhr der Blondine unter die Nase und fordert sie dazu auf, ihm ihre Nummer zu geben, wenn sie etwas Cooles sehen wolle. Sie diktiert ihre Nummer, er ruft sie gleich darauf über die Gear an. Man verrät einander, dass man Jack und Aimee heißt. Währenddessen versucht der zweite Bewerber neben Aimee, sein Smartphone aus der Tasche zu fummeln, um die Nummer auch zu notieren. Natürlich fällt es aus dem Sessellift, und seine Skier gleich mit. Dann geht es mit dem Snowboard die Piste hinunter. Jack fährt hinter Aimee und macht mit der Gear heimlich einen Film sowie tolle Actionfotos von ihren Sprüngen (sicher, sicher), die er ihr sofort zeigt.
Man will sich wiedersehen. Schnitt auf die Après-Ski-Disco, Aimee und Jack begegnen sich im Gedränge, sie stößt ihn an, sein Smartphone fällt aus der Tasche. Er demonstriert ihr, wie er es über die Suchfunktion der Smartwatch wiederfindet. (Einfach bücken wäre schneller gegangen.) Er holt zwei Gläser Rotwein von der Bar, dabei scannt er die Flasche mit seiner Gear und sieht im Internet nach, was man darüber sagen kann.
Als Aimee ihn anruft (hat das so lange gedauert?), kann er dank Gear trotz der beiden Gläser, die er in der Hand hält, den Anruf annehmen. Seinem namenlosen Konkurrenten dagegen, der die Weinaktion beobachtet hat und ihm eigentlich mit zwei Gläsern bei Aimee zuvorkommen wollte, fällt ein Glas herunter, als er in die Hosentasche greift.
Jack kehrt zu Aimee auf die Terrasse zurück, beeindruckt sie mit dem eben erworbenen Weinwissen und spielt per Gear-Fernsteuerung Musik von seinem Handy ab. Sie schmiegt sich in seine Arme, und wir ahnen: Die beiden landen heute noch im Bett. Die Aussage: Wenn man »Geared Up« ist, kriegt man alle Weiber rum.
Das Ganze ist so platt, so mit dem Holzhammer, so sexistisch, so fürchterlich gecastet, schlecht gespielt und den Konsumenten für dumm verkaufend, dass man sich wirklich fremdschämt. Kein Wunder, dass Samsung auf YouTube die Kommentare unter dem Spot deaktivieren musste.
Ganz anders dagegen Apples Misunderstood, das ein Familienfest wie aus dem Bilderbuch zeigt. Wir sehen die Ankunft einer Familie (Mutter, Vater, Teenager-Sohn und Kindergarten-Tochter) bei ihren (Groß-)Eltern vor dem verschneiten Haus. Man umarmt sich, begrüßt die anderen Verwandten, die schon angekommen sind, und verbringt Zeit miteinander. Während drei Generationen Schlittschuh laufen, Schneespaziergänge machen, Schneemänner bauen und Schnee-Engel machen, sieht man den Teenager-Sohn leicht abseits sitzen und auf sein Smartphone starren. Immer wieder muss er von den anderen liebevoll in die Familienaktivitäten integriert werden.
Doch dann kommt die große Überraschung beim Geschenkeauspacken: Er schaltet zur Verwunderung aller den Fernseher an und präsentiert den Familien-Weihnachtsfilm, den er während der letzten Tage auf seinem iPhone gedreht, geschnitten, mit Titeln versehen und mit stimmungsvoller Musik unterlegt hat. Auch bei der Musikauswahl beweist Apple wieder einmal Stil. Statt die etwas süßliche Originalversion des Klassikers Have Yourself a Merry Little Christmas von 1944 mit Judy Garlands Stimme zu verwenden, untermalt Apple den Spot mit einer moderneren und minimalistisch instrumentierten Version. Und keine Mainstream-Chartsängerin verkitscht den Song, sondern die zerbrechliche Stimme von Chan Marshall aka Cat Power unterstützt die Bilder mit genau der richtigen Menge Emotion. Mutter und Großmutter wischen sich Tränen der Rührung aus den Augen, und auch manchem Zuschauer vor dem Bildschirm dürfte es ähnlich gehen. Am Ende wünscht Apple einfach »Happy Holidays«.
Natürlich ist auch der Apple-Spot nicht nach jedermanns Geschmack. Vielleicht zeigt er ein idealisiertes Familienbild und ist für manche zu rührselig. Aber die Charaktere sind toll ausgewählt, die Szenen stimmig und glaubwürdig. Und es gibt wohl keine Eltern, die sich nicht wünschten, ihr eigener Teenager, der abwesend auf seinen Bildschirm blickt, würde sie mit so einem Happy End überraschen.
Verglichen mit den nahezu zeitgleich erschienenen Werbespots der Konkurrenz ist der Spot von Apple reines Werbegold. Das Unternehmen verzichtet zur Weihnachtszeit auf Produktwerbung, setzt stattdessen voll auf Emotion. Man zeigt eben auch bei der Werbung Geschmack und setzt Maßstäbe.
6. GRUND
Weil Apple sich immer wieder neu erfindet
Vom ziemlich amateurhaften Computerhersteller, dessen erste 200 Geräte in der elterlichen Garage zusammengelötet wurden, bis zum IT-Riesen, der es heute ist: Apple hat jede Menge Neuanfänge und Kehrtwendungen vollzogen. Mehr als einmal sah es nicht gut für das Unternehmen aus. Aber Apple hat es immer wieder geschafft, sich neu zu definieren und gilt heute (jedenfalls zu dem Zeitpunkt, an dem ich das schreibe) als wertvollstes Unternehmen der Welt.
Der erste große Sprung war sicher der von der Schrauberbude zum börsennotierten Unternehmen. Nur vier Jahre nach seiner Gründung ging Apple an die Börse. Die Aktie kostete 22 Dollar, und der Börsengang brachte mehr Kapital als jeder andere seit dem Börsengang der Ford Motor Company im Jahr 1956. Ganz nebenbei wurden mehr Aktieninhaber zu Millionären als bei irgendeinem Börsengang zuvor – rund 300.
Zu diesem Zeitpunkt war Apple immer noch eine reine Computerfirma. Wiederum vier Jahre nach dem Börsengang, 1984, brachte Apple den Macintosh heraus. Der Macintosh revolutionierte zusammen mit dem Laserdrucker und dem Programm PageMaker die Art und Weise, wie Drucksachen entstanden – das Desktop-Publishing war geboren.
Trotz des Erfolgs kam es 1985 zum Machtkampf zwischen Steve Jobs und dem Vorstandsvorsitzenden John Sculley – einem Kampf, den Steve Jobs verlor. Er wurde aus seiner eigenen Firma gedrängt und gründete noch im selben Jahr die Konkurrenzfirma NeXT.
Apple entwickelte sich auch ohne Steve Jobs ein paar Jahre ganz gut, aber in den Neunzigerjahren begann der Stern des Unternehmens zu sinken. Man experimentierte mit Produkten wie den QuickTake-Digitalkameras, CD-Spielern und Lautsprechern oder dem Persönlichen Digitalen Assistenten Newton, dessen Entwicklung eine Menge Geld verschlang. Mit eWorld betrieb Apple in Zusammenarbeit mit AOL ein Online-Portal nur für Mac-Nutzer, das eine Alternative zu traditionellen Portalen wie CompuServe bilden sollte. All diese Dinge kosteten Geld, und im vierten Quartal 1995 meldete Apple einen Verlust von 68 Millionen Dollar. Im Januar 1996 wurde Gil Amelio Vorstandsvorsitzender von Apple. Der kürzte Ausgaben, unter anderem für die Entwicklung des neuen Betriebssystems. Dafür kaufte Apple im Februar 1997 unter seiner Leitung ironischerweise NeXT auf und nutzte Teile des Betriebssystems, um darauf Mac OS X und iOS aufzubauen. Die Aktie ging aber weiter in den Keller und erreichte im zweiten Quartal ein Zwölfjahrestief. Laut Wikipedia lag das zumindest teilweise auch am anonymen Verkauf von 1,5 Millionen Anteilen am 26. Juni.1 Der Verkäufer entpuppte sich später als Steve Jobs.
Am Wochenende des 4. Juli überzeugte Jobs den Vorstand davon, sich gegen Gil Amelio zu stellen. Weniger als eine Woche später trat dieser zurück und Steve Jobs wurde Vorstandsvorsitzender. Sein Lohn: 1 US-Dollar im Jahr. Allerdings erhielt er ausreichend Aktienanteile, um ihn für seine Mühen zu entschädigen. Zunächst trug Jobs den Titel »Interim CEO«, also »vorläufiger Vorstandsvorsitzender«, aber im Jahr 2000 wurde das »Interim« fallen gelassen. Die monatelange Suche nach einem festen Vorstandsvorsitzenden hatte keinen Erfolg gehabt. Apple war in keiner guten Verfassung, und niemand wollte sich von Steve Jobs bei der Arbeit über die Schulter sehen lassen.
Sobald Steve Jobs wieder das Sagen hatte, beendete er kurzerhand viele Experimente, von denen er nicht überzeugt war. Auch der Newton wurde eingestellt – er war seiner Zeit einfach zu weit voraus. Angeblich fürchteten sich Angestellte davor, ihn im Aufzug zu treffen, aus Angst, keinen Job mehr zu haben, wenn die Türen sich wieder öffneten.
Ausgerechnet der frühere Gegner Microsoft rettete Apple über die verlustreiche Zeit. Apple arbeitet mit Microsoft an einer neuen Version von Microsoft Office, und Microsoft investierte 150 Millionen Dollar in Apple-Anteile. 1997 führte Apple den Online Store ein, in dem man sich seinen Mac mit ein paar Klicks zusammenstellen konnte. 1998 wurde der iMac vorgestellt. Der Leiter des iMac-Teams war kein anderer als Jonathan Ive, der auch die späteren Erfolge iPod und iPhone designte.
Der iMac legte den Grundstein für Apples jetzigen Erfolg und stand für alles, was man mit dem Unternehmen heute verbindet. Er war extrem eigenständig und gut designt. Er brach mit Regeln (zum Beispiel verfügte er über kein Diskettenlaufwerk) und er war revolutionär einfach zu bedienen. Mit wenigen Einrichtungsschritten war man mit dem Internet verbunden. Es gab nicht einmal ein richtiges Handbuch.
In einem Werbefilm ließ man einen Stanford-Studenten mit einem Hewlett-Packard-Rechner und einen Siebenjährigen mit seinem Border Collie und einem iMac gegeneinander antreten. Welcher von beiden würde es eher schaffen, seinen Rechner frisch aus der Verpackung zum Laufen zu bekommen und sich mit dem Internet zu verbinden? Der siebenjährige Johann Thomas schaffte es mit dem iMac in acht Minuten und 15 Sekunden. Da mühte sich der Stanford-Student mit seinem herkömmlichen Rechner immer noch ab.
Seit damals bleibt Apple seiner Philosophie der Einfachheit und Innovation treu, erfindet sich dabei aber trotzdem immer wieder neu. Apple stellt nicht mehr nur Rechner her, sondern hat ganz nebenbei auch den Musikmarkt und die Kommunikationsindustrie revolutioniert – durch seine Fähigkeit, sich immer weiterzuentwickeln.
7. GRUND
Weil Apple auch mal Fehler macht
Okay, kommen wir zu den wenigen Punkten, angesichts derer auch der größte Apple-Fanboy verschämt die Augen niederschlägt und beim besten Willen keine Argumente zur Verteidigung seines Lieblingsunternehmens mehr vorzubringen weiß. Und wir sprechen hier nicht von zweifelhaften Entscheidungen wie der, den Newton einzustellen (gerade als ich mich damals zum Kauf entschlossen hatte), weil die Zeit noch nicht reif war. Wir sprechen auch nicht vom wohl kurzlebigsten Social Network, das jemals fast existiert hätte – Ping. Es war in iTunes integriert, konnte also vom Start weg auf eine riesige Nutzerbasis aufbauen – und floppte trotzdem so grandios, dass Apple die Totgeburt rund zwei Jahre später beerdigte.
Nein, wir reden von einem Produkt, dessen Fehlkonzeption so groß und eindeutig, so unmittelbar ersichtlich war, dass man sich fragen muss, wie es jemals Serienreife erlangen konnte.
Wir reden von der runden Maus, die zusammen mit dem ersten iMac 1998 ausgeliefert wurde. Die farblich zum iMac passende Maus war Apples erste USB-Maus und eine echte Katastrophe. Auf den ersten Blick schien sie ganz ansprechend, aber wenn man versuchte, sie zu benutzen, wurde einem innerhalb weniger Sekunden klar: Das Ding war unbrauchbar.
Das Problem lag in der scheinbar perfekten runden Form. Wenn man beim Schreiben blind zur Maus griff, um schnell mal ein paar Wörter zu markieren, zu verschieben oder zu bearbeiten, wusste man nie, in welche Richtung sich der Mauszeiger bewegen würde. Zeigte die Maus»spitze« mit dem Kabel auch nur ein wenig nach links, schoss der Mauszeiger zum Beispiel nach rechts oben anstatt gerade nach oben, wie gewünscht. Das passierte ständig. Der Hockey-Puck glitt unkontrollierbar über das Mauspad.
Zwar brachten findige Zubehörhersteller schnell ein passendes Kunststoffteil zum Anklippen auf den Markt, das der Maus wieder zur nötigen länglichen Form verhalf. Aber auch diese Krücke brachte nicht viel, denn mit dem Zusatzteil konnte das insgesamt viel zu große Gerät nur von Menschen mit Riesenpranken ordentlich bedient werden. Es verdiente eher die Bezeichnung »Ratte« als »Maus«. Ein hilfloser Versuch, ein unbrauchbares Eingabegerät halbwegs benutzbar zu machen.
Die wenigsten Nutzer fielen darauf herein. Stattdessen wechselte man zum Erzfeind: Microsoft. Nicht gleich mit dem ganzen Rechner, das dann doch nicht. Aber immerhin mit der Maus. Durch den USB-Anschluss konnte man glücklicherweise auf die Mäuse anderer Hersteller ausweichen. Sicher hat Microsoft zu keiner Zeit mehr Mäuse an Apple-Nutzer verkauft als damals. Noch heute fragen sich Apple-Veteranen, die das Desaster damals miterleben mussten, kopfschüttelnd: Wie konnte Steve Jobs, der detailbesessene Perfektionist, diese Maus nur durchgehen lassen?
Wahrscheinlich einfach deswegen, weil er eben auch nur ein Mensch war. Weil Apple eben doch nicht der alles kontrollierende Moloch ist, dem nichts entgeht.
8. GRUND
Weil Apple zu den wertvollsten Marken der Welt gehört
Die weltweit größte Werbeholding WPP (Wire and Plastic Products – das Kernunternehmen produzierte ursprünglich Einkaufskörbe) erstellt seit Jahren eine Studie mit Namen BrandZ Report (also in etwa »MarCKen Report«).
In dieser Studie bewerten die Marketingexperten von WPP den Wert von über 60.000 Marken in mehr als 200 Kategorien, indem sie Konsumenten und andere Marketingexperten befragen. 2006 lag Apple noch auf Platz 29, 2007 hatte sich das Unternehmen schon auf Platz 16 verbessert, 2009 lag es auf Platz 6.
2013 schaffte Apple es auch bei den Kollegen von Interbrand, noch vor Google, Coca Cola, IBM und Microsoft auf Platz 1 der Studie »Best global Brands« zu landen.
Und auch im Brand Finance Global 500 Report 2014 setzt sich Apple mit weitem Abstand an die Spitze – zum dritten Mal übrigens. Konkurrent Samsung folgt auf dem zweiten Platz, dahinter erst kommen Google und Microsoft. Das erste deutsche Unternehmen ist die Telekom auf Platz 14.
Der Abstand von Apple zu Samsung ist dabei übrigens beträchtlich. Apples Markenwert wird von den Autoren der Studie für 2014 mit rund 104 Millionen US-Dollar angegeben, der von Samsung »nur« mit 78 Millionen. Berechnet wird dieser Wert auf der Grundlage verschiedener Faktoren. Insbesondere die Höhe der Lizenzgebühren wird dabei berücksichtigt.
Natürlich kann man sich über den Sinn oder Unsinn solcher Rankings und deren Genauigkeit streiten. Aber immerhin bestätigen sie den Eindruck, den wohl jeder Verbraucher in den letzten Jahren gewonnen hat: Apple ist die Nummer eins. Es ist das erfolgreichste Unternehmen, und zwar nicht nur gefühlt, sondern messbar. Im letzten Quartal 2013 soll das Unternehmen laut der Website Investors.com sogar 87,4 Prozent der weltweiten Gewinne mit mobilen Geräten eingestrichen haben. Samsung an zweiter Stelle habe sich 32,2 Prozent gesichert. Aufmerksame Rechner werden sich jetzt vielleicht wundern, wieso da mehr als 100 Prozent herauskommen. Das liegt daran, dass die anderen Unternehmen in dieser Zeit Verluste gemacht haben. Fragen Sie mich nicht, wie genau die Rechnung funktioniert, jedenfalls behauptet Apple auch hier stolz seinen Platz.
Und das allen Unkenrufen zum Trotz, die Apple schon seit Jahren den baldigen Untergang prophezeien. Aber anders als in den Neunzigerjahren des letzten Jahrtausends, als Apple-Nutzer sich manchmal fragen mussten, wie lange es das Unternehmen wohl noch geben würde, kann man die Miesmacher heutzutage getrost ignorieren. Es sieht nicht so aus, als würde Apple so schnell wieder untergehen, wie es vom kleinen Rechnerhersteller zum Elektronikgiganten aufgestiegen ist. Das Unternehmen liefert den Menschen einfach jedes Jahr neue Gründe, es zu lieben, seine Produkte zu kaufen und dafür zu sorgen, dass es seine Position ganz oben noch eine Weile behält. Und falls Apple doch einmal in den nächsten Jahren ein paar Positionen nach unten rutschen sollte2 und die Propheten des Untergangs wieder ihre Stimme erheben – hey, das Software-Unternehmen SAP liegt als bestes deutsches Unternehmen auf Platz 19 und wird dafür gefeiert. Wahren Fans sind solche Ranglisten sowieso egal. Die freuen sich höchstens bei guten wirtschaftlichen Aussichten für Apple über die Gewissheit, dass sie noch viele Jahre lang Produkte werden kaufen können, die Dinge möglich machen, von denen sie immer geträumt haben.
9. GRUND
Weil Apple mobiles Arbeiten für alle ermöglicht hat
Gut, es gab sie schon vorher, die Palms, HandEras und Treos. Aber das waren weniger Schreibgeräte als vielmehr elektronische Kalender mit einigen Zusatzfähigkeiten.
Das Schreiben auf diesen Geräten war trotz einigermaßen funktionierender Handschrifterkennung nur etwas für kürzere Notizen, für Adressen und Telefonnummern. Wollte man längere Texte verfassen, biss man entweder bald frustriert in den unbedingt notwendigen Stift oder legte sich eine faltbare Tastatur zu, die wiederum die Mobilität einschränkte. Für Pendler, die zum Beispiel im Zug die Fahrt zur Arbeit vernünftig nutzen wollten, war das nichts. Man brauchte eine feste Unterlage für diese Art Tastatur.
Erst mit der Software-Tastatur des iPhones, mit der man auch ohne Stift und mit dicken Fingern vernünftig längere Texte tippen konnte, begann die Ära des mobilen Arbeitens wirklich. Die komplette erste Fassung dieses Textes zum Beispiel entstand auf einem iPhone im Liegestuhl am Urlaubsstrand. Mit einem der vielen Textverarbeitungsprogramme, die Markdown unterstützen (mehr dazu im 84. Grund, »Weil Markdown auf dem Mac entstanden ist«).
Außer dem iPhone hätte das Gerät meiner Wahl natürlich auch das iPad, iPad mini oder der iPod touch sein können (den ich vor dem iPhone tatsächlich als Laptop-Ersatz benutzt habe). Tatsache ist, dass Apple mit seinem iOS und den entsprechenden Geräten einen Laptop für reines Schreiben (und viele andere Office-Aufgaben) entbehrlich gemacht hat. Googles Android-Betriebssystem kam erst später.
Steve Jobs stellte das ursprüngliche Betriebssystem zusammen mit dem ersten iPhone am 9. Januar 2007 vor. Damals nannte er das System, das wir heute als iOS kennen, noch OS X, weil es vom Mac OS X abstammte.
Im selben Jahr, aber erst am 5. November 2007, gab Google bekannt, dass man an einem Betriebssystem für Mobiltelefone arbeite. Erst am 22. Oktober 2008 kam dann das erste Gerät mit diesem Android-System auf den Markt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Apple schon die Version 2.0 seines iPhones OS vorgestellt, zusammen mit dem neuen Konzept des App Stores.
Zu diesem Zeitpunkt war das iPhone noch nicht so vielseitig einsetzbar wie heute, aber ein Anfang war gemacht. Ein Anfang, der eine Wende für das mobile Arbeiten einläutete.