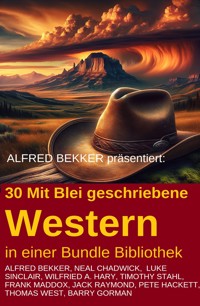
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Harte Männer, wilde Cowboys und scharfe Ladies - Romane aus einer wilden Zeit und einem ungezähmten Land; tabulos, prickelnd und authentisch in Szene gesetzt. (1699) Dieses Buch enthält folgende Western: Alfred Bekker: Nelsons Rache Alfred Bekker: Das Gesetz des Don Turner Alfred Bekker: Der Geächtete Alfred Bekker: Zum Sterben nach Sonora Alfred Bekker: Entscheidung in Nogales Alfred Bekker: Wölfe in der einsamen Geisterstadt Alfred Bekker: Der Prediger kommt nach Lincoln Barry Gorman: Wenn Revolver sprechen Alfred Bekker: Die Bande der Revolvermänner Alfred Bekker: Das heiße Spiel von Dorothy Alfred Bekker: Die wilde Brigade Timothy Stahl: In Devil Town ist die Hölle los Timothy Stahl: Die Legende vom goldenen Mustang Timothy Stahl: Ein Greenhorn auf gefährlicher Spur Timothy Stahl: Zwei wie Dynamit und Feuer Luke Sinclair: Die Verfluchten der Blizzard-Hölle Luke Sinclair: Der Teufel mit dem Stern Wilfried A. Hary: Blutrache in Ghost Town City Wilfried A. Hary: John Steins Rache Pete Hackett: Und dann schlägt dir die Stunde, McQuade Frank Maddox: Reiter in sehr dunkler Nacht Frank Maddox: Grainger und die Mormonenbraut Frank Maddox: Grainger und der dunkle Revolverheld Neal Chadwick: Rache in Dodge City Jack Raymond: Der Schatten der Banditen Pete Hackett: Ein Strick für Johnny Fletcher Pete Hackett: Sie traten das Gesetz mit Füßen Pete Hackett: Weide in Flammen Pete Hackett: Einsam sind die Tapferen Jack Raymond: Der Goldsucher von Santamira Schüsse peitschten draußen, auf dem Vorhof der Sundance Ranch, dem Freudenhaus am Rande von Lincoln. Town-Marshal Clay Braden steckte im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme. Alles, was er trug, war der Stetson auf seinem Kopf. Die blonde Dorothy, mit der er sich in den Kissen wälzte, war ebenfalls nackt. Ihre langen Beine hatte sie um Clays Körpermitte geschlungen. Damit zog sie ihn zu sich heran, hinein ihre Wärme. "Lass die Kerle da draußen sich doch gegenseitig erschießen!", keuchte sie. "Aber jetzt kommst du hier nicht weg..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 2801
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
30 Mit Blei geschriebene Western in einer Bundle Bibliothek
Inhaltsverzeichnis
30 Mit Blei geschriebene Western in einer Bundle Bibliothek
Copyright
Nelsons Rache
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Das Gesetz des Don Turner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Der Geächtete
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Zum Sterben nach Sonora
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ENTSCHEIDUNG IN NOGALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Wölfe in der einsamen Geisterstadt:
Der Prediger kommt nach Lincoln
Copyright
Wenn Revolver sprechen
Die Bande der Revolvermänner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Das heiße Spiel von Dorothy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Die wilde Brigade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
In Devil Town ist die Hölle los!
Die Legende vom goldenen Mustang
Ein Greenhorn auf gefährlicher Spur
Zwei wie Dynamit und Feuer
Die Verfluchten der Blizzard-Hölle
Der Teufel mit dem Stern
Blutrache in Ghost Town City
John Steins Rache
Und dann schlägt dir die Stunde, McQuade
Reiter in sehr dunkler Nacht
Grainger und die Mormonenbraut
Grainger und der dunkle Revolverheld
Rache in Dodge City
Der Schatten der Banditen: Western
Reite, kämpfe und töte
Ein Strick für Johnny Fletcher
Sie traten das Gesetz mit Füßen
Weide in Flammen
Einsam sind die Tapferen
Der Goldsucher von Santamira
30 Mit Blei geschriebene Western in einer Bundle Bibliothek
Neal Chadwick, Frank Maddox, Jack Raymond, Alfred Bekker, Barry Gorman, Timothy Stahl, Luke Sinclair, Wilfried A. Hary, Pete Hackett
Harte Männer, wilde Cowboys und scharfe Ladies - Romane aus einer wilden Zeit und einem ungezähmten Land; tabulos, prickelnd und authentisch in Szene gesetzt.
Dieses Buch enthält folgende Western:
Alfred Bekker: Nelsons Rache
Alfred Bekker: Das Gesetz des Don Turner
Alfred Bekker: Der Geächtete
Alfred Bekker:Zum Sterben nach Sonora
Alfred Bekker: Entscheidung in Nogales
Alfred Bekker: Wölfe in der einsamen Geisterstadt
Alfred Bekker: Der Prediger kommt nach Lincoln
Barry Gorman: Wenn Revolver sprechen
Alfred Bekker: Die Bande der Revolvermänner
Alfred Bekker: Das heiße Spiel von Dorothy
Alfred Bekker: Die wilde Brigade
Timothy Stahl: In Devil Town ist die Hölle los
Timothy Stahl: Die Legende vom goldenen Mustang
Timothy Stahl: Ein Greenhorn auf gefährlicher Spur
Timothy Stahl: Zwei wie Dynamit und Feuer
Luke Sinclair: Die Verfluchten der Blizzard-Hölle
Luke Sinclair: Der Teufel mit dem Stern
Wilfried A. Hary: Blutrache in Ghost Town City
Wilfried A. Hary: John Steins Rache
Pete Hackett: Und dann schlägt dir die Stunde, McQuade
Frank Maddox: Reiter in sehr dunkler Nacht
Frank Maddox: Grainger und die Mormonenbraut
Frank Maddox: Grainger und der dunkle Revolverheld
Neal Chadwick: Rache in Dodge City
Jack Raymond: Der Schatten der Banditen
Pete Hackett: Ein Strick für Johnny Fletcher
Pete Hackett: Sie traten das Gesetz mit Füßen
Pete Hackett: Weide in Flammen
Pete Hackett: Einsam sind die Tapferen
Jack Raymond: Der Goldsucher von Santamira
Schüsse peitschten draußen, auf dem Vorhof der Sundance Ranch, dem Freudenhaus am Rande von Lincoln.
Town-Marshal Clay Braden steckte im wahrsten Sinne des Wortes in der Klemme.
Alles, was er trug, war der Stetson auf seinem Kopf. Die blonde Dorothy, mit der er sich in den Kissen wälzte, war ebenfalls nackt. Ihre langen Beine hatte sie um Clays Körpermitte geschlungen. Damit zog sie ihn zu sich heran, hinein ihre Wärme.
"Lass die Kerle da draußen sich doch gegenseitig erschießen!", keuchte sie. "Aber jetzt kommst du hier nicht weg..."
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Nelsons Rache
Von Alfred Bekker
Es war entsetzlich, was in jener schicksalhaften Stunde alles über Jesse Nelson hereinbrach. Es waren Bilder und Eindrücke, die ihn bis ans Ende seiner Tage nicht mehr loslassen würden: wie das Blei seiner Gegner in seinen Körper schlug. Wie er Alices Hilfeschrei hörte – und wie er sich durch beißenden Rauch und mörderische Flammen kämpfte, um vielleicht doch noch wenigstens einen der Menschen retten zu können, die er mehr liebte als alles andere auf der Welt. In dieser Stunde begann Jesse Nelsons unerbittlicher Rachetrail …
1
Dan McLeish war jetzt zu allem entschlossen und hatte die zwei Dutzend Cowboys mitgebracht, die bei ihm in Lohn und Brot standen. Es konnte nicht länger angehen, dass ein dahergelaufener Schafhirte ihm ungestraft auf der Nase herumtanzen durfte!
McLeish hatte bisher noch jeden vertrieben, der versucht hatte, in dieser Gegend Schafe zu züchten oder Landparzellen abzustecken. Jeder, der das versuchte, musste wissen, dass das nur über McLeishs Leiche ging.
Er blickte den Hügel hinab auf das Farmhaus und die Schafe, diese verdammten Schafe, die das Gras bis zur Wurzel abfraßen und für die Rinder nichts übrig ließen.
Seine hellblauen Augen blitzten gefährlich.
„Wir haben Nelson weiß Gott oft genug gewarnt!“, sagte McLeish, in dessen sonnenverbranntem Gesicht ein grausamer Zug stand.
Er nahm den Hut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn, wobei sein hellblondes, fast weißes und bereits ein wenig schütteres Haar zum Vorschein kam.
Er wandte sich an seine Leute: „Ihr wisst, was ihr zu tun habt!“
2
Lynn Nelson war eine kleine, kräftige Frau mit langen roten Haaren, die sie mit einer einfachen Schleife zusammengefasst hatte. Sie trug eine Hose aus blauem Drillich und ein weißes Hemd, beides von Jesse, ihrem Mann – und beides viel zu groß. Aber bei der Arbeit mit den Schafen waren diese Sachen einfach praktischer als ein Kleid.
Als sie die Reitschar auf dem nahe gelegenen Hügel bemerkte, wusste sie, dass das nichts Gutes bedeuten konnte.
Zu dumm, dass Jesse ausgerechnet heute in die Stadt reiten musste, um Besorgungen zu machen!, dachte sie, während das Entsetzen für einige Momente von ihr Besitz ergriff und sie lähmte.
Sie erkannte McLeish, den Rancher, unter den Reitern und wusste sofort, was das bedeutete.
McLeish hatte schon einiges versucht, um sie und Jesse aus der Gegend zu vertreiben, aber es war ihm bisher nicht gelungen. Sie hatten die Zähne zusammengebissen und den Schikanen des Rinderzüchters, so gut es ging, standgehalten.
Aber jetzt war es so weit, jetzt wollte McLeish offensichtlich ein für allemal reinen Tisch machen.
Lynn sah, wie ihre kleine Tochter Alice unbekümmert hinter einem der Lämmer herrannte und es an den Ohren zu ziehen versuchte. Sie ahnte nichts von der Gefahr, die ihnen drohte.
„Alice!“, rief Lynn Nelson. „Alice! Komm ins Haus!“
„Warum denn?“
„Frag nicht, sondern tu, was ich dir sage!“
Jetzt bemerkte auch Alice die Reiter auf dem Hügel. Sie lief zu ihrer Mutter, die sie zum Haus führte.
„Ma, was wollen diese Männer von uns?“
Lynn antwortete nicht, sondern schob ihre Tochter durch die Tür. Dann war sie mit zwei schnellen Schritten dort, wo die Winchester an der Wand hing. Sie nahm die Waffe an sich und suchte anschließend nach Munition.
Als sie sie gefunden hatte, sah sie Alice am offenen Fenster stehen und nach draußen blicken.
„Geh vom Fenster weg, hörst du! Leg dich in die Ecke hinter dem Schrank! Flach auf den Boden!“ Sie wechselten einen kurzen Blick miteinander. Die Tochter spürte wohl, dass jetzt nicht die Zeit war, um Widerspruch zu üben. Sie gehorchte wortlos und mit vor Schreck geöffnetem Mund.
Das Geräusch von zwei Dutzend galoppierenden Pferden war dann zu hören und ließ Lynn mit der unterdessen geladenen Winchester am Fenster Stellung beziehen, nachdem sie zuvor hastig die Tür verriegelt hatte.
„Ma, sind das die Männer, die nicht wollen, dass wir Schafe haben?“, rief die kleine Alice aus ihrer Deckung heraus.
„Ja“, antwortete Lynn knapp.
Aber ihre Gedanken beschäftigten sich mit ganz anderen Dingen.
Die Holzwände sind nicht sehr dick!, überlegte sie. Jesse und sie hatten das Haus gegen Regen, Wind und Kälte gebaut, aber nicht als eine Festung, die geeignet war, schießwütigen Cowboys standzuhalten!
Wenn geschossen wird, dann werden die Bleikugeln das dünne Holz durchschlagen, als wäre es Papier!, dachte sie.
Sie sah die Reiter herankommen, sah ihre grimmig entschlossenen Gesichter und erschauderte.
Aber Lynn Nelson war mindestens ebenso entschlossen wie ihre Gegner. Zu dumm, dass ihr Mann ihr in diesem Augenblick nicht beistehen konnte, aber auch ohne ihn würde sie sich zu wehren wissen!
Jesse hatte ihr den Umgang mit Waffen beigebracht. Sie war keine Frau, die sich widerstandslos in ihr Schicksal fügte.
Sie werden es zunächst auf die Schafe abgesehen haben!, überlegte sie.
Die Schafe stoben auseinander, als die Reiter herankamen.
In einiger Entfernung vom Farmhaus zügelte Dan McLeish sein Pferd, und die Männer folgten seinem Beispiel.
„Nelson!“, rief McLeish in barschem, befehlsgewohntem Ton.
Lynn antwortete nicht.
Wenn sie wissen, dass Jesse nicht da ist, ist mein Stand noch schwerer!, dachte sie. So blieb ihnen ein Rest von Ungewissheit.
„Nelson, wo sind Sie? Wo verkriechen Sie sich?“
Lynn packte ihre Waffe fester. „Nelson, ich weiß, dass Sie hier irgendwo stecken! Schauen Sie sich gut an, was jetzt geschieht! Ich habe Sie gewarnt, Sie wollten nicht hören!
Was jetzt geschieht, haben Sie sich selbst zuzuschreiben!“
Er wandte sich an seine Cowboys. „Los, Männer, fangt an!“
Sie zogen ihre Revolver aus den Holstern und ballerten wie wild auf die Schafe, die in heller Panik durcheinander liefen. Jemand zündete die Scheune an, ein anderer steckte den Pferdewagen in Brand.
Lynn Nelson legte kurz an und schoss. Einer von McLeishs Männern sank tödlich getroffen aus dem Sattel, einen weiteren erwischte sie am Waffenarm, so dass er laut aufschrie und seinen Revolver fallen ließ.
„Da hinten!“, rief er mit vor Schmerz und Wut verzerrtem Gesicht. „Am Fenster!“
Lynn duckte sich rasch, aber der Geschosshagel, den McLeishs Männer in ihre Richtung abgaben, durchschlug die dünne Bretterwand, als wäre sie nichts. Sie konnten Lynn nicht sehen, sondern schossen einfach blind drauflos.
Zwei Kugeln fuhren ihr in den Bauch. Wie gelähmt sah sie, wie sich das weiße Hemd rot färbte. Ein weiterer Schuss traf sie an der Schulter und riss sie herum. Zunächst war da der Schmerz, der dann aber zurücktrat. Sie spürte, wie ihr die Sinne zu schwinden begannen.
Nein!, schrie es in ihr. Es durfte noch nicht zu Ende sein! Es durfte einfach nicht!
Sie spürte, wie ihr das Gewehr aus der Hand glitt und sie an der Bretterwand zu Boden rutschte.
Sie sah Alice in ihrer Ecke hocken, den Mund vor Entsetzen weit aufgerissen. Schon um des Kindes willen durfte sie jetzt nicht sterben! Sie durfte nicht …
„Ma!“, hörte sie die Kleine rufen.
Es war das letzte, was sie hörte.
Alles verstummte. Es wurde dunkel vor ihren Augen.
3
Es war Jesse Nelson unter den gegenwärtigen Umständen nie ganz wohl dabei, seine Familie allein auf der Farm lassen zu müssen – und wenn es nur für wenige Stunden war.
McLeish war unberechenbar.
Es war unmöglich vorherzusagen, welche Gemeinheit ihm als nächste einfallen würde, um sie zu schikanieren.
Diesem Mann war, so schien es, jedes Mittel recht, um sie aus der Gegend zu vertreiben.
Zunächst hatte er es mit Geld versucht, aber Jesse Nelson war nicht käuflich. Dann hatte der Rancher härtere Bandagen benutzt.
Einige von McLeishs Cowboys hatten ihm aufgelauert und ihn verprügelt; man hatte ihm seine Schafe auseinander getrieben, so dass er sie sich weit verstreut in der Umgebung wieder hatte zusammensuchen müssen, und vor etwa einer Woche hatte Nelson einen Mann überrascht, der versuchte, seiner Familie das Dach über dem Kopf anzuzünden.
Nelson hatte sich an den Sheriff gewandt, dessen Aufgabe es gewesen wäre, hier für Recht und Ordnung zu sorgen, aber der stand auf Seiten von McLeish und hatte wenig Neigung, sich mit dem mächtigen Rancher anzulegen.
Sheriff Duggan machte einfach die Augen zu und nahm nicht zur Kenntnis, was McLeish da für ein hässliches Spiel inszenierte.
Von anderen Leuten in der Gegend hatte Nelson erfahren, dass Duggan in früheren Fällen ähnlich verfahren war. Er hatte nie etwas dagegen unternommen, dass McLeish bisher alle Siedler und Schafzüchter davongejagt hatte, obwohl er kein Recht dazu besaß.
Aber Nelson war zäh und wild entschlossen, sich nicht vertreiben zu lassen, denn abgesehen von McLeishs Anwesenheit gefiel ihm dieses Land.
Er trieb sein Pferd voran, mit der Linken führte er die Zügel eines Packtieres, dessen Rücken mit allerlei Gerätschaften beladen war, die er in New Kildare eingekauft hatte. Jetzt befand er sich auf dem Rückweg und war voller Unruhe.
Er dachte an Lynn, seine Frau – und an die kleine Alice.
Verdammt, wenn dieser McLeish oder einer seiner Schergen sich an ihnen vergriffen haben sollte, kann ich für nichts mehr garantieren!, dachte er grimmig.
Aber dann scheuchte er seine Befürchtungen mit dem Gedanken davon, dass er Lynn den Gebrauch der Winchester beigebracht hatte und sie sich zu wehren wissen würde.
Sie war eine gute Schützin.
4
Als Jesse Nelson die Schüsse in der Ferne hörte, schnürte es ihm fast die Kehle zu. Eine schwarze Rauchsäule stieg am Horizont auf.
Nelson ließ die Zügel des Packtieres fahren und gab seinem Pferd die Sporen. Dort, wo die Rauchsäule aufstieg, war seine Farm. Etwas Furchtbares musste dort gerade im Gange sein …
Wut und Verzweiflung begannen sich in ihm auszubreiten.
Als er die Farm erreichte, bot sich ihm ein Bild des Grauens: Der Boden war übersät mit den Kadavern dahingemetzelter Schafe. Die Scheune war niedergebrannt, und das Wohnhaus stand in hellen Flammen.
Mein Gott!, durchfuhr es Nelson. Wo waren Lynn und Alice?
Sein Blick fiel auf McLeish und seine Männer, die ihr Werk der Zerstörung wohl gerade beendet hatten und sich nun davonzumachen gedachten.
McLeishs Gesicht hatte eben noch einen selbstzufriedenen Eindruck gemacht, aber als er Nelson bemerkte, erschrak er für einen Moment.
Aber dann gewann der Rancher seine Fassung zurück, griff zum Holster an seiner Seite und riss den Revolver heraus.
Nelson reagierte zu spät.
Er schaffte es gerade noch, mit der Rechten den Griff seines Revolvers zu berühren, da spürte er, wie ihm eine Kugel in die Seite fuhr.
Eine weitere schoss ihm in die rechte Schulter und riss ihn herum. Benommen rutschte er aus dem Sattel und fiel in das stachelige, trockene Präriegras.
Nelson biss die Zähne zusammen.
Er versuchte, den Revolver aus dem Holster zu holen, aber es war zwecklos. Sein rechter Arm gehorchte ihm nicht mehr.
Er keuchte und sah, dass sich an seiner Seite das Hemd bereits mit Blut getränkt hatte. Mit der Linken versuchte er, die Blutung aufzuhalten, aber natürlich hatte das nicht viel Sinn.
„Ich glaube, der hat genug, Boss!“, sagte jemand. „Der wird Ihnen kaum noch einmal in die Quere kommen!“
Nelson hörte Schritte auf sich zukommen. Er sah ein paar schmutzige Stiefel und blickte hoch. McLeishs kalte blaue Augen blickten auf ihn herab.
„Ich habe ihn schwer erwischt“, erklärte er.
„Wahrscheinlich wird er sterben.“
5
Vor Nelsons Augen drehte sich alles.
Nur ganz am Rande nahm er wahr, wie Dan McLeish und seine Männer sich davonmachten.
Beißender Qualm stieg ihm in die Nase und ließ ihn husten.
Er hörte das Knistern von brennendem Holz und dann eine helle, dünne Stimme, deren Klang ihm wohlvertraut war.
„Hilfe! Hilfe!“
Das war Alice!
Sie musste noch im Haus sein, an dessen Wänden die Flammen hoch emporzüngelten. Die ersten Balken krachten hernieder. Nicht mehr lange, und das ganze Gebäude würde wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen.
„Hilfe!“, rief es wieder. „Hilfe!“
Mit einem Mal traten Schmerz und Benommenheit in den Hintergrund. Eder Klang dieser Stimme gab Nelson neue Kraft, eine Kraft, die aus Verzweiflung geboren war.
Er nahm die Linke von der Wunde an seiner Seite und versuchte sich aufzustützen.
Er stöhnte und keuchte, kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn und rann ihm das Gesicht hinunter.
Erst jetzt wurde ihm klar, wie schwach er wirklich war.
Nachdem es ihm tatsächlich gelungen war, auf die Beine zu kommen, stolperte er in Richtung des Hauses, strauchelte nach ein paar Metern und befand sich gleich darauf wieder auf der Erde.
Es waren jetzt nur noch ein paar Schritte.
Er spürte die Hitze. Der Qualm raubte ihm mittlerweile fast den Atem.
Aber da war diese helle, dünne Stimme voller Todesangst, die seiner Tochter gehörte, die jetzt irgendwo dort drinnen in den Flammen war und um ihr Leben schrie.
Diese Stimme trieb ihn dazu, alles zu versuchen und das Letzte aus sich herauszuholen.
Mit der Kraft der Verzweiflung kroch Nelson voran.
Erst als er die Haustür erreicht hatte, unternahm er einen erneuten Versuch, sich aufzurichten.
Dann versuchte er, die Tür mit dem Fuß aufzustoßen, aber sie war von innen verriegelt. Nelson fluchte. Die Flammen züngelten bereits an ihrem Holz empor, aber er konnte unmöglich warten, bis der Riegel verbrannt war, der die Tür geschlossen hielt.
Augen zu!, dachte Nelson. Augen zu und durch!
Er nahm alle Kraft zusammen, die ihm noch geblieben war, und warf sich mit vollem Gewicht gegen die brennende Tür.
Es war heiß, verdammt heiß …
Nelson schrie laut auf, aber die Tür gab nicht nach.
Kraftlos rutschte er an ihr zu Boden und rollte sich dann zur Seite. Hastig schüttelte er den Hut ab, der Feuer gefangen hatte.
Er sah das offene Fenster, und für einen Augenblick erwog er die Möglichkeit, von dort ins Hausinnere zu klettern.
Er verwarf diesen Gedanken allerdings rasch wieder.
Unter normalen Umständen wäre das eine Kleinigkeit gewesen und nicht der Rede wert, aber in seiner jetzigen Verfassung war er einfach zu schwach.
Es hatte keinen Zweck.
Er musste es noch einmal probieren, sich noch einmal gegen die brennende Tür werfen.
Er presste die Lippen aufeinander und raffte sich auf.
Wenig später stand er wieder auf wackeligen Beinen vor der Tür und warf sich mit aller Kraft dagegen.
Diesmal gab sie nach.
Er hörte, wie der Riegel, der sie von innen versperrte, splitterte. Dann stürzte er zusammen mit der Tür nach Innen.
Ein brennender Balken krachte hinunter und traf ihn schmerzhaft am Rücken. Nelson schüttelte ihn ab. Dann sah er Lynn, deren unnatürlich geweitete Augen ihn starr anblickten. Das Feuer begann bereits, ihre Kleidung und ihr Haar zu erfassen, aber die blutenden Wunden, die man ihr beigebracht hatte, ließen keinen Zweifel daran, dass es nicht die Flammen gewesen waren, die sie getötet hatten.
Sie war erschossen worden!
Nelson spürte einen Kloß im Hals. Er konnte kaum schlucken.
Sein Mund öffnete sich halb, als ob er etwas sagen wollte. Er war unfähig, sich zu rühren oder irgendetwas zu tun, er war sogar unfähig, einen Fluch über die Lippen zu bringen. Abgrundtiefe Verzweiflung und Schmerz standen in seinen Zügen. Er schüttelte stumm den Kopf, so als wollte er es einfach nicht wahrhaben …
Nein, dachte er. Nein, das konnte doch nicht wahr sein!
Dann dachte er an die Kinderstimme, die ihn hier hergebracht und ihm Kraft eingeflößt hatte. Es wurde ihm plötzlich klar, dass sie verstummt war.
„Alice!“
Es war halb Keuchen, halb Husten. Seine Stimme klang für ihn selbst entsetzlich schwach, aber es war alles, wozu er im Moment imstande war.
Doch es kam keine Antwort.
„Alice!“
Er schleppte sich weiter und hatte seine Tochter wenig später gefunden. Sie lebte nicht mehr. Einer der herunterbrechenden Dachbalken hatte sie erschlagen.
6
Nelson kroch aus den brennenden Trümmern seines Hauses und blieb schließlich im trockenen Gras keuchend liegen. Er sah nicht mehr, wie alles in sich zusammenstürzte.
Nelson hatte die Augen geschlossen, während Tränen über seine Wangen rannen. Alles, was sein Leben ausgemacht, wofür er gearbeitet und gekämpft hatte, existierte nicht mehr. Seine Familie war ermordet, die Schafe massakriert, die Farm niedergebrannt …
Ich hätte mir vorher ausrechnen können, dass ich gegen McLeish nicht ankomme!, durchzuckte es ihn bitter. Der Rancher hatte gesiegt, aber wen konnte das schon wirklich wundern?
Und was jetzt?, fragte Nelson sich. Einfach liegen bleiben und sterben …?
Er spürte, wie Kraft und Mut ihn verließen. Er fühlte sich müde und schwach. Die Schmerzen, die seine Schussverletzungen verursachten, kamen ihm von neuem und umso stärker ins Bewusstsein.
Es war nicht mehr viel Leben in ihm, das war ihm klar.
Lethargie breitete sich in ihm aus und begann ihn zu lähmen.
Nelson dachte an den Tod.
Er spürte, dass er nahe an ihm dran war, so nahe wie vielleicht niemals zuvor.
Schwärze, Vergessen …
Das Ende aller Qualen, vielleicht eine Art Erlösung …
Aber da war noch etwas anderes in ihm, eine Pflanze, deren Same erst heute gelegt worden war: der Hass.
Der Gedanke, dass McLeish in dieser Sache das letzte Wort haben würde, wenn er jetzt starb, erschien ihm auf einmal geradezu unerträglich zu sein.
Alles in ihm lehnte sich dagegen auf, und das gab ihm neue Kraft, Kraft, die er schon verloren geglaubt hatte.
Der Tag wird kommen!, dachte er grimmig. Der Tag wird kommen, an dem abgerechnet wird!
Nelson hörte sein eigenes Keuchen, seinen eigenen schwachen Atem, der ihm zuvor wie ein Todesröcheln erschienen war.
Jetzt klang dieser Atem wie Musik, wie eine ständige Erinnerung daran, dass er noch lebte und nicht aufgeben durfte.
Seine Muskeln spannten sich, ächzend kam er hoch, bis er auf den Knien war. Dann sah er sich nach seinem Pferd um.
7
Es hatte Nelson unsägliche Mühen gekostet, in den Sattel zu kommen, und jetzt hatte er ziemliche Schwierigkeiten, sich dort auch zu halten.
Der Schmerz riss an seiner Schulter und fraß sich den ganzen rechten Arm entlang. An seiner verwundeten Seite bohrte er sich unbarmherzig in seinen Körper, so dass er glaubte, die Zähne fest aufeinander beißen zu müssen, um nicht laut loszuschreien.
Wahrscheinlich wäre jedoch kaum mehr als ein schwaches Stöhnen über seine Lippen gekommen, so entkräftet war er.
Wohin reiten?, fragte er sich.
Zunächst einmal musste er aus der Gegend verschwinden, zumindest für eine Weile.
Aber er würde wiederkommen, das stand fest! Mochte die Sache für McLeish auch erledigt sein, für Nelson war sie es noch lange nicht!
Er lenkte sein Pferd nach Nordosten, weil er wusste, dass dort irgendwann die County-Grenze kam.
Mit der Linken krallte er sich am Sattelknauf fest, während sein Pferd vorwärts trottete. Jede Erschütterung spürte er schmerzhaft, aber er musste durchhalten.
Zeitweise überfiel ihn gnädige Benommenheit, die ihn den Schmerz besser ertragen ließ.
Wenn er dann wieder ins volle Bewusstsein zurückkehrte, war es dafür umso schlimmer.
Vor seinem geistigen Auge tauchte das Gesicht von Lynn auf, mit ihrer langen roten Mähne, die er so mochte.
Sie war die Frau seines Lebens gewesen. Er hatte sie von ganzer Seele geliebt, ihr Temperament und ihren eigensinnigen Dickkopf, den sie von ihrem irischen Vater geerbt hatte, wie auch die Sanftheit und Zärtlichkeit, zu der sie genauso fähig war.
Sie war die Mutter seines Kindes gewesen; eine gute Mutter.
Dann dachte er an Alice, hörte noch einmal ihr Rufen um Hilfe, und es krampfte sich dabei alles in ihm zusammen.
McLeish!, schrie es in ihm. Verdammt, so wahr ich noch lebe! Das hast du nicht ungestraft getan!
Sein Gesicht verzog sich gequält. Dann senkte sich gnädige Dunkelheit über ihn.
8
Der Junge hatte strubbeliges dunkles Haar und eine Menge Dreck an den Fingern und im Gesicht.
Er war vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt.
„Hast du deine Arbeit schon erledigt?“, fragte seine Mutter, eine Frau von Anfang Dreißig, deren Gesichtszüge für ihr Alter um einiges zu hart waren.
Sie musste eine Menge durchgemacht haben, sonst wären diese Spuren in ihrem Gesicht kaum erklärlich gewesen.
Der Junge nickte ihr zu.
„Ja“, erklärte er im Brustton der Überzeugung. „Ich habe alles gemacht!“
Für einen kurzen Augenblick entspannten sich die Züge der Frau etwas; ihr Mund bildete fast so etwas wie ein Lächeln.
„Dann willst du jetzt sicher mit dem Pony herumreiten?“, vermutete die Frau, und der Junge lachte.
„Ja“, sagte er.
„Tu das, Tom. Aber komm nicht zu spät zurück, hörst du? Man weiß nie, was für Gesindel sich in der Gegend herumtreibt!“
Der Junge machte eine wegwerfende Geste.
„Ach, ich bin doch schon groß genug, um auf mich selbst aufzupassen, Ma!“
„Trotzdem tust du, was ich dir sage, verstanden?“
„Ja.“
Die Frau seufzte, als der Junge gegangen war.
Ihr Gesicht wurde wieder sorgenvoll und ein wenig hart.
Sie wischte sich die schweißverklebten Haare aus dem Gesicht.
Soll der Junge nur mit dem Pony herumspielen!, dachte sie. Wer weiß, wie lange wir es noch haben!
Die kleine Farm konnte sie und den Jungen kaum ernähren.
Der Boden war trocken und steinig. Letztes Jahr hatte die Dürre die Ernte vernichtet, und wenn es dieses Jahr genauso sein würde, dann müssten sie nicht nur das Pony verkaufen.
Sie würden hungern.
9
Der Junge besaß weder Zaumzeug noch Sattel für das Pony.
Er schwang sich geschickt auf den Rücken des Tieres und klammerte sich mit den Händen an der Nackenmähne fest.
Das Tier hörte auf ihn.
Es reagierte auf den Druck, den er mit seinen schmächtigen Schenkeln ausübte. Er brauchte keine Zügel.
„Heya!“, rief der Junge und trieb das Pony vorwärts.
Aber das Tier schien etwas müde zu sein.
Schließlich hatte es tagsüber den Pflug ziehen müssen, vor den eigentlich ein größeres Pferd gehörte.
Aber sie hatten nur noch das Pony. Die anderen Pferde hatten sie nach und nach verkaufen müssen.
Das Pony ließ ein störrisches Wiehern hören. Der Junge wusste nun, dass es zwecklos war, das Tier weiter antreiben zu wollen. Es würde also nur gemütlich vorangehen.
Der Junge ließ die kleine Farm hinter sich.
Das Haus wurde kleiner und kleiner, bis es hinter einigen Hügeln verschwand. Es war später Nachmittag, und in wenigen Stunden würde die Dämmerung über das Land hereinbrechen.
Der Junge überlegte, wohin er reiten sollte.
Die nächste Siedlung war einen halben Tagesritt entfernt. Es lohnte sich nicht mehr, dorthin aufzubrechen.
Er spürte, wie ihm die Sonne auf den Nacken brannte.
Es war noch immer sehr heiß, die Luft flimmerte sogar etwas.
Der Junge nahm die Hand wie einen Schirm vor die Augen und blickte in die Ferne.
Dann sah er irgendwo in der Nähe des Horizonts ein Pferd, das sich allerdings kaum von der Stelle bewegte. Es schien fast, als sei das Pferd reiterlos.
Der Junge strengte seine Augen bis auf das äußerste an, aber er konnte beim besten Willen nicht zweifelsfrei erkennen, ob es sich um einen Reiter handelte, der in tief gebeugter Haltung im Sattel hing, oder ob es ein herrenloses Packpferd war.
Einen Moment lang zögerte er, das Pony vorwärts zu treiben.
Seine Mutter hatte ihn vor Gesindel gewarnt, das sich in der Gegend herumtrieb.
Möglicherweise war dieses punktgroße Gebilde am Horizont nichts anderes als ein Strauchdieb, der nur darauf wartete, ihm das Pony abnehmen zu können, um es bei nächster Gelegenheit zu verkaufen.
Aber die Neugier war stärker.
Es kam schließlich nicht allzu häufig vor, dass in der Umgegend irgendetwas geschah, das über den alltäglichen Trott hinausging.
Als sich der Junge dem fremden Pferd weiter näherte, sah er, dass tatsächlich ein Reiter im Sattel hing!
Man hatte ihm offenbar übel mitgespielt. Er schien verwundet oder war vielleicht sogar schon tot.
Jedenfalls rührte er sich nicht und machte auch keinerlei Anstalten, die Richtung, in die sein Pferd lief, irgendwie zu beeinflussen.
Gegenwärtig kaute das Tier etwas von dem trockenen Präriegras.
Es hat Hunger!, dachte der Junge. Zweifellos war es schon geraume Zeit her, seit es seine letzte Futterration bekommen hatte.
Der Junge zügelte das Pony.
Er war in diesem Land aufgewachsen, und das hatte ihn gelehrt, dass man immer und überall wachsam sein musste, wenn man überleben wollte.
Wochenlang konnte es scheinen, als würde die Zeit still stehen, als würde gar nichts passieren … Und dann war man von einem Augenblick zum anderen in tödlicher Gefahr! Ein wildes Tier, eine Schlange, ein Strauchdieb … Früher hatte es auch Indianerüberfälle gegeben, aber das war lange her, fast so lange, wie er lebte.
Der Junge runzelte misstrauisch die Stirn.
Es war eine Masche mancher Gauner, sich verletzt an den Wegesrand zu legen, zu warten, bis jemand vorbeikam, der ihm zu helfen versuchte, und diesen dann auszurauben.
Manchmal, wenn der Junge mit seiner Mutter in die weit entfernte Stadt kam, um zum Beispiel Saatgut einzukaufen, dann besorgte die Mutter hin und wieder eine Zeitung. Da standen solche Dinge drin, er wusste also Bescheid.
Vorsichtig umrundete der Junge den Fremden.
Der Mann hatte seine Augen geschlossen, als ob er schlief. An seiner rechten Schulter hatte er eine böse Wunde, wahrscheinlich eine Schussverletzung. Wenig später sah der Junge dann die Wunde an der Seite des Fremden, die noch hässlicher aussah.
Vielleicht lebt er gar nicht mehr!, dachte der Junge. In diesem Fall würde er seiner Mutter vorschlagen, das Pferd an sich zu nehmen. Dann brauchte das Pony nicht mehr den schweren Pflug zu ziehen.
10
Die Frau war gerade dabei, Wasser aus dem Brunnen zu schöpfen, als sie ihren Sohn zurückkehren sah.
Doch er war nicht allein.
Er führte ein Pferd mit sich, in dessen Sattel ein regloser Mann hing.
„Ma, schau mal!“, rief der Junge, während die Frau die Stirn runzelte und einen zunehmend ärgerlichen Eindruck machte.
„Was soll das, Tom!“
„Er ist schwer verletzt, Ma! Ich glaube, man hat ihn angeschossen! Er ist bewusstlos und braucht Hilfe!“
„Tom, du weißt, dass wir kaum genug für uns selbst haben!“ Sie stellte den schweren Holzeimer auf den Boden und schüttelte energisch den Kopf. „Es geht nicht. Du hättest ihn dort lassen sollen, wo du ihn gefunden hast!“
„Ich glaube, dann würde er bald sterben, Ma. Aber er lebt noch; ich habe seinen Puls gefühlt!“
„Jeder muss für sich selbst sorgen, Tom, das weißt du doch! Es geht uns selbst nicht gut, wie sollen wir da noch für diesen Mann sorgen können?“
„Vielleicht stirbt er ja“, erwiderte der Junge kühl. „Und dann können wir uns sein Pferd nehmen.“
Die Frau sagte nichts.
Sie trat nun an das Pferd des Fremden heran und musterte ihn. Jemand hatte diesem Mann sehr übel mitgespielt. Wer mochte das getan haben? Banditen?
Indianer?
Vielleicht stirbt er, dachte die Frau, dann haben wir das Pferd. Aber vielleicht wird er auch wieder gesund …
Ein Mann auf der Farm wäre nicht schlecht!, kam es ihr in den Sinn.
Sie atmete tief durch. Es blieb eine Menge an Arbeit liegen. Sie konnte nicht alles schaffen. Der Junge half zwar, wo er konnte, aber er war eben noch ein Kind.
„Was ist nun?“, fragte der Junge.
„Fass mit an, Tom! Wir bringen ihn ins Haus!“
11
Langsam begann sich der Nebel aus dumpfer Bewusstlosigkeit aufzulösen, der sich über ihn gelegt hatte.
Das Erste, was Jesse Nelson wahrnahm, war das Tageslicht. Es drang durch seine Augenlider und färbte sich dabei rot. Dann, noch bevor er die Augen geöffnet hatte, kamen die Erinnerungen – und mit ihnen die Schmerzen. Er bemerkte, dass seine Wunden mit notdürftigen Verbänden versorgt waren. Nelson musterte den Raum, in dem er sich befand. Es war eine einfache, enge Wohnstube. Der Ofen schien fast unverhältnismäßig groß zu sein, so dass es fast den Eindruck machte, als habe man das Haus um ihn herum gebaut.
Nelson sah den Rücken einer Frau. Die ungepflegten, schweißverklebten Haare fielen ihr unfrisiert über den Rücken. Ihre Kleidung bestand aus vor Dreck starrenden Röcken und einer mehrfach geflickten Bluse.
Sie drehte sich und schaute zu ihm herüber. Ihr Gesicht war hart. Es war das Gesicht einer Frau, die es nicht leicht gehabt hatte.
Als sie sah, dass Nelson erwacht war, zog sie die Augenbrauen in die Höhe.
Misstrauen stand deutlich in ihren Zügen, selbst jetzt, da er fast hilflos dalag. Sie kam ein paar Schritte näher, zunächst zögernd, dann entschlossener.
Nelson hob den rechten Arm und blickte auf den Verband seiner Schulter. Aber dann verzog er das Gesicht vor Schmerz und ließ den Arm schleunigst wieder sinken. Es tat höllisch weh. Es war eine gewohnheitsmäßige Bewegung gewesen, er hatte zunächst gar nicht darüber nachgedacht.
„Wie geht es Ihnen?“, fragte die Frau. Nelson erwiderte ihren Blick, der jetzt nicht mehr ganz so hart und unnahbar war wie zu Anfang. Sein Mund verzog sich erneut etwas; es war eine Regung, die halb vom Schmerz diktiert, halb Lächeln war.
„Ich …“, hauchte er.
Nelson erschrak, als er den schwächlichen Klang seiner eigenen Stimme vernahm. Da war nicht mehr viel Kraft und Leben drin …
Er atmete tief durch und setzte ein zweites Mal an, jetzt etwas besser hörbar. „Ich bin froh, dass ich noch lebe!“, erklärte er. Er spürte die Schweißperlen auf seiner Stirn. Ihm war schwindelig und kalt.
„Sie hatten etwas Geld bei sich“, erzählte die Frau.
„Davon habe ich den Arzt bezahlt.“
„Welchen Arzt?“
„Sie erinnern sich nicht?“ Sie winkte ab. „Er hat Ihnen eine ganze Menge Laudanum gegeben, vielleicht liegt es daran.“
„Und die Kugeln?“
„Die sind raus. Was von Ihrem Geld übrig geblieben ist, liegt bei Ihren Sachen. Wir sind arm, aber ehrlich. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, dann …“
„Ich glaube Ihnen!“, schnitt er ihren Redefluss ab.
„Ihre Wunden haben sich entzündet“, erklärte sie sachlich. „Sie haben Fieber!“
„Ja …“, erwiderte Nelson schwach. „Das glaube ich auch.“
„Sie haben eine Menge fantasiert!“
Nelson nickte.
Vor seinem inneren Auge erschein das Gesicht von Dan McLeish. Er sah die hellblauen, blitzenden Augen und den zynisch verzogenen Mund und spürte, wie sich sein Puls augenblicklich beschleunigte. Er ballte die Linke zur Faust.
„McLeish …!“
„Sie haben diesen Namen einige Male im Fieberwahn erwähnt“, stellte die Frau fest.
Sie kam an sein Lager heran und legte ihm einen feuchten Lappen auf die Stirn. Dabei blieb sie keine Sekunde länger als unbedingt notwendig in seiner Nähe. Sie war vorsichtig, aber wer konnte ihr das verdenken?
„Hat es irgendetwas auf sich mit diesem Namen?“, fragte die Frau dann.
Sie lässt nicht locker!, dachte Nelson. Sie bohrt, bis sie erfahren hat, was sie wissen will!
„Ich werde McLeish töten, wenn ich ihn das nächste Mal treffe!“, brummte Nelson finster. Die Frau erschrak über den abgrundtiefen Hass, der in seiner Stimme mit einem Mal mitschwang. Er sagte das in demselben Tonfall, in dem ein Richter vielleicht ein Todesurteil aussprechen mochte.
Absolute Gewissheit lag in diesen Worten. McLeishs Schicksal schien in diesem Augenblick so gut wie besiegelt.
„Dieser McLeish …“, begann die Frau vorsichtig von neuem. „Hat er auf Sie geschossen?“
„Ja.“
„Aber warum?“
„Nicht jetzt!“, keuchte Nelson.
„Vielleicht später.“
12
Nelson fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Als er erwachte, war es tiefe Nacht und stockdunkel. Nelson wusste nicht, wie lange er geschlafen hatte, aber es mussten wohl etliche Stunden gewesen sein.
Er fühlte sich deutlich besser.
Der kalte Schweiß auf seiner Stirn war getrocknet, und obwohl die Nacht viel kühler war als der Tag, fror er nicht mehr so schrecklich.
McLeish!, dachte er.
Wieder und wieder tauchte dieser Name in seinem Bewusstsein auf.
Der Tag wird kommen!, durchfuhr es ihn heiß. Der Tag der Abrechnung!
Mit diesen Gedanken des Hasses und der Rache schlief er wieder ein, aber nicht traumlos und dumpf wie zuvor.
Wieder und wieder warf er sich auf seinem Lager hin und her. Hass vergiftete seinen Schlaf und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen.
13
Als er durch die Strahlen der Sonne erwachte, die durch die Fenster einfielen, war der Tag schon eine geraume Weile angebrochen.
Von draußen hörte er Stimmen, konnte aber nicht genau verstehen, was sie sagten.
Einen Augenblick lang verfluchte er sich dafür, wieder aufgewacht zu sein, denn nun drangen wieder die zermürbenden Schmerzen auf ihn ein, die er in den kurzen Stunden des Schlafs fast vergessen hatte.
Und doch: Seine Kräfte waren – im Vergleich zum Vortag gesehen – beträchtlich gewachsen.
Er hob vorsichtig den Kopf und stützte sich mit dem Ellbogen auf.
Zunächst blieb er eine Weile allein. Dann kam die Frau durch die knarrende Holztür herein. Sie hatte ein paar Wurzeln in der Hand und ging geradewegs auf den Ofen zu, an dem sie sich dann zu schaffen machte.
Anscheinend wollte sie aus dem, was sie mitgebracht hatte, etwas Essbares zaubern.
Nelson setzte sich nun vollends auf. Mit dem Geräusch, das er dabei verursachte, machte er die Frau auf sich aufmerksam, die bisher zu beschäftigt gewesen war, um Notiz von ihm zu nehmen.
Sie wischte sich die verklebten Haare aus dem Gesicht.
Und musterte ihn halb vorsichtig, halb misstrauisch mit ihren dunklen Augen.
„Ich sehe, es geht Ihnen bereits etwas besser!“, stellte sie fest. Nelson nickte flüchtig.
„Ja. Aber es könnte besser sein …“
„Seien Sie nicht zu ungeduldig! An Ihrer Stelle wäre ich vollauf zufrieden damit, überhaupt noch unter den Lebenden zu weilen. Auch der Doc hat Ihnen keine großen Chancen gegeben. Freuen Sie sich, dass Sie wieder ohne fremde Hilfe auf Ihren vier Buchstaben sitzen und sich dort halten können! Ist das etwa nichts?“
Nelson lächelte schwach.
„Von der Seite habe ich die Sache noch nicht betrachtet“, meinte er. Und dann setzte er noch nachdenklich hinzu: „Aber vielleicht sollte ich es mir angewöhnen, die Dinge so zu sehen … Sie mögen Recht haben!“
„Natürlich habe ich Recht!“
Ihre Züge hatten sich jetzt etwas entspannt, sie schienen irgendwie weniger hart, weniger verschlossen.
„Wo bin ich eigentlich hier?“, fragte Nelson.
Die Frau machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Am Ende der Welt“, meinte sie. Sie zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht recht, was ich Ihnen dazu sagen soll. Die nächste Stadt heißt Stockton und ist einen halben Tagesritt entfernt. Man muss sich allerdings ranhalten, sonst schafft man es nicht.“
„Stockton …“, murmelte Nelson nachdenklich und rieb sich dabei mit der Linken das Kinn. „Ich kenne Stockton dem Namen nach, war aber noch nie dort.“ Er schüttelte den Kopf. „Erstaunlich, wie weit ich noch gekommen bin …“
„Woher kommen Sie denn, Mister … äh …“
„Oh, entschuldigen Sie, Ma'am, dass ich mich bisher noch nicht vorgestellt habe! Ich heiße Nelson. Jesse Nelson.
Und ich komme aus der Gegend um New Kildare.“
Die Frau pfiff durch die Zähne wie ein Cowboy, was Nelson für den Bruchteil eines Augenblicks ein Grinsen entlockte. Aber die Macht dessen, was er erlebt hatte, war zu gewaltig, zu erdrückend, als dass dieser Anflug von Heiterkeit sich länger bei ihm halten konnte. Seine Züge veränderten sich schnell wieder, viel schneller, als sie es unter gewöhnlichen Umständen getan hätten.
„So, New Kildare, sagen Sie“, echote sie. „Das ist ńe ganze Ecke von hier entfernt, wenn ich mich recht entsinne!“
Dann schwieg sie eine ganze Weile und kümmerte sich um die Zubereitung des Essens. Nelson empfand das als angenehm, denn die Unterhaltung strengte ihn doch mehr an, als er es je für möglich gehalten hatte.
Er sah sie von hinten. Geschäftig hantierte sie am Ofen herum. Sie arbeitete sehr flink, jeder Handgriff besaß Routine.
Er sah ihre langen, dunklen und ziemlich verklebten Haare und ihre schlanke, hoch gewachsene Gestalt.
Aber dann war ihm mit einem Mal, als sähe er eine Mähne roter Haare, dazu eine Gestalt, die klein, aber kräftig war …
„Lynn …“, sagte er plötzlich laut und erschrak über seine eigene Stimme. Er presste die Lippen fest aufeinander, so als wollte er verhindern, dass noch etwas nach außen drang.
„Ich heiße Jody“, sagte die Frau, ohne sich umzublicken.
„Jody Lawton. Habe ich Ihnen das eigentlich schon gesagt, Mr. Nelson?“
14
Die Frau hatte aus den Wurzeln eine dünne Suppe gekocht, deren Geruch bald die kleine Wohnstube erfüllte.
Nachdem sie den Tisch gedeckt hatte, ging sie zur Tür und rief den Jungen, der wenig später hereinkam.
„Das ist Tom“, sagte die Frau. „Mein Sohn. Er hat Sie gefunden, Mr. Nelson.“
„Oh, dann muss ich mich wohl bei dir bedanken, Tom“, erwiderte Nelson, wobei er den Jungen freundlich anlächelte.
Der Junge lächelte zurück.
Nelson sah, dass die Frau drei Teller auf den Tisch gestellt hatte, woraus er schloss, dass sie wahrscheinlich mit dem Jungen allein auf der Farm lebte. Aber er wollte sie nicht danach fragen.
Nelson schlug die Decke zur Seite, die bislang über seinen Beinen gelegen hatte, und versuchte aufzustehen. Die Wunde an seiner Seite schmerzte dabei höllisch, während es mit der Schulter nicht so schlimm war. Er presste die Lippen angestrengt aufeinander und spürte seine Schwäche umso deutlicher, als er auf seinen wackligen Beinen stand. Mit zwei unsicheren Schritten hatte er den Tisch mit den Stühlen erreicht, wo er sich abstützen konnte. Als er sich niedersetzte, zitterten ihm ein wenig die Knie. Er atmete heftig.
Verdammt!, dachte er. Es wird wohl eine Weile dauern, bis ich wieder richtig auf die Beine komme!
Als er mit der Rechten gewohnheitsmäßig den Löffel ergreifen wollte, spürte er einen reißenden Schmerz. Er ließ den Löffel fallen und fluchte leise. Dann aß er mit der Linken.
„Der Doc hat gesagt, dass Ihr Arm wieder wird, wenn Sie ihn trainieren“, sagte die Frau. „Die Kugel in der Schulter hat Sie wohl ziemlich ungünstig getroffen.“
Nelson nickte stumm.
Es war im Moment völlig unmöglich, mit seiner Rechten einen Revolver abzudrücken. Er würde das Schießen wohl völlig neu lernen müssen. Sein Plan, mit Dan McLeish abzurechnen, würde sich verzögern, aber er dachte nicht daran, aufzugeben.
Er würde so lange üben, bis er schnell und treffsicher genug war, um dem Rancher zu begegnen. Er würde trainieren bis zum Umfallen …
Gierig schlürfte er die Suppe in sich hinein, und auf einmal wurde ihm bewusst, wie leer sein Magen war. Die Suppe schmeckte fade, aber in diesem Moment war sie für Jesse Nelson eine Köstlichkeit! Er schlang Löffel um Löffel in sich hinein. Nein, eine Mahlzeit, die unter die Rippen geht, wie die Cowboys sagten, war dies nicht. Aber es war allemal besser als nichts. Er fühlte, wie sich sein Magen füllte und neue Kraft in ihm wuchs.
„Sie werden sicher schon besser gegessen haben, Mr.
Nelson“, sagte die Frau mit einem entschuldigenden Unterton. Sie zuckte ihre schmalen Schultern. Dann setzte sie noch hinzu: „Sie werden sicher bemerkt haben, in welchen Verhältnissen wir hier leben, mein Sohn und ich!“
„Ma'am, ich weiß deshalb Ihre Hilfe umso mehr zu schätzen. Und ich will Ihnen keineswegs länger zur Last fallen, als unbedingt nötig. Morgen reite ich.“
Die Frau winkte ab.
„Das ist völlig unmöglich, Mr. Nelson. Sie können noch nicht reiten, und das wissen Sie!“
15
Am nächsten Morgen erhob Nelson sich in aller Frühe von seinem Lager. Die Sonne war zwar längst aufgegangen, aber die Morgenkühle hatte sich noch nicht unter ihren wärmenden Strahlen aufgelöst.
Den Rest des vergangenen Tages hatte er verschlafen, war dann gegen Abend noch einmal kurz aufgewacht, um die Nacht durchzuschlafen. Nelson fühlte sich jetzt ausgeruht, wenngleich immer noch etwas schwach. Aber das würde sich in nächster Zeit geben, davon war er überzeugt.
Er sah seine Sachen auf einer altertümlichen Kommode liegen: seinen Revolvergurt, seine Winchester, die Satteltaschen, seinen Hut und seine Jacke.
Nelson nahm den Revolvergurt und schnallte ihn sich um die Hüften. Er verzog das Gesicht, als sein rechter Arm wieder zu schmerzen anfing. Aber es war bei weitem nicht so schlimm wie an den vergangenen Tagen.
Vorsichtig betastete er seine Seite. Der Verband saß noch einigermaßen, aber als er sein Hemd etwas öffnete, sah er, dass er rot durchtränkt war. Das Blut war getrocknet.
Ich werde die Frau fragen, ob sie mir dabei hilft, den Verband zu wechseln!, überlegte er. Dann knöpfte er das Hemd wieder zu. Fürs erste würde es so gehen.
Neben der Wohnstube befand sich noch ein anderer Raum. Die Tür, die dorthin führte, stand offen. Nelson trat ein paar Schritte vor und blickte auf zwei Betten. In dem einen lag der Junge, das andere war leer.
Der Junge schlief noch tief und fest. Sein Gesicht strahlte Frieden aus. Nelson sah das strubbelige Haar, die ebenmäßigen Züge und die schmuddeligen Hände, die er sich natürlich nicht gewaschen hatte. Er hörte das gleichmäßige Atmen des Jungen und sah plötzlich Alice vor sich.
Sie war jünger gewesen, aber in diesem Moment schien es ihm, als habe sie beim Schlafen ähnlich ausgesehen.
Er wischte sich mit der Hand über das Gesicht, wusste aber gleichzeitig, dass er diese Bilder aus der Erinnerung nicht verscheuchen konnte. sie würden ihn immer wieder heimsuchen.
Er wandte sich ab, öffnete die Außentür und trat nach draußen. Am Brunnen sah er die Frau. Sie hatte Wasser geschöpft und schickte sich nun an, den gefüllten Holzeimer ins Haus zu bringen.
„Guten Morgen, Ma'am.“
„Guten Morgen!“
Trotz der Kühle war sie offenbar ins Schwitzen geraten und wischte sich mit dem halblangen Ärmel ihrer Bluse über die Stirn.
„Man muss früh aufstehen, hat viel Arbeit und am Ende doch kaum genug zum Leben auf so einer Farm!“, meinte sie und atmete dabei deutlich hörbar aus.
„Ich hatte auch eine Farm“, murmelte Nelson. „Man hat sie mir niedergebrannt!“
Die Frau runzelte die Stirn. „McLeish?“, fragte sie.
Nelson nickte und fuhr sich mit der Linken durch das Haar.
„Ja“, brummte er. „Meine Frau, meine Tochter …“ Er schluckte und wandte den Blick zur Seite. Seine Augen waren rot geworden, die Mundwinkel zusammengekniffen.
„Ich … ich kann verstehen, wie Sie sich fühlen“, erklärte sie. Nelson blickte sie grimmig an.
„So, können Sie das? Können Sie sich vorstellen, wie das ist, wenn man die Menschen verliert, die einem am wichtigsten sind? Was wissen Sie schon …!“ Die Worte waren kaum über seine Lippen gekommen, da bereute er sie bereits. Nein, dachte er, das hätte ich nicht sagen sollen!
„Ich weiß mehr, als Sie denken“, erwiderte die Frau ruhig und ohne Ärger in der Stimme. „Ich habe meinen Mann bei einer Schießerei verloren. Glauben sie mir, ich weiß, wie Sie sich jetzt fühlen. Ich habe das selbst durchgemacht und fast den Verstand darüber verloren!“
Sie nahm den Eimer mit Wasser, den zu heben ihr kaum Mühe zu machen schien. Sie war sehr kräftig. Bevor sie an Nelson vorbei ins Haus ging, blieb sie kurz stehen und meinte: „Da müssen Sie durch, Mr. Nelson. Und Sie werden das auch schaffen, ich habe es auch geschafft!“
16
Die Frau war im Haus verschwunden und räumte dort herum, während sich Nelson auf der Farm umsah. Ein großer Besitz war das wirklich nicht, darüber hinaus befand er sich in einem schlechten Zustand.
In einem baufälligen Stall fand er sein Pferd zusammen mit einem Pony. Auch sein Sattel war dort abgelegt.
Ich habe wirklich Glück gehabt, an diese Leute geraten zu sein!, überlegte er.
Im Stall fand er einen Holzklotz, der etwas kleiner war als eine Whisky-Flasche. Nelson hob ihn vom Boden auf und nahm ihn mit nach draußen.
Dann entfernte er sich etwas vom Haus und dem Stall und stellte den Klotz hochkant auf die Erde. Sich selbst postierte er etwas mehr als ein Dutzend Schritt weit weg.
Er bewegte die Finger seiner rechten Hand. Er musste trainieren, wollte er tatsächlich jemals in der Lage sein, mit McLeish abzurechnen.
Nelson griff zum Holster an seiner Hüfte und riss den Revolver heraus, den er dann auf den Holzklotz gerichtet hielt.
Aber er drückte nicht ab.
Wenn McLeish mir jetzt gegenübergestanden hätte, wäre ich längst tot!, dachte er. Seine Form war erbärmlich, und er wusste das.
17
Die Tage gingen einer wie der andere dahin. Nelson verbrachte lange Stunden damit, seinen rechten Arm zu trainieren.
Laut donnerten die Revolverschüsse über die Ebene, was der Frau zunächst nicht recht war. Wer konnte schon wissen, ob nicht irgendwelche Herumstreuner von den Schüssen angelockt wurden – wenn es nur aus Neugier war. Ihr erster Gedanke war, Nelson die Ballerei zu verbieten. Aber dann entschied sie sich doch anders. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, einen Mann auf der Farm zu wissen, der mit dem Revolver umzugehen wusste.
So ließ sie ihn also gewähren. Oft stand der Junge fasziniert dabei und schaute zu, bis dann gewöhnlich seine Mutter auftauchte und ihn anwies, seine Arbeiten zu Ende zu bringen.
Zwischendurch beteiligte sich Nelson an den Arbeiten, die auf der Farm anfielen. Mit jedem Tag, den er hier verbrachte, kehrte ein Teil seiner alten Kräfte zurück, und auch sein Arm machte Fortschritte.
Eines Tages beschloss er, den Stall wieder in Ordnung zu bringen, wobei ihm der Junge nach Kräften zur Hand ging.
Die Frau betrachtete Nelsons Genesungsprozess mit gemischten Gefühlen. Einerseits war sie froh, endlich nicht mehr alles allein machen zu müssen, aber auf der anderen Seite bedeutete jede Besserung seines Zustands, dass der Tag näher rückte, an dem er die Farm verlassen würde. Wenn sie ehrlich zu sich selbst war, dann musste sie feststellen, dass sie sich schon sehr an die Anwesenheit des Fremden gewöhnt hatte. Er erweckte ein Gefühl der Sicherheit in ihr.
Ihre Züge hatten einen Gutteil ihrer Verhärmung verloren, und er bewirkte wohl auch, dass sie mehr Wert auf ihre Körperpflege und ihr Äußeres zu legen begann.
Und doch wusste sie im Inneren ihres Herzens, dass es sinnlos war, ihn halten zu wollen. Es würde der Tag kommen, an dem er aufbrach, um den Mord an seiner Familie zu rächen. Keine zehn Pferde - und auch keine Frau - würden imstande sein, ihn davon abzubringen!
18
Aus den Tagen wurden Wochen. Nelson verlor etwas den Überblick darüber, wie lange er sich bereits auf der Farm von Jody Lawton befand.
Nachts peinigten ihn oft die Erinnerungen an das Grauen, das seiner Familie widerfahren war. Er warf sich dann wild auf seinem Lager hin und her oder schrie im Schlaf.
Einmal rüttelte die Frau ihn wach, und er war ihr dankbar dafür. „Ich werde es einfach nicht los!, sagte er ihr.
„Ich sehe immer wieder dieselben Bilder vor mir …“
„Irgendwann wird es aufhören“, meinte sie zuversichtlich. „Glauben Sie mir!“
„Das würde ich gerne …“
Vielleicht würde es besser werden, wenn er mit McLeish abgerechnet hatte. Vielleicht würde er dann zumindest zum Teil seinen Frieden wiederfinden.
19
In einer anderen Nacht erwachte Nelson vom Schrei eines Coyoten, der keiner war. Die beiden Pferde wieherten und scharrten unruhig. Nachdem er sich aufgesetzt hatte, war Nelsons erste Handbewegung ein schneller Griff zu seinem Revolvergurt, den er sich daraufhin hastig umschnallte.
Er stand auf, ging zum Fenster und blickte hinaus in die Dunkelheit. Es war eine sternklare Nacht, der Mond stand als helle Sichel am Himmel. Ein leichter Wind blies und bog die Sträucher in seine Richtung.
Instinktiv spürte Nelson, dass dort draußen etwas nicht in Ordnung war.
Er trat zur Tür, schob so leise wie möglich den Riegel zur Seite und öffnete sie. Er konnte trotz aller Vorsicht nicht vermeiden, dass sie dabei etwas knarrte. Seine Hand umfasste den Griff des Revolvers und zog ihn lautlos aus dem Holster.
Irgendwo dort in der Dunkelheit schien sich etwas zu bewegen.
Ein Geräusch, ein Schatten.
Nelson kniff die Augen zusammen. Vielleicht täuschte er sich und sah Gespenster.
Es wäre nicht verwunderlich gewesen, hätten ihm seine überreizten Sinne einen Streich gespielt. Doch nun sah Nelson einen Schatten am Stall umherschleichen, der eindeutig einer menschlichen Gestalt gehörte.
Ein Pfeil sirrte fast lautlos an seinem linken Ohr vorbei und bohrte sich in die Holzwand, die sich hinter ihm befand.
Nelson warf sich augenblicklich zu Boden und rollte sich ab. Sekundenbruchteile später kamen zwei weitere Pfeile aus dem Nichts geschossen. Nelson feuerte in die ungefähre Richtung, aus der dieser Angriff erfolgt war, und rollte sich dann erneut herum.
Eine barbarische Gestalt mit langer, schwarzer Mähne und nur mit einem Lendenschurz bekleidet tauchte plötzlich über ihm auf und stieß einen furchtbaren Kriegsruf aus.
Nelson sah, wie sein Gegner mit dem Tomahawk zum Schlag ausholte. Nelson schoss, der Indianer taumelte rückwärts und fiel zu Boden.
Auf einmal war die Nacht voller Leben. An mehreren Stellen zugleich bewegte sich etwas. Nelson sah, wie zwei Indianer versuchten, den Pferdestall zu öffnen. Den ersten traf er am Kopf, der zweite konnte noch einen Schuss mit seinem altertümlichen Vorderlader abgeben, bevor auch er getroffen zu Boden sank.
Nelson warf einen kurzen Blick zur Haustür, an der unterdessen die Frau mit einer Winchester in der Hand Posten bezogen hatte. Die Schießerei musste sie geweckt haben. Sie schaute angestrengt in die Dunkelheit und schoss, wenn sie etwas zu sehen glaubte.
Nelson rannte in gebeugter Haltung zum Stall hinüber, wobei ihn mehrere Gewehrschüsse knapp verfehlten. Worauf konnten es die Indianer schon abgesehen haben – außer auf die Pferde!
Sie waren das Einzige, was hier noch einen gewissen Wert besaß, und zar für weiß und rot gleichermaßen.
Als Nelson den Stall erreichte, warf er sich hinter einem Strauch in Deckung. Von dort konnte er beobachten, wie die Frau einen Indianer erschoss, der sich geschickt angeschlichen und versucht hatte, ins Innere des Hauses zu gelangen.
Wenn es nur eine kleine Bande ist, haben wir eine Chance!, überlegte Nelson.
Ansonsten sind wir geliefert!
Plötzlich spürte er in seinem Rücken das Atmen eines Menschen.
Er wollte sich blitzschnell herumdrehen und den schussbereiten Revolver abfeuern, aber dafür war es bereits zu spät. Ein muskulöser Arm hatte sich um seinen Hals gelegt und zog ihn nach hinten.
Eine fest zupackende Hand krallte sich um den Unterarm seiner Rechten, in der er den Revolver hielt, und drehte ihn so herum, dass er die Waffe mit schmerzverzerrtem Gesicht fallen ließ.
Dann stieß Nelson mit aller Kraft den linken Ellbogen nach hinten. Sein Gegner stöhnte dumpf und lockerte für den Bruchteil eines Augenblicks seinen Griff. Nelson nutzte das, um sich loszureißen, aber der Indianer hatte sich erstaunlich schnell von dem Schlag erholt. Mit einem furchtbaren Schrei auf den Lippen warf er sich gegen Nelson, bevor dieser seine Waffe wieder aufheben konnte.
Der Indianer umklammerte ihn, und sie stürzten gemeinsam zu Boden, wo sie sich hin und herwälzten.
Nelson konnte an dem nackten, eingeölten Oberkörper seines Gegners kaum Halt finden. Sie rollten ineinander verkrallt über die Erde. Mit einer raschen Handbewegung zog der Indianer ein Messer aus dem Futteral, das er am Gürtel trug. Er packte es mit der Faust, holte aus und wollte es Nelson in die Brust rammen. Im letzten Moment konnte dieser das Handgelenk seines Gegners packen und den Stoß aufhalten.
Aber die Gefahr war keineswegs gebannt. Sie wälzten sich erneut herum. Nelson umklammerte verzweifelt das Handgelenk des Indianers, der seinen Druck verstärkte.
Schließlich kam Nelson in die Unterlage. Die Kraftreserven seines Gegners waren einfach die größeren.
Nelson sah mit Entsetzen, wie das Messer immer näher auf ihn zukam. Er spürte seine Kräfte schwinden. Nicht mehr lange, und er würde ihm nicht mehr standhalten können …
Die Messerspitze berührte jetzt schon fast sein Hemd. In dem bemalten Gesicht des Indianers stand bereits der Triumph, da donnerten zwei Schüsse. Nelson spürte, wie der Druck nachließ und sich das Gesicht des Indianers veränderte. Er sackte leblos in sich zusammen. Nelson befreite sich von dem Toten und erhob sich.
Dann sah er die Frau einige Schritt entfernt. Sie hielt die Winchester in der Hand.
„Das war knapp“, meinte Nelson. Er deutete auf den toten Indianer. „Es hätte wirklich nicht viel gefehlt!“
Nelson sah sich um, ging zu dem Strauch zurück, hinter dem er Deckung gesucht hatte, und hob seinen Revolver auf.
Alles schien ruhig, die Gefahr vorüber.
„Mit scheint, wir haben es überstanden!“, meinte die Frau sachlich und ließ das Gewehr sinken. „Der letzte Indianerüberfall in dieser Gegend ist schon eine Ewigkeit her.“
„Es sind Apachen“, meinte Nelson.
„Was können sie hier gesucht haben?“
Er zuckte mit den Schultern.
„Ich weiß es nicht. Vielleicht hatten sie einfach Hunger.“ Er deutete auf den Stall. „Die beiden Pferde hätten die ganze Bande eine Weile ernähren können!“
20
Am nächsten Morgen machte sich Nelson daran, die Toten zu begraben. Das war keine angenehme Sache, aber es musste getan werden.
Später sah er sich nach Spuren um.
Die Apachen hatten offensichtlich keine Pferde bei sich gehabt. Ob welche von ihnen entkommen waren, konnte er nicht mit Bestimmtheit sagen, es erschien ihm aber nicht sehr wahrscheinlich.
„Was meinen Sie, müssen wir in nächster Zeit mit weiteren Überfällen rechnen?“, fragte ihn die Frau, die jetzt das Gewehr immer in Reichweite hatte.
„Schwer zu sagen. Aber um kein Risiko einzugehen, sollten wir auf der Hut sein!“ Nelson machte eine hilflose Handbewegung. „Sehr viel weiß ich nicht über die Indianer.
Ich hatte noch nicht allzu viel mit ihnen zu tun.“
21
Die Tage gingen dahin, ohne dass etwas Außergewöhnliches geschah. Das Leben auf der Farm war wieder so eintönig wie eh und je. Nelson ritt etwas in der Gegend umher, um nach Spuren weiterer Apachenbanden zu suchen, aber er fand keine.
In den ersten Tagen nach dem Überfall wechselten sie sich des Nachts mit der Wache ab, aber als sich keine Anzeichen dafür fanden, dass ein weiterer Überfall wahrscheinlich war, stellten sie das wieder ein.
Ein- bis zweimal unternahm Nelson jede Nacht einen kleinen Rundgang über das Farmgelände, konnte aber nie etwas Verdächtiges ausmachen.
Die anfängliche Spannung, die sie in den Tagen nach dem Überfall beherrscht hatte, wich mehr und mehr einer aufmerksamen Gelassenheit.
Tag für Tag trainierte Nelson das Schnellschießen mit dem Revolver. Längst war sein Arm wieder in akzeptabler Verfassung, und auch das Schießen klappte wieder so wie vor seiner Verletzung.
Aber das reichte ihm nicht.
Tag für Tag hörte man die Schüsse weit über die Ebene donnern. Er wirkte sehr verbissen dabei und war dann zumeist kaum ansprechbar.
Hin und wieder dachte er jetzt daran, die Farm zu verlassen und in Richtung New Kildare aufzubrechen, um die offene Rechnung mit McLeish zu begleichen. Das Feuer des Hasses brannte noch immer in ihm. Manchmal schien es, als sei es etwas abgekühlt, ja, ab und zu machte es für kurze Augenblicke sogar den Eindruck, als sei es gänzlich erloschen. Wenig später loderte es dafür umso heftiger wieder auf.
Aber er dachte auch an die Frau und den Jungen und an die Nacht, in der der Überfall stattgefunden hatte. Sie hatten ihm das Leben gerettet, konnte er sie nun in dieser Situation einfach allein auf sich gestellt zurücklassen?
Nelson beschloss, seinen Aufbruch erst einmal zu verschieben, bis ein weiterer Apachenüberfall völlig ausgeschlossen oder doch zumindest sehr unwahrscheinlich war.
Sie sprachen nie offen darüber, aber Nelson glaubte zu spüren, dass Jody Lawton seine Anwesenheit auf der Farm als günstigen Umstand empfand.
Verdammt, sie hat jahrelang mit dem Jungen hier draußen allein gelebt!, versuchte er sich einzureden. Warum machst du es dir so schwer?
22
Das Schießtraining hatte seinen Vorrat an Munition mit der Zeit bedenklich zusammenschrumpfen lassen, so dass er schließlich beschloss, nach Stockton zu reiten, um neue Patronen zu kaufen.
In aller Frühe sattelte er sein Pferd.
Die Frau stand nachdenklich an der Haustür und beobachtete, wie er in den Sattel stieg.
„Kommen Sie wieder?“, fragte sie.
Nelson musste in diesem Augenblick feststellen, dass er sich darüber selbst noch nicht so recht im Klaren war.
Nach kurzem Zögern meinte er: „Ja.“
„Das ist gut“, sagte die Frau.
Dann ritt er davon.
Die Frau sah ihm stumm nach.
In einiger Entfernung zügelte er noch einmal sein Pferd und blickte zur Farm zurück.
Man darf nicht zurückschauen!, kam es ihm in den Sinn.
Jedenfalls nicht zu lange!
Nur die Zukunft war wichtig, nur dorthin lohnte ein längerer Blick. Aber das war etwas, was ihm sein Verstand sagte, nicht sein Gefühl.
23
Stockton war eine kleine Stadt, die aber in den letzten Jahren, vor allem seit die Eisenbahn an ihr vorbeiführte, stark gewachsen war.
Nelson lenkte sein Pferd durch die staubigen namenlosen Straßen. Die Sonne stand hoch am Horizont. Es war die heißeste Zeit des Tages, und es war kaum jemand zu sehen, was nicht verwunderte. Die meisten Leute hatten sich wohl in den Schatten zurückgezogen.
Erst am späteren Nachmittag würde es in den Straßen von Stockton wieder etwas lebendiger zugehen.
Nelson hoffte allerdings, dann längst wieder auf dem Rückweg zu sein.
Vor einem Drugstore zügelte er sein Pferd und stieg aus dem Sattel.
Nachdem er sich den Staub von den Kleidern geschlagen hatte, ging er durch die offene Tür.
Das gedämpfte Licht, das hier herrschte, war nach dem halbtägigen Ritt durch die brennende Sonne eine Wohltat für seine Augen. Es dauerte allerdings ein paar Augenblicke, bis er sich daran gewöhnt hatte.
Ein dicker kleiner Mann mit grauem Bart saß auf einem Stuhl hinter dem Tresen. Er hatte die Füße hochgelegt und die Augen geschlossen, aber er schlief nicht.
„Suchen Sie etwas Bestimmtes, Mister?“, erkundigte er sich, ohne dabei auch nur mit den Augenlidern zu zucken.
„Ich möchte etwas Munition kaufen“, erklärte Jesse Nelson.
Der Dicke atmete laut hörbar aus und öffnete jetzt auch endlich die Augen. Gleich darauf kniff er sie jedoch wieder zusammen, so als wollte er Nelson ganz genau betrachten. Er musterte seinen Kunden zunächst einige Augenblicke lang wortlos und raunte dann: „Sie sind nicht von hier, was?“
Mit umständlichen, etwas ungeschickt wirkenden Bewegungen erhob er sich von seinem Stuhl, der dabei zu Boden knallte. Ohne den Blick dabei von Nelson zu wenden, hob er ihn wieder auf.
„Mit dem Zug gekommen?“, fragte er. „Auf der Durchreise?“ Aber er wartete Nelsons Antwort gar nicht erst ab, sondern fuhr fort: „Seit Stockton eine Eisenbahnstation hat, kommen viele Fremde hierher. Früher war das anders.
Früher wusste man, wer dazugehörte und wer nicht. Heute kommen Leute zu mir in den Laden, die morgen nicht mehr da sind!“ Er zuckte mit den Schultern und machte eine hilflose Geste. „So ändern sich die Zeiten. Es sind auch eine Menge Halunken nach Stockton gekommen. Zwielichtige Typen: Spieler und solche Leute … So etwas hat es hier früher nicht gegeben. Einmal ist sogar jemand gekommen, der wollte hier ein Freudenhaus errichten.“
Nelson zog die Augenbrauen in die Höhe.
„Und?“
Der Dicke grinste über das ganze Gesicht, wobei sich an seinen Augen Bündel von Falten bildeten. Es bereitete ihm sichtlich Vergnügen, diese Geschichte jemandem erzählen zu können, der sie noch nicht kannte.
„Der Sheriff hatte bereits seine Erlaubnis gegeben.
Wahrscheinlich ist er damals bestochen worden – so habe ich später jedenfalls gehört. Aber unser Reverend hatte etwas dagegen. Wir hatten ihn bis dahin immer für einen zahmen Mann gehalten, der zwar die Bibel auf Hebräisch lesen konnte, aber bei einem Gewehr nicht wusste, wo hinten und vorne ist. Doch da hatten wir uns in ihm gründlich getäuscht!
Diese Sache ging ihm so sehr über die Hutschnur, dass er seine lange Sharps-Rifle aus dem Schrank holte – wir wussten gar nicht, dass er so etwas überhaupt besaß! – und dann den armen Fremden auf ganz unchristliche Weise verjagte! Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört!“
Der Dicke fand seine Geschichte so komisch, dass er laut loslachte.
Nelson schwieg jedoch. Früher hätte er zaghaft mitgelacht, aber jetzt war das anders geworden, und so endete auch ziemlich abrupt das Lachen des Drugstorebesitzers.
Er runzelte befremdet die Stirn.
„Sie verstehen keinen Spaß, was, Mister?“





























