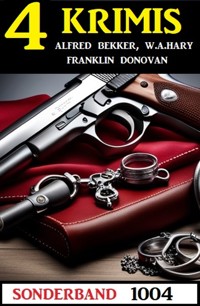Eine der Frauen begann zu weinen. Pedro Fernandez trat neben
sie, packte sie grob am Arm. Seine Worte klangen so leise und
gefährlich wie das Zischeln einer Klapperschlange.
»Halts Maul, Schlampe! Wenn ich noch einen Ton von dir höre,
lasse ich dich hier!« Die schöne junge Frau biss die Zähne zusammen
und verstummte. Sie bezwang die Angst, die Kälte, das Heimweh nach
ihrem Dorf. Sie wollte nicht hier gelassen werden, mitten in der
mexikanischen Wüste. Die Latina würde alles tun, um hinüber in die
USA zu kommen. Buchstäblich alles…
Genau wie die anderen fünfzig Frauen, die Pedro Fernandez in
dieser wolkenreichen Nacht von Mexiko nach Amerika führte. Keine
von ihnen hatte einen gültigen Pass. Aber alle hofften auf eine
bessere Zukunft im reichen Norden.
Bisher war alles glattgegangen. Motorengeräusch, das sich
rasch näherte. Die U.S. Border Patrol.
Fernandez machte ein Handzeichen. Doch die Killer, aus denen
sein ›Begleitschutz‹ bestand, waren schon alarmiert. Einer von
ihnen schulterte eine Bazooka…
Jay Avery freute sich auf seinen Geburtstag.
Der Beamte der U.S. Border Patrol fuhr in dieser Nacht südlich
von Nogales Streife. Auf einem Abschnitt von rund fünfzig Meilen
setzte die Grenzbehörde ganze acht Mann ein. Auf der anderen Seite,
im mexikanischen Bundesstaat Sonora, warteten Abertausende von
Illegalen. Jeder von ihnen war wild entschlossen, hinüber nach
Arizona zu kommen.
Avery kam sein Job oft sinnlos vor. Meist fingen er und sein
Partner David Goyer wirklich ein paar arme Teufel und schickten sie
zurück nach Mexiko. Dann versuchten es die Kerle eben in der
nächsten Nacht noch mal. Sie hatten ja nichts zu verlieren.
Im Grunde taten die illegalen Einwanderer dem Grenzer Leid.
Sie waren nur Opfer des Elends im eigenen Land. Und wurden auch
noch ausgenommen von diesen Grenzschleusern, die ›Kojoten‹ genannt
wurden.
»Da regt sich was!«
David Goyers Stimme riss Avery aus seinen Gedanken. Die Border
Patrol hatte nur wenig Personal, war aber technisch perfekt
ausgerüstet. Mannshohe Zäune, Bewegungsmelder, mit Radar
ausgerüstete Fesselballons, Überwachungsflugzeuge… Der Landrover,
in dem sie saßen, war gepanzert. Die Methoden der ›Kojoten‹ wurden
nämlich in letzter Zeit immer brutaler.
Seit einem halben Jahr schienen die Grenzübertritte in großem
Stil organisiert zu sein…
Im Wagen von Avery und Goyer befand sich ein Wärme-Sensor. Das
Gerät konnte menschliche Körper auf eine Meile hin anpeilen. Dort
vor ihnen, im Schwarz der kalten Wüstennacht, musste gerade eine
größere Gruppe die Grenze passiert haben.
»Ich gebe Alarm!«, brummte Avery und griff zum Mikrofon des
Funkgeräts. Er hoffte sehr, dass es keinen Ärger geben würde.
Gleich nach dieser Nachtschicht würde seine Frau mit einem
Geburtstagsfrühstück auf ihn warten. Wie sie es immer getan hatte
in den bisher zwanzig Jahren einer glücklichen Ehe.
Goyer riss das Lenkrad herum. Die starken Suchscheinwerfer des
Border-Patrol-Fahrzeugs glitten über die nackten Hügel des
Grenzgebiets. Das Offroad-Fahrzeug rumpelte durch ein
ausgetrocknetes Flussbett.
»Streife vier an HQ!« Avery brüllte, um das Aufröhren des
Motors zu übertönen. »Verdächtige Personen in Abschnitt C!
Nord-Nordwest von… verdammt!«
Der Beamte unterbrach sich. Vor ihm in der Dunkelheit sah er
eine Bewegung. Etwas blitzte auf, gefolgt von einem dumpfen Knall.
Und dann zerbrach die Welt um Jay Avery herum.
Die leichte Panzerung des Fahrzeugs reichte nicht aus, um
gegen das Explosivgeschoss aus der Panzerfaust abzuschirmen. Die
Killer hatten gut gezielt. Das Border-Patrol-Fahrzeug wurde frontal
erwischt.
Der Motorblock flog auseinander. Eine Stichflamme erhellte
plötzlich die Wüste Arizonas im Umkreis von einer halben
Meile.
Avery war geblendet von dem Feuer. Wie durch ein Wunder
schaffte es der schwerverletzte Border Patrol-Man, die Beifahrertür
aufzustoßen. David Goyer hing im Gurt, und aus einer klaffenden
Kopfwunde sprudelte das Blut über sein Gesicht.
Mit letzter Kraft löste Avery seinen eigenen Sicherheitsgurt.
Dass sein Partner tot war, daran bestand für ihm kein
Zweifel.
Seine eigenen Schmerzen verursachten ihm seltsame
Visionen.
Kerzen…, dachte der Verletzte beim Anblick des lichterloh
brennenden Fahrzeugs. Das sind doch nur die Kerzen auf meinem
Geburtstagskuchen…
Ein paar Yards kroch Jay Avery noch durch den kalten Sand.
Dann erwischte ihn ein Killer.
Eine Garbe aus einer kurzläufigen Uzi-Maschinenpistole
hämmerte in den Kopf und Oberkörper des Beamten.
Jay Avery erlebte seinen fünfundvierzigsten Geburtstag nicht
mehr…
***
Pedro Femandez scheuchte die einundfünfzig Frauen weiter.
Trotz des grässlichen Anblicks der toten Border-Patrol-Männer hatte
keine von ihnen mehr geschrien oder geweint. Zu groß war die Angst,
von dem ›Kojoten‹ nicht mit nach Amerika genommen zu werden.
Fernandez grinste zufrieden, was in der Dunkelheit natürlich
niemand sehen konnte. Sein mageres Gesicht mit dem dünnen
Schnurrbart war wettergegerbt und dunkel.
»Vamos!«, sagte der Verbrecher, halb zu sich selber. »Wieder
zwei vqn diesen verdammten Gringos weniger! Wer sich Esperanza in
den Weg stellt, dem bekommt das sehr schlecht!«
***
Señor Semilla hustete.
Diesmal dauerte es minutenlang, bis sein Anfall vorbei war.
Die Augen quollen dem Fünfzigjährigen aus dem Kopf, als er
verzweifelt nach Luft rang.
Seine Tochter Julia legte ihm ein nasses Tuch auf die Stirn.
Viel mehr konnte sie nicht tun. Der medico war schon da gewesen. Er
hatte nur ein Medikament dagelassen, das sowieso nicht half. Für
eine Wirksame Medizin musste Geld bezahlt werden, das die Semillas
nicht hatten.
Eduardo Semilla war schon länger krank. Er wirkte wie Mitte
Sechzig. Denn hier, in El Centro, der Altstadt von Mexico City,
alterten die Menschen schneller. Vor allem, wenn sie arm
waren.
Julia rang verzweifelte die Hände. Ihr Vater warf sich in dem
durchgelegenen Bett hin und her. Die Tür knarrte. Señora Semilla
kam von der Arbeit im supermercado in Tacubaya. Julias Mutter
schuftete dort stundenweise als Kassiererin. Das Geld reicht
trotzdem hinten und vorne nicht.
»Dios Mio!«, seufzte Señora Semilla. »Geht es Papa immer noch
nicht besser?«
Julia antwortete nicht. Die schöne junge Frau blickte
geradeaus. Aber sie sah nicht ihre frühzeitig gealterten Eltern.
Und auch nicht die saubere, aber schäbige Zwei-Zimmer-Wohnung an
einer verkehrsreichen Avenida. Julia hatte plötzlich einen
Tagtraum.
In dieser Vision lag ihr Vater entspannt auf einem
Krankenhausbett in einer teuren Privatklinik. Ein
Lungen-Sanatorium, auf den Hügeln um Acapulco. Von dort hatte er
einen herrlichen Blick auf den blauen Ozean, während er von
Schwestern und renommierten Ärzten Tag und Nacht umsorgt
wurde.
Julia stand auf wie in Trance.
»Wo willst du hin, Chica?« Ihre Mutter hatte begonnen, in der
kleinen Küche das einfache Abendessen zu bereiten.
»Ich muss noch was erledigen, Mama. Bin bald wieder da…«
Julia Semilla eilte die ausgetretenen Stufen hinunter. Die
Neunzehnjährige war in Mexico City aufgewachsen. Sie kannte nichts
anderes. Hier lebten ihre Freundinnen, hier hatte sie sich zum
ersten Mal verliebt. Aber nun wurde ihr klar, dass sie gehen
musste.
Um ihren Vater zu retten…
Plötzlich hatte die junge Frau es sehr eilig. Sie hatte
wochenlang mit sich selbst gerungen. Aber jetzt, wo sie sich
entschlossen hatte, war alles ganz einfach.
Julia Semilla lief über die Plaza de Santo Domingo, wo sich
die Medizinschule befindet. Das Mädchen hätte selber gerne Medizin
studiert. Aber woher hätten ihre Eltern das Geld dafür nehmen
sollen?
Doch jetzt hatte Julia eine bessere Idee. Jedenfalls glaubte
sie das…
Ein unentwegtes Klappern tönte über die Plaza. Das waren die
Schreibmaschinen der Schreiber. Kleine Männer, die unter den
Arkaden saßen und für die zahlreichen Analphabeten Briefe und
andere Schriftstücke tippten.
Die Schreiber und ihre Kunden schickten Julia anerkennende
Pfiffe hinterher, obwohl sie in ihrem knielangen blassgelben Kleid
nicht besonders aufreizend gekleidet war. Die junge Frau ließ sich
davon nicht beirren. Sie wusste, dass sie gut aussah.
An der Plaza Garibaldi machten sich die Mariachi-Musiker mit
ihren breiten Sombreros bereit, den Touristen heile mexikanische
Welt vorzuspielen.
Doch das interessierte Julia Semilla nicht. In einer
Nebenstraße der Plaza Garibaldi saß die Firma, zu der es Julia
hinzog.
ESPERANZA (Spanisch: HOFFNUNG)
Mit großen roten Neonbuchstaben prangte das Wort an der
Vorderfront eines zweistöckigen Gebäudes.
Jetzt oder nie, sagte sich die junge Frau.
Mit klopfendem Herzen trat die Neunzehnjährige durch die
spiegelblanke Glastür.
Die Halle machte einen vornehmen Eindruck. Marmorfußboden,
antike Möbel, ein Ölgemälde, das den mexikanischen N ationalhelden
Pancho Villa zeigte.
Eine etwa dreißigjährige Frau saß an einem verschnörkelten
Schreibtisch. Obwohl die Empfangsdame geschminkt war wie eine puta,
fühlte sich Julia sofort zu ihr hingezogen.
»Buenos Dias! Wie kann ich Ihnen helfen?«
Die Neunzehnjährige errötete. Nun wurde es ernst.
»Ich… ich suche Arbeit…«
»In Amerika, nicht wahr?« Verschwörerisch blinzelte die
Empfangsdame dem unerfahrenen Mädchen zu.
»Ja.«
»Arbeit gibt es dort mehr als genug«, lockte die stark
Geschminkte, »und wenn Sie fleißig sind, können Sie ein Vermögen
verdienen.«
Ein Vermögen! Das waren genau die Worte, die bei der
verzweifelten Julia auf fruchtbaren Boden fielen. Doch noch waren
ihre letzten Hemmungen nicht gefallen.
»Ich… ich habe aber kein Visum für Amerika. Und auch keine
Green Card. Noch nicht mal einen gültigen Pass…«
»Das macht nichts!«, lachte die Frau von ›Esperanza‹. »Um den
Papierkram kümmern wir uns…«
***
Diese Nacht war viel zu schön zum Sterben.
Das war mein Gedanke, als ich plötzlich in die Revolvermündung
von Harry Finch starrte.
Mein Freund und Dienstpartner Milo Tucker und ich hatten
diesen verdammten Raubmörder seit zwei Tagen und zwei Nächten
gejagt. Seine ersten Bluttaten hatte Finch drüben in New Jersey
begangen. Dann hatte er einen Chevy geklaut, war damit nach New
York gekommen und hatte hier wieder zugestochen mit seinem
verdammten Sägemesser.
Drei Morde, begangen in zwei Bundesstaaten, alle offenbar mit
derselben Waffe. Ein klassischer FBI-Fall.
»Ich werde meine besten Leute auf Finch ansetzen!«, hatte
unser Chef Jonathan D. McKee dem Commissioner von Jersey City
versprochen. Milo und ich hatten uns sofort auf die Jagd nach dem
Raubmörder gemacht.
»Auf Wiedersehen in der Hölle, Fed!«, ächzte der Raubmörder.
Er war plötzlich aus einem Wäldchen im nördlichen Central Park
getreten. Milo und ich hatten uns getrennt, damit uns Finch nicht
durch die Lappen gehen konnte. Und nun waren wir selbst die
Gejagten.
Es war schon seit einigen Stunden dunkel, doch trotz des
leichten Nebels vom See her bot der Vollmond genügend Licht, so
dass ich in seinem silbrigen Schein alles mit erschreckender
Deutlichkeit erkennen konnte.
Ich hatte so gut wie keine Chance.
Ich würde keine Zeit mehr haben, um zu meiner Dienstpistole
der Marke SIG Sauer P226 zu greifen. Harry Finch stand zehn
Schritte links von mir zwischen einigen jungen Bäumen.
Finch zog den Stecher durch.
Das Geschoss prallte auf meine Brust.
Zum Glück hatte der Killer nicht auf meinen Kopf gezielt. Denn
dann hätte mir meine schusssichere Kevlar-Weste nichts
genützt.
Milo und ich hatten uns an diesem Morgen damit ausgerüstet. So
als hätten wir geahnt, dass sich Finch nicht mehr mit seinem
Sägemesser begnügen würde.
Es schmerzte in meinen Lungen. Ein Gefühl, als wäre ich mit
einem Schmiedehammer getroffen worden. Obwohl mich der Aufschlag
der Patrone nicht umgeworfen hatte, ließ ich mich trotzdem fallen.
Finch sollte denken, ich sei verletzt.
Noch während ich fiel, griff ich zu meinem Ballermann.
Leider war der Verbrecher nicht von gestern.
Sein schweißnasses Gesicht verzerrt sich vor Hass. Fed hatte
er mich genannt, eine Abkürzung von Federal. Also wusste er, dass
ich für die Bundespolizei FBI arbeitete. Hatte Finch schon länger
geschnallt, dass Milo und ich ihn jagten? Spielte er Katz und Maus
mit uns?
Darüber konnte ich mir später den Kopf zerbrechen.
Jetzt galt es, die nächsten Minuten zu überleben: Und den
Killer kampfunfähig zu machen.
Ich lag auf der linken Seite, meine Knarre jetzt mit beiden
Händen haltend. Vor mir der Kiesweg, über den ich eben noch
geschlichen war. Der Killer war wieder zwischen den Bäumen in
Deckung gegangen. Und schoss auf mich.
Eine Patrone sirrte unmittelbar neben meinem Schädel vorbei
und schlug in den Kies. Die Steinchen flogen mir um die
Ohren.
Ich erwiderte das Feuer. Durch das Double-Action-Prinzip lud
sich meine Pistole nach jedem Schuss automatisch neu. Durch den
Rückstoß.
Nachdem ich zweimal geballert hatte, rollte ich mich seitlich
weg.
Finch war nicht dumm. Er würde kapieren, dass ich eine
kugelsichere Weste trug. Und deshalb nur noch auf meinen Kopf
zielen.
Meine Kugeln hatten ihn verfehlt. Kein Wunder bei meiner
miserablen Schussposition. Ich lag da wie auf dem Präsentierteller.
Auf meiner Seite des Weges gab es keine Bepflanzung.
Da mischte sich eine weitere Waffe in das Duell zwischen Harry
Finch und mir. Eine SIG Sauer.
Milo!
Mein Freund und ich hatten verabredet, den kleinen See namens
The Pool im Central Park zu umrunden. Einer vom Norden, einer vom
Süden her. Dann wollten wir uns wieder treffen.
Vom See her zogen Nebelschwaden durch den Park, erschwerten
zusätzlich noch die Sicht.
Milo musste alle Sprintrekorde gebrochen haben, um mir zu
Hilfe zu eilen.
Ich bemerkte, wie der Killer weiter zurückwich. Von meinem
Standort aus konnte ich Milo nicht sehen. Aber ich hörte, wie er
Harry Finch Saures gab.
BOOM! - BOOM! - BOOM!
Dann erklang wieder die Waffe des Mörders. Ich hatte Finch aus
den Augen verloren.
Eine halbe Minute später ertönte Milos Stimme.
»Er entkommt, Jesse!«
Ich federte hoch. Im Zickzack rannte ich auf das Wäldchen zu,
von dem aus mich der Killer unter Feuer genommen hatte. Die Bäume
standen ziemlich dicht, boten gute Deckung, und das Licht des
Mondes reichte hier auch nicht mehr, um einen guten Schuss
anzubringen.
Ich arbeitete mich vor. Kam an der Stelle vorbei, wo Finch mir
aufgelauert hatte.
Zweige knackten. Ich richtete meine Pistole nach rechts.
Gleich darauf entspannte ich mich. Ich hatte Milos braune
Lederjacke in dem Gestrüpp entdeckt.
»Wenn man nicht immer auf dich aufpasst!«, frotzelte er, wurde
aber gleich wieder ernst. »Bist du okay?«
Milo deutete auf das Loch in meiner Jacke.
»Wird bloß ’nen schönen blauen Fleck geben«, knurrte ich.
»Wohin ist Finch flitzen gegangen?«
»Nach Norden. Ich habe ihn nicht erwischt. Der Kerl ist
gerissen!«
Der Meinung war ich auch. Dieser Teil des Central Parks ist
nicht nur nachts, sondern auch tagsüber ziemlich menschenleer. Die
Parkbesucher fürchten sich vor Gangs aus Harlem und Spanish Harlem,
die New Yorks Grüne Lunge unsicher machten. Nördlich des großen
Wasser-Reservoirs ist der Central Park sehr unübersichtlich, bietet
eine Menge Verstecke.
Sicherlich war das auch Harry Finch bekannt.
Wir hetzten dem Mörder hinterher. Dabei waren wir immer darauf
gefasst, wieder in einen Hinterhalt zu geraten.
Aber die Jagd dauerte nur kurz.
Als wir das Wäldchen verließen, stand Finch auf einer sanft
ansteigenden Hügelkuppe. Er war nicht zu übersehen, trotz des
Nebels, der hier dichter war. Aber das freute uns ganz und gar
nicht.
Denn der Killer hatte eine weibliche Geisel!
Eine junge Latina, mit schulterlangem schwarzem Haar. Das Girl
trug einen Blazer, dazu einen beigen Pulli und einen Supermini, der
sehr, sehr viel von ihren langen Beinen sehen ließ.
Milo und ich erstarrten.
»Keine Bewegung, ihr Scheiß-Feds!«, keifte Finch siegessicher.
Er hatte den linken Arm um den Oberkörper der Latina geschlungen,
mit der rechten Hand presste er sein verfluchtes Sägemesser gegen
ihre Kehle. »Oder ich mach’ die Kleine gleich kalt!«
Obwohl ich Geiselnahmen zutiefst verabscheue, blieb ich
diesmal innerlich ziemlich ruhig. Und das hatte seinen Grund. Denn
der Killer hatte niemand anderen als Geisel genommen als unsere
FBI-Kollegin Annie Franceso!
Sie konnte mit der Situation besser umgehen als eine
unbeteiligte Zivilistin. Wie jeder andere von uns wusste die Latina
genau, was zu tun war.
»Schon gut!«, rief ich. »Was wollen Sie, Finch?«
»Erst mal legt ihr eure Knarren ab, Scheiß-G-Men!«, brüllte
Finch. Er fühlte sich stark. Dabei war er nur ein feiger
Mörder.
»Wird’s bald?« Finch packte Annie fester. Ich bemerkte, wie
sie vor Angst zitterte.
Milo und ich wussten, dass das nur Show war. Die beherzte
Kung-Fu-Kämpferin fürchtete sich nicht vor so einem Bastard. Dafür
kannte ich sie zu gut.
»Bitte, Mister…«, jammerte Annie. »Tun Sie mir nichts… Ich bin
doch nur ein schwaches Mädchen…«
Der Verbrecher grinste. Das gefiel ihm. Und es gefiel ihm
auch, wie Milo und ich unsere Bleispritzen langsam ins Gras legten.
Er genoss es, Macht über Menschen zu haben.
Doch was gleich darauf geschah, gefiel ihm nicht mehr.
Annie startete einen Befreiungsschlag. Hart, präzise,
blitzschnell. Finch konnte nicht ahnen, dass er ausgerechnet eine
der besten Kung-Fu-Kämpferinnen von New York City als Geisel
genommen hatte.
Annies Absatz rammte auf Finchs Fuß. Gleichzeitig drückte sie
den Oberkörper zur Seite und rammte ihren Ellenbogen in seine
Magengrube. Ihr Hals entfernte sich von der Messerklinge.
Und Finch hatte momentan andere Sorgen, als ihr
nachzusetzen.
Der Verbrecher riss den Mund auf und rang nach Atem. Annie
drehte sich auf dem Absatz herum. Sie rammte ihr Knie zwischen
seine Beine.
Finch krümmte sich.
Annies Hand formte sich zur berüchtigten Tigerfaust. Damit
bretterte sie ihm das Sägemesser weg. Und zum Abschluss schlug die
Kung-Fu-Kämpferin dem Killer eine blitzschnelle
Links-Rechts-Kombination mitten auf die Zwölf.
Finch war stehend k.o.
Er torkelte, sackte in sich zusammen.
Milo und ich schnellten vor. Aber wir mussten ihm nur noch
Handschellen anlegen. Der Killer hatte sich diesmal das falsche
Opfer ausgewählt.
Annie grinste und stemmte die Fäuste in die Hüften. »Der wird
es sich noch mal überlegen, ob er kleine Mädchen erschreckt,«
»Dazu wird er keine Gelegenheit mehr haben.« Ich griff nach
meinem Handy, um Finch abholen zu lassen. »Ich wusste gar nicht,
dass du nachts um diese Uhrzeit im Central Park spazieren gehst,
Annie.«
»Tue ich auch nicht, denn ich bin noch im Dienst.« Die Latina
wies mit ihrem Zeigefinger auf Milo und mich. »Ich bin hier, um
euch beiden Hübschen zu suchen. Mr. McKee, der auch noch in seinem
Büro hockt, hat mir verraten, dass ihr hier einen Einsatz habt,
aber ihr hattet eure Handys ausgeschaltet.«
»Wir wollten uns bei der Mörderjagd auch nicht von
irgendwelchen Anrufern stören lassen«, sagte Milo.
»Jedenfalls ist alles andere für uns abgeblasen«, fuhr Annie
fort. »Ihr beide und ich haben einen neuen Auftrag. Es geht um eine
Riesensauerei namens - Esperanza!«
Ich durchforstete mein Gedächtnis. »Sagt mir nichts.«
»Mir auch nicht, Jesse. Deshalb wollte ich euch ja zur Federal
Plaza schleppen. Damit Mr. McKee endlich die Katze aus dem Sack
lässt.«
***
Es ist ein weiter Weg von Mexico City zur amerikanischen
Grenze.
Julia Semilla reiste noch am Abend des Tages, an dem sie sich
bei ›Esperanza‹ beworben hatte. Es war leicht gewesen, den Job zu
kriegen. ›Esperanza‹ war eine Art Leiharbeiter-Firma, wenn Julia
alles richtig verstanden hatte. Ihre Freundin Anjelica hatte dort
vor einem halben Jahr angeheuert. Seitdem hatte Julia von ihr
nichts mehr gehört. Aber Anjelicas Eltern prahlten mit den
Dollar-Überweisungen, die sie aus dem reichen Nachbarland
erhielten.
Seitdem dachte Julia daran, auch für ›Esperanza‹ zu
arbeiten.
Die Handflächen der Neunzehnjährigen waren feucht vor
Aufregung, als sie auf einen der vier riesigen Busbahnhöfe von
Mexico City zusteuerte. Am Terminal Central de Autobuses del Norte
fuhren die Busse in die nördlichen Bundesstaaten Mexikos ab. Und
zur amerikanischen Grenze.
›Esperanza‹ hatte zwei riesige aluminiumglänzende Busse
gechartert. Julias Augen strahlten. Sie war noch nie in ihrem Leben
verreist. Allmählich wurde ihre Angst durch Abenteuerlust
verdrängt.
Señor und Señora Semilla waren nicht gerade begeistert gewesen
von den Plänen ihrer Tochter. Aber die Aussicht auf ein
Familieneinkommen in US-Dollar hatte schließlich den Ausschlag
gegeben. Die Semillas hatten das Geld verzweifelt nötig.
Ein dicker Lockenkopf mit einem Clipboard stand neben der
geöffneten Bustür. Er verbeugte sich vor Julia so elegant wie ein
Matador.
»Buenas Noches, Señorita! Wie lautet Ihr werter Name?«
»S-Semilla, Señor. Julia Semilla.«
»Sehr gut.« Der Lockige machte einen Haken auf seiner Liste.
»Wenn Sie bitte einsteigen wollen, Señorita Semilla. Die meisten
Ihrer Kolleginnen sind schon an Bord…«
Die Höflichkeiten des Esperanza-Mannes waren eine Wohltat für
die junge Frau. Sie freute sich jetzt richtig auf ihren neuen Job.
Schon bald würde Julia ihren Eltern echte Dollars überweisen
können.
Die Neunzehnjährige stieg in den Bus. Die Plätze waren zu drei
Vierteln besetzt, und zwar ausschließlich von Mädchen in ihrem
Alter. Die Señoritas schnatterten, kicherten, redeten aufgeregt
durcheinander. Wahrscheinlich war es für viele von ihnen ebenfalls
die erste Reise.
Julia sah sich um. Sie kannte keines der Girls. Das war
allerdings nicht verwunderlich in einer Stadt wie Mexico City, die
zwanzig Millionen Einwohner hatte. Vielleicht waren es auch
zweiunddreißig Millionen. Das wusste niemand so genau.
»Hola. Ist hier noch frei?«
Julia deutete auf den Platz neben einer Mestizin mit
Kurzhaarfrisur.
Das Mädchen machte eine einladende Handbewegung. Julia
schätzte sie auf etwa achtzehn Jahre. Die Mestizin war etwas
kleiner als Julia und mollig. Sie hatte einen ziemlich großen
Busen.
Julia versuchte, mit der anderen ins Gespräch zu kommen. Doch
die Mestizin war einsilbig. Ob aus Abneigung oder Furcht, konnte
die Neunzehnjährige nicht sagen.
Die beiden Busse fuhren ab.
Julia starrte an der Großbusigen vorbei auf die Lichter ihrer
Heimatstadt Mexico City. Sie hatte jetzt schon Heimweh. Obwohl sie
sich unwiderstehlich vom Land der reichen Gringos angezogen
fühlte.
Die Fahrzeuge waren das Beste, was ›Esperanza‹ hatte
auftreiben können. Sie verfügten über Air Condition und
Bordtoiletten. Für Julia und die meisten anderen Mädchen ein
ungewohnter Luxus.
Es dauerte lange, bis die Busse den riesigen Moloch Mexico
City verlassen hatten. Inzwischen war es spät in der Nacht. Das
eintönige Schaukeln des Wagens und die leise Salsa-Musik der
Bord-Stereoanlage schläf erten Julia ein. Es war ein anstrengender
Tag für sie gewesen. Doch noch bereute das Mädchen seinen Entschluß
nicht.
Der jungen Frau fielen die Augen zu. Sie träumte von den
USA.
Bis sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen wurde.
Jemand fummelte an ihrem Busen herum!
***
Der k.o. gegangene Harry Finch wurde von Kollegen in die
Krankenabteilung von Riker’s Island geschafft. Dort konnte er
später verhört werden. Die Beweislage war sowieso eindeutig. Für
Milo und mich war der Fall abgeschlossen.
Umso gespannter saßen wir mm Jonathan D. McKee in seinem Büro
gegenüber. Wir, das waren Milo, Annie Franceso und ich.
Dass Mr. McKee bis in die späten Nachtstunden noch im Büro
sitzt, ist keine Seltenheit. Seit seine Familie von brutalen
Gangstern ermordet wurde, widmet er sein Leben ausschließlich dem
Kampf gegen das Verbrechen.
Der SAC hatte drei Besucherstühle vor seinen wie immer penibel
aufgeräumten Schreibtisch gestellt. Es duftete köstlich nach dem
aromatischen Kaffee, den seine Sekretärin Mandy so meisterhaft zu
kochen versteht.
Aber Mr. McKee wirkte nicht, als ob ihn das heiße Getränk
erfreuen würde. Sein mageres, asketisches Gesicht wirkte
angespannt.
Der Chef beugte sich vor. In seinem korrekten grauen Anzug mit
Weste sah er so würdevoll aus wie immer.
»Ich danke Ihnen für Ihr schnelles Kommen, Jesse und Milo. Es
ist gut, dass der Finch-Fall erledigt ist. Denn ich brauche Sie
drei dringend für einen neuen Auftrag. Washington hat ausdrücklich
Sie verlangt!«
Milo hob eine Augenbraue. »Das Headquarter, Sir?«
»Genau, Milo. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist unsere Grenze
zu Mexiko ziemlich durchlässig. Illegale Einwanderer kommen in
Scharen, um auf Farmen oder in Fabriken des Südwestens zu arbeiten.
Wenn sie gestellt werden, schickt die Border Patrol diese Menschen
zurück. Kein Fall für das FBI also. Bisher.«
Ich hatte genau zugehört. Bei Mr. McKee kam es auf die
Zwischentöne an. »Was ist passiert, Sir?«
»Vor drei Tagen wurden zwei Beamte der Border Patrol förmlich
niedergemacht«, erklärte der Chef nach einem Blick auf seine
Unterlagen. »Mit Kriegswaff en, offenbar von professionellen
Killern oder Söldnern. Und das ist nicht das erste Mal. Unsere
V-Leute behaupten, ein Menschenhändler-Ring stecke hinter diesen
Taten. Eine Organisation, die sich Esperanza nennt.«
»Was für ein Zynismus!«, stiess Annie Franceso hervor.
Da konnte ich ihr nur beipflichten. Meine Spanisch-Kenntnisse
halten sich zwar in Grenzen. Aber dass Esperanza soviel wie
Hoffnung heißt, weiß auch ich.
Mr. McKee nickte.
»Esperanza ist offenbar auf junge, gutaussehende Frauen
spezialisiert. Wir vermuten, dass sie ihre Opfer US-weit verteilen.
In Privathaushalten, in Fabriken - und möglicherweise auch in
Bordellen.«
Allein dieser Verdacht rechtfertigte schon das Eingreifen des
FBI. Esperanza verstieß gegen den White Slave Traffic Act - den
zwischenstaatlichen Transport von Prostituierten. Und bei
Bandenverbrechen und organisierter Kriminalität waren wir sowieso
zuständig.
»Können wir Esperanza etwas nachweisen?«
»Leider nein, Milo. Die Organisation ist sehr gefährlich. Sie
schafft die Mädchen in großen Gruppen über die Grenze. Wenn ihnen
dabei die Border Patrol in die Quere kommt, gibt es Tote. Esperanza
ist absolut rücksichtslos. Wenn wenigstens ein Opfer gegen die
Bande aussagen würde… Eine junge Mexikanerin hat unser Field Office
in Kansas City um Hilfe gebeten.« Mr. McKee machte eine kurze
Pause. Er presste seine schmalen Lippen aufeinander. »Als unsere
Kollegen in ihrem Zimmer eintrafen, war sie schon tot. Brutal
ermordet. Und vorher vergewaltigt.«
Annie Franceso ballte in ohnmächtigem Zorn die Fäuste.
»Washington will jetzt eine Undercover-Agentin bei Esperanza
einschleusen. Assistant Director Joseph T. Burgess wünscht
ausdrücklich Sie für diesen Job, Annie. Er hat Sie noch von dem
Fall mit den Zugpiraten in guter Erinnerung. [1] Wenn Sie
allerdings nicht wollen…«
Die Latina stampfte mit dem Fuß auf.
»Selbstverständlich will ich, Sir! Diese gottverdammten
Arschl… äh… diese kriminelle Organisation muss umgehend zerschlagen
werden, Sir!«
Ein leises Lächeln stahl sich auf die schmalen Lippen des
SAC.
»Ich habe keine andere Reaktion von Ihnen erwartet,
Annie.«
»Welche Aufgabe kommt Jesse und mir zu, Sir?«, fragte
Milo.
»Sie beide werden ebenfalls undercover tätig, Milo. Und zwar
treten Sie als zwei amerikanische Zuhälter auf, die für einen
Bordellring in Baltimore neue Ladies suchen.«
»Also diesmal anders herum als in Rio«, sagte ich schmunzelnd.
Vor einiger Zeit waren Milo und ich in Rio de Janeiro als
Mädchenhändler aufgetreten, um angeblich Annies Dienstpartnerin
Jennifer Clark und weitere FBI-Agentinnen zu verscherbeln. Wir
hatten mit Einverständnis der brasilianischen Behörden
gearbeitet.
Diesmal sollten wir keine Mädchen anbieten, sondern welche
kaufen.
»Sie werden nach Nogales reisen, an die Grenze zu Mexiko«,
fuhr Mr. McKee fort. »Ich werde Sie drei zeitweise zum Field Office
Phoenix versetzen, das dort zuständig ist. Jesse und Milo, Sie
werden Kontakt mit Esperanza auf nehmen und gleichzeitig Annie den
Rücken freihalten. Wenn es sich ergibt.«
»Ich brauche keinen Babysitter, Sir!«, platzte unsere Kollegin
heraus.
Sofort biss sie sich auf die Lippen. Annie hätte sich Mr.
McKee gegenüber nie eine Respektlosigkeit erlaubt. Aber manchmal
ging ihr Temperament mit ihr durch.
»FBI-Arbeit ist Teamarbeit«, wies der SAC Annie mit mildem
Tadel zurecht. »Sie werden alle drei undercover ermitteln und auf
sich selbst gestellt sein. Jedenfalls größtenteils. Vor allem, wenn
Sie auf der mexikanischen Seite der Grenze tätig werden.«
»Das verstehe ich nicht ganz, Sir«, meinte Milo. »Wir arbeiten
doch normalerweise gut mit den Mexikanern zusammen.«
»Normalerweise ja«, bestätigte Jonathan D. McKee. »Aber hier
liegt der Fall anders. Mexiko ist ein armes Land. Die Auswanderung
in unser Staatsgebiet - ob legal oder illegal - ist wie ein Ventil.
Jeder Illegale bei uns ist ein Arbeitsloser in Mexiko weniger. Die
mexikanischen Behörden haben kein großes Interesse daran, diesen
Zustand zu ändern. Und solange Esperanza nicht auf mexikanischem
Boden Verbrechen begeht…«
Er brauchte den Satz nicht zu beenden. Uns wurde klar, dass
ein verdammt harter Job vor uns lag.
Wie hart, konnten wir allerdings noch nicht ahnen…
***
Julia Semilla kreischte erschreckt auf.
In der dämmerigen Nachtbeleuchtung des Busses erkannte sie den
dicken Lockenkopf, der sich über sie gebeugt hatte. Er schwitzte.
Seine lüsternen Blicke ruhten auf ihrem kleinen, aber festen
Busen.
»Warum so spröde?«, fragte er mit rauher Stimme. »Du bist ein
hübsches Ding, Julia. Du stellst dich lieber gut mit dem lieben
Pancho. Das bin ich -Pancho. Sonst hast du es nicht leicht bei
Esperanza…«
Julia brachte ein Lächeln zustande, doch es sah aus, als ob
sie in eine Zitrone gebissen hätte. Sie war es nicht gewöhnt, plump
betatscht zu werden. Andererseits war dieser Pancho doch vorhin so
höflich und zuvorkommend gewesen.
Vielleicht bin ich ja nur etwas spröde, sagte sie sich.
Deshalb legte sie ihre Hand auf seine Pranke und schob sie sanft,
aber trotzdem bestimmt von ihrer Brust.
»Ich habe mich nur erschrocken, Pancho. Ich… äh… ich habe
geschlafen…«
»Schon gut.«
Plötzlich war Pancho wieder freundlich. Er kniete sich neben
Julia in den Mittelgang des Busses. Das Mädchen schielte auf die
Uhr mit den Leuchtziffern, die rechts neben dem Fahrer hing. Es war
3 Uhr 44 morgens.
»Dauert noch lange bis zur Grenze«, meinte Pancho, während er
seine Hand nun auf Julias Knie legte und ihren Rock höher schob.
Die-Neunzehnjährige warf einen Blick auf die Mestizin. Aber die
schnarchte zusammengesunken in ihrem Sitz und kriegte nichts
mit.
Der Lockenkopf leckte sich beim Anblick von Julias
wohlgeformten Oberschenkeln die Lippen. Doch plötzlich besann er
sich auf seine Pflichten. Wie ein Feinschmecker, der sich das Beste
bis zum Schluss aufhebt.
»Ich wollte dir sagen; wo du zuerst arbeiten wirst, Julia,
›International Rubber‹. Das ist eine Fabrik in Phoenix, im
Gringo-Bundesstaat Arizona - falls du das wissen willst.« Er
lachte, als hätte er einen besonders guten Witz gemacht.
Julia errötete. Ihr brannte eine Frage auf der Zunge, die sie
sich noch nicht zu stellen getraut hatte. Aber nun, da sie Pancho
offensichtlich so gut gefiel…
»W-wie ist das eigentlich mit dem Geld, Pancho?«
»Ah, ja!« Der Dicke fischte einen Taschenrechner aus der
Hosentasche und tippte darauf mit seinen Wurstfingern herum. »Nun,
das wären 850 Dollar plus zweihundert weitere Bucks, außerdem
Zulage für den Grenzübertritt 500 Dollar… zusammen 1.550 Dollar -
für die erste Woche.«
Julia hätte den feisten Pancho umarmen können, so glücklich
war sie.
1.550 Dollar! Dann konnte sie ja ihren Eltern sofort Geld
schicken!
»Das ist aber ein guter Lohn für eine Woche«, sprudelte sie
hervor.
Doch plötzlich wurde Panchos grinsendes Gesicht
heimtückisch.
»Wieso Lohn? Das sind die Kosten für diese Busfahrt, für die
Grenzformalitäten und für die Weiterreise in den Staaten. 1.550
Dollar, das sind die Schulden, die du bei Esperanza hast!«
Schulden? Julias Magen krampfte sich zusammen.
Panchos Hand ging wieder auf ihrem Oberschenkel auf
Entdeckungsreise.
»Nimm’s nicht so schwer, guapa. Das arbeitest du ganz schnell
wieder ab, wenn du erst bei International Rubber bist…«
***
Pablo Carranza war unermesslich reich.
Er besaß Villen in Mexiko, in der Schweiz und im US-Staat
Kalifornien. Seine illegal zusammengerafften Millionen lagen auf
verschwiegenen Konten in einem Dutzend verschiedener Staaten.
Carranza hatte mit Drogenhandel angefangen. Doch das war ihm
zu riskant geworden. Die Kolumbianer drängten in den US-Markt und
machten mit der mexikanischen Konkurrenz kurzen Prozess.
Da hatte Carranza mit seinem Drogenkapital ›Esperanza‹
aufgebaut.
Eine Organisation, die wie ein Spinnennetz ganz Mexiko und die
halben USA umspannte. Die Komplizen des ehemaligen Rauschgiftbosses
saßen überall. Sie schleusten wöchentlich hunderte von jungen
Mexikanerinnen in die Staaten, Tausende pro Monat.
Schmuggler, Killer, Fahrer, Kundschafter, bestochene Beamte -
Carranzas Lohnliste war endlos. Jeder von ihnen verdiente gut. Aber
am meisten Dollars scheffelte natürlich der Boss selber.
Es gab in Amerika genügend Bedarf an jungen, rechtlosen
Mexikanerinnen. Vor allem, wenn man alles mit ihnen machen konnte.
Und dass sie gefügig wurden, dafür sorgten die Schergen von
›Esperanza‹ mit beispielloser Brutalität.
An diesem Tag war Pablo Carranza höchstpersönlich unterwegs,
um sein Imperium zu kontrollieren. Der schlanke, hochgewachsene
Boss saß im Fonds seiner gepanzerten Oldsmobile-Limousine. Eine
Klimaanlage sorgte für angenehme Temperaturen.
Carranza fuhr mit der linken Hand über sein graumeliertes
Haar, checkte sein Aussehen kurz in einem Taschenspiegel. Bei
Männern mit seiner Macht und seinem Geld kam es nicht auf das
Äußere an. Carranza sah trotzdem unverschämt gut aus, wie er
fand.
Kantiges Kinn, gerade Nase, schlanker, aber muskulöser Körper.
Carranzas Haar war immer noch voll und wurde von einem Top-Friseur
regelmäßig geschnitten. Der Boss hatte letzte Woche seinen
fünfzigsten Geburtstag gefeiert, sah aber zehn Jahre jünger
aus.
Die Limousine glitt über den Highway Number 15. Der
stiernackige Fahrer betätigte den Blinker. Carranzas Wagen
erreichte Nogales.
Das amerikanische Nogales im Bundesstaat Arizona. Die Stadt
auf der anderen Seite der Grenze hieß ebenfalls Nogales, lag aber
im mexikanischen Bundesstaat Sonora.
Der Boss hatte gerade seine amerikanischen ›Gebietsleiter‹
kontrolliert, wie er die Sklavenhändler zynisch nannte. Nun kehrte
Carranza ins heimatliche Mexiko zurück. Mit ›Esperanza‹ war alles
in bester Ordnung.
»Sind Sie zufrieden, Señor Carranza?«
Die Frage war von Alfredo Chavez gekommen, dem jungen Sekretär
des Bosses. Er saß dienstbeflissen neben Carranza im Fond, las
seinem Boss jeden Wunsch von den Augen ab. Und wünschte sich
insgeheim, eines Tages selbst bei ›Esperanza‹ das Zepter zu
schwingen.
Carranza nickte bedeutungsschwer. »Ja, Alfredo. Die Leute
legen sich ins Zeug, die kleinen Nutten spuren. Bleibt ihnen ja
auch nichts anderes übrig.« Er lachte dreckig. »Aber wir können
noch expandieren. Noch haben wir keine Kunden in North Dakota und
Wisconsin. Das muss sich ändern.«
Der Sekretär machte sich eine Notiz. »Fuentes kann sich darum
kümmern. Der ist doch da oben im Norden für Esperanza
unterwegs.«
Der Boss brummte uninteressiert. Mit solchem Kleinkram gab er
sich normalerweise nicht ab.
Das Oldsmobile rollte durch das amerikanische Nogales. Als
Mexikaner, die nach Mexiko zurück wollten, wurden Carranza und
seine Männer vom U.S. Customs kaum kontrolliert. Dann passierten
sie den Zaun, vorbei an dem Schild ›Entrada a Mexico‹.
Die mexikanischen Beamten beschränkten sich darauf, schneidig
zu grüßen. Señor Carranza war hier als ehrbarer Bürger und guter
Steuerzahler bekannt.
Die protzige Limousine rollte durch die Avenida Central. Links
und rechts davon standen Elendshütten.
Plötzlich stieg der Fahrer fluchend in die Eisen.
Ein muskulöser Schlägertyp torkelte auf die Fahrbahn. Die
Stoßstange des Oldsmobiles rammte den Kerl, obwohl der Stiernacken
auf der Bremse stand. Die Limousine geriet ins Schlingern.
Pablo Carranza spähte durch das getönte Seitenfenster,
ungehalten über die Störung.
Und dann sah er sie.
***
Annie Franceso fühlte sich fremd in Nogales/Mexiko.
Die FBI-Agentin war ein echtes New Yorker Stadtkind, geboren
und aufgewachsen in Spanish Harlem. Aber sie sprach Spanisch
genauso gut wie Englisch. Und als Tochter puertoricanischer Eltern
konnte sie sich leicht als Mexikanerin ausgeben. Jedenfalls
leichter als ihre blonde Freundin und Dienstpartnerin Jennifer
Clark, auf deren Begleitung sie diesmal verzichten musste.
Annies erster Tag im Undercover-Einsatz begann.
Die Latina war mit ihrer Tarnung als Bauemtrampel nicht ganz
zufrieden. Kritisch beäugte sich Annie in einer
Supermarkt-Schaufensterscheibe auf der Avenida Central.
Sie steckte in einem billigen bunten Fähnchen von Minikleid,
das ihre runden Pobacken mehr schlecht als recht bedeckte. An den
Füßen trug Annie weiße Turnschuhe, die durch den mexikanischen
Straßenstaub schon ziemlich dreckig geworden waren. Jn einer
Plastik-Umhängetasche befanden sich ein paar Habseligkeiten und
eine Handvoll Pesos.
Ihre gesamte Aufmachung hatte Annie sich hier in Mexiko
gekauft. Ihre Dienstwaffe und ihre FBI-Marke hatte ein Kollege vom
Field Office Phoenix an sich genommen. Er hatte sie auch auf
Umwegen hierher nach Nogales gefahren.
Jesse und Milo wollten mit dem Wagen direkt über die Grenze
kommen. Bisher hatte sie die beiden noch nicht entdeckt.
Unauffällig schaute sich Annie Franceso um.Es gab viel zu
sehen.
Klapprige Fords und Chevys mit mexikanischen Nummernschildern
kamen von der U.S.-Border zurück. Schwer beladen mit Fernsehern und
Stereoanlagen. Andere Latinos waren zu Fuß auf dem Weg nach Hause.
Auch sie hatten in den US-Billig-Supermärkten jenseits der Grenze
groß eingekauft.
Aber das interessierte Annie wenig. Sie hielt Ausschau nach
den ›Kojoten‹.
So wurden im Slang des Grenzlandes die Schleuser genannt, die
Illegale aus Mexiko in die Staaten brachten.
Die Kerle waren nicht zu übersehen. Der G-Man aus Phoenix
hatte ihr auf der Fahrt erklärt, wie die Sache lief.
»Die Kojoten stehen in Mexiko ganz offen auf der Straße ‘rum
und warten auf Kundschaft. Sie haben regelrechte Tarife. Für zehn
US-Dollar bringen sie dich über den Rio Grande. Irgendwo machen die
Typen ein Loch in den sogenannten Tortilla-Vorhang, in den
Grenzzaun. Da lotsen sie ihre Kunden durch. Das war’s dann. Wenn du
von einem Kojoten bis nach El Paso gebracht werden willst, kostet
es fünfzig Bucks mehr. Manche Illegale sind schon elend in der
Wüste verreckt, weil sie sich allein verlaufen haben. Es ist zum
Heulen…«
Das fand Annie auch, aber sie konnte die Verhältnisse nicht
ändern. Sie konnte nur einer brutalen Menschenhändler-Bande das
Handwerk legen. Deshalb war sie nach Nogales gekommen.
Die Latina kam mit einigen ›Kojoten‹ ins Gespräch. Schnell
merkte sie, dass sie an der falschen Adresse war. Diese Kerle
arbeiteten auf eigene Rechnung. Keiner von ihnen gehörte zu
›Esperanza‹.
»Kein Job? Ooooooh, wie schade…«, flötete Annie und klapperte
mit den Wimpern. Sie konnte sehr naiv tun, wenn sie wollte. »Ich
möchte doch sooooo gerne drüben arbeiten, in den Staaten. Aber ich
weiß nicht, wie man das macht. Ich bin doch nur ein Mädchen… Können
Sie mir nicht helfen, Señor? Sie sehen so stark und klug
aus…«
Auf die Tour kam sie bei jedem Latino-Macho gut an. Annie
wusste, wie sie die Jungs nehmen musste. Schließlich war sie
zwischen solchen Kerlen aufgewachsen.
Ein dürrer ›Kojote‹ warf sich in die Brust, als wäre er
Antonio Banderas.
»Da muss man die richtigen Leute kennen, schönes Kind. Dein
Glück, dass du den guten Enero angesprochen hast.«
Der ›Kojote‹ warf je einen triumphierenden Blick nach links
und rechts, die Avenida International hinauf und hinunter. Er stand
vor dem geschlossenen Hotel San Enrique. Seine gierigen Augen
wurden von einem Panama-Hut beschattet. Er konnte seine Blicke
nicht von Annie Francesos Ausschnitt abwenden.
Das nutzte die FBI-Agentin eiskalt aus.
Sie ergriff mit beiden Händen seine Rechte und drückte sie
gegen ihre linke Brust.
»Oooooooh, Señor Enero! Was habe ich doch für ein Glück!
Spüren Sie, wie laut mein kleines Herz schlägt vor Aufregung?
Spüren Sie es?«
Die zahnlückige Futterklappe des Ganoven blieb offen stehen.
Man musste kein Psychologe sein, um seine Gedanken erraten zu
können.
»Hehehe… Ich… äh… kenne da einen Señor. Er arbeitet für eine
Firma, die sich Esperanza nennt, Señorita.«
Nun beschleunigte sich Annies Pulsschlag wirklich. Das
Jagdfieber hatte die FBI-Agentin gepackt!
In diesem Moment fiel ein großer Schatten über Annie und
Enero.
Lautlos hatte sich ein Hüne von hinten genähert.
Er war für einen Latino ziemlich groß, fast so groß wie Jesse
Trevellian. Und er ging brutal zur Sache.
Sein rechter Arm schoss an Annie vorbei und packte den dürren
Enero.
»C-Carlito!«, stotterte der kleine ›Kojote‹ ängstlich. »Was
machst du denn hier?«
Carlito?, dachte Annie Franceso. Was ist denn das für ein
beknackter Name?
Der mit Carlito Angesprochene war einen Kopf größer als die
FBI-Agentin. Und auch der magere Ganove reichte ihm nur bis zur
Schulter.
Carlito trug sein gelocktes Haar vorne kurz und hinten lang.
Unter seiner Boxernase wuchs ein ungepflegter Schnurrbart.
Mit anderen Worten: ein Mann, den Annie noch nicht mal mit der
Kneifzange angefasst hätte.
Carlito lachte röhrend auf und warf Enero zur Seite wie ein
kaputtes Spielzeug.
»Geh mir aus der Sonne, du kleiner Furz! Und zwar, bevor
Carlito böse wird!«
Normalerweise wäre Annie dazwischen gegangen. Sie hasste es,
wenn Schwächere vermöbelt wurden. Selbst, wenn diese Schwächeren
selbst Ganoven waren.
Aber dieses eine Mal schaffte es Annie, sich zu
beherrschen.
Sie wollte hier schließlich als naives mexikanisches Landgirl
auftreten. Und nicht als hartgesottene FBI-Kampfkatze.
»A-aber was… was habe ich dir getan, Carlito?«
Der ›Kojote‹ war immer noch nicht verschwunden. Er stand nun
drei Schritte links von Annie und Carlito.
Der Muskelmann hatte offenbar keine Lust, weiter nach Worten
zu suchen. Er ließ lieber die Fäuste sprechen.
Die Rechte des Machos krachte auf Eneros Kinn. Der Kleine
jaulte auf. Carlito schob eine linke Gerade nach, die auf dem
linken Auge des ›Kojoten‹ landete. Das Veilchen war
vorprogrammiert. Dann beendete Carlito den Faustkampf mit einem
fürchterlichen Uppercut.
Enero hob durch die Wucht des Schlages förmlich ab. Er wurde
nach hinten geschleudert und blieb fünf Yards weiter stöhnend im
Staub liegen. Blut floss aus seiner Nase.
Die anderen ›Kojoten‹, die links und rechts von dem Hotel San
Enrique alles mitgekriegt hatten, taten nichts. Einige blätterten
in der Zeitung, andere zündeten sich eine Zigarette an oder
starrten plötzlich interessiert in langweilige Schaufenster von
Zigarettenläden oder Friseursalons.
Keiner wollte sich mit Carlito anlegen.
»Alles Feiglinge!« Carlito zeigte Annie mit einem Grinsen
seine gelben Zähne. »Zum Glück hast du den einzigen echten Mann in
Nogales getroffen, Chica!«
Annie hasste diesen Kotzbrocken. Aber vielleicht kam sie ja
auch über ihn an ›Esperanza‹ heran.
»Weißt du, wie ich in den USA Arbeit finde, Carlito?«
»Arbeit?«, echote der Muskelmann so widerwillig, als hätte
Annie etwas Ekelhaftes erwähnt. Und vielleicht fand Carlito
Arbeiten auch wirklich abstoßend. »Warum Arbeit? Du bist doch eine
schöne Frau, Chica! Frauen müssen nicht arbeiten.«
Er wollte Annie mit seinem muskulösen rechten Arm an sich
drücken. Die Kung-Fu-Kämpferin hätte ihm gerne das Handgelenk
gebrochen. Aber sie entwand sich ihm nur wie eine Schlange.
Zeitverschwendung, sich mit dem Arschloch abzugeben, dachte
Annie. Der weiß nichts über Esperanza. Ich muss mir ein paar von
den anderen Kerlen vorknöpfen…
Aber so leicht ließ sich Carlito nicht abwimmeln. Er packte
Annie an der Schulter.
»He, Tonta! Bist du ’ne Nonne oder was? Oder hast du Angst vor
richtigen Männern?«
Er lachte dreckig und ließ die Hand über Annies Rücken bis zu
ihrem Hintern gleiten, kniff kräftig hinein.
Jetzt wurde es der FBI-Agentin zu bunt, Tarnung hin oder her.
Außerdem musste sie den Kerl loswerden, wenn sie weiter
Informationen suchen wollte.
»Finger weg«, sagte Annie mit gefährlicher Ruhe. »Noch mal
sage ich es nicht.«
»Oh, jetzt kriege ich aber Angst!«, höhnte Carlito. »Was
willst du denn tun, Tonta? Mich schlagen?«
Annie antwortete nicht. Sie steppte einen Schritt nach vorn,
nahm die Kampfstellung ein - und gab Carlito eine Kostprobe ihrer
Kung-Fu-Künste.
Den ›Schattenlosen Kick‹.
Ein Tritt, der so schnell geführt wird, dass man ihn nicht
kommen sieht.
Der Angeber wurde zurückgeschleudert, als wäre er gegen einen
Bus gerannt. Carlitos Oberlippe war geplatzt wie eine reife
Sonora-Tomate. Ungläubig keuchte er auf. Von einer Frau geschlagen
zu werden, tat seiner Macho-Ehre doppelt weh.
Wie ein wilder Stier stürzte sich Carlito auf Annie. Seine
rechte Faust zielte auf das schöne Gesicht der FBI-Agentin.
Annie riss den Arm nach unten und auf sich zu. Carlito
wunderte sich noch, welche Kraft in ihren zarten Händen steckte.
Dann lief der Schläger direkt in ihre Faust.
»Ich mach’ dich fertig!«, keuchte der Macho.
Diesmal versuchte er es seinerseits mit einem Tritt. In Annies
Magengrube. Doch die Latina steppte zur Seite, packte Carlitos Fuß
mit beiden Händen und drehte ihn um.
Der Muskelmann jaulte auf. Verzweifelt versuchte er, sich auf
den Beinen zu halten, nachdem Annie wieder losgelassen hatte.
Sie erwartete seinen nächsten Angriff in Kampfstellung. Das
linke Bein vorgeschoben, die linke Faust geballt vor der
Brust.
Doch Carlito griff nicht mehr an.
Er hatte am Rand des Gehwegs gestanden, als er ins Stolpern
geraten war. Nun geriet er auf die Fahrbahn.
Plötzlich tauchte eine fette schwarze Oldsmobile-Limousine
auf. Carlito hörte, wie die Bremsen kreischten. Dann traf ihn der
zweite Hammerschlag dieses Morgens.
***
Milo und ich trafen in einem Cadillac in Nogales ein.
Mein Sportwagen XKR wäre mir lieber gewesen. Aber das
Hauptquartier in Washington hatte sich viel Mühe mit unserer
Tarnung gegeben. Und die beiden Männer, die wir verkörpern sollten,
gurkten nun mal seit Menschengedenken mit Cadillacs durch die
Gegend.
»Nette Gegend«, meinte Milo. »Hier könnte man glatt mal Urlaub
machen, Jesse.«
»Nenn mich Dan, Milo.«
»Okay, Dan. Und ich heiße nicht Milo, sondern Vic.«
Die beiden Typen gab es wirklich. Dan Coley und Vic Hayes.
Zwei Nachtclub-Geschäftsführer aus dem Zuhältermilieu von
Baltimore. Keine wirklich großen Nummern, aber als Interessenten
für eine Organisation wie ›Esperanza‹ durchaus glaubhaft und
akzeptabel.
Der echte Coley und der echte Hayes hatten sich schon vor
einigen Tagen in Knastvögel verwandelt. Sie warteten im State
Prison von Maryland auf ihren Prozess.
Freie Bahn also für Milo und mich, um hier im Grenzgebiet die
Lockvögel zu spielen. Wir trugen teure Anzüge und dicke Uhren und
Goldschmuck. Genau der vulgäre Stil, den Coley und Hayes so
schätzten.
»Wo würden sich die bösen Buben hier nach Mädchen umhören?«,
dachte Milo laut nach.
»In ihrem eigenen Milieu natürlich, Vic.«