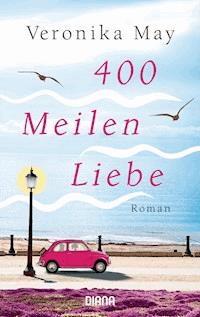
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diana Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 30-jährige Marie und der exzentrische Endfünfziger Harry haben auf den ersten Blick nichts gemein – bis auf ihren Liebeskummer. Während Marie nach Cornwall will, weil sie Angst hat, ihren Mann Steven und den Kampf um ihre Ehe zu verlieren, hofft Harry dort seine große Liebe Nora wiederfinden.
Als Marie ihn auf dem Weg zur Fähre beinahe mit dem Auto umfährt, beginnt für das ungleiche Gespann eine Reise quer durch England.
Die Erkenntnis, dass Liebe manchmal blind macht und dass Vergessen gnädiger sein kann als die Erinnerung, wird ihrer beider Leben für immer verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Marie und der exzentrische sechzigjährige Harry haben auf den ersten Blick nichts gemein – bis auf ihren Liebeskummer. Marie will nach Cornwall, weil sie Angst hat, ihren Mann Steven zu verlieren und Harry hofft, dort seine große Liebe Nora wiederzufinden. Als Marie ihn auf dem Weg zur Fähre beinahe überfährt, beginnt für das ungleiche Gespann eine Reise quer durch England. Die Erkenntnis, dass Liebe manchmal blind macht, und dass Vergessen gnädiger sein kann als die Erinnerung, wird ihrer beider Leben für immer verändern.
Von Hamburg nach Cornwall: ein wundervoller Roadtrip und das Abenteuer einer ungewöhnlichen Freundschaft
Die Autorin
Veronika May ist das Pseudonym von Heike Eva Schmidt, die als erfolgreiche Roman- und Fernsehautorin arbeitet. Sie lebt im Süden Deutschlands zwischen Seen und Bergen. Ihre Ideen sprudeln beim Entdecken der Natur oder nachts, wenn sie am Sternenhimmel nach Kassiopeia sucht. Nach Der Duft von Eisblumen ist 400 Meilen Liebe ihr zweiter Roman in Diana Verlag.
Veronika May
400
Meilen
Liebe
Roman
Von Veronika May sind im Diana Verlag erschienen:
Der Duft von Eisblumen
400 Meilen Liebe
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 07/2018
Copyright © 2018 by Diana Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Wiebke Bach
Umschlaggestaltung: t. mutzenbach design, München
Satz: Leingärtner Nabburg
Alle Rechte vorbehalten
e-ISBN 978-3-641-21639-9V001
www.diana-verlag.de
Besuchen Sie uns auch auf www.herzenszeilen.de
Prolog
Prolog
Harry, Liebster. Unser Streit tut mir leid. Ich war ein Scheusal und habe Dinge zu Dir gesagt, für die ich mich im Nachhinein schrecklich schäme. Wenn dieser Zorn mich packt, bin ich wie ein tollwütiger Hund, der blind um sich beißt und jeden verletzt, der ihm zu nahekommt.
Und Du bist mir zu nahegekommen, Harry, viel näher als je ein Mensch zuvor. Das ist zwar wunderbar, aber es macht mir auch Angst. Weil ich verletzlich geworden bin durch die Gefühle, die Du in mir auslöst. Dabei heißt es doch, Liebe macht stark und lässt einen alle Hindernisse überwinden. Aber Liebe macht auch schwach. Manchmal hätte ich am liebsten die Tür nicht aufgemacht, wenn Du davor gestanden hast. Weil ich gefürchtet habe, Du wärst gekommen, um mir zu sagen, dass alles ein Irrtum war. Dass Du Dich nicht für mich entschieden hast, sondern für Dein altes Leben.
Und deswegen schlage ich manchmal um mich, damit ich nicht zuerst getroffen werde.
Harry, mein Geliebter, ich werde von heute an jeden Nachmittag zu unserer Bank am Hafen gehen und auf Dich warten – so lange, bis Du kommst und mich in Deine Arme nimmst.
Für immer in Liebe, Nora
Der Luftzug von einer sich öffnenden Tür ließ den eng beschriebenen Papierbogen erzittern, ehe er sanft zu Boden segelte wie ein Blatt, das der beginnende Herbst nun von den Bäumen fallen ließ. Halb unter einem niedrigen, runden Tisch kam der Brief zum Liegen. Kurz darauf betrat ein Mann das Zimmer, dessen graue Haare bis auf den Kragen seines violetten Jacketts aus feinem Wollstoff reichten. Ein burgunderroter Schal und eine senfgelbe Cordhose vervollständigten sein exzentrisches Outfit.
Er sah sich in dem Appartement um. Ein Schrank in der Ecke, gegenüber ein kleiner Tisch, zwei Stühle, ein billiger Fernseher und ein braunes Sofa, auf dem sich vier oder fünf Bücher stapelten. Sein Blick fiel auf das schlichte Sideboard aus dunklem Holz, und er seufzte unwillig beim Anblick des Briefstapels, der sich darauf türmte. »Sieht nicht so ordentlich aus hier. Sollte mal jemand aufräumen«, murmelte er vor sich hin. Er öffnete das Fenster, das auf den asphaltierten Hinterhof hinausging und spähte hinaus, während er gleichzeitig die Taschen seines Jacketts abtastete, bis er die Schachtel Zigaretten gefunden hatte. Er klopfte eine davon aus der Packung, zündete sie mit einem Feuerzeug an und lehnte sich ein Stück hinaus, ehe er den ersten Zug nahm.
Es war ein ungewöhnlich warmer Tag Anfang September, aber der Baum vor dem Fenster leuchtete bereits im ersten orangegelben Schimmer des nahenden Herbstes. Harry musterte stirnrunzelnd die schlanke Birke und fragte sich, warum er jedes Jahr aufs Neue den Zeitpunkt verpasste, an dem die Bäume ihr sattes Grün verloren. Oder war das die Absicht der Natur – ein perfider Trick, zu warten, bis die Menschen schliefen, um ihnen dann über Nacht blitzschnell ein paar rötliche, herabgefallene Blätter zu präsentieren? Eine kleine bösartige Erinnerung an die eigene Vergänglichkeit?
Ein schrilles Piepsen riss ihn aus seinen Gedanken. Es war die Digitaluhr an seinem Handgelenk, die sich meldete. Harry drückte die erst halb gerauchte Zigarette auf dem Außenblech des Fensterbretts aus und warf dann einen beiläufigen Blick auf das blau leuchtende Display. Es zeigte die Worte »1 x Tab 10mg«.
Murrend schlurfte Harry in das kleine Bad, nahm das Zahnputzglas und füllte es mit kaltem Wasser. Suchend blickte er auf die Glasplatte über dem Waschbecken. Rasierzeug, Zahnpasta und Seife – aber die Schachtel lag nicht dort. »Mist«, murmelte Harry und wanderte mit dem vollen Wasserglas in der Hand zurück in den Wohnraum. Sein Blick fiel auf einen Bilderrahmen, der auf dem Sideboard stand und beinahe hinter dem Stapel Briefe verschwand. Harry nahm den Rahmen vorsichtig hoch. Das Bild darin war kein Foto, sondern ein Scherenschnitt, der das Profil einer Frau mit hochgesteckten Haaren zeigte. Nur ein paar Locken lösten sich aus dem Knoten, die der Künstler mit der Schere filigran ausgeschnitten hatte. Harry blickte auf das Frauenprofil und lächelte. »Nun guck nicht so streng«, sagte er leise und drückte das Bild kurz an sein Herz, als die Uhr erneut mahnend piepste.
»Ja doch«, knurrte Harry und stellte den Bilderrahmen widerwillig ab. Dann hob er den Stapel Post hoch, sah unter das Sofakissen und tastete über die Sitzflächen der Stühle, ehe er endlich das Gesuchte – eine weiße Schachtel mit blauer Schrift – auf dem Sofa fand. Hatte er sie gestern dorthin gelegt, nachdem er in dem Gedichtband gelesen hatte? Kurz schoss ihm durch den Kopf, dass vielleicht auch Nora die Tabletten dorthin gelegt haben könnte. Gleich darauf aber wusste er, dass es unmöglich war. Nora war gestern nicht hier gewesen und vorgestern auch nicht. Harry spürte sein Herz schwer werden, und um sich abzulenken, drückte er hastig eine der Kapseln aus dem Blister und spülte sie mit einem großen Schluck Wasser hinunter. Danach trank er das ganze Glas in einem Zug aus, als könnte er damit auch den bitteren Kloß in seinem Hals hinunterschlucken, der jedes Mal beim Gedanken an Nora seine Kehle verstopfte.
Mit raschen Schritten ging Harry zu den beiden Stühlen und hängte den Mantel an die Garderobe, der über der Lehne des einen hing. »Schon besser«, murmelte er und wollte nach dem Papierstapel auf dem Sideboard greifen, da fiel sein Blick auf den Boden und die heruntergefallene Seite mit der zierlichen Handschrift. »Harry, Liebster. Unser Streit tut mir leid …«
Er hob das Papier auf. Plötzlich kam ihm sein Verhalten kindisch vor. Wieso verkroch er sich hier, in diesem kleinen Appartement mit den unpersönlichen Möbeln und dem winzigen Bad? Er hätte längst schon auschecken und abreisen sollen – zu Nora. Sie hatte doch geschrieben, dass sie jeden Tag auf ihn warten würde. Nur sein dummer Stolz hatte ihn so lange zurückgehalten. Entschlossen öffnete Harry die Schranktür und zerrte aus der hintersten Ecke eine marineblaue Sporttasche hervor. Hastig stopfte er seine Wäsche, Pullover und Hosen hinein, holte sein Rasierzeug und die Zahnbürste aus dem Bad und legte zum Schluss den Bilderrahmen mit dem Scherenschnitt oben auf die Kleidung. Nach kurzer Überlegung nahm er die Post – es waren sowieso ausschließlich Reklameschreiben – und warf den gesamten Stapel in den Papierkorb. Nur Noras Brief faltete er wieder behutsam zusammen und verstaute ihn in der Innentasche seines Jacketts, ehe er den Raum verließ, der sowieso nichts anderes als eine Zwischenstation gewesen war.
Der Pförtner an der Rezeption war mit zwei Gästen in eine hitzige Diskussion über das offenbar nicht funktionierende Heißwasser verstrickt und bemerkte Harry nicht einmal, als der das Foyer durchquerte und durch die gläserne Drehtür nach draußen trat. Mit einem tiefen Atemzug sog Harry die milde Septemberluft ein und spürte, wie sich sein Mund von alleine zu einem breiten Lächeln verzog. Mit energischen Schritten schlug er die Richtung zum Hafen ein. Er würde Nora finden, und dann konnte sie nichts mehr trennen.
Kapitel 1
Take The »A« Train
(Duke Ellington)
»Getrennt oder zusammen?« Marie legte die Rechnung auf das runde, weiß lackierte Cafétischchen. Zwei Kännchen Earl Grey Tee, eine Portion Apfeltorte mit Sahne, ein Stück Käsekuchen und zwei Gläschen Sherry. Das Pärchen am Tisch blickte hoch, und der Mann, dessen schlohweiße Haare einen interessanten Gegensatz zu seinem gebräunten, von Falten durchzogenen Gesicht bildeten, lächelte Marie an. »Zusammen natürlich, liebes Fräulein. Für meine Herzdame ist mir nichts zu teuer.«
Seine Begleiterin, eine etwa siebzigjährige Dame in einem eleganten hellblauen Kostüm und mit Perlenkette, errötete wie ein junges Mädchen. »Du bist wirklich ein Kavalier, mein Lieber. Aber nenn die jungen Frauen nicht immer ›Fräulein‹! Das haben sie heutzutage nicht mehr so gerne.«
»Ach, ist schon in Ordnung«, sagte Marie, während sie dem Mann das Wechselgeld herausgab. Viele der Gäste nannten sie »Kindchen«, »Liebchen« oder eben »Fräulein«, und sie hatte wirklich nichts dagegen. Die meisten Cafébesucher hatten die Siebzig bereits deutlich überschritten und sahen in ihr wahrscheinlich eine Art Enkelersatz. Sie strich sich eine Strähne ihrer dunklen, lockigen Haare hinters Ohr und lächelte die zwei alten Leute an. »Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.«
Der Mann legte ein großzügiges Trinkgeld auf den Tisch, dann stand er auf und bot der Dame galant seinen Arm. »Reich mir die Hand, mein Leben«, sagte er zärtlich zu seiner Begleiterin.
»Du und dein Don Giovanni«, seufzte sie, aber ihre Augen strahlten, und der Blick, mit dem sie ihn ansah, versetzte Marie einen Stich. Sie schaute den beiden nicht nach, sondern nahm die gebrauchten Teller und Tassen und trug sie hinter den Tresen. Aber sie hatte das Geschirr zu nachlässig gestapelt, sodass eine Kaffeetasse ins Rutschen geriet und zu Boden fiel. Mit einem lauten Knall zerbarst das Porzellan, und der Kaffeerest bildete eine braune Pfütze auf den Steinfliesen. »Verflixt«, rief Marie, und eine Sekunde lang hätte sie am liebsten die zweite Tasse samt den Tellern hinterhergeworfen. Doch weil die wenigen anderen Gäste schon erschrocken guckten – bis auf Frau Petersen, die ihr Hörgerät mal wieder nicht eingeschaltet hatte – beherrschte Marie sich. Sofort kam Gitta mit Kehrbesen und Schaufel an. »Nichts passiert! Guten Appetit die Herrschaften«, rief sie in die Runde und lachte ihr unschuldiges Gitta-Lachen, das wie ein Sonnenstrahl nach einer Sturmbö wirkte. Die Cafébesucher widmeten sich beruhigt wieder ihren Kaffees und Kuchenstücken, während Marie Gitta den Handbesen abnahm. »Alles okay mit dir? Du bist seit ein paar Tagen schon so nervös«, fragte Gitta leise, und der besorgte Ton in ihrer Stimme hätte Marie beinahe den Rest gegeben. Sie bückte sich hastig, sodass ihr das Haar ins Gesicht fiel und kehrte die Scherben zusammen. »Alles bestens. Ich hab nur nicht gut geschlafen.«
Gitta nickte mit ernster Miene. »Verstehe. Es ist wegen Steven, stimmt’s?«
Marie zuckte zusammen, aber Gitta fuhr fröhlich fort. »Es macht mich bei meinem Göttergatten auch immer rasend, wenn er die ganze Nacht schnarcht. In dem Augenblick beneide ich die Frauen, die ihr Bett für sich alleine haben.«
Marie verzog das Gesicht zu einem gequälten Lächeln. Ungewollt hatte Gitta Salz in Maries Wunde gestreut. »Steven ist nicht da. Er besucht seine Familie.«
»In England?«
»Nein, in Papua-Neuguinea. Man hat ihn nämlich als Kind aus dem Dschungel entführt und nach Cornwall verschleppt.«
»Echt?«
Marie sah Gittas ehrlich verblüffte Miene und seufzte innerlich. Sie vergaß immer wieder, wie immun ihre Kollegin gegen jegliche Ironie war. Gitta glaubte an das Gute im Menschen, und Sarkasmus war ihr völlig fremd. Marie holte tief Luft. »Nein, war nur ein Witz. Ich bin heute einfach … Ich weiß auch nicht.«
Doch natürlich wusste Marie ganz genau, warum sie am liebsten mit Geschirr um sich geschmissen und aus dem Café gerannt wäre. Steven war seit fünf Tagen weg, und Marie vermisste ihn schrecklich. Sie schrieb jeden Tag ellenlange Kurznachrichten an ihn, wobei sie sogar Grüße an Stevens Schwester ausrichtete – und an seine Eltern, obwohl sie und ihr Schwiegervater nicht gerade beste Freunde waren. Das lag unter anderem daran, dass sein Sinn für Humor ebenso unausgeprägt war wie der von Gitta, wobei deren sympathisch-naive Art ihm völlig abging. Sein Tonfall, den er seiner Frau und sicher auch manchmal seinen Kindern gegenüber anschlug, erinnerte Marie leider weniger an Mister Bean als an Mussolini. Trotzdem bemühte sie sich um ein gutes Verhältnis, denn sie war mit Steven verheiratet. Und wenn die Patels ihn nicht tatsächlich als Säugling heimlich adoptiert oder in der Klinik vertauscht hatten, dann mussten seine Eltern wenigstens ein bisschen von Stevens Charme, seiner Wortgewandtheit und seiner unnachahmlichen Art, Witze zu machen, in den Genen haben, oder?
Dummerweise schien die kühle britische Art im Familienurlaub auf Steven abzufärben. Er hatte auf Maries lange Nachrichten zwar zurückgeschrieben, immerhin. Genau zwei Mal. Knappe, freundliche Nachrichten und auch das »Love, Steven« am Ende hatte nicht gefehlt. Trotzdem hatte Marie sich nicht richtig darüber freuen können und war sich vorgekommen wie ein Kätzchen in einem dieser Internetclips, über dessen Tollpatschigkeit man nur müde lächelt. Ein Hauch von Gleichgültigkeit schien ihr aus dem Handy entgegenzustrahlen, wenn Steven schrieb, dass es ihm gut ging und er die Ruhe und die Zeit mit seiner Familie genoss.
Gleich darauf hatte Marie sich selbst jedes Mal energisch ermahnt, dass sie Gespenster sah. Bestimmt war Steven einfach froh, einmal nicht schreiben zu müssen, sondern auf langen Spaziergängen oder beim Essen mit seiner Familie den Kopf freizukriegen. Sein Alltag als Journalist für ein überregionales Magazin bestand darin, die wirtschaftliche und politische Weltlage zu analysieren und in möglichst kluge Zeilen zu verpacken. Oft kam er spät abends gestresst nach Hause. Seine dunkelblonden Haare waren dann noch zerzauster als am Morgen, wenn er das Haus verlassen hatte, und er regte sich beim Essen nicht nur über korrupte Wirtschaftsbosse, sondern auch über unfähige Politiker aus der ganzen Welt auf. Steven war nicht bereit, etwas zu schreiben, wovon er nicht überzeugt war. Diese Haltung unterstrich er, indem er sich weigerte, bei wichtigen Terminen immer angemessene Kleidung zu tragen. So hatte er es tatsächlich fertiggebracht, eine Pressekonferenz, bei der mehrere Diplomaten und ein Minister anwesend waren, in Baggyhosen und Flipflops zu besuchen. Samt eines T-Shirts, auf das ein Schimpanse und der Schriftzug »Monkey Business« gedruckt war. Lachend hatte er Marie erzählt, dass er ungerührt »Pressefreiheit« gekontert hatte, als man ihn deswegen der Veranstaltung verweisen wollte. Sie wusste, dass einige den Fehler machten, Steven wegen seines Äußeren zu unterschätzen. Die Leute bereuten es spätestens dann, wenn sie einen seiner scharfzüngigen Artikel lasen. Er besaß ein unglaubliches Gedächtnis für geschichtliche Fakten, und Marie bewunderte ihren Mann sehr dafür. Sie war alles andere als dumm, aber gegen Steven erschien Marie ihre Allgemeinbildung so lückenhaft wie der morsche Zaun, der den kleinen Garten ihrer Erdgeschosswohnung am Stadtrand Hamburgs von dem ihrer Nachbarn trennte. Nicht, dass Marie Steven um seinen Job beneidete. Jeden Tag von den Nachrichten aus aller Welt – und es waren meistens nicht einmal gute – förmlich überschwemmt zu werden, stellte sie sich schon unerfreulich vor. Auch noch unter all den Informationen und Meinungen die wichtigen Fakten wie ein Goldsucher herauszusieben und diese möglichst rasch und aktuell in eine lesbare Form zu bringen, wäre ein Albtraum für Marie. Stattdessen sperrte sie an fünf Tagen die Woche die leicht verzogene Tür zum Café auf, wobei beim Öffnen das Klingeln der Glocke und das leise Quietschen des verzogenen Türrahmens eine lang vertraute Geräuschkulisse waren. Als Erstes riss Marie die Fenster auf, um den scharfen Geruch von Essig und Kernseife zu verscheuchen, den ihre Putzfee Edda allabendlich nach Ladenschluss hinterließ.
Nachdem Marie am Morgen den Laden durchgelüftet und die riesige Kaffeemaschine angeschaltet hatte, fuhr bald darauf einer der Bäckergesellen mit dem Lieferwagen vor und brachte Torten und Gebäck fürs Café. Während Marie die Köstlichkeiten in die Vitrine räumte, steckten schon die ersten Frühstücksgäste die Köpfe herein. Meist waren es Bewohner der nahe gelegenen Seniorenresidenz, die hier Zuflucht vor dem dünnen Kaffee und den faden Weißbrotscheiben des Wohnheims fanden. Marie kam sich oft wie ihre Komplizin vor, wenn die Stammkunden – drei ältere Männer Mitte siebzig – starken Espresso sowie ein herzhaftes Frühstück mit Eiern, Speck und Schwarzbrot bei ihr bestellten. »Die Panzerknacker in Rente«, nannte Marie sie bei sich und beobachtete amüsiert, wie das Trio sich über die Cholesterinbomben hermachte.
Die weibliche Kundschaft dagegen liebte die Törtchen oder Macarons und dazu ein Kännchen Tee.
Eine Dame, die mindestens neunzig sein musste, erzählte Marie immer wieder, dass sie als Kind noch mit Dienstboten und einer eigenen Köchin im Haushalt aufgewachsen war. »Sie hat die besten Zitronentörtchen gebacken, meine Liebe. Da kommt kein Konditor ran«, betonte sie und schob sich geziert einen Bissen von der Tartelette oder dem Schokoladenkuchen in den Mund.
Marie hatte all ihre Gäste ins Herz geschlossen, und es störte sie nicht, wenn Herr Harms seinen Kaffee verschüttete, weil das Zittern in seiner Hand immer schlimmer wurde und die Tabletten nicht mehr dagegen halfen. Marie kam dann mit einem feuchten Lappen und redete darüber, wie kühl es am Morgen war, »da kann man schon mal frieren, stimmt’s Herr Harms?«
Und Frau Dülwers mit ihrem Rheuma schnitt sie den Käsekuchen klein, bevor sie ihn servierte.
Ein weiterer Vorteil ihrer betagten Gästeschar war, dass sich kaum junge Leute in das Café verirrten – schon gar keine Mütter mit Kinderwagen oder Sprösslingen im Krabbelalter. Die drehten beim Anblick der ausnahmslos weiß- oder grauhaarigen Cafégäste, die sie durch das große Fenster sahen, gleich wieder ab. Marie war es recht. Nicht, dass sie keine Kinder mochte. Im Gegenteil. Sie hätte nichts dagegen gehabt, aufzupassen, dass die Kleinen keine Meuterei mit Muffins anzettelten oder den Kaffee aus vollen Tassen zu einem See zusammengossen, auf dem man prima Servietten schwimmen lassen konnte. Es tat ihr nur weh zu sehen, dass sie kein Recht dazu hatte, all das zu tun. Weil es fremde Kinder waren. Daher war sie froh, dass junge Eltern ihr Café mieden.
Nicht nur deswegen hätte sie ihren Job auch nicht gegen den in einem hippen, lauten Szenecafé tauschen mögen. Das Kratzen der Kuchengabeln, die klappernden Löffel auf den Untertassen und die leisen Gespräche waren für Marie wohltuende Hintergrundgeräusche, während sie Tee brühte, Milch für Cappuccino schäumte und geschäftig mit vollen und leeren Tassen und Tellern herumlief. Manchmal ließ sie das alte Radio laufen, allerdings ausschließlich den Klassik-Sender und so leise, dass nur sie hinter der Theke etwas hörte. Für den seltenen Fall, dass sich einmal ein Jazzstück in das Radioprogramm schlich, schaltete Marie sofort ab. Das sanfte Wischen und Klopfen der Jazzbesen auf der Trommel sowie der Klang des einsetzenden Saxophons, das nach durchwachten Nächten in einer Kneipe klang, stand für einen Abschnitt in ihrem Leben, an den sie nicht mehr denken wollte. Diese Zeit war vorbei, abgeschlossen und von Marie höchstpersönlich in eine Schublade gesperrt worden, deren Schlüssel sie tief in sich, an einem Ort des Vergessens aufbewahrte.
Ihr Handy piepte. Es war der Ton, der eine neu eingegangene Nachricht meldete, und Marie hatte schon so lange darauf gewartet. Rasch stellte sie ihr Tablett ab und fischte das Telefon aus der Tasche ihrer langen weißen Schürze, die sie über ihren Kleidern trug. Allerdings waren diese nie schwarz wie bei den meisten Bedienungen. Marie trug keine dunklen Farben, denn sie war überzeugt, dass die schlecht fürs Gemüt waren. Nein, ihre Kleidung sollte in allen Farben leuchten, das war gut für die Seele. Daher hatte sie sich heute für ein knallgrünes Wickelkleid mit einem Muster aus kleinen, weißen Blütenblättern entschieden. Dazu trug sie bequeme Turnschuhe – in Kobaltblau.
Grün ist die Hoffnung, dachte Marie und lächelte, während sie den Code eingab und ihr Smartphone entsperrte. Als sie den Absender der Nachricht sah, sanken jedoch ihre Mundwinkel. Ihr Vater hatte das Foto einer zerrupften Palme geschickt, die an einer Strandpromenade stand. Der Text war knapp. »Grüße aus Palma. Rolf und Claudia.«
»Na toll«, knurrte Marie. Das war typisch für ihren Vater. Reiste mit einer seiner häufig wechselnden Freundinnen in der Weltgeschichte herum und meldete sich – wenn überhaupt – mit Dreiwortsätzen und einem unpersönlichen Gruß bei seinem einzigen Kind. Er unterschrieb auch nie mit »Papa«, sondern immer mit seinem Vornamen. Er schien mit dem Tod von Maries Mutter vor zehn Jahren nicht nur sein bisheriges Leben als Ehemann, sondern auch seine Rolle als Vater abgelegt zu haben. »Gönn es ihm, Marie«, hatte Steven ihr schon vor längerer Zeit geraten, nachdem sie über ein Foto den Kopf geschüttelt hatte, das ihren Erzeuger im Kaftan und mit Turban beim Kamelreiten in der Wüste zeigte. »Du bist erwachsen und brauchst ihn nicht mehr. Freu dich lieber, dass er sich beschäftigt, anstatt dich dauernd vollzujammern.«
Stevens Argument war vernünftig, und Marie hatte ihm recht gegeben. Wie hätte sie ihm erklären sollen, dass man nie erwachsen genug war, um nicht wenigstens ab und zu ein Zuhause zu brauchen? Doch ihr Vater hatte die Doppelhaushälfte am Stadtrand von Hamburg, in der Marie aufgewachsen war, verkauft. Jetzt lebte er in einer Zweizimmerwohnung in einem kleinen Dorf an der Elbe, die mehr oder minder nur eine Station zwischen seinen Reisen war. Marie seufzte und schloss das Bild samt väterlichem Lebenszeichen. Trotzdem zögerte sie, das Handy wieder einzustecken. Seit zwei Tagen kein »Miss you« oder ein »Ich denke an dich« von Steven. War in dem kleinen Feriencottage seiner Eltern das WLAN ausgefallen? Oder hatte er sich bei einer Wanderung im Moor verirrt?
Dann erinnerte sie sich, dass Steven bereits einige Zeit vor seiner Abreise irgendwie abwesend gewirkt hatte. Beim Essen hatte er kaum mehr über seinen Alltag in der Redaktion gesprochen, sondern oft stumm das Essen in sich hineingeschlungen. Danach verzog er sich entweder auf die Couch, wo er sich in sein Tablet vertiefte – »Recherchen, Marie, ich habe im Moment einfach viel zu tun« – oder früh ins Bett verschwand. Wenn sie, die ein Nachtmensch war, dann später nachkam, schlief Steven schon tief und fest. Sie hatte dem keine große Bedeutung zugemessen, denn Steven war schon immer ein Arbeitstier gewesen, aber nun fragte sich Marie, ob sie etwas übersehen – oder besser gesagt überfühlt – hatte. Wann hatten sie und Steven eigentlich das letzte Mal miteinander geschlafen? Marie rechnete nach. Ihre Periode hatte gestern aufgehört, also war ihr Eisprung gute drei Wochen her. Das war auch die Antwort auf ihre Frage, dachte Marie bitter.
Noch einmal öffnete sie die App-Funktion. Zwei farbige Häkchen hinter der Nachricht, die sie Steven gestern am späten Abend geschickt hatte. Also war er online gewesen. Warum schrieb er ihr dann nicht zurück? Marie verspürte ein flaues Gefühl im Magen. Was, wenn er keine Lust hatte, ihr zu antworten? Weil er sie nicht ansatzweise vermisste? Bei dem Gedanken schlug ihr Herz schneller, es war das dumpfe Pochen einer vagen Angst. Doch was konnte sie tun? Noch eine Nachricht schreiben? Unsinn! Marie kannte ihren Mann gut genug, um zu wissen, dass Steven auf Druck allergisch reagierte. In diesem Fall verschloss sich sein schmales Gesicht, und seine blauen Pupillen sahen aus wie Glasmurmeln. Nein, dachte Marie, am Ende würde er tagelang nicht mehr ans Handy gehen oder ihr eine kurze unfreundliche Antwort schicken. Gegen ihre Zweifel – oder war es eine Vorahnung? – half nur eins …
Marie steckte den Kopf in die winzige Küche, die direkt an das Café anschloss. »Gitta, kannst du mal für zehn Minuten hier übernehmen? Ich brauche eine kurze Pause.«
»Du bist ziemlich blass. Ist dir nicht gut?«, fragte Gitta. Dann schnappte sie nach Luft, und ihr Blick ging zu Maries Bauch. »Oder bist du etwa …«
Sofort wurde Marie noch elender zumute. »Nein, das ist es nicht«, unterbrach sie Gitta hastig. »Ich muss nur meinen linken Zeh bepflastern. Neue Schuhe, du weißt schon …«, schwindelte sie und hoffte, Gitta würde nicht weiter nachbohren.
Zu ihrer Erleichterung nickte ihre Kollegin. »Du weißt ja, wo der Erste-Hilfe-Kasten ist.«
»Danke. Dauert nicht lange«, sagte Marie, ehe sie durch die Hintertür des Cafés schlüpfte. Die führte in den Flur des Jugendstilhauses, in dessen Erdgeschoss sich das Café befand. Das Treppenhaus hätte zwar einen neuen Anstrich gebraucht, doch die Buntglasfenster und die breite Holztreppe, die sich in die oberen Stockwerke schwang, erinnerten immer noch an die frühere Pracht des Gebäudes. Marie steuerte auf eine zweite, schmalere Treppe zu, die in den Keller führte. Die Luft wurde merklich kühler, je weiter sie nach unten stieg. In einer Art Vorraum befand sich die Garderobe, wo die Bedienungen ihre Taschen und Mäntel lassen konnten. Ein wackliger Tisch und zwei Stühle erweckten den Anschein, dass es sich um einen Ruheraum handelte, wobei sich keine der Mitarbeiterinnen lange hier unten aufhielt. Wer wollte schon freiwillig in einem Kellerverlies Pause machen? Marie und ihre Kolleginnen kamen höchstens hierher, um aus der Kühlung, die sich hinter dem Vorraum befand, einen neuen Milchkarton, einen Becher Sahne oder Kaffeebohnen zu holen, wenn diese im Café ausgegangen waren.
Marie setzte sich auf einen der Holzstühle und angelte nach ihrer Handtasche. Darin befanden sich all die Dinge, ohne die Marie niemals das Haus verließ: Lippenbalsam, Deospray, Pfefferminzbonbons, ein Abdeckstift und – eigentlich das Wichtigste – ihr Tarotspiel. Marie hatte lange auf dieses Kartendeck gespart, ehe sie es sich schließlich im Internet bestellt hatte. Mit einem feierlichen Gefühl hatte sie damals den kleinen Karton geöffnet, in dem das Deck verschickt worden war und hütete es seitdem wie einen Schatz. Die Bilder und Gestalten auf den einzelnen Karten waren in gedeckten Farben gezeichnet und muteten altertümlich an. Für Marie strahlten die Karten Weisheit und ein geheimes Wissen aus, und sie zog das Spiel immer zu Rate, wenn sie vor einem Problem oder einer wichtigen Entscheidung stand. Das war ziemlich häufig der Fall. Gut verborgen in einem Beutel aus dunkelrotem Samt warteten die Karten darauf, zum Einsatz zu kommen. Normalerweise legte Marie erst am Abend die Karten und nur, wenn Steven nicht da war, denn der hielt nicht viel von »diesem esoterischen Schnickschnack«, wie er Marie erklärte. Jetzt aber befand sie sich in einer Ausnahmesituation, und daher musste der klamme Garderobenraum für eine Sitzung herhalten. Marie zog das Kartendeck aus dem Beutel, legte es mit der Rückseite nach oben auf die zerkratzte Tischplatte und atmete tief durch. Mit der linken Hand hob sie dreimal von dem Kartenstapel ab. Es war wichtig, das Ritual einzuhalten, sonst würden die Karten nicht die Wahrheit preisgeben. Nachdem der Stapel auf diese Weise gemischt worden war, kam nun der Hauptteil. Mit der flachen Hand fuhr Marie einmal über das Deck, sodass es wie ein Fächer auf der Tischfläche ausgebreitet lag. Dann schloss sie die Augen und konzentrierte sich, während ihre Lippen lautlos die Frage für das Tarot formten. »Wie steht es um die Beziehung zwischen Steven und mir?«
Maries linke Hand schwebte über dem Spiel. Immer wenn sie einen Impuls verspürte, ähnlich einem leichten Stromschlag, zog sie die Karte, über der sich ihre Hand befand. Sie hatte nur ein einziges Mal versucht, Steven zu erklären, dass beim Tarotlegen die Intuition das Wichtigste war. »Das ist keine Intuition. Es ist eine Illusion des Verstehens«, hatte Steven erwidert und dabei sein »Professorengesicht« aufgesetzt, wie Marie es nannte: Die Augenbrauen hochgezogen und den Mund etwas gespitzt. So hatte er Marie in Grund und Boden argumentiert. »Die Karten zeigen dir nur Bilder. Die Bedeutung oder gar eine Vorhersage interpretierst du aber hinein. Ich wette, wenn du drei Leuten dieselbe Frage stellst, würde jeder von ihnen die Karten anders deuten. Man macht sich damit vor, die Zukunft weissagen und sein Leben kontrollieren zu können, aber das ist Nonsens.«
Marie hatte daraufhin das Thema nie wieder angeschnitten und fortan das Tarot heimlich befragt. So wie jetzt. Nachdem sie vier Karten gezogen und in die Form eines Kreuzes gelegt hatte, drehte Marie sie nacheinander um. Die Linke stand für die Situation, in der die Beziehung zu Steven sich befand. »Die Liebenden«. Im ersten Moment atmete Marie auf. Die beiden Figuren auf der Karte symbolisierten Adam und Eva im Garten Eden. Das war ein gutes Zeichen, oder? Dann fiel ihr jedoch ein, dass den beiden der herrliche Zustand nicht all zu lange vergönnt gewesen war, ehe sie hochkant aus dem Paradies geflogen waren. Zur Sicherheit faltete Marie das kleine Heftchen auf, das dem Deck beilag und die Symbolik der einzelnen Karten erklärte. Ihr Blick flog über die schwarzen Buchstaben. »In der Bedeutung der Tarotkarten stehen die Liebenden nicht unbedingt für ein Happy End«, stand da. »Vielmehr ist diese Karte ein Hinweis, sich für den richtigen Weg zu entscheiden. Je nach Situation kann die Auslegung positiv sein, dann steht die Karte für Liebe und Fürsorge. Der negative Aspekt ist Orientierungslosigkeit oder sogar Betrug.«
Marie schluckte. Was traf auf sie und Steven zu? Vielleicht gaben die anderen Karten einen Hinweis. Die zweite Karte stand für die unbewussten Wünsche des Fragenden, also Maries. Sie drehte sie um: »Acht der Kelche«. »Die Karte steht für Unklarheit aber auch Opferbereitschaft«, las Marie. »Noch weiß man nicht, wohin der Weg führt. Aber nimmt man das Opfer in Kauf, wird die Mühe sich lohnen, auch wenn man sich im Augenblick noch im Ungewissen und Dunklen befindet.« Das klang schon besser, fand Marie, denn tatsächlich hatte sie ja das Tarot befragt, weil sie sich unsicher fühlte.
Sie zögerte, die nächste Karte aufzudecken, denn diese stand für Steven. Beziehungsweise seine Einstellung zu Marie und der Beziehung. Ihre Hände zitterten leicht, und sie schloss kurz die Augen, ehe sie ihren Mut zusammennahm und nachsah, welches Symbol sie gezogen hatte. Es war die »Fünf der Münzen«. Laut Beschreibung wies diese Karte auf Isolation, Unbehagen und Zielsuche hin. Aber auch auf die Notwendigkeit, zusammenzuhalten, wie Marie aus der Beschreibung erfuhr. Das war gar nicht schlecht, dachte sie. Unter Umständen brauchte Steven sie gerade jetzt, wo er in England war. Sie hatten keine leichten Zeiten hinter sich, und genau deswegen war er ein paar Tage weggefahren. Doch tat ihm das so gut, wie er behauptete? Vielleicht war er zu viel allein mit seinen Gedanken und quälte sich? Entschlossen drehte Marie die letzte Karte um, die einen Rat geben sollte, was Marie jetzt zu tun hatte. Es war der »Bube der Stäbe«. Diese Karte kannte sie, sie wies auf einen Aufbruch und neue Herausforderungen hin. Tatsächlich stand in der Erklärung, man sollte dem Ruf seines Herzens folgen und offen für das Unbekannte sein.
Mit einem tiefen Atemzug schob Marie das Tarotspiel zusammen und verstaute den Kartenstapel wieder in dem Samtbeutel und anschließend in ihrer Handtasche.
Dabei merkte sie, dass ihre Finger von der kühlen Kellerluft eiskalt waren. Das machte nichts, denn innerlich war ihr warm. Sie wusste jetzt, was sie zu tun hatte.
Kapitel 2
Georgia On My Mind
(Ella Fitzgerald)
»Das ist nicht dein Ernst!« Gitta starrte Marie an, als hätte sie gerade verkündet, zum Mond fliegen zu wollen.
»Meine Güte, Gitta. Wir sind hier weder ein Sternerestaurant noch eine In-Disko. Du kommst locker ein paar Tage ohne mich aus. Ich brauche eben kurzfristig frei.« Marie hörte selbst, wie angespannt sie klang, und sofort tat ihr der harsche Ton leid. Gitta war eine liebe Kollegin, nur manchmal etwas schwerfällig. Trotzdem hatte sie es nicht verdient, von Marie angeschnauzt zu werden. Daher bemühte sie sich um ein Lächeln und legte Gitta die Hand auf den Arm. »Sieh mal, es ist so etwas wie ein … privater Notfall.«
Gitta riss die Augen auf. »Etwas Schlimmes?«
Ich hoffe nicht, dachte Marie. Laut aber sagte sie: »Nein, aber dringend.«
»Na ja, viel ist wirklich nicht los bei uns. Natürlich komme ich ohne dich klar«, sagte Gitta zögernd.
Marie wollte schon aufatmen, da fuhr ihre Kollegin fort: »Aber ich kann das nicht entscheiden. Da muss ich erst Bernd fragen.«
Marie rollte insgeheim die Augen. Das hatte sie befürchtet. Bernhard Koch, genannt Bernd, war ein gut aussehender, dauergebräunten Mittvierziger mit nach hinten gekämmtem Haar. Er trug immer lässige Jacketts zur Markenjeans und lief im Sommer stets barfuß in schicken Lederslippern. Er sah aus, als würde er jeden Moment bei der Crew des »Traumschiffs« anheuern, war aber in Wirklichkeit Inhaber des Cafés und Maries Chef. Da sie ahnte, was er zu ihren kurzfristigen Plänen sagen würde, versuchte Marie, Gitta zu besänftigen. »Ach was. Es reicht doch, wenn du einverstanden bist, mich alleine hier zu vertreten. Bernd sagt sowieso immer, dass wir selbstständig denken sollen und der Dienstplan unsere Sache ist, oder?«
Tatsächlich war es Bernd ziemlich egal, wann welche Bedienung im Café war. Was zählte, waren die Einnahmen am Ende des Tages. Die waren nicht einmal schlecht, auch wenn sie nicht mit irgendwelchen angesagten Locations in Hamburgs In-Vierteln zu vergleichen waren. Da Bernd dort noch vier andere Cafés und Kneipen besaß, konnte er es sich locker leisten, »karitativ zum demografischen Wandel« beizutragen, wie er es nannte. Leider übersah er dabei nonchalant, auch etwas für die Altersvorsorge seiner Mitarbeiterinnen zu tun – sein Stundenlohn war nicht großzügig. Trotzdem hätte Marie nicht woanders arbeiten wollen, und Gitta ging es ähnlich. Dank der Tatsache, dass sie beide Ehemänner hatten, die gut verdienten, konnten sie es sich leisten, mehr ideell als finanziell zu denken, und zudem waren die alten Leutchen mit Trinkgeld nicht knausrig. Außerdem machte Marie diesen Job sowieso nur übergangsweise. Aber jetzt war es Zeit für eine Gegenleistung seitens ihres Chefs, fand Marie, und daher konnte Bernd wohl kaum etwas dagegen haben, dass sie sich einmal kurzfristig freinahm. Ihr letzter gemeinsamer Urlaub mit Steven war schon fast zwei Jahre her, denn in den vergangenen Monaten hatte sein Job ihn dazu gezwungen, quasi dauerpräsent zu sein. »Die Welt dreht sich gerade zu schnell, um Urlaub zu machen, Love«, hatte Steven ihr erklärt, während er seine Reisetasche gepackt hatte. Er war von seiner Nachrichtenredaktion kurzfristig für ein paar Tage nach Berlin beordert worden, wo sich die politische Elite gerade eine Nabelschau lieferte. Marie hatte es aufgegeben, ihren Mann darum zu bitten, einen längeren Urlaub zusammen zu machen. Daher war sie von seinen Reiseplänen nach Cornwall völlig überrascht worden. »Ich brauche einfach ein bisschen Ruhe. Und mal Zeit mit meiner Familie, das verstehst du sicher«, hatte Steven gesagt. »Und so spontan kannst du ja in deinem Café gar nicht freinehmen. Außerdem sind es nur ein paar Tage.«
Doch die Tarotkarten sagten, dass offensichtlich noch mehr dahintersteckte, und erneut ergriff Marie eine Unruhe und bange Vorahnung.
»Ich rufe Bernd von unterwegs an und erkläre ihm alles, okay?«, sagte sie daher hastig, während sie bereits die Bänder ihrer Schürze aufknotete.
»Das brauchst du nicht«, sagte Gitta milde. Na also, dachte Marie aufatmend, geht doch.
Gitta deutete nach draußen. »Da kommt er nämlich. Du kannst ihn also gleich persönlich fragen.«
»Sch…«, rutschte Marie raus. Zum Glück ging der Fluch in dem Läuten des Glockenspiels über der Tür unter, das Bernd auslöste, als er dynamischen Schrittes sein Café betrat.
»Na, Mädels, alles klar bei euch?« Er lächelte und zeigte dabei eine Reihe gerader weißer Zähne. »Moin, Moin, die Herrschaften«, rief er fröhlich ins Café und winkte. »Schön, dass ich Sie alle so munter und zufrieden sehe. Ich hoffe, das liegt nicht nur am Kuchen, sondern auch an unserem Service!«
Marie beobachtete insgeheim amüsiert, wie bezaubert die älteren Damen von Bernds Zahnpastalächeln und der Traumschiffkapitän-Nummer waren. Sie kicherten und winkten zurück, ehe sie sich wieder ihren Kaffee- und Teetassen widmeten. Bernd richtete seinen Blick auf Maries offene Schürzenbänder. »Na, schon Zeit für eine Pause?«, fragte er süffisant.
»Wie du sicher weißt, stehen mir laut Paragraf vier und fünf des Arbeitszeitengesetzes dreißig Minuten zu«, gab Marie im selben Tonfall zurück. Gleich darauf fiel ihr ein, dass das vielleicht nicht das Schlaueste war, wenn sie ihn gleich um einige Tage Spontanurlaub bitten wollte. Doch da waren die Worte schon raus, und sie sah, wie Bernds Augen sich verengten. Doch er ließ sich nichts anmerken, sondern lächelte unbeeindruckt. »Immer schön, wenn die Mitarbeiter ihre Rechte und Pflichten kennen«, sagte er leichthin. Dann wandte er sich an Gitta. »Kannst du morgen kurzfristig im Elb-Bistro einspringen? Die Studentin hat sich krankgemeldet.« Auch das war typisch Bernd, fiel Marie auf. Er nannte viele Bedienungen nicht beim Namen. Für ihn waren sie »die Studentin«, »die Alleinerziehende« oder »die Köchin«. Marie wollte lieber nicht wissen, wie Bernd sie anderen gegenüber bezeichnete. »Die verkrachte Künstlerin?«
Gitta sah von Marie zu Bernd. »Aber das geht doch nicht«, platzte sie heraus. »Wer soll dann hier das Café machen, wenn Marie nicht da ist?«
Na prima, dachte Marie und verfluchte nicht zum ersten Mal Gittas Naivität. Bernd runzelte die Stirn. »Hab ich was verpasst?«
»Nein. Ich wollte gerade mit dir reden, ehe mir Gitta …« Marie bedachte ihre Kollegin mit einem gereizten Seitenblick, »… mir zuvorgekommen ist. Ich brauche kurzfristig ein paar Tage frei.«
»Frei?«, echote Bernd in einem Ton, der besagte, dass allein das Wort in seinen Ohren schon eine Frechheit war. Doch Marie durfte jetzt nicht nachgeben. Die Tarotkarten und ihr Gefühl sagten eindeutig, dass es um ihre Ehe ging – und um ihre Zukunft. Daher blickte sie Bernd fest an. »Nenn es wie du willst. Ich muss zu Steven nach England. Dringend.«
»Ist wer gestorben?«, fragte Bernd unbeeindruckt. Marie zögerte. Sollte sie ihren Chef anschwindeln? Sie könnte tatsächlich behaupten, Stevens Vater wäre tot. Oder zumindest mit einem Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert worden. Oder seine Mutter hätte einen Unfall gehabt. Oder …
»Du zögerst zu lange mit der Antwort«, stellte Bernd fest. »Also kein Todesfall oder etwas Schlimmes. Daher lautet die Antwort: nein.« Damit wandte er sich ab. Marie und ihr Anliegen waren uninteressant für ihn geworden.
Eine Welle der Verzweiflung überkam sie. Sie musste zu Steven, das fühlte sie. Sie hatte schon seit geraumer Zeit eine Vorahnung gehabt, dass seine Reise nach Cornwall nicht aus einer Laune heraus geschehen war – und die Karten hatten ihr ein deutliches Signal gegeben. Sie brauchte diesen Urlaub, das musste sie Bernd klarmachen. »Moment mal …«, fing sie an, doch ihr Boss winkte ab. »Nein heißt nein. Ich kann es mir nicht leisten, dass meine Angestellten spontan in den Urlaub verschwinden. Wo kämen wir denn da hin?«
»Es ist kein Urlaub«, presste Marie heraus. »Sondern eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Schließlich habe ich auch immer auf der Matte gestanden, wenn du mich gebraucht hast!«
»Na und?«, gab Bernd unbeeindruckt zurück. »Dafür bezahle ich dich schließlich. Und wenn es dir nicht passt, kannst du jederzeit gehen. In Hamburg-Ottensen werden ja immer Musiklehrerinnen gesucht.«
Seine Worte trafen Marie wie eine Ohrfeige. Gleichzeitig wurde ihr klar, dass ihr Chef nun endlich seine joviale Maske fallen ließ und sein wahres Gesicht zeigte. Seine Mitarbeiter waren ihm im Grunde völlig egal. Sie hatten zu funktionieren, alles andere interessierte ihn nicht, das sah sie an dem kalten Blick seiner Augen. Einige Sekunden lang konnte sie Bernd nur anstarren, während sich ein einziger Gedanke in ihrem Kopf ausbreitete: Nicht weinen! Vergeblich, schon spürte Marie einen heißen, bitteren Klumpen in ihrer Kehle aufsteigen. Sie schluckte krampfhaft und bemerkte aus dem Augenwinkel Gittas betroffene Miene. Die Gespräche im Café waren verstummt. Marie sah ihre betagten Gäste an und dachte daran, wie sehr sie diese ins Herz geschlossen hatte. Es schmerzte sie, daran zu denken, die meisten wohl nicht mehr wiederzusehen. Doch wie lange würden die alten Leutchen noch hierherkommen, ehe sie erst für ein paar Tage und dann für immer fortblieben? Frau Dülwers war schon seit fast einer Woche nicht mehr im Café gewesen, fiel Marie ein. Sie und die anderen Gäste standen ab jetzt für die Vergangenheit, während Maries Ehe mit Steven Gegenwart war – und auch Zukunft sein sollte. Dieser Gedanke war wie ein auffordernder Schubs für Marie. Manchmal musste man sich eben entscheiden. Sofort.
»Weißt du was, Bernd? Ich nehme dein großzügiges Angebot an«, sagte sie. Zwar klang ihre Stimme dünn und gepresst, aber immerhin waren die Worte nun raus. Sie zog ihre Schürze ab, zückte die Kellnerbörse und fischte fünfzig Euro heraus. »Mein Lohn für fünf Stunden Arbeit plus Trinkgeld«, erklärte sie.
Bernd glotzte sie mit offenem Mund an, offenbar hatte es ihm ausnahmsweise die Sprache verschlagen. Marie wandte sich an Gitta und drückte kurz ihren Arm. »Viel Glück für dich«, murmelte sie.
Ohne einen weiteren Blick zu Bernd ging sie zur Tür. Dort drehte sie sich noch einmal um und sah in die bedrückten und fassungslosen Gesichter von einem halben Dutzend Gäste. »Es tut mir wirklich leid. Aber ich muss mich um mein Leben kümmern«, erklärte sie. Dann wirbelte sie herum und lief aus dem Café. Sie wollte die Traurigkeit hinter sich lassen. Auch dieses Gefühl sollte ab jetzt der Vergangenheit angehören.
Die Reisetasche war schnell gepackt. Das Wetter in Hamburg und Cornwall hatte eins gemeinsam – es war selbst im schönsten Spätsommer unberechenbar. Also hatte Marie vom T-Shirt bis zur dünnen Daunenjacke alles dabei. Sogar an ein Paar Gummistiefel – mit pinkfarbenen Rosen auf rotem Grund – hatte sie gedacht. Die warteten nun im Kofferraum auf ihren Einsatz. Im Packen war Marie Profi. Damals, als sie viel unterwegs gewesen war, hatte sie gelernt, alles Wichtige innerhalb kurzer Zeit und platzsparend unterzubringen. Marie fiel der alte, klapprige Bus ein. Ob es ihn noch gab – und wer nun mit ihm durch die Lande kurvte? Hatten die anderen es wirklich fertiggebracht, ihn zu verkaufen – oder gar auf dem Autofriedhof zu entsorgen? Seine Rostflecken waren zahlreich gewesen, aber er fuhr Kilometer um Kilometer und man konnte seine Sitze nicht nur ausklappen, sondern sogar komplett ausbauen, sodass eine vierköpfige Crew samt Instrumenten darin Platz zum Schlafen hatte. Oder zum Proben, Kochen oder Quatschen. Wegen Maries panischer Flugangst war er ein wichtiges Transportmittel, aber vor allem ein Zuhause für sie und die Band gewesen. Ob Mo seine Kotletten immer noch so lang trug? Er hatte stur an diesem Look festgehalten, auch wenn Rick ihn immer aufzog, dass er damit aussah wie der alternde Elvis. Und was Zoe wohl machte? Wahrscheinlich hatte sie inzwischen ihre Haarfarbe mehrmals geändert. Das letzte Mal, als Marie sie gesehen hatte, trug sie einen pinken Pixie.
Verloren in dieser längst verdrängten Erinnerung lächelte Marie. Doch als sie sich ertappte, wie sie Duke Ellington summte, verstummte sie erschrocken und rief sich selbst zur Ordnung. Sie hatte keine Zeit zum Träumen! Sie musste zusehen, dass sie die gut hundertdreißig Kilometer nach Cuxhaven schaffte. Dort gab es eine Frachtfähre nach England, die jedoch auch Autofahrer mitnahm. Vorausgesetzt, man war rechtzeitig vor Ort. Daher griff Marie jetzt hastig nach ihrer Tasche, überprüfte Ausweis, Schlüssel und Handy, ehe sie die Wohnungstür hinter sich zuzog und zweimal absperrte. Wenn sie das nächste Mal die Wohnung betreten würde, dann hoffentlich nicht mehr alleine, sondern zusammen mit Steven.
Zu ihrem Leidwesen musste sie quer durch Hamburg, um auf die Autobahn zu fahren und während sie sich durch den Altstadtverkehr quälte, kamen Marie Zweifel. Wie würde Steven reagieren, wenn sie plötzlich vor seiner Tür oder besser gesagt der des Cottages seiner Eltern stand? Dann aber sagte sie sich, dass er verstehen würde, warum sie so und nicht anders handeln musste. Bestimmt würde er sich freuen. Sie legte aus Sehnsucht mehr als tausend Kilometer zurück – gab es einen größeren Liebesbeweis?
Die Fähre würde die ganze Nacht über die Nordsee brauchen und Marie rechnete damit, morgen Nachmittag bereits in Cornwall zu sein. »I Drove All Night« fiel ihr ein und sie sang die Anfangstakte des Songs »I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you …« Dann aber drehte sie das Radio laut – Klassiksender. Doch auch Smetanas Moldau konnte die hartnäckig wiederkehrende Frage nicht verscheuchen, ob es wirklich klug gewesen war, Herz über Kopf ins Ungewisse aufzubrechen. Als sie in Richtung Alter Fischmarkt abbog, fiel Marie der Spruch ihrer Großmutter ein: »Im Krieg und in der Liebe sind alle Mittel erlaubt«, hatte die immer gesagt. Allerdings befand Marie sich nicht im Krieg, schon gar nicht mit Steven, und sie hoffte, dass ihr Auftauchen bei seinen Eltern auch nicht dafür sorgen würde. Die Patels waren von ihrer Schwiegertochter noch nie begeistert gewesen, und vor allem Stevens Vater hatte sie oft spüren lassen, dass er sich jemand anderen an der Seite seines Sohnes gewünscht hätte. Wahrscheinlich eine Trägerin des Pulitzerpreises, dachte Marie spöttisch und drückte unwillkürlich etwas fester aufs Gaspedal. Aber zwischen ihr und Steven hatte vor etwas mehr als drei Jahren der Blitz eingeschlagen, und da konnte man nichts gegen tun.
Auch jetzt schlug der Blitz ein. Allerdings in Form einer Polizistin mit Kamera und Stativ. »Verdammt«, murmelte Marie und trat auf die Bremse, natürlich zu spät. Ein paar Meter weiter stand prompt ein Polizeiauto am Straßenrand. Samt zweier Beamter, die Marie mit einem Stoppschild in eine Haltebucht winkten. Schicksalsergeben kurbelte sie die Fensterscheibe herunter und versuchte ein Lächeln. Vielleicht half es. Denn sie durfte keine Zeit verlieren. Das Schiff, das sie zu Steven bringen sollte, würde nicht auf sie warten.
»Eine Fähre nach England? Ne, die gibt’s schon seit Jahren nicht mehr! Jedenfalls nicht von Hamburg aus.«
Harry starrte den Mann hinter dem Schalter an. »Das ist jetzt ein Scherz, oder?« Er war eine gefühlte Ewigkeit an den Glas-Stahl-Konstruktionen der St. Pauli-Landungsbrücken entlanggelaufen, bis er das Hafenbüro gefunden hatte, in dem Tickets für Fahrgastschiffe verkauft wurden. Harry war nicht in der Stimmung für Diskussionen. Sein Gegenüber offenbar auch nicht. Das wettergegerbte Gesicht des Mannes hinter dem Schalter verfinsterte sich, und der Blick wurde stechend.
»Seh ich aus, als ob ich Witze machen würde? Von Hamburg fährt nix nach Britannien. Keine Fähre, kein Dampfer und auch kein Tretboot. Da müssen Sie schon zum Hafen nach Holland.«
»Holland? Wie soll ich denn so schnell dahin kommen? Ich muss sofort nach Cornwall!«
»Dann nehmen Sie den Flieger. Gibt ja inzwischen genug Billigflüge nach London.«
»So viel Geld habe ich aber nicht«, rief Harry.
Der gealterte Seebär zuckte die Schultern und kaute ungerührt auf seiner kalten Pfeife herum. Damit und mit seiner schwarzen Prinz-Heinrich-Mütze war er ein solches Klischee, dass Harry sich kurz fragte, ob die Schifffahrtsgesellschaft ihn zu dieser Kostümierung gezwungen hatte. Um den Verkauf von Tickets anzukurbeln – für eine Fähre, die es gar nicht mehr gab. Jedenfalls nicht nach England. Wobei Harry wieder bei seinem ursprünglichen Problem war. »Was ist mit einer Nachtfähre?«, fragte er hoffnungsvoll.
Käpt’n Iglo verdrehte die Augen. »Sagen Sie mal, machen Sie jetzt Witze? Ich sag es zum letzten Mal! Es. Gibt. Hier. Keine. Fähre. Nach. England. Haben wir uns verstanden?«
Wortlos drehte Harry sich um und verließ das Kabuff mit seinen schmutzigen Plexiglaswänden, die einen verschwommenen Blick auf die See gewährten. Flinke, grauweiße Schatten flitzten über das aufgewühlte Wasser. Möwen, dachte Harry wehmütig und wünschte sich in diesem Augenblick, eine von ihnen zu sein. Dann müsste er sich nicht mit einem unfreundlichen Hans-Albers-Abklatsch herumärgern und könnte einfach übers Meer fliegen. Zu Nora, die auf ihn wartete. Harry lief los. Er durfte keine Zeit mehr verlieren.
»Einundzwanzig Stundenkilometer drüber. Da waren Sie in einer geschlossenen Ortschaft ziemlich zackig unterwegs«, sagte der Polizist ungerührt und sah stoisch durch Maries Lächeln hindurch.
»Macht achtzig Euro und einen Punkt. Geschenk des Kraftfahrtbundesamts Flensburg«, fügte der Zweite an.
»Was?«, rief Marie erschrocken. Dummerweise hatte sie nämlich bereits zwei Punkte in den vergangenen eineinhalb Jahren aufgebrummt bekommen, unter anderem weil sie die Rotphase einer Ampel … nun ja, unterschätzt hatte.
»Kann ich, ich meine, kann man da nichts machen?«, fragte sie bang.
»Nein. Und die achtzig Euro kriegen wir bitte gleich. Sofortkasse«, schnarrte Polizist Nummer eins. »Außerdem würden wir gerne Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen.«





























