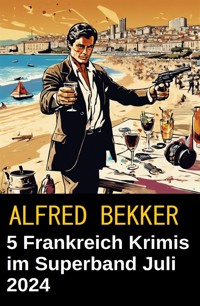Commissaire Marquanteur und der Killer von Point-Rouge:
Frankreich-Krimi
von Alfred Bekker
Ein Bandenkrieg unter Drogendealern in Marseille ruft die
Commissaire Marquanteur und die Sonderabteilung FoPoCri auf den
Plan. Unliebsame Zeugen werden durch einen Profikiller
ausgeschaltet. Als auch beteiligte Anwälte getötet werden, wird die
Suche intensiviert, aber der Killer ist geschickt. Er hat jedoch
ein eindeutiges Merkmal, auf das sich die Fahndung konzentriert –
sehr kleine Füße.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books,
Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press,
Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition,
Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints
von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress,
Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich
lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und
nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
1
Manchmal fragt man sich, welchen Sinn all das macht, was wir
tun.
Da macht man einen Schritt vor, und dann sorgen andere dafür,
dass es hinterher wieder mindestens genauso viele Schritte zurück
geht.
Vielleicht muss ich erst einmal erklären, wer ich bin und
worum es geht, sonst können sie nicht nachvollziehen, was ich
meine. Mein Name ist Pierre Marquanteur. Ich bin Commissaire.
Soweit, so gut.
Ich gehöre zu einer Sondereinheit, die für die Bekämpfung des
organisierten Verbrechens gegründet wurde. Sie nennt sich Force
spéciale de la police criminelle und ist hier in Marseille
angesiedelt.
Zusammen mit meinem Kollegen François Leroc übernehme ich die
wirklich kniffligen Fälle, die größere Ressourcen und Fähigkeiten
benötigen.
Wir riskieren unser Leben, um unseren Job erfüllen zu
können.
Und wenn dann ein Krimineller, von dem man genau weiß, dass er
schuldig ist, durch juristische Winkelzüge wieder auf freien Fuß
kommt, dann ist das gerade für unsereins ziemlich schwer zu
verdauen.
Aber das ist wohl auch eine Seite unseres Berufs, mit der man
irgendwie klarkommen muss.
2
Hugo Grenadille hob die Hand zum Victory-Zeichen, als er die
Stufen des Gerichtsgebäudes hinab schritt. Eine Handvoll Polizisten
schirmten den Mann ab, der soeben wegen eines Verfahrensfehlers
einer Verurteilung wegen Mordes entgangen war.
Mehrere Kamerateams und Dutzende von Reportern drängten sich
um Grenadille, der die Aufmerksamkeit sichtlich genoss.
Eine Mikrofonstange reckte sich Grenadille entgegen.
»Ein kurzes Statement!«, rief jemand.
Grenadille grinste.
»Was soll ich sagen? Wir leben eben in einem Rechtsstaat«,
lachte er und bleckte dabei zwei Reihen makellos weißer Zähne.
Hugo Grenadille ahnte nicht, dass er sich in dieser Sekunde im
Fadenkreuz eines Zielfernrohrs befand.
Mein Kollege François Leroc und ich hielten uns etwas abseits
des Menschenauflaufs auf, der rund um den Haupteingang des
Gerichtsgebäudes entstanden war.
Hugo Grenadille war des Mordes an einen Barbesitzer in
Pointe-Rouge bezichtigt worden, aber Staatsanwalt David Lohmer war
mit seiner Anklage sang- und klanglos untergegangen. Es hatte sich
herausgestellt, dass Beweismittel teilweise unter gesetzwidrigen
Bedingungen erhoben worden waren. Man hatte den Verdächtigen nach
seiner Verhaftung nämlich nicht hinreichend über seine Rechte
aufgeklärt.
Darüber hinaus waren im Verlauf des Verfahrens die Zeugen der
Anklage reihenweise umgefallen, hatten ihre Aussagen zurückgezogen
oder waren nicht mehr bereit, sie vor Gericht zu bestätigen. Die
Staatsanwaltschaft vermutete, dass diese Zeugen unter Druck gesetzt
worden waren. Beweise hatte sie dafür allerdings nicht vorlegen
können.
Plötzlich hatte sich niemand mehr daran erinnern können, dass
Hugo Grenadille die Bar, in der das Verbrechen verübt worden war,
am Tatabend überhaupt betreten hatte.
Wir vom Polizeipräsidium Marseille ermittelten seit Langem
gegen jenen Mann, der als Auftraggeber dieses Mordes verdächtigt
wurde.
Niko Dragnea.
Ein Mann, der hinter vorgehaltener Hand auch als der »Wäscher
von Pointe-Rouge» bezeichnet wurde. Er war an Dutzenden von Bars,
Clubs und Diskotheken im gesamten Marseille beteiligt oder betrieb
sie in eigener Regie. Diese Etablissements, so glaubten wir,
dienten einzig und allein der Wäsche von Drogengeldern.
Hugo Grenadille, der als Dragneas Mann fürs Grobe galt, schien
sich in seiner Rolle als Medienstar immer mehr zu gefallen.
»Ich danke der Staatsanwaltschaft dafür, dass sie nicht in der
Lage war, ein ordentliches Verfahren auf die Beine zu stellen. Ich
danke außerdem meinen Anwälten, dass sie es geschafft haben, diesem
besser ungenannt bleibenden Schmalspurrechtsverdreher, der durch
politische Schleimscheißerei zum Staatsanwalt werden konnte, mal
gezeigt wurde, wo seine Grenzen sind. Es würde mich nicht einmal
wundern, wenn er sich sogar sein Universitätsdiplom und seinen
Doktorhut selbst gekauft hat.«
»Ein widerlicher Kerl«, kommentierte François den Auftritt
Hugo Grenadilles, der sich immer weiter in seinen Triumph
hineinzusteigern schien.
Plötzlich veränderte sich Hugo Grenadilles Gesichtsausdruck.
Er wurde starr. Mitten auf seiner Stirn erschien ein roter Punkt,
der rasch größer wurde. Gleichzeitig ging ein Ruck durch seinen
Körper. Er sackte in sich zusammen.
Tumult entstand.
Eine Kugel hatte Hugo Grenadilles Stirn durchschlagen.
Instinktiv ging meine Hand zum Griff meiner SIG Sauer P 226. Ich
blickte an der Fassade eines mehrstöckigen Gebäudes empor, das dem
Gericht gegenüber lag. Von dort aus musste der Schuss gekommen
sein.
Das dritte Fenster im siebten Stock war offen. Ein Windstoß
wehte die Gardine ins Freie. Wahrscheinlich die Zugluft, die
entstand, wenn jemand gleichzeitig die Wohnungstür öffnete. Der
Killer machte sich offenbar schleunigst davon.
»Los! Vielleicht kriegen wir den Kerl noch!«, rief ich
François zu.
»Seit wann glaubst du an Wunder, Pierre?«
3
Wir kämpften uns durch die Menge, während im Hintergrund
bereits Sirenen von Einsatzfahrzeugen der Polizei und der
Notfallambulanz schrillten. Anschließend rannten wir über die
Straße. Der Van eines Pizza-Service bremste mit quietschenden
Reifen. Der Fahrer zeigte mir einen Vogel, ich ihm meinen
Dienstausweis des Polizeipräsidiums Marseille.
Endlich erreichten wir die andere Straßenseite.
Über Handy hatte François längst unsere Zentrale in der
Dienststelle verständigt. Von dort aus würden alle weiteren als
notwendig erachteten Maßnahmen ergriffen werden.
Wir erreichten den Eingang des gewiss schon etwas älteren,
aber in einem Top-Zustand befindlichen Hauses. Ein Bürohaus der
gehobenen Sorte – ohne den Komfort der modernen Glaspaläste, aber
mit dem Charme und dem Stil der Architektur der Dreißiger.
Anwaltskanzleien residierten hier. Die unmittelbare Nähe zum
Gerichtsgebäude war zweifellos ein Standortvorteil, der es
zumindest für Kanzleien der mittleren Kategorie attraktiver
erscheinen ließen, sich hier einzumieten statt in einer Etage
irgendeines teuren Glaspalastes.
In der Eingangshalle patrouillierten Angehörige eines privaten
Security Service in schwarzen Uniformen herum. Sie trugen
sechsschüssige kurzläufige Revolver vom Typ Smith & Wesson
Kaliber 38 an den Gürteln. Ich ging auf den ersten Mitarbeiter der
Security zu, zeigte ihm meinen Dienstausweis und sagte: »Pierre
Marquanteur, FoPoCri. Vom dritten Fenster im siebten Stock ist auf
das Portal des Gerichtsgebäudes geschossen worden. Sorgen Sie mit
Ihren Leuten dafür, dass die Ausgänge, das Treppenhaus und die
Aufzüge bewacht werden! Niemand darf das Haus verlassen, bevor
unsere Verstärkung nicht eingetroffen ist und die Personen
kontrollieren konnte.«
»Ja, kein Problem.«
Ich gab ihm meine Karte.
»Da ist meine Handynummer drauf. Melden Sie sich sofort, wenn
sich hier unten etwas tut!«
»In Ordnung.« Er steckte die Karte ein. »Drittes Fenster,
siebter Stock, sagten Sie?«
»Ja.«
»Das müssen die Räume von Watton & Partner sein. Die sind
letzte Woche ausgezogen. Seitdem steht die Etage leer, weil sich
noch kein Nachmieter gefunden hat, der bereit war, die horrende
Miete zu bezahlen!« Der Mitarbeiter der Security drehte sich um.
Sein Name stand in Großbuchstaben an seinem Uniformhemd: B. Borné.
»Hey, Jacques! Bring die Commissaires ins Siebte! Aber pass
auf! Kann sein, dass sich da oben ein schießwütiger Killer
herumtreibt.«
Jacques – dem Hemdaufdruck nach hieß er Jacques Tihange – zog
Revolver und Generalschlüssel und bedeutete uns, ihm zu folgen.
Borné bellte inzwischen Befehle an seine Leute durch die
Eingangshalle. Ein weiterer Mitarbeiter der Security, der seinen
Platz in einem Kubus aus Panzerglas hatte und von dort aus den
Eingang überwachte, griff zum Telefonhörer, um Anweisungen
weiterzugeben.
Jacques Tihange führte uns zum Treppenhaus. Wir konnten nur
hoffen, dass Borné auch wirklich meinen Anweisungen folgte und in
Kürze noch ein paar Mitarbeiter der Security hier in Stellung
gingen und sich die schwarzen Sheriffs nicht nur auf die Aufzüge
konzentrierten. Schließlich musste innerhalb kürzester Zeit dem
Täter jegliche Fluchtmöglichkeit genommen und jedes noch so kleine
Loch gestopft werden.
Wenn es nicht ohnehin schon zu spät war.
Wir nahmen jeweils zwei bis drei Stufen mit einem Schritt.
Dabei stellte sich heraus, dass es Jacques Tihange in puncto
Kondition durchaus mit zwei durchtrainierten Commissaire wie
François und mir aufnehmen konnte.
Schließlich erreichen wir den siebten Stock. Ein kurzer
Korridor führte zu den Räumen von Watton & Partner. Das
Firmenschild war abmontiert.
Lediglich ein Umriss und die Schraubenlöcher waren noch zu
sehen.
»Hieß nicht einer der Verteidiger von Grenadille Watton?«,
fragte François.
»Allerdings!«
Die Zugangstür zum Bereich von Watton & Partner war durch
eine Glastür vom Eingangsbereich getrennt, wo sich auch der Zugang
zu den Aufzügen befand. Die überprüften wir zuerst.
Keine der vier Kabinen war gerade in Höhe des siebten Stocks.
Drei befanden sich auf dem Weg nach unten, die vierte bewegte sich
aufwärts, wie anhand der Leuchtanzeigen erkennbar war.
»Wenn der Kerl den Lift genommen hat, sind wir zu spät«,
stellte Tihange fest.
»Aber dann läuft er hoffentlich Ihren Kollegen in die Arme!«,
erwiderte François.
Tihange steckte den Generalschlüssel ins Schloss der
Glastür.
»Ist offen!«, stellte er überrascht fest.
»Bleiben Sie hier und achten Sie auf den Fahrstuhl!«, sagte
ich.
»Aber …«
»Das ist jetzt unser Job, Monsieur Tihange!«
Mit der SIG in der Faust öffnete ich die Tür. François folgte
mir. Lautlos traten wir in den Korridor. Zu beiden Seiten befanden
sich die Türen zu den Büroräumen, in denen diese ihre Mandanten
berieten. Ganz klassisch und konservativ. Kein Großraumbüro und
abgesehen von der Eingangstür gab es auch keinerlei Glas.
Seriosität schien bei Watton & Partner Trumpf gewesen zu sein.
Ich fragte mich, weshalb diese Kanzlei ihren Sitz mit freiem
Ausblick auf die künftige Stätte des zu erringenden juristischen
Triumphs, den die Mitarbeiter von Watton & Partner für ihre
Mandanten zu erringen hatten, aufgegeben hatte.
Das dritte Fenster musste sich im ersten oder zweiten Zimmer
auf der rechten Seite befinden. Die Räume auf der anderen Seite des
Korridors waren zur Rückseite ausgerichtet und kamen nicht infrage.
Ich trat die erste Tür auf. François sicherte auf dem
Flur.
Ein kahler Raum ohne Möbel lag vor mir. Die Abdrücke auf dem
hellblauen Teppichboden zeigte genau an, wo die einzelnen
Möbelstücke gestanden hatten.
Beide Fenster waren geschlossen.
Ich schnellte zurück, machte François ein Zeichen.
Diesmal war er dran, die Tür aufzustoßen und den Raum als
Erster zu betreten, während ich auf dem Flur sicherte.
Mit der SIG in der Faust machte er einen Schritt in den
Nachbarraum, dessen Tür nur angelehnt gewesen war. Das Fenster
stand offen. Anders als in den ultramodernen Bürotürmen, die sich
zwanzig oder noch mehr Stockwerke in den Himmel über Marseille
Mitte erheben, bei denen sich die Fenster oft aus Angst vor
Selbstmördern gar nicht mehr öffnen lassen und Frischluft einzig
über die Klimaanlage in die Räume gebracht werden kann, waren hier
ganz herkömmliche Schiebefenster zu finden, wie sie in den meisten
französischen Häusern üblich sind.
François senkte die Waffe.
Dies war also der Ort, von dem aus geschossen worden war.
»Los, lass uns die anderen Räume noch kurz durchsuchen!«,
sagte François.
»Warte!«
»Was ist?«
»Hier stimmt was nicht.« Ich deutete auf den Vorhang am
Fenster. Er hing schlaff herunter, bewegte sich nicht. »Monsieur
Tihange, öffnen Sie die Glastür!«, rief ich.
»Steht offen!«, gab Tihange einen Augenblick später
zurück.
François sah mich verständnislos an.
»Worauf willst du hinaus, Pierre?«
»Kein Durchzug, François! Der Kerl ist nicht durch die Glastür
zu den Aufzügen gelaufen.«
»Sondern?«
Ich rannte über den Flur, stieß die Tür gegenüber auf. Sie war
nur angelehnt. Mit der SIG in der Hand trat ich ein. Eines der zum
Hinterhof ausgerichteten Fenster stand offen. Zugluft entstand und
ließ die Tür hinter mir zuschlagen. Ich lief zum Fenster und
blickte in den Hinterhof. Ein Mann mit Baseball-Kappe und einer
Sporttasche über der Schulter ging eiligen Schritts auf die etwa
hundert Meter entfernte Ausfahrt des von mehrstöckigen Bauten
eingerahmten Hinterhofs zu, der vor allem als Parkplatz
diente.
Über eine Außentreppe konnte man hinab gelangen. Ich zögerte
keine Sekunde, schwang mich aus dem Fenster, erreichte den ersten
Absatz der Treppe und rannte sie hinunter.
»Stehen bleiben! FoPoCri!«, rief ich dem Kerl mit der
Baseball-Kappe hinterher.
Der Kerl drehte sich um.
OM (Olympique Marseille) stand in Großbuchstaben auf seiner
Mütze. Die Augen waren durch eine Sonnenbrille mit Spiegelgläsern
verdeckt, so dass man von seinem Gesicht lediglich Nase und
Kinnpartie sehen konnte.
Der Mann mit der OM-Mütze griff unter seine blousonartige
Jacke, riss eine Waffe hervor und feuerte sofort in meine Richtung.
Schüsse peitschten, kratzten Funken sprühend am Metallgestänge der
Feuertreppe entlang oder gruben sich in das vergleichsweise weiche
Mauerwerk.
Ich feuerte zurück.
François hatte inzwischen das Fenster erreicht und gab mir
ebenfalls Feuerschutz.
Der Kerl rannte auf die Ausfahrt zu.
Ich sah zu, dass ich hinunterkam, nahm mehrere Stufen mit
einem Schritt, sprang und rutschte, bis ich schließlich den Asphalt
des Hinterhofs unter den Schuhen hatte.
Wieder peitschten Schüsse in meine Richtung. Ich duckte mich
hinter eine parkende Limousine, feuerte zurück, ohne jedoch zu
treffen.
Der Mann mit der OM-Mütze hatte jetzt die Einfahrt zum
Hinterhof erreicht.
Ein Wagen bremste. Es handelte sich um einen Renault in
Silbermetallic. Der OM-Mann richtete die Waffe auf den Fahrer,
umrundete die Motorhaube, riss die Fahrertür auf und zerrte den
etwa fünfzigjährigen Mann am Steuer grob heraus.
»Nicht schießen!«, zitterte der Ford-Fahrer.
Der Killer gab ihm einen Schlag mit dem Lauf seiner Pistole,
der ihn niedersinken ließ. Dann setzte er sich ans Steuer. Er
setzte den Wagen zurück. Rücksichtslos fuhr er auf die sich an die
Einfahrt anschließende Straße. Ein Wagen bremste mit quietschenden
Reifen.
Ich rannte hinterher, zielte auf die Reifen des Ford. Den
vorne rechts erwischte ich. Der OM-Mann startete trotzdem durch.
Funken sprühten und ein Geruch von verbranntem Gummi verbreitete
sich, als der Renault nach vorne schoss.
Der OM-Mann vollführte mit dem Renault einen riskanten
Fahrbahnwechsel. Ein Peugeot musste bremsen. Zwei weitere Fahrzeuge
fuhren auf. Ein Fahrradkurier konnte gerade noch rechtzeitig
ausweichen.
Mit aufheulendem Motor und über den Asphalt kratzender Felge
vorne rechts dröhnte der Renault die Fahrbahn entlang.
Ich erreichte die Straße, sprang auf den Kofferraum eines
parkenden Wagens, legte die SIG Sauer P 226 an und feuerte.
Zwei Schüsse.
Einer traf den Reifen hinten rechts.
Es war ohnehin schon ein Wunder gewesen, wie der OM-Mann es
geschafft hatte, den Renault trotz des zerschossenen Vorderreifens
in der Spur zu halten. Jetzt brach er hinten aus, schabte an einer
Reihe parkender Fahrzeuge entlang und blieb schließlich an einem
von ihnen hängen.
Die beiden verbleibenden Reifen drehten durch. Die Metallfelge
sprühte Funken wie ein Schweißgerät.
Der OM-Mann öffnete die Tür, riss die Waffe empor und feuerte
in meine Richtung. Ich duckte mich, sprang vom Wagen und rannte
hinter ihm er.
Keine fünfzig Meter entfernt befand sich eine U-Bahnstation.
Der OM-Mann rannte die Stufen hinab, die in die Tiefe führten.
Hinunter in die unterirdische Stadt aus U-Bahnhöfen,
Schienentunneln und Abwasserkanälen, von denen nur noch ein
Bruchteil in Gebrauch war. Mehrere Stockwerke tief reichte dieser
Maulwurfbau unter die Oberfläche.
Ich setzte dem flüchtigen OM-Mann, den ich für den Mörder Hugo
Grenadilles hielt, weiter nach. Ein Strom von Menschen kam mir
entgegen, hielt mich auf, und es nützte mir auch nichts, dass ich
mit meiner Polizeimarke herumwedelte. Es waren einfach zu viele.
Schon nach wenigen Augenblicken hatte ich den OM-Mann aus den Augen
verloren.
Aber noch war ich nicht bereit aufzugeben.
Schließlich erreichte ich den Bahnsteig.
Ein Zug fuhr gerade weg.
Der Bahnsteig war voller Menschen. Eine Minute später stand
ich fast allein dort. François sah ich die Treppe hinunterkommen,
die SIG in der einen und den Dienstausweis in der anderen
Hand.
Er sah sich suchend um.
Von dem OM-Mann war nirgends eine Spur zu finden.
Ich steckte meine Pistole weg und griff stattdessen zum Handy,
um sicherzustellen, dass der gerade Richtung Seepark abgefahrene
Zug bei der nächsten Station von Kollegen der Marseiller Polizei
unter die Lupe genommen wurde. Meine knappe Täterbeschreibung
sollte dabei helfen: Der Killer war mindestens eins-achtzig groß,
männlich, Baseball-Kappe mit der Aufschrift OM und eine Sporttasche
der Firma Nike.
»Danach könnte man nicht einmal ein Phantombild fabrizieren,
Pierre«, tadelte mich François, der alles mitbekommen hatte. Auch
er steckte jetzt die SIG zurück ins Holster und ließ den
Dienstausweis in der Jackentasche verschwinden.
»Sehr witzig, François! Leider hat der Kerl auf meine
Aufforderung seine Brille nicht abgenommen, damit ich ihn besser
sehen kann!«
4
Wir kehrten zurück zum Tatort.
Nur eine Viertelstunde später war dort bereits der Teufel los.
Rund um das Portal des Gerichtsgebäudes natürlich auch. Ein Wagen
des Gerichtsmediziners war vorgefahren, um die Leiche von Hugo
Grenadille abholen.
Der gesamte Bereich vor dem Gerichtsgebäude und um das
gegenüberliegende Gebäude war abgesperrt worden. Uniformierte
Kollegen der Polizei hatten das übernommen. Außerdem waren ein
halbes Dutzend Commissaire am Tatort eingetroffen, darunter unsere
Kollegen Léo Morell und Josephe Kronbourg. Stéphane Caron, der
stellvertretende Chef des Polizeipräsidiums Marseille traf zusammen
mit seinem Kollegen Boubou Ndonga etwas später ein. Wenn ein
Bluthund dieser Größe des organisierten Verbrechens selbst das
Opfer eines Mordanschlags wurde, war das ein Fall für die FoPoCri.
Schließlich lag nahe, dass dahinter eine Fehde unter organisierten
Gangsterbanden steckte.
Kollegen der Erkennungsdienstes, dem im Präsidium ansässigen
zentralen Erkennungsdienst, dessen Einrichtungen von allen
Marseiller Polizeieinheiten benutzt wurden, trafen ein. In
besonderen Fällen hatten wir darüber hinaus die Möglichkeit, auch
unsere eigenen erkennungsdienstlichen Mitarbeiter und Labore
einzuschalten. In diesem speziellen Fall reichten die Kapazitäten
unserer Kollegen vom Erkennungsdienst vollkommen aus.
Polizeihauptmeister Ralph Maiziere leitete den Einsatz unserer
Kollegen. Maiziere war ein bärbeißiger, sommersprossiger Mann mit
roten Haaren. Seine bretonischen Vorfahren waren nicht zu leugnen.
»Einem Widerling wie Hugo Grenadille dürfte wohl kaum jemand
eine Träne nachweinen«, meinte er, als wir uns zusammen mit meinem
Kollegen Stéphane Caron in einem der leer stehenden Büroräume von
Watton & Partner trafen.
»Trotzdem werden wir den Mord an ihm mit derselben Intensität
verfolgen wie jedes andere Verbrechen«, erwiderte ich. »Auch, wenn
jetzt der eine oder andere sagen wird, dass es mit Grenadille den
Richtigen getroffen hat.«
»Einen Mann, der um keinen Preis der Welt hätte freikommen
dürfen!«, war Maiziere überzeugt. »Ich glaube nicht, dass ihn in
Pointe-Rouge viele Leute vermissen werden!«
Stéphane zuckte die Achseln.
»Wer weiß, vielleicht hat ihn sogar dieser Niko Dragnea auf
dem Gewissen.«
»Sein eigener Boss?«, fragte François.
»Warum nicht?«, erwiderte Stéphane. »Grenadille war für
Dragnea der Mann fürs Grobe – und so ein Mann fürs Grobe weiß doch
häufig über die dunkelsten Kellerlöcher Bescheid, die sein
Auftraggeber zu verbergen hat.«
»Wenn wir erst einmal den Killer haben, bekommen wir auch den
Boss, der hinter ihm steht«, war ich überzeugt.
Die Liste derer, die Grenadille den Tod gewünscht hatten,
musste ziemlich lang sein. Dutzende von kleinen Bar- und
Ladenbesitzer, denen Grenadille im Auftrag von Dragnea auf die Füße
getreten war. Natürlich auch die Konkurrenz im Geldwäschegeschäft,
die Grenadille recht erfolgreich eingedämmt hatte. Nach unseren
Ermittlungen war Grenadille es gewesen, der seinem Boss den Weg
nach oben buchstäblich frei geboxt hatte. Oft genug mit
Unterstützung von einschlägig bekannten Kriminellen oder
Straßengangs. Grenadille war schlau genug gewesen, sich die Hände
nur dann schmutzig zu machen, wenn er vollkommen sicher sein
konnte, nicht erwischt zu werden.
Mein Handy schrillte.
Es war die Zentrale. Ich bekam Bescheid darüber, dass unser
Zeichner Commissaire Perouche auf dem Weg zum Tatort war, um mit
mir und François ein Phantombild des Täters zu erstellen, das
möglichst schnell an die Medien gegeben werden sollte.
Michel Prevoust vom Erkennungsdienst trat zu uns. Ich kannte
Michel von anderen Einsätzen her, hatte ihn aber in seinem
schneeweißen Ganzkörperschutzanzug mit Kapuze und Mundschutz nicht
erkannt. Erst jetzt, da er beides zur Seite schob, sah ich, mit wem
ich es zu tun hatte.
»Hi, Michel!«
»Hi, Pierre.«
Er begrüßte auch die anderen und meinte schließlich: »Diese
Anzüge sind das pure Grauen. Angeblich sollen die atmungsaktiv
sein.«
»Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, im
Außendienst zu sein«, grinste François.
Aber das Tragen dieser Schutzanzüge hatte sich in der
Spurensicherung bewährt. Gerade die Technik der DNA-Analyse und der
Einsatz von Luminol, um normalerweise unsichtbare oder teilweise
schon entfernte Spuren sichtbar zu machen, hatten das Geschäft der
Spurensicherung in den letzten Jahren revolutioniert. Eine Schuppe,
die aus dem Haar eines Beamten rieselte, konnte am Tatort zu einem
dermaßen verwirrenden Befund führen, dass der Fortgang der
Ermittlungen dadurch stark verzögert wurde.
»Viel kann man im Moment noch nicht sagen«, erklärte Prevoust.
»Der Raum war leer, der Täter hat keine Patronenhülse hinterlassen,
und das Projektil kann erst nach der Obduktion der Leiche
untersucht werden, denn soweit ich den Gerichtsmediziner verstanden
habe, steckt es noch in Grenadilles Kopf.«
»Es wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn die Waffe schon mal
benutzt worden wäre«, meinte Stéphane.
»Fingerabdrücke gibt es nirgendwo«, fuhr Prevoust fort. »Der
Täter hat Handschuhe getragen. Er hatte allerdings Öl unter den
Füßen und hat deswegen ein paar Abdrücke produziert, die mit bloßem
Auge fast nicht sichtbar sind, aber …«
»Ihr habt da so eure Tricks«, schloss ich.
Michel nickte.
»Worauf du wetten kannst! Der Kerl trug Turnschuhe der Marke
Nike, Größe einundvierzig. Ich würde daher auf einen eher kleinen
Täter schließen.«
»Ich habe den Mann gesehen«, sagte ich. »Eins-achtzig war der
mindestens, vielleicht sogar noch größer!«
Michel hob die Augenbrauen.
»Schuhgröße einundvierzig passt nicht so richtig dazu,
oder?«
»Kannst du laut sagen!«
»Aber an den Messungen wirst da ja wohl nicht zweifeln
wollen.« Michel Prevoust zuckte die Schultern und lächelte
verschmitzt. »Wie ihr das zusammenbringt – diesen großen Kerl und
die kleinen Füße – das ist euer Problem. Aber dafür habt ihr ja
eure berühmte Ausbildung in der Polizeihochschule hinter euch.« Ein
bisschen Ironie schwang in Michels Worten mit. Ich hatte zufällig
von einem seiner Kollegen mal gehört, dass Michel Prevoust selbst
mal versucht hatte, die Aufnahmetests bei der Polizei zu bestehen
und gescheitert war. Vielleicht kamen daher die Seitenhiebe auf die
Polizei, die er sich hin und wieder wohl einfach nicht verkneifen
konnte.
»Das ist zumindest ein sehr auffälliges körperliches Merkmal,
das uns bei der Fahndung helfen wird«, glaubte Stéphane. »Was
wollen wir mehr?«
Während der Zeit, wie wir am Tatort zubrachten, stellte sich
noch mehr heraus. So waren sämtliche Fenster der siebten Etage
geschlossen gewesen, wie die Mitarbeiter des Security Service
versicherten. Auch die Spurenlage an dem Fenster zum Hinterhof,
durch das der Täter über die Feuerleiter geflüchtet war, ergab,
dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf diesem Weg das
Gebäude betreten hatte. Vielmehr sprach alles dafür, dass er auf
dem herkömmlichen Weg in die ehemaligen Räumlichkeiten von Watton
& Partner gelangt war.
Mit Hilfe von B. Borné fanden wir schließlich die
entsprechende Video-Sequenz der Überwachungskamera im
Eingangsbereich. In dieser Sequenz sprach er kurz mit einem
Mitarbeiter der Security, dessen Identität schnell ermittelt war.
Er hieß Rainier Gervais, war vierunddreißig Jahre alt und galt nach
B. Bornés Angaben als außerordentlich zuverlässig. Die
Video-Sequenz konnte uns, was das Äußere des Killers anging, zwar
nicht wirklich weiterhelfen, abgesehen davon, dass sich unsere
Spezialisten vom Innendienst darum kümmern konnten, ob der Kerl mit
der OM-Mütze tatsächlich auch Schuhgröße 41 hatte, was mit Hilfe
neuester biometrischer Messverfahren auch anhand von Videoaufnahmen
möglich war.
Gervais konnte sich jedoch über die bekannten Details hinaus
noch an zwei weitere wichtige Einzelheiten erinnern. Erstens hatte
der OM-Mann Gervais‘ Angaben nach stark nach Menthol und Zigaretten
gerochen. Und zweitens konnte sich der Wachmann daran erinnern,
dass er sich nach der Kanzlei Brugger, Gerlonde & Parte im
achten Stock erkundigt.
»Ich habe kurz bei der Kanzlei durchgerufen, um mich danach zu
erkundigen, ob er dort tatsächlich einen Termin hatte. Sonst hätte
ich ihn gar nicht zu den Fahrstühlen gelassen«, berichtete Gervais.
»Sicherheit wird bei uns nämlich groß geschrieben, müssen Sie
wissen.«
»Hat er einen Namen genannt?«, fragte ich.
Gervais nickte. »Pierre Meyere.«
»Nicht besonders originell.«
»Habe ich auch gedacht, Commissaire Marquanteur. Aber wenn
Brugger, Gerlonde & Parte einen Termin mit einem gewissen
Pierre Meyere vereinbart hat und in der Eingangshalle taucht jemand
mit diesem Namen auf, dann habe ich keinen Grund, denjenigen daran
zu hindern, das Gebäude zu betreten.«
»Es macht Ihnen auch niemand einen Vorwurf«, versicherte
ich.
»Wer hätte auch schon ahnen können, dass es sich bei diesem
Typ um einen Killer handelt? Schließlich können wir unmöglich bei
all den Mandanten der in diesem Haus residierenden Anwälte Leibes-
und Gepäckvisitationen durchführen. Dann hätten wir sehr schnell
deren gesamte Mandantschaft verprellt.«
Wenig später statteten wir der Kanzlei Brugger, Gerlonde &
Parte einen kurzen Besuch ab. Wir bekamen dort die Auskunft, dass
tatsächlich ein Mann namens Meyere telefonisch um einen Termin
gebeten hatte. Er wollte angeblich Rechtsauskunft in einer
Erbschaftsangelegenheit. Wie unsere Kollegen Léo Morell und Josephe
Kronbourg herausfanden, hatte dieser ominöse Pierre Meyere auch in
zwei anderen Kanzleien angerufen, um einen Termin zu bekommen, war
dort jedoch auf spätere Termine vertröstet worden.
Inzwischen traf unser Zeichner, Commissaire Perouche, ein, der
zusammen mit dem Mitarbeiter der Security Gervais, François und mir
ein Phantombild erstellte. Dazu benutzte er natürlich schon lange
nicht mehr Block und Bleistift, sondern einen hochmodernen Laptop
mit einer speziellen Software zur Erstellung brauchbarer
Phantombilder.
Da in diesem Fall niemand besonders viel vom Gesicht des
Verdächtigen gesehen hatte, blieb das Ergebnis trotz eines
Top-Bildprogramms und dem unbestreitbaren Können Perouches eher
dürftig.
Wir waren gerade damit fertig, als uns ein sehr interessantes
Ergebnis der Kollegen des Erkennungsdienstes erreichte. Es war
Michel Prevoust, der mir die Neuigkeit per Handy mitteilte.
»Am Schloss der Glastür, die zu den Räumen von Watton &
Partner führen, sind keinerlei Spuren eines Einbruchs erkennbar. Da
wir davon ausgehen, dass der mutmaßliche Täter über diesen Weg an
den Tatort gelangt ist, muss man daraus eigentlich den Schluss
ziehen, dass er wahrscheinlich einen Schlüssel hatte oder ihn
jemand hereingelassen hat, Pierre.«
»Ich danke dir, Michel.«
Wenig später besprach ich die Sache mit François und
Stéphane.
»Wenn ihr mich fragt, dann gibt es da nur zwei Möglichkeiten,
wie er an den Schlüssel herangekommen sein kann«, sagte Stéphane.
»Entweder hatte er einen Helfer bei den Wachleuten oder bei Watton
& Partner.«
»Dürfte auf jeden Fall interessant sein, diese Kanzlei mal
unter die Lupe zu nehmen«, fand ich.
5
Es war später Nachmittag. Niko Dragnea saß mit zwei
dunkelhaarigen Schönheiten in den Armen an einem Tisch im Buena
Vista Club, einer Disco, die als Tummelplatz von Kokain-Dealern für
den gehobenen Bedarf bekannt war. Niko Dragnea kontrollierte diesen
Laden über einen Strohmann namens Rafi Hazrat. Der Buena Vista Club
diente ihm vor allem zur Geldwäsche. Gewinn brauchte der Club
ansonsten kaum abzuwerfen. Tat er es doch – umso besser.
Wichtig war nur, dass der Umsatz möglichst hoch war. Je höher
der Umsatz, desto mehr schwarzes Geld konnte man durch ihn
hindurchschleusen und zu schneeweißem Kapital machen, mit dem sich
ganz legale Geschäfte machen ließen. Und genau darauf waren sie
alle aus, die mit illegalen Geschäften ihr Geld machten. Die
Drogenbarone ebenso wie die Paten der Müll-Mafia oder
Falschgeldhändler, die mit dem Export von falschen Euro-Noten nach
Osteuropa oder in die ehemaligen GUS-Staaten ein Vermögen machten.
Das Problem blieb immer dasselbe – und Männer wie Niko Dragnea
hatten die Lösung dafür.
Die Drogenhändler, die allabendlich im Club herumhingen und
ihren Stoff an Rechtsanwälte, Yuppies – karrierebewusste, meist
junge Menschen, die großen Wert auf ihre äußere Erscheinung legen –
und andere Kunden verhökerten, die bereit waren, für guten Koks
etwas mehr auszugeben, als man an den Straßenecken dafür
hinblättern musste, nahm Dragnea eigentlich nur in Kauf. Im Grunde
stellten sie eine Gefahr für sein Geschäft dar – wenn auch nicht
für ihn persönlich, denn im Zweifelsfall musste sein Strohmann für
alle rechtlichen Folgen den Kopf hinhalten.
Dragnea waren diese schmierigen Typen, die allabendlich an den
Tresen herumhingen oder ihre Hüften zu den Rhythmen wiegten, die im
Buena Vista gespielt wurden, zuwider.
Aber da es die Leute von Ben Toufique waren, dem Koks-König
von Pointe-Rouge, der es geschafft hatte, so etwas wie der
Generalvertreter eines Drogensyndikats in Marseille zu werden,
konnte Niko Dragnea die Koksdealer nicht aus dem Buena Vista und
anderen seiner Clubs verbannen. Schließlich war Ben Toufique einer
seiner wichtigsten Kunden. Davon abgesehen hatte er mehr Männer
unter Waffen als sonst irgendjemand in dem Viertel.
Für Gäste hatte das Buena Vista um diese Zeit noch gar nicht
geöffnet. Aber bevor der Publikumsverkehr losging, wollte sich der
Boss noch etwas amüsieren. Eine Champagnerflasche stand auf dem
Tisch. Die Gläser schäumten über, und die beiden Girls, die Dragnea
im Arm hielt, schienen bester Laune zu sein.
Rafi Hazrat, Dragneas Strohmann, stand hinter dem Schanktisch
und beobachtete misstrauisch die Szene. Hazrat war Mitte dreißig,
hatte dunkel gelocktes Haar und war sehr hager. Er hatte bei
Dragnea als Türsteher angefangen. Jetzt konnte er sich Clubbesitzer
nennen, auch wenn ihm durchaus klar war, dass er seine Existenz
auch jetzt noch zu hundert Prozent Dragnea verdankte.
»Auf die Zukunft, Mädels!«, rief Dragnea, der bereits mehrere
Champagnergläser geleert hatte.
Die Mademoiselles kicherten.
Aber dieses Kichern erstarb von einem Augenblick zum anderen,
als die Eingangstür vom Buena Vista zur Seite flog.
Ricky Balmorte, der breitschultrige und fast zwei Meter große
Türsteher des Buena Vista, taumelte durch den Raum und flog der
Länge nach zu Boden. Mit einem Fluch auf den Lippen wischte er sich
das Blut von der Nase.
Ein unglaublich dicker Mann Anfang vierzig und in einen
schneeweißen Maßanzug gekleidet, betrat den Raum. Das blauschwarze
Haar war nach hinten gekämmt. Drei Kerle mit schwarzen
Rollkragenpullovern und Bodybuilderfigur begleiteten ihn. Sie
trugen Maschinenpistolen vom Typ MP 7 der Firma Heckler und Koch im
Anschlag.
»Monsieur Toufique!«, stieß Dragnea völlig verblüfft
hervor.
Mit allem hätte er jetzt gerechnet, nur nicht damit, dass
ausgerechnet Ben Toufique ihm einen Besuch abstattete.
Der Koks-König von Pointe-Rouge deutete auf den am Boden
liegenden Balmorte.
»Lausige Bodyguards beschäftigen Sie, Dragnea«, tadelte er den
Mann hinter den Champagnergläsern.
Die Mademoiselles saßen jetzt auf einmal ziemlich steif da.
Ihre Gesichter erbleichten.
Ben Toufique trat näher.
Hazrat machte eine unbedachte Bewegung, die damit quittiert
wurde, dass gleich zwei von drei MP 7-Läufen auf ihn gerichtet
wurden.
»Hey, keine Panik! Am besten, wir bleiben alle ganz ruhig!«,
zeterte Hazrat.
Toufique steckte sich eine Zigarre in den Mund und zündete
sich an.
»Indem Sie das hier dulden, begehen Sie gerade eine
Ordnungswidrigkeit, Hazrat«, lachte Toufique, blies den Rauch in
die Luft und lächelte kalt. »Schließlich ist das Rauchen in
sämtlichen Lokalen nicht nur in Marseille verboten – und bei
Zuwiderhandlung wird der Besitzer in Regress genommen!«
»Monsieur Toufique, ich …«, flüsterte Hazrat, aber der Mann in
Weiß bedeutete ihm mit einer kurzen, knappen Geste zu schweigen.
»Gehen Sie einfach eine Weile spazieren, klar?«
Hazrat wandte den Blick in Dragneas Richtung.
»Ist schon in Ordnung, Rafi!«, sagte dieser.
Toufique versetzte dem am Boden liegenden Türsteher einen
Tritt.
»Und nehmen Sie dieses Stück Scheiße mit, Hazrat! Ich will
mich mit Ihrem Boss mal ungestört unterhalten.«
Ricky Balmorte bleckte die Zähne wie ein Raubtier. Die obere
Reihe war so gleichmäßig, dass sie falsch sein musste. Er ballte
die Fäuste.
»Ist schon gut!«, schritt jetzt Dragnea ein. »Tut, was
Monsieur Toufique wünscht!«
»Ist das Ihr Ernst, Monsieur Dragnea?«, vergewisserte sich
Ricky Balmorte.
»Ja, klar!«, bestätigte Dragnea.
Balmorte erhob sich. Zusammen mit Hazrat verließ er den
Raum.
»Ihr verschwindet auch besser!«, knurrte Toufique die beiden
Girls an Dragneas Tisch an. »Tut mir wirklich leid, normalerweise
habe ich nichts gegen charmante Gesellschaft, aber diesmal stören
mich eure Ohren.«
Die beiden jungen Frauen ließen sich das nicht zweimal sagen
und verzogen sich sofort – offensichtlich froh darüber, den Raum
verlassen zu können. Dragnea schluckte.
»Jetzt sind wir allein, Dragnea!«
»Wollen Sie einen Schluck Champagner, Monsieur
Toufique?«
»Was gibt‘s denn zu feiern?«
»Was wollen Sie?«
Toufique setzte sich an den Tisch und ließ sich dabei von
einem seiner Leibwächter den Stuhl zurechtrücken. Den Zigarrenrauch
blies er Dragnea direkt ins Gesicht.
»Unser beider Geschäfte sind – wie soll ich mich da angemessen
ausdrücken – ziemlich eng miteinander verwoben.«
»Ja. So ist es«, murmelte Dragnea fast tonlos. »Das stimmt
…«
»Und da werden Sie es doch sicher verstehen, dass ich anfange,
mir Sorgen zu machen, wenn ein Kerl, der als Dragneas Bluthund
bekannt wurde, plötzlich ungeniert von einem Profikiller auf den
Stufen des Gerichtsgebäudes niedergestreckt wird.«
»Sie sprechen von Grenadille!«
»Natürlich spreche ich von Grenadille – und wie Sie hier so
ruhig sitzen und Champagner schlürfen können, ist mir ehrlich
gesagt unbegreiflich.«
Einige Augenblicke lang herrschte Schweigen.
Einer von Toufiques Leibwächtern zapfte sich ungefragt ein
Bier und trank es halb leer, bevor er den Mund verzog und es mit
vor Ekel verzerrtem Gesicht stehen ließ.
»Ich habe keine Ahnung, wer hinter dem Anschlag auf Grenadille
steckt«, behauptete Dragnea.
»Wirklich nicht? Eigentlich liegt es nahe, dass jemand von
Ihrer direkten Konkurrenz dahintersteckt. Jemand, der Sie treffen
will und Ihnen dafür erst einmal einen Bauern aus dem Spiel nimmt.
Aber ich nehme an, dass Grenadille in Ihrem ganz persönlichen Spiel
sehr viel mehr als nur ein Bauer war – habe ich recht?«
»Hören Sie, Monsieur Toufique, Sie brauchen sich keine Sorgen
zu machen. Ich habe meine Organisation im Griff und gegen
Konkurrenz kann ich mich wehren.«
»Mit diesem Jammerlappen von Bodyguard, der wie eine
Vogelscheuche vor der Tür herumstand?« Toufique lachte rau. »Das
ist doch nicht Ihr Ernst. Hier kann doch jeder hereinspazieren und
Sie umlegen, Dragnea!« Toufique beugte sich etwas weiter vor und
sprach nun in gedämpftem Tonfall. »Sie stecken in Schwierigkeiten,
Dragnea. Und zufällig bin ich der Mann, der Sie raushauen kann –
oder haben Sie vielleicht Ihren Bluthund selbst umbringen lassen,
weil er Ihnen lästig wurde? Weil er vielleicht zu gierig wurde und
sich all die kleinen, schmutzigen Geheimnisse, die er mit Ihnen
teilt, bezahlen lassen wollte?«
»Sie erwarten doch nicht im Ernst, dass ich dazu jetzt etwas
sage!«
»Wenn erst die FoPoCri auf der Matte steht, werden Sie
antworten müssen, Dragnea – und ich kann nur auch in meinem eigenen
Interesse hoffen, dass Sie sich bis dahin Ihre Antworten etwas
besser zurechtgelegt haben, statt Champagner zu schlürfen!«
»Ich weiß Ihre Sorge um mich zu schätzen, Monsieur Toufique«,
erwiderte Dragnea, dem bereits der Schweiß auf der Stirn stand. Ihm
war klar, worauf Toufique hinauswollte. Und das gefiel ihm ganz und
gar nicht. »Ich komme sehr gut allein zurecht. Dass es
zwischendurch mal ein paar Schwierigkeiten gibt, wissen Sie ja wohl
auch aus eigener Erfahrung.«
»Ich mache Ihnen ein Angebot«, sagte Toufique.
Ein Angebot von der Sorte, die man nicht ablehnen kann, dachte
Dragnea bitter. Genau so etwas hatte er erwartet. Aber nicht mit
ihm! Er war entschlossen, Toufique die Stirn zu bieten – wenn auch
vielleicht nicht gerade jetzt, da die Läufe mehrerer
Maschinenpistolen vom Typ MP 7 auf ihn gerichtet waren.
»Ich schütze Ihre Geschäfte, Monsieur Dragnea, und dafür
bekomme ich einen Anteil von allem, was Sie an Gewinn einstreichen
von – sagen wir – dreißig Prozent. Ich bin ja kein Unmensch und
möchte natürlich auch, dass Sie existieren können. Aber für den
Schutz muss ich nun einmal gewisse Unkosten vorstrecken … Sie haben
sicher Verständnis dafür.«
»Ich werde mir Ihren Vorschlag durch den Kopf gehen lassen,
Monsieur Toufique.«
Toufique schnipste mit den Fingern, woraufhin einer der
Bodyguards seine MP 7 an einen der anderen Gorillas weiterreichte.
Der Kerl begann mit den Fingerknochen zu knacken.
»Die türkische und die arabische Übersetzung des Wortes Killer
lautet Kaatil«, begann Toufique. Er sprach mit leiser, wispernder
Stimme, deren Klang Dragnea an klirrendes Eis erinnerte. »Kaatil
hört sich sehr viel poetischer an als Killer – finden Sie nicht,
Monsieur Dragnea?« Toufique deutete auf den Kerl, der sich offenbar
anschickte, Dragnea zusammenzuschlagen. »Kaatil – das ist sein
Spitzname. Er tötet langsam. Er weiß, wie man Schmerzen zufügt.
Wenn er mit Ihnen fertig ist, werden Sie ein Krüppel sein, Dragnea
…«
»Pfeifen Sie Ihren Dobermann zurück!«, zeterte Dragnea.
»Was soll ich machen? Er hatte in letzter Zeit wenig zu tun
und braucht wieder Übung.«
Kaatils Pranke schnellte blitzschnell vor. Er packte Dragneas
Nase, drehte sie herum. Dragnea schrie. Blut lief ihm über das
Gesicht.
»Okay, okay«, stieß Dragnea schließlich hervor, nachdem er
sich wieder gefasst hatte. »Dreißig Prozent sind in Ordnung.«
»Fünfunddreißig«, verlangte Toufique. »Dreißig hätte ich
genommen, wenn es ohne irgendwelche Schwierigkeiten zu einer
Einigung gekommen wäre.«
Dragnea schluckte. Hass leuchtete in seinen Augen.
Aber er konnte nichts tun.
Nicht jetzt …
Kaatil packte Dragneas Handgelenk, bis es knackte. Und der
Wäscher von Pointe-Rouge schrie.
»Wir sind uns also einig«, stellte Toufique fest.
»Ja«, knurrte Dragnea.
Der dicke Mann im schneeweißen Anzug erhob sich. Ein
triumphierendes Grinsen stand auf seiner Stirn.
»Ich habe immer gerne mit Ihnen Geschäfte gemacht, Dragnea.
Und ich hoffe, dass das noch lange so bleibt – zukünftig auch gerne
wieder in angenehmerer Gesprächsatmosphäre. Aber das liegt ganz bei
Ihnen. Und jetzt noch eine Sache: Wer spuckt Ihnen ins Geschäft,
Dragnea? Wer immer es ist, ich blas ihn aus dem Weg.«
6
François und ich fuhren später zur neuen Residenz von Germaine
Watton, dem ehemaligen Chef von Watton & Partner.
Per Handy versorgte uns die Zentrale mit allen gegenwärtig
über Watton vorliegenden Informationen. Commissaire Maxime Valois,
einer unserer Innendienstler aus der Fahndungsabteilung, hatte auf
die Schnelle herausfinden können, dass die Kanzlei vor Kurzem
aufgelöst worden war.
Trotzdem waren alle drei Teilhaber weiterhin an der
Verteidigung in Hugo Grenadilles jüngstem Prozess beteiligt
gewesen. Schließlich war jeder von ihnen nach wie vor als Anwalt
zugelassen.
»Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen!«, meinte
François. »Ein Gangster stirbt durch einen Schuss, der aus der
Kanzlei seines Anwalts abgegeben wurde. An Zufälle glaubt doch da
niemand!«
Zuvor hatte Wattons Kanzlei immer wieder Mandanten aus dem
Umfeld von Niko Dragnea verteidigt, darunter mehrere Drogenhändler,
die wir der Organisation von Ben Toufique zurechneten, einem
Drogenkönig, der unseren Erkenntnissen nach in geschäftlichen
Verbindungen zu Dragnea stand, ohne dass wir einem der beiden
daraus bislang einen Strick hätten drehen können.
Wattons gegenwärtige Wohnung war eine Traumetage in einem
modernen Hochhaus mit Blick auf den Seepark.
Wir hatten gerade einen Parkplatz gefunden, als François‘
Handy schrillte. Es war noch einmal Maxime Valois aus dem
Innendienst. Er war auf einen interessanten Fall gestoßen, der vor
drei Jahren vor Gericht ausgetragen worden war. Hugo Grenadille war
wegen schwerer Körperverletzung und Drogenhandel angeklagt und aus
Mangel an Beweisen schließlich freigesprochen worden. Der
Verteidiger in diesem Verfahren war ebenfalls niemand anderes als
Germaine Watton gewesen, Seniorpartner der Kanzlei Watton &
Partner.
Wir fuhren in den obersten Stock des exklusiven
Appartementhauses, in dem er jetzt residierte. Die Miete dieser
Traumetage musste mindestens das Dreifache dessen betragen, was ihn
die Räumlichkeiten in dem Bau gegenüber dem Gerichtsgebäude
gekostet hatte. Aber Germaine Watton schien sich das leisten zu
können.
An seiner Wohnungstür verriet kein Schild, dass sich hier die
Residenz eines Anwalts befand. Ob er überhaupt noch ein Büro
unterhielt, war noch keineswegs klar.
Ich betätigte die Klingel.
Ein Kameraauge nahm uns ins Visier.
Ein paar Augenblicke später ertönte eine leise Stimme aus der
Sprechanlage: »Sie wünschen?«
»Pierre Marquanteur, FoPoCri!«, meldete ich mich und hielt
meinen Dienstausweis in die Kamera. »Mein Kollege Commissaire
François Leroc und ich haben im Zusammenhang mit der Ermordung
eines ehemaligen Mandanten von Ihnen ein paar Fragen.«
»Werfen Sie Ihren Dienstausweis bitte durch den Briefschlitz,
damit ich mich von dessen Echtheit überzeugen kann.«
Ich zuckte die Achseln, wechselte einen kurzen Blick mit
François und warf schließlich meinen Dienstausweis durch den
Briefschlitz.
Wenig später öffnete sich die Tür. Ich hörte, wie mehrere
Ketten und zusätzliche Sicherheitsschlösser geöffnet wurden.
Ein kleiner, hagerer Mann mit etwas wirren Haaren stand vor
uns. Ich erkannte ihn von seinen Auftritten im Gerichtssaal wieder
und schätzte ihn auf etwa fünfzig Jahre. Seine Brille mit den
dicken, viereckigen Gläsern und der knallroten Fassung wirkte sehr
auffällig.
»Monsieur Germaine Watton?«, vergewisserte ich mich.
»Der bin ich. Kommen Sie herein!«, sagte er und winkte uns mit
einer lässigen Geste zu.
Er drehte sich um. Wir folgten ihm, während die Tür hinter uns
von selbst ins Schloss fiel. Watton brachte uns in sein Wohnzimmer,
das mehr Quadratmeter hatte, als die meisten Marseiller Wohnungen
insgesamt.
Kaum etwas ist in Marseille so knapp wie Wohnraum. Die
verschwenderische Art und Weise, in der Watton damit umging, schien
fast so etwas wie eine Demonstration zu sein. Er wollte damit jedem
Besucher zeigen, dass er es geschafft hatte und es sich leisten
konnte, eine Fläche, die sich gut und gerne für eine fünfstellige
Summe im Monat vermieten ließ, einfach so gut wie leer stehen zu
lassen.
Die Einrichtung des Wohnzimmers, in das er uns führte, war von
genauso demonstrativer Schlichtheit. Ein paar Regale in
Metalloptik. Ein abstraktes, großformatiges Bild, das Kreise und
Quadrate auf einer hellblau grundierten Fläche sich abwechseln und
ein Muster erzeugen ließ, das sich wahrscheinlich vielfältig
interpretieren ließ, eine Designer-Lampe in Form eines
Schlangenkopfes, in deren Rachen ein großer Halogenscheinwerfer
strahlte – das war schon beinahe alles. Diese Wohnung hatte kaum
etwas, das eine persönliche Note verriet. Außer einer Bibel, einem
Windows-Handbuch und einem Ratgeber für legale Steuertricks gab es
keinerlei Bücher.
»Bitte setzen Sie sich«, forderte Germaine Watton uns auf. Wir
nahmen in tiefen Ledersesseln Platz, die rund um einen Glastisch
gruppiert waren.
»Ich denke, Ihnen ist der Name Hugo Grenadille ein Begriff«,
begann ich.
»Oh, natürlich ist er das«, fiel mir Watton ins Wort.
»Natürlich! Vor allem seit die lokalen Fernsehnachrichten
ausführlich über das Attentat auf ihn vor dem Gerichtsgebäude
berichtet haben.« Watton schüttelte energisch den Kopf, während
seine Gesichtszüge einen nachdenklichen Ausdruck zeigten. »Ich sage
Ihnen, mit diesem Land geht es bergab. Es gibt keinen Respekt mehr
vor dem Gesetz. Und selbst auf den Stufen eines Gerichtsgebäudes
ist man nicht mehr sicher davor, einfach durch eine Kugel
niedergestreckt zu werden.«
»Monsieur Grenadille war ein Mandant von Ihnen«, stellte ich
sachlich fest.
»Allerdings!«
»Konnten Sie ihn nicht an seinem peinlichen Auftritt auf den
Stufen des Portals hindern?«
»Ich war immer jemand, der dem Gedränge und dem
Blitzlichtgewitter ausgewichen ist – Grenadille hingegen hat es in
dem Moment wahrscheinlich genossen.«
»Bis zu dem Augenblick, da ihm eine Kugel in den Schädel fuhr.
Sie waren zuvor schon einmal für Hugo Grenadille juristisch tätig.«
Watton nickte.
»Das dürfte aber schon ein paar Jahre her sein, Monsieur
…«
»Marquanteur«, stellte ich zum zweiten Mal vor und fragte mich
dabei, ob er nur so tat, als ob er sich meinen Namen nicht hatte
merken können und das vielleicht eine ganz bewusst eingesetzte
Geste der Geringschätzung war, mit der ich es da zu tun hatte, oder
ob er zeitweise wirklich so fahrig und vergesslich aufzutreten
pflegte. Meine Eindrücke im Gerichtssaal entsprachen dem jedenfalls
nicht. Mir fiel gleich die gerötete Nase auf. Möglich, dass er nur
einen Schnupfen hatte, aber da er während unseres gesamten
Gesprächs nicht einmal die Nase schnäuzte, tippte ich eher auf
einen anderen Grund für seine zerstörten Nasenschleimhäute. Im
Laufe der Zeit bekommt man einen Blick für eine durch das Schnupfen
von Kokain ruinierte Nase. Für einen Blütenpollenallergiker
schniefte er entschieden zu wenig und außerdem hätte er schon
ausgesprochen dämlich sein müssen, sich ausgerechnet eine Wohnung
zu nehmen, die nur ein paar Schritte vom Seepark entfernt
lag.
»Grenadille wurde von Ihrer ehemaligen Kanzlei aus erschossen.
Sie sind doch noch Mieter der Etage in dem zehnstöckigen Haus
gegenüber dem Gerichtsgebäude.«
»Aber nur noch für einen Monat«, erwiderte Watton. »Dann läuft
der Mietvertrag aus. Leider war es mir nicht möglich, vor dem Ende
der Kündigungsfrist einen Nachmieter zu benennen.« Er zuckte die
Achseln. »Die Zeiten werden härter, selbst für Anwälte, auch wenn
es keiner glauben mag.«
»Für Sie scheint das ja nicht zuzutreffen«, mischte sich
François in das Gespräch ein.
Wattons Augen verengten sich.
»Was wollen Sie damit sagen? Wollen Sie mir irgendetwas
anhängen? Dann kann ich Sie nur warnen.«
»Ich habe nicht die Absicht, mit Ihnen vor Gericht die Klingen
zu kreuzen«, schnitt ihm François das Wort ab. »Warum also so
empfindlich?«
»Was mein Kollege damit sagen wollte, ist lediglich, dass es
jemandem, der sich in einer Traumetage mit Blick auf den Seepark
zur Ruhe setzen kann, finanziell nicht gerade schlecht gehen kann«,
ergänzte ich.
»Meine Finanzen gehen Sie nichts an, und wie kommen Sie
überhaupt darauf, dass ich mich zur Ruhe gesetzt hätte?«
»Wie ein Büro sieht das hier nicht gerade aus«, stellte ich
fest.
»Ich bin mir sicher, dass ich nicht verpflichtet bin, Ihnen
diese Fragen zu beantworten.«
»Gut, dann beantworten Sie mir doch bitte eine andere.«
»Ich bin gespannt!«
»Wie kommt der Killer, der Grenadille auf dem Gewissen hat, an
den Schlüssel zu Ihren ehemaligen Kanzlei-Räumen?«
Watton sah mich völlig entgeistert an. Er schien fassungslos
zu sein.
»Wie bitte?«
»Sie haben meinen Kollegen schon richtig verstanden«,
bestätigte François. »Nach den Erkenntnissen der Spurensicherung
steht fest, dass der Täter einen Schlüssel hatte. Und eine der
Adressen, von denen er diesen Schlüssel haben könnte, sind
Sie!«
»Warten Sie!«, verlangte Watton. Er ging mit großen Schritten
auf eine Tür zu, schob sie zur Seite. Dahinter befand sich ein
weiterer Raum, der ebenfalls sehr spärlich, aber mit edlem Mobiliar
eingerichtet war.
Watton ging an einen kleinen Schrank, holte insgesamt drei
Schlüssel hervor und hielt sie François und mir wenige Augenblicke
später vor die Nase.
»Watton & Partner besaß drei Schlüssel, und hier sind drei
Schlüssel. Was wollen Sie mehr?«
»Was ist mit Ihren ehemaligen Teilhabern?«
»Ihre Schlüssel sind dabei. Mit der Abwicklung der Kanzlei
haben sie nichts mehr zu tun. Ich hatte es übernommen, mich um
einen Nachmieter zu kümmern, also habe ich die Schlüssel.«
»Geben Sie uns bitte die gegenwärtigen Adressen Ihrer
ehemaligen Teilhaber«, verlangte ich.
»Da wollen Sie also auch noch herumschnüffeln. Tun Sie es
ruhig! Die Adressen schreibe ich Ihnen auf.«
Ich wunderte mich etwas über Wattons feindselige, sehr nervöse
und dünnhäutige Art. Schließlich kannte er das Spiel doch bestens,
nur dass er diesmal nicht Verteidiger sondern Zeuge war. Zunächst
einmal. Wer konnte schon wissen, wie sich das weiter
entwickelte?
»Jeder von Ihnen hätte eine Kopie anfertigen können«, erklärte
ich.
»Ja sicher! Und außerdem der Besitzer des Appartementhauses
sowie jeder der Wachmänner, die ja Zugang zu Generalschlüsseln
hatten, um im Notfall in die Wohnungen eintreten zu können«,
verteidigte sich Watton. »Ich weiß nicht, welchen Strick Sie mir da
drehen wollen, aber daraus wird nichts. Sie fischen im
Trüben!«
Abwarten!, dachte ich. Die Verbindungen, die sich zwischen
Watton und unserem Fall ergaben, waren für meinen Geschmack zu
eindeutig, um auf Zufall basieren zu können. Welche Rolle er
allerdings in diesem Stück spielte, würden wir noch ermitteln
müssen.
»Erzählen Sie uns so viel wie möglich über Hugo Grenadille«,
verlangte ich schließlich. »Und natürlich über jeden, der einen
Grund haben könnte, ihn töten zu lassen!«
7
Am frühen Abend versuchten unsere Kollegen Léo Morell und
Josephe Kronbourg den »Wäscher von Pointe-Rouge« aufzutreiben.
Dragnea hatte mehrere Wohnungen über ganz Marseille verstreut. Es
gab verschiedene Residenzen, die er über Strohmänner gekauft hatte
und von deren Existenz nur sehr wenige Personen etwas wussten.
Manche munkelten, dass Dragnea von Paranoia befallen wäre,
andere waren der Überzeugung, dass er genug Feinde hatte, um gute
Gründe für seine Angst zu haben.
Aber trotz seiner Ängste hätte Dragnea niemals darauf
verzichtet, sich Abend für Abend in einem der Clubs zu zeigen, die
unter seiner Kontrolle standen. Das musste er schon deshalb tun, um
allen Konkurrenten deutlich zu machen, dass er nach wie vor die
Fäden in der Hand hielt und an ihm niemand vorbeikam, der in
Pointe-Rouge aus Schwarzgeld schneeweißes Investmentkapital zu
machen beabsichtigte.
Im Neuve Avangarde, einer Bar in einer Seitenstraße,
kontaktierten Léo und Josephe einen Mann namens René Thierry, der
hin und wieder als Informant für uns tätig war. Er glaubte zu
wissen, dass Dragnea den heutigen Abend im Buena Vista, einem
seiner derzeit angesagtesten Clubs, geplant hatte.
»Das ist eine angesagte Disco«, meinte Thierry. »Das Publikum
besteht zum Großteil aus gut betuchten Kunden. Die Preise sind
gepfeffert. Polizisten wie Sie können sich von Ihrem Spesenkonto
dort wahrscheinlich nicht einmal einen Tequila bestellen …« Thierry
kicherte in sich hinein, während Josephe Kronbourg dem Barkeeper im
Neuve Avangarde ein Zeichen gab, damit dieser Thierry das Glas
nachfüllte.
»Wie kommen Sie darauf, dass Dragnea heute dort ist?«, hakte
unterdessen unser Kollege Commissaire Léo Morell nach.
Thierry kicherte nur.
»Glauben Sie, ich gebe Ihnen meine Quelle preis, damit das
Geld, das ihr Polizisten in mich investiert, in Zukunft anderswohin
fließt?« Er schüttelte energisch den Kopf. »Ich mag vielleicht ab
und zu einen über den Durst trinken, aber das heißt noch lange
nicht, dass es hier oben bei mir schon aussetzt«, glaubte er und
tippte sich dabei mit dem Zeigefinger der rechten Hand gegen die
Schläfe. »Er ist dort, verlassen Sie sich drauf.«
»Ab wann?«
»Jetzt schon. Und ich habe noch etwas ziemlich Interessantes
gehört.«
»Und was?«, knurrte Josephe mäßig interessiert. Er wusste
nicht so recht, wie er die Qualität dieser Quelle nun eigentlich
einordnen sollte. In der Vergangenheit hatten wir von Thierry schon
so manchen wertvollen Tipp erhalten, aber in letzter Zeit war
nichts Brauchbares mehr unter seinen Informationen gewesen. Nichts,
worauf sich später irgendeine Festnahme oder ähnliches hätte
stützen lassen. Das meiste waren derzeit Gerüchte und Dinge, die
Thierry vom Hörensagen her wusste.
Er beugte sich vor, sprach plötzlich so leise, dass man ihn
kaum verstehen konnte.
»Dragnea soll, als er in den Lokalnachrichten des Fernsehens
von Grenadilles Tod gehört hat, eine Flasche seines besten
Champagners geköpft haben.«
»Und Sie waren dabei – oder woher wissen Sie das so genau?«,
fragte Josephe ungläubig.
»Wenn ich‘s Ihnen doch sage! Er hat sich gefreut, dass es
Grenadille erwischt hat!«
»Aber das passt doch nicht zusammen!«
»Weil Grenadille sein Mann fürs Grobe war?«
»Ja.«
Thierry kicherte abermals. Sein anschließendes Aufstoßen
sorgte dafür, dass sich schon einige der anderen Gäste im Neuve
Avangarde nach ihm umdrehten.
Léo Morell verdrehte die Augen, während er Josephe einen
kurzen Blick zuwarf, der soviel bedeutete wie: Aus dem Kerl kriegen
wir heute nicht mehr viel Vernünftiges heraus.
»Es soll in letzter Zeit zwischen Grenadille und seinem Herrn
und Meister ein paar Spannungen gegeben haben.«
»Genaueres!«, forderte Léo.
»Genaueres kann ich dazu nicht sagen. Aber das mit dem
Champagner stimmt. Das weiß ich von einem der Mademoiselles, die
mit am Tisch saßen.«
»Wie heißt die Frau?«
»Eines der Go-Go-Girls aus dem Buena Vista. Nennt sich
Dolores. Weiß der Geier, wie sie wirklich heißt. Die hat mir
übrigens auch erzählt, dass Dragnea ziemlich unerfreulichen Besuch
von Ben Toufique hatte.«
»Dem Koks-König von Pointe-Rouge?«, fragte Josephe.
»Genau.«
»Worum ging es?«
»Weiß ich leider nicht. Das Mädchen, von dem ich diese
brandheiße Story habe, wurde rausgeschickt. Aber Dragnea war
kreidebleich hinterher, und sein Hemd war von Blut besudelt. Wenn
Sie mich fragen, haben sich da zwei die Meinung auf ziemlich
unangenehme Art gesagt.« Thierry streckte die Hand aus. »Das ist
eine Story, die nur ein paar Stunden alt ist, dafür sollten Sie
etwas mehr springen lassen als den üblichen Satz, Monsieur
Kronbourg.«
8
Nachdem François und ich aus Germaine Watton nicht mehr viel
an brauchbaren Informationen herausholen konnten, suchten wir noch
Bastien Salvere und Jean Elloque auf, die beiden ehemaligen
Teilhaber von Watton & Partner. Elloque hatte sich ein
schmuckes Haus in Auban gekauft. Salvere war Teilhaber von Berlonge
& Partner geworden, einer der angesehensten Kanzleien in der
Umgebung, die Büros in zwanzig Städten unterhielt.
Sowohl Salvere als auch Elloque waren offenbar von Watton
vorgewarnt worden, und so waren ihre Antworten auf unsere Fragen
entsprechend einsilbig.
»Eigenartig, dass bei den ehemaligen Anwälten von Watton &
Partner plötzlich der Wohlstand ausgebrochen zu sein scheint«, fand
François, während wir schon auf dem Weg zurück zur Dienststelle
waren.
Dort wartete eine kurze Besprechung im Büro unseres Chefs auf
uns, an der außerdem noch die Kollegen Stéphane Caron, Fred Lacroix
und Boubou Ndonga teilnahmen. Monsieur Marteau hatte inzwischen
erste Ergebnisse auf seinem Schreibtisch. Danach war Grenadille mit
einem sehr ungewöhnlichen Kaliber getötet worden, bei dem es sich
offenbar um eine Spezialanfertigung handelte. Das Projektil war aus
Grenadilles Kopf isoliert worden und hatte bestimmt werden können.
»Unsere Kollegen haben mit Hilfe von SIS herauszufinden
versucht, ob überhaupt schon einmal mit einer Waffe, die diese
Projektile verschießt, ein Verbrechen verübt worden ist«,
berichtete Monsieur Marteau. »Die Antwort ist negativ. Daher
brauchen wir in diesem Fall noch nicht einmal den ballistischen
Bericht und dessen Abgleich mit einschlägigen Datenbanken
abzuwarten, um ausschließen zu können, dass der Killer mit dieser
Waffe schon mal aktiv war.«
»Was ist das Besondere an dem Projektil?«, fragte ich.
Monsieur Marteau kündigte an, dass unser Chef-Ballistiker
Davide Cherdan uns das am nächsten Morgen genauer auseinandersetzen
würde, denn daraus ergaben sich garantiert noch ein paar
Fahndungsansätze.
»Interessanter könnte die Automatik vom Kaliber fünfundvierzig
sein, mit der der Kerl auf Sie beide geschossen hat«, fuhr Monsieur
Marteau fort und wandte sich dabei an François und mich. »Unsere
Kollegen vom Erkennungsdienst konnten tatsächlich eines der
Projektile sicherstellen, was gar nicht so einfach war, wie Sie
sich denken können. Davide arbeitet noch an den Tests.«
Eines der Telefone auf dem Schreibtisch unseres Chefs
schrillte. Monsieur Marteau nahm den Hörer ab, sagte ein paar Mal
kurz und knapp »Ja!« und schloss mit dem Satz: »Verstärkung ist
unterwegs!«
Er wandte sich an uns.
»Das war unser Kollege Josephe Kronbourg. Er hat Niko Dragnea
in einem seiner Clubs aufgespürt, und jetzt braucht er noch ein
paar Leute, die ihm helfen, den Kerl im Auge zu behalten.«
Ich trank meinen Becher mit Kaffee aus. Melanie, die
Sekretärin unseres Chefs, war berühmt dafür, das beste Gebräu im
gesamten Polizeipräsidium zu kochen.
Mit einem Feierabend nach Dienstplan war heute wohl nicht zu
rechnen, und im Hinblick auf die zu erwartende lange Nacht war
diese Dosis Koffein sicher noch nützlich.
9
François und ich erreichten das Buena Vista. Die Neonreklame
dieses derzeit offenbar ziemlich angesagten Clubs blinkte bereits
auf. Der Betrieb musste hier vor Kurzem begonnen haben. Auffallend
viele teure Karossen waren in der Umgebung des Nobelclubs
abgestellt worden.
Ich folgte mit dem Dienstwagen, den uns die Fahrbereitschaft
des Polizeipräsidiums Marseille zur Verfügung stellte, einem
unscheinbaren metallicfarbenen Renault, in dem die Kollegen
Stéphane Caron und Fred Lacroix sowie Boubou Ndonga saßen. Stéphane
hatte bereits in der Vergangenheit im Umkreis des Buena Vista
ermittelt und daher traute ich ihm zu, dass er in den engen
Seitenstraßen noch eine Parkmöglichkeit finden würde.
Ein paar Minuten später stellte ich den Dienstwagen in eine
Parklücke am Straßenrand. Stéphane hatte den Renault etwa zwanzig
Meter von uns entfernt abgestellt.
François und ich stiegen aus. Stéphane, Boubou und Fred kamen
uns schon entgegen. Unsere Kollegin Mara Lautergne war bereits vor
uns hier eingetroffen, um Josephe und Léo zu unterstützen.
Stéphanes Handy schrillte. Er nahm das Gerät ans Ohr, murmelte
ein paar knappe Erwiderungen und sagte schließlich an uns
gerichtet: »Das war Josephe. Er hat Niko Dragnea bereits
ausgemacht. Er hängt mit ein paar Girls herum und war zuvor in eine
intensive Unterhaltung mit dem Rafi Hazrat verwickelt – dem
Strohmann, der mit Dragneas dreckigem Geld diesen Nobelschuppen
betreibt!«
»Interessanter ist für uns, was Dragnea macht, wenn er das
Buena Vista erst einmal verlassen hat«, meinte ich.
Wir mussten einfach wissen, in welchem seiner zahllosen
Schlupflöcher sich der Wäscher von Pointe-Rouge im Moment
vorwiegend aufhielt, mit wem er sich zur Zeit traf und so weiter.
Natürlich hätten wir Dragnea auch zum Verhör laden können, aber wir
waren nicht scharf auf die geglätteten, in Anwesenheit eines
Anwalts gegebenen Auskünfte, die wir unter diesen Umständen von
Dragnea zu erwarten hatten. Es war schließlich nicht das erste Mal,
dass er durch die FoPoCri oder durch Beamte der Polizei in der
einen oder anderen Sache vernommen wurde. Er war erfahren darin,
bei solchen Gelegenheiten extrem vorsichtig zu sein und keine
Äußerung fallen zu lassen, die ihn später in irgendeiner Form in
Schwierigkeiten bringen konnte.
Bei dieser Operation ging es darum, herauszukriegen, was
hinter den Kulissen für ein Spiel gespielt wurde. Grenadilles
Ermordung war vermutlich nur die Spitze eines Eisbergs, von dem
sich bekanntermaßen neun Zehntel unter der Wasseroberfläche
befinden.
Wir legten Kragenmikros und Ohrhörer an, um ständig Verbindung
untereinander zu haben.
»Im Moment sitzt Dragnea mit einigen jungen Frauen zusammen,
aber so richtig gut gelaunt kommt er mir eigentlich nicht vor«,
meldete sich Josephe Kronbourg über die Link-Verbindung. »Ist nur
so ein Gefühl, aber für meinen Geschmack zieht der Kerl hier nur
seine Show ab und will zeigen, dass er der große Hecht im
Karpfenteich ist, der alles im Griff hat. Aber irgendeine Laus ist
ihm über die Leber gelaufen.«
Der Empfang war hervorragend, was bei manchen Einsätzen in
unterirdischen Parkhäusern oder dergleichen schon mal schwierig
sein konnte.
»Vielleicht kommt die Laus da vorne gerade«, stellte ich fest.
Wir hatten gerade die Seitenstraße verlassen und befanden uns
auf der dem Buena Vista gegenüberliegenden Straßenseite. Eine lange
Stretchlimousine hielt vor dem Club. Sie war schneeweiß, so wie der
Anzug des schwergewichtigen Manns, dem von einem seiner Bodyguards
gerade aus dem Wagen geholfen wurde.
»Ben Toufique will den Abend ausgerechnet im Buena Vista
verbringen – wenn das nicht eine interessante Neuigkeit ist!«,
stieß Stéphane hervor.
»Zumal Toufique heute Nachmittag noch ziemlich mies auf
Dragnea zu sprechen gewesen ist, wenn wir unserem Informanten
trauen können, den wir in der Neuve Avangarde-Bar getroffen haben«,
war Josephes Stimme über Ohrhörer vernehmbar. »Angeblich soll
Toufique Dragnea übel zugesetzt haben.«
»Würde das nicht die angespannte Stimmung bei Dragnea
erklären?«, meinte Stéphane. »Vielleicht weiß er, dass sich heute
noch der Schneekönig von Pointe-Rouge die Ehre bei ihm gibt.«
»Toufique ist doch wahrscheinlich einer seiner wichtigsten
Kunden«, mischte sich François ein. »Warum sollte er schlechte
Laune bekommen, wenn er auftaucht?«
»Jedenfalls scheinen die beiden ihre Differenzen ausgeräumt zu
haben – worin sie auch immer bestanden haben mögen«, murmelte
Josephe.
Mara meldete sich von der anderen Straßenseite zu Wort.
»Hier steht eine Limousine mit laufendem Motor im Hinterhof«,
berichtete sie. »Ich schätze, das ist Dragneas Wagen.«
»Kannst du einen GPS-Sender anbringen?«
»Ich werde es versuchen, hätte aber gerne noch Verstärkung
hier.«
Stéphane wandte sich an François und mich.
»Macht ihr das? Wir müssen uns ohnehin auf die verschiedenen
Eingänge verteilen, damit er uns nicht durch die Lappen geht.«
Auf der anderen Straßenseite hatte inzwischen ein Mercedes
angehalten. Den Wagen kannte ich. Er stammte ebenfalls aus dem
Fundus unserer Fahrbereitschaft. Zwei junge Kollegen – Marcel
Lagrange und Alphonse Zephire waren die Insassen. Monsieur Marteau
hatte die beiden jungen Polizeischulabsolventen ebenfalls unserem
Observationsteam zugeteilt. Stéphane dirigierte sie in die Nähe der
Ausfahrtstraße des Hinterhofs, in dem sich Maras Angaben nach die
Limousine befand. Wenn es nicht gelang, die Limousine mit einem
GPS-tauglichen Sender zu bestücken, über den wir dann den Weg des
Wagens verfolgen konnten, musste dem Wagen jemand direkt auf den
Fersen sein.
Auf getrennten Wegen machten François und ich uns zu Maras
gegenwärtigem Standort auf. François marschierte mitten durch das
Buena Vista hindurch und hatte so Gelegenheit, den Auftritt des
großen Kokain-Königs Ben Toufique mitzubekommen.
Ich hingegen war gezwungen, einen ganzen Block zu umrunden. Da
ich nicht zu viel Zeit verlieren und noch rechtzeitig helfen
wollte, nahm ich einen Teil der Strecke in gemäßigtem
Jogging-Tempo.
Schließlich erreichte ich die Einfahrt zum Hinterhof.
Inzwischen war es ziemlich dämmrig geworden.
»Bleib am Beginn der Zufahrt stehen!«, riet mir unsere
Kollegin Mara über Funk. »Da läuft so ein Typ mit einer Uzi unter
dem Arm herum …«
Ich blieb an der Ecke, so wie Mara es mir geraten hatte. Aus
der Deckung heraus konnte ich alles beobachten. Josephe meldete,
dass Dragnea kurz mit Toufique sprach, der offenbar als
privilegierter Gast im Buena Vista behandelt wurde.
Eine halbe Stunde lang harrten wir auf unseren Posten aus,
ohne dass sich etwas tat.
Mara ging inzwischen auf die Limousine zu und tat dabei so,
als wäre sie etwas beschwipst und hätte Schwierigkeiten, sicher zu
gehen. Der Bodyguard drückte eine Zigarette aus und warf sie auf
den Boden. Etwas, wofür man nicht nur in Marseille schon eine
saftige Strafe zahlen muss, weil sich unsere Stadtregierung das
Ziel gesetzt hat, aus Marseille ein sauberes Pflaster zu machen.
Der Chauffeur, der am Steuer saß und bis dahin nervös mit den
Fingern auf dem Lenkrad herumgetickt hatte, drehte sich auch zu ihr
um.
»Was machen Sie hier?«, fragte der Bodyguard grob. Seine
rechte Hand ging augenblicklich zum Griff der Uzi, die er an einem
Riemen über der Schulter trug. »Los, verschwinden Sie!«
Mara simulierte einen Schluckauf.
»Kein Problem, ich habe mich hier wohl ein bisschen verlaufen
…«
»Kommt davon, wenn man den Hinterausgang benutzt.«
Mara machte einen ungeschickten Schritt, tat so, als würde sie
stolpern und landete direkt neben dem Hinterreifen links auf dem
Asphalt. Blitzschnell klebte sie den Sender unter den Wagen.
Der Uzi-Träger trat an sie heran, packte sie grob am Arm und
stellte sie wieder auf die Füße. »Hauen Sie ab! Am besten gehen Sie
einfach den Weg zurück, den Sie gekommen sind!«
»Aber – dann lande ich ja wieder im Buena Vista!«
»Klar! Das stimmt! Und dann lassen Sie sich vom Barkeeper ein
Taxi bestellen.«
Mara ließ sich das nicht zweimal sagen. Sie ging zurück zum
Hinterausgang, durch den sie gekommen war.
Ich stellte unterdessen fest, dass der Uzi-Träger nun schon
zum dritten Mal auf die Uhr schaute.
Endlich meldete Josephe, dass Bewegung in die Sache kam.
Dragnea brach auf.
»Er hat einen Anruf auf sein Handy gekriegt«, stellte Josephe
fest.
Wenig später meldete François, dass Dragnea den Korridor
passiert hatte, der zur Hintertür führte. Mara hatte sich
inzwischen längst wieder unter die Gäste des Buena Vista gemischt,
um nicht weiter aufzufallen.
Ich beobachtete, wie Dragnea ins Freie trat. Er schritt auf
die Limousine zu, nahm dabei sein Handy in die Hand und wählte eine
Nummer. Das Gespräch war sehr kurz. Er sagte höchstens einen Satz,
dann steckte er das Gerät weg.
Hinter ihm folgte ein breitschultriger Kerl mit weißblond
gefärbten Haaren. Er war breitschultrig, muskulös und gut einen
Meter neunzig groß. Auch er trug eine Uzi im Anschlag. Sein Kollege
öffnete die Hintertür der Limousine.
Plötzlich ging ein Ruck durch den Körper des Bodyguards. Er
sackte in sich zusammen und blieb reglos am Boden liegen. Auf
seiner Stirn hatte sich ein kleiner, roter Punkt gebildet.
Ein Einschussloch.
Aber es war kein Schussgeräusch zu hören gewesen.
Ein zweiter Schluss peitschte lautlos durch die Luft und
zerschmetterte den linken Außenspiegel der Limousine.
Dragnea hechtete sich in seinen Wagen und riss die Tür hinter
sich zu. Schüsse krachten jetzt laut durch den Innenhof. Der zweite
Leibwächter schaffte es gerade noch seine Uzi emporzureißen und
feuerte eine ziemlich ungezielte Salve auf die Fensterfronten der
oberen Stockwerke.
Ich rannte die Einfahrt zum Hinterhof entlang, riss die SIG
aus dem Holster. An der Ecke blieb ich stehen.
Dragnea hatte sich inzwischen im Wagen verkrochen. Der
Chauffeur startete. Die Reifen der Limousine drehten durch.
Ich machte einen Sprung nach vorne, während mindestens ein
Dutzend Kugeln in den gepanzerten Seitenscheiben hängen blieben.
Schüsse fetzten auch in den Reifen hinten links hinein. Die
Limousine brach aus, statt schnurgerade durch die Ausfahrt des
Hinterhofs hinauszuschießen, krachte sie gegen eine Wand.
Der Fahrer war nach vorn gegen das Lenkrad geprallt. Dabei
hatte sich der Airbag entfaltet.
Am Hintereingang des Buena Vista sah ich François und Mara
auftauchen.
Sie wurden sofort von einem der Fenster auf der
gegenüberliegenden Seite des Hinterhofs aus beschossen.
Eine MPi ratterte los. Die Kugeln rissen kleine Stücke aus der
Wand.
Dieser geballten Feuerkraft hatten François und Mara nichts
entgegenzusetzen.
Ich lief zu Dragneas Limousine, riss die hintere Tür auf.
Dragnea war benommen. Beim Aufprall des Wagens war er nach
vorn geschleudert worden und mit dem Kopf gegen die Trennscheibe
zur Fahrerkabine geprallt. Zumindest war dort sein verschmiertes
Blut zu sehen, während an Dragneas Kopf eine Platzwunde blutete. Es
sah allerdings schlimmer aus, als es tatsächlich war.
Der Fahrer kämpfte sich unter seinem Airbag hervor.
»Marquanteur, FoPoCri«, rief ich. »Bleiben Sie hier und rühren
Sie sich nicht! Unsere Leute sind in der Nähe!«
»Hey, Sie …«
»Rühren Sie sich nicht vom Fleck!«, wies ich ihn noch einmal
unmissverständlich an.
Auf der gegenüberliegenden Seite der Hinterhofeinfahrt gab es
eine Tür, die sich plötzlich einen Spalt breit öffnete. Das
Mündungsfeuer einer MPi blitzte auf. Ich warf mich zu Boden. Der
Kugelhagel pfiff über mich hinweg. Rechts und links schlugen die
Projektile gegen die Limousine, blieben in den Scheiben hängen und
bildeten dabei jeweils das Zentrum von feinen Rissen, die sich wie
Spinnenbeine verzweigten, oder prallten von der gepanzerten
Karosserie ab. Gefährliche Querschläger entstanden auf diese Weise.
Noch im Fallen hatte ich die SIG Sauer P 226 hochgerissen und
mehrfach gefeuert.
Am Boden feuerte ich noch einmal, diesmal mit einem genau
gezielten Schuss. Mein Gegner schrie auf. Im selben Moment verebbte
der MPi-Kugelhagel.