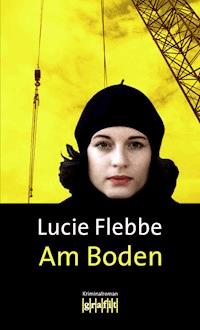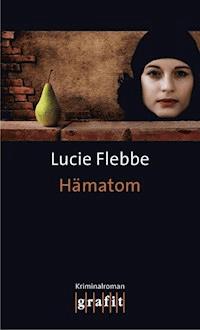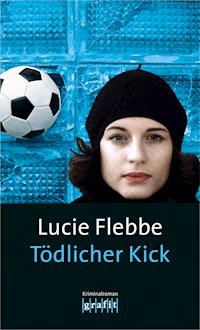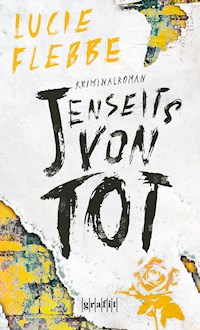Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GRAFIT
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lila Ziegler
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für die junge Detektivin Lila Zieger - einfach nur gut! Die junge Detektivin Lila und ihr Partner Ben Danner sollen herausfinden, ob hinter den ungewöhnlich hohen Todesfallzahlen eines Pflegedienstes mehr steckt als ein Zufall. Sie mischen sich unter das Betreuerteam. Über ein Blog lernt Lila sehr überraschende Seiten ihrer neuen Kolleginnen kennen. Doch dass eine Mörderin unter ihnen ist, schließt sie aus. Nicht nur, dass es mit dem Fall nicht richtig vorangeht, erhält Lila Besuch von ihrem Bruder. Und er kommt nicht in friedlicher Absicht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 301
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucie Flebbe
77 Tage
Kriminalroman
© 2012 by GRAFIT Verlag GmbH Chemnitzer Str. 31, D-44139 Dortmund Internet: www.grafit.de E-Mail: [email protected] Alle Rechte vorbehalten. Umschlagmotive: © Anna-Lena Thamm und © Friedberg – Fotolia.com eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck eISBN 978-3-89425-873-3
Die Autorin
Lucie Flebbe kam 1977 in Hameln zur Welt. Sie ist Physiotherapeutin und lebt mit Mann und Kindern in Bad Pyrmont. Mit ihrem Krimidebüt Der 13. Brief (noch unter dem Namen Lucie Klassen) mischte sie 2008 die deutsche Krimiszene auf. Folgerichtig wurde sie mit dem ›Friedrich-Glauser-Preis‹ als beste Newcomerin in der Sparte ›Romandebüt‹ ausgezeichnet. Es folgten: Hämatom und Fliege machen.
www.lucieflebbe.de
1.
Mein Herz rast.
Es ist eng in den Häuserschluchten der Bochumer Innenstadt. Und dunkel. Keine Straßenlaterne, kein beleuchtetes Fenster in Sicht. Einzig ein weit entfernter Mond taucht zwischen den Dächern der Hochhäuser auf, wirft sein fahles Licht auf das farblose Pflaster der Fußgängerzone und verschwindet schon wieder hinter Wolkenfetzen.
Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Außer mir ist um diese Zeit niemand unterwegs. Die Stille ist ungewohnt und mein Herzklopfen unnatürlich laut zu hören. Genau wie das Echo meiner Schritte, das die düsteren Fassaden auf mich zurückschleudern. Es gaukelt mir fremde Schritte vor.
Kann nicht sein. Ich bin allein.
Zur Sicherheit umfasse ich den stabilen Plastikschaft des Federhalters in meiner Jackentasche fester.
Ich nehme meinen Mut zusammen, bleibe stehen und sehe mich hastig um. Die Gassen enden im Schatten.
Da! Wieder höre ich die Schritte. Kein Echo, kein Zweifel, jemand folgt mir. Eindeutig. Und rasch.
Ich habe es geahnt. Ich renne los.
Mein Verfolger beginnt ebenfalls zu laufen, bemüht sich nicht mehr, seine Geräusche zu dämpfen. Das Echo schwillt an, seine Schritte und meine, seine immer lauter.
Der ferne Mond leuchtet über mir. Jetzt sehe ich den Mann, er ist groß und kräftig. Verdammt! Ich renne, so schnell ich kann, zwischen den eng stehenden Häusern hindurch, deren bröckelnde Mauern immer dichter zusammenzurücken scheinen. Doch mein Verfolger kommt mir immer näher. Schon kann ich seinen schnaufenden Atem hören, spüren, in meinem Nacken.
»Nein!«, schreie ich laut, wirbele herum und reiße in der gleichen Bewegung den Federhalter in die Höhe, wie einen Dolch. Der Mann steht direkt vor mir. Mondlicht streift sein Gesicht und ich glaube, es zu erkennen.
Mit aller Kraft ramme ich die scharfkantige Feder in seinen Körper, direkt vor der Nackenmuskulatur, an der Stelle, an der der Hals in die Schulter übergeht. Ich weiß, ich habe getroffen. Ich habe die lebenswichtigen Gefäße durchtrennt, die an dieser Stelle beinahe ungeschützt unter der Haut liegen.
Trotzdem presse ich die Waffe mit beiden Händen tiefer in die Wunde. Warmes Blut strömt über meine Finger, meine Unterarme hinunter, lässt den Federhalter glitschig werden. Auch als der schwere Körper kippt wie ein gefällter Baum, lasse ich nicht los …
Schweißgebadet fuhr ich hoch, sog keuchend Luft ein. Suchte das Blut an meinen Händen. Ich brauchte einen Moment, um mich zu orientieren, um zu begreifen, dass ich aufrecht im Bett saß. Im Schlafzimmer unserer Dachwohnung. Neben Danner.
Mal wieder hatte mich meine Vergangenheit heimgesucht, ein bisschen in meinem Schlaf herumgespukt, wie ein gelangweiltes Gespenst.
Mein Name ist Lila Ziegler, ich bin zwanzig Jahre alt und ich weiß, wie man einen Menschen tötet.
Ich presste die Knöchel meiner geballten Fäuste gegen meine Stirn. Die eiskalte Zimmerluft half mir, wach zu werden, während Danner murrend nach der dicken Daunendecke angelte, die ich in meiner Panik zur Seite geschleudert hatte. In einer Ecke der Fensternische pendelte eine dünne Spinne vor der beschlagenen Scheibe und mein hastiger Atem kondensierte milchigweiß in der eisigen Luft.
»Wird sowieso Zeit, dass wir aufstehen«, brummte Danner nach einem Blick auf den Wecker.
Wenig später hockte ich beim Zähneputzen auf der Kante der Wanne in unserem renovierungsbedürftigen Badezimmer und ließ meine nackten Waden von einem brummenden Heizlüfter wärmen. Die Wände waren altmodisch beige gefliest, mehrere Kacheln hatten Risse oder Löcher von Haken und Schränken, die längst nicht mehr hingen. Die Keramik von Waschbecken, Wanne und Klo hatte man im Kontrast zur Wandfarbe eine Nuance dunkler gewählt – kotbraun.
Wie jeden Morgen störte mich meine Frisur. Von der Wannenkante aus konnte ich meinen Kopf im Spiegel über dem Waschbecken betrachten. Für die Ermittlungen zu unserem letzten Fall hatte ich meine langen Haare kurzerhand abrasiert. Statt bis über meine Schultern zu zotteln, strubbelte mein Blondschopf neuerdings streichholzkurz in alle Richtungen. Gewöhnungsbedürftig.
Ohne die langen Haare konnte man mehr von mir sehen. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob das ein Vorteil war. Mein Kinn und meine Nase sahen noch spitzer aus und ich konnte mich nicht mehr hinter meiner Frisur verstecken, wenn es nötig war. Meine Haare fehlten mir mehr, als ich erwartet hatte.
Während das kleine Heizgerät weiter meine Füße wärmte, krabbelte eine Gänsehaut meine Oberschenkel hinauf bis unter meinen langen, lila Wollpulli. In unserer Wohnung herrschten so ziemlich die gleichen Temperaturen wie draußen. Um Strom zu sparen, hatte Molle, unser Vermieter, die Heizung ausgeschaltet. Anfang März ein wenig verfrüht, fand ich. Letzte Woche hatte es noch geschneit. Andererseits würde Molles Geiz womöglich spontan nachlassen, wenn Danner und ich mal wieder Miete zahlen würden. Doch unsere letzten Ermittlungen hatten uns zwar ein paar werbewirksame Schlagzeilen eingebracht, aber kaum die Kasse klingeln lassen.
Durch die Wohnzimmertür beobachtete ich, wie sich Danner ein dunkles T-Shirt über die Glatze zog. Mein Blick wanderte über seinen trainierten Rücken und blieb an seinem Hintern hängen. Mittlerweile hielt unsere Beziehung bereits ein halbes Jahr. Mehr oder weniger, in letzter Zeit eher mehr. Seit Neuestem hatte ich sogar einen Arbeitsvertrag, ein Gehalt und einen festen Wohnsitz hier in Bochum. Ich vögelte meinen Boss, aber ansonsten verlief mein Leben in für meine Verhältnisse erstaunlich geregelten Bahnen. Vielleicht benötigte ich meine langen Haare ja gar nicht mehr so dringend …
Pünktlich um halb zehn klingelte es an der Wohnungstür. So pünktlich, dass ich überlegte, ob die Person womöglich schon auf der Treppe gewartet hatte, bis der Zeiger ihrer Uhr umsprang.
Danner seufzte.
»Bock hab ich nicht auf den Job«, brummte er, während er sich auf den Weg zur Tür machte.
Hm. Also bei mir hatte das arktische Klima in unserer Wohnung deutlich mehr Arbeitseifer aufkommen lassen.
»Guten Morgen«, sagte die stämmige, kleine Frau, die vor unserer Wohnung im Treppenhaus stand. »Elsbeth van Pels mein Name. Wir haben telefoniert?!«
»Ben Danner, kommen Sie herein.«
Während ihres prüfenden Handschlags flitzten die wachen, grünlichen Augen der Frau hinter dem schmalen Silberrahmen ihrer Brille über Danners dunkle Kleidung, die kräftigen Unterarme, das unrasierte Gesicht und seine Glatze. Die hellgrauen Augenbrauen zuckten hinauf in ihre Stirn, doch ihre strenge Miene verriet nicht, ob der erste Eindruck des Privatdetektivs ihren Erwartungen entsprach. Oder vielleicht zu sehr?
Jedenfalls konnte Danners Schmuddellook die Frau nicht abschrecken. Sowieso wirkte sie wie jemand, der sich nur schlecht erschrecken lässt. Mit zackigen Schritten marschierte Elsbeth van Pels in unser extra aufgeräumtes Wohnbüro. Sie hielt sich sehr aufrecht, den Rücken durchgedrückt, konnte damit aber nicht über ihre geringe Körpergröße hinwegtäuschen. Wollte sie anscheinend auch nicht, denn sie trug sehr flache, sehr schlichte Schuhe.
»Und Sie sind …?«, erkundigte sie sich nach mir, während sie ihre Winterjacke mit Pelzbesatz über die Sessellehne hängte.
Sie war sicher über fünfzig und klappte zum Sprechen nur den Unterkiefer hoch und runter, wodurch sie an einen altertümlichen Holznussknacker erinnerte, der den Mund öffnete, wenn man den Hebel an der Rückseite bewegte.
»Meine Mitarbeiterin Lila Ziegler«, stellte Danner mich vor.
Wieder hob die Klientin, die noch gar keine war, ihre Brauen über den Rand der Brille. Ihre ungeschminkten Lippen pressten sich aufeinander, als hätte sie gerade eine Nuss zerbissen. Ich entsprach definitiv nicht den Erwartungen, die sie an eine einigermaßen fähige Detektivin stellte.
Trotzdem saß mir Elsbeth van Pels gleich darauf gegenüber in unserem alten, grauen Sessel. Wie ein Ringer in Kampfposition stellte sie die Füße breit und fest auf den Boden, die Ellenbogen stützte sie auf die Knie.
Danner platzierte einen Kaffeebecher vor ihr auf der Marmorplatte des Couchtisches. Der heiße Dampf stieg in hellen Wolken in der kalten Luft unseres ungeheizten Wohnzimmers auf. Elsbeth van Pels zog ihre Jacke wieder an, während ihr forschender Blick erneut wanderte. Über unseren beinahe aufgeräumten Schreibtisch, das von Akten überquellende Regal, den fleckigen Teppich. An einer leeren Bierflasche auf einem Pizzakarton, den wir beim Aufräumen neben dem Computer übersehen hatten, blieb ihr Blick hängen.
Danner hatte sich den Schreibtischstuhl herangerollt: »Was führt Sie zu uns?«
Elsbeth van Pels brach ihre Zimmerinspektion ab. »Ich bin durch einen Zeitungsartikel auf Ihre Detektei aufmerksam geworden. Sie haben doch diesen Korruptionsfall im Otto-Ruer-Klinikum aufgeklärt, nicht wahr?«
»Das war Frau Zieglers Fall, ja«, bestätigte Danner.
Die stämmige, kleine Frau wandte sich mir zu. Einen Augenblick lang betrachtete sie meine geringelten Wollsocken.
»Diskretion hätte in meinem Fall oberste Priorität«, erklärte sie dann meinen Füßen.
»In jedem Fall«, berichtigte Danner.
»Ich spreche von wirklicher Geheimhaltung.« Ihre Stimme wurde eine Spur schärfer. »Top secret sagt man wohl in Ihrer Branche.«
Danners Miene blieb unbewegt.
»Gut«, sagte Elsbeth van Pels, als er schwieg. »Ich bin mir nicht sicher, ob es sich überhaupt um einen Fall handelt. Besser, wenn nicht.« Die Schärfe ihrer Stimme wich einer überraschenden Unsicherheit. Statt mit Danner sprach sie lieber wieder mit meinen Socken. »Es ist nur – wie soll ich sagen – ein Verdacht.«
Sie klappte den Mund ein paarmal auf und zu, ohne dass weitere Worte herauskamen.
»Vielleicht bilde ich mir auch nur etwas ein …«, fügte sie dann doch noch hinzu. »Hoffentlich.«
»Genau das könnten wir für Sie herausfinden«, bemerkte Danner, allmählich amüsiert. »Dabei wäre es natürlich von Vorteil, wenn wir wüssten, worum es geht.«
»Wie gesagt, ich bitte um absolute Diskretion«, wiederholte Elsbeth van Pels. Plötzlich schien ihr die Kälte zuzusetzen. Sie griff nach dem dampfenden Kaffeebecher und umschloss die warme Keramik mit den Fingern. »Ich bin kaufmännische Leiterin des ambulanten Pflegedienstes Sonnenschein. Wir sind einer der größten Pflegedienstleister im Ruhrgebiet, haben außer in Bochum Zweigstellen in Gelsenkirchen, Essen, Kamen und Unna. Mittlerweile bin ich seit über vier Jahren Geschäftsführerin. Qualität …«, sie machte eine bedeutungsvolle Pause, »… Qualität hat für mich schon immer den höchsten Stellenwert gehabt. Deshalb habe ich gleich zu Beginn meiner Tätigkeit – schon vor der gesetzlichen Verpflichtung – ein Qualitätsmanagement eingeführt. Kennen Sie sich damit aus?« Ihr Mund klappte zu und sie sah unvermittelt von meinen Socken hoch zu Danner.
»Sie prüfen und optimieren die Arbeitsabläufe und legen Standards fest«, nickte der.
Die skeptischen Falten um den Mund der Klientin in spe wurden etwas weicher. Danner vermittelte anscheinend einen durchaus kompetenten Eindruck.
Ein etwas schmuddeliger, aber cleverer Privatschnüffler war vermutlich genau das, was die meisten Klienten suchten. Einen Augenblick lang überlegte ich, ob Danner sich womöglich aus geschäftsfördernden Gründen nicht rasierte. Ich betrachtete die kurz geschorenen Resthaare in seinem Nacken.
Nein, er war von Natur aus unrasiert.
Von seinen Resthaaren wanderte mein Blick zu meinen Wollsocken. Eine kaum volljährige Wollsockenträgerin hingegen erwarteten die meisten Klienten eher nicht. Ich war eine unschöne Begleiterscheinung.
»Bei den jährlichen Qualitätsprüfungen ist mir eine Kennzahl immer wieder aufgefallen. Im ersten Jahr dachte ich mir nichts dabei. Im zweiten Jahr glaubte ich an einen Zufall. Im dritten Jahr meinte ich, es könnte auf eine fehlerhafte Dokumentation zurückzuführen sein. Aber als der Wert bei der letzten Qualitätsprüfung im Dezember wieder aus dem Rahmen fiel, wurde mir klar, dass ich die Ursache herausfinden muss. Doch einfach nachfragen kann ich nicht. Da bin ich auf den Artikel über Ihre Ermittlungen im Otto-Ruer-Klinikum gestoßen und kam auf die Idee, Sie sozusagen undercover als Mitarbeiter einzustellen. Zur Tarnung.«
Offensichtlich hatte sie sich auf das Gespräch vorbereitet und sich über die Fachausdrücke informiert. Mithilfe überwiegend amerikanischer Fernsehserien.
»Die Mitarbeiter brauchen das nicht zu wissen, ich möchte ja niemandem etwas unterstellen. Und wenn Sie meinen Verdacht nicht bestätigen können, verschwinden Sie einfach wieder, ohne dass ich das ganze Team in Aufregung versetzen musste.«
»Genau das wäre unser Job«, nickte Danner unserer potenziellen Brötchengeberin aufmunternd zu. Selbst wenn er noch immer keine Lust auf den Auftrag hatte, war er offensichtlich neugierig geworden. Es machte ihm Spaß, herauszukitzeln, worum es genau ging.
»Um was für eine Kennzahl handelt es sich?«
Elsbeth van Pels erkannte, dass sie sich nicht mehr hinter ihrem Wirtschaftschinesisch verstecken konnte. Wieder klappte ihr Unterkiefer herunter.
»Die Kennzahl, ja, natürlich – also, es handelt sich um einen Wert, der bei allen unseren Pflegediensten jährlich erhoben wird. Unsere Zweigstelle hier in Bochum ist von der Größe, der Kunden- und Mitarbeiterzahl gut mit den Zweigstellen in Essen und Gelsenkirchen vergleichbar. Trotzdem liegt dieser Wert in Bochum regelmäßig um etwa zwanzig Prozent höher …«
Immer schön drum herum marschieren, um den heißen Brei.
»Welcher Wert?«, beharrte Danner auf einer Antwort.
»Wie? Ach so, ja natürlich. Es ist – ähm …« Sie senkte die Stimme, als hätte sie Angst, dass ein Fassadenkletterer vor unserem Fenster unterwegs war und zufällig mithörte.
»Es ist die Anzahl der Todesfälle«, flüsterte sie.
Ich hob den Kopf.
Einen Augenblick lang hallte der Satz wie ein Echo durch unser Wohnzimmer.
Danner verzog keine Miene, doch sein Schweigen verriet, dass auch er diese Antwort überdenken musste.
»Sie meinen, in einem Ihrer Pflegebezirke sterben mehr Patienten als in den anderen?«, vergewisserte ich mich.
»Ziemlich genau zwanzig Prozent mehr«, informierte die Geschäftsführerin, jetzt wieder mit der gewohnten Präzision.
Wow!
»Das kann natürlich alle möglichen Gründe haben!«, fügte sie rasch hinzu.
Klar, es konnte am Trinkwasser, am AKW Hamm-Uentrop, an kosmischer Strahlung oder dem unerträglichen Fernsehprogramm liegen, dass die alten Leute sich reihenweise aus dem Diesseits verabschiedeten.
Doch die Bilder, die die Pflegedienstchefin vermeiden wollte, drängten sich mit Macht in meinen Kopf. Zeitungsartikel über Pfleger oder Ärzte, die aus vermeintlichem Mitleid schwerstkranke Patienten töteten. Immer wieder hörte man davon. Der Super-GAU für jede medizinische Einrichtung. Kein Wunder, dass unsere Geschäftsführerin ins Stottern geriet und die Ermittlungen um jeden Preis ›top secret‹ halten wollte.
»Womöglich gibt es eine ganz banale Erklärung«, hoffte Elsbeth van Pels. Doch die Sorgenfalten auf ihrer Stirn verrieten, dass der weiß bekittelte Todesengel längst auch durch ihre Gedanken spukte. Vermutlich schon seit ein paar Jahren. Und mit ihm die Schlagzeilen, in die ihr Unternehmen unweigerlich geraten würde, wenn an dieser Vermutung etwas dran war.
»Aber allein die Aufregung, die gerade in unserem Dienstleistungsbereich möglicherweise durch so eine Geschichte entsteht, kann den Ruin für unser gesamtes Unternehmen bedeuten.«
Genau.
»Zuletzt ist diese Dame hier verstorben.« Die Pflegedienstleiterin schob ein Foto über den Tisch. Es zeigte eine grauhaarige Oma in einer zur Haarfarbe passenden Strickjacke, die mit ausdrucksloser Miene in die Kamera blickte. »Unsere Klientin Frau Brandstetter, sechsundneunzig Jahre alt. Verstarb nach einem unglücklichen Sturz auf die Kante eines Glastisches. Eine Mitarbeiterin fand sie am nächsten Morgen in ihrer Wohnung.«
»Oje«, machte ich automatisch.
»Das kommt schon mal vor, Frau Ziegler«, belehrte mich Elsbeth van Pels verständnislos. Anscheinend hatte ich erkennen lassen, dass ich mich in meiner sorglosen Jugend noch nicht damit hatte beschäftigen müssen, dass alte Menschen letztendlich irgendwann zu Tode kommen.
Kam so etwas oft vor?, überlegte ich. Lagen womöglich noch mehr einsame, alte Menschen tot in den Wohnungen der Bochumer Innenstadt? Womöglich nur wenige Meter von uns entfernt, ohne bemerkt zu werden?
Elsbeth van Pels tat jedenfalls, als wäre der Tod ihr Tagesgeschäft. Trotzdem war sie aber genau deswegen hier.
»Weil dieser Fall mit sehr viel Blut verbunden war, hat sich die Polizei die Sache angesehen«, fuhr Elsbeth van Pels fort. »Der Arzt wollte eine Fremdeinwirkung nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Aber die Ermittlungen wurden eingestellt. Ein Sturz ist in dem Alter nicht ungewöhnlich.« Sie zögerte, bevor sie weitersprach. »Ungewöhnlich ist allerdings, dass Frau Brandstetter bereits der vierte Todesfall im Bezirk Bochum in diesem Jahr ist. Und wir haben erst März. Ich möchte, dass Sie die Ursache der vermehrten Todesfälle ermitteln. Ob dieser Umstand mit unserem Unternehmen zusammenhängt – oder besser, dass nicht. Wie sind Ihre Konditionen?«
»Fünfhundert Euro am Tag plus Spesen«, erklärte Danner schnell.
Ich verzog keine Miene, obwohl mir die spontane Erhöhung unseres Tagessatzes keineswegs entgangen war. Die Frage war, ob Danner bei dem zahlungskräftigen Unternehmen einfach ein Taschengeld rausschlagen wollte. Oder wollte er die Frau abschrecken, weil er noch immer keine Lust auf diesen Job hatte?
Doch wie gesagt, Elsbeth van Pels ließ sich schlecht erschrecken: »In Ordnung.«
»Und eine Anzahlung von zweitausend«, ergänzte Danner rasch. »Vorausgesetzt, wir übernehmen Ihren Auftrag.«
Die Pflegedienstleiterin musterte Danner mit scharfem Blick, doch sein Gesicht blieb weiterhin unbewegt.
»Selbstverständlich«, nickte Elsbeth van Pels ebenfalls mit Pokerface, zog eine große Geldbörse aus der Innentasche ihrer Jacke und begann, einen grünen Schein nach dem anderen neben den Kaffeebecher auf unseren Couchtisch zu legen.
Ich riss die Augen auf und sogar Danner legte jetzt interessiert den Kopf schief.
»Und übernehmen Sie den Auftrag? Herr Danner? Frau Ziegler?«, erkundigte sich Elsbeth van Pels, ohne mit dem Hinblättern der Geldscheine aufzuhören.
Danner sah zu mir herüber.
Der Fall versprach Arbeit für ein bis zwei Wochen und sicherte unsere Miete für das nächste halbe Jahr. Ich sah keinen Grund, der dagegen sprach, Molle zum Wiedereinschalten der Heizung zu bewegen.
Tag 0
BELLAS BLOG:
DONNERSTAG, 23.15 UHR
Es ist Donnerstag. Kurz nach elf.
Und dies ist mein Hochzeitstag. Ich habe geheiratet. Heute.
Absurd. In meiner Hochzeitsnacht habe ich nichts Besseres zu tun, als mit dem Tagebuchschreiben zu beginnen.
In meinem ganzen Leben habe ich noch kein Tagebuch geführt. Mit fünfzehn habe ich mal eines geschenkt bekommen. Ein rosa Büchlein mit Vorhängeschloss am Einband. Ich habe es nicht benutzt. Ich war einfach nicht gut im Schreiben. Und auch nicht besonders sorgfältig. Bin ich bis heute nicht.
Doch manches ändert sich mit der Zeit. Ich bin jetzt zweiunddreißig. Besitze ein Notebook. Meine Einträge blogge ich im World Wide Web. Mitten in der Nacht werde ich zur anonymen Exhibitionistin.
Ausgerechnet ich. Lächerlich. Normalerweise bin ich das Gegenteil. Schüchtern. Unauffällig. Spießig wahrscheinlich.
Aber ich muss das hier loswerden! Sonst laufe ich Amok! Die betrunkenen Hochzeitsgäste unten im Wohnzimmer wären leichte Opfer. Und verdient hätten sie es allesamt.
Der schönste Tag im Leben. Und ich bin nicht glücklich. Trotzdem erwartet man noch stundenlanges Lächeln von mir.
Warum bin ich nicht glücklich?
Weil ich mir meine Hochzeit anders vorgestellt habe.
Und weil ich vor einem Spiegel sitze. Sogar an meinem Hochzeitstag sehe ich unmöglich aus. Weil ich, wie gesagt, inzwischen zweiunddreißig bin. Ich kann zusehen, wie mein Hintern dicker wird. Meine Brille vergrößert meine Krähenfüße. Und neuerdings habe ich eine Krampfader. Das fehlte mir noch zu meinem Glück. Bisher waren meine Beine das Erfreulichste an meinem Spiegelbild.
Mein Gesicht und mein Hintern sind zu breit. Ich bin nicht wirklich dick. Aber mein Gesicht und mein Gesäß sehen aus, als hätte ich zwanzig Pfund Übergewicht.
Und eine wahre Katastrophe sind meine Haare. Sie hängen kraftlos herunter. Wie Spaghetti. Busen habe ich zu wenig. Po, wie gesagt, zu viel. Bleiben die Beine. Womit wir wieder bei der Krampfader wären.
Mario hat mich nicht wegen meines Sexappeals geheiratet.
Warum dann? Diese Frage stellen sich sicher die meisten Menschen, die uns kennen. Viele denken, Mario habe sich einfach an mich gewöhnt. Einige Kumpel glaubten bisher, ich würde abends in Strapsen strippen. Ein Irrtum, den meine Mutter vor zehn Minuten aus der Welt geschafft hat.
Auch für meine Mutter ist meine Ehe ein Rätsel. Bis gestern hatte sie noch Zweifel, ob die Feier tatsächlich stattfinden würde. Dieser Traum von Schwiegersohn will ausgerechnet mich? Sie hat nie viel davon gehalten, ihre Meinung für sich zu behalten. Sie ist einen Kopf kleiner als ich. Wiegt das Doppelte. Und findet es normal, mit einem pinkfarbenen Turban zu meiner Hochzeit zu erscheinen.
Daran bin ich natürlich selbst schuld. Eine Kleiderordnung hielt ich für überflüssig. Naiverweise. Nach zehn Jahren Beziehung feiern wir im kleinen Kreis. Familie und Freunde. Standesamt heute Morgen. Mittags zum Lieblingsitaliener. Abends Sekt zu Hause.
Aber meine Mutter kenne ich seit zweiundreißig Jahren. Mit dem Turban hätte ich rechnen können.
Nicht rechnen konnte ich hingegen mit der Unterhose. Mit spitzen Fingern hat meine Mutter sie aus den Tiefen einer Ritze zwischen den Sofapolstern gezogen. In die sie bei meiner großangelegten Wäschebeseitigungsaktion der letzten Woche geraten sein muss. Die verschiedenfarbigen Trocknerladungen hatten die Couch gefüllt. Und zum Fernsehen hatte ich mich einfach draufgesetzt.
Ein Fehler, wie mir jetzt im Nachhinein klar ist.
Warum passieren mir solche Dinge?
Vielleicht wäre es nicht so schlimm gewesen, hätte es sich um einen durchsichtigen Spitzenstring gehandelt. Aber ich habe nie zu den Frauen gehört, die Reizwäsche unter Jeans verbergen. Ich bin wirklich langweilig. Drüber und drunter. Beim Fundstück meiner Mutter handelte es sich um ein hässliches Baumwollungetüm. In der Größe meines Hinterns.
Mario lachte am lautesten.
Übrigens immer, wenn so etwas passiert. Nachsichtig tätschelt er mir den Kopf. Wie einem begriffsstutzigen Pudel, der einfach nicht Männchen machen will.
Seine Meinung: »Bella hat den Brüller des Abends gelandet.«
Mal wieder.
»Wenn du je lernst, wie man einen Haushalt führt, haben unsere Gäste nichts mehr zu lachen.«
Das stimmt. In Sachen Hausarbeit bin ich keine Leuchte.
Ein weiterer Grund, warum meine Mutter unsere Beziehung nicht begreift. Mein Sexappeal und meine Hausfrauenqualitäten sind es nicht, die mich attraktiv machen. Und für meine Mutter sind diese beiden Punkte die Grundlagen einer Ehe.
Trotzdem gibt es etwas, was Mario an mir mag. Auch heute noch. Er ist noch immer aufmerksam. Liest mir jeden Wunsch von den Augen ab.
Ich würde gern mal wieder ins Musical gehen, sagte ich letzte Woche. Die Karten steckten heute im Hochzeitsstrauß.
Fast bekomme ich jetzt ein schlechtes Gewissen. Dass ich mich überhaupt beschwere. Mario ist nicht mehr ganz so charmant wie zu Beginn unserer Beziehung. Aber das kann man nach zehn Jahren auch nicht ernsthaft erwarten.
Immerhin schenkt er mir regelmäßig Blumen. Trotz Slip im Sofa. Trotz Krampfader.
Vielleicht kann ich doch wieder hinuntergehen.
Ohne meine Mutter mit der Unterhose zu erwürgen …
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!