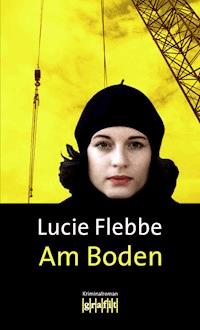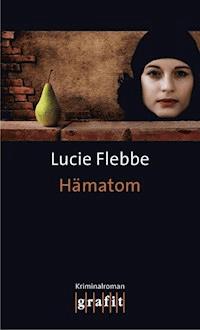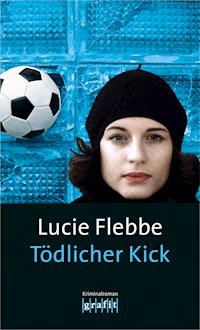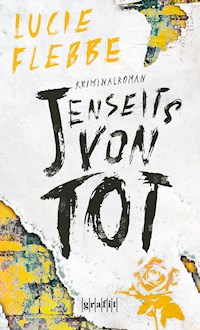
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grafit Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Eddie Beelitz
- Sprache: Deutsch
Das furiose Finale der Trilogie der Friedrich-Glauser-Preisträgerin Privat läuft es für Kriminalkommissarin Eddie Beelitz. Dem beruflichen Vorankommen allerdings steht ihre Teilzeitregelung im Weg. Das ändert sich schlagartig, als auf einem alten Zechengelände eine Leiche gefunden wird und die Staatsanwältin Eddie ausdrücklich ins Ermittlerteam beruft. Nachforschungen ergeben, dass die Tote, die in der Immobilienbranche arbeitete, etliche Feinde hatte. Zudem stößt Eddie auf eine Intensivpflege-Wohngemeinschaft, in der die Mutter der Ermordeten untergebracht werden sollte. Da die Polizei dort alles andere als willkommen ist, bittet Eddie ihren Freund Jo Rheinhart alias "Zombie" um Hilfe, der den Leiter der Einrichtung kennt. Als Zombie während der Ermittlungen auf einen alten Feind trifft, holt ihn sein dunkelstes Geheimnis ein. Wird ihm seine Vergangenheit zum Verhängnis?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucie Flebbe
Jenseits von tot
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2019 by GRAFIT im Emons Verlag GmbH
Cäcilienstr. 48, D-50667 Köln
Internet: http://grafit.de
E-Mail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Diego Schtutman (Plakatwand), Krasoovski Dmitri (Mauer), Ana Babil (Typ), oleschwander (Rose), Sharif Hidayatulloh (Löwenzahn)
eBook-Produktion: CPI books GmbH, Leck
eISBN 978-3-89425-750-7
ÜBER DIESES BUCH
Privat läuft es für Kriminalkommissarin Eddie Beelitz. Dem beruflichen Vorankommen allerdings steht ihre Teilzeitregelung im Weg. Das ändert sich schlagartig, als auf einem alten Zechengelände eine Leiche gefunden wird und die Staatsanwältin Eddie ausdrücklich ins Ermittlerteam beruft. Nachforschungen ergeben, dass die Tote, die in der Immobilienbranche arbeitete, etliche Feinde hatte. Zudem stößt Eddie auf eine Intensivpflege-Wohngemeinschaft, in der die Mutter der Ermordeten untergebracht werden sollte. Da die die Polizei dort alles andere als willkommen ist, bittet Eddie ihren Freund Jo Rheinhart alias ›Zombie‹ um Hilfe, der den Leiter der Einrichtung kennt. Als Zombie während der Ermittlungen auf einen alten Feind trifft, holt ihn sein dunkelstes Geheimnis ein. Wird ihm seine Vergangenheit zum Verhängnis?
DIE AUTORIN
Lucie Flebbe, geb. 1977 in Hameln, ist Physiotherapeutin und lebt mit Mann und Kindern im Weserbergland. Mit ihrem Krimidebüt ›Der 13. Brief‹ mischte sie 2008 die deutsche Krimiszene auf. Folgerichtig wurde sie mit dem ›Friedrich-Glauser-Preis‹ als beste Newcomerin in der Sparte ›Romandebüt‹ ausgezeichnet. Die Geschichte der Detektivazubine Lila Ziegler lässt sich über acht weitere Romane verfolgen.
›Jenseits von tot‹ ist der dritte Teil einer Trilogie um die Kriminalkommissarin Eddie Beelitz. Band eins heißt ›Jenseits von Wut‹, Band zwei ›Jenseits von schwarz‹.
www.lucieflebbe.de
ZOMBIE
Scheiße, ich war nicht bei der Sache! Für einen Sekundenbruchteil waren meine Gedanken abgedriftet. Zum Gerichtstermin und zu dem Plastikkästchen in meiner Hosentasche.
Jetzt war meine Deckung nicht rechtzeitig oben!
Die Quittung bekam ich sofort, denn mein Gegner hatte trainiert. Das Tempo seiner rechten Geraden hatte sich in den letzten Monaten bemerkenswert verbessert. Der zerschlissene, rote Boxhandschuh schnellte auf meine Schläfe zu.
Dana würde ausrasten, wenn sie wüsste, dass ich in den Ring stieg. Garantiert verstand sie etwas anderes darunter, »das Risiko, einen Schlag gegen den Kopf zu bekommen, so gering wie möglich zu halten«, wie sie es mir dreihundertfünfzigtausend Mal eingeschärft hatte.
Erst recht, weil der Typ, der gerade zum ersten Mal in seinem Leben eine echte Chance hatte, mich auszuknocken, mir mit ein bisschen schlechter Laune die Schuld am Tod seiner kleinen Schwester geben könnte.
Bevor mir sein Schlag wirklich gefährlich wurde, hielt Lars inne. Grinsend ließ er die Fäuste sinken.
»Du vögelst zu viel und trainierst zu wenig, Boss.« Der bullige Kerl wischte sich eine verschwitzte, dunkelrote Haarsträhne aus dem Gesicht.
Da war was dran.
»Ohne unsere wöchentliche Trainingssession würdest du doch heute noch wie Klitschko in Slow Motion zuschlagen«, konterte ich trotzdem gewohnheitsmäßig.
»An deiner Stelle würde ich öfter mal ein paar Trainingseinheiten einschieben. Sonst versohle ich dir nächste Woche deinen untoten Arsch«, witzelte Lars.
Ich schnalzte mit der Zunge. Vielleicht machte ich das wirklich. Einfach so. Zum Spaß.
Seltsamer Gedanke. Ich brauchte den Sandsack seit Monaten nicht mehr, aber in meinem Kopf war der Sport noch immer mit der Wut verknüpft. Das Training war Mittel zum Zweck, um mich abzureagieren, um die Kontrolle zu behalten.
Und jetzt war es ausgerechnet Lars Bleier, der mich darauf hinwies, dass normale Leute tatsächlich zum Spaß trainierten, einfach nur, um sich fit zu halten.
Es war eine abgefahrene Idee gewesen, ausgerechnet ihn zum Geschäftsführer vom Jenseits zu machen. Ich hatte die alte Boxbude von meinem Kumpel Freddie geerbt, aber es hatte Monate gedauert, bis ich mich nach seinem Tod getraut hatte, wieder einen Fuß hineinzusetzen. Da war der Laden schon ziemlich abgewrackt gewesen.
Doch inzwischen hatte Lars die Eingangstür repariert, ein paar Sandsäcke ausgetauscht und Matten besorgt, die beim Sprungtraining unebenen Boden simulierten. Im vorderen Bereich hatte er eine komplette Wand verspiegeln lassen.
So viel Eigeninitiative hatte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich ließ ihn machen, was er wollte. Und vielleicht musste ich ihm statt eines Gehalts irgendwann eine Beteiligung anbieten.
Eine Horde lärmender Teenager riss mich aus meinen Gedanken. Die Kids warfen ihre Rucksäcke in die Hallenecke vor der neuen Spiegelwand. Lars’ jüngere Brüder Silvio und Danielo schmissen die Soundanlage an und dumpfe Bassbeats ließen die Wände vibrieren.
Ich streifte die Handschuhe ab und bückte mich aus dem Ring.
Nach seiner steilen Hartz-IV-Karriere hatte Lars selbst wohl am wenigsten damit gerechnet, mit über dreißig sein eigenes Ding zu machen, noch dazu in einem Job, auf den er tatsächlich Bock hatte.
Jetzt hatte er sogar seine ebenfalls arbeitsscheuen jüngeren Brüder drangekriegt. Die beiden lockten drei Mal pro Woche Teenies mit Hip-Hop-Kursen in den Laden.
»Was ist jetzt?« Lars lehnte sich über die Seile. »Ich brauche einen Gegner, kein Opfer. Sieh zu, dass du von deiner Schnecke runterkommst und die Hanteln bewegst.«
»Wenn ich hier selbst den Deko-Gorilla machen wollte, bräuchte ich dir nicht so viel Kohle rüberschieben, oder?«, entgegnete ich.
Ich hatte Besseres zu tun. Meine Hand tastete nach dem Plastikkästchen in meiner Hosentasche.
EDDIE
Philipp schwieg.
Ich presste die Hände auf die Oberschenkel, damit sie meine Nervosität nicht verrieten.
Mein Noch-Ehemann wirkte wie immer jungenhaft attraktiv in seinem dunklen Anzug, zu dem er ein orangefarbenes T-Shirt trug, das perfekt zu seinen roten Locken passte. Nur die unnatürlich eckige Form seiner blauen Augen verriet seinen noch immer schwelenden Zorn.
Weil Philipp nicht antwortete, sah der Richter irritiert von seinen Unterlagen auf.
Mir brach der Schweiß aus. Wenn Philipp jetzt behauptete, dass er noch eine Chance für unsere Ehe sah, dann würde der nächste Scheidungstermin erst nach zwei weiteren Trennungsjahren angesetzt werden. Bei der Hochzeit erzählt dir niemand, wie schwer es ist, aus einer Ehe wieder herauszukommen.
Philipp hatte es mit der Scheidung nicht eilig gehabt. Ich hatte den Anwalt beauftragt, ich hatte auf die Klärung der Rente gedrängt.
Philipp hingegen hatte auch ein Jahr nach meinem Auszug nicht verdaut, dass ich nicht auf Knien zu ihm zurückgekrochen war. Mal ganz davon zu schweigen, dass ich inzwischen mit seiner Tochter mit einem anderen Mann zusammenlebte. Das war auch der Grund, aus dem ich Zombie gebeten hatte, nicht mitzukommen. Ich wollte Philipps Laune nicht unnötig verschlechtern.
»Glaubst du wirklich, ich lasse dich damit durchkommen?«, hatte Philipp mir noch vor fünf Minuten beim Betreten des Gerichtssaals zugezischt.
»Glaubst du wirklich, ich verzichte weiterhin auf alle Ansprüche, wenn du die Scheidung heute platzen lässt?«, hatte ich eisig entgegnet.
Meine einzige Forderung war gewesen, dass Lotti bei gemeinsamem Sorgerecht bei mir lebte.
Sogar diese Regelung kam Philipp entgegen. Er konnte unsere Tochter jedes zweite Wochenende abholen – von mir aus auch öfter. Weil sein Luxusfitnesscenter aber auch samstags und sonntags geöffnet hatte, reichte Philipp meist der Samstag aus.
»Herr Kramaczik, halten auch Sie Ihre Ehe für gescheitert?«, wiederholte der Richter seine Frage ungeduldig.
Philipp sah aus, als würde er mich gern umbringen.
ZOMBIE
Genervt betrachtete ich die langstielige Rose. Das ging einfach nicht, so einen Kitsch kaufte Eddie mir nicht ab. Verdammte Scheiße, warum funktionierte sie nicht wie jede andere Tussi? Dann könnte ich einfach die Blumen-und-Klunker-Nummer abziehen und fertig. Aber Eddie würde mir vermutlich unterstellen, dass ich sie bestechen wollte.
Was durchaus korrekt war. Wütend wandte ich mich ab und trat ans Fenster.
Unten ließ Steffi ihren mickrigen Köter in die Rabatten kacken. Steffi hatte abgenommen. Sichtbar. Das lag an dem inkontinenten Kläffer, den Eddie ihr aufs Auge gedrückt hatte. Nun musste Steffi im Stundentakt die Treppen der vier Stockwerke rauf- und runterrennen, um das Vieh auf den Rasen neben dem Kinderklettergerüst pissen zu lassen.
Vorher war Steffi nicht mal mehr Einkaufen gegangen, weil sie sich geschämt hatte, dass sie in keine Hose passte. Mütze hatte mich einmal sogar schon das Schloss ihrer Wohnungstür knacken lassen, weil sie Angst gehabt hatte, Steffi könnte mit einem Herzinfarkt im Flur liegen. Dabei war die erst fünfundzwanzig oder so.
Eddie und der Köter hatten ein kleines Wunder vollbracht.
Zufällig, könnte man denken. Allerdings häuften sich die Wunder um Eddie herum wie Ufolandungen in der Area 51.
Meiner Tochter hatte sie eine Karriere als Pornodarstellerin ausgeredet und mir selbst hatte sie mein grandios verpfuschtes Leben nicht nur wortwörtlich gerettet, sondern es geschafft, dass meine Zukunft nicht mehr wie ein jede Materie ansaugendes und vernichtendes schwarzes Loch aussah.
Ich drehte die viereckige Plastikschachtel in meiner Hosentasche zwischen den Fingern. Nach acht Monaten Beziehung wunderte ich mich immer noch darüber, dass wir miteinander schliefen. Unglaublich, dass das passiert war, obwohl Eddie den krankhaft aggressiven, abgefuckten, sexistischen Wichser, der ich neulich noch gewesen war, zuerst kennengelernt hatte.
Jetzt war mein Bedürfnis, wahllos Leute zusammenzuschlagen, weg. Ich konnte mich nicht einmal erinnern, wann ich das letzte Mal bis zum Zusammenbruch auf einen Sandsack eingeprügelt hatte.
Ich musste es durchziehen. Heute.
Ruckartig drehte ich mich um, zog die Schachtel aus der Hosentasche und schnippte sie neben die bescheuerte Rose auf den Tisch.
EDDIE
»Boah! Ich hab echt keinen Bock, jedes Mal für dich die Putze zu spielen, bevor die Tussi vom Amt um die Ecke kommt!«
Ich blieb in der Tür des einzigen Zimmers der winzigen Wohnung stehen. Es roch muffig. Nach nasser Wäsche. Und dem schimmelnden Cornflakes-Matsch in der auf dem wackligen Couchtisch festgegammelten Schüssel. Und – ich seufzte – nach Zigaretten. Immer noch.
Weil das Jugendamt seinen Besuch bei unserer zwanzigjährigen Nachbarin Flo angekündigt hatte, hatten meine Freundinnen Dana, Mütze und Steffi die Putzkolonne gespielt, während ich zu meinem Scheidungstermin gefahren war.
Mütze zerrte genervt schmutzige Wäsche unter dem Bett hervor. Sie trug eine pinkfarbene Hose im Tarnfleckmuster zu einem schlabberigen Achselshirt, unter dem ihr BH zu sehen war. Aus ihrer strubbeligen, grau-blonden Kurzhaarfrisur baumelte ein langer, dünner, pinkfarbener Zopf.
»Und schmeiß deinen Müll nicht in das Kinderbett«, ergänzte Steffi, während sie leere Kekspackungen aus dem Gitterbettchen am Fenster sammelte. Ihr kleinwüchsiger Pudelmischling Fussel schnüffelte skeptisch an einem auf dem Boden stehenden Plastikbecher mit Instantnudeln, traute sich aber nicht, den Inhalt zu fressen.
Dana hob den Becher auf und warf einen Blick hinein. Zombies Schwester war ein ganzes Stück größer als ich, schlank und dunkelhäutig. Die schwarzen Afrolocken trug sie raspelkurz. Wäre die ganze Situation nicht zum Heulen gewesen, wäre es beinahe lustig, dass eine promovierte Neurologin bei Hartz-IV-Empfängerin Flo putzte.
»Mann, Flo«, meckerte Dana gereizt. »Das Jugendamt nimmt dir das Kind weg, wenn hier alles schimmelt. Wann schnallst du das endlich?«
»Geht mir doch nicht auf den Sack!« Die hochschwangere Bewohnerin der Müllkippe legte ihre nackten Füße neben die Schimmelschüssel auf den Couchtisch. »Ich kann im Moment ja wohl kaum die Wäsche machen.«
»Nee, alle Schwangeren sitzen neun Monate lang auf dem Sofa und lassen sich bedienen – vorausgesetzt, sie sind englische Prinzessinnen und haben ein paar Butler.« Mütze stapfte mit dem vollen Korb an mir vorbei.
Wie immer in Flos Wohnung beschlich mich ein mulmiges Gefühl. Fühlte sich an, als würde die Katastrophe, die auf uns zurollte, den Boden unter meinen Füßen zittern lassen. Die Geburt von Flos Kind stand unmittelbar bevor, übermorgen war der errechnete Termin.
Floriane Neri war zwanzig Jahre alt, kleiner als ich und trotz ihres Drei-Tage-vor-der-Geburt-Schwangerschaftsbauches sehr zierlich, mit kinnlangen, braunen Haaren und Rehaugen.
Als ehemaliges Straßenkind fiel es ihr schwer, ein halbwegs geregeltes Leben zu führen. Eine Betreuerin kam einmal in der Woche vorbei und Mütze, Dana, Steffi und ich halfen, wo wir konnten.
Als Flo versehentlich eine Lehrstelle gefunden hatte und auf eigenen Füßen zu stehen drohte, hatte sie sich schwängern lassen – von einem siebzehnjährigen Alkoholiker, der auf den vielsagenden Namen ›Rüde‹ hörte.
Seitdem war Flo der Ansicht, dass sich irgendwer um sie kümmern müsste und das Amt sie ja wohl kaum mit ihrem Kind auf die Straße setzen konnte.
Ihre Betreuerin hatte das Jugendamt über die anstehende Geburt informiert, doch was das bedeutete, schien Flo einfach nicht zu begreifen.
ZOMBIE
Ich starrte die Scheißrose an. Das Grünzeug ging gar nicht.
Gereizt trommelte ich mit den Fingern auf die Tischplatte, die aus einer Scheibe vom Stamm eines gigantischen Baumes gefertigt war.
Mein Leben lang hatte ich nicht geschnallt, warum immer alle von einer ›Partnerschaft‹ quatschen, wenn sie ficken meinten. Bevor ich Eddie kennengelernt hatte, war eine Tussi für mich bloß eine Person gewesen, der ich als Gegenleistung fürs Vögeln den Friseur finanzieren musste. Es war immer klar gewesen, dass die Weiber mit mir zusammen waren, weil ich der supercoole Boss einer supercoolen Securityfirma war, ein iPhone in der Hand und einen fetten Hummer H2 unterm Arsch hatte und Haarverlängerungen für fünfhundert Euro bezahlen konnte.
Irgendwie hatte ich es fertiggekriegt, immer die Schicksen aufzureißen, die genau so tickten. Vielleicht lag das tatsächlich ein bisschen an meiner verrückten Mutter. Die versuchte ja heute noch, in ihrer Leo-Leggings den Supermacker aufzureißen, von dem sie sich wie der letzte Dreck behandeln lassen konnte als Gegenleistung dafür, dass er sie finanzierte.
Wahnsinn, dass ich ihr gestörtes Beziehungsmuster tatsächlich übernommen hatte.
Die Trennung von meiner letzten Kurzzeitbeziehung Michelle tauchte aus einer besonders düsteren Ecke meines Gedächtnisses auf. Ich schaffte es nicht, sie in die Dunkelheit zurückzudrängen.
Das war an dem Tag gewesen, als ich zum ersten Mal die Kondome in Jaz’ Schulranzen entdeckt hatte. Ich war ausgerastet.
»Du bist zehn Jahre alt!«, hatte ich meine Tochter angebrüllt.
»Meine Mutter verdient mit Werbung für Dildos ihr Geld und mein Alter vögelt eine Tussi, der man auf YouTube zusehen kann, wie sie nackt kocht. Glaubst du wirklich, ich weiß nicht, wozu die Dinger da sind?«, hatte Jaz prompt gekontert.
Ich hätte ihr am liebsten eine gescheuert.
Weil das nicht ging, war ich zu Michelle gefahren, in die Küche marschiert und hatte sie auf dem Tisch zwischen frisch geschnittenen Paprika und Zwiebeln gefickt. Auf die harte Tour. Das hatte mit Sex nichts zu tun gehabt. Ich war aggro gewesen und hatte jemandem wehtun wollen. Hatte geklappt. Als ich hinterher Michelles blauen Flecken gesehen hatte, war mir schlagartig wieder bewusst gewesen, dass ich meine Wut mithilfe von Sex abreagierte, seit ich mit Anfang zwanzig aufgehört hatte, Leute zusammenzuschlagen.
Ich hatte mich beschissen gefühlt und mich entschuldigt. Doch Michelle hatte bloß blöde geglotzt und gemeint, ich sollte nicht rumheulen. Wir hätten doch besprochen, dass sie auf Vergewaltigungsfantasien stand. Noch geiler wäre es aber, wenn ich sie beim nächsten Mal auch noch würgen würde.
Das war der Moment gewesen, in dem ich endlich kapiert hatte, dass ich beim Sex genauso kurz davor war, jemanden umzubringen wie im Ring. Ich war gegangen und hatte danach die Finger von den Weibern gelassen.
Bis Eddie aufgetaucht war …
Bei dem Gedanken sträubten sich mir reflexartig die Nackenhaare.
Nee, mit Eddie war alles anders! Es war unvorstellbar, dass ich Eddie jemals wehtun könnte. Mit ihr fühlte ich mich plötzlich wieder wie der zu groß geratene, schüchterne Junge, der es in der dritten Klasse nicht gebacken bekam, Ashley Brinkmann unters T-Shirt zu fassen.
Andererseits war der Sex mein Leben lang genauso mit der Wut verknüpft gewesen wie der Sport …
Ruckartig bewegte ich die Schultern, um das Frösteln abzuschütteln.
Mein Blick wanderte zurück zu der Scheißrose neben der kleinen Plastikschachtel auf Eddies Teller.
Das war ein todsicheres Zeichen, dass ich den Verstand verloren hatte. Ich hatte bereits eine Ex-Frau, für die ich noch ein paar Jahre lang blechen musste, bis ich ihr endlich ihren Zugewinnanteil an meiner Firma ausgezahlt hatte.
Und ich wusste besser als jeder andere, dass ich nichts festhalten konnte. Alles konnte im nächsten Moment einfach zu Ende sein. Deshalb hatte sich meine Zukunftsplanung seit Jahren darauf beschränkt, die Dienstpläne für den nächsten Monat zu erstellen. Aber jetzt wollte ich sie, die blödsinnige kleine Chance, dass doch noch alles gut werden könnte. Ich musste es hinkriegen, für die Kids.
Dass das nicht einfach werden würde, war klar. Eddie würde mich liebenswürdig abblitzen lassen.
Und deshalb konnte ich ihr auf keinen Fall mit Blumen kommen! Ich musste mir was Besseres, was Besonderes, was Großartiges einfallen lassen.
Genervt ließ ich die Schachtel wieder in meiner Hosentasche verschwinden. Dann öffnete ich das Fenster und schnippte die Rose hinaus.
EDDIE
»Und? Können wir anstoßen oder muss ich deinen Ex besuchen und ihm ein paar Finger brechen?«
Zombie stand in Jogginghose und einem Achselshirt in der Küchentür und hielt mir ein Sektglas hin. Es roch nach Pizza.
Ich biss mir auf die Zunge, um nicht zu grinsen. Mein Freund war zwei Meter groß, dunkelhäutig, seine langen, schwarzen Locken hatte er zum Knoten zusammengebunden und sein muskelbepackter, rechter Arm war bis in die Ellenbeuge extrem scheußlich tätowiert.
Er ließ den Gangster raushängen. Klappte nicht. Es war nicht zu übersehen, dass der Verlauf meines Scheidungstermins ihn mehr interessierte, als er zugeben wollte. Seine dunklen Augen hingen an meinem Gesicht, er wippte auf die Zehenspitzen, während er auf meine Antwort lauerte. Es wunderte mich, dass seine Anspannung nicht als elektrisches Knistern in der Luft zu hören war.
Ich nahm ihm das Sektglas aus der Hand. Unsere Finger berührten sich und mir wurde warm.
Zombies Schultern entspannten sich prompt, seine Augen leuchteten auf und er fuhr sich mit der Zunge über die anscheinend trocken gewordenen Lippen.
Jetzt musste ich doch grinsen.
Zombie besaß die emotionale Steuerungsfähigkeit eines pubertierenden Teenagers. Und seit er das nicht mehr hinter unkontrollierten Aggressionen versteckte, war sogar meine sechsjährige Tochter besser in der Lage zu vertuschen, wie sie sich fühlte.
Unsere Blicke sogen sich aneinander fest.
»Es ist echt einfacher, Läuse wieder loszuwerden als einen Ehemann«, erklärte ich.
»Dann sollte ich dich heute lieber nicht fragen, ob du jetzt mich heiraten willst?«, konterte Zombie belustigt.
»Wenn ich schon eine Ex-Frau am Hintern kleben hätte, die mich die Kinder großziehen lässt und mir trotzdem noch auf der Tasche liegt, wäre ich mit den Witzen, die ich reiße, vorsichtiger«, warnte ich ihn ironisch.
»Du dürftest mich bis auf die Unterhose ausziehen«, entgegnete Zombie achselzuckend.
Die Anspannung nach dem Scheidungstermin fiel von mir ab und ich spürte plötzlich mein Herzklopfen. Ich schob das Sektglas zu den Schuhen in das Regal im Flur und trat dicht vor meinen Freund.
»Wie? Nur bis auf die Unterhose?«, erkundigte ich mich.
Zombie ließ mich nicht aus den Augen, er blieb an den Türrahmen gelehnt stehen. Er wartete darauf, dass ich den ersten Schritt machte, er ließ mich immer den ersten Schritt machen. Möglicherweise, weil er bei unserem ersten Zusammentreffen das Horrorfilmmonster hatte raushängen lassen und immer noch befürchtete, ich könnte wieder Angst vor ihm bekommen. Dabei hatte ich schon lange keine Angst mehr.
Ich schob meine Hände unter sein Achselshirt. Die Berührung seiner warmen Haut kribbelte in meinen Fingerspitzen. Ich konnte sehen, wie seine Atmung beschleunigte, als ich meine Finger über seine harten Bauchmuskeln wandern ließ.
»Hast du die Kinder geknebelt oder wieso sind sie so still?«, erkundigte ich mich.
»So ähnlich«, grinste er. »Sie gucken Ice Age 4.«
Sanft umgriff er mit beiden Händen meinen Nacken und zog mich an sich. Zombie küsste mich so behutsam, als wäre ich sehr leicht zerbrechlich.
Prompt wurde mir schwindelig, meine Knie gaben nach. Ich war hoffnungslos verknallt in das Möchtegernungeheuer.
Nachdem wir mit den Kindern zusammen die Pizza aufgegessen hatten, startete Zombie Ice Age 5.
Gleich darauf zerrte ich ihm sein Achselshirt über den Kopf, noch während ich rückwärts aufs Bett fiel. Der Knoten, zu dem er seine langen, dunklen Locken zusammengebunden hatte, löste sich und seine Haare fielen ihm ins Gesicht, als er sich über mich beugte.
Das hätte gruselig wirken können, denn ein vermutlich geistesgestörter Tattookünstler hatte Zombies dunkle Haut auf der gesamten rechten Seite seines Körpers zerfetzt. Blanke Knochen blitzten unter zerrissenem Muskelfleisch auf, zwischen den freigelegten Rippen seines Brustkorbes geiferte eine tollwütige Ratte mit blutverschmiertem Maul hervor. Das Vieh sah aus, als hätte es sich gerade durch seine Eingeweide gefressen. Aber mir kamen Zombies Horrortattoos mittlerweile so normal vor wie seine rechte Hand.
Zombie küsste sich meinen Bauch hinunter und noch weiter, nachdem er den Reißverschluss meiner Jeans geöffnet hatte.
Dann klingelte mein Handy.
Nee!
Verdammt. Die Kinder waren satt und beschäftigt, es bestand zumindest eine Chance, dass sie während der nächsten halben Stunde nicht zankten.
Ich ignorierte das Klingeln – bis ich bemerkte, dass mein Freund das Gerät mit dem geschickten Griff eines Profidiebes aus meiner Hose geangelt hatte und einen Blick auf das Display warf.
»Adamkowitsch. Der geht mir auch auf den Sack, wenn er mich nicht einbuchten will«, murrte er.
Adrian Adamkowitsch leitete das Ermittlungsteam, dem ich im Kriminalkommissariat 11 zugeteilt war, und war somit mein direkter Vorgesetzter. Allerdings herrschte zwischen uns seit einem unbedachten One-Night-Stand kurz nach dem Aus meiner Ehe tiefste Eiszeit.
Auch aus Zombie und Adrian würden wohl keine Kumpel mehr werden. Zombie nahm es meinem Kollegen übel, dass er bei jeder sich bietenden Gelegenheit versuchte, ihn zu verhaften. Und Adrian konnte nicht vertragen, dass Zombie das Alphamännchen überzeugender spielte als er.
Dabei hatte Adrian noch nicht mal mitbekommen, dass wir miteinander schliefen.
»Hörst du dir an, was er will, oder soll ich ›Hallo‹ sagen?«, erpresste mich Zombie, das Gespräch anzunehmen. Dass Adrian mich aus der ›richtigen‹ Ermittlungsarbeit konsequent ausklammerte, ging Zombie noch mehr auf die Nerven als mir selbst.
Diese Woche schob Zombie Nachtschichten, weil einer seiner Mitarbeiter krank war. Ansonsten lief seine Securityfirma scheinbar von selbst, vormittags zog er neue Aufträge an Land und wenn ich nach Hause kam, hatte er meistens schon gekocht.
Nachmittags bespaßten wir dann gemeinsam unsere drei Kids. Weil Kinderbetreuung mit Zombie Kletterhallenbesuche, Indoor-Skydiving oder knallhartes Bootcamp-Training für den Ninja-Warrior-Parcours bedeutete, waren nicht nur meine sechsjährige Tochter Lotti und Zombies gleichaltrige Tochter Jo Feuer und Flamme, auch Jos zwölfjährige Schwester Jaz war erstaunlich häufig dabei. Der Untote war ein Superpapa.
Allerdings besaß er trotz seiner momentanen Arbeitszeitreduzierung in beruflichen Angelegenheiten weiterhin einen instinktiven Ehrgeiz. Ums Geld ging es ihm dabei nicht, er wollte schlicht das Sagen haben. Er sorgte konsequent dafür, dass alles lief. Nicht nur in seiner Securityfirma mit über vierzig Mitarbeitern, neuerdings schrieb sogar seine Boxhalle schwarze Zahlen.
Dass ich mit meiner Teilzeitstelle als Kriminalkommissarin die überbezahlte Sekretärin für meine Teamkollegen spielen musste, war für ihn schwerer verständlich als die chinesische Bedienungsanleitung vom Fernseher.
Ich bemühte mich, meine festgefahrene Arbeitssituation pragmatisch zu sehen: Zumindest hatte ich einen familienfreundlichen Job, der zuverlässig den Kühlschrank füllte. Überstunden und Bereitschaftsdienst waren nur selten nötig. Ich konnte vormittags ein paar Berichte abtippen und einfache, telefonische Recherchen erledigen, um dann pünktlich Feierabend zu machen und zum Mittagessen zu Hause zu sein.
Obwohl Lotti und ich seit acht Monaten bei Zombie und seinen beiden Töchtern lebten, hatte ich meine eigene kleine Wohnung im Haus gegenüber nicht aufgegeben. Zu hart hatte ich mir das eigene Dach über dem Kopf erkämpft, nachdem Philipp mich mitten in der Nacht ohne einen Cent in der Tasche vor die Tür gesetzt hatte.
Zombie hielt mir immer noch das hartnäckig klingelnde Handy hin.
Seufzend nahm ich das Gespräch an.
»Mein Dienst beginnt morgen früh um acht, Adrian«, meldete ich mich. Zombie beobachtete mich. Sein Zeigefinger, mit dem er kitzelnd die Konturen meines Schlüsselbeins nachzeichnete, lenkte mich ab.
»Es gibt eine Leiche«, kam Adrian sofort zur Sache.
Das war keine Überraschung, schließlich waren wir im Kriminalkommissariat 11 für Todesermittlungen, Waffen und Brandsachen zuständig. Aber ein Grund, mich anzurufen, war es für Adrian normalerweise auch nicht. Die Berichte konnte ich auch morgen abtippen.
Ich wartete darauf, dass mein Teamleiter auf den Punkt kam.
»Der Fundort ist gleich bei dir um die Ecke. Wir gehen von Tod durch Fremdeinwirkung aus.«
»Und?«
Ich konnte das Knirschen seiner Zähne durchs Telefon hören.
»Und Frau Dr.Röhmer würde sich freuen, wenn du herkommen und dir das ansehen könntest.«
Ach so.
Staatsanwältin Röhmer hatte schon mehrmals durchblicken lassen, wie wenig Verständnis sie dafür hatte, dass Adrian mich wegen meiner reduzierten Arbeitszeit die Tippse spielen ließ. Gelegentlich versuchte sie, mich stärker in die Ermittlungen einzubinden.
Ich ballte die Fäuste. Natürlich hatte ich die Polizeihochschule nicht besucht, um für meine Kollegen den Kaffee zu kochen. Zwei Mal hatte ich bisher als vollwertiges Teammitglied in einer Mordkommission mitgearbeitet und jedes Mal hatte ich zur Aufklärung der Tatumstände beigetragen.
Dass ich Röhmers Einladung in die Mordkommission ablehnen musste, weil Adrian mir mein Arbeitsleben so unangenehm wie möglich machen würde, wenn ich mich in seine Ermittlungen einmischte, nervte mich.
Zombie versuchte, meine Gedanken an meinem Gesicht abzulesen. Er zog die richtigen Schlüsse und deutete fragend mit einem Finger einen Schnitt quer über seine Kehle an.
Ich nickte.
»Wir sind in Gerthe«, informierte mich Adrian, wahrscheinlich, weil Dr.Röhmer ihn hören konnte.
Mein Blick wanderte zum Fenster.
»Ostwaldstraße, Ecke Fischerstraße. Das ist wohl ehemaliges Zechengelände«, fuhr Adrian fort. »Wir sind in einer alten Maschinenhalle, die vor einiger Zeit halb abgebrannt ist.«
Ich wusste, welche Halle er meinte. Das Gelände lag tatsächlich nur ein paar Minuten entfernt.
»Ein Wohnungsloser, der die Ruine als Unterschlupf nutzt, hat die tote Frau gefunden.«
Zombie machte eine Handbewegung, die »Worauf wartest du?« bedeutete. Er war der simplen und überhaupt nicht hilfreichen Meinung, dass mein Teamchef mal eine in die Fresse brauchte, um wieder auf den Boden zu kommen.
Deshalb ließ er mein Kopfschütteln nicht gelten.
»Na los, geh hin und ärgere ihn ein bisschen. Der Wichser fragt doch sowieso nur, weil er weiß, dass du kneifst«, bemerkte Zombie laut genug, um auch durchs Telefon verstanden zu werden.
»Wie bitte?«, schnappte Adrian.
Ich hielt hastig das Mikro zu.
Zombie grinste.
Ich verdrehte die Augen.
»Ich komme«, antwortete ich Adrian. »Aber um zehn muss ich wieder zu Hause sein, mein Freund hat Nachtschicht.«
Damit Zombie keine Gelegenheit mehr bekam, sich mit Adrian anzulegen, beendete ich schnell das Gespräch.
»Dein Freund ist zufällig sein eigener Boss und kann seine Schicht auch nachts um drei beginnen«, erklärte mir Zombie sofort. »Wie kommt der Lackaffe plötzlich auf die Idee, die Lorbeeren mit dir zu teilen?«
Ich setzte mich auf und zog mein Shirt herunter.
»Ist nicht seine Idee«, winkte ich ab. »Die Staatsanwältin will mich dabeihaben.«
»Die kleine Dicke?« Zombie neigte nachdenklich den Kopf. »Warum?«
Ich seufzte. »Sie glaubt, ich hätte eine gute Intuition.«
Zombie stützte sich interessiert auf die Unterarme. »Ist etwa doch jemandem aufgefallen, dass ich hinter Gittern sitzen würde, wenn es nach Adamkowitsch gegangen wäre?«
»Du hattest mehr Glück als Verstand.«
»Ich hatte einen Schutzengel«, korrigierte er belustigt.
Als wir uns das erste Mal während einer Mordermittlung begegnet waren, hatte Zombie die Idealbesetzung eines pathologisch aggressiven Irren abgegeben. Auch mir selbst war erst in letzter Sekunde klar geworden, dass er lediglich den Verdacht von seiner jüngsten Schwester abgelenkt hatte. Dass ich Adrian irgendwie davon hatte abhalten können, Zombie zu erschießen, als er nach dem Tod seiner Schwester Amok lief, hatte die Staatsanwältin mal als ›souveränes Deeskalieren einer Gefahrenlage‹ bezeichnet. In Wirklichkeit war ich natürlich alles andere als souverän gewesen.
Wiederbegegnet waren wir uns durch eine weitere Todesfallermittlung, bei der Adrian Zombie gern zum Hauptverdächtigen gemacht hätte.
»Deine Oma glaubt auch, du kannst hellsehen«, versuchte Zombie, seine Schutzengeltheorie zu untermauern.
»Meine Oma würde dir auch einen Kiesel als Heilstein verkaufen, bloß, weil sie dreimal draufgespuckt hat.«
»Mann, Eddie!«, wurde Zombie ärgerlich. »Willst du echt die nächsten zehn Jahre die Tippse für Adamkowitsch spielen?«
»Natürlich nicht!«, fauchte ich.
Zombie hatte gut reden. Er war schon mit Anfang zwanzig sein eigener Boss gewesen und kommandierte seine Wachleute so selbstverständlich herum, wie er Zähne putzte. Nicht mal der Härteste seiner Türsteher käme auf die Idee, sich mit ihm anzulegen.
Während meine Teamkollegen die Anwesenheit der Kaffeemaschine bei den Ermittlungen für wichtiger hielten als meine.
»Wenn du an dem Fall mitarbeiten kannst, dann los«, schärfte mir Zombie ein. »Ich halte dir den Rücken schon frei.«
ZOMBIE
So eine verfickte Scheiße! Ich hatte gekniffen! Das gab es doch gar nicht! Seit wann war ich so eine feige Ratte?
Hatte ich Schiss vor dem Korb, den ich kriegen würde?
Ja, verdammt!
Definitiv.
Eddie würde sich eingeengt fühlen. Sie würde glauben, ich wollte irgendwelche kranken Besitzansprüche anmelden wie ihr Ex. Sie war so abartig eigenständig, sie musste nur ihre Tochter und ihre Zahnbürste einpacken und in ihre eigene Wohnung hinübergehen und schon wäre sie aus meinem Leben verschwunden.
Das konnte ich nicht riskieren.
Lottis Alter, der verdammte Sack, hatte es verbockt! Dem Wichser würde ich die Fresse polieren, sobald sich die Gelegenheit ergab. Der hatte dafür gesorgt, dass Eddie trotz ihres Einser-Abschlusses der Polizeischule für Adamkowitsch Kaffee kochte, statt selbst zu ermitteln. Und dass sie eine vollkommen nutzlose Wohnung bezahlte für den Fall, dass sie und ihr Kind mal wieder überraschend von einem Typ rausgeschmissen wurden. Und dass sie in einem lebensgefährlichen Schrotthaufen durch die Gegend schüsselte, obwohl auf dem Parkplatz meiner Firma zwei Firmenwagen herumstanden. Sogar, wenn wir Pizza bestellten, zahlte sie selbst.
Ich hatte endlich mal wieder Lust auszurasten! Dem Arschloch von Ex-Mann würde ich den Hals umdrehen, wenn er je so dämlich war, mir über den Weg zu laufen.
Hm. Fast war es beruhigend, dass ich doch noch zu ein paar harmlosen Tötungsfantasien in der Lage war.
Vielleicht schaffte ich es mit der Hilfe von Eddies Ex ja mal wieder zu ein paar Trainingseinheiten am Sandsack.
Meine Erektion machte sich bemerkbar.
Da Eddie hoffentlich eine Weile unterwegs sein würde, brauchte ich eine kalte Dusche.
EDDIE
Ich parkte meinen siebzehn Jahre alten Ford Fiesta am Straßenrand der Sackgasse.
Der Regen prasselte auf die Frontscheibe, der Scheibenwischer quietschte, neben mir tropfte es auf den Beifahrersitz. Im Licht der Scheinwerfer erkannte ich den dunkelblauen Bulli des Erkennungsdienstes. Er parkte direkt vor dem verrosteten Maschendrahttor, dessen rechter Flügel offen stand. Zwei Uniformierte hantierten im strömenden Regen mit rot-weißem Flatterband, um das gesamte Gelände abzusperren.
Eine Beamtin stand unter dem Regenschirm einer jungen Frau im Gruftilook vor dem letzten Wohnhaus in der Straße, die an dem heruntergekommenen Firmengelände endete.
Neben dem Bulli der Spurensicherer erkannte ich Adrians nachtschwarzen, blank polierten Alfa Romeo Giulietta. Auf dem Armaturenbrett des Wagens meines Teamchefs blinkte das portable Blaulicht. Dahinter stand der rote Golf, mit dem mein Lieblingsrechtsmediziner Marvin unterwegs war. Und auch der Audi der Staatsanwältin parkte am Straßenrand. Die Tatortgruppe schien bereits vollständig versammelt.
Mein Mut verließ mich. Es war idiotisch gewesen, hierherzufahren. Selbst wenn ich wirklich etwas zu den Ermittlungen beitragen könnte, würde es Adrian nur ärgern. Und versagte ich, lieferte ich ihm die nächste Gelegenheit, mich aus dem Kriminaldienst zu mobben.
Einen Moment lang blieb ich hinter den hin- und herschrabbelnden Scheibenwischern sitzen. Ich hatte das Gefühl, dringend aufs Klo zu müssen. Eine lange antrainierte Strategie meines Körpers, einer unangenehmen Situation zu entkommen.
Aber jetzt konnte ich nicht mehr kneifen. Ich zog mir die Kapuze meines Winterparkas über den Kopf und stieg aus dem Wagen.
Es war halb neun und bereits stockdunkel.
Die außen am Spurensicherungsbulli angebrachte Lampe erhellte gerade noch den Durchgang des alten Zauns. Neben dem Tor stand ein verfallenes Häuschen, das aussah, als hätte irgendwann mal ein Pförtner darin gesessen.
Ich trat neben die Kollegin, die unter dem Regenschirm der jungen Anwohnerin stand und eifrig notierte.
»Da rechts, das war die Schachteinfahrt, sagt Omma. Und das große Haus war eine alte Maschinenhalle. Sollte eigentlich denkmalgeschützt sein, aber nachdem die abgefackelt ist, kommt sie jetzt wohl doch weg.«
Ich sah in die Richtung, in die die Frau über den Zaun deutete.
Ich war ganz in der Nähe aufgewachsen, in dem Reihenhäuschen der alten Zechensiedlung, in dem meine Eltern heute noch wohnten. Der Schrebergarten meiner Oma war nur ein paar Schritte entfernt. Ich wusste, dass die Stollen der Zeche Lothringen den Boden unter uns durchlöcherten wie einen Schweizer Käse. Als Jugendliche war ich mit meiner Freundin Anne in den stillgelegten Anlagen herumgestreift.
»Entschuldigung«, unterbrach ich das Gespräch der jungen Kollegin mit dem blonden Zopf. »Beelitz, KK 11.«
Sie nickte und huschte unter dem Regenschirm hervor, zum Bulli hinüber. Aus einer der ausziehbaren Schubladen hinter der Schiebetür kramte sie einen weißen Plastikoverall, Einmalhandschuhe und Überzieher für die Schuhe. Und eine große Taschenlampe.
Während ich den Schutzanzug über meine dicke Winterkleidung zog, betrachtete ich das zerfetzte Transparent am Zaun, auf dem das orangefarbene Logo einer Abrissfirma abgebildet war.
Hinter dem Durchgang begann ein schmaler Trampelpfad, der zwischen den vertrockneten, hochgewucherten Unkrautresten platt getreten und mit den winzigen, gelben Plastikpyramiden der Kriminaltechniker kenntlich gemacht worden war.
Der Boden war uneben, von schweren Fahrzeugen zerfahren und glitschig. Heute hatte es beinahe ununterbrochen geregnet, was die Spurensicherung im Außenbereich erschwerte.
Außerdem war der ›Außenbereich‹, soweit ich mich an die örtlichen Gegebenheiten erinnerte, riesig. Der Lichtschein meiner Lampe reichte jedenfalls nicht aus, um das Ausmaß des Areals zu überblicken. Über mir hörte ich die Regentropfen in die letzten Blätter der hohen Bäume rauschen.
Der Trampelpfad wies mir den Weg über das verwilderte Gelände. Ich näherte mich dem Gebäude und ließ den Lichtkegel meiner Lampe an der Fassade hinaufflitzen. Eine gewaltige Ruine aus braunem Ziegel.
Selbst in der Dunkelheit wirkte die Halle einsturzgefährdet. Ich hörte Stimmen. Vorsichtig stieg ich die ausgetretenen Steinstufen zur Eingangstür hinauf, darauf bedacht, auf dem von den Kriminaltechnikern kenntlich gemachten Pfad zu bleiben. Die ursprünglich mit Brettern verbarrikadierte und von Brennnesseln und Efeu zugewucherte Tür war geöffnet worden. Den Innenraum der Halle erleuchteten die akkubetriebenen Hochleistungsstrahler der Kriminaltechnik.
Ich widerstand dem Impuls, mir die Kapuze vom Kopf zu streifen und den Regen abzuschütteln, als ich eintrat.
Wow! Ich ließ das Licht meiner Lampe zur hohen Decke hinaufflitzen. Sie hatte ein riesiges Loch. Die Balken waren verkohlt, Dachziegel waren im hinteren Bereich der Halle zu Boden geprasselt, die Tonscherben in alle Richtungen auseinandergespritzt. Es roch nach verbranntem Holz und Feuchtigkeit. Das Feuer hatte die Wände schwarz gefärbt, der Hallenboden war von Schutt übersäht. Grelles Kunstlicht leuchtete einen orangefarbenen Bagger an, der neben einem Kipplader parkte. Vorn rechts, in einer trockenen Ecke, fotografierte eine Kriminaltechnikerin.
Mein Kollege Gregor stand mit einem jungen Mann in einem schmutzigen Parka im Eingangsbereich. Der Fremde war mager, die Augen glasig, die Wirbelsäule im oberen Bereich gebeugt wie bei einem alten Mann. Sein ungepflegtes, blondes Haar hatte er fettig hinter die Ohren zurückgestrichen, in seinen Ohrläppchen steckten jede Menge Ringe und Tunnel und aus seiner Jackentasche ragte der Hals einer Flasche.
Der Wohnungslose, der die Tote gefunden hatte, schlussfolgerte ich.
Gregor entdeckte mich. Mein Kollege war zwei Jahre jünger als ich. Sportlich, attraktiv, ehrgeizig. Seine Haare hatte er millimeterkurz rasiert. Statt der Kapuze seines Schutzanzuges hatte er eine Strickmütze über die Glatze gezogen. Gregor verhielt sich mir gegenüber nicht unbedingt feindselig wie Adrian, ein Kämpfer für die Gleichberechtigung war er allerdings auch nicht. Die Aufgabenverteilung in unserem Team hatte er nicht hinterfragt, als er dazugestoßen war.
Dass Adrian mich zur Sekretärin degradiert hatte, weil ich im Zustand geistiger Umnachtung mit ihm im Bett gelandet war, nur um festzustellen, dass ich den Sex mit ihm nicht wiederholen wollte, wusste Gregor vermutlich bis heute nicht.
»Haben Sie hier drin übernachtet?«, erkundigte ich mich direkt bei dem Fremden. »Das Gebäude sieht aus, als könnte es jeden Moment zusammenbrechen.«
Der Wohnungslose winkte ab. »Ich penn hier seit Jahren.«
Gregor deutete mit dem Kopf auf den Bagger. »Hätte Herr Zimmermann die Tote nicht entdeckt, wäre sie wohl erst gefunden worden, wenn die Abrissfirma mit der Arbeit begonnen hätte.«
»Ich bin schon seit einer Woche hier«, fiel ihm der junge Mann ins Wort. Seine Hand tastete nach dem Hals der Flasche und umklammerte ihn, als müsste er sich daran festhalten. Das Weiß seiner Augen schimmerte gelblich. Konnte aber auch am Baustrahlerlicht liegen.
»Ich schwör, heute Morgen lag die da noch nicht.«
Er deutete mit der Flasche unbestimmt auf die Baumaschinen. Bier spritzte durch den Raum und Gregor nahm vorsichtshalber Abstand.
»Wann haben Sie das Gelände denn heute Morgen verlassen?«, erkundigte ich mich, obwohl Gregor diese Frage garantiert schon gestellt hatte. Ich wollte aber nicht auf die Antwort warten, bis ich die Berichte meiner Kollegen abtippen durfte.
»So gegen neun, schätze ich«, murmelte der Mann. »Eher später. War jedenfalls schon hell.«
Die Sonne ging im Augenblick gegen sieben auf.
Das alte Zechengelände lag am Ende einer Sackgasse. Die Straße benutzten nur die Anlieger, aber direkt am Gelände führte ein Fußweg vorbei. War hier am helllichten Tag ein Mord geschehen?
Mein Blick wanderte von dem Mann, der offensichtlich betrunken war, zu dem neben Gregor bereitstehenden Uniformierten. Hatte ›mein Team‹ den Wohnungslosen etwa schon als tatverdächtig im Visier?
Mein Blick wanderte weiter zu der Kollegin mit dem Fotoapparat. Sie machte Aufnahmen von einem aus Kartons und einer Isomatte zusammengebastelten Schlafplatz.
Wurde nach Spuren gesucht, die auf einen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit des Wohnungslosen und dem Tod der Frau hindeuteten? Wundern würde es mich nicht, denn eine solche vorurteilsbehaftete Vorgehensweise wäre Zombie beinahe zum Verhängnis geworden.
Ich folgte dem auch im Gebäude fortgeführten Trampelpfad der Kriminaltechniker um den Bagger herum. Die Maschine war nicht mehr neu, hier und da entdeckte ich Rost unter der abblätternden Farbe. Die gigantische, brusthohe Schaufel lag auf dem bröselnden Hallenboden. DEMON-GmbH, entzifferte ich die verblasste Aufschrift an der Tür. Demontage, Abriss und Entrümpelungen.
Der Boden war mit Schutt, Zigarettenkippen und leeren Getränkedosen übersät, die grellen Strahler auf die Ecke hinter dem Bagger gerichtet.
Neben einem Haufen Altmetall – alte Regenrinnen, Kupferrohre und Leitungen – kniete der dünne Rechtsmediziner. Seine zottigen Haare hatte er zu einem Zopf im Nacken zusammengebunden und seinen langen Bart mit einem Haargummi zusammengezurrt.
Die Kriminaltechnikerin fotografierte unter dem Kommando meines Lieblingsfeindes Daniel ›Bussi‹ Bussemeier. Ein anderer Kollege protokollierte. Ein dritter fertigte auf einem Laptop eine Tatortskizze an. Offenbar war das Spurensicherungsteam bereits aufgestockt worden – in Anbetracht der Geländegröße und des Wetters eine sinnvolle Maßnahme.
Direkt vor mir diskutierten die Staatsanwältin, Kommissariatsleiter Böck und Adrian mit gedämpften Stimmen den Fall. Sie blockierten den Trampelpfad, ich kam nicht an ihnen vorbei, um zu der Toten zu gelangen.
Dr.Röhmer bemerkte mich. Die resolute, kleine Frau mit den kurz geschnittenen, grauen Haaren und der runden Brille auf der Nase wandte sich zu mir um.
Adrian versprühte selbst im Oktober in einer Ruine in einem weißen Plastikoverall Beach-Boy-Charme. Er hatte die schmale Statur eines Ausdauersportlers, blonde Locken und ein einnehmendes Lausbubenlächeln. Brauen, Wimpern und Bartstoppeln waren dunkler als sein Haar und verliehen seinem attraktiven Gesicht markante Konturen. Der Dreitagebart sollte verwegen aussehen, wirkte penibel auf drei Millimeter gestutzt aber eher glatt rasiert. Ein Hingucker waren Adrians Augen: Sie waren hellblau wie ein Winterhimmel bei Sonnenschein.
Die Frauen lagen ihm reihenweise zu Füßen und auch bereitwillig in seinem Bett, wenn er das wollte. Der seltene Fall, dass eine mal nicht spontan bereit war, sich von ihm mit Handschellen an die Matratze fesseln zu lassen, weckte normalerweise höchstens seinen Ehrgeiz.
Dr.Röhmer reichte mir die Hand. »Schön, dass Sie uns spontan unterstützen, Frau Beelitz.«
Ich nickte knapp und nutzte die Gelegenheit, mich auf dem schmalen Pfad an ihr vorbeizuquetschen.
Röhmer runzelte die Stirn.
Ich war nicht in der Lage, neben einer Leiche bei meinen Vorgesetzten zu schleimen. Ich ließ die Staatsanwältin stehen und trat hinter Rechtsmediziner Marvin.
»Eddie«, murmelte er. »Hi.«
Er wich zurück, damit ich an ihm vorbeisehen konnte und blieb neben mir hocken. Glücklicherweise sparte sich auch Marvin gern überflüssige Worte.
Die tote Frau lag auf dem Rücken. Zwischen der verkohlten Ziegelwand und dem angehäuften Buntmetall. Weil ich vermied, sofort ihr Gesicht zu betrachten, fiel mir die blaue Abdeckplane an ihren Füßen auf, die aussah, als wäre sie gerade eben zur Seite geschlagen worden.
»Lag sie dadrunter?«
»Sieht aus, als hätte jemand verhindern wollen, dass sie so schnell gefunden wird«, ließ Marvin sich zu einer Mutmaßung hinreißen, weil ihn außer mir niemand hören konnte.
Langsam ließ ich meinen Blick an den Beinen der Frau hinaufwandern. Erfahrungsgemäß verkraftete ich den Anblick von Leichen nicht sonderlich gut. Kippte ich hier um, hing morgen eine erkennungsdienstliche Fotografie davon am schwarzen Brett der Präsidiumscafeteria.