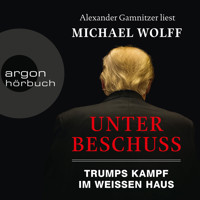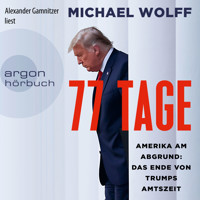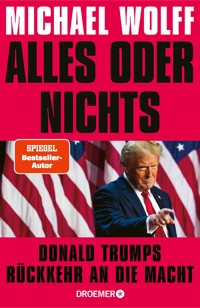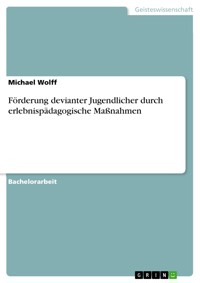12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Michael Wolff beschrieb in seinem Bestseller «Feuer und Zorn» die ersten fiebrigen Monate der Trump-Regierung. Nun haben sich ihm wieder hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses anvertraut: Wolff liefert eine aktuelle Darstellung der letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft und der Versuche des Präsidenten und seines Umfelds, das Wahlergebnis vom November 2020 auf jedem nur denkbaren Weg zu korrigieren. Er schreibt über den Wahn eines Verlierers, den Kampf der Anwälte um Rudy Giuliani, den Angriff aufs Kapitol und über das endgültige Ende einer denkwürdigen und gefährlichen Regierungszeit – und interviewt schließlich Trump selbst in Mar-a-Lago. Michael Wolffs Buch schildert von Tag zu Tag, aus erster Hand, jene dramatische Zeit, in der die amerikanische Demokratie auf der Kippe stand.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Michael Wolff
77 Tage
Amerika am Abgrund: Das Ende von Trumps Amtszeit
Über dieses Buch
Michael Wolff beschrieb in seinem Bestseller «Feuer und Zorn» die ersten fiebrigen Monate der Trump-Regierung. Nun haben sich ihm wieder hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses anvertraut: Wolff liefert eine aktuelle Darstellung der letzten Wochen von Trumps Präsidentschaft und der Versuche des Präsidenten und seines Umfelds, das Wahlergebnis vom November 2020 auf jedem nur denkbaren Weg zu korrigieren. Er schreibt über den Wahn eines Verlierers, den Kampf der Anwälte um Rudy Giuliani, den Angriff aufs Kapitol und über das endgültige Ende einer denkwürdigen und gefährlichen Regierungszeit – und interviewt schließlich Trump selbst in Mar-a-Lago. Michael Wolffs Buch schildert von Tag zu Tag, aus erster Hand, jene dramatische Zeit, in der die amerikanische Demokratie auf der Kippe stand.
Vita
Michael Wolff, 1953 geboren, ist Journalist und Autor. Wolff hat zahlreiche Preise für seine Arbeit erhalten, darunter zweimal den National Magazine Award. Er schreibt für Vanity Fair, New York und The Hollywood Reporter und hat acht Bücher verfasst, darunter den Bestseller «Feuer und Zorn» über die ersten Monate der Trump-Präsidentschaft und «Unter Beschuss». Michael Wolff lebt mit seiner Familie in New York.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Landslide» bei Henry Holt and Company, New York
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg,
Originalausgabe © 2021 by Michael Wolff Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Lektorat Kristian Wachinger
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, nach dem Original von Henry Holt and Company; Jacket design by Christopher Sergio
Coverabbildung Tasos Katopodis/Getty Images
ISBN 978-3-644-01224-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Paolo Lanapoppi
«Wir haben gesiegt. In einem Erdrutsch gesiegt. Es war ein Erdrutschsieg.»
Präsident Donald J. Trump am 6. Januar 2021
Einleitung
Aus der New York Times vom 31. Januar 2021:
… eine Untersuchung der 77 die Demokratie untergrabenden Tage zwischen der Wahl und der Inauguration zeigt, wie in einem von der Pandemie gebeutelten Land, in dem Verschwörungstheorien grassierten, eine Lüge des Mr. Trump, die er jahrelang gehegt und gepflegt hatte, schließlich die Republikanische Partei überwältigte und, als eine Bremse nach der anderen gelöst wurde, immer mehr Fahrt aufnahm, unterstützt von neuen und radikaleren Anwälten, Politikern, Geldgebern und dem Surround-Sound rechter Medien.
Nach jenem zerstörerischen Nachmittag am Kapitol tauchte die Lesart auf, entropische Kräfte seien in Trumps Namen in einem ungeplanten, allerdings verhängnisvollen Ausbruch von Wut und Verdrängung entfesselt worden.
Interviews mit wesentlichen Akteuren und Dokumente wie bislang unveröffentlichte E-Mails, Videos und Posts auf sozialen Netzwerken lassen jedoch eine umfassender koordinierte Aktion erkennen.
In diesen 77 Tagen rief der scheidende Präsident die Mächte des Chaos herbei und wiegelte sie auf. Dabei nutzte er die Macht, die ihm seine treuen Parteianhänger verliehen, indem sie ihn für nahezu unfehlbar erklärten, zu einem letzten die Regeln verletzenden Akt einer Präsidentschaft, die auf dem Leugnen der Realität beruhte.
Wobei …
In den Tagen und Wochen nach dem Wahltag des 3. November wurde der Präsident von seinen Beratern und Mitarbeitern im Stich gelassen. Das politische Establishment ließ ihn fallen, zumindest all jene mit einer vielversprechenden Karriere. Die unglückselige Schar seiner Mitverschwörer war entweder zu verrückt oder zu betrunken oder zu zynisch, um eine glaubwürdige Strategie zu entwickeln und in die Tat umzusetzen. Es war einfach eine beschissene Show – lächerlich, unerklärlich, peinlich, wahnsinnig, sogar für die Leute, die ihm größte Loyalität bewiesen. Die Anfechtung der Wahl war von Anfang an zum Scheitern verurteilt.
Trumps ganze Präsidentschaft war das Gegenteil von guter Regierung und normaler Funktionalität eines Staatsapparats, doch in seinen letzten Tagen entfernte er sich um einen weiteren Quantensprung von jeglichem System, das ihm Unterstützung oder Wahlerfolge hätte bieten können – und sei es nur ein erschwindeltes oder fingiertes Resultat.
Im zweiten Amtsenthebungsverfahren wurde Donald Trump wegen seiner expliziten Pläne und Strategien und Absichten angeklagt – seine letzten Tage im Amt als der ausgeklügelte Versuch, alles für den Erhalt seiner Präsidentschaft zu tun. Aber jene, die Trump aus der Nähe erlebten, selbst jene, die glaubten, dass er sich vieler Vergehen schuldig gemacht hatte, hielten diese Einschätzung für falsch. Im Gegenteil: Trumps wahrer Anschlag auf die Normen der Demokratie war gewesen, dass er Organisation, Strategie, Methode, rationales Denken und bewusste Entscheidungsfindung aus der höchsten Regierungsebene verbannte.
Als Trump in das politische Leben Amerikas einzudringen begann, waren seine Fahrlässigkeit und Ignoranz für die zielstrebige, geordnete, ergebnisorientierte, liberale Welt und ihre Medien völlig unvorstellbar, und bis heute gelingt es ihnen mit ihren normalen politischen Maßstäben nicht, ihn und seine Unterstützer zu verstehen. Was ihnen verrückt und selbstzerstörerisch erscheint, musste doch Teil eines Plans sein.
Politik konnte schließlich nicht pure Launenhaftigkeit und Farce sein, oder?
Durch dieses Festhalten an einer bestimmten Intention, an einem kalkulierten oder «koordinierten» Machtmissbrauch wird Donald Trump im Bereich einer einschätzbaren Politik gelassen. Was aber, wenn es genau die Abwesenheit einer Intention oder sogar das Auf und Ab von Unvernunft und Verrücktheit waren, was so viele Menschen in seinen Bann zog, selbst noch, als seine Regierung in sich zusammenbrach?
Die grundlegende moderne Annahme geht dahin, dass eine verrückte Person nicht zum Präsidenten gewählt werden kann – ein böser Mensch, ein korrupter, ein inkompetenter, ein verlogener, ein heuchlerischer Mensch ja, aber keiner, der sich völlig von der Wirklichkeit verabschiedet hat. Der heutige Politikbetrieb verlangt einem zumindest ab, eine Sitzung bis zum Ende durchzustehen, ohne wie ein Hund zu bellen.
Vom Schlingerkurs der katastrophalen letzten Phase seines Wahlkampfes zur Wiederwahl über seine absurde Anfechtung des Ergebnisses und das tödliche Chaos des 6. Januar bis hin zu der unsäglichen Clownsposse bei seinem zweiten Amtsenthebungsverfahren entsteht ein ganz anderes Bild als das überwiegend von den Medien gezeichnete eines korrupten, zynischen und despotischen Versuchs, an der Macht festzuhalten und die Demokratie zu unterwandern. Hier zeigt sich vielmehr eine deutlich kompliziertere menschliche und politische Geschichte der Verzweiflung und Verblendung.
Nach allen Regeln der Vernunft hätte diese Geschichte am 6. Januar enden müssen. Aber die herausragende und dieses politische Zeitalter bestimmende Tatsache ist, dass die Trump-Saga weitergesponnen wird und dass sie selbst in der Niederlage weiterhin so viele Menschen inspiriert – und dass alle Wege der Republikaner jetzt nach Mar-a-Lago führen. «Mr. President», sagte der Meinungsforscher Tony Fabrizio, als er Trump zu erklären versuchte, was er selbst nicht ganz verstand, «Ihre Wähler glauben alles, wenn Sie ihnen sagen, dass sie es glauben sollen.» Tatsächlich zeigte eine Umfrage Mitte Mai 2021, dass 67 Prozent der Republikaner glaubten, Joe Biden hätte die Präsidentschaftswahl 2020 nicht rechtmäßig gewonnen.
Trump macht nichts richtig. Kann sich nicht ein Hosenbein nach dem anderen anziehen. Seine stümperhaften, zum Scheitern verurteilten und peinlichen Versuche, die Wahl rückgängig zu machen, sowie sein fahrlässiger Ruf zu den Waffen am 6. Januar zeigten ihn erneut als den Kaiser ohne Kleider, dessen Nacktheit nicht nur seine Feinde erkannten, sondern, mit immer tieferem ungläubigem Seufzen, auch seine Verbündeten. Und trotz alledem sind wir an einem Punkt angelangt, an dem er das Herz von knapp der Hälfte der Menschen seines Landes in der Hand hält, der einstige und zukünftige Donald Trump, der seine Wunden leckt und mit dem Blick auf sein Publikum darüber sinniert, welche neuen, absurden und unüberlegten Heldentaten er in Angriff nehmen soll.
Dies ist das dritte Buch, das ich in drei Jahren über Donald Trump geschrieben habe. Aufgrund dieser Chronistentätigkeit habe ich fast jede Phase Trumps im Weißen Haus aus nächster Nähe miterlebt und war mit fast allen Mitgliedern seiner ständig wechselnden Belegschaft in engem Kontakt. Sehr viele von ihnen aus dem West Wing, aus dem Wahlkampf und der Republikanischen Partei haben zu diesem Bericht beigetragen, auch Donald Trump selbst.
Dem Büro des ehemaligen Präsidenten wurde eine detaillierte Zusammenfassung eines Großteils des Materials in diesem Buch zur Verfügung gestellt. Sein Mitarbeiterstab hat Begebenheiten, Gespräche und verschiedene Details aus der Trumpwelt, wie ich sie beschrieben habe, entweder bestätigt oder Korrekturvorschläge gemacht. Wenn dabei Fakten bestritten wurden, fanden sie nur Aufnahme ins Buch, wenn sie durch andere Quellen bestätigt werden konnten.
Viele, die mit mir über diese Ereignisse gesprochen haben, baten mich, ihre Anonymität zu wahren – aus Gründen, die im Verlauf dieser Geschichte offensichtlich werden.
PrologImpeachment
Tippfehler brachten ihn auf die Palme. Er konnte tagelang toben, wenn er einen entdeckte oder, was wahrscheinlicher war, wenn jemand anderer auf einen Schnitzer in einem Dokument hinwies, das in seinem Namen erstellt wurde – die hilflose Wut von jemandem, der befürchtet, die Nachlässigkeit anderer lasse seine eigenen Schwächen sichtbar werden.
Diesmal schäumte er vor Wut, weil ein juristischer Schriftsatz voller Fehler war, in dieser Woche nun schon der zweite – die Vereinten Staaten! In der ersten Zeile! Ein Staatsstreich! Und noch viel mehr. Die Presse stürzte sich bereits auf ihn, er machte sich vollends lächerlich – in gewisser Weise war das eine noch schlimmere Erniedrigung und noch mehr Grund für einen Wutausbruch als das zweite Amtsenthebungsverfahren, mit dem er gerade überzogen wurde.
Dafür musste jemand büßen – wer immer das freigegeben hatte, war gefeuert. Sollte sofort verschwinden! Er telefonierte einen nach dem anderen seiner verbliebenen Berater ab. «Was, verdammt noch mal, läuft bei diesen Leuten verkehrt? Können die nicht mal die Rechtschreibprüfung einschalten?» Die Rechtschreibprüfung – im Kopf eines Mannes, der nicht einmal einen Computer benutzte, war das die Lösung.
Der Übeltäter jedoch konnte realistisch betrachtet nicht so leicht rausgeschmissen werden, denn es war der leitende Anwalt im Amtsenthebungsverfahren des Präsidenten, Bruce Castor. Erst seit wenigen Tagen mit dem wichtigsten Auftrag seiner Berufslaufbahn betraut, hatte Castor an diesem Morgen, am 8. Februar 2021 um 3 Uhr 40, den Schriftsatz in aller Eile gelesen und sofort abgeschickt. Niemand hatte ihn Korrektur gelesen.
Castor versuchte, dies dem ehemaligen Präsidenten zu erklären, der ihn ständig unterbrach und seine Ausreden schneidend, schroff, spöttisch und unnachgiebig zurückwies. «Die Rechtschreibprüfung erfasst kursiv gesetzte Wörter nicht», sagte Castor, noch einer, der wohl eher selten einen Computer benutzt.
«Wie bitte? Das ist das Bescheuertste, was ich je gehört habe! Bringen Sie das in Ordnung! JETZT!», brüllte der ungläubige Präsident, wie so oft halb am Durchdrehen.
Das war es auch, was das zusammengekauerte Grüppchen auf dem vereisten Gehsteig vor dem Trump International Hotel in Washington wie ein kopfloses Huhn versuchte – während es zur gleichen Zeit, ohne Vorbereitung oder ernstzunehmende Vorkehrungen, versuchte, den Präsidenten vor einer bodenlosen Schande zu bewahren. Sie korrigierten Tippfehler. JETZT!
«Kann man dämlicher sein als diese Anwälte?», schimpfte Trump jedem gegenüber, der es hören wollte. «Kann man noch dämlicher sein?»
Das weitaus größere Problem, das nun von diesem Rechtschreib-Drama überschattet wurde, war das vierte Impeachment-Verfahren in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dessen Beginn für den folgenden Tag angesetzt war und das von Anwälten geführt werden sollte, die den Fall erst vor einer Woche übernommen hatten. Von den drei Hauptanwälten, Castor, David Schoen und Mike van der Veen, hatte Trump noch keinen persönlich getroffen, und mit van der Veen hatte er noch nicht einmal gesprochen (tatsächlich der einzige der Anwälte, der von Trump einen gewissen bleibenden Respekt erfahren würde).
Castor saß in einem G-Klasse-Mercedes und wartete darauf, einen Rundgang durchs Kapitol zu machen und die Republikanischen Senatsmitarbeiter zu treffen. Außerdem standen da noch ein Jeep Rubicon und ein Range Rover, die darauf warteten, das neue Team zur Verhandlung im Senat zu bringen. Castor fühlte sich noch immer getroffen, weil Trumps Leute ihm nicht erlaubt hatten, mit seiner geliebten Corvette am Kapitol vorzufahren. So hatte er sich das vorgestellt. Das war einer der Gründe, warum er den Fall übernommen hatte: dieses Bild. «Die Corvette, das bin ich. Sie ist so was wie meine Visitenkarte.»
Die verbliebenen Berater Trumps – an diesem Punkt bereits gegen jede Überraschung gefeit – konnten es kaum fassen. In Trumps Kreisen war fehlendes Gespür für Situationen, gelinde gesagt, ein häufig auftretendes Problem, aber eine Corvette vor dem Kapitol der Vereinigten Staaten, das noch ganz unter dem Schock des gewalttätigen Sturms stand, den man dem Präsidenten zu Füßen gelegt hatte?
Trumps Anwälte – nicht diese Anwälte, sondern Trumps ehemalige Anwälte, von denen einige beim ersten Amtsenthebungsverfahren dabei waren, die jetzt versuchten, bei diesem Impeachment-Schlamassel nicht im Vordergrund zu stehen – wurden ihrerseits vom ehemaligen Präsidenten wegen der neuen Anwälte zusammengestaucht. «Wer sind die? Woher kommen die? Wer hat sie beauftragt? Warum gerate immer ich an die schlechtesten Anwälte?»
Irgendwie, und aus einem für niemanden, außer für Bruce Castor und den Rest der neuen Anwälte, ersichtlichen Grund, war Trumps juristische Bezugsperson Eric Herschmann. Herschmann war ein Jahr zuvor, während des letzten Amtsenthebungsverfahrens, im Trumpuniversum aufgetaucht und trieb sich noch immer im Weißen Haus herum, abwechselnd mit der Aufgabe betraut, den White House Counsel, das Rechtsbüro im Weißen Haus, zu leiten, dann als Wahlkampf- und Politikberater im West Wing – er war einer der vielen, die Schwiegersohn und ranghöchster Berater Jared Kushner als Babysitter für den Präsidenten einsetzte.
Auch Herschmann hing an seinen Autos und parkte seinen Lamborghini unpassenderweise neben den Staatskarossen auf dem Parkplatz des Weißen Hauses. Doch nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar und vor dem zweiten Impeachment-Verfahren hatte Herschmann sich schleunigst aus dem Staub gemacht. Tatsächlich waren sämtliche Anwälte, die in Trumps erstes Amtsenthebungsverfahren involviert waren, praktischerweise nicht verfügbar. Dennoch, ähnlich wie Trumps ehemaliger Anwalt Michael Cohen, der dem Präsidenten bei all seinen Vergehen zur Seite gestanden hatte, die er, Cohen, seitdem widerrufen hat, man verlässt Donald Trump nicht so einfach. Vielleicht weil er einen ständig am Telefon anschnauzt oder einfach nur weil einen das Drama wieder zurückrief, das Drama des außer Kontrolle geratenen Zuges. Sollte man nicht bleiben, um das Ende mitzuerleben: das haarsträubendste Fiasko aller Zeiten?
Und tatsächlich waren Schoen und Castor inzwischen wütend auf Herschmann, der sich in Deckung hielt, aber trotzdem noch versuchte, seinen Platz im Trumpuniversum zu halten und alles zu steuern. Na ja, richtiger ist, niemand hat da etwas gesteuert; Herschmann steuerte etwas mehr als sie, weil er öfter mit dem Ex-Präsidenten telefonierte – der war wütend, rasend vor Zorn, nörgelte ununterbrochen herum, unumstößlich in seinen Gewissheiten, so wie immer.
Er erging sich seinem Anwaltsteam gegenüber in endlosen Tiraden, das Verfahren dürfe nicht so über die Bühne gehen – Formsachen, Meinungsfreiheit, Rechtsprechung, dieser ganze Schwachsinn. Er wollte, dass seine Verteidigung darin bestand zu beweisen, dass man ihm seine Wahl gestohlen hatte. Sie war gestohlen! Jeder wusste, dass sie gestohlen war. Und dies war die Gelegenheit, den Fall darzulegen! Und wirklich schlug der vormalige Präsident vor, seinen Fall vor dem Senat selbst zu vertreten!
Doch war just dies der Anklagepunkt, bei dem Herschmann und so ziemlich jeder, der mit dem Verfahren zu tun hatte, keinerlei Zweifel hegte, dass der ehemalige Präsident verurteilt werden würde. Einmal mehr versuchten alle, Trump vor sich selbst zu schützen – das war noch nie ein vielversprechendes Unterfangen gewesen.
Es gab akutere Probleme. Das disparate Grüppchen – keiner von ihnen war besonders gesprächig – saß draußen vor dem Hotel in der Kälte fest. Die Trump-Truppe, die verbliebene Gefolgschaft und ein paar Übriggebliebene, versuchte, sie alle anzutreiben – und dazu zu bringen, schnellstmöglich die Tippfehler zu korrigieren. Doch nach dem 6. Januar war das Kapitol regelrecht abgeschottet. Es gab neue Straßensperren und Kontrollposten, die passiert werden mussten. Die Temperaturen lagen ein Grad unter null, es war eiskalt, und sie standen schon seit zwanzig Minuten draußen (mit Ausnahme von Castor, in dessen Mercedes die Heizung lief). Und außer diesem Jemand, der ihnen gesagt hatte, sie müssten warten, schien keiner zu wissen, warum; und Adam war nicht da.
Wer, fragte schließlich jemand, ist Adam?
Adam war der Rechtsreferendar, der den Jeep fahren wollte.
Und warum ist Adam nicht da?
«Er nimmt auf Zoom an einer Prüfung der juristischen Fakultät teil.»
Einer der Trump-Witzbolde bemerkte dazu: «Da haben wir sämtliche Anwälte durchlaufen, und jetzt sind wir bei den Jurastudenten gelandet.»
Schließlich verfrachteten die Trump-Jungs die Leute in zwei Autos, den Jeep und Adam ließen sie zurück.
Im Kapitol zwängten sich zwei Dutzend Leute in Raum S-211, den Lyndon-Baines-Johnson-Raum gegenüber dem Senatsflügel. Es herrschte ein Gedränge aus Trump-Anwälten, Servicemitarbeitern, Mitgliedern der Presseabteilung und Leuten aus dem Büro des Republikanischen Fraktionsvorsitzenden Mitch McConnell: David Popp, der Pressesprecher von McConnell, Stefanie Muchow, seine stellvertretende Stabschefin, und Andrew Ferguson, der Verteidiger vor dem Nebenausschuss, die alle drei eher kleinlaut wirkten in ihrer plötzlichen Rolle als Trumps Händchenhalter und sich ihrer Funktion genauso wenig sicher waren wie alle anderen.
Es war dies das erste persönliche Zusammentreffen von Trumps Verteidigungsteam und der Parteiführung der Republikaner, von der Trumps Schicksal abhing. Zu behaupten, dass auf Seiten der Verteidigung niemand auch nur die leiseste Idee davon hatte, welche Vorgehensweise die jeweils anderen für das vierte Impeachment-Verfahren in der Geschichte, aber eben auch das zweite in dreizehn Monaten, im Sinn hatten, wäre geradezu eine Untertreibung. Auch hier mal wieder die vertraute Trump’sche Verkettung: Jeder hoffte, dass sich irgendein anderer einen Reim auf die Plan- und Ziellosigkeit machen konnte, die Donald Trump stets begleitete, oder der zumindest den ersten Schritt machte, um es zu versuchen.
Die Leute von McConnell, die ja irgendwie den Anschein würden erwecken müssen, dass es hier eine vernünftige Verteidigungsstrategie gäbe, und die in der Tat über vier Jahre Erfahrung im Umgang mit den fundamentalen Eigenheiten des Weißen Hauses unter Trump verfügten, wirkten dennoch wie aus allen Wolken gefallen und fassungslos: Die Demokraten verfügten über eine neue Mehrheit, eine gerechte Sache, und obendrein hatten sie dieses Amtsenthebungsverfahren eben vor einem Jahr schon einmal geprobt. Das Trump-Team seinerseits, das man, weiß der Himmel wo, aufgetrieben hatte, sah gewiss nicht nach einer Truppe aus, die einen geraden Schuss zustande brachte – eher schienen sie sich gegenseitig abzuschießen.
Bruce Castor, der noch immer versuchte, die Tippfehler zu korrigieren, kümmerte sich auch noch bis ins kleinste Detail um die Sitzordnung der Verteidiger in der Senatskammer, wo jeder für die dort fest installierte Fernsehkamera positioniert werden sollte. Präsenz im Fernsehen war der Lohn.
David Schoen, ein selbständiger Jurist aus Montgomery, Alabama, war von Trump zum leitenden Anwalt bestimmt worden. Doch dann erklärte Bruce Castor dem Team, dass in Wirklichkeit verdammt noch mal er der leitende Anwalt sei. Das war, nachdem die erste Riege an Anwälten – eine Gruppe von Typen aus South Carolina, die der Senator ebendieses Bundesstaats, Lindsey Graham, nach einer Golfrunde mit Trump zusammengetrommelt hatte – innerhalb weniger Tage nach ihrer Einsetzung wieder entlassen worden war.
Das versetzte Schoen in mürrisch-explosive Stimmung – eine Art Streik, wie es plötzlich schien, nur einen Tag bevor das Verfahren eröffnet wurde. Und da war sie nun, die Krise, die alles anhalten ließ: Castor hatte für Schoens Sohn im Studentenalter, Simon, keinen Platz vor dem Senat reserviert!
Es war schwer zu verstehen, warum jemand Donald J. Trumps Verteidigung übernahm. Die meisten Anwälte haben – wieder und wieder – eine solche Gelegenheit gescheut. Hier freilich könnte ein nachvollziehbarer Grund zu finden sein: Schoen wollte seinen Sprössling beeindrucken.
«Wo wird Simon sitzen? Es ist für Simon kein Platz vorgesehen. Mir wurde gesagt, Simon könne mich begleiten.» Schoen war drauf und dran, die Nerven zu verlieren, während McConnells Berater in Schockstarre gerieten.
In dem kalten Dunstkreis Donald Trumps, wo in der Regel nur die Gefühle eines einzigen Mannes zählten, war dies ein bizarrer menschlicher Ausraster, mit dem niemand umzugehen wusste.
«Mir wurde gesagt, ich kann Simon mitnehmen», wiederholte Schoen und verharrte auf seinem Standpunkt.
Im Raum herrschte ein kollektives Oh-Oh, alle versuchten, Blickkontakt zu vermeiden, und schienen bestürzter denn je über die grundlegenden Funktionsweisen, mit denen Donald Trump sich zu verteidigen gedachte, wenn einer seiner führenden Anwälte gleich losheulen würde.
«Sie haben Assistenten. Ich habe niemanden.» Schoen verschränkte die Arme.
«Aber es gibt nur eine beschränkte Anzahl an Plätzen, und er ist nicht direkt in den Fall involviert», versuchte Castor seinen neuen Kollegen zu beschwichtigen.
«Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht der Punkt!», erwiderte Schoen mit brechender Stimme. «Mir wurde gesagt, ich kann ihn dabeihaben. Ich will, dass er dabei ist», sagte der empörte Vater – die bedeutendere Rolle als die des Präsidentenverteidigers.
«Dad, Dad, ist schon okay», sagte der Sohn schließlich, im letzten Moment, bevor das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump aussah, als würde es in völliger Absurdität, Unzulänglichkeit und Tränen versinken, und sich alle in Raum S-211 fragten – wie übrigens jeder, der sich im Trumpuniversum wiederfand –, an was für einen irrsinnigen Ort es sie verschlagen hatte.
1Todesstern
Der Präsident hatte etwas läuten hören, das ihm eine Heidenangst machte und seine Kampagne jäh zum Stillstand brachte. Der 2020er-Wahlkampf bewegte sich gerade auf die entscheidenden Sommermonate zu. Während Joe Biden sich in seinem Keller verbarrikadierte, prasselte der ganze Corona-Ärger auf den Präsidenten ein, und er konnte nicht mit seinen Großveranstaltungen gegenhalten. Denn Joe Biden anzugreifen, ihn so richtig fertigzumachen, wie nur er, Trump, es konnte, das war genau das, was die Demokraten wollten – und ebendeshalb würde er es nicht tun. So bescheuert war er ja nun nicht.
Brad Parscale, der von der Familie Trump ernannte Wahlkampfleiter, hatte eine der gewaltigsten politischen Geldmaschinen aller Zeiten, eine wahre Cadillac-Kampagne, gebastelt und musste jetzt mit ansehen, wie die Umfragewerte sich verschlechterten und alles den Bach runterging, nur weil Donald Trump sich scheute, zur Attacke zu blasen. Weil die Demokraten ihn verarschten!
Jared Kushner, Schwiegersohn des Präsidenten und Strippenzieher hinter den Kulissen, forderte Parscale auf, die Initiative zu ergreifen. Wir brauchen eine neue Strategie. Wir brauchen den allerbesten Strategen. Rufen Sie Karl Rove an.
Parscale flehte Rove an, so schnell wie möglich nach Washington zu kommen. Er müsse sich mit dem Präsidenten zusammensetzen. Die Demokraten machten ihn völlig kirre. Sie hätten sich eine teuflische Strategie ausgedacht. Trump und die Partei bräuchten ihn, Rove, dringend.
Rove, ehemals führender Kopf hinter der Regierungsmannschaft von George W. Bush, war unter den alten Parteihasen eine der beliebtesten Zielscheiben für Trump’sche Verunglimpfungen. («Er sieht so dermaßen bescheuert aus mit seinem komischen Whiteboard», höhnte Trump jedes Mal, wenn Rove an Wahlabenden bei Fox News auftrat und die vorliegenden Ergebnisse kommentierte.) Aber er war ein Profi, sprich: eine seltene Spezies in der Trumpwelt.
Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie verließ Rove sein Zuhause in Texas, um nach Washington zu fliegen, wo ein Geheimtreffen mit dem Präsidenten anberaumt war. Als man ihn ins Oval Office führte, musste er jedoch verblüfft feststellen, dass dort bereits fünfzehn Personen versammelt waren. Rove hatte acht Jahre lang in diesem Trakt des Weißen Hauses gearbeitet, zu einer Zeit, als noch nicht Hinz und Kunz hier Zugang hatten. Jetzt ging es zu wie an einer Bushaltestelle. Oder wie in der Barszene in Krieg der Sterne, so der Eindruck von Trump-Mitarbeitern, die ebenfalls einigermaßen fassungslos das Kommen und Gehen befremdlicher Gestalten im Oval Office beobachteten.
Anwesend waren Parscale und Kushner; Ronna McDaniel, Vorsitzende des Republican National Committee (RNC); Mark Meadows, neu ernannter Stabschef; Dan Scavino, der die Twitter-Accounts des Präsidenten betreute; Hope Hicks, persönliche Beraterin des Präsidenten, die ihm bei Bedarf auch das Händchen hielt; und noch eine Reihe anderer, die Rove nicht kannte.
Der Präsident – der in Roves Ohren ein bisschen klang wie Alec Baldwins Imitation von Trump in Saturday Night Live, eine Imitation (der Imitation) also, die Rove selbst häufig zum Besten gab – skizzierte das Dilemma: Die Demokraten, so hatte man ihm zugetragen, setzten darauf, dass er Biden frontal attackieren würde, um ihn zu schwächen und zu vernichten. Und dann, wenn er «Sleepy Joe» vernichtet hätte, wie nur er, Trump, es konnte, dann wollten die Demokraten, und das habe er aus supergeheimer Quelle, Biden als Kandidaten zurückziehen und ersetzen durch … Andrew Cuomo. Der Gouverneur von New York hatte mit vielbeachteten und populären täglichen Fernsehauftritten die Corona-Politik des Weißen Hauses in schlechtem Licht erscheinen lassen – für den Präsidenten ein permanenter Affront.
«Selbst wenn wir mal annehmen, dass das der Plan ist», entgegnete Rove, der diese Theorie für vollkommen lächerlich hielt, «warum sollte Bernie Sanders» – der eindeutige Zweite im Nominierungsrennen der Demokraten – «so etwas zulassen?»
«Weil», sagte der erregte Präsident mit gesenkter Stimme, «das alles von den Obamas koordiniert wird. Und», fügte Trump in noch düstererem Ton hinzu, «es sieht ganz so aus, als würde Michelle als Vizepräsidentschaftskandidatin mit Cuomo antreten.»
So respektvoll, wie es ihm möglich war, gab Rove zu verstehen, dass er dies für eine, um das Mindeste zu sagen, recht bizarre Theorie halte. Trump, in seiner üblichen schmeichlerischen Art, bekundete Respekt für Roves Einwände, schließlich sei er ja der Klügste von allen, dennoch sei er, der Präsident, felsenfest davon überzeugt, dass hier eine ausnehmend raffinierte Verschwörung im Gange sei – wieder einmal!
Die Diskussion zwischen den fünfzehn Personen im Raum – einige beteiligten sich, andere waren aus für Rove nicht einsichtigen Gründen dabei – dauerte etwa eine Stunde. Sollte man Biden angreifen und damit das Risiko Cuomo eingehen? Sollte man Biden in Ruhe lassen, bis es für die Demokraten zu spät wäre, ihn zu ersetzen? Aber wie stark könnte er vielleicht werden, wenn man ihm nicht in seinem Keller zu Leibe rückte? Und würde nicht Michelle Obama den sicheren Untergang für das Trump-Lager bedeuten? Was also war zu tun?
«Mein Gott, wo hat er das bloß her?», wandte Rove sich an Parscale, der ihn nach draußen geleitete.
«Sean Hannity.»
«Sean Hannity?», wiederholte Rove, der nicht glauben mochte, dass der Moderator von Fox News, berüchtigt für seine ausgefallenen Verschwörungstheorien, die Ausrichtung des präsidentiellen Wahlkampfs bestimmte.
«Der Präsident glaubt daran», sagte Parscale, sichtlich hilflos. «Vielleicht könnten Sie Hannity anrufen und ihm sagen, er soll sich zurückhalten, das wäre bestimmt hilfreich.»
Die Entscheidungsschwäche des Präsidenten, seine Ressentiments, seine Desorganisation, seine Neigung, sich ständig als Opfer zu betrachten, sich immer an das zu halten, was ihm irgendwer zuletzt eingeflüstert hatte, und ebenso die kluge, aus Gründen des Selbstschutzes zu befolgende Devise seines Schwiegersohns, ihm nie direkt zu widersprechen – all das spiegelte dieser Wahlkampf in konzentrierter Form wider. Doch die Schuld für die implodierende Kampagne wurde jetzt Bradley Parscale in die Schuhe geschoben, dem Website-Designer aus San Antonio, Texas, der 2016 als «Mann fürs Digitale» angefangen hatte und dann, von Kushner und Trumps Kindern persönlich ausgewählt, zum Wahlkampfmanager aufgestiegen war und der das milliardenschwere politische Unternehmen Trumps stolz als den «Todesstern» bezeichnete – eine seltsame Metapher, wenn man bedenkt, dass es den Rebellen in den Krieg-der-Sterne-Filmen gelungen war, das riesige Bauwerk des Imperiums anzugreifen und zu zerstören.
Am 13. Juli traf man, wiederum in großer Runde, zu einer Art Rette-sich-wer-kann-Sitzung im Oval Office zusammen. Der hochgradig angepisste Präsident saß hinter dem Resolute Desk und signierte Fotos, während er strenge Blicke schweifen ließ. Offizieller Zweck des Treffens war es, Schuldige zu benennen für die Tatsache, dass in einem Monat der Nominierungsparteitag der Republikaner anstand und eine ausgemachte Katastrophe zu werden versprach. Nachdem man die Veranstaltung in Charlotte, North Carolina, hatte absagen müssen – buchstäblich rausgeschmissen von den Stadtvätern, die wegen Corona Panik bekommen hatten –, gab es momentan noch keinen Plan für den neuen Veranstaltungsort in Jacksonville, Florida. Der Programmleiter in Charlotte hatte sich – obwohl schon bezahlt! – einfach aus dem Staub gemacht. In Jacksonville war kein Tagungsort fest gebucht, es gab kein Programm, keinen Programmleiter, es waren keine Reden geschrieben, keine Redner bestimmt, und das Geld war so gut wie alle, weil das Organisationskomitee sich schon in Charlotte vertraglich verpflichtet hatte.
Tatsächlich war der Schlamassel großenteils auf den Widerwillen des Präsidenten zurückzuführen, auf eine große Abschluss-Massenveranstaltung, also das ultimative Trump-Event, zu verzichten. Trotzdem wurde die Schuld jetzt bei allen anderen gesucht.
«Ich dachte, Sie würden das machen», hatte Parscale, der Verzweiflung nahe, vor ein paar Tagen zur RNC-Vorsitzenden McDaniel gesagt, die im Oval Office angetreten war, um sich zu verteidigen.
«Den Parteitag planen? Entschuldigung, aber das ist Ihr Job.»
McDaniel, eine Nichte von Mitt Romney, dem Republikanischen Präsidentschaftskandidaten von 2012 – sie hatte immer stolz den Namen «Ronna Romney McDaniel» getragen, bis Trump ihr nahelegte, das «Romney» wegzulassen –, war jetzt in ihrer leitenden Parteifunktion Trumps Adjutantin, eine Karrieristin mit der Begabung, im richtigen Moment die Klappe zu halten. Sie wurde begleitet von ihrem Stabschef Richard Walters, der eine Akte mit Unterlagen zu möglichen Veranstaltungsorten in Jacksonville unterm Arm trug. Jason Miller, der sich ohne Schutzmaske direkt vor dem Schreibtisch platziert hatte, versuchte den gebotenen Hygieneabstand zu dem Vorstandspärchen einzuhalten. Kushner hatte Miller, der, noch vom letzten Wahlkampf her, eine beruhigende Wirkung auf den Präsidenten ausübte, erst kürzlich wieder in den engeren Kreis geholt, nachdem er 2016 in Ungnade gefallen war wegen seiner Affäre mit einer Mitarbeiterin, die er geschwängert hatte und die seither, weil er sich weigerte, seine Ehefrau zu verlassen, unnachgiebig und unermüdlich auf Twitter gegen ihn vom Leder zog; jetzt, vier Jahre später, war sie immer noch am Twittern. Anwesend war auch Lara Trump, die sich im Wettstreit mit den anderen Ehefrauen und Freundinnen der Trump-Brüder als das diensteifrigste unter den angeheirateten Familienmitgliedern erwiesen hatte (wenn auch neuerdings hart bedrängt von Don Juniors Freundin Kimberly Guilfoyle). Neben ihr saß ein bedröppelt dreinschauender, in sich zusammengesunkener Parscale. Gut zwei Meter groß, schien Parscale sich immer irgendwie klein machen zu wollen, um möglichst nicht den theoretisch eins neunzig großen Präsidenten zu überragen, der schlechte Laune bekam, wenn er nicht der größte Mann im Raum war. Mike Pence, der stets lächelnde Vizepräsident, saß zur Linken des Präsidenten. Kushner, Bill Stepien, einer von Parscales Stellvertretern, und Marc Short, Stabschef des Vizepräsidenten, saßen sich auf den Sofas gegenüber, zwischen ihnen ein Modell des Präsidentenflugzeugs Air Force One.
Der Präsident jedoch schien nicht imstande, sich auf das drohende Parteitagsdesaster zu konzentrieren. Er kam auf ein anderes Desaster von vor ein paar Wochen zu sprechen. Er hatte sich eine gigantische Wahlkampfkundgebung gewünscht – aber nicht irgendwo draußen, sondern in der Halle! –, um zu demonstrieren, dass seine Anhänger mehr Sehnsucht nach ihm als Angst vor Corona hatten, und um seiner Basis zu zeigen, dass er viel zäher war als Sleepy Joe Biden, der sich in seinem Keller versteckte.
«Ich brauche meine Leute, ich brauche meine Leute», lautete seine wiederholte Klage, woraus Parscale die an alle weiterzugebende Losung machte: «Wir müssen ihm seine Leute besorgen.»
Herausgekommen war dabei die Kundgebung in Tulsa. Parscale verkündete eine der größten Besucherzahlen in der Laufbahn des Präsidenten: Es gebe eine Million Ticketanfragen, twitterte er in verhängnisvollem Überschwang. Aber ach. Nach Angaben des Trump’schen Wahlkampfteams bezifferte der Secret Service die endgültige Teilnehmerzahl auf zwölftausend, der Brandschutzbeauftragte hingegen kam auf sechstausend, und das sollte nun also die größte (und teuerste) Kundgebung aller Zeiten gewesen sein. Eine totale Pleite, eine Katastrophe sondergleichen. (Hinzu kam, dass eine ganze Reihe von Trump-Mitarbeitern sich auf der Kundgebung mit dem Virus infizierten. In seiner Wut befahl Trump, alle Tests einzustellen, damit nicht noch mehr Fälle bekannt würden.)
«Hat Brad überhaupt schon mal irgendwas richtig gemacht?» Der wutschnaubende Präsident sprach in die Runde, als wäre Parscale gar nicht anwesend. «Er hat nur Scheiße gebaut.» Drohend über seine fotoreif saubere Schreibtischplatte gebeugt, aus der lediglich der rote Knopf für die Bestellung seiner Cola lights hervorstach, explodierte er förmlich: «Wie kann man nur so bescheuert sein. Antworten Sie!», fuhr er Parscale vor allen Leuten an.
Stotternd suchte Parscale nach Rechtfertigungen, doch dann hielt er lieber den Mund und ließ alles über sich ergehen.
«Ich frage Sie, wie man nur so blöd sein kann! Ich kann nicht glauben, dass ich so einen bescheuerten Wahlkampfleiter habe», wütete Trump weiter. «Sie haben totale Scheiße gebaut.»
Unter den Anwesenden gab es niemanden, der so etwas nicht schon miterlebt hatte. In gewisser Weise war es eine Trump’sche Standardszene, ein Tobsuchtsanfall, der ihn aber offenbar nicht erschöpfte, sondern im Gegenteil immer mehr Energie freisetzte. Jeder hatte seine höchsteigene Demütigung hinnehmen müssen, verbunden mit der Lektion – für die allermeisten nicht die erste –, dass der Präsident immer jemanden brauchte, dem er die Schuld geben konnte; dass ausnahmslos alles, was zu seinen Ungunsten geschah, direkt mit dem Versagen oder dem bösen Willen einer anderen Person zusammenhing.
«Dumm, dümmer, am dümmsten … erklären Sie mir mal, wie dumm es überhaupt noch geht. Das möchte ich wissen. Ganz im Ernst. Sagen Sie’s mir.» Er ließ nicht ab von seinem Wahlkampfleiter.
Am Tag darauf wurde Parscale von Kushner und Trump degradiert, die Wahlkampfleitung ging an Parscales Stellvertreter Bill Stepien über. Die ganze Kampagne musste neu aufgestellt werden.
George Floyd machte ihn fertig. Eine Woche nach Floyds Ermordung in Minneapolis durch einen Polizisten, der auf seinem Nacken gekniet und ihm die Luft abgeschnürt hatte, woraufhin im ganzen Land Massenproteste ausbrachen, war der Präsident, um Stärke zu zeigen, mit seinen Generälen durch den Lafayette Park zur St. John’s Church spaziert – den Park hatte man mittels Tränengas und anderer Maßnahmen zur Aufstandsbekämpfung von Protestlern gesäubert –, und dafür war er quasi gekreuzigt worden. Er wirkte schwach. Und es waren nicht nur die üblichen «Lamestream»-Medien, die ihn angingen – sogar Tucker Carlson von Fox News bezeichnete ihn als schwach und ineffektiv. Und als wäre das nicht genug, wurde er auch noch vom eigenen Justizministerium und dem Minister selbst im Stich gelassen, Bill Barr, dieser Angsthase, der keinen Finger rührte, ein Schleimer vor dem Herrn, aber genauso nichtsnutzig, stellte sich jetzt heraus, wie Jeff Sessions, den er hatte ersetzen müssen, weil er zu nichts nutze war.
Jetzt hatte Trump aber endgültig die Nase voll. Jetzt mussten gerichtliche Schritte her und Widerstand gegen die Medien.
«Ich werde in Tuckers Sendung niedergemacht, und wir tun verdammt noch mal nichts dagegen!», schrie er im Oval Office Mark Meadows, ehemaliger Kongressabgeordneter aus North Carolina und erst seit wenigen Monaten als Trumps vierter Stabschef im Amt, und Pat Cipollone an, der als Rechtsberater des Weißen Hauses einer der bevorzugten Leidtragenden von Trumps Spott und gezielten Beleidigungen war.
Demonstranten in Portland und Seattle übernahmen das Ruder. Sie stürzten Denkmäler um, und keiner machte was dagegen – und deshalb wirkte er … schwach! Schwach wirken, das war die schlechteste Wirkung, die es überhaupt gab!
Cipollone bemerkte, man habe bereits einiges in Bewegung gesetzt.
«Ich gebe einen Scheiß darauf, was ihr in Bewegung gesetzt habt, ich will, dass sie ins Gefängnis wandern. Denkmäler umstürzen, dafür muss es zehn Jahre Knast geben. Und dieser Wheeler …» – der Bürgermeister von Portland – «was für ein Versager. Können wir nicht einfach die Nationalgarde hinschicken?»
Stammelnd versuchte Cipollone ihm die rechtlichen Voraussetzungen für den Einsatz der Nationalgarde zu erläutern.
«Diese Scheiße höre ich schon seit Wochen. Ich werde fertiggemacht. Tucker hat ein Millionenpublikum. Aber ihr und Barr und all ihr ‹großartigen Anwälte› unternehmt einfach nichts. Schluss damit! Verhaftet die Leute! Tut, was zu tun ist! Ich hab die beschissensten Anwälte. Sorgt dafür, dass die Radikalen eingebuchtet werden! Nicht mal das kriegt ihr hin! Was ist los mit euch? Alles muss ich selber machen!»
Im Weißen Haus gab es, wie so oft, nur einen mit Durchblick.
Und dieser eine telefonierte.
Ein großer Teil der Geschäfte des Weißen Hauses unter Trump wurde durch einsame Beschlüsse und den Griff zum Hörer bestimmt oder beeinflusst. Nach Belieben und aus irgendeiner Laune heraus klingelte er bei Leuten an, die ihm kürzlich im Fernsehen aufgefallen waren, oder auch, dem reinen Zufallsprinzip folgend, bei solchen, die es aus unerfindlichen Gründen irgendwann mal geschafft hatten, zu ihm durchzudringen.
Jetzt gerade hatte er Dick Morris am Apparat.
Morris war eine Art Polit-Berater mit einer besonderen Begabung dafür, genau dann aufzutauchen, wenn die Gegensätze im Land besonders unversöhnlich aufeinanderprallten, ein Genie der Spaltung, das hinter den Kulissen der offiziellen amerikanischen Politik wirkte.
1994, nach den katastrophalen Zwischenwahlen im Gefolge von Hillary Clintons geplanter Umstrukurierung des Gesundheitswesens, war Morris zu Hilfe gerufen worden, um die Clinton-Regierung wieder zurück auf ihren ursprünglichen, den reinen neoliberalen Weg zu führen. Es gab so gut wie niemanden, der Morris mochte, außerdem hing ihm auf ewig der Geruch eines Zu-schön-um-unwahr-zu-sein-Sexskandals nach – er war erwischt worden, wie er an den Zehen einer Prostituierten lutschte –, aber es war gerade die von ihm ausgehende Unappetitlichkeit, die ihn dafür qualifizierte, jedermann als Erfüllungsgehilfe für erlesene politische Brutalitäten zu dienen.
In gewisser Weise war es ein unerwartet konventioneller Schritt von Trump, sich an einen solch dunklen Spindoktor zu wenden.
Morris hatte einen guten Ansatzpunkt, um sich bei Trump «einzuschleichen», wie einige frustrierte Mitarbeiter des Weißen Hauses es nannten. Sein Vater, Eugene Morris, hatte vor etlichen Jahren als Immobilienanwalt Trump’sche Interessen vertreten, und Donald hatte nur gute Erinnerungen an ihn: «Wirklich ein harter Hund.»
Morris, der Sohn, hatte einen verlockenden Vorschlag zu machen:
Corona und die steigenden Todeszahlen wurden dem Präsidenten zur Last gelegt. Und man versuchte auch, ihm den Tod von George Floyd anzulasten – genauso wie, völlig ungerechtfertigt, die Ereignisse von Charlottesville 2017, als eine Massenversammlung Weißer Suprematisten aus dem Ruder lief und in Chaos und Gewalt mündete. Offensichtlich, so Morris am Telefon, waren doch die Demonstranten Amerikas größtes Problem – nicht Corona!
Wenn jemand versuchte, dir für irgendwas die Schuld zu geben, dann musstest du dir einfach irgendwen suchen, dem du die Schuld geben konntest, eine schon lange bewährte Praxis in der Politik, die aber von Trump ins sich selbst begründende Extrem getrieben wurde. Der schwarze Peter, das wussten alle Trump-Mitarbeiter, landete immer irgendwo anders.
Morris hatte eine endlose Liste von Vorschlägen und lesenswerten Artikeln für den Präsidenten – nicht, dass dieser sie tatsächlich lesen würde, aber Morris rief immer wieder an und erbot sich, den Inhalt für ihn zusammenzufassen (nicht, dass Trump sich die Zusammenfassungen zwangsläufig im Detail anhören würde). Obwohl er nie persönlich im Weißen Haus, gar im West Wing, oder im Wahlkampfhauptquartier in Rosslyn, Virginia, auftauchte – und sich noch nicht mal bezahlen ließ, wobei die Bereitschaft, für lau zu arbeiten, natürlich die allerbeste Empfehlung für jeden war, der für diesen Präsidenten tätig sein wollte –, wurde der dreiundsiebzigjährige Morris plötzlich zum Einflüsterer des Präsidenten, ein Mann, der über noch niedrigere politische Instinkte verfügte als Trump selbst.
Auf Kushners Anweisung hin stellte John McLaughlin, Trumps Lieblings-Meinungsforscher, Morris seine Daten zur Verfügung. Kushners Versuch einer Dreiecksbeziehung war eine psychologische Maßnahme: den Präsidenten mit einer neuen Stimme, der er sein Ohr leihen konnte, ruhigzustellen, aber Morris gleichzeitig aus dem Wahlkampf rauszuhalten und seinen Einfluss darauf möglichst zu minimieren.
Morris’ Tätigkeit wurde weitgehend geheim gehalten. Den einzigen Hinweis darauf lieferte eine Reihe von provozierenden Fragen mit rassistischer Schlagseite, die plötzlich in den wöchentlich durchgeführten Meinungsumfragen auftauchten. «Wo kommen denn diese Scheißfragen her?», wunderte sich Trumps Meinungsforscher Tony Fabrizio. Dann verschickte Morris eine E-Mail, bei der er versehentlich die Wahlkampfleitung in den Verteiler setzte. Die Katze war aus dem Sack und Kushners psychologische Strategie fehlgeschlagen. Ab sofort lautete die offizielle Wahlkampfparole: Chaos in Amerika, die soziale Ordnung in Gefahr, Kriminelle laufen frei herum.
Während die Nation einen Bewusstseinswandel zu vollziehen und Sympathien für die «Black Lives Matter»-Bewegung zu entwickeln schien, sandte das Trump-Lager in einer abrupten Kehrtwende eine alte Botschaft aus, in der nur von Recht und Ordnung und von schrecklichen Gefahren für weiße Damen in den Vorstädten die Rede war.
Und wer sagt’s denn, tatsächlich breitete sich Chaos auf den Straßen aus. Jedenfalls dann, wenn man Fox News eingeschaltet hatte. Während praktisch sämtliche Medien mit Corona, Black Lives Matter und der ökonomischen Krise befasst waren, konzentrierte Fox News sich zu nahezu hundert Prozent auf das Amerika in Flammen.
Die Law-and-Order-Kampagne, das Zurückschlagen gegen die Proteste, die Beschwörung der amerikanischen Finsternis zur Mittagszeit, all das würde, versicherte Morris dem Präsidenten, ganz sicher die Anhängerschaft mobilisieren. «Die Basis anheizen», war eine im Weißen Haus kursierende Wendung für eine Reihe von Trump-Tweets, die Fox News veranlassten, ein bestimmtes Thema aufzugreifen, woraufhin die Emotionen bei Wahlkampfveranstaltungen hochkochten, Umfragewerte nach oben schossen und außerdem, womit sich der Kreis aufs schönste schloss, der Präsident in seiner Überzeugung bestärkt wurde, dass er das Richtige tat.
Das war immer das höchste Ziel: dem Präsidenten versichern, dass er richtig lag.
Darin, dass es nur wenig gab, was in die vom Präsidenten erwählte Version der Realität eindringen konnte, mag man eine Vorausdeutung sehen auf das, was noch kommen sollte.
Morris entwarf eine Serie von Werbespots, düster und bösartig gehalten, die er dem Präsidenten zukommen ließ:
Telefon klingelt:
Danke, dass Sie 911 gewählt haben, den Notruf der Polizei. Aufgrund von Mittelkürzungen und erhöhtem Anruferaufkommen können wir Ihren Anruf im Moment leider nicht entgegennehmen. Hinterlassen Sie entweder Ihren Namen und Ihre Nummer, dann rufen wir Sie zurück. Oder bleiben Sie einfach in der Leitung, während wir uns um die Nöte Ihrer Mitbürger kümmern. Die geschätzte Wartezeit beläuft sich auf eine Stunde dreißig Minuten.
In den Wochen vor seiner Degradierung hatte Parscale begonnen, die Wirkung der neuen Botschaft zu erproben. Mit stets feinem Gespür dafür, welche Berichte dem Präsidenten am Herzen lagen, gab er brav zur Kenntnis, dass Morris’ Angstmacherspots, die in Ton und Tendenz denkbar krass von dem eher positiven Bild abstachen, das die größeren Medien von der Black-Lives-Matter-Bewegung zeichneten, bei Vorabvorführungen außergewöhnliche Bewertungen erzielten. Es wurden noch zwei weitere Spots aus Morris’ «Aufruhr»-Serie produziert. Werbung nach dem Motto: lieber zu viel als zu wenig. Etwa vierzig Millionen Dollar wurden in die sommerliche Law-und-Order-Kampagne versenkt.
Aber es tat sich nichts. Kein Aufwärtstrend in den Umfragen, nirgendwo. Vierzig Millionen für nichts – so ziemlich das erste Mal in der neueren amerikanischen Politikgeschichte, dass Recht und Ordnung als Wahlkampfthema nicht gezogen hatte.
Zu behaupten, der Hochsommer sei der absolute Tiefpunkt der Kampagne gewesen – eine ins Leere gehende Botschaft, ein logistischer Totalschaden, Auswechslung der Führungsspitze –, würde nicht der Wahrheit entsprechen, denn es sollten noch weitere Tiefpunkte folgen. Und sie ließen nicht auf sich warten.
Bill Stepien, der neue Wahlkampfmanager, entdeckte nach kurzer Zeit eine Lücke von zweihundert Millionen zwischen den geplanten Ausgaben und den erwarteten Einnahmen.
Stepien, ebenfalls ein Kushner-Protegé, war der Typus des Republikanischen Nachwuchsfunktionärs im Brooks-Brothers-Stil, zweiundvierzig Jahre alt, aber mit seinem vollen, jungenhaften Haarschopf glatte zehn Jahre jünger wirkend. In Trumps bevorzugtem Kreis großgewachsener Männer (aber möglichst nicht so groß wie er selbst) gehörte Stepien zu den kleinen. Aus New Jersey stammend, hatte er dem dortigen Gouverneur Chris Christie als rechte Hand gedient. 2014 wurde er jedoch von Christie geschasst, als man dessen Regierung beschuldigte, einen nicht willfährigen Bürgermeister durch massive Verkehrsbehinderungen in dessen Stadt bestraft zu haben – «Bridgegate» wurde der Vorgang genannt. Stepien wurde zwar von jeglicher Verantwortung freigesprochen, bekam aber nur noch untergeordnete Tätigkeiten zugewiesen, bis Kushner – immer darauf bedacht, Christie eins auszuwischen, weil dieser einst als Bundesanwalt Kushners Vater, einen Bauunternehmer aus New Jersey, ins Gefängnis gebracht hatte – ihn für den 2016er-Wahlkampf verpflichtete. Im Gegensatz zu Parscale hatte Stepien, der schon so manchen Wahlkampf bestritten hatte, verstanden, dass es bei einem Präsidentschaftsrennen mindestens ebenso sehr auf das Budget ankommt wie auf die Massenkundgebungen und sogar auf die Anziehungskraft und den Star-Appeal des Kandidaten.
Die Trump-Kampagne hatte mehr Spenden eingesammelt als jede andere in der Geschichte, aber was Parscale an Geld ausgegeben hatte, verstieß gegen alle Regeln der Vernunft. In der ersten Oktoberwoche würde die Kampagne absehbar auf dem Trockenen sitzen – kein Geld mehr für Medien, Gehälter und nicht mal mehr für kurze Wahlkampfausflüge in der Air Force One.
«Hat er mich beklaut?», wollte der Präsident von nun an jedes Mal wissen, wenn eine Besprechung anstand. Diese neuerliche Zwangslage setzte ihm mächtig zu, und Parscales unterstellte Niederträchtigkeit wurde zum Dauerthema seiner Monologe. «Wo ist all das Geld hin? Hat er mich beschissen? 2016 hat er mich auch beschissen, das war mir schon damals klar!»
Zum Teil war die Antwort, dass viel Geld aufgewendet worden war, um noch mehr Geld zu sammeln, damit man Zahlen vorweisen konnte, die den Präsidenten glücklich machten. Trump behielt stets die laufende Summe von Eingängen im Kopf, die von Parscale regelmäßig aktualisiert wurde und die er selbst durch kleine Übertreibungen noch ein bisschen aufhübschte. Ja, die Trump-Kampagne konnte mit mehr Online-Spendern prahlen, als es je zuvor gegeben hatte – das Verhältnis belief sich auf sage und schreibe zehn zu eins –, aber die Kosten der Online-Spendenbeschaffung, die angesichts von gratis verschickten E-Mails gering erscheinen mochten, überstiegen in Wirklichkeit die des traditionellen, persönlichen Anwerbens um 35 bis 40 Prozent. Kundenakquisekosten – Beschaffung von Adresslisten, Werbung in den Social Media, Ausbau des digitalen Marketings – belasteten jedes Online-Geschäft mit direktem Endkundenkontakt, und eben dazu hatte die Trump-Kampagne sich inzwischen entwickelt. Hingegen fielen bei einer Publikumsveranstaltung nach der alten Methode, bei der man vielleicht 10 oder 20 Millionen sammeln konnte, allenfalls Kosten fürs kalte Buffet, für ein paar Flaschen billigen Weißwein und die Benutzung des Hauses eines reichen Gönners an.
Und in einer Trumpwelt, die von Einzelkämpfertum, von unkonventionellen Einnahmequellen, von allgemeinem Frohsinn und der Anerkennung persönlichen Erfolgs geprägt war, fiel es noch schwerer, zu wissen, wohin das Geld floss, ob es dort wirklich hinfließen sollte oder lieber nicht, oder ob man diese Frage überhaupt stellen sollte.
Katie Walsh – langjährige Beraterin und Referentin der Parteispitze, Verbündete Parscales und kurzzeitig stellvertretende Stabschefin des Weißen Hauses unter Trump, bevor sie sich mit Kushner zerstritt – war als eine Art Schnittstelle zwischen Wahlkampfteam und Parteispitze eingesetzt worden. Nach Parscales Abgang wurde sie von Wahlkampfhelfern bedrängt, die wissen wollten, warum sie fünfzehntausend Dollar im Monat von Firmen bezog, die unter Parscales Kontrolle standen und die diese Bezüge wiederum der Kampagne in Rechnung stellten. «Ist das so?», erwiderte sie, ein unlauteres Ausweichmanöver, das wiederum ein Licht auf die unübersichtlichen Verhältnisse in der Trumpwelt warf, die kaum erkennen ließen, wer wem etwas bezahlte und wofür.
Auch noch Monate nach dem Ende des Wahlkampfs rissen die Fragen nach den Geldsummen nicht ab, die von der Kampagne in Richtung externer, von Parscale kontrollierter Firmen abgeflossen waren, wobei Schätzungen sich bis hinauf in den Bereich von 30 oder 40 Millionen bewegten. Gary Coby, zuständig für die Online-Spendenbeschaffung, verschickte täglich bis zu fünf Millionen Textnachrichten an potenzielle Spender. Bei dieser Größenordnung hätten die Kosten etwa ein oder zwei Cent pro Nachricht betragen sollen, die Trump-Kampagne aber bezahlte mehr als sieben Cent pro Nachricht, und ein beträchtlicher Anteil dessen lief über Cobys externe Firma.
«Egal, was Gary macht, es ist die Sache wert», wehrte Kushner alle Nachfragen ab. «Er ist derjenige, der das Geld herbeischafft.» Kushners Management-Credo, das keiner Platitüde aus dem Weg ging, besagte: Wenn du erst einmal die großen Dinge klargemacht hast – und das meint: das große Geld (wobei man sich in der Trump’schen Politik- und Geschäftswelt ganz auf das dem Prahlbedürfnis schmeichelnde Brutto konzentrierte statt auf die grausame Realität des Netto) –, dann folgen die kleinen von ganz allein.
Was Trump betraf, so hatten die Bestürzung, die Gerüchte und die Schuldzuweisungen im Zusammenhang mit vergeudeten, fehlgeleiteten oder gar veruntreuten Geldern durchweg eins gemeinsam: das Einvernehmen darüber, dass der Präsident keine Ahnung hatte, wo das Geld abgeblieben war. «Er schwebt in seliger Unwissenheit», so die Worte eines Wahlkampfmitarbeiters.
Am 20. Juli kamen die Meinungsforscher ins Oval Office – John McLaughlin und Tony Fabrizio.
McLaughlin bemühte sich zuverlässig darum, seine Umfragewerte genau das aussagen zu lassen, was Trump hören wollte. Fabrizio scherte sich einen Dreck um das, was Trump hören wollte, ja, er machte sich nicht einmal die Mühe, seinen Abscheu vor dem Präsidenten zu verbergen. Fabrizio war sechzig Jahre alt, übergewichtig und hatte – reichlich ungewöhnlich in den Republikanischen Kreisen, in denen er sein Geld verdiente – schon vor Jahren sein Coming-out gehabt. Er war knurrig, schroff, und er schien mehr und mehr Gefallen daran zu finden, den Spaßverderber zu geben und einfach das zu präsentieren, was die Daten zeigten.
Trump seinerseits war der Ansicht, dass Fabrizio zu viel Honorar verlange und Infos an die New York Times weitergebe. Er fand ihn offensichtlich persönlich abstoßend und verlieh ihm den einfallsreichen Spitznamen «Fat Tony».
Fabrizio führte das Wort. Aufgereiht vor dem Präsidentenschreibtisch saßen Stepien, Fabrizio, Miller, McLaughlin und Brian Jack, der politische Geschäftsführer des Weißen Hauses, während Scavino, Kushner, Meadows, Hicks, Politberater Stephen Miller und einige andere immer mal die Nase ins Oval Office steckten und wieder verschwanden. Eine PowerPoint-Präsentation war vorbereitet, doch es wurden Ausdrucke ausgeteilt. Trump nahm angewidert ein Blatt nach dem anderen in die Hand: «Was soll das denn?»
Er drückte auf den roten Schreibtischknopf, um eine weitere Cola light kommen zu lassen.
Fabrizio, sichtlich ungeduldig, versuchte, die Vorlage mit ihm durchzugehen. Aber Trump war bockig, wollte zum einen nicht hören, was ihm erklärt wurde, konnte zum anderen nicht verstehen, was ihm erklärt wurde, und war letzten Endes nicht interessiert genug, es verstehen zu wollen.
Es war schwer, Trumps Aufmerksamkeit zu fesseln, wenn er nicht derjenige war, der das Wort führte.
Aber Fabrizios Botschaft war eindeutig: Mit seiner Corona-Politik lag der Präsident falsch. Der Spruch vom «China-Virus» zog nicht mehr, hatte sein Haltbarkeitsdatum längst überschritten.
Die Zahlen waren unmissverständlich, und Fabrizio legte sie fast genussvoll dar: Die große Mehrheit der Wähler betrachtete Masken und Tests als geeignete Mittel, das Leben wieder zu öffnen und die Wirtschaft in Gang zu bringen, fast 70 Prozent der Befragten waren sich darin einig. Sobald der Präsident den Eindruck erweckte, er nehme Corona ernst, gingen seine Zustimmungswerte hoch. Für die Verbreitung des Virus machten die meisten Menschen mangelhaftes Abstandhalten und fehlendes Tragen von Schutzmasken verantwortlich; die meisten Wähler und auch eine Mehrheit von Trump-Wählern waren für eine Maskenpflicht, um das Land offen zu halten; die meisten befürworteten einen Präsidentenerlass, der Schutzmasken in öffentlichen Innenräumen vorschrieb; zwei Drittel der Trump-Wähler waren der Ansicht, dass der Präsident, wenn er eine Schutzmaske trüge, ein gutes Beispiel geben und Vaterlandsliebe demonstrieren würde; und acht von zehn Trump-Wählern befürworteten das Tragen von Schutzmasken als Präventivmaßnahme.
Da blieb im Grunde kein Spielraum für weitere Debatten.
«Damit ist die Sache klar», sagte Kushner, der, sichtlich beeindruckt von den Zahlen, der Zusammenkunft jetzt doch seine volle Aufmerksamkeit lieh.
Selbst McLaughlin, ein professioneller Abwiegler, sprach sich deutlich für eine zumindest weniger feindselige Haltung gegenüber den Schutzmasken aus und schlug eine Verfügung vor, wonach in den bundesstaatlichen Amtsgebäuden Masken zu tragen seien.
Der missmutige Präsident schaltete auf stur. «Ich kenne meine Leute. Die machen das nicht mit. Die glauben nicht dran. Keine Maskenverfügung!» Er spannte die Schultern an und hob die Hände, um die Maskenverfügung abzuwehren, sein ganzer Körper schien beim bloßen Gedanken daran zu revoltieren.
Meadows, seit vier Monaten in seiner neuen Rolle als Stabschef, hatte Verständnis für die Corona-Phobie des Präsidenten und war gewillt, ihm nach dem Mund zu reden. «Eine Maskenverfügung? Die Leute würden ausrasten.»
«Mr. President.» Fabrizio blieb ebenfalls unnachgiebig. «Ich werde Ihnen sagen, was Ihre Wähler in Bezug auf Masken glauben. Sie glauben genau das, wovon Sie sagen, dass sie es glauben sollen.»
Wenn man versuchte, Trump in eine bestimmte Richtung zu lenken, bewegte er sich oft in die genau entgegengesetzte. Ihm zu sagen, was er tun sollte, führte dazu, dass er es nicht tat.
Jetzt aber schlug sein Missmut jäh in Vergnügen um. Er hatte eine Idee! Es gab eine andere Möglichkeit, mit Corona umzugehen. Wenn die Demokraten Corona benutzten, um ihn in Schwierigkeiten zu bringen, dann würde er den Spieß einfach umdrehen: Man könnte doch Corona als Grund nehmen, die Wahl zu verschieben! «Die Leute können nicht zu den Wahlkabinen kommen. Das ist ein nationaler Notstand. Stimmt’s?» Er blickte in die Runde, um Bestätigung zu finden – und Glückwünsche für diese phantastische Idee.
Oft folgte ein kurzer Moment des Schweigens und des kollektiven Luftholens, wenn Trump wieder einmal, und das geschah mit erschreckender Häufigkeit, Vorschläge entwickelte, denen niemand folgen oder auch nur gedanklich nähertreten mochte. Die Reaktion in diesem Moment schwankte zwischen der Einschätzung, dass Trump nun einmal Trump sei und man ja wusste, dass neun Zehntel dessen, was aus seinem Mund kam, reines Blabla war, und der leisen Ahnung, dass sie hier womöglich an einem kritischen Punkt der Geschichte standen und der Präsident allen Ernstes glaubte, er könne die Wahl verschieben. Falls Letzteres zutraf, stellte sich die dringende Frage, wer sich jetzt, und zwar augenblicklich, in die Bresche werfen würde.
Meadows tat es, wenn auch widerstrebend: «Mr. President, dafür gibt es kein Verfahren. Wir könnten uns auf keinen verfassungsrechtlichen Präzedenzfall berufen und hätten keine entsprechenden Instrumente zur Verfügung. Das Datum ist festgesetzt. Der erste Dienstag …» Meadows’ zuckrige Stimme mit dem North-Carolina-Tonfall war von Panik befallen.
«Soso. Aber was ist mit …?»
«Ich fürchte – nein, Sie können das nicht. Wir können das nicht.»
«Ich bin sicher, es gibt vielleicht einen Weg, aber … na ja …»
In der Woche darauf kam der Präsident auf das Thema zurück, ob man die Wahl verschieben, absagen oder irgendwie umschiffen könne. Diesmal bei einer Vorbereitungssitzung auf anstehende Debatten in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey.
Da die ganze Zeit mehr Golf gespielt als Debatten vorbereitet wurden, befand der Präsident sich in gelöster Stimmung. Tatsächlich hatten Mitarbeiter oft das Gefühl, dass er gerade in Bedminster auf besonders hirnverbrannte oder gefährliche Ideen kam, zumal wenn er ungehemmt über den Umfang seiner Machtbefugnisse sinnierte (auch seine «Feuer und Zorn»-Drohungen gegen Nordkorea hatte er von Bedminster aus in die Welt geschickt).
Chris Christie, Ex-Gouverneur von New Jersey und, wenn sie nicht gerade zerstritten waren, Trump-Verbündeter, nahm an einer der Pseudodebatten teil, die sich binnen kurzem in eine der üblichen, vom Hundertsten ins Tausendste kommenden Trump-Monologe verlor.
«Ich überlege, die Sache abzublasen», sagte Trump in eher beiläufigem Ton.
«Was, die Vorbereitung?», fragte Christie.
«Nein, die Wahl – zu viel Virus.»
«Na ja, das können Sie nicht tun, Mann», sagte Christie, ein ehemaliger Bundesstaatsanwalt, beinahe glucksend. «Sie wissen doch, dass Sie kein Kriegsrecht verhängen können.» Sicherheitshalber fragte er nach: «Das wissen Sie doch, oder?»
Sowohl erschreckend als auch peinlich, dass das nicht so ganz klar war.
Die Absurdität von Trumps Ideen, verbunden mit der Möglichkeit, dass er es vielleicht todernst meinte, konnte Situationen schaffen, in denen Peinlichkeit und der Ausbruch einer Krise nicht mehr zu unterscheiden waren.
Trumps Gedankenspiele bezüglich der Wahl hatten nicht unbedingt mit der Frage nach Gewinnen oder Verlieren zu tun. Vielmehr war die Wahl für ihn eine Art Formalität, eine hinderliche Zumutung, die man irgendwie umgehen musste, so wie Steuern, Bauordnungsbestimmungen oder Umschuldungen. Etwas, von dem nur die Gegenseite profitieren konnte, es sei denn, man hätte einen noch clevereren Gegenzug in petto.
Im vergangenen März, während der ersten Tage des Lockdowns, hatten sich fast dreißig Personen, ohne Maske, im Oval Office versammelt, der Präsident hinter seinem Schreibtisch, davor eine ganze Stuhlreihe, die Sofas vollbesetzt, einige Leute hinter den Sofas, andere entlang der Seitenwände – Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, aus dem Wahlkampfteam, aus den Parteigremien und Mitglieder der Familie Trump. Thema waren die Anstrengungen der Demokraten, die Wahl zu stehlen.
«Stehlen» war eher ein Kunstausdruck, gemeint war nicht wirklich ein Diebstahl der Wahl, sondern das Einwirken auf einzelstaatliche und lokale Behörden, die Wahlbestimmungen zu liberalisieren, um auch solchen Menschen das Wählen zu erleichtern, die sonst nicht zur Wahl gingen. Mit anderen Worten, mehr Demokraten-Stimmen zu mobilisieren.
Für den Präsidenten umfasste das «Stehlen» mehr als nur die Wahl. Der «Russland-Schwindel» und die zwei Jahre dauernden Mueller-Ermittlungen waren Versuche, ihm die Präsidentschaft zu stehlen. Mehrfach kam er auf seine Forderung zurück, dass ihm deshalb zwei zusätzliche Jahre, zwei Bonusjahre, zustünden.
Unter dem Schutzmantel von Corona waren die Demokraten darauf aus, die Wahl zu «manipulieren», wenn auch (wie mitunter hinzugefügt wurde) «legal».
Dabei stützten sie sich auf ein «Genie» beziehungsweise einen «Dr. Evil»: Marc Elias. Elias, ein auf Wahlrecht spezialisierter Anwalt, hatte sowohl Bill Clintons als auch John Kerrys Wahlkampf als Chefjurist begleitet und war – noch schlimmer in den Augen der Republikaner – Partner in der Demokratischen Anwaltskanzlei Perkins Cole, die eine Schlüsselrolle bei der Finanzierung des «Dossiers» gespielt hatte, in dem behauptet wurde, Trump habe in einem Moskauer Hotelzimmer Prostituierte auf ein Bett urinieren lassen, in dem einst die Obamas geschlafen hatten.
Elias war, da schienen sich auch die meisten Republikaner einig, der beste Wahlrechtsanwalt im ganzen Land. Er war tatsächlich imstande, eine Wahl zu stehlen. Er war der Mittelpunkt eines «Systems» und einer «Maschine», die Wahlgesetze so hinbogen, dass sie den Demokraten nützten. Mit diesem Gegner also hatten sie es hier zu tun.
Eine der Teilnehmerinnen des Meetings war eine junge Juristin namens Jenna Ellis, die von Trump persönlich angeworben worden war, nachdem er sie im Fernsehen gesehen hatte, und die seit kurzem für die Kampagne arbeitete. Der Präsident erfreute sich nicht nur an ihren Fernsehauftritten, sondern ließ sich auch Schweinereien wie die, dass die Demokraten die «Sicherheitsstandards bei der Wahldurchführung» anfochten (das heißt die Wahl manipulieren wollten), besonders gern von ihr berichten. Ebenfalls anwesend war Justin Clark, ein langjähriger Wahlrechtsanwalt, Angehöriger des Mitarbeiterstabs im Weißen Haus und derzeit Wahlkampfhelfer. Ellis und Clark waren eine Woche zuvor anlässlich einer Podiumsdiskussion auf der CPAC aneinandergeraten, der alljährlichen Konferenz konservativer Aktivisten und Abgeordneter. Ellis, ohne erkennbare Sachkenntnis in Fragen des Wahlrechts, abgesehen davon, dass der Präsident sie in sein Team geholt hatte, behauptete, die Demokraten würden versuchen, das System und sogar die Verfassung selbst zu untergraben. Clark, Wahlrechtsanwalt von Beruf, wies im Wesentlichen darauf hin, dass sowohl Demokraten als auch Republikaner traditionell darum rangen, sich verfahrenstechnische Vorteile bei Wahlen zu verschaffen, und dass letzten Endes, da sich diese Bemühungen meist gegenseitig neutralisierten, Wahlen von dem besseren Kandidaten mit dem besseren Programm und der besseren Kampagne gewonnen würden – unabhängig von der Wahlordnung.
Clark glaubte fest daran, dass die Trump-Kampagne, in dieser noch frühen Phase der Pandemie, gut genug aufgestellt sei, um einen überzeugenden Sieg einzufahren, und alle Fragen des Wahlverfahrens im Griff habe. Ellis dagegen lief, nachdem die Konferenz ohne klares Ergebnis und eine entsprechende Resolution zu Ende gegangen war, sofort zum Präsidenten, um ihm mitzuteilen, dass die Demokraten nur dann gewinnen könnten, wenn jeder Hinz und Kunz mitwählen dürfte. Das also war der Diebstahl: dass man den Menschen die Teilnahme an der Wahl erleichterte. Die bittere Ironie, die in dieser Behauptung steckte, wurde ignoriert.
Auch schien Trump immer wieder die Wahl als etwas gegen ihn persönlich Gerichtetes zu betrachten, etwas irgendwie grundsätzlich Unfaires, und er formulierte das auf bemerkenswert unverblümte Weise: «Sie benutzen die Wahl, um mir zu schaden.»
Am 7. August kamen Trump-Mitarbeiter und Meinungsforscher erneut in Bedminster zusammen – McLaughlin persönlich anwesend, Fabrizio per Telefon zugeschaltet. Bedminster sollte das Flair eines britischen Herrenclubs ausstrahlen, sah aber eher wie ein Steakrestaurant aus. Man versammelte sich um einen Konferenztisch, auf dem zahlreiche Wasserflaschen mit dem Trump-Logo standen. Die Klimaanlage lief auf vollen Touren.
Die Botschaft war klar: Die Stimmabgabe per Briefwahl, die der Präsident so erbittert bekämpfte, würde zu einem entscheidenden Faktor bei dieser Wahl werden. Fast 70 Prozent der Wahlberechtigten wollten davon Gebrauch machen.
Die Empfehlung dazu war eindeutig: Zwar würde die Briefwahl den Demokraten helfen, aber eine militante Opposition gegen die Briefwahl würde den Nachteil für die Republikaner noch dramatisch verstärken.
Trumps Widerstand gegen das logisch Offenkundige war schmerzhaft.
Es war klar, dass in Zeiten einer Pandemie weniger Menschen in die Wahllokale strömen würden und die Briefwahl daher eine attraktive Ausweichmöglichkeit bot – folglich, argumentierten die Meinungsforscher, war es ratsam, die eigenen Anhänger zu ermuntern, ihre Stimme auf egal welche Weise abzugeben. Für den Präsidenten aber war all dies jetzt zu einem Bestandteil der bösen Corona-Kräfte und der gegen ihn gerichteten Strategien geworden. Corona war das Werkzeug der Demokraten, um nicht nur seine wunderbare Wirtschaft zu ruinieren, sondern auch die Wahl zu stehlen – indem sie Leute, die sonst nicht wählten, die «wenig geneigten» Wähler, also Wähler der Demokraten, dazu brachten, ihre Stimme abzugeben.
Stepien, der neue Wahlkampfleiter, erst seit wenigen Wochen im Amt, gab zu bedenken, dass sie, die Republikaner, bessere Grundstrukturen hätten und die Briefwahl durchaus zu ihren Gunsten nutzen könnten.
In einem Versuch, die eigene Person ein wenig aus der Schusslinie des Präsidenten zu nehmen, brachte Stepien zu einer Folgebesprechung im Oval Office Kevin McCarthy, den Republikanischen Fraktionsvorsitzenden im Repräsentantenhaus, als Unterstützung mit – «Mein Kevin», so Trumps Ausdruck der Zuneigung und des Besitzanspruchs. Die Republikanische Partei habe Wahlantragsformulare verschickt, erklärte McCarthy, und die Rückläufe lägen bei 2 bis 3 Prozent, eigentlich sollten es aber eher 15 Prozent sein.
Der Präsident schien nicht zu begreifen.
Er sei es, formulierte McCarthy überraschend deutlich, der die Rücklaufquote herunterdrücke.
Es gab verschiedene Formen und Antragswege bei der Briefwahl, die Trump (selbst Briefwähler in Florida) grundsätzlich durcheinanderbrachte; unterschiedslos zog er gegen alle vom Leder, die ihre Stimme anders abgaben als am Wahltag im Wahllokal, und erklärte es quasi zu einer Trump’schen Tugend, dort persönlich zu erscheinen. Aber könne er sich nicht, so McCarthys Frage, bei diesem Thema zukünftig ein bisschen zurückhalten?