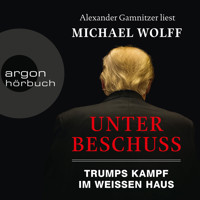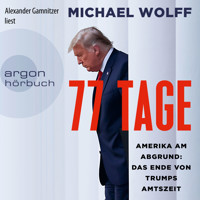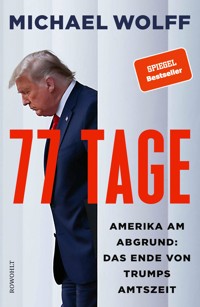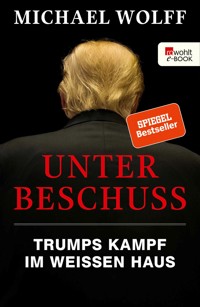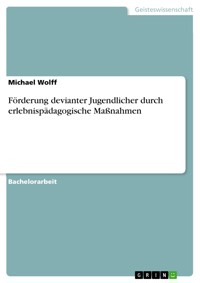11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Es ist das Buch, das die Präsidentschaft von Donald Trump erschüttert: Michael Wolffs «Feuer und Zorn» ist ein eindrucksvolles Sittengemälde der amerikanischen Politik unter Trump. Im Mittelpunkt ein Präsident, den seine Mitarbeiter wie ein kleines Kind behandeln und der umgeben ist von Inkompetenz, Intrigen und Verrat. Der Bestsellerautor Wolff beschreibt das Chaos, das in den ersten Monaten im Weißen Haus geherrscht hat, er enthüllt, wie nah die Russland-Verbindung an Trump herangerückt ist und wie es zum Rauswurf des FBI-Chefs James Comey kam. Und er liefert erstaunliche Details über das Privatleben dieses Präsidenten. Über zweihundert Interviews hat Wolff mit den engsten Mitarbeitern des US-Präsidenten geführt, darunter auch der ehemalige Chef-Berater Stephen Bannon: Noch nie ist es einem Journalisten gelungen, das Geschehen im Weißen Haus so genau nachzuzeichnen. Herausgekommen ist das einzigartige Porträt eines Präsidenten, der selbst nie damit gerechnet hat, die Wahl zu gewinnen. Michael Wolffs Bericht aus dem Weißen Haus unter Trump ist in den USA ein Bestseller: ein aktuelles politisches Buch, das sich wie ein Königsdrama von Shakespeare liest.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Ähnliche
Michael Wolff
Feuer und Zorn
Im Weißen Haus von Donald Trump
Aus dem Englischen von Isabel Bogdan, Thomas Gunkel, Dirk van Gunsteren, Gregor Hens, Werner Schmitz, Jan Schönherr, Nikolaus Stingl
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Es ist das Buch, das die Präsidentschaft von Donald Trump erschüttert: Michael Wolffs «Feuer und Zorn» ist ein eindrucksvolles Sittengemälde der amerikanischen Politik unter Trump. Im Mittelpunkt ein Präsident, den seine Mitarbeiter wie ein kleines Kind behandeln und der umgeben ist von Inkompetenz, Intrigen und Verrat. Der Bestsellerautor Wolff beschreibt das Chaos, das in den ersten Monaten im Weißen Haus geherrscht hat, er enthüllt, wie nah die Russland-Verbindung an Trump herangerückt ist und wie es zum Rauswurf des FBI-Chefs James Comey kam. Und er liefert erstaunliche Details über das Privatleben dieses Präsidenten. Über zweihundert Interviews hat Wolff mit den engsten Mitarbeitern des US-Präsidenten geführt, darunter auch der ehemalige Chef-Berater Stephen Bannon: Noch nie ist es einem Journalisten gelungen, das Geschehen im Weißen Haus so genau nachzuzeichnen. Herausgekommen ist das einzigartige Porträt eines Präsidenten, der selbst nie damit gerechnet hat, die Wahl zu gewinnen. Michael Wolffs Bericht aus dem Weißen Haus unter Trump ist in den USA ein Bestseller: ein aktuelles politisches Buch, das sich wie ein Königsdrama von Shakespeare liest.
Über Michael Wolff
Michael Wolff, 1953 geboren, ist ein amerikanischer Journalist und Autor. Er schreibt für «Vanity Fair», «The Hollywood Reporter», «The Guardian», «USA Today» und die britische Ausgabe von «GQ». Er hat sechs Bücher veröffentlicht, darunter «The Man Who Owns the News» (2008), eine Biographie über Rupert Murdoch. Wolff hat zahlreiche Preise für seine Arbeit erhalten, darunter zweimal den «National Magazine Award». Er lebt in New York und hat vier Kinder.
Für Victoria und Louise, Mutter und Tochter
Vorbemerkung des Autors
Der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, könnte nicht offensichtlicher sein. Mit Donald Trumps Amtseinführung am 20. Januar 2017 gerieten die USA in das Auge des wohl außergewöhnlichsten politischen Sturms seit Watergate. Während der Tag näher rückte, machte ich mich daran, die Ereignisse so zeitnah wie möglich zu dokumentieren und die Vorgänge im Weißen Haus aus Sicht der Menschen zu schildern, die dort ein und aus gingen.
Anfangs hatte ich vor, einen Bericht über die ersten hundert Tage von Trumps Amtszeit zu schreiben, eine Einschätzung, wie sie traditionsgemäß bei jeder neuen Präsidentschaft vorgenommen wird. Doch die Ereignisse hörten mehr als zweihundert Tage lang nicht auf, sich zu überstürzen, und der Vorhang nach dem ersten Akt von Trumps Präsidentschaft fiel erst mit der Ernennung des pensionierten Generals John Kelly zum Stabschef Ende Juli und dem Rauswurf des Chefstrategen Stephen K. Bannon drei Wochen später.
Meine Schilderung der Ereignisse beruht auf Gesprächen, die ich im Verlauf von achtzehn Monaten mit dem Präsidenten, den meisten seiner Berater – mit manchen Dutzende Male – sowie mit Leuten geführt habe, mit denen diese engsten Mitarbeiter gesprochen hatten. Das erste Interview fand statt, lange bevor ich mir Donald Trump im Weißen Haus, geschweige denn ein Buch darüber, vorstellen konnte, nämlich Ende März 2016 in Trumps Haus in Beverly Hills. Während Hope Hicks, Corey Lewandowski und Jared Kushner ein und aus gingen, verputzte der Kandidat einen Halbliterbecher Häagen-Dazs-Vanilleeis und verbreitete sich oberflächlich plaudernd und gutgelaunt über ein breites Spektrum von Themen. Mit Mitarbeitern seines Wahlkampfteams sprach ich während des Parteitags der Republikaner in Cleveland, als ein Wahlsieg Trumps noch unvorstellbar schien. Und im Trump Tower sprach ich mit einem redseligen Steve Bannon – vor der Wahl, als er noch ein unterhaltsames Kuriosum war, und nach der Wahl, als es aussah, als hätte er ein Wunder bewirkt.
Kurz nach dem 20. Januar nahm ich eine Art Stammplatz auf einem Sofa im West Wing ein. Seither habe ich mehr als zweihundert Interviews geführt.
Obwohl die Trump-Regierung Feindseligkeit gegenüber der Presse quasi zur Politik erhoben hat, stand das Weiße Haus den Medien so offen wie nie zuvor in der jüngsten Geschichte. Anfangs suchte ich einen offiziellen Zugang zum Weißen Haus – ich wollte überall dabei sein dürfen. Der Präsident persönlich unterstützte diesen Ansatz. Doch angesichts der zahlreichen Seilschaften, die vom ersten Tag der Präsidentschaft an miteinander im Streit lagen, zeigte sich, dass dies nicht in der Macht eines Einzelnen lag. Und ebenso wenig gab es jemanden, der mich hinauswerfen konnte. So war ich denn weniger ein geladener Gast als vielmehr ein ständiger Lauscher – das sprichwörtliche «Mäuschen» –, der sich weder irgendwelchen Regeln unterworfen noch Absprachen darüber getroffen hatte, was er schreiben dürfe und was nicht.
Viele Schilderungen von Vorgängen im Weißen Haus widersprechen sich, viele sind, ganz nach Trump-Manier, schlicht erlogen. Solche Widersprüche und der lockere Umgang mit der Wahrheit – um nicht zu sagen: mit der Realität – ziehen sich wie ein roter Faden durch dieses Buch. Manchmal gebe ich einfach die Version der Beteiligten wieder und überlasse das Urteil dem Leser. In anderen Fällen habe ich mich aufgrund übereinstimmender Berichte von Informanten, die sich als zuverlässig erwiesen haben, für die Version entschieden, die mir wahr erscheint.
Manche meiner Informanten berichteten «unter drei». Diese gebräuchliche Vorgehensweise ermöglicht die Schilderung von Ereignissen nach ungenannt bleibenden Quellen. Ich habe auch Gespräche «unter zwei» geführt, bei denen der jeweilige Informant – unter der Bedingung, anonym zu bleiben – wörtliche Zitate wiedergab. Während einige verlangten, das durch die Interviews gewonnene Material dürfe nicht vor dem Erscheinen des Buchs veröffentlicht werden, äußerten andere sich unverblümt und hatten nichts dagegen, zitiert zu werden.
Ich sollte aber auch auf einige journalistische Schwierigkeiten hinweisen, denen ich mich bei meinen Recherchen gegenübersah. Viele davon resultierten aus dem Fehlen offizieller Richtlinien und aus der Unerfahrenheit der Führungsebene. Zu diesen Schwierigkeiten gehörten der Umgang mit Hintergrundmaterial oder inoffiziellen Informationen, die im Nachhinein beiläufig offiziell bestätigt wurden; Informanten, die mir vertrauliche Informationen gaben und sie wenig später jedem Beliebigen erzählten, als hätte das einmalige Aussprechen sie von der Schweigepflicht entbunden; eine häufige Vernachlässigung der Frage, inwieweit der Inhalt eines Gesprächs verwendet werden durfte; die Tatsache, dass die Ansichten mancher Personen so allgemein bekannt waren, dass es lächerlich gewesen wäre, diese nicht zuzuordnen; die geradezu subversive, fassungslose Wiedergabe privater, nicht für die Öffentlichkeit bestimmter Gespräche. Und überall in diesem Buch erklingt unablässig, unermüdlich und unbeherrscht die Stimme des Präsidenten, und was er äußert, ob öffentlich oder privat, wird von anderen täglich und manchmal praktisch im selben Augenblick weiterverbreitet.
Erstaunlicherweise hatte fast jeder, zu dem ich Kontakt aufnahm – hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses ebenso wie aufmerksame Beobachter –, viel Zeit für mich und bemühte sich nach Kräften, die außergewöhnlichen Vorgänge im Weißen Haus zu erhellen. Letztlich geht es bei dem, was ich erlebt und in diesem Buch geschildert habe, um Menschen, die sich – jeder auf seine Weise – damit abmühten zu verstehen, was es bedeutet, für Donald Trump zu arbeiten.
Ich stehe tief in ihrer Schuld.
PrologAiles und Bannon
Der Abend begann um halb sieben, aber Steve Bannon, seit neuestem einer der mächtigsten Männer der Welt und weniger denn je bereit, sich Terminzwängen zu unterwerfen, kam zu spät.
Bannon hatte versprochen, zu diesem von gemeinsamen Freunden im Greenwich Village arrangierten Abendessen zu kommen und sich mit Roger Ailes zu treffen, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden von Fox News. Ailes war die bedeutendste Figur im rechten Medienspektrum und phasenweise Bannons Mentor. Am folgenden Tag, dem 4. Januar 2017, würde Ailes nach Palm Beach in den – wie er hoffte, nur zeitweiligen – erzwungenen Ruhestand fliegen.
Schneefall war vorhergesagt, und für eine Weile stand das Treffen in Frage. Der sechsundsiebzigjährige Ailes war wegen eines langjährigen Bein- und Hüftleidens schlecht zu Fuß und hatte, als er mit seiner Frau Beth von ihrem Haus am Hudson nach Manhattan aufbrach, befürchtet, die Straßen könnten glatt sein. Doch er wollte Bannon unbedingt sehen. Bannons Assistentin Alexandra Preate schickte ständig Textnachrichten und hielt die Anwesenden über Bannons Anfahrt vom Trump Tower auf dem Laufenden.
Während die kleine Gruppe auf Bannon wartete, hatte Ailes die Runde für sich. Er war über den Sieg seines alten Freundes Donald Trump ebenso verblüfft wie fast alle anderen und veranstaltete für die Anwesenden eine Art Crashkurs über die Wechselfälle und Absurditäten der Politik. Bevor er 1996 Fox News ins Leben gerufen hatte, war er dreißig Jahre lang einer der maßgeblichen Strippenzieher in der Republikanischen Partei gewesen. Er war zwar überrascht über den Ausgang dieser Wahl, aber auch imstande, eine gerade Linie von Nixon zu Trump zu ziehen. Er habe nur seine Zweifel, sagte er, ob Trump, der sich im Lauf der Zeit mal als Republikaner, mal als Unabhängiger, mal als Demokrat gegeben habe, seinerseits imstande sein würde, dieser Linie zu folgen. Doch er glaubte Trump genau zu kennen und wollte seine Hilfe anbieten. Und wieder ins Geschäft mit den rechten Medien einsteigen: Schwungvoll beschrieb er einige Möglichkeiten, eine Milliarde Dollar aufzutreiben, die er für einen neuen Kabelkanal brauchen würde.
Beide, Ailes und Bannon, betrachteten sich als Menschen, die die Geschichte studiert hatten. Beide waren Autodidakten mit einer Schwäche für Weltformeln. Für sie war es eine Frage des Charismas: Sie hatten nicht nur eine persönliche Beziehung zur Geschichte, sondern auch zu Donald Trump.
Ailes begriff, wenn auch nur widerwillig, dass er dabei war, die Fackel der politischen Rechten zumindest fürs Erste an Bannon weiterzureichen. Diese Fackel verdankte ihr Leuchten einigen Ironien des Schicksals. Ailes’ Fox News machte jährlich 1,5 Milliarden Dollar Gewinn und hatte zwei Jahrzehnte lang die Politik der Republikaner bestimmt. Jetzt erhob Bannons Nachrichtenseite Breitbart News, die lediglich 1,5 Millionen Dollar pro Jahr abwarf, Anspruch auf diese Rolle. Dreißig Jahre lang hatte Ailes – bis vor kurzem die herausragend mächtige konservative Figur – Donald Trump bei Laune gehalten und ertragen, doch letztlich hatten Bannon und Breitbart dafür gesorgt, dass er gewählt worden war.
Sechs Monate zuvor, als Trumps Sieg noch völlig unmöglich schien, waren gegen Ailes Vorwürfe wegen sexueller Belästigung laut geworden. In einem Manöver, das die liberalen Söhne des fünfundachtzigjährigen konservativen Rupert Murdoch ins Werk gesetzt hatten, des Mehrheitsaktionärs von Fox News und derzeit mächtigsten Medienunternehmers, hatte man Ailes aus der Vorstandsetage entfernt. Ailes’ Sturz ließ Linksliberale frohlocken: Der größte Scharfmacher der Konservativen war durch die neue gesellschaftliche Norm zu Fall gekommen. Kaum drei Monate später wurde Trump, dem man ein weit vulgäreres und beleidigenderes Verhalten vorwarf, zum Präsidenten gewählt.
Ailes gefiel vieles an Trump: dass er Geschäftsmann war, dass er Showman war, dass sich Gerüchte um ihn rankten. Er schätzte Trumps sechsten Sinn für die Öffentlichkeit – oder jedenfalls die Unermüdlichkeit, mit der dieser versuchte, sie für sich zu gewinnen. Ihm gefiel Trumps Spiel. Ihm gefielen Trumps Durchschlagskraft und Schamlosigkeit. «Er macht einfach weiter», hatte Ailes nach der ersten Debatte mit Hillary Clinton bewundernd zu einem Freund gesagt, «wenn man Donald eins über den Schädel zieht, macht er einfach weiter. Er merkt es nicht mal.»
Zugleich war Ailes überzeugt, dass Trump weder politische Überzeugungen noch so etwas wie Rückgrat besaß. Die Tatsache, dass Trump zur Inkarnation des von Fox propagierten wütenden Mannes auf der Straße geworden war, deutete – wie vieles andere – darauf hin, dass man in einer völlig veränderten Welt lebte. Irgendjemand würde das Nachsehen haben – und Ailes befürchtete, dieser Irgendjemand könnte er selbst sein.
Aber Ailes hatte jahrzehntelang Politiker begleitet und während seiner Laufbahn alle möglichen Typen, Stile, Eigentümlichkeiten, Couleurs, Feigheiten und Manien erlebt. Strippenzieher wie er selbst – und jetzt Bannon – hatten es mit jeder Art von Politikern zu tun. Es war eine symbiotische Beziehung von wechselseitiger Abhängigkeit. Politiker waren die Frontmänner komplexer Organisationen. Strippenzieher wussten, wie das Spiel gespielt wurde, ebenso wie die meisten Amtsinhaber und Kandidaten, doch Ailes war sich ziemlich sicher, dass Trump es nicht wusste. Trump war unbeherrscht und nicht imstande, eine Taktik zu entwickeln und durchzuhalten. Er konnte nicht Teil einer Organisation sein und kannte vermutlich weder Programm noch Prinzipien. In Ailes’ Augen war er ein Rebell ohne Ziel. Er war einfach «Donald» – als wäre damit alles gesagt.
Anfang August, nicht einmal einen Monat nach Ailes’ Rauswurf bei Fox News, bat Trump seinen alten Freund, die Leitung seiner bislang katastrophalen Kampagne zu übernehmen. Ailes, der Trumps Beratungsresistenz kannte, lehnte ab. Eine Woche später übernahm Bannon den Job.
Nach Trumps Wahlsieg erkannte Ailes fassungslos, dass dessen Angebot eine einmalige Gelegenheit gewesen war, und bereute, sie nicht ergriffen zu haben. Er sah, dass Trumps Aufstieg zur Macht der überraschende Triumph von vielem war, wofür Ailes und Fox News standen. Immerhin hatte Ailes vermutlich am meisten dazu beigetragen, die wutbürgerlichen Kräfte freizusetzen, die Trump den Sieg gebracht hatten: Er hatte die rechte Medienmaschine, die Trump als ihren Helden feierte, geradezu erfunden.
Ailes gehörte zu dem kleinen Kreis von Freunden und Beratern, mit denen Trump regelmäßig telefonierte, und er hoffte, mehr Zeit mit dem neuen Präsidenten verbringen zu können, sobald Beth und er in Palm Beach wären; er wusste, dass Trump regelmäßig nach Mar-a-Lago fahren wollte, in dessen Nachbarschaft Ailes’ neues Haus lag. Doch er wusste auch, dass in der Politik ein Sieg alles ändert – der Sieger ist der Sieger –, und konnte noch immer nicht ganz fassen, dass sein Freund Donald Trump gegen alle Wahrscheinlichkeit und Erwartung jetzt Präsident der Vereinigten Staaten war.
Um halb zehn, drei Stunden zu spät – das Essen ging schon dem Ende zu –, erschien Bannon. Wie üblich trug er ein zerknittertes Jackett, eine Khakihose und zwei Hemden übereinander. Der unrasierte, übergewichtige Dreiundsechzigjährige setzte sich zu den anderen Gästen an den Tisch und zog das Gespräch an sich. Er schob das angebotene Weinglas beiseite – «Ich trinke nicht» – und lieferte einen Bericht, eine Sturzflut von Informationen über die Welt, die zu übernehmen er gerade im Begriff war.
«Wir werden Vollgas geben und in den nächsten sieben Tagen sämtliche Kabinettsmitglieder durch die Bestätigungsanhörungen bringen», sagte er über die vorgesehenen Minister, die allesamt wie die Männer aus Wirtschaft und Militär wirkten, mit denen man in den 1950er Jahren Kabinettsposten besetzt hatte, «zwei Tage für Tillerson, zwei Tage für Sessions, zwei Tage für Mattis …».
Bannon leitete von «Mad Dog» Mattis – dem pensionierten Vier-Sterne-General, den Trump für das Amt des Verteidigungsministers nominiert hatte – zu einem langen Vortrag über, in dem er sich über Folter, über die erstaunliche Liberalität von Generälen und über die Dummheit der zivilen und militärischen Bürokratie ausließ. Weiter ging es mit der bevorstehenden Nominierung von Michael Flynn – einem General, dem Trump sich besonders verbunden fühlte und der bei vielen Wahlveranstaltungen als Eröffnungsredner aufgetreten war – zum Nationalen Sicherheitsberater.
«Er ist prima. Er ist kein Jim Mattis und kein John Kelly … aber er ist prima. Er braucht nur die richtigen Mitarbeiter.» Dennoch betonte Bannon: «Wenn man all die Trump-Gegner aussortiert, die all diese Briefe unterschrieben haben, und all die Neokonservativen, die uns all diese Kriege eingebrockt haben … ist die Auswahl nicht groß.»
Bannon sagte, er habe für den Posten des Nationalen Sicherheitsberaters den für seinen harten außenpolitischen Kurs berühmt-berüchtigten Diplomaten John Bolton vorgeschlagen. Bolton war auch einer von Ailes’ Günstlingen.
«Er ist ein Bombenleger», sagte Ailes, «ein seltsamer kleiner Scheißer. Aber ihr braucht ihn. Wer sonst ist gut zu Israel? Flynn hat in Hinblick auf Iran eine kleine Schraube locker. Und Tillerson» – der designierte Außenminister – «kennt sich bloß mit Öl aus.»
«Boltons Schnurrbart ist ein Problem», schnaubte Bannon, «Trump findet, dass er nicht aussieht wie ein Nationaler Sicherheitsberater. Bolton ist gewöhnungsbedürftig.»
«Er hat wohl mal Ärger gehabt, weil er in einem Hotel in einen Streit verwickelt war und irgendeiner Frau nachgestiegen ist.»
«Wenn ich das Trump erzähle, kriegt er den Job vielleicht.»
Eigenartigerweise war Bannon imstande, Trump voll und ganz zu unterstützen und zugleich den Eindruck zu erwecken, er nehme ihn nicht richtig ernst. Er hatte Trump, den Mal-ja-mal-nein-Präsidentschaftskandidaten, 2010 kennengelernt; bei einem Treffen im Trump Tower hatte Bannon vorgeschlagen, Trump solle einige der Tea Party nahestehende Kandidaten für Sitze im Kongress mit einer halben Million Dollar unterstützen, um seine eigenen Ambitionen auf die Präsidentschaft zu fördern. Am Ende des Gesprächs hatte Bannon den Eindruck gehabt, Trump werde niemals so viel Geld lockermachen. Er sei einfach kein ernstzunehmender Akteur. Zwischen dieser ersten Begegnung und Mitte August 2016, als er die Trump-Kampagne übernahm, hatte Bannon, abgesehen von ein paar Interviews für seine Breitbart-Radioshow, keine zehn Minuten unter vier Augen mit Trump gesprochen.
Doch jetzt war Bannons Zeitgeist-Moment gekommen. Überall auf der Welt gerieten Gewissheiten ins Wanken. In Großbritannien gab es den Brexit, Flüchtlinge strandeten an Europas Küsten, der Mann auf der Straße fühlte sich übergangen, es wurde das Gespenst einer weiteren Finanzkrise an die Wand gemalt, Bernie Sanders und sein linker Revisionismus feierten Erfolge – überall gab es Widerstände. Selbst die entschiedensten Verfechter der Globalisierung begannen zu zweifeln. Bannon glaubte, dass sehr viele Menschen plötzlich empfänglich waren für eine neue Botschaft: Die Welt brauchte Grenzen – jedenfalls sollte sie wieder so sein wie damals, als es noch Grenzen gab. Als Amerika groß war. Trump war zum Verkünder dieser Botschaft geworden.
An jenem Abend im Januar 2017 war Bannon bereits fast fünf Monate Bestandteil von Donald Trumps Welt. Und obwohl er Trumps Eigenheiten ausgiebig kennengelernt und angesichts der Unberechenbarkeit seines Bosses Grund genug zur Sorge hatte, schmälerte dies in seinen Augen weder Trumps außergewöhnliche charismatische Wirkung auf die politische Rechte, auf die Tea Party und auf seine Follower im Internet noch die große Chance, die sich Steve Bannon jetzt, nach Trumps Sieg, bot.
«Kapiert er das?», fragte Ailes unvermittelt, hielt inne und sah Bannon gespannt an.
Mit «er» war Trump gemeint. Das schien eine der Fragen bezüglich des Themenkatalogs der Rechten zu sein: Kapierte der milliardenschwere Playboy wirklich, worum es den Populisten ging? Aber möglicherweise war es überhaupt die Frage nach dem Wesen der Macht: Kapierte Donald Trump, wohin ihn die Geschichte gestellt hatte?
Bannon trank einen Schluck Wasser. «Ja», sagte er dann nach einem Zögern, das vielleicht ein bisschen zu lange gedauert hatte, «er kapiert, soviel er kapiert.»
Ailes fuhr fort, ihn von der Seite anzusehen, als wartete er darauf, dass Bannon weitere Karten aufdeckte.
«Wirklich», sagte Bannon, «er hält sich ans Programm. Es ist ja seins.» Er leitete von Trumps Person zu dessen Agenda über. «Am ersten Tag verlegen wir die Botschaft nach Jerusalem. Netanjahu ist schon eingeweiht. Sheldon» – Sheldon Adelson, der weit rechts stehende Casinomilliardär, der sowohl Israel als auch Trump unterstützte – «ebenfalls. Wir wissen, wohin es in dieser Frage gehen soll.»
«Weiß Donald es auch?», fragte Ailes skeptisch.
Bannon lächelte und fuhr quasi augenzwinkernd fort: «Jordanien kriegt das Westjordanland, Ägypten den Gazastreifen. Sollen die sich damit rumschlagen oder dabei untergehen. Die Saudis stehen in den Startlöchern, die Ägypter ebenfalls, alle haben die Hosen voll wegen Iran … Jemen, Sinai, Libyen … diese ganze Sache ist übel … Darum ist Russland so entscheidend. Und sind die Russen wirklich so schlimm? Sie sind böse, ja – aber die Welt ist voll von bösen Menschen.»
Er sprach überschwänglich: ein Mann, der dabei war, die Welt neu zu ordnen.
«Aber es ist gut zu wissen, dass die Bösen die Bösen sind», gab Ailes zu bedenken, «Donald weiß es vielleicht nicht.»
Der wahre Feind, konterte Bannon und bemühte sich, Trump weder zu sehr zu verteidigen noch ihn auch nur ansatzweise zu kritisieren, sei China. China sei die erste Front in einem neuen Kalten Krieg. Und das sei in den Obama-Jahren nicht erkannt worden – man habe geglaubt, etwas zu verstehen, es aber ganz und gar nicht verstanden. Auf diesem Gebiet hätten die amerikanischen Geheimdienste versagt. «Ich halte Comey für drittklassig und Brennan für zweitklassig», sagte Bannon über die Direktoren des FBI und der CIA.
«Im Augenblick ist das Weiße Haus wie Johnsons Weißes Haus 1968. Susan Rice» – Obamas Nationale Sicherheitsberaterin – «leitet die Maßnahmen gegen den IS. Irgendwer sucht die Ziele aus, und sie ordnet die Drohneneinsätze an. Ich meine, die führen diesen Krieg ungefähr so effektiv wie Johnson seinen Vietnamkrieg. Das Pentagon ist nicht eingebunden, die Geheimdienste sind nicht eingebunden. Die Medien haben Obama vom Haken gelassen. Wenn man die ideologischen Aspekte beiseitelässt, ist das Ganze nichts weiter als eine Amateurshow. Ich weiß nicht, was Obama so treibt. Keiner auf dem Kapitol kennt ihn, kein Geschäftsmann kennt ihn – was hat er erreicht, was tut er eigentlich?»
«Was sagt Donald dazu?», fragte Ailes und ließ deutlich durchblicken, dass Bannon seinem Gönner weit voraus war.
«Er ist völlig einverstanden.»
«Konzentriert?»
«Er steht dahinter.»
«Ich würde Donald nicht zu viel zum Nachdenken geben», sagte Ailes amüsiert.
Bannon schnaubte. «Zu viel oder zu wenig – kein großer Unterschied.»
«Auf was hat er sich mit den Russen eingelassen?», wollte Ailes wissen.
«Er ist nach Russland geflogen», sagte Bannon, «und hat gedacht, er würde mit Putin zusammentreffen, aber dem war er scheißegal. Also hat er es weiter versucht.»
«Er ist eben Donald», sagte Ailes.
«Großartig», sagte Bannon, dem Trump wie ein Naturwunder vorkam, wie etwas, das jenseits aller Erklärungen war.
Als wollte er das Thema Trump umgehen – dieser war bloß eine eigentümliche, spürbare Präsenz, die man dankbar willkommen heißen, aber auch ertragen musste –, gab Bannon in seiner selbstkonzipierten Rolle als Präsidentenmacher den Kurs vor: «China ist entscheidend. Alles andere ist zweitrangig. Wenn wir’s mit China vermasseln, werden wir’s auf allen Gebieten vermasseln. Es ist ganz einfach: China ist heute da, wo Nazi-Deutschland 1929 oder 1930 war. Die Chinesen sind, wie die Deutschen, das vernünftigste Volk der Welt – bis sie es plötzlich nicht mehr sind. Und wie die Deutschen in den Dreißigern werden sie kippen. Und wenn das passiert, braucht man schon einen extrem nationalistischen Staat, um den Geist wieder in die Flasche zu kriegen.»
«Donald als Nixon in China?», sagte Ailes mit unbewegter Miene und deutete damit an, dass bei der Vorstellung, Donald Trump könnte beim globalen Wandel eine Führungsrolle übernehmen, Zweifel angebracht waren.
Bannon lächelte. «Als Bannon in China», sagte er mit einer bemerkenswerten Mischung aus Großspurigkeit und Selbstironie.
«Was macht der Junge?», fragte Ailes und meinte damit Trumps Schwiegersohn und engsten politischen Berater, den sechsunddreißigjährigen Jared Kushner.
«Er ist mein Partner», sagte Bannon. Sein Ton verriet, dass er entschlossen war, bei dieser Aussage zu bleiben, auch für den Fall, dass sie nicht stimmte.
«Wirklich?», fragte Ailes skeptisch.
«Er ist mit von der Partie.»
«Er hat ziemlich oft mit Rupert zu Mittag gegessen.»
«Das ist übrigens eine Sache», sagte Bannon, «bei der ich Ihre Hilfe gebrauchen könnte.» Einige Minuten lang versuchte er, Ailes zu überreden, er solle ihm, Bannon, helfen, Rupert Murdoch zu Fall zu bringen. Seit seinem Rauswurf bei Fox war Ailes in Hinblick auf Murdoch immer bitterer geworden. Inzwischen plauderte Murdoch häufig mit dem zukünftigen Präsidenten und mahnte ihn zur Mäßigung – eine eigenartige Umkehrung der Strömung im immer seltsameren amerikanischen Konservatismus. Ailes, schlug Bannon vor, könnte in einem Gespräch mit Trump, einem Mann, zu dessen zahlreichen Neurosen eine panische Angst vor Vergesslichkeit oder Senilität gehörte, andeuten, Murdoch verliere wohl langsam den Überblick.
«Ich werde ihn anrufen», sagte Ailes, «aber für Rupert würde Trump durch einen Reifen springen. Genau wie für Putin. Er schleimt sich ein und schaltet das Gehirn aus. Ich frage mich, wer da wen an der Leine hat.»
Der ältere und der (wenn auch nicht sehr viel) jüngere Virtuose auf der rechten Medienklaviatur fuhren mit ihrem Gespräch zur Freude der anderen Gäste bis halb eins fort. Der Ältere versuchte, das neue nationale Rätsel zu ergründen, das Trump darstellte – auch wenn er behauptete, Trump sei eigentlich immer berechenbar –, während der Jüngere entschlossen schien, seinen Schicksalsmoment nicht ungenutzt verstreichen zu lassen.
«Donald Trump hat’s kapiert. Er ist Trump, aber er hat’s kapiert. Trump ist Trump», bekräftigte Bannon.
«Ja, er ist Trump», sagte Ailes mit einer Spur von Skepsis.
Kapitel 1Wahltag
Am Nachmittag des 8. November 2016 betrat Kellyanne Conway – Donald Trumps Wahlkampfleiterin und eine zentrale, ja herausragende Figur in der Trump-Welt – ihr Büro im Trump Tower. Bis in die letzten Wochen war es in Trumps Wahlkampfhauptquartier sehr ruhig zugegangen. Nur ein paar Plakate mit rechten Slogans deuteten darauf hin, dass man sich hier nicht in der Verwaltung irgendeines Geschäftsbetriebs befand.
Gemessen an der Tatsache, dass ihr eine heftige, wenn nicht gar verheerende Niederlage bevorstand, war ihre Stimmung bemerkenswert gut. Donald Trump würde die Wahl verlieren, da war sie sich sicher, doch es war realistisch, dass der Abstand zur Konkurrentin weniger als sechs Prozent betragen würde. Das wäre ein beachtlicher Erfolg. Was die drohende Niederlage betraf, so zuckte sie die Schultern: Die hatte Reince Priebus zu verantworten, nicht sie.
Sie hatte einen guten Teil des Tages damit verbracht, Freunde und politische Verbündete anzurufen, um Priebus die Schuld zuzuweisen. Jetzt sprach sie mit einigen Fernsehproduzenten und -moderatoren, zu denen sie beste Kontakte unterhielt und mit denen sie in der Hoffnung, nach der Wahl einen unbefristeten Job zu ergattern, in den vergangenen Wochen Bewerbungsgespräche geführt hatte. Viele von ihnen hatte sie sorgfältig umworben, seit sie sich Mitte August Trumps Wahlkampfteam angeschlossen hatte und nicht nur zur zuverlässig kämpferischen Stimme, sondern mit ihrem sprunghaften Lächeln und der seltsamen Mischung aus tiefer Gekränktheit und Unerschütterlichkeit auch zum eigenartig telegenen Gesicht der Kampagne geworden war.
Abgesehen von all den anderen schrecklichen Fehlern im Verlauf des Wahlkampfs, sagte sie, sei das eigentliche Problem der Teufel, den sie nicht bändigen könnten: das Republican National Committee (RNC) – und das werde von Priebus, seiner Handlangerin, der zweiunddreißigjährigen Katie Walsh, und seinem Pressefuzzi Sean Spicer geführt. Anstatt sich mit aller Kraft zu engagieren, habe sich das RNC – letztlich das Werkzeug des Republikaner-Establishments – seit Trumps Nominierung im Frühsommer bemerkenswert zurückgehalten. Als Trump Unterstützung gebraucht habe, sei keine gekommen.
Das war der erste Teil von Conways Geschichte. Der zweite Teil war: Trotz aller Widrigkeiten habe die Kampagne sich aus dem tiefen Tal emporgekämpft. Das mit bescheidenen Mitteln ausgestattete Team des praktisch schlechtesten Kandidaten in der modernen politischen Geschichte – wenn Trumps Name fiel, verdrehte Conway die Augen oder starrte vor sich hin – hatte sich außerordentlich gut geschlagen. Conway, die bis dahin keinerlei Erfahrung mit landesweiten Wahlkämpfen gehabt und vor Trumps Kampagne ein kleines Meinungsforschungsinstitut geleitet hatte, wusste genau, dass sie nach der Wahl eine der führenden konservativen Stimmen im Fernsehen sein würde.
Dabei hatte John McLaughlin, der Meinungsforscher des Trump-Teams, erst in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass sich die bisher eher miserablen Umfrageergebnisse aus einigen der entscheidenden Bundesstaaten möglicherweise gerade zu Trumps Gunsten verschoben. Doch weder Conway noch Trump selbst oder sein Schwiegersohn Jared Kushner – der eigentliche Leiter des Wahlkampfteams, das wachsame Auge der Familie – ließen sich davon abbringen, dass ihr unerwartetes Abenteuer bald vorbei sein würde.
Nur der Querkopf Steve Bannon hielt einen Durchbruch für möglich. Aber dass ausgerechnet er – Crazy Steve – daran glaubte, war eigentlich eher beunruhigend.
Fast alle im noch immer extrem kleinen Wahlkampfteam hielten sich für realistische Menschen, die ihre Chancen so nüchtern einschätzten wie nur irgendjemand, der in der Politik tätig ist. Die stillschweigende Übereinkunft lautete: Donald Trump würde nicht Präsident werden – und das wäre wahrscheinlich auch besser so. Die erste Hälfte dieses Satzes bedeutete, dass man sich mit der in der zweiten Hälfte aufgeworfenen Frage nicht zu befassen brauchte.
Als der Wahlkampf zu Ende ging, war Trump bester Laune. Er hatte im Oktober 2016 die Veröffentlichung eines Gesprächs überstanden, in dem er 2005 dem Moderator Billy Bush gegenüber in vulgärer Sprache mit sexuellen Übergriffen auf Frauen geprahlt hatte – dabei hatte das RNC ihn mitten in dem Sturm der Entrüstung, der darauf folgte, aufgefordert, seine Kandidatur aufzugeben. Und FBI-Direktor James Comey hatte Hillary Clinton mit seiner Ankündigung, er werde die Ermittlungen in der E-Mail-Affäre wiederaufnehmen, elf Tage vor der Wahl in schwerste Bedrängnis gebracht und dazu beigetragen, einen Erdrutschsieg Clintons abzuwenden.
«Ich kann der berühmteste Mann der Welt werden», sagte Trump zu seinem immer wieder angeheuerten und gefeuerten Berater Sam Nunberg.
«Aber wollen Sie denn überhaupt Präsident werden?», fragte Nunberg (eine qualitativ andere Frage als die, welche man Kandidaten gewöhnlich stellt: «Warum wollen Sie Präsident werden?»). Er bekam keine Antwort.
Das Entscheidende war: Eine Antwort war nicht nötig, denn er würde ja nicht Präsident werden.
Roger Ailes sagte gern, wenn man es auf eine Karriere in der Fernsehindustrie abgesehen habe, solle man erst einmal für die Präsidentschaft kandidieren. Jetzt setzte Trump, von Ailes ermuntert, Gerüchte über einen eigenen Sender in die Welt. Eine großartige Zukunft lag vor ihm.
Aus diesem Wahlkampf, versicherte Trump seinem Freund, werde er mit einem gestärkten Markenzeichen und ungeahnten Möglichkeiten hervorgehen. «Diese Sache ist größer als in meinen größten Träumen», sagte er eine Woche vor der Wahl zu Ailes, «ich denke nicht ans Verlieren, weil es kein Verlieren ist. Wir haben total gesiegt.» Und dann legte er dar, wie seine öffentliche Reaktion sein würde: Man hat uns um den Sieg betrogen!
Donald Trump und seine winzige Wahlkampftruppe bereiteten sich auf einen Untergang mit Feuer und Zorn vor. Auf einen Sieg waren sie nicht gefasst.
In der Politik muss es einen Verlierer geben, und doch denkt jeder, er könne gewinnen. Und tatsächlich kann wohl nur gewinnen, wer an den Sieg glaubt – mit Ausnahme von Donald Trumps Wahlkampfteam.
Wenn Trump über seinen Wahlkampf sprach, war sein Leitmotiv, dieser sei beschissen und alle Beteiligten seien Versager. Und er war gleichermaßen überzeugt, dass die Clinton-Leute allesamt brillante Sieger waren. «Sie haben die Besten und wir die Schlechtesten», sagte er immer. Wer in Trumps Wahlkampfmaschine mitflog, bekam oft Anschisse von epischen Ausmaßen zu hören: Donald Trump war umgeben von Idioten.
Corey Lewandowski, Trumps erster mehr oder weniger offizieller Wahlkampfmanager, wurde häufig beschimpft. Monatelang bezeichnete Trump ihn als «den Schlimmsten», im Juni 2016 wurde er schließlich gefeuert. Von da an erklärte Trump, ohne Lewandowski sei die Kampagne zum Scheitern verurteilt. «Wir sind alle Versager», sagte er, «unsere Leute sind allesamt schrecklich, keiner weiß, was er tut … Ich wollte, Corey wäre wieder da.» Auch Paul Manafort, sein zweiter Wahlkampfmanager, fiel bald in Ungnade.
Im August lag Trump zwölf bis siebzehn Prozentpunkte hinter Clinton, wurde von der Presse täglich in der Luft zerrissen und konnte sich kein noch so weit hergeholtes Szenario vorstellen, in dem er die Wahl gewann. An diesem Tiefpunkt verkaufte Trump seine scheiternde Kampagne in mehrfacher Hinsicht. Der weit rechts stehende Milliardär Bob Mercer, zuvor ein Unterstützer von Ted Cruz, hatte Trump mit einer Fünf-Millionen-Dollar-Geldspritze unterstützt. Da er fürchtete, Trumps Wahlkampf könnte einbrechen, flogen Mercer und seine Tochter Rebekah mit dem Hubschrauber von ihrem Anwesen auf Long Island zu einem Spendendinner, das Woody Johnson, Eigentümer der Footballmannschaft New York Jets und des Konzerns Johnson & Johnson, in seinem Sommerhaus in den Hamptons veranstaltete. Auch andere potenzielle Spender fanden sich dort ein.
Weder zum Vater noch zur Tochter hatte Trump eine echte Beziehung. Er hatte sich nur ein paarmal mit Bob Mercer unterhalten, der meist einsilbige Antworten gab; Rebekah Mercers Geschichte mit Trump beschränkte sich auf ein Selfie mit ihm im Trump Tower. Doch als die Mercers ihren Plan präsentierten, die Kampagne zu übernehmen und ihre eigenen Leute – Steve Bannon und Kellyanne Conway – zu installieren, leistete Trump keinen Widerstand. Er gab nur zu erkennen, dass er absolut nicht einsah, warum jemand das tun wollte. «Die ganze Sache», sagte er den Mercers, «ist völlig verfahren.»
Alles deutete darauf hin, dass etwas Dunkleres als bloß der Schatten des bevorstehenden Scheiterns über dem lag, was Steve Bannon als «Schlappschwanz-Kampagne» bezeichnete: deren strukturelle Unmöglichkeit.
Der Kandidat, der sich als Milliardär – als zehnfachen Milliardär – bezeichnete, weigerte sich, eigenes Geld in seinen Wahlkampf zu investieren. Bannon sagte zu Jared Kushner – der, als Bannon an Bord geholt worden war, mit seiner Frau und Trumps Feind David Geffen Urlaub in Kroatien machte –, man werde nach der ersten Fernsehdebatte im September weitere fünfzig Millionen Dollar brauchen, um bis zum Wahltag durchzuhalten.
Kushner bewies Realitätssinn: «Auf keinen Fall kriegen wir fünfzig Millionen – es sei denn, wir garantieren ihm den Sieg.»
«Fünfundzwanzig Millionen?», fragte Bannon.
«Wenn wir ihm sagen können, dass der Sieg mehr als wahrscheinlich ist.»
Letztlich gab Trump seiner Kampagne lediglich zehn Millionen, als Darlehen und rückzahlbar, sobald genug anderes Geld eingegangen war. (Steve Mnuchin, der damals für die Finanzen zuständig war, erschien persönlich bei Trump und hatte die ausgefüllten Unterlagen mitgebracht, damit sein Boss nicht «vergessen» konnte, das Geld anzuweisen.)
Eigentlich gab es keinen richtigen Feldzug, denn es gab gar keine Organisation – oder bestenfalls eine einzigartig dysfunktionale. Roger Stone, anfangs faktisch der Wahlkampfleiter, kündigte oder wurde von Trump gefeuert – jeder der beiden verlautbarte seine Version. Sam Nunberg, der früher auch für Stone gearbeitet hatte, wurde von Lewandowski unter viel Geräuschentwicklung vor die Tür gesetzt, worauf Trump die Menge der öffentlich gewaschenen schmutzigen Wäsche exponentiell vergrößerte, indem er Nunberg verklagte. Lewandowski und Hope Hicks, die von Ivanka Trump installierte PR-Beraterin, hatten eine Affäre, die mit einem heftigen Streit auf offener Straße endete – ein Zwischenfall, den Nunberg in seiner Erwiderung auf Trumps Klage anführte. Diese Kampagne war ganz offensichtlich nicht geeignet, irgendetwas zu gewinnen.
Selbst als Trump die sechzehn anderen Kandidaten der Republikaner aus dem Feld schlug, womit wirklich niemand gerechnet hatte, erschien das eigentliche Ziel – die Präsidentschaft – nicht weniger grotesk.
Und im Herbst, gerade als der Sieg ein kleines bisschen greifbarer zu sein schien, wurde diese Aussicht durch die Billy-Bush-Affäre zunichtegemacht. Ausgerechnet mitten in einer landesweiten Debatte über sexuelle Belästigung wurde bekannt, dass Trump Jahre zuvor bei eingeschaltetem Mikrofon zu dem NBC-Moderator Billy Bush gesagt hatte: «Ich fühle mich automatisch zu schönen Frauen hingezogen – ich fange einfach an, sie zu küssen. Es ist wie ein Magnet. Einfach küssen. Ich warte nicht mal ab. Und wenn du ein Star bist, lassen sie dich ran. Du kannst alles machen … ihnen zwischen die Beine fassen [grab them by the pussy]. Du kannst alles tun, was du willst.»
Es entwickelte sich eine bühnenreife Katastrophe, so niederschmetternd, dass RNC-Leiter Reince Priebus, der von Washington zu einer Krisensitzung nach New York gerufen worden war, es nicht über sich brachte, die Penn Station zu verlassen. Erst nach zwei Stunden hatte das Trump-Team ihn so weit, dass er zum Trump Tower kam.
«Mann», sagte ein verzweifelter Bannon ins Telefon, «es kann sein, dass wir uns heute zum letzten Mal sehen, aber Sie müssen kommen, und zwar durch die Vordertür.»
Nach der Demütigung, die Melania Trump im Zuge der Billy-Bush-Affäre zu erdulden hatte, war die Tatsache, dass ihr Mann nun auf keinen Fall mehr Präsident werden konnte, der Silberstreif an ihrem Horizont.
Donald Trumps Ehe war beinahe allen Menschen in seiner Umgebung ein Rätsel – jedenfalls denen, die nicht über viele Häuser und Privatjets verfügten. Er und Melania verbrachten relativ wenig Zeit miteinander. Sie begegneten sich manchmal tagelang nicht, selbst wenn sie beide im Trump Tower waren. Oft wusste sie nicht, wo er gerade war, oder nahm es nur am Rande zur Kenntnis. Ihr Mann wechselte den Aufenthaltsort, als würde er von einem Zimmer ins andere gehen. So wenig Melania wusste, wo er war, so wenig wusste sie, was er eigentlich tat, und ihr Interesse dafür war nicht sehr ausgeprägt. Schon um seine ersten vier Kinder hatte Trump sich kaum gekümmert, und um das fünfte, Barron, den Sohn, den er mit Melania hatte, kümmerte er sich noch weniger. Er führte jetzt die dritte Ehe und sagte Freunden, er glaube, er habe endlich die Zauberformel gefunden: Leben und leben lassen – «Mach dein Ding».
Er war ein berüchtigter Frauenheld und wurde im Wahlkampf zum vielleicht berühmtesten Grabscher der Welt. Niemand konnte behaupten, Trump sei im Umgang mit Frauen besonders feinfühlig. Er selbst verbreitete sich oft darüber, wie man die Frauen zu nehmen habe. In einer Unterhaltung mit Freunden entwickelte er einmal die Theorie, je größer der Altersunterschied zwischen einem älteren Mann und seiner jungen Frau sei, desto weniger persönlich nehme diese seine Seitensprünge.
Die Annahme, diese Ehe bestehe nur auf dem Papier, war dennoch falsch. Er sprach oft von Melania. Er bewunderte ihr Aussehen – zu ihrer Verlegenheit oft in Anwesenheit anderer. Sie war, wie er stolz und ohne jede Ironie verkündete, eine «Vorzeigefrau». Und obgleich er nicht unbedingt sein Leben mit ihr teilte, war er doch bereit, sie an dem teilhaben zu lassen, was dabei heraussprang. «Glückliche Frau – glückliches Leben», sagte er gern – eine unter den oberen Zehntausend beliebte Plattitüde.
Er bemühte sich auch um Melanias Anerkennung (wie um die aller anderen Frauen in seiner Umgebung, und diese waren gut beraten, nicht damit zu sparen). Als er 2014 zum ersten Mal ernsthaft in Erwägung zog, sich um die Präsidentschaft zu bewerben, gehörte Melania zu den wenigen, die einen Wahlsieg für möglich hielten. Das war eine Steilvorlage für seine Tochter Ivanka, die damals auf deutliche Distanz zu dieser Idee gegangen war. Zu Freundinnen hatte Ivanka, die aus ihrer Abneigung gegen ihre Stiefmutter nie ein Hehl gemacht hatte, gesagt: Alles, was man über Melania wissen muss, ist, dass sie tatsächlich glaubt, wenn er kandidieren würde, würde er bestimmt gewinnen.
Doch für Melania war die Vorstellung, ihr Mann könnte Präsident werden, entsetzlich. Sie war überzeugt, mit ihrem sorgfältig abgeschirmten und abseits vom Rest der Familie geführten Leben, in dessen Mittelpunkt ihr Sohn stand, werde es dann vorbei sein.
Ihr Mann sagte amüsiert, so weit sei es ja noch nicht, verbrachte aber seine Tage auf Wahlkampftour und machte Schlagzeilen. Melanias Sorgen und Ängste wuchsen.
Freundinnen erzählten ihr, in Manhattan sei eine Flüsterkampagne voll grausamer, aberwitziger Andeutungen im Gange. Man nahm ihre Modelkarriere unter die Lupe. Nachdem Trump die Nominierung geschafft hatte, verbreitete in Slowenien, wo Melania aufgewachsen war, die Klatschzeitschrift Suzy üble Gerüchte über sie, Gerüchte, die dann – als Vorgeschmack dessen, was noch kommen mochte – von der Daily Mail in alle Welt hinausposaunt wurden.
Der New York Post wurden Aktaufnahmen zugespielt, die Melania zu Beginn ihrer Karriere hatte machen lassen. Alle außer Melania nahmen an, die Quelle sei niemand anderes als Trump persönlich.
Niedergeschmettert fauchte sie ihren Mann an. Ob das die Zukunft sei. Sie werde nicht imstande sein, das zu ertragen.
Trump reagierte auf seine Art – Die verklagen wir! – und stellte ihr seine Anwälte zur Verfügung, doch er war, ganz gegen seine Gewohnheit, auch zerknirscht. Nicht mehr lange, sagte er. Im November werde das alles vorbei sein. Er gab seiner Frau sein feierliches Wort: Ein Wahlsieg war schlicht unmöglich. Und obwohl es das Versprechen eines chronisch – er selbst hätte gesagt: hilflos – untreuen Mannes war, sah es ganz danach aus, als würde er es halten können.
Die Trump-Kampagne hatte, vielleicht nicht ganz unabsichtlich, das Schema von Mel Brooks’ Frühling für Hitler abgekupfert. In diesem Filmklassiker verkaufen Brooks’ durchgeknallte, betrügerische Helden Max Bialystok und Leo Bloom mehr als hundert Prozent der Anteile an einem von ihnen produzierten Broadway-Musical. Da die Sache nur auffliegt, wenn das Musical ein Erfolg wird, setzen sie alles daran, es floppen zu lassen. Die Show, die sie auf die Bühne stellen, ist so geschmacklos, dass sie Furore macht, worauf unsere beiden Helden erledigt sind.
Siegreiche Präsidentschaftskandidaten haben sich – getrieben von Hybris, Narzissmus oder übersteigertem Sendungsbewusstsein – während eines großen Teils ihrer Karriere, wenn nicht gar ihres ganzen Erwachsenenlebens, auf diese Rolle vorbereitet. Sie werden in immer höhere Ämter gewählt. Sie perfektionieren ihre Darstellung in der Öffentlichkeit. Sie vernetzen sich wie verrückt, denn politischer Erfolg ist weitgehend eine Frage von Bündnissen. Sie hängen sich rein. (Der desinteressierte George W. Bush verließ sich darauf, dass die Freunde seines Vaters sich für ihn reinhängten.) Und sie hinterlassen keinen Dreck – oder jedenfalls keine Spuren. Sie bereiten sich darauf vor, die Wahl zu gewinnen und zu regieren.
Trumps Rechnung sah – ganz bewusst – anders aus. Der Kandidat und seine führenden Berater glaubten, sie könnten die Vorteile einer beinahe errungenen Präsidentschaft genießen, ohne ihr Benehmen oder ihre Weltsicht auch nur ein bisschen zu ändern: Wir brauchen nichts anderes zu sein als das, was wir sind, denn natürlich werden wir nicht gewinnen.
Viele Präsidentschaftskandidaten haben die Tatsache, dass sie mit den Verhältnissen in Washington nicht vertraut waren, als Tugend verkauft; tatsächlich begünstigt diese Strategie lediglich Gouverneure gegenüber Senatoren. Jeder ernstzunehmende Kandidat, ganz gleich, wie wütend er über Washington herzieht, braucht Insider als Unterstützer und Berater, doch in Trumps innerstem Zirkel gab es kaum einen, der landesweit politisch tätig gewesen war – seine engsten Berater hatten bis dahin überhaupt nichts mit Politik zu tun gehabt. Sein Leben lang hatte Trump nur sehr wenige enge Freunde, doch als er seine Kandidatur verkündete, gab es kaum welche, die in der Politik waren. Die einzigen echten Politiker, denen Trump nahestand – Rudy Giuliani und Chris Christie – waren, jeder auf seine Art, sonderbar und isoliert. Und zu sagen, dass Trump nichts, aber auch gar nichts über die grundsätzlichen intellektuellen Voraussetzungen für dieses Amt wusste, wäre eine groteske Untertreibung. In den Anfängen des Wahlkampfs erklärte Sam Nunberg dem Kandidaten in einer Szene, die eines Mel Brooks’ würdig gewesen wäre, die amerikanische Verfassung: «Als wir beim Fourth Amendment waren, zupfte er mit den Fingern an der Unterlippe und verdrehte die Augen.»
Fast jeder im Trump-Team hatte die unschönen Konflikte im Gepäck, die jedem Präsidenten und seinem Stab zu schaffen machen. Mike Flynn, Trumps zukünftiger Nationaler Sicherheitsberater, der bei Wahlkampfauftritten die Eröffnungsrede hielt und den Trump gern über die CIA und die Unfähigkeit amerikanischer Spione sprechen hörte, erwiderte auf Vorhaltungen von Freunden, es sei keine gute Idee gewesen, sich von den Russen 45000 Dollar für eine Rede bezahlen zu lassen: «Tja, das wäre ein Problem, aber nur, falls wir gewinnen.» Er wusste eben, dass es kein Problem sein würde.
Paul Manafort, der internationale Lobbyist und politische Strippenzieher, den Trump nach Lewandowskis Rausschmiss zu seinem Wahlkampfmanager machte – und der bereit war, ohne Honorar zu arbeiten, was Fragen nach anderen Gegenleistungen aufwarf –, hatte dreißig Jahre lang Diktatoren und korrupte Despoten vertreten und Millionen Dollar angehäuft, für deren Herkunft und Weg sich amerikanische Ermittler schon lange interessierten. Außerdem wurde Manafort, als er die Wahlkampftruppe übernahm, von dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska verfolgt, der Manaforts finanzielle Transaktionen lückenlos dokumentieren ließ, weil er sich von ihm durch ein krummes Immobiliengeschäft um 17 Millionen Dollar betrogen fühlte und blutige Rache geschworen hatte.
Vor Trump gab es keinen Präsidenten und kaum einen anderen Politiker, der aus der Immobilienbranche kam, und das hat einleuchtende Gründe: Das Geschäft mit Immobilien findet auf einem wenig regulierten Markt statt und basiert auf hohen Schulden; es ist häufigen Fluktuationen ausgesetzt, auf günstige Gesetze und staatliche Regelungen angewiesen und ein bevorzugtes Mittel, Geld zu waschen. Jared Kushner, dessen Vater Charlie, Trumps Söhne Don Jr. und Eric, seine Tochter Ivanka und natürlich er selbst – sie alle stützten ihre Geschäfte in kleinerem oder größerem Umfang auf den freien internationalen Zahlungsverkehr und Geld unklarer Herkunft. Charlie Kushner, in dessen Immobiliengeschäft Trumps Schwiegersohn und wichtigster Berater stark eingebunden war, hatte bereits wegen Steuerhinterziehung, Zeugenbeeinflussung und illegaler Wahlkampfspenden im Gefängnis gesessen.
Der gründlichsten Schwachstellenanalyse unterziehen heutige Politiker und ihre Stäbe nicht den politischen Gegner, sondern sich selbst. Hätte man den Kandidaten und seine ethischen Werte etwas gründlicher abgeklopft, dann hätte man schnell erkennen können, dass Gefahr drohte. Trump unternahm bewusst nichts in dieser Richtung. Roger Stone erklärte Steve Bannon, Trumps psychische Disposition mache es ihm unmöglich, sich selbst genau zu betrachten. Ebenso wenig könne er den Gedanken ertragen, dass jemand anderes dann eine Menge über ihn wissen und es womöglich gegen ihn einsetzen würde. Und überhaupt: Wozu das Risiko eines genauen Blicks nach innen eingehen, wenn die Chancen auf einen Wahlsieg so schlecht standen?
Trump ignorierte nicht nur die durch seine Geschäftsbeziehungen und Immobilienholdings drohenden Konflikte, sondern weigerte sich auch rundheraus, seinen Steuerbescheid zu veröffentlichen. Warum auch? Er würde die Wahl ja ohnehin nicht gewinnen.
Aber darüber hinaus lehnte Trump es auch ab, sich irgendwelche Gedanken, und seien sie noch so hypothetischer Natur, zur Übergangszeit zu machen, und zwar mit der Begründung, das «bringe Unglück» – womit er in Wirklichkeit meinte, das sei Zeitverschwendung.
Er würde nicht gewinnen! Es sei denn, verlieren war gewinnen.
Trump würde der berühmteste Mann der Welt sein – ein Opfer der betrügerischen Hillary Clinton.
Seine Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn Jared würden nicht mehr relativ unbekannte reiche Kinder, sondern internationale Berühmtheiten und Markenbotschafter sein.
Steve Bannon würde der De-facto-Anführer der Tea-Party-Bewegung sein.
Kellyanne Conway würde ein Fernsehstar sein.
Reince Priebus und Katie Walsh würden ihre Republikanische Partei zurückbekommen.
Melania Trump würde wieder unerkannt zu Mittag essen können.
Das war das beruhigende Ergebnis, das man für den 8. November 2016 erwartete. Trumps Niederlage würde allen gut in den Kram passen.
Als sich der überraschende Trend – Trumps Sieg schien doch noch möglich – um kurz nach acht an diesem Abend bestätigte, sagte Don Jr. zu einem Freund, sein Vater (oder DJT, wie er ihn nannte) sehe aus, als wäre er einem Gespenst begegnet. Melania, der Donald Trump ein feierliches Versprechen gegeben hatte, weinte – und zwar nicht etwa Tränen des Glücks.
Wie Steve Bannon nicht unamüsiert bemerkte, verwandelte sich ein verdatterter Trump binnen kaum einer Stunde erst in einen ungläubigen und dann in einen ziemlich entsetzten Trump. Und dann kam die letzte Verwandlung: Unvermittelt wurde Donald Trump zu einem Mann, der davon überzeugt war, dass er es verdiente und hervorragend geeignet war, der nächste Präsident der Vereinigten Staaten zu sein.
Kapitel 2Trump Tower
Am Samstag nach der Wahl empfing Donald Trump in seiner dreistöckigen Penthouse-Wohnung im Trump Tower eine kleine Gruppe Gratulanten. Selbst seine engen Freunde waren noch immer schockiert und verwirrt, und alle wirkten irgendwie benommen. Trump aber sah nur immer wieder auf die Uhr.
Rupert Murdoch, der Trump bis dahin für einen Scharlatan und Dummkopf gehalten hatte, wollte mit seiner neuen Frau Jerry Hall dem designierten Präsidenten seine Aufwartung machen, aber er verspätete sich – und zwar sehr. Trump versicherte seinen Gästen wieder und wieder, Rupert sei unterwegs und werde bald eintreffen. Als einige trotzdem aufbrechen wollten, überredete Trump sie, noch ein wenig zu bleiben. Ihr wollt doch sicher Rupert sehen. (Oder, wie einer der Gäste es auffasste: Ihr wollt doch sicher Rupert zusammen mit Trump sehen.)
Murdoch und seine frühere Frau Wendi hatten engen Kontakt zu Jared und Ivanka gehabt. In der jüngeren Vergangenheit aber hatte Murdoch wenig getan, um sein Desinteresse an Trump zu kaschieren. Murdochs Sympathien für Kushner erzeugten eine eigenartige Machtdynamik zwischen Trump und seinem Schwiegersohn, die dieser einigermaßen subtil zu seinem Vorteil nutzte, indem er in Gesprächen mit seinem Schwiegervater häufig Murdochs Namen fallenließ. Als Ivanka diesem 2015 gesagt hatte, ihr Vater habe tatsächlich, wirklich, allen Ernstes vor, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, hatte Murdoch das glatt von der Hand gewiesen.
Doch jetzt, nach dem erstaunlichsten Überraschungserfolg der amerikanischen Geschichte, saß der designierte Präsident wie auf Kohlen und wartete auf Murdoch. «Er ist einer von den ganz Großen», sagte er zu seinen Gästen und wurde immer aufgeregter, «wirklich, einer von den ganz Großen, der letzte von den ganz Großen. Ihr müsst bleiben und ihn sehen.»
Es war ein eigenartiges Gegensatzpaar, eine ironische Symmetrie. Trump, der vielleicht noch nicht ganz begriff, dass zwischen der bloßen Verbesserung seines sozialen Status und der Tatsache, dass er demnächst Präsident sein würde, ein gewisser Unterschied bestand, gab sich größte Mühe, den bislang geringschätzigen Medienmogul für sich zu gewinnen. Und Murdoch, der schließlich (und in mehrfacher Hinsicht arg verspätet) eintraf, war so kleinlaut und verblüfft wie alle anderen und mühte sich um eine Neueinschätzung des Mannes, der für die Reichen und Berühmten seit mehr als einer Generation bestenfalls ein Clown gewesen war.
Murdoch war keineswegs der einzige Milliardär, der Trump mit Herablassung begegnet war. In den Jahren vor der Wahl hatte sich Carl Icahn, den Trump oft als Freund bezeichnete und, wie er angedeutet hatte, mit einem hohen Amt betrauen wollte, öffentlich über seinen Mitmilliardär (der nach seinen Worten nicht mal annähernd Milliardär war) lustig gemacht.
Wenige, die Trump kannten, gaben sich irgendwelchen Illusionen über ihn hin. Das machte beinahe seinen Reiz aus: Er war, was er war. Ein verschmitztes Blitzen im Auge, aber Raffgier im Herzen.
Doch jetzt war er der designierte Präsident. Und wie in einer Art Realitäts-Jiu-Jitsu veränderte das alles. Was immer man über ihn sagen mochte – das jedenfalls hatte er geschafft. Er hatte das Schwert aus dem Stein gezogen. Das bedeutete etwas. Es bedeutete alles.
Die Milliardäre mussten umdenken. Wie alle in Trumps Dunstkreis. Die Mitglieder des Wahlkampfteams, die mit einem Mal in der Position waren, einen Job im West Wing, dem Westflügel des Weißen Hauses, zu ergattern – um den Grundstein für eine Karriere zu legen und Geschichte zu schreiben –, waren gezwungen, diesen seltsamen, schwierigen, geradezu lächerlichen und offenbar unqualifizierten Mann in einem neuen Licht zu sehen. Er war zum Präsidenten gewählt worden. Und darum war er, wie Kellyanne Conway gern betonte, per Definition präsidial.
Doch bislang hatte ihn noch niemand etwas Präsidiales tun sehen. Weder hatte er sich politischen Umgangsformen und Gepflogenheiten gebeugt noch auch nur ansatzweise Mäßigung gezeigt.
Außenstehende wurden rekrutiert und nahmen das Angebot an, trotz ihres offensichtlichen Eindrucks von diesem Mann. Jim Mattis, Vier-Sterne-General im Ruhestand, einer der angesehensten Kommandeure der amerikanischen Streitkräfte; Rex Tillerson, Vorstandsvorsitzender von ExxonMobil; Scott Pruitt und Betsy DeVos, beide Gefolgsleute von Jeb Bush – sie alle konzentrierten sich auf die Tatsache, dass Donald Trump zwar eine eigenartige, ja vielleicht sogar absurd wirkende Gestalt sein mochte, aber nichtsdestoweniger zum Präsidenten gewählt worden war.
Wir können es schaffen, sagten plötzlich alle in der Trump-Welt. Oder wenigstens: Wir könnten es schaffen.
Aus der Nähe betrachtet war Trump tatsächlich nicht der bombastische, streitsüchtige Kerl, der im Wahlkampf die Zuschauermengen aufgewiegelt hatte. Er war weder wütend noch streitlustig. Er war vielleicht der bedrohlichste, beängstigendste Präsidentschaftskandidat der modernen Geschichte gewesen, doch im persönlichen Umgang konnte er beinahe besänftigend sein. Seine extreme Selbstzufriedenheit färbte ab. Das Leben war schön. Trump war Optimist – zumindest in Hinblick auf sich selbst. Er war charmant, er schmeichelte, er konzentrierte sich auf sein Gegenüber. Er war witzig, manchmal sogar selbstironisch. Und unglaublich schwungvoll. Das machen wir – was immer es sein mochte –, das machen wir. Er war nicht hartgesotten. Er war «ein großer, warmherziger Affe» – so jedenfalls lautete Bannons eher zweischneidiges Lob.
Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal und Vorstandsmitglied von Facebook – eigentlich die einzige bedeutende Person im Silicon Valley, die Trump unterstützte –, wurde von einem anderen Milliardär und langjährigen Trump-Freund gewarnt, Trump werde ihn unter zahllosen Schmeicheleien seiner unvergänglichen Freundschaft versichern. Alle sagen, Sie sind großartig, Sie und ich werden großartig zusammenarbeiten, wenn’s irgendwas gibt, das ich für Sie tun kann, rufen Sie mich an, und wir erledigen das! Thiel erhielt den Rat, das lieber nicht allzu wörtlich zu nehmen, doch nachdem er Trump in seiner Rede auf dem Parteitag der Republikaner in Cleveland unterstützt hatte, sagte er, trotz dieser Warnung sei er absolut sicher gewesen, dass Trump seine Beteuerung, nun seien sie Freunde fürs Leben, ernst gemeint habe – und dann habe er praktisch nichts mehr von ihm gehört. Schon immer hat Macht schlechtes Benehmen entschuldigt. Auch Thiels Anrufe waren unbeantwortet geblieben. Andere Aspekte von Trumps Charakter waren problematischer.
Fast alle Profis, die jetzt an Bord kamen, mussten der Tatsache ins Auge sehen, dass er eigentlich von nichts eine Ahnung hatte. Es gab – mit Ausnahme vielleicht des Baugeschäfts – kein einziges Thema, von dem er etwas verstand. Bei ihm kam alles aus dem Stegreif. Was immer er wusste, schien er eine Stunde zuvor gehört zu haben, allerdings nur mit halbem Ohr. Doch jedes Mitglied der neuen Trump-Truppe redete sich ein, es sei nicht so schlimm. Was wussten sie schon – immerhin war dieser Mann zum Präsidenten gewählt worden. Es musste ja irgendwas an ihm dran sein. Während Trumps umfassende Ignoranz in den Kreisen seiner reichen Kumpane allgemein bekannt war – der große Geschäftsmann Trump konnte nicht einmal eine Bilanz lesen und hatte im Wahlkampf zwar sein Verhandlungsgeschick herausgestrichen, war in Wirklichkeit aber wegen seiner mangelnden Aufmerksamkeit für Details ein katastrophaler Verhandler –, fanden diese Menschen ihn irgendwie instinktiv. Das war das Wort. Er war eine starke Persönlichkeit. Er konnte einem was vormachen.
«Ist Trump ein guter Mensch, ein intelligenter Mensch, ein fähiger Mensch?», fragte Sam Nunberg. «Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass er ein Star ist.»
Der britische Journalist und glücklose CNN-Moderator Piers Morgan, der in Trumps Fernsehshow Celebrity Apprentice aufgetreten war und Trump die Freundschaft gehalten hatte, versuchte, Trumps Tugenden und seine Strahlkraft zu erklären, indem er sagte, es stehe alles in Trumps Buch The Art of the Deal von 1987 – alles, was ihn zu Trump gemacht habe, alles, was seine Schläue, seine Energie, sein Charisma ausmache, sei dort zu finden. Aber Trump hatte dieses Buch gar nicht geschrieben. Sein Mitautor Tony Schwartz beharrte darauf, dass Trump kaum etwas dazu beigetragen und es möglicherweise nicht einmal ganz gelesen habe. Und vielleicht war das der entscheidende Punkt: Trump war kein Autor, sondern eine Figur, ein Protagonist, ein Held.
Trump war Wrestling-Fan, ein aktiver Unterstützer von World Wrestling Entertainment (er wurde in die WWE Hall of Fame aufgenommen), und führte, wie Hulk Hogan, das Leben einer real existierenden fiktionalen Figur. Zum Amüsement seiner Freunde und zum Unbehagen vieler Menschen, die sich nun darauf vorbereiteten, auf höchster Regierungsebene für ihn zu arbeiten, sprach er von sich selbst oft in der dritten Person: Trump hat dies oder jenes gemacht, der Trumpster hat dies oder jenes veranlasst. Diese Rolle war so stark, dass er nicht willens war und wohl auch gar nicht imstande, sie aufzugeben und sich wie ein Präsident zu benehmen.
So schwierig es auch war, versuchten doch viele, die ihn jetzt umgaben, sein Verhalten zu rechtfertigen und es als Erklärung für seinen Erfolg zu betrachten, nicht als Einschränkung, sondern als etwas, das ihn auszeichnete. Für Steve Bannon lag Trumps einzigartige politische Qualität darin, dass er ein Alpha-Mann war, vielleicht der letzte Alpha-Mann. Ein Mann aus den 1950ern, ein Rat-Pack-Typ, eine Figur aus der Serie Mad Men.
Trumps eigene Einschätzung seiner Persönlichkeit war noch akkurater. Einmal, auf dem Heimweg in seinem Flugzeug zusammen mit einem befreundeten Milliardär und dessen Begleitung, einem ausländischen Model, wollte er die Dame beeindrucken und schlug einen Zwischenstopp in Atlantic City vor. Er werde ihnen sein Casino zeigen. Sein Freund versicherte dem Model, es gebe wirklich nichts, was für Atlantic City spreche, es wimmele dort von white trash.
«Was ist das – white trash?», wollte das Model wissen.
«Leute wie ich», sagte Trump, «nur ohne Geld.»
Er wollte sich nicht an Regeln halten, er wollte nicht respektabel sein müssen. Es war das Erfolgsgeheimnis eines Outlaws – und Erfolg, ganz gleich, wie man ihn erreichte, war schließlich alles, was zählte.
Oder, wie seine Freunde bemerkten, die nicht vorhatten, sich in etwas mit hineinziehen zu lassen: Er hatte einfach keine Skrupel. Er war ein Rebell, ein Störenfried, der Regeln verachtete und nicht einhielt. Ein enger Freund von Trump, der auch gut mit Bill Clinton befreundet war, fand die beiden geradezu gespenstisch ähnlich – nur dass Clinton eine salonfähige Fassade wahrte und Trump nicht.
Diese Outlaw-Persönlichkeit manifestierte sich sowohl bei Trump als auch bei Clinton darin, dass sie sich ständig an Frauen heranmachten und sie drangsalierten. Selbst unter Weltklasse-Frauenhelden und -Grabschern stachen diese beiden durch ihren Mangel an Zweifel und Zurückhaltung heraus.
Trump sagte gern, zu den Dingen, die das Leben lebenswert machten, gehöre es, die Frau eines Freundes ins Bett zu kriegen. Zu diesem Zweck würde er ihr gegenüber andeuten, ihr Mann sei vielleicht nicht der, für den sie ihn halte. Dann würde er den Freund durch seine Sekretärin in sein Büro bitten lassen und ihn gleich frotzeln. Hast du noch Sex mit deiner Frau? Wie oft? Du hast doch bestimmt schon mal besseren gehabt als mit ihr, oder? Erzähl mir davon. Um drei kommen ein paar Mädels aus Los Angeles – wir könnten raufgehen und uns ein bisschen amüsieren, sie sind große Klasse, das verspreche ich dir … Und das alles vor den Ohren der Frau des Freundes, die über die Freisprecheinrichtung mithörte.
Natürlich hatten auch frühere Präsidenten, und beileibe nicht nur Clinton, wenig Skrupel gehabt. Für viele, die Trump gut kannten, war weit verwirrender, dass er die Wahl gewonnen und diese höchste Stufe erklommen hatte, obwohl ihm das, was offensichtlich als grundlegende Voraussetzung für dieses Amt gelten muss und von Neuropsychologen mit dem Begriff «kognitive Kontrolle» bezeichnet wird, vollkommen fehlte. Irgendwie hatte er das Rennen um die Präsidentschaft gewonnen, doch sein Gehirn schien außerstande, die Aufgaben zu erfüllen, die sein neuer Job erforderte. Er konnte weder planen noch organisieren, weder zuhören noch sich auf etwas Neues konzentrieren; er war nie imstande gewesen, sein Verhalten den jeweiligen Zielen anzupassen. Kausales Denken lag ihm fern, er sah einfach keine Verbindung von Ursache und Wirkung.
Dass Trump nur Hohn übrighatte für den Vorwurf, er habe mit den Russen zusammengearbeitet, um die Wahl zu gewinnen, war nach Ansicht einiger Freunde das beste Beispiel für sein Unvermögen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Auch wenn er sich nicht mit den Russen verbündet und die Wahl manipuliert hatte – sein Werben um ausgerechnet Wladimir Putins Gunst hatte eine breite Spur alarmierender Worte und Taten hinterlassen, was einen enormen politischen Preis haben würde.
Kurz nach der Wahl beschwor ihn sein Freund Ailes: «Du musst diese Russland-Sache in Ordnung bringen.» Obwohl er nicht mehr bei Fox News war, hatte Ailes noch immer ein legendäres Netz von Informanten und warnte Trump, er könnte mit potenziell gefährlichem Material konfrontiert werden. «Du musst das ernst nehmen, Donald.»
«Das macht Jared», sagte Trump heiter, «ist alles schon besprochen.»
Der Trump Tower, in unmittelbarer Nachbarschaft von Tiffany gelegen und jetzt Hauptquartier einer populistischen Revolution, wirkte plötzlich wie ein auf der Fifth Avenue gelandetes Alien-Raumschiff, wie der Todesstern. Während die Wichtigen, die Guten und die Ehrgeizigen, aber auch wütende Demonstranten und neugierige Massen sich auf den Weg zum nächsten Präsidenten machten, wurde zu seinem Schutz eilends ein Labyrinth aus Barrikaden errichtet.
Der Pre-Election Presidential Transition Act von 2010 stellt Mittel bereit, damit der designierte Präsident beginnen kann, Tausende von Kandidaten für Jobs in der neuen Regierung zu durchleuchten, politische Ziele zu formulieren, die den Schwerpunkt der ersten Regierungstätigkeit bilden werden, und sich auf die Übernahme der Amtsgeschäfte am 20. Januar vorzubereiten. Im Wahlkampf hatte Chris Christie, Gouverneur von New Jersey und nomineller Chef der Übergangsmannschaft, den Kandidaten nachdrücklich darauf hinweisen müssen, dass er diese Mittel nicht anderweitig verwenden dürfe. Es sei gesetzlich vorgeschrieben, das Geld für die Planung der Übergangszeit zu verwenden – auch wenn sich das als unnötig erweisen sollte. Trump war frustriert und sagte, er wolle nichts mehr davon hören.
Am Tag nach der Wahl begannen Trumps engste Berater, hochmotiviert, nun an einem Prozess teilzuhaben, mit dem kaum einer gerechnet hatte, Christie wegen seiner mangelhaften Vorbereitung zu kritisieren. Eilig wurde das dürftig besetzte Übergangsteam von Washington in den Trump Tower beordert.
Es war sicher eine der teuersten Immobilien, in denen je ein Übergangs- oder ein Wahlkampfteam residiert hatte, und das war kein Zufall. Es sendete eine Botschaft im Trump-Stil: Wir sind nicht nur Outsider, sondern auch mächtiger als ihr Insider in Washington. Reicher. Berühmter. In den besseren Immobilien.
Und der Turm trug natürlich seinen Stempel: Über der Tür stand Trumps berühmter Name. Sein dreistöckiges Penthouse war wesentlich größer als der Wohnbereich des Weißen Hauses. Hier befand sich seit den 1980er Jahren sein Büro. Und hier waren auch die Etagen, in denen jetzt das Übergangsteam seine Arbeit aufnahm – auf seinem Terrain, nicht in Washington mit seinem «Sumpf».
Angesichts dieses unwahrscheinlichen, wenn nicht gar grotesken Erfolgs folgte Trump seinem Instinkt, der ihm nicht zur Bescheidenheit riet, sondern ihn vielmehr ermunterte, alle Welt mit der Nase darauf zu stoßen. Die Insider aus Washington und wer dazugehören wollte, würden sich nun zu ihm bemühen müssen. Mit einem Mal war der Trump Tower wichtiger als das Weiße Haus. Alle, die den designierten Präsidenten aufsuchten, erkannten damit eine Regierung an, die aus lauter Außenseitern bestand. Trump zwang sie zu einem «perp walk», wie es in seiner Umgebung schadenfroh genannt wurde: Sie mussten wie Delinquenten an der versammelten Presse und der Meute der Schaulustigen vorbeimarschieren. Ein Akt der Unterwerfung, ja der Demütigung.
Die alienhafte Fremdartigkeit des Trump Tower verbarg auch die Tatsache, dass nur wenige im dünn besetzten inneren Zirkel, der nun plötzlich für die Bildung einer Regierung verantwortlich war, über irgendwelche relevante Erfahrung verfügten. Keiner hatte mit Politik zu tun gehabt. Keiner hatte mit Strategie zu tun gehabt. Keiner hatte mit Gesetzgebung zu tun gehabt.
Politik ist ein Geschäft, bei dem es um Verbindungen geht. Es kommt darauf an, wen man kennt. Im Gegensatz zu anderen designierten Präsidenten – von denen jeder seine Anfangsschwierigkeiten gehabt hatte – konnte Trump nicht auf eine im Lauf seiner Karriere gesammelte Liste von Kontakten aus Politik und Regierung zurückgreifen. Er verfügte auch nicht über eine nennenswerte politische Organisation. In den vergangenen anderthalb Jahren des Wahlkampfs war es im Grunde eine Drei-Personen-Show gewesen, bestehend aus seinem Wahlkampfmanager Corey Lewandowski (bis dieser einen Monat vor dem Parteitag der Republikaner hatte zurücktreten müssen), seiner achtundzwanzigjährigen Sprecherin-Assistentin-Praktikantin Hope Hicks, die als Erste zum Wahlkampfteam gestoßen war, und ihm selbst. Ein schlankes, entschlossenes, instinktgesteuertes Team – Trump fand, je mehr Leute man mit sich herumschleppte, desto schwieriger wurde es, mit seiner Maschine zurückzufliegen und sich abends ins eigene Bett zu legen.
Die Profis – auch wenn es unter ihnen eigentlich kaum einen politischen Profi gab – waren erst im August an Bord gekommen, als letzter Versuch, eine schmerzhafte Demütigung abzuwenden. Aber das waren Leute, mit denen er erst ein paar Monate zusammengearbeitet hatte.
Reince Priebus, der sich auf den Wechsel vom RNC ins Weiße Haus vorbereitete, stellte beunruhigt fest, dass Trump irgendwelchen Leuten, von denen er manche noch nie zuvor gesehen hatte, spontan eine Position anbot, deren Bedeutung er im Grunde nicht erfasste.