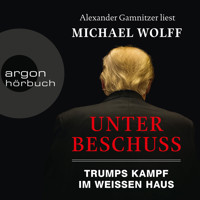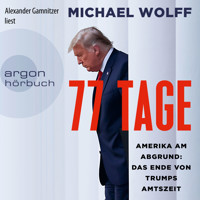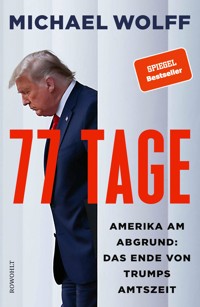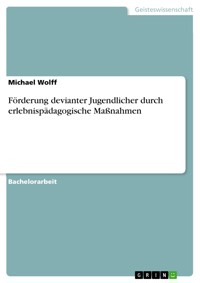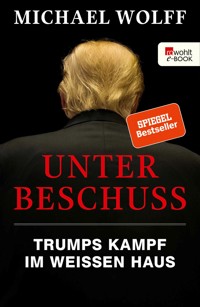
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
In «Feuer und Zorn» hatte Michael Wolff die chaotischen ersten Monate von Donald Trumps Präsidentschaft dokumentiert. Nun ist die Lage ganz anders: Trump hat die fähigsten Berater entlassen, die Weltmacht USA ist endgültig seinen impulsiven Instinkten unterworfen. Gleichzeitig ist er unter Beschuss, von Freund und Feind, von seiner radikalen Basis und dem politischen Establishment in Washington. Wolff schildert in seinem packenden neuen Buch einen amerikanischen Präsidenten, der sich permanent verfolgt fühlt und der sich dabei immer wieder an den Rand der Selbstzerstörung bringt: einen Trump, der rasend ums politische Überleben kämpft. Wolffs Buch ist eine Tragikkomödie und ein großes politisches Drama. Er macht deutlich, wie sehr die amerikanische Außenpolitik mit den Geschäftsinteressen seines Schwiegersohns verquickt ist und warum Trump dem Sonderermittler Robert Mueller noch einmal entkommen konnte; dass Trump Nordkorea nicht auf der Karte finden könnte und Melania wieder bei ihren Eltern wohnt. Und im Zentrum von allem ein Weißes Haus, in dem jeder gegen jeden steht - und alle sich fragen: Wann fliegt uns das hier um die Ohren? "Unter Beschuss" ist das detailreichste Porträt jenes außergewöhnlichen Mannes, der trotz allem noch immer Präsident der Vereinigten Staaten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Ähnliche
Michael Wolff
Unter Beschuss
Trumps Kampf im Weißen Haus
Aus dem Englischen von Gisela Fichtl, Hainer Kober, Elisabeth Liebl, Silvia Morawetz, Stefanie Römer, Werner Schmitz, Jan Schönherr, Karsten Singelmann, Peter Torberg und Henriette Zeltner
Über dieses Buch
In «Feuer und Zorn» hatte Michael Wolff die chaotischen ersten Monate von Donald Trumps Präsidentschaft dokumentiert. Nun ist die Lage ganz anders: Trump hat die fähigsten Berater entlassen, die Weltmacht USA ist endgültig seinen impulsiven Instinkten unterworfen. Gleichzeitig ist er unter Beschuss, von Freund und Feind, von seiner radikalen Basis und dem politischen Establishment in Washington. Wolff schildert in seinem packenden neuen Buch einen amerikanischen Präsidenten, der sich permanent verfolgt fühlt und der sich dabei immer wieder an den Rand der Selbstzerstörung bringt: einen Trump, der rasend ums politische Überleben kämpft.
Wolffs Buch ist eine Tragikomödie und ein großes politisches Drama. So wird deutlich, wie sehr die amerikanische Außenpolitik mit den Geschäftsinteressen seines Schwiegersohns verquickt ist und warum Trump dem Sonderermittler Robert Mueller noch einmal entkommen konnte. Im Zentrum ein Weißes Haus, in dem jeder gegen jeden steht – und alle sich fragen: Wann fliegt uns das hier um die Ohren?
«Unter Beschuss» ist das detailreichste Porträt jenes außergewöhnlichen Mannes, der trotz allem noch immer Präsident der Vereinigten Staaten ist.
Vita
Michael Wolff, 1953 geboren, ist ein amerikanischer Journalist und Autor. Wolff hat zahlreiche Preise für seine Arbeit erhalten, darunter zweimal den «National Magazine Award». Er hat sieben Bücher verfasst und schreibt für «Vanity Fair», «New York» und «The Hollywood Reporter». Michael Wolff lebt in New York und hat vier Kinder.
Dem Andenken an meinen Vater
Lewis A. Wolff
Vorbemerkung
Kurz nach Donald Trumps Amtseinführung als 45. Präsident der Vereinigten Staaten erhielt ich als Beobachter Zutritt zum West Wing des Weißen Hauses. Als Augenzeuge schilderte ich in Feuer und Zorn das organisatorische Chaos und die ständigen Dramen – mehr Psychodramen als politische Dramen – von Trumps ersten sieben Monaten im Amt. Das Buch handelt von einem unbeständigen und unsicheren Präsidenten, der sowohl die Welt als auch seine Mitarbeiter nahezu täglich seinen Zorn spüren ließ. Diese erste Phase des sonderbarsten Weißen Hauses in der Geschichte Amerikas endete im August 2017 mit dem Abgang des Chefstrategen Stephen K. Bannon und der Ernennung des pensionierten Generals John Kelly zum Stabschef.
Das vorliegende Buch beginnt im Februar 2018 mit dem Beginn von Trumps zweitem Jahr im Amt; die Lage hat sich tiefgreifend geändert. Den launischen Wutausbrüchen des Präsidenten sind inzwischen durch zunehmend organisierte und systematische institutionelle Verfahrensweisen gewisse Grenzen gesetzt. Das Räderwerk der Justiz wendet sich unerbittlich gegen ihn. In mancher Hinsicht hat seine eigene Regierung, ja sein eigenes Weißes Haus sich gegen ihn gewandt. Praktisch jedes Machtzentrum links von der äußersten Rechten hält ihn inzwischen für ungeeignet. Selbst in seiner Basis finden ihn manche unzuverlässig, hoffnungslos abgelenkt und seinem Amt nicht gewachsen. Nie zuvor wurde ein Präsident derart von allen Seiten angegriffen und hatte dem so wenig zu seiner Verteidigung entgegenzusetzen.
Seine Feinde umzingeln ihn, fest entschlossen, ihn zu Fall zu bringen.
Meine Katastrophen-Faszination von Trump – die Gewissheit, dass er sich am Ende selbst zerstören wird – teile ich vermutlich mit allen, die ihm seit seiner Wahl zum Präsidenten begegnet sind. In seiner Nähe zu arbeiten bedeutet, sich mit einem Verhalten konfrontiert zu sehen, wie es sich überspannter und verstörender nicht denken lässt. Womit ich kaum übertreibe. Trump ist nicht nur nicht wie andere Präsidenten, er ist auch nicht wie irgendein anderer Mensch, der uns jemals über den Weg gelaufen ist. Weshalb jeder, der ihn besser kennt, nach Erklärungen für sein Verhalten und seine befremdlichen Eigenarten sucht. Aber auch dies schlägt ihm zum Nachteil aus: Alle aus seinem engeren Kreis, mögen sie auch noch so sehr durch Vertraulichkeitszusagen oder Verschwiegenheitsklauseln oder gar Freundschaft gebunden sein, können nicht aufhören, über ihre Erfahrungen mit ihm zu reden. In diesem Sinne ist er exponierter als jeder andere Präsident der Geschichte.
Viele im Weißen Haus, die mich beim Schreiben von Feuer und Zorn unterstützt haben, sind zwar nicht mehr im Amt, aber ebenfalls nach wie vor mit der Trump-Saga befasst. Ich bin dankbar, diesem bedeutenden Netzwerk anzugehören. Viele von Trumps Spezis aus der Zeit vor seiner Präsidentschaft hören weiter auf ihn und unterstützen ihn; andererseits kommt ihre Besorgnis und Ungläubigkeit zum Ausdruck, wenn sie einander und auch anderen gegenüber von seinen Launen und spontanen Eingebungen berichten. Generell habe ich bemerkt: Je näher Leute ihm stehen, desto besorgter äußern sie sich gelegentlich über seinen Geisteszustand. Alle spekulieren, wie das enden soll – schlecht für ihn, meinen fast alle. Tatsächlich dürfte Trump ein viel besseres Thema für Schriftsteller sein, die sich für menschliche Fähigkeiten und Defekte interessieren, als für die Mehrzahl der Reporter und Autoren, die regelmäßig aus Washington berichten und sich in erster Linie mit dem Streben nach Macht und Erfolg befassen.
Unter Beschuss soll vor allem eine lesbare und anschauliche Erzählung sein, dann aber auch so etwas wie eine Live-Geschichte dieser außerordentlichen Zeiten, denn sollten wir sie erst im Nachhinein verstehen, ist es vielleicht zu spät. Und schließlich geht es mir um ein Porträt Donald Trumps als eines extremen, geradezu unwirklichen und gewiss zur Vorsicht mahnenden amerikanischen Charakters. Um dies zu erreichen und um die richtige Perspektive und die unabdingbaren Quellen für die größeren Zusammenhänge zu finden, habe ich allen, die darum gebeten haben, Anonymität zugesichert. In Fällen, in denen man mir – nachdem ich versprochen hatte, die Quellen nicht zu nennen – von nicht öffentlich bekannt gewordenen Vorfällen oder privaten Gesprächen oder Bemerkungen berichtet hat, habe ich alle Anstrengungen unternommen, diese durch andere Quellen oder Dokumente zu überprüfen. In einigen Fällen war ich selbst bei den hier beschriebenen Vorfällen oder Gesprächen zugegen. Was die Mueller-Ermittlungen betrifft, so berichte ich auf der Basis interner Dokumente, die ich vom Büro des Sonderermittlers nahestehenden Quellen zur Verfügung bekommen habe.
Der Umgang mit Informanten in Trumps Weißem Haus bringt seine ganz eigenen Probleme mit sich. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dort zu arbeiten, ist die Bereitschaft, die Wahrheit zu zerreden oder für unwahr zu erklären oder notfalls gleich unverblümt zu lügen. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass einige von denen, die das Vertrauen der Öffentlichkeit untergraben haben, sich eben darum veranlasst sehen, unter vier Augen die Wahrheit zu sagen. Das ist ihr Pakt mit dem Teufel. Doch den Berichterstatter bringen Gespräche mit solch janusköpfigen Quellen in die Klemme, muss man sich doch darauf verlassen, dass notorische Lügner auch einmal die Wahrheit sagen – um sie später womöglich wieder zu bestreiten. Tatsächlich werden die außerordentlichen Ereignisse im Weißen Haus von Trumps Sprechern oder Sprecherinnen und natürlich vom Präsidenten selbst ständig in Abrede gestellt. Und dennoch hat sich fast jeder haarsträubende Bericht aus dem Innern dieser Regierung – bei ständigem Höherlegen der Messlatte – am Ende bestätigt.
In einer Atmosphäre, die Übertreibungen fördert und häufig sogar verlangt, nimmt schon der Ton selbst eine Schlüsselrolle ein, wenn es um Genauigkeit geht. Zum Beispiel, und ganz entscheidend, wird der Präsident von vielen, die in engem Kontakt zu ihm stehen, immer wieder mit drastischen Worten als mental instabil beschrieben. «Ich habe nie einen Verrückteren kennengelernt als Donald Trump», erklärte wörtlich ein Angehöriger seines Stabs, der unzählige Stunden mit dem Präsidenten verbracht hat. Ähnliches habe ich von einem Dutzend anderen seiner engeren Mitarbeiter vernommen. Wie überträgt man dies in eine zuverlässige Einschätzung dieses einzigartigen Weißen Hauses? Meine Vorgehensweise: zeigen, was ist, die größeren Zusammenhänge schildern, das selbst Erlebte mitteilen und den Lesern so plastisch darstellen, dass sie selbst beurteilen können, wo Donald Trump auf einer schwindelerregenden Skala menschlichen Verhaltens anzusiedeln ist. Es ist dieser Zustand, eher eine Gemütsverfassung als eine politische Haltung, die im Zentrum dieses Buches steht.
Kapitel 1Ins Schwarze
Der Präsident machte seine bekannte angewiderte Miene und dann eine Handbewegung, als wollte er eine Fliege verscheuchen.
«Schluss damit», sagte er. «Warum erzählen Sie mir das?»
Ende Februar 2018, gut ein Jahr nach Trumps Amtsantritt, versuchte sein persönlicher Anwalt John Dowd ihm zu erklären, dass die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich die Herausgabe einiger Geschäftsunterlagen der Trump Organization verlangen werde.
Trump schien weniger auf die möglichen Konsequenzen einer so tiefgreifenden Untersuchung seiner Angelegenheiten zu reagieren, als vielmehr überhaupt davon erfahren zu müssen. Seine Verärgerung löste eine kleine Tirade aus. Er schimpfte nicht über Leute, die ihm ans Leder wollten – und davon gab es reichlich –, sondern dass niemand ihm zu Hilfe eilte. Das Problem waren seine eigenen Leute. Vor allem seine Anwälte.
Trump erwartete von seinen Anwälten, dass sie Dinge «regelten». «Bringen Sie mir keine Probleme, bringen Sie mir Lösungen», war einer seiner häufig benutzten Sprüche als Firmenchef. Er beurteilte seine Anwälte nach ihrem Trickreichtum und lastete es ihnen an, wenn sie ein Problem nicht aus der Welt schaffen konnten. An seinen Problemen waren sie dann schuld. «Lassen Sie das verschwinden», wies er sie häufig an. Oft gleich dreimal hintereinander: «Lassen Sie das verschwinden, lassen Sie das verschwinden, lassen Sie das verschwinden.»
Don McGahn, Rechtsberater des Weißen Hauses – der also das Weiße Haus vertrat und nicht, wie Trump nie richtig verstanden hat, den Präsidenten –, zeigte wenig Geschick darin, Probleme verschwinden zu lassen, und wurde zum ständigen Ziel von Trumps Wutausbrüchen und Beschimpfungen. Seine juristische Interpretation der Zulässigkeit des Wirkens der Exekutive lief allzu oft den Wünschen seines Chefs zuwider.
Auf der anderen Seite hatten Dowd und seine Kollegen Ty Cobb und Jay Sekulow – das Trio von Anwälten, die den Präsidenten durch seine privaten juristischen Probleme navigieren sollten – großes Geschick darin entwickelt, der schlechten Laune ihres Mandanten, die oft von finsteren, kaum beherrschten persönlichen Angriffen begleitet wurde, aus dem Weg zu gehen. Allen dreien war klar, dass man Donald Trump nach dem Mund reden musste, wenn man als sein Anwalt Erfolg haben wollte.
Trump hegte eine Idealvorstellung von einem Anwalt, die mit juristischen Gepflogenheiten nicht viel zu tun hatte. Regelmäßig zitierte er Roy Cohn, seinen alten New Yorker Freund, Anwalt und Durchboxtrainer, und Robert Kennedy, den Bruder von John F. Kennedy. «Er nervte mich ständig mit Roy Cohn und Bobby Kennedy», sagte Steve Bannon, der Politstratege, der mehr als jeder andere für Trumps Wahlsieg verantwortlich war. «Roy Cohn und Bobby Kennedy», sagte Trump. «Wo sind meine Roy Cohn und Bobby Kennedy?» Cohn hatte zu seinem eigenen Nutzen und Ruhm den Mythos konstruiert, auf den Trump immer wieder zurückkam: Mit genug Kohle und Einfluss könne man der Justiz immer entwischen. Bobby Kennedy, Justizminister und Mann fürs Grobe seines Bruders, beschützte John F. Kennedy und arbeitete hinter den Kulissen zum Besten der Familie.
Das war Trumps ständiges Thema: das System austricksen. «Ich bin der, der mit allem durchkommt», prahlte er gern vor seinen New Yorker Freunden.
Dabei wollte er von Einzelheiten nichts wissen. Seine Anwälte sollten ihm nur versichern, dass er auf der Siegerstraße war. «Wir schaffen das aus dem Weg, ja? Das will ich wissen. Das ist alles, was ich wissen will. Wenn das nicht klappt, habt ihr Mist gebaut», schrie er eines Nachmittags die Mitarbeiter seiner Rechtsabteilung an.
Eine besondere Herausforderung war von Anfang an, Staranwälte zu finden, die sich einer Aufgabe stellten, um die sich in der Vergangenheit alle gerissen hätten: den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu vertreten. Ein prominenter Washingtoner Wirtschaftsanwalt übergab Trump eine Liste mit zwanzig Punkten, die unverzüglich angegangen werden müssten, wenn er sich der Sache annehmen solle. Trump weigerte sich, auch nur über einen davon nachzudenken. Mehr als ein Dutzend große Kanzleien hatten bereits abgelehnt. Am Ende blieb Trump eine zusammengewürfelte Truppe von Einzelkämpfern, die nicht über die Durchschlagskraft der Großen verfügten. Jetzt, dreizehn Monate nach seiner Amtseinführung, stand er vor privaten Schwierigkeiten mit der Justiz, die mindestens so groß waren wie seinerzeit die von Richard Nixon und Bill Clinton, und das mit Winkeladvokaten, die kaum für Schwierigeres geeignet schienen. Trump war sich dieser offenen Flanke wohl nicht bewusst. Er verschloss die Augen noch fester vor dem ihm drohenden juristischen Ungemach und erklärte forsch: «Wenn ich gute Anwälte hätte, würde ich schuldig wirken.»
Dowd, 77 Jahre alt, hatte lange Jahre erfolgreich für die Regierung und in Washingtoner Kanzleien gearbeitet. Aber das war Vergangenheit. Jetzt arbeitete er allein, und von Ruhestand wollte er nichts wissen. Er begriff, wie wichtig es war, jedenfalls für seine Position in Trumps Juristenstab, die Bedürfnisse seines Mandanten zu verstehen. Er sah sich gezwungen, Trumps Bewertung der Ermittlungen zu den Kontakten seines Wahlkampfteams mit russischen Staatsinteressen zuzustimmen: Die würden ihm nichts anhaben. Weshalb Dowd und Trumps andere Rechtsberater ihm empfahlen, mit Mueller zu kooperieren.
«Ich bin nicht in der Schusslinie, nicht wahr?», fragte Trump ständig nach.
Das war keine rhetorische Frage. Er bestand auf einer Antwort, und zwar auf einer bejahenden: «Mr. President, Sie sind nicht in der Schusslinie.» Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Trump den FBI-Direktor James Comey zu exakt dieser Zusicherung gedrängt. Und er hatte, typisch für sein Verhalten, Comey im Mai 2017 nicht zuletzt deswegen gefeuert, weil ihm dessen Beteuerungen nicht begeistert genug erschienen und er Comey daher in Verdacht hatte, er agiere gegen ihn.
Ob die Ermittler den Präsidenten wirklich im Visier hatten – und man musste schon sehr vernagelt sein, um ihn nicht im Zentrum von Muellers Ermittlungen zu sehen –, diese Frage schien sich in einer Parallelwelt zu stellen, neben Trumps Bedürfnis, zugesichert zu bekommen, dass er nicht in der Schusslinie war.
«An Trump habe ich das gelernt», sagte Ty Cobb zu Steve Bannon, «selbst wenn etwas schlecht lief, war es großartig.»
Trump bildete sich ein – und mit geradezu übernatürlichem Selbstvertrauen ließ er sich durch nichts davon abbringen –, in Kürze werde er einen Brief des Sonderermittlers erhalten, in dem dieser ihn vollumfänglich entlasten und sich bei ihm entschuldigen werde.
«Wo», fragte er immer wieder nach, «wo bleibt denn der verdammte Brief?»
Die von Sonderermittler Robert Mueller ins Leben gerufene Grand Jury trat immer donnerstags und freitags im Federal District Court zusammen, im fünften Stock eines unscheinbaren Gebäudes in der Constitution Avenue 333 in Washington. Der kahle Raum glich eher einem Klassenzimmer als einem Gerichtssaal. Die Anklagevertreter saßen auf einem Podium, vor ihnen an einem Pult die Zeugen. Unter Muellers Geschworenen waren mehr Frauen als Männer, mehr Weiße als Schwarze, mehr Ältere als Jüngere; was sie vor allem auszeichnete, war ihre angespannte Konzentration. Sie folgten dem Verfahren mit «ängstlicher Aufmerksamkeit, als wüssten sie bereits alles», erzählte ein Zeuge.
Bei einer Befragung durch die Grand Jury fällt man in eine von drei Kategorien. Entweder ist man «Tatsachenzeuge», was bedeutet, dass der Ankläger glaubt, man sei im Besitz von Informationen über eine anstehende Ermittlung. Oder man ist «Subjekt», jemand, der persönlich mit dem verhandelten Verbrechen zu tun hat. Oder, am beunruhigendsten, man ist ein «Ziel», was bedeutet, der Ankläger erwartet von den Geschworenen, dass sie den Betreffenden anklagen. Oft wurden Zeugen zu Subjekten, und oft wurden Subjekte zu Zielen.
Anfang 2018, während Mueller und seine Geschworenen in geradezu historischer Verschwiegenheit ihres Amtes walteten, konnte niemand im Weißen Haus sicher sein, wer auf welcher Seite stand. Oder wer was zu wem sagte. Ob Mitarbeiter oder ranghöhere Berater des Präsidenten – jeder konnte jederzeit mit dem Sonderermittler reden. Die Verschwiegenheit der Ermittlung erstreckte sich bis in den West Wing. Niemand wusste und niemand sagte, wer gerade auspackte.
Nahezu alle höheren Mitarbeiter – die Schar von Beratern mit direktem Zugang zum Präsidenten – hatten sich einen Anwalt genommen. Schon seit den ersten Tagen des Präsidenten im Weißen Haus hatten Trumps Rechtsstreitigkeiten in der Vergangenheit und sein offensichtliches Desinteresse an juristischen Belangen einen Schatten auf alle geworfen, die für ihn arbeiteten. Höhere Mitarbeiter suchten bereits nach Anwälten, als sie noch lernten, sich im Labyrinth des West Wing zu orientieren.
Im Februar 2017, wenige Wochen nach der Amtseinführung und nicht lange nachdem das FBI erstmals Fragen über den Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn aufgeworfen hatte, tauchte Stabschef Reince Priebus in Steve Bannons Büro auf und sagte: «Ich werde Ihnen einen großen Gefallen tun. Geben Sie mir Ihre Kreditkarte. Fragen Sie nicht, warum, tun Sie es einfach. Sie werden mir bis an Ihr Lebensende dankbar sein.»
Bannon nahm seine American-Express-Karte aus der Brieftasche und gab sie Priebus. Der kam kurz darauf wieder und gab sie ihm zurück mit den Worten: «Jetzt sind Sie juristisch abgesichert.»
Im Lauf des Jahres verbrachte Bannon – ein Tatsachenzeuge – etliche hundert Stunden mit seinen Anwälten, die ihn auf seine Aussage vor dem Sonderermittler und vor dem Kongress vorbereiteten. Seine Anwälte wiederum führten immer längere Gespräche mit Muellers Team und den Beratern des Kongressausschusses. Ende des Jahres beliefen sich Bannons Anwaltskosten auf zwei Millionen Dollar.
Jeder Anwalt rät seinen Mandanten als Erstes ganz unmissverständlich: Sprechen Sie mit niemandem, dann muss auch niemand aussagen, was Sie gesagt haben. Binnen kurzem ließen höhere Mitarbeiter in Trumps Weißem Haus es sich immer mehr angelegen sein, so wenig wie möglich zu wissen. Die Welt war auf den Kopf gestellt: Wo man sich früher darum gerissen hatte, «mit im Raum» zu sein, ging man Besprechungen jetzt möglichst aus dem Weg. Man wollte nicht Zeuge von Gesprächen werden; man vermied es, wenn man klug war, gesehen zu werden. Verlässliche Freunde gab es nicht. Unmöglich zu wissen, auf welcher Seite ein Kollege bei den Ermittlungen stand; weshalb man nie wissen konnte, wie wahrscheinlich es war, dass jemand – man selbst vielleicht –, um durch Zusammenarbeit mit dem Sonderermittler die eigene Haut zu retten, gezwungen sein könnte, über jemand anderen auszusagen, also «umzukippen», wie sich das nannte.
Das Weiße Haus, so dämmerte es fast allen, die dort arbeiteten – bald ein weiterer Grund, nicht dort zu arbeiten –, war zum Schauplatz einer laufenden strafrechtlichen Ermittlung geworden, in deren Fänge potenziell jeder geraten konnte, der sich dort blickenließ.
Oberste Hüterin der Geheimnisse des Wahlkampfs, der Übergangszeit und der ersten zwölf Monate im Weißen Haus war Hope Hicks, die Kommunikationschefin des Weißen Hauses. Sie hatte fast alles mitbekommen. Sie sah, was der Präsident sah; sie wusste, was der Präsident wusste – ein Mann, der es einfach nicht fertigbrachte, den Mund zu halten.
Am 27. Februar 2018 wurde sie bei ihrer Aussage vor dem House Intelligence Committee – vor dem Sonderermittler war sie bereits erschienen – gefragt, ob sie jemals für den Präsidenten gelogen habe. Ein geschickterer Kommunikationsprofi hätte hier vielleicht noch den Kopf aus der Schlinge ziehen können, doch Hicks, die, abgesehen von ihrer Tätigkeit als Donald Trumps Sprecherin, nur wenig Erfahrung hatte – was oft genug bedeutete, mit seiner Geringschätzung für empirische Tatsachen umzugehen –, fand sich plötzlich wie in einem unerwarteten moralischen Vakuum, als sie versuchte, den Stellenwert der Lügen ihres Chefs öffentlich zu analysieren. Sie gestand einige «Notlügen» ein, also wohl Lügen etwas unterhalb krasser Lügen. Dieses vorschnelle Eingeständnis reichte ihren Anwälten, sich mitten während der Anhörung fast zwanzig Minuten lang mit ihr zurückzuziehen; sie fürchteten, was sie sonst noch einräumen und wohin eine Erörterung der ständigen Verdrehungen des Präsidenten noch führen könnte.
Nicht lange nach ihrer Aussage wurde ein anderer Zeuge von Muellers Geschworenen gefragt, wie weit Hicks mit ihren Lügen für den Präsidenten gehen würde. Der Zeuge antwortete: «Ich denke, wenn es darum geht, als ‹Jasager› für den Präsidenten aufzutreten, ist sie dabei – aber sie wird sich nicht für ihn opfern.» Diese Bemerkung konnte man als zweideutiges Kompliment auffassen, aber auch als Einschätzung darüber, wie es um die Loyalität in Trumps Weißem Haus bestellt war – vermutlich nicht so gut.
Man könnte sagen, fast niemand in der Trump-Regierung war nach herkömmlichen Maßstäben für die Arbeit dort geeignet. Aber mit Ausnahme des Präsidenten selbst verkörperte wohl niemand diese schlecht vorbereitete und schlecht informierte Präsidentschaft mehr als Hicks. Sie besaß weder nennenswerte Erfahrung in Politik oder Medienarbeit, noch hatte jahrelange Tätigkeit unter Hochdruck ihr ein dickes Fell verliehen. Immer in kurzen Röcken, wie Trump es gernhatte, geriet sie unweigerlich ins Scheinwerferlicht. Trump bewunderte sie, nicht weil sie die politischen Fähigkeiten besaß, ihn zu schützen, sondern für ihre fügsame Pflichttreue. Ihr Job war es, ihn zu umsorgen.
«Wenn Sie mit ihm sprechen, beginnen Sie mit positivem Feedback», lautete Hicks’ Rat. Sie verstand Trumps Bedürfnis nach unablässiger Bestätigung und sein fast vollständiges Unvermögen, über irgendetwas anderes als sich selbst zu reden. Ihre Aufmerksamkeit für Trump und ihr gefügiges Wesen hatten sie mit neunundzwanzig Jahren an die Spitze der Kommunikationsabteilung des Weißen Hauses gebracht. Darüber hinaus fungierte sie praktisch als seine Stabschefin. Trump wollte keine Profis in seiner Mannschaft, er wollte Leute, die ihm um den Bart gingen.
Hicks – «Hopey» für Trump – war sowohl Türsteherin als auch Kuscheltuch des Präsidenten. Und häufig Gegenstand seiner lüsternen Interessen: Geschäftliches, auch im Weißen Haus, regelte Trump lieber auf persönlicher Ebene. «Wer fickt Hope?», verlangte er zu wissen. Das Thema interessierte auch seinen Sohn, Don Jr., der oft den Wunsch äußerte, «Hope zu ficken». Ivanka, die Tochter des Präsidenten, und Jared Kushner, ihr Mann, beide als ranghohe Berater im Weißen Haus tätig, blickten behutsamer auf Hicks und versuchten sogar gelegentlich, sie auf heiratswürdige Männer hinzuweisen.
Doch Hicks, die das Insulare der Trumpwelt erkannte, blieb konsequent in dieser Blase und entschied sich für deren schlimmste Finger: Während des Wahlkampfs war dies Wahlkampfmanager Corey Lewandowski und dann im Weißen Haus der Präsidentenberater Rob Porter. Die Beziehung zwischen Hicks und Porter entspann sich im Herbst 2017, und wer von der Affäre wusste, durfte als Insider der Trumpwelt gelten, wobei freilich sehr darauf geachtet wurde, die Sache vor dem übergriffigen Präsidenten geheim zu halten. Oder gerade nicht: Andere, die davon ausgingen, dass Porters Verhältnis mit Hicks dem Präsidenten ganz und gar nicht recht sei, waren weniger verschwiegen.
In der feindseligen Stimmung, die in Trumps Weißem Haus um sich griff, hätte Rob Porter es zur bei allen unbeliebtesten Person bringen können, abgesehen vielleicht vom Präsidenten selbst. Mit seinem kantigen Kinn und Fünfziger-Jahre-Look wie eine Reklamefigur für Pomade, wirkte er geradezu wie eine Witzfigur von Tücke und Verrat: Wenn er einem nicht in den Rücken fiel, musste man annehmen, dass man bei ihm nichts galt. Ein Schleimer wie aus einer Sitcom – «Eddie Haskell», spöttelte Bannon in Anspielung auf die doppelzüngige und arschkriecherische Kultfigur aus der alten Fernsehserie Erwachsen müsste man sein –, katzbuckelte er vor Stabschef John Kelly, während er ihn gleichzeitig beim Präsidenten madigmachte. Porters Einschätzung seiner eigenen großen Verantwortung im Weißen Haus, dazu die Aussicht auf die ihm von Trump versprochenen noch höheren Posten, beides erweckte in ihm den Eindruck, als läge sowohl die Regierung als auch die ganze Nation direkt auf seinen Schultern.
Porter, noch keine vierzig, hatte bereits zwei verbitterte Exfrauen; mindestens eine von ihnen hatte er geschlagen, und beide hatte er, wie die ganze Stadt wusste, betrogen. Zu seiner Zeit als Mitarbeiter im Senat hatte Porter, noch verheiratet, eine Affäre mit einer Praktikantin, die ihn den Job kostete. Im Sommer 2017 war seine Freundin Samantha Dravis bei ihm eingezogen, während er gleichzeitig hinter ihrem Rücken mit Hicks anbandelte. «Ich habe dich betrogen, weil du nicht attraktiv genug bist», erklärte er Dravis später.
Durch einen womöglich strafrechtlich relevanten Verstoß gegen das Protokoll hatte Porter Zugang zu seiner noch nicht ausgewerteten FBI-Unbedenklichkeitsüberprüfung erlangt und darin die Aussagen seiner Exfrauen gelesen. Seine zweite Exfrau hatte außerdem in einem Blog von vermeintlichen Misshandlungen berichtet: Auch wenn sein Name dabei nicht fiel, wies alles auf ihn hin. Beunruhigt über die schädlichen Auswirkungen, die die Aussagen seiner Exfrauen auf das Ergebnis seiner Sicherheitsüberprüfung haben könnten, spannte er Dravis ein, die ihm helfen sollte, die Beziehungen zwischen ihm und den beiden Frauen zu verbessern.
Lewandowski, Hicks’ Exfreund, bekam Wind von der Hicks-Porter-Affäre und nahm sich vor, die Sache ans Licht zu bringen; angeblich setzte er Paparazzi auf Hicks an. Während Porters eheliches Fehlverhalten dank der FBI-Untersuchung allmählich herauskam, vereitelte Lewandowskis Feldzug gegen Hicks viele andere Bemühungen, Porters Verfehlungen zu vertuschen.
Im Herbst 2017 kamen Dravis die von Lewandowski gestreuten Gerüchte über das Verhältnis zwischen Hicks und Porter zu Ohren. Dravis hatte Hicks’ Telefonnummer unter einem Männernamen in Porters Kontaktliste entdeckt und stellte ihn zur Rede, worauf er sie prompt hinauswarf. Sie zog wieder bei ihren Eltern ein und begann ihren eigenen Rachefeldzug, indem sie offen über Porters Probleme mit seiner Sicherheitsfreigabe sprach, auch zu Leuten im Büro des Rechtsberaters des Weißen Hauses, wo sie behauptete, er genieße Schutz auf höchster Ebene. Sodann leakte sie mit Lewandowskis Hilfe die Einzelheiten der Hicks-Porter-Affäre an die Daily Mail, die am 1. Februar darüber berichtete.
Doch Dravis musste ebenso wie Porters Exfrauen empört feststellen, dass er in dem Artikel der Daily Mail gut weggekommen war – als Teil eines glamourösen Power-Pärchens! Porter verspottete Dravis am Telefon: «Du hast dir eingebildet, du könntest mir was anhaben!» Jetzt packten Dravis und seine Exfrauen aus und erzählten, wie er sie misshandelt hatte. Seine erste Frau sagte, er habe sie mit Füßen und Fäusten traktiert, und legte ein Foto von ihrem blauen Auge vor. Seine zweite Frau teilte den Medien mit, sie wolle ein Kontaktverbot gegen ihn erwirken.
Das Weiße Haus, oder zumindest Kelly – und wahrscheinlich auch Hicks –, hatte von vielen dieser Behauptungen gewusst und sie bis dahin mit Erfolg vertuscht. («Normalerweise hat man im Weißen Haus genug fähige Leute, um die prügelnden Ehemänner auszusortieren, aber in Trumps Weißem Haus konnte man nicht so wählerisch sein», sagte ein republikanischer Bekannter Porters.) Der Skandal, der um Porter und seine beunruhigende Vorgeschichte ausbrach, ärgerte nicht nur Trump – «Er stinkt nach schlechter Presse» –, sondern schwächte auch Kellys Position. Am 7. Februar, nach Interviews seiner beiden Exfrauen bei CNN, kündigte Porter.
Plötzlich sah die öffentlichkeitsscheue Hicks – Donald Trump legte großen Wert auf Mitarbeiter, die ihn nicht in den Schatten stellten – ihr Liebesleben in den Fokus intensiver Recherchen der internationalen Presse gerückt. Ihre Affäre mit dem diskreditierten Porter lenkte die Aufmerksamkeit nicht nur auf ihre seltsame Beziehung zum Präsidenten und seiner Familie, sondern auch auf das planlose Management, die gestörten zwischenmenschlichen Verhältnisse und den umfassenden Mangel an politischem Geschick im Hause Trump.
Kurioserweise zählte die Affäre noch zu Hicks’ kleinsten Problemen. Ja, die dunkle Wolke des Porter-Skandals bot ihr womöglich eine bessere Chance, die Regierung zu verlassen, als jene andere Wolke, die fast alle im West Wing für die dunkelste hielten.
Am 27. Februar berichtete Jonathan Swan, Reporter für den Washingtoner Insider-Newsletter Axios und von Leakern im Weißen Haus gern als Sprachrohr benutzt, John Raffel werde das Weiße Haus verlassen. Raffel war im April 2017 für viele überraschend am Kommunikationsteam des Weißen Hauses vorbei als exklusiver Sprecher für Jared Kushner, den Schwiegersohn des Präsidenten, und seine Frau Ivanka ins Weiße Haus gekommen. Raffel, wie Kushner Mitglied der Demokratischen Partei, hatte zuvor für Hiltzik Strategies gearbeitet, die New Yorker PR-Agentur, die Ivankas Modelabel vertrat.
Hope Hicks, die ebenfalls für Hiltzik gearbeitet hatte – die Agentur war vielleicht am besten bekannt durch ihre langjährige Verbindung zum Filmproduzenten Harvey Weinstein, der im Herbst 2017 durch einen epochemachenden Missbrauchs- und Vertuschungsskandal zu Fall gekommen war –, hatte ursprünglich dieselbe Rolle wie Raffel, nur auf höherer Ebene: Sie war die persönliche Sprecherin des Präsidenten. Im September war Hicks zur Kommunikationschefin des Weißen Hauses befördert worden, mit Raffel als ihrem Stellvertreter.
Der Ärger hatte sich im Sommer zuvor angekündigt. Hicks und Raffel befanden sich im Juli 2017 an Bord der Air Force One, als die Nachricht kam, Donald Trump junior habe sich während des Wahlkampfs im Trump Tower mit russischen Mittelsmännern getroffen, die ihm Schmutz über Hillary Clinton angeboten hätten. Auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Deutschland halfen Hicks und Raffel dem Präsidenten bei der Formulierung einer im Wesentlichen falschen Darstellung jenes Treffens im Trump Tower und wurden so zu Mittätern der Vertuschung.
Raffel war zwar nur etwas länger als neun Monate im Weißen Haus gewesen, aber dem Axios-Artikel zufolge hatte man seinen Rauswurf schon seit mehreren Monaten erwogen. Was nicht stimmte. Sein Abgang kam aus heiterem Himmel.
Tags darauf, und ebenso unerwartet, kündigte auch Hope Hicks – die Person im Weißen Haus, die dem Präsidenten am nächsten stand.
Plötzlich war ausgerechnet diejenige, die vermutlich mehr als jeder andere über die Vorgänge in Trumps Wahlkampf und danach im Weißen Haus wusste, nicht mehr da. Große Sorge bereitete im Weißen Haus die berechtigte Annahme, Hicks und Raffel, beide beteiligt an den Bemühungen des Präsidenten, die Einzelheiten des Treffens zwischen seinem Sohn und seinem Schwiegersohn und den Russen zu vertuschen, könnten zu Subjekten oder Zielen von Muellers Ermittlungen werden – oder, noch schlimmer, hätten bereits einen Deal ausgehandelt.
Der Präsident, der Hicks öffentlich mit Lob überschüttete, versuchte nicht, sie zum Bleiben zu bewegen. In den folgenden Wochen jammerte er über ihre Abwesenheit – «Wo ist meine Hopey?» –, tatsächlich aber wollte er sie, sobald er erfuhr, dass sie auspacken könnte, loswerden und machte sich daran, ihre Stellung und Bedeutung im Wahlkampf und im Weißen Haus herunterzuspielen.
Hier jedoch ergab sich aus Trumps Sicht ein Hoffnungsschimmer, was Hicks betraf: So wesentlich sie für seine Präsidentschaft war, hatte sie im Grunde nur die Aufgabe gehabt, ihm zu Gefallen zu sein. Als große Strategin und Strippenzieherin sah sie wohl kaum jemand. Trumps Team bestand ausschließlich aus Kleindarstellern.
John Dowd mochte gezögert haben, seinem Mandanten schlechte Neuigkeiten zu überbringen, wusste aber um die Gefahr, die von einem gründlichen Strafverfolger mit praktisch unbegrenzten Mitteln ausgehen konnte. Je mehr ein FBI-Team sichtet, aufdeckt und untersucht, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl vorsätzliche als auch leichtfertige Gesetzesübertretungen ans Licht kommen. Je umfassender die Suche, desto sicherer wird etwas gefunden. Und der Fall Donald Trump – mit seiner Vorgeschichte von Bankrotten, finanziellen Taschenspielereien, dubiosen Verbindungen und anderem, woraus er immer wieder ungestraft davongekommen war – bot den Strafverfolgern eine reichhaltige Auswahl.
Donald Trump seinerseits schien zu glauben, mit seinem Geschick und Gespür sei er dem Justizministerium der Vereinigten Staaten und dessen Akribie und Ressourcen mindestens ebenbürtig. Er glaubte sogar, die Gründlichkeit der Ermittler könnte ihm zum Vorteil gereichen. «Langweilig. Verwirrend für jeden», tat er die von Dowd und anderen vorgelegten Berichte über die Untersuchung ab. «Dem kann doch keiner folgen. Völlig reizlos.»
Einer der vielen eigenartigen Aspekte von Trumps Präsidentschaft bestand darin, dass er seinen Präsidentenjob, sowohl was die Verantwortung als auch was die Wirkung in der Öffentlichkeit betraf, kaum anders betrachtete als sein früheres Leben als Geschäftsmann. In seiner langen Karriere hatte er zahllose Ermittlungen gegen sich durchgestanden. Fast fünfundvierzig Jahre lang hatte er alle möglichen Prozesse geführt. Er war ein Kämpfer, der sich mit Dreistigkeit und Aggressivität aus Schwierigkeiten befreit hatte, die einen schwächeren, nicht so gerissenen Mann ruiniert hätten. Seine maßgebliche Geschäftsstrategie lautete: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Immer und immer wieder verwundet, verblutete er nie.
«Man muss das Spiel machen», erklärte er in einem seiner häufigen Monologe über seine eigene Überlegenheit und die Dummheit aller anderen. «Ich bin gut in dem Spiel. Vielleicht bin ich der Beste. Wirklich, ich könnte der Beste sein. Ich denke, ich bin der Beste. Ich bin sehr gut. Echt cool. Die meisten Leute haben Angst, es könnte zum Schlimmsten kommen. Aber das tut es nicht oder nur wenn man dumm ist. Und ich bin nicht dumm.»
In den Wochen nach seinem ersten Jahrestag im Amt – Mueller ermittelte seit acht Monaten – sah Trump die Arbeit des Sonderermittlers weiterhin als eine Art Kräftemessen. Dass es sich um einen Zermürbungskrieg handelte, ein ständiges Nagen an der Kraft und Glaubwürdigkeit der Zielperson durch nie erlahmende Kontrolle und zunehmenden Druck, kam ihm nicht in den Sinn. Er sah nur eine Situation, der er entgegenzutreten hatte, eine unberechtigte Regierungsaktion, die seinen Attacken schutzlos ausgeliefert war. Er war zuversichtlich, diese «Hexenjagd» – in seinen Tweets oft mit Großbuchstaben geschrieben – wenigstens zu einem subjektiven Unentschieden zerreden zu können.
Verärgert wehrte er Versuche ab, ihn zu überreden, von seinem Kurs abzugehen und das Spiel auf die übliche Washingtoner Art zu spielen – gute Anwälte auffahren, verhandeln, die Verluste möglichst klein halten. Wenn dies schon viele in seiner unmittelbaren Umgebung befremdlich fanden, so beunruhigte sie es noch mehr, dass gleichzeitig mit Trumps Empörung und Eingeschnapptheit auch sein Glaube an seine Unschuld wuchs.
Ende Februar klagten Muellers Geschworene eine Gruppe russischer Staatsangehöriger wegen illegaler Aktivitäten in Zusammenhang mit Versuchen der russischen Regierung an, die Wahl in den USA zu beeinflussen; darüber hinaus war Mueller weiter in den engeren Kreis um Trump vorgedrungen. Zu denen, die angeklagt wurden oder sich eines Verbrechens schuldig bekannt hatten, zählten sein ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort, sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn, der strebsame Nachwuchsberater George Papadopoulos und Manaforts Geschäftspartner und Wahlkampfmitarbeiter Rick Gates. Man könnte diese Serie juristischer Schritte auf klassische Weise als den Versuch eines systematischen Vorrückens auf die Festung Trump interpretieren. Aus der Sicht von Trumps Lager war es wohl eher ein Kesseltreiben gegen die Opportunisten und Hofschranzen, die Trump seit eh und je im Gefolge hatte.
Die Zweifel an der Nützlichkeit von Trumps Mitläufern waren das A und O ihrer Nützlichkeit: Man konnte sie jederzeit ignorieren oder verleugnen, und genau dies geschah dann auch prompt beim kleinsten Anzeichen von Schwierigkeiten. Die von Mueller geschnappten Trump-Leute wurden allesamt zu Möchtegernen und Nebenfiguren abgestempelt. Der Präsident hatte sie nie gesehen, konnte sich nicht an sie erinnern oder kannte sie nur flüchtig. «Ich kenne Mr. Manafort – ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen, aber ich kenne ihn», wimmelte Trump alle Fragen ab.
Eine Verschwörung zu beweisen ist schwierig, weil man dazu erst einmal den Vorsatz beweisen muss. Viele in Trumps engerem Kreis glaubten, er und die Trump Organization und infolgedessen auch seine Wahlkampfleute operierten auf eine so diffuse, planlose, gangsterkomödienhafte Art, dass sich ein vorsätzliches Handeln nur sehr schwierig beweisen lassen könnte. Außerdem waren Trumps Mitläufer offenkundig so unterbelichtet, dass man Dummheit als durchaus plausibles Argument gegen Vorsatz sehen konnte.
Viele in Trumps engerem Kreis waren sich mit ihrem Boss einig: Sie glaubten, egal was für idiotische Schritte von idiotischen Trump-Helfern unternommen worden waren, die Russland-Ermittlung war zu absurd und bedeutungslos, um am Ende haftenzubleiben. Andererseits waren viele, wenn nicht alle, insgeheim der Überzeugung, dass eine eingehende – oder auch nur eine oberflächliche – Untersuchung von Trumps Finanzgebaren in der Vergangenheit jede Menge klarer Rechtsverstöße und Korruptionsfälle zutage fördern würde.
Es war demnach keine große Überraschung, dass Trump seit dem Beginn von Muellers Ermittlungen versucht hatte, den Sonderermittler von den Finanzen der Trump-Familie fernzuhalten, indem er Mueller unverhohlen mit Konsequenzen drohte, falls er sich damit befasse. Trump blieb bei der Annahme, der Sonderermittler habe Angst vor ihm und wisse, wo und wie seine, Trumps, Nachsicht ein Ende haben werde. Trump war zuversichtlich, dem Mueller-Team seine Grenzen aufzeigen zu können, sei es durch listige Hinweise, sei es durch plumpe Drohungen.
«Die wissen, dass sie mich nicht kriegen», sagte er zu einem seiner abendlichen Telefonpartner, «weil ich nie was damit zu tun hatte. Ich bin nicht in der Schusslinie. Da ist nichts. Ich bin nicht in der Schusslinie. Haben sie mir selbst gesagt, ich bin nicht in der Schusslinie. Und sie wissen, was passiert, wenn sie mich ins Visier nehmen. Jeder versteht jeden.»
Bücher und Zeitungsartikel über Trumps fünfundvierzig Jahre im Wirtschaftsleben waren voll von seinen zwielichtigen Geschäften, und sein Auftauchen im Weißen Haus rückte sie dann erst recht ins Scheinwerferlicht und förderte gar noch pikantere Dinge zutage. Immobilien waren die weltweit beliebteste Geldwaschanlage, und Trumps zweitklassige Immobilienfirma – von Trump unermüdlich als Unternehmen mit höchster Bonität angepriesen – war ganz ausdrücklich auf Leute ausgerichtet, die Geld zu waschen hatten. Mehr noch, Trumps eigene Geldsorgen und seine verzweifelten Bemühungen, Lebensstil, Prestige und Marktfähigkeit als Milliardär aufrechtzuerhalten, zwangen ihn ständig zu wenig subtilen Machenschaften. Ironischerweise hatte Jared Kushner als Jurastudent, bevor er Ivanka kennenlernte, in einem Aufsatz mögliche Betrugsvorwürfe gegen die Trump Organization erörtert; es ging dabei um ein bestimmtes, von ihm analysiertes Immobiliengeschäft – was seinen Bekannten aus jener Zeit jetzt Anlass zu einiger Belustigung bot. Wie die Staatsanwälte herausgefunden zu haben schienen, versteckte sich Trump praktisch in aller Öffentlichkeit.
Im November 2004 zum Beispiel erbot sich der Banker Jeffrey Epstein, der später in einen Skandal um minderjährige Prostituierte verwickelt wurde, aus einer Konkursmasse ein Haus in Palm Beach, Florida, für 36 Millionen Dollar zu kaufen, ein Anwesen, das seit über zwei Jahren zum Verkauf stand. Epstein und Trump waren über zehn Jahre lang eng befreundet gewesen – sozusagen Waffenbrüder –, wobei Trump sich häufig an Epstein gewandt hatte, damit ihm der aus seinen chaotischen finanziellen Angelegenheiten heraushalf. Zu Beginn der Kaufverhandlungen in Palm Beach zeigte Epstein ihm das Haus und bat um Rat zu baulichen Verbesserungen wie der Versetzung des Pools. Doch während er dabei war, den Kauf unter Dach und Fach zu bringen, fand Epstein heraus, dass Trump, der zu der Zeit in ernsten finanziellen Nöten steckte, 41 Millionen für das Anwesen geboten und es Epstein vor der Nase weggeschnappt hatte – und zwar mit Hilfe einer Firma, die sich Trump Properties LLC nannte und vollständig von der Deutschen Bank finanziert wurde, die bereits eine beträchtliche Menge gefährdeter Kredite an die Trump Organization und an Trump persönlich in ihren Büchern hatte.
Trump, wusste Epstein, hatte seinen Namen schon öfter für Immobiliengeschäfte hergegeben; gegen ein üppiges Honorar diente er Immobilienhändlern als Strohmann, wenn die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse im Dunkeln bleiben sollten. (Also eine Variante von Trumps Geschäftsmodell, für Geschäftsimmobilien, die jemand anderem gehörten, seinen Namen herzugeben.) Überzeugt davon, dass Trump bloß als Strohmann für die wahren Eigentümer diente, drohte Epstein ihm wütend, die Sache, über die in den Zeitungen Floridas ausführlich berichtet wurde, auffliegen zu lassen. Der Streit wurde noch heftiger, als Trump das Haus bald nach dem Erwerb für 125 Millionen Dollar zum Verkauf anbot.
Epstein kannte einige von Trumps Geheimnissen, aber umgekehrt war es nicht anders. Trump sah Epstein häufig in dessen damaligem Haus in Palm Beach und wusste, dass Epstein fast täglich, und das schon seit vielen Jahren, Besuch von Mädchen bekam, die er für gewisse entspannende Massagen bezahlte – Mädchen, die er in Restaurants, Stripclubs und auch in Trumps Mar-a-Lago anzuheuern pflegte. Als nach dem Hauskauf die Feindschaft zwischen den zwei Freunden eskalierte, fand Epstein sich plötzlich im Fadenkreuz der Polizei von Palm Beach. Und während Epstein sich mit der Justiz herumschlug, wurde das Haus nach nur minimalen Umbauten für 96 Millionen Dollar an Dmitri Rybolowlew verkauft, einen Oligarchen, der zu Putins engstem Kreis von regierungstreuen russischen Unternehmern gehörte und tatsächlich nie in dieses Haus eingezogen ist. Auf wundersame Weise hatte Trump 55 Millionen Dollar eingestrichen, ohne selbst auch nur einen Cent hinzulegen. Oder aber, eher wahrscheinlich, Trump kassierte lediglich ein Honorar dafür, dass der wahre Eigentümer sich hinter ihm verstecken konnte – ein Schatteneigentümer, dem Rybolowlew aus Gründen, die nichts mit dem Haus zu tun hatten, Geld zugeschanzt haben könnte. Oder, auch das ist denkbar, der wahre Eigentümer und der wahre Käufer waren ein und dieselbe Person. Rybolowlew könnte das Haus selbst bezahlt haben und damit die zusätzlichen 55 Millionen für den zweiten Erwerb des Hauses gewaschen haben.
So ging es zu in Donald Trumps Immobilienwelt.
Jared Kushner, offenbar ein Meister der Selbstbeherrschung, hatte enormes Geschick darin entwickelt, den Frust über seinen Schwiegervater in Schach zu halten. Er verzog keine Miene – und wirkte manchmal geradezu wie erstarrt –, wenn Trump aus der Haut fuhr, Wutausbrüchen freien Lauf ließ oder hirnrissige politische oder taktische Schritte vorschlug. Kushner, ein Höfling an einem verrückten Hof, gebot über eine unheimliche Gelassenheit. Dabei machte er sich große Sorgen. Es schien erstaunlich und lachhaft zugleich, dass diese vorgeschützte Sachlichkeit – «Sie sind nicht in der Schusslinie, Mr. President» – seinem Schwiegervater tatsächlich solchen Trost bieten konnte.
Kushner sah die Pfeile, die von allen Seiten auf Trump gerichtet waren und von denen jeder einzelne ihn tödlich verwunden konnte: Behinderung der Justiz; illegale Absprachen; eine genauere Untersuchung seiner jahrzehntelangen dubiosen Finanzgeschäfte; die ständig lauernden Frauengeschichten; die mögliche Schlappe bei den Zwischenwahlen und das dann drohende Amtsenthebungsverfahren; der Wankelmut der Republikaner, die sich jederzeit gegen Trump wenden konnten; und die ranghöheren Mitarbeiter, die aus der Regierungsmannschaft entfernt worden waren (Kushner selbst hatte auf den Rauswurf der meisten von ihnen gedrängt), von denen jeder einzelne gegen Trump aussagen konnte. Allein im März wurden Gary Cohn, der Chefwirtschaftsberater des Präsidenten, Rex Tillerson, der Außenminister, und Andrew McCabe, der stellvertretende FBI-Direktor, aus ihren Ämtern entfernt – drei Männer, die für den Präsidenten nichts als Verachtung empfanden.
Doch der Präsident war nicht in der Stimmung, auf Kushners Rat zu hören. So richtig hatte er seinem Schwiegersohn nie getraut – wie Trump auch sonst niemandem traute, vielleicht mit Ausnahme seiner Tochter Ivanka, Kushners Frau –, und plötzlich stand Kushner eindeutig auf der falschen Seite der von Trump gezogenen roten Linie der Loyalität.
Als Mitglied der Familie hätte Kushner bei all diesen Hofintrigen, die mit solcher Bösartigkeit ausgefochten wurden, dass sie in früheren Zeiten zu Mordkomplotten geführt haben könnten, wie ein Triumphator über seine frühen Rivalen im Weißen Haus ausgesehen. Doch Trump wurde grundsätzlich aller seiner Mitarbeiter überdrüssig, so wie sie seiner überdrüssig wurden, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil er fast immer zu dem Schluss kam, dass sie auf seine Kosten Vorteile erzielten. Er war überzeugt davon, dass jeder Mensch von Gier getrieben wurde, dass sie also früher oder später versuchen würden, an sich zu reißen, was rechtmäßig ihm zustand. Es sah zunehmend danach aus, dass auch Kushner bloß einer von denen war, die Donald Trump ausnutzen wollten.
Vor kurzem hatte Trump erfahren, dass Apollo Global Management, ein von Leon Black geführter New Yorker Investmentfonds, der familieneigenen Immobilienfirma Kushner Companies, die von Kushner geführt wurde, während sein Vater Charlie im Gefängnis saß, eine Finanzspritze in Höhe von 184 Millionen Dollar gegeben hatte.
Dies war in vieler Hinsicht beunruhigend und machte einen angeschlagenen Kushner noch angreifbarer durch Fragen nach den Konflikten zwischen seinen Geschäften und seiner Position im Weißen Haus. In der Übergangsphase hatte Kushner dem Apollo-Mitgründer Marc Rowan die Leitung des Office of Management and Budget der für korrekte Haushaltsführung zuständigen Bundesbehörde OMB angeboten. Rowan nahm den Job zunächst an und lehnte erst ab, als Apollo-Chef Leon Black ihm vor Augen führte, was dann über die Kapitalanlagen Rowans und der Firma offengelegt werden müsste.
Der designierte Präsident hatte jedoch ganz andere Probleme damit: Er ärgerte sich maßlos darüber, dass bei der ständigen Suche nach Geldgebern, wie sie bei mittelständischen Immobilienfirmen wie der seinen an der Tagesordnung sind, Apollo nie auf die Trump Organization zugekommen war. Jetzt schien auf der Hand zu liegen, dass Apollo Kushner allein wegen dessen familiärer Verbindung zur Regierung unterstützte. Trumps unablässiges Nachrechnen, wer von wem profitierte, und sein Gefühl, alle seien ihm etwas schuldig, weil er die Umstände herbeigeführt hatte, von denen sie alle profitierten: Das waren mit Sicherheit Dinge, die ihn nachts nicht schlafen ließen.
«Glaubst du, ich weiß nicht, was da läuft?», zischte Trump seine Tochter an, eine der wenigen, die er normalerweise immer zu besänftigen versuchte. «Glaubst du, ich weiß nicht, was da läuft?»
Die Kushners hatten Gewinn gemacht. Er nicht.
Die Tochter des Präsidenten setzte sich für ihren Gatten ein. Sie sprach von den unglaublichen Opfern, die das Paar mit seinem Umzug nach Washington gebracht habe. Und wofür? «Unser Leben ist zerstört», sagte sie melodramatisch – auch wenn durchaus etwas dran war. Aus den ehemaligen New Yorker Edelpromis waren Leute geworden, die womöglich bald vor Gericht gestellt wurden, vom Spott der Medien ganz zu schweigen.
Nachdem Freunde und Berater Trump ein Jahr lang eingeflüstert hatten, seine Tochter und ihr Mann seien die Ursache allen Übels im Weißen Haus, kam ihm wieder einmal der Gedanke, dass sie niemals hätten herkommen sollen. In Verdrehung der Tatsachen erzählte er mehreren seiner nächtlichen Telefonpartner, er habe schon immer gedacht, sie hätten nicht kommen sollen. Gegen den erbitterten Einspruch seiner Tochter lehnte er es ab, sich in Kushners Probleme mit seiner Sicherheitsfreigabe einzumischen. Das FBI hatte die Freigabe immer wieder hinausgezögert – der Präsident könne sie nach Belieben erteilen, erinnerte ihn seine Tochter. Aber Trump tat nichts, er ließ seinen Schwiegersohn einfach hängen.
Kushner wartete mit übermenschlicher Geduld und Entschlossenheit auf seine Gelegenheit. Trump-Flüsterer beherrschten den Trick, seine Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken; denn niemand konnte sich darauf verlassen, dass Trump zu einem normalen Gespräch mit vernünftigem Hin und Her etwas beizusteuern hatte. Sport und Frauen, das kam bei ihm an, da legte auch er gleich los. Auch illoyales Verhalten ließ ihn aufmerken. Und Verschwörungen. Und Geld – immer wieder Geld.
Abbe Lowell, Kushners persönlicher Anwalt, war ein bekannter Sprücheklopfer unter den Washingtoner Strafverteidigern; seine von ihm selbst gepriesene Spezialität war es, die Erwartungen und die Aufmerksamkeit seiner Mandanten mit exakt getimten Gerüchten und Einblicken darüber zu lenken, mit was für Tricks oder Strategien die Staatsanwaltschaft demnächst kommen werde. Der wahre Vorteil, den ein prominenter Verteidiger zu bieten hatte, war vielleicht nicht sein Geschick im Gerichtssaal, sondern im Hinterzimmer.
Von Lowell erfuhr Kushner zusätzlich zu dem, was Dowd zu Ohren gekommen war, dass dem Präsidenten – und seiner Familie – von Seiten der Strafverfolger noch größere Gefahr drohte. Dowd hatte ständig versucht, den Präsidenten zu beschwichtigen, während Kushner, von Lowell mit Informationen versorgt, seinem Schwiegervater von dieser neuen Front im juristischen Krieg gegen ihn berichtete. Und tatsächlich, am 15. März kam die Nachricht, der Sonderermittler verlange die Herausgabe der Geschäftsunterlagen der Trump Organization – umfangreiche Dokumente bis weit in die Vergangenheit hinein.
Kushner warnte seinen Schwiegervater auch, die Untersuchung werde sich ausweiten: vom Mueller-Team, das sich nur auf mögliche geheime Absprachen mit den Russen konzentrierte, auf den New Yorker Southern District – also die Bundesanwaltschaft in Manhattan, die sich nicht auf die Russland-Frage beschränken werde. Das solle nicht nur die Beschränkung des Sonderermittlers auf die Russland-Angelegenheit umgehen, vielmehr wolle das Mueller-Team auch jede Möglichkeit des Präsidenten torpedieren, seine Ermittlungen zu stoppen oder einzudämmen. Indem er Teile der Untersuchung in den Southern District auslagere, so erklärte Kushner es Trump, stelle Mueller sicher, dass die Ermittlungen gegen den Präsidenten auch ohne den Sonderermittler fortgeführt werden könnten. Mueller versuche seinen Arsch zu retten, halte sich aber schlau an die Regeln: Während er sich einerseits auf den ihm vorgegebenen, beschränkten Bereich seiner Ermittlungen konzentriere, spalte er Hinweise auf andere möglichen Verbrechen davon ab und überlasse sie anderen Gerichtsbezirken, die alle ganz wild darauf seien, sich an der Jagd zu beteiligen.
Es kommt noch schlimmer, sagte Kushner zu seinem Schwiegervater.
Der Southern District hatte einmal Trumps Freund Rudy Giuliani unterstanden, dem ehemaligen Bürgermeister von New York. In den achtziger Jahren wurde der Southern District unter Bundesanwalt Giuliani – einer seiner Mitarbeiter war übrigens ausgerechnet James Comey – zum Hauptankläger der Mafia und der Wall Street. Giuliani hatte als Erster eine rigorose, von vielen für verfassungswidrig gehaltene Auslegung des RICO Act (Gesetz zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität) gegen die Mafia eingesetzt. Mit derselben Auslegung ging er gegen das Großkapital vor, und 1990 brachte die drohende Anklage nach dem RICO Act, der die Regierung ermächtigte, nahezu wahllos Vermögenswerte zu beschlagnahmen, die Investmentbank Drexel Burnham Lambert zu Fall.
Der Southern District war Trump schon lange ein Dorn im Auge. Nach seiner Wahl hatte er ein ungebührliches Treffen mit dem dortigen Bundesanwalt Preet Bharara, ein Signal, das alle seine Berater in Unruhe versetzte, darunter Don McGahn und der neue Justizminister Jeff Sessions. (Das Treffen wies schon auf jenes voraus, das Trump wenig später mit Comey hatte, bei dem er sich dessen Loyalität zusichern lassen und ihm dafür eine Jobgarantie geben wollte.) Trumps Treffen mit Bharara brachte nichts: Bharara war nicht bereit, auf seine Wünsche einzugehen, und reagierte bald gar nicht mehr auf seine Anrufe. Im März 2017 wurde er von Trump gefeuert.
Jetzt, sagte Kushner, sei der Southern District auch ohne Bharara darauf aus, die Trump Organization als Mafia-ähnliches Unternehmen zu behandeln; die Ankläger wollten sich unter Berufung auf die RICO-Gesetze auf den Präsidenten stürzen, als wäre dieser ein Drogenbaron oder Mafiaboss. Kushner wies darauf hin, dass Konzerne nicht die Privilegien des 5. Zusatzartikels zur Verfassung, des Aussageverweigerungsrechts, genössen und dass man einen Konzern nicht begnadigen könne. Des Weiteren könnten Vermögenswerte, die beim Begehen eines Verbrechens erwirtschaftet oder eingesetzt wurden, von der Regierung beschlagnahmt werden.
Mit anderen Worten, über vielen der mehr als fünfhundert Unternehmen, in deren Vorstand Donald Trump bis zu seiner Wahl gesessen hatte, hing das Damoklesschwert der Konfiskation. Ein mögliches Opfer einer erfolgreichen Konfiskationsverfügung war die Vorzeigeimmobilie des Präsidenten: Der Staat könnte den Trump Tower beschlagnahmen.
Mitte März fuhr ein Zeuge, der über die Vorgänge in der Trump Organization bestens Bescheid wusste, mit dem Zug nach Washington, um vor Muellers Grand Jury auszusagen. Vom FBI an der Union Station abgeholt, wurde der Zeuge zum Bezirksgericht gefahren. Von 10 bis 17 Uhr gingen zwei Strafverfolger des Mueller-Teams, Aaron Zelinsky und Jeannie Rhee, mit dem Zeugen unter anderem die Struktur der Trump Organization durch.
Die Strafverfolger fragten den Zeugen nach Leuten, die regelmäßig mit Trump sprachen, wie oft und zu welchem Zweck sie sich mit ihm trafen. Sie fragten, wie Treffen mit Trump verabredet wurden und wo sie stattfanden. Die Auskünfte des Zeugen förderten neben anderen nützlichen Informationen eine beachtliche Tatsache ans Licht: Sämtliche Schecks, die von der Trump Organization ausgestellt wurden, wurden von Trump persönlich unterschrieben.
Besonderes Augenmerk richtete sich an diesem Tag auf die Aktivitäten der Trump Organization in Atlantic City. Der Zeuge wurde nach Trumps Beziehungen zu bekannten Mafia-Angehörigen gefragt – nicht, ob er solche Beziehungen habe, sondern nach der Art jener Beziehungen, von denen die Strafverfolger bereits wussten. Ferner stellten sie Fragen nach dem geplanten Trump Tower in Moskau, einem Projekt, das Trump seit vielen Jahren verfolgte – bis weit in den Wahlkampf 2016 hinein –, das aber nie verwirklicht wurde.
Michael Cohen, Trumps persönlicher Anwalt und Angestellter der Trump Organization, war ein weiteres wichtiges Thema. Die Strafverfolger stellten Fragen nach dem Ausmaß von Cohens Enttäuschung darüber, dass er von Trump nicht ins Weiße Haus geholt worden war. Wie groß Cohens Verärgerung war, wollten sie wissen, woraus der Zeuge folgerte, dass sie abzuschätzen versuchten, wie stark ihre Druckmittel wären, falls sie Michael Cohen dazu bringen wollten, sich gegen Trump zu wenden.
Zelinsky und Rhee erkundigten sich nach Jared Kushner. Und nach Hope Hicks.
Dann verlegten sich die beiden auf das Privatleben des Präsidenten. Wie oft betrog er seine Frau? Mit wem? Wie wurden die Schäferstündchen organisiert? Wie stand es um die sexuellen Vorlieben des Präsidenten? Mueller und seine Grand Jury wurden zur Abrechnungsstelle für die Details von Trumps langer Vorgeschichte beruflicher und privater Falschspielerei.
Am Ende der langen Befragung ging der Zeuge konsterniert aus dem Saal – nicht so sehr von dem, was die Strafverfolger hatten wissen wollen, sondern vor allem von dem, was sie bereits wussten.
In der dritten Märzwoche hatte Trumps Schwiegersohn die volle Aufmerksamkeit des Präsidenten. «Die können nicht nur ein Amtsenthebungsverfahren gegen dich einleiten, sie können dich auch geschäftlich ruinieren», erklärte ihm Kushner.
Beunruhigt und wütend, forderte Trump von Dowd weitere Zusicherungen und hielt ihm die früheren Zusicherungen vor, die er ihm regelmäßig abverlangt hatte. Dowd blieb standhaft. Nach seiner Überzeugung hatte die Schlacht gerade erst angefangen, und Mueller hatte seine Ermittlungen noch lange nicht abgeschlossen.
Aber Trump riss nun endgültig der Geduldsfaden. Dowd sei ein Idiot und solle in den Ruhestand zurückkehren, aus dem er ihn, wie Trump mehrfach wiederholte, befreit habe. Aber statt sich in den Rausschmiss zu ergeben, setzte Dowd zu seiner Verteidigung an und versicherte dem Präsidenten, er könne ihm weiterhin wertvolle Dienste leisten. Vergebens: Am 22. März reichte Dowd widerstrebend seine Kündigung ein, womit ein weiterer verbitterter ehemaliger Trump-Mann in die Welt hinauszog.
Kapitel 2Zwischen Wahlen
An dem Tag, an dem John Dowd gefeuert wurde, saß Steve Bannon an seinem Esstisch und versuchte, eine erneute Gefahr abzuwenden, die der Trump-Präsidentschaft drohte. Diesmal nicht von einem unermüdlichen Strafverfolger, sondern von einer betrogenen Basis. Es ging um die Mauer, die nicht da war.
Die Stadthäuser auf dem Capitol Hill, Reste eines bürgerlichen Viertels aus dem 19. Jahrhundert, sind beengte mehrgeschossige Bauten mit bescheidenen Grundrissen, verwinkelten Wohnzimmern und kleinen Schlafräumen. Viele werden als Sekretariat von Vereinigungen und Organisationen genutzt, die sich die in großer Zahl in Washington angebotenen Büros üblicher Ausstattung nicht leisten können. Einige dienen den Leitern der Organisationen gleichzeitig als Unterkunft. Man sieht ihnen das Laienhafte oder Exzentrische der Anliegen an, die da verfolgt werden; häufig sind sie ein Schrein der Hoffnungen, Träume und Revolutionen, die erst noch stattfinden müssen. Die «Embassy» in der A Street – ein 1890 gebautes Haus und der frühere Sitz von Bannons Breitbart News – war Bannons Wohnhaus und Arbeitsplatz seit seinem Weggang aus dem Weißen Haus im August 2017. Es war teils Verbindungshaus, teils Männerhöhle und teils pseudomilitärische Redoute; überall lag konspirative Literatur herum. Diverse unterbeschäftigte junge Männer mit ernsten Gesichtern, Möchtegern-Milizkämpfer, hockten auf den Stufen.
Das dunkle Herz und das Gruselige der Embassy standen in krassem Gegensatz zu Bannons Mitteilsamkeit und seiner fröhlichen Miene. Er mochte aus Trumps Weißem Haus vertrieben worden sein, aber es war eine gutgelaunte Verbannung, beflügelt von Kaffee oder was auch immer.
In den Wochen zuvor hatte er erfolgreich daran gearbeitet, Verbündete – und die besten Kandidaten aus der Übergangsphase – an Schaltstellen in der Trump-Regierung unterzubringen. Mike Pompeo war vor kurzem zum Außenminister der Vereinigten Staaten ernannt worden, John Bolton sollte bald Nationaler Sicherheitsberater werden, und Larry Kudlow war als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates nominiert. Die wichtigsten politischen Berater des Präsidenten waren Corey Lewandowski und David Bossie, alle beide Mitstreiter, wenn nicht gar Jünger Bannons. Beide operierten außerhalb des Weißen Hauses und waren häufig in der Embassy zu Gast. Viele aus der Phalanx der täglichen Verteidiger des Weißen Hauses im Kabelfernsehen – die Sprachrohre – waren Bannon-Leute, die sowohl dessen Botschaften als auch die des Präsidenten verbreiteten. Hinzu kam, dass seine Feinde das Weiße Haus verließen, darunter Hope Hicks, H.R. McMaster, der ehemalige Nationale Sicherheitsberater, und dass der Kreis derer, die den Schwiegersohn und die Tochter des Präsidenten unterstützten, ständig schrumpfte.
Bannon war viel unterwegs. In Europa traf er sich mit den erstarkenden rechtspopulistischen Gruppen und in Amerika mit Hedgefonds-Managern, denen die Einordnung der Variablen Trump noch erhebliches Kopfzerbrechen bereitete. Außerdem versuchte er bei jeder sich bietenden Gelegenheit, Liberale davon zu überzeugen, dass der Weg des Populismus auch ihr Weg sein sollte. Zu Beginn des Jahres fuhr Bannon nach Cambridge zu einem Treffen mit Larry Summers, der unter Bill Clinton Finanzminister, unter Barack Obama Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates und eine Zeitlang Präsident der Harvard University gewesen war. Summers Frau verwehrte Bannon den Zutritt zu ihrem Haus, sodass das Treffen stattdessen in Harvard stattfand. Summers war schlecht rasiert und trug ein Hemd, an dem ein oder zwei Knöpfe fehlten, Bannon erschien in Hemd und T-Shirt, Cargohose und Safarijacke. «Sie sahen beide aus, als hätten sie Asperger», sagte ein Teilnehmer des Treffens.
«Ist Ihnen verdammt noch mal klar, was Ihr verfluchter Freund da tut?», schrie Summers, der von Trump und dessen Regierung sprach. «Sie verarschen das Land.»
«Ihr Elitedemokraten – ihr interessiert euch bloß für die Ränder der Gesellschaft, für Reiche oder Arme», erwiderte Bannon.
«Mit eurer verkorksten Handelspolitik treibt ihr die Welt in eine Depression», donnerte Summers.
«Und ihr habt amerikanische Jobs nach China exportiert», erklärte ein freudig erregter Bannon, der das Gerangel mit einem Vertreter des Establishments immer genoss.
Bannon war – oder sah sich jedenfalls als – Problemlöser, Strippenzieher und Königsmacher ohne Portfolio. Er war so etwas wie die absurde Variante von Clark Clifford, dem Politpromi und einflussreichen Tausendsassa in den sechziger und siebziger Jahren. Oder ein kluger Vertreter des politischen Randes, wenn das kein Widerspruch in Reinform ist. Oder der Kopf einer Nebenregierung. Oder vielleicht wirklich jemand sui generis: Keiner hatte je so eine zentrale Rolle im politischen Leben Amerikas gespielt wie Bannon oder war ihm ein solcher Pfahl im Fleisch gewesen. Was Trump betrifft: Wenn man Freunde wie Bannon hatte, brauchte man da noch Feinde?
Doch selbst wenn jeder der beiden für den anderen unentbehrlich war, so verhöhnten und beschimpften sie sich auch. Bannons ständige öffentliche Auslegung von Trumps Sprunghaftigkeit – mit ihren komischen und erschütternden Anteilen, dem Gebaren eines verrückten Onkels – und sein taktloses Wettern gegen die Dummheit von Familienangehörigen entfremdeten ihn dem Präsidenten weiter. Doch obwohl zwischen den Männern nun Funkstille herrschte, hing jeder an den Lippen des anderen – und wollte unbedingt wissen, was der über ihn sagte.
Was immer Bannon derzeit von Trump halten mochte – seine Einschätzung bewegte sich von Verärgerung über Zorn und Empörung bis zur Ungläubigkeit –, er war nach wie vor davon überzeugt, dass niemand im politischen Amerika es mit Trumps volksfesttauglicher Selbstdarstellung aufnehmen konnte. Ja, mit Donald Trump war die Selbstdarstellung in die amerikanische Politik zurückgekehrt – er hatte den Typ des Strebers ausgemustert. Kurzum: Er kannte sein Publikum. Gleichzeitig konnte er keine Strecke des Weges geradeaus gehen. Nach jedem Schritt vorwärts drohte ein Schlingern nach links oder rechts. Wie bei vielen großen Schauspielern stand das Selbstzerstörerische in ihm ständig in Widerspruch zu seinem ausgeprägten Selbsterhaltungstrieb. Manche aus dem Umkreis des Präsidenten hatten nicht mehr als die Hoffnung, dass Letzterer gegen Ersteres obsiegen würde. Andere verstanden, auch wenn die Mühe sie verdross, wie sehr er darauf angewiesen war, unbemerkt an die Hand genommen zu werden – wobei die Betonung auf unbemerkt liegt.
Da niemand ihn daran hinderte, lenkte Bannon unbemerkt die Angelegenheiten des Präsidenten von seinem Esstisch in der A Street aus.
An jenem Nachmittag hatte der Kongress parteiübergreifend und überraschend schnell das Gesetz zur Bereitstellung von 1,3 Billionen Dollar für das Haushaltsjahr 2018 verabschiedet. «McConnell, Ryan, Schumer und Pelosi», sagte Bannon über die Führung der Republikaner und der Demokraten im Kongress, «haben Trump in singulärer parteiübergreifender Großherzigkeit eins übergebraten.»
Dieser gesetzgeberische Meilenstein war das Ergebnis von Trumps Lässigkeit und der Wachsamkeit aller Übrigen. Die meisten Präsidenten haben den Ehrgeiz, bei Budgetfragen bis ins Unterholz vorzudringen. Trump zeigte daran wenig oder gar kein Interesse. Daher konnten führende Republikaner und Demokraten – hierbei unterstützt von den für Haushalt und Gesetzgebung zuständigen Teams im Weißen Haus – ein Gesetz über gewaltige Staatsausgaben verabschieden, in dem die Mittel für Trumps Posten mit der höchsten Priorität nicht enthalten waren, für die Mauer, den Heiligen Gral, das Monument, das sich mit über dreitausend Kilometer Länge über die gesamte Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko erstrecken sollte. Das Haushaltsgesetz sah nur 1,6 Milliarden Dollar für Grenzschutz vor. Verabschiedet wurde faktisch also genau das Budget, das bereits Ende September 2017 in die Gesetzgebung eingebracht worden war; auch damals waren keine Mittel für die Mauer vorgesehen gewesen. Im Herbst hatte Trump eingewilligt, den von Republikanern dominierten Kongress über eine Ausweitung des Haushaltsgesetzes vom September abstimmen zu lassen. Wenn die Vorlage das nächste Mal zur Abstimmung kam, würde die Mauer finanziert werden, oder, drohte er, es würde zu einem Shutdown der Regierung kommen.
Sogar den eingefleischtesten Trumpisten im Kongress war es recht, wenn sie nicht auf dem Schlachtfeld der Mauer-Finanzierung ihr Leben lassen mussten, hieße das doch, einen politisch stets riskanten Shutdown mitzutragen oder wenigstens zu ertragen. Auf seine Weise schien sogar Trump zu verstehen, dass die Mauer eher Mythos war als Realität, eher Slogan als tatsächliches Vorhaben. Die Mauer konnte immer an einem anderen Tag drangenommen werden.
Andererseits war nicht genau klar, was der Präsident begriffen hatte. «Wir haben das Budget bekommen», sagte er nach Abschluss der Haushaltsberatungen im März im privaten Gespräch zu seinem Schwiegersohn. «Wir haben die Mauer bekommen, vollständig.»
Am Mittwoch, dem 21. März, dem Tag vor der entscheidenden Abstimmung, war Paul Ryan, der Sprecher des Repräsentantenhauses, ins Weiße Haus gekommen, um sich das Haushaltsgesetz vom Präsidenten absegnen zu lassen.
«Habe 1,6 Milliarden für den Beginn der Mauer an der Südgrenze erhalten, der Rest folgt», twitterte der Präsident kurz darauf.
Ursprünglich hatte das Weiße Haus 25 Milliarden Dollar für die Mauer gefordert, obwohl hoch angesetzte Schätzungen Gesamtkosten der Mauer von 70 Milliarden veranschlagten. Gleichzeitig waren die im Haushalt bewilligten 1,6 Milliarden weniger für die Mauer als vielmehr für bessere Sicherungsmaßnahmen bestimmt.
Als die Abstimmung näherrückte, sah es so aus, als hätte man – unter Einbeziehung sämtlicher Bereiche der Regierung – ein Gentlemen’s Agreement getroffen, das offenbar sogar Trump stillschweigend gebilligt hatte – oder das ihm praktischerweise entgangen war. Die Übereinkunft war schlicht und einfach: Ganz gleich, welcher politischen Strömung sie angehörten, die Mitglieder des Kongresses würden die Budgetverhandlungen nicht an der Mauer scheitern lassen.
Außerdem wollten Republikaner wie Ryan – mit Rückendeckung von Spendern wie Paul Singer und Charles Koch – durch jeden noch so kleinen Schritt Trumps unnachgiebige Haltung in der Einwanderungspolitik und -rhetorik entschärfen. Ryan und andere hatten sich eine einfache Methode zur Erreichung dieses Ziels ausgedacht: Man stimmte dem Präsidenten zu und achtete dann nicht mehr auf ihn. Man plauderte nett, Trump genoss das – und was an praktischen Maßnahmen folgte, langweilte ihn.
An diesem Mittwoch führte Trump eine Reihe von Telefonaten, in denen er die Mitwirkung aller am Haushaltsgesetz lobte. Ryan verkündete am nächsten Morgen in einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz zum Abschluss der Beratungen: «Der Präsident befürwortet das Gesetz, daran gibt es nichts zu deuteln.»
Dies waren die zwei Seiten der einen Realität. Die Mauer war der konkreteste Ausdruck von Trumps politischen Grundsätzen, seiner Einstellung, seinen Überzeugungen und seiner Persönlichkeit. Gleichzeitig nötigte die Mauer jeden republikanischen Politiker zur Selbstüberprüfung im Hinblick auf gesunden Menschenverstand, fiskalische Vernunft und politische Flexibilität.
Es waren nicht nur die Kosten und die Unbrauchbarkeit der Mauer, es war auch der Umstand, dass man sich an dem Kampf um ihre Durchsetzung beteiligen musste. Ein Shutdown der Bundesverwaltung käme einer hochriskanten Konfrontation zwischen Trump-Welt und Nicht-Trump-Welt gleich. Sollte es dazu kommen, wäre das eine so dramatische Zuspitzung, wie es sie seit der Wahl im Jahre 2016 noch nicht gegeben hatte.
Würden die Demokraten die Kluft zwischen den Parteien