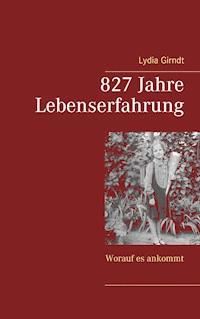
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Zehn lebensbejahende Menschen erzählen in diesem Buch ihre ganz persönliche Geschichte. In ihrem langen Leben haben sie bei Schweinen übernachtet und Häuser gekauft, sich nach Brot gesehnt und Kartoffelpuffer genossen. Sie sind in Bunker geflüchtet und haben Volksfeste besucht, haben Kinder geboren und Ehepartner begraben, Kühe gehütet und Konzerte besucht. Dabei haben sie sich ihre Lebensfreude bis ins hohe Alter erhalten. Die Autorin hat jeden ihrer Gesprächspartner gefragt, worauf es im Leben ankommt und was er oder sie jüngeren Menschen empfiehlt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin:
Lydia Girndt, geboren 1973, ist Diplom-Psychologin und lebt in der Nähe von Bremen. Sie ist seit mehr als zehn Jahren als Coach und Beraterin für Führungskräfte und ihre Teams tätig. Ihre Leidenschaft ist die Persönlichkeitsentwicklung.
Inhalt
BEREICHERNDE BEGEGNUNGEN
ILSE G.: AUF MENSCHEN ZUGEHEN
Frühe Erinnerungen
Der Mann mit den karierten Hosen
Die Erfüllung
Abschied von Herbert
Sonderschule und angebrochene Schokolade
Zum Glück ein Hund
Unterwegs mit dem Sohn
Worauf es ankommt
HANNA S.: WENN ICH HELFEN KANN,
Aufwachsen in Stedefreund
Knappe Kriegsjahre
Eine überraschende Familiengründung
Ein plötzlicher Schlag
Ein besonderer Reichtum
Worauf es ankommt
CHRISTEL B.: DAS LEBEN, EIN ABENTEUER
Start in Hinterpommern
Aufbruch in den Westen
Von Meierstorf bis Hamburg
Endlich ankommen
Folgenreiche Freimarktbesuche
Sich auf das Alter einstellen
Worauf es ankommt
EGON W.: ENTSCHEIDEN UND VERTRAUEN
Geradlinig durchs Finanzamt
Geradlinig durch die Familie
Krieg und Glaube
Worauf es ankommt
GÜNTER G.: DEN WILLEN MUSS MAN HABEN
Berlin, Schlesien, Litauen
Nicht von meinem Kirchturm
Bomben auf Berlin
Ich finde den Papa!
Bauingenieurwesen und Schaltpläne
Berufsstationen
Alleinerziehender Vater
Wieder eine richtige Familie
Worauf es ankommt
DELA UND FRITZ H.: GEMEINSAM LACHEN
Von Haus zu Haus: Wohnstationen
Familienleben
Dela: „Schrecklicher als Kaffee ohne Milch“
Fritz: „eine normale Kindheit“
Gemeinsame Werte
Gemeinsam im Bestattungsinstitut
Gute Erinnerungen, wohlsortiert
Worauf es ankommt
HANNE R.: GLÜCK GEHABT
Krieg in Hamburg und Bayern
Fuß fassen im Berufs- und Familienleben
Glück gehabt in allen Schwierigkeiten
Reiseglück
Gute Freunde und tolle Töchter
Worauf es ankommt
MARLIESE B.: CHANCEN ERGREIFEN!
Von Warwickshire bis zur Bremer Landesbank
Plötzlich Ehefrau und Mutter
Möglichkeiten nutzen
Worauf es ankommt
MARIE D.: NICHT JAMMERN, MACHEN!
Harte Lehrjahre mit Kühen und Kartoffeln
Wie entsorgt man Hitler-Bilder?
Schnaps, Kartoffelpuffer und Heiratsmarkt
Kraft in schwierigen Zeiten
Worauf es ankommt
ÄHNLICHKEITEN, BESONDERHEITEN UND EIN FAZIT
DANK
BEREICHERNDE BEGEGNUNGEN
„Das Bewusstsein eines erfüllten Lebens und die Erinnerung an viele gute Stunden sind das größte Glück auf Erden.“ (Francis Bacon)
Was haben lebensbejahende Menschen über 80 in ihrem Leben richtig gemacht? Warum sind sie so zufrieden? Diese Fragen stellte ich mir 2014, als ich las, wie gut es tut, sich an Gutes zu erinnern. Es musste doch möglich sein, aus der Lebenserfahrung über 80-Jähriger zu lernen und ihnen gleichzeitig auch noch etwas Gutes zu tun. Ich wollte es wissen und marschierte mit einem Interviewleitfaden in der Hand zu meiner agilen, lebensfrohen Schwiegermutter. Nach dieser ersten bereichernden Begegnung hat es ein Jahr gedauert, bis ich das Projekt mit voller Kraft angegangen bin.
Ende 2015 habe ich neun weitere lebensbejahende Menschen mit mindestens 80 Jahren Lebenserfahrung gesucht, die mich und die Leser dieses Buches an ihrer Geschichte teilhaben lassen würden. Wie haben sie Schwierigkeiten in ihrem Leben gemeistert, worüber haben sie sich gefreut und welche guten Entscheidungen haben sie getroffen? Bei der Kontaktaufnahme habe ich mich auf die Empfehlungen von Freunden und Bekannten verlassen. Vor Ihnen liegt eine subjektive Auswahl wunderbarer Menschen, die mein Leben mit ihren Haltungen, Einstellungen und Erlebnissen sehr bereichert haben. Vermutlich haben sie alle auch ein paar anstrengende Gewohnheiten, doch die haben mich bei diesem Buch nicht interessiert. Jedem habe ich ein Kapitel gewidmet, bis auf Fritz und Dela H., deren Geschichten untrennbar miteinander verwoben sind.
So unterschiedlich detailreich die Erzählungen waren, so unterschiedlich lang sind auch die einzelnen Kapitel. Doch jedes endet mit der Frage, worauf es im Leben wirklich ankommt und was meine Gesprächspartnerinnen und -partner uns Jüngeren empfehlen möchten. Lassen Sie sich mit hineinnehmen in 827 Jahre Lebenserfahrung. Lesen Sie, was ich daraus gelernt habe, und ziehen Sie Ihre eigenen Schlüsse.
ILSE G.: AUF MENSCHEN ZUGEHEN
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ (Martin Buber)
Es ist ein Montagabend im September 2014, als ich an der Tür zum oberen Stockwerk der Seniorenwohnanlage klingele. Kein Aufzug. Wer oben wohnt, muss noch gut zu Fuß sein. Ilse G. öffnet strahlend ihre Wohnungstür. Mit ihren 1,76 Metern ist sie fast so groß wie ich, und ihren Bewegungen sieht man sofort an, dass Treppen sie nicht schrecken können. Seit ihrer Geburt 1926 lebt meine Schwiegermutter in Bremen Nord, mittlerweile im betreuten Wohnen. Das Interview mit ihr führe ich wenige Wochen nach ihrem 88. Geburtstag.
Als Erstes betreten wir ihre kleine Küche, in der schon das Wasser kocht. Ob ich einen Tee möchte? Aber gerne doch. Mit Porzellankanne, Stövchen und Teegläsern ausgerüstet, nehmen wir am kleinen runden Wohnzimmertisch Platz. Alles in dieser Wohnung ist recht klein. Vom Wohnbereich aus führt ein offener Durchgang in den Schlafbereich und eine Terrassentür auf den liebevoll mit Geranien geschmückten Balkon. Ich weiß, dass sich Ilse an die begrenzte Wohnfläche längst gewöhnt hat. Nur ihr Garten fehlt ihr bis heute.
„Erzähl einfach einmal von Anfang an, was in deinem Leben so passiert ist und was dir wichtig war“, bitte ich sie.
Frühe Erinnerungen
Ilses früheste Erinnerung ist nicht fröhlich: Im Flur steht ein kleiner, weißer Sarg, in dem ihre Schwester Herma liegt. Herma war 1929 geboren worden und wurde nur ein Jahr alt.
„Meine Mutter ist mit mir zu Hause geblieben, während sie begraben wurde“, berichtet Ilse nüchtern. Ich traue meinen Ohren kaum. Wäre es heute denkbar, dass die Mutter nicht zur Beerdigung ihrer Tochter geht, um bei der anderen Tochter zu bleiben? Heute würde man die Kleine vermutlich mitnehmen oder bei Verwandten oder Freunden lassen. Andererseits konnte Ilse die Nähe ihrer Mutter in dieser verwirrenden Situation sicher gut gebrauchen. Ilse erklärt, dass sie gerne eine Schwester gehabt hätte – und eine weitere feststehende Erinnerung taucht auf: Herma bekommt die Brust und Ilse ist neidisch.
„Aber ich durfte dann auch mal“, erinnert sie sich amüsiert.
Ilses Eltern hatten einen Elektroladen mit Werkstatt. Nur die Werkstatt erbrachte einen kleinen Gewinn. Wie knapp das Geld immer war, erzählt Ilse erst auf Nachfrage. Das Thema Geld ist für sie weder tabu noch sonderlich interessant.
Ilses ein Jahr älterer Bruder, mit dem sie heute häufigen und guten Kontakt hat, spielt in den Erzählungen von damals kaum eine Rolle.
Ilse hat die Volksschule bis zur achten Klasse besucht. Dann kam die Handelsschule in Bremen Vegesack und nebenher half sie im Laden. Als ich überlege, wie reif ich in der achten Klasse war, werden mir die unterschiedlichen frühen Lebensumstände sehr deutlich. Den Kriegsbeginn erwähnt Ilse nicht.
Erst bei unserem nächsten Treffen sagt sie, sie hätte noch ein paar Dinge vergessen, und beginnt mit dem gefühlten Ende ihrer Jugend: Als sie 13 Jahre alt war, kam die Mutter ins Krankenhaus. Die Oma war ebenfalls krank. Also stellte sich die Frage, wer nun kochen sollte. Es war ein Samstag, an dem es grundsätzlich etwas ganz Einfaches gab. Die Entscheidung lautete: Ilse soll kochen und es soll Schmorkartoffeln geben.
„Im Nachhinein hab‘ ich gedacht, da war auch meine Jugend zu Ende", sagt Ilse. „Meine Mutter kam aus dem Krankenhaus. Ein paar Wochen später starb meine Oma.“ Eine Tante aus Berlin kam zu ihnen und alles zusammen war für Ilse ein großer Wendepunkt.
„Da war ja auch Krieg“, sagt sie. Und nach einer kurzen Pause: „Ja, ich hör das noch, wie sie im Radio sagen ‚Seit soundso viel Uhr wird zurückgeschossen‘“. Dabei sagt sie ‚zurückgeschossen‘ mit einer solchen Aggression und Schärfe, dass ich kurz innerlich zusammenzucke.
„Dieses ‚zurückgeschossen‘, das hat sich so eingeprägt“, erklärt Ilse. „Und es war ja gelogen. Hinterher konnte man das nicht begreifen.“
In ihrer Handelsschulzeit hatte sich eine Freundschaft entwickelt, die ein Leben lang gehalten hat. Ilses Freundin wohnte später auf der anderen Weserseite in Niedersachsen und war mit einem Seemann verheiratet. Entsprechend war sie viel alleine und Ilse hat sie häufig besucht.
„Ich war immer die, die hinfuhr“, sagt sie. „Das hat sich komischerweise in meinem Leben so fortgesetzt. Ich gehe immer irgendwo hin. Ich denke, das ist auch eine Veranlagung. Meine Großmutter hat mich früher immer mitgenommen. Wir gingen immer irgendwo hin.“ Ich kann das bestätigen. Manchmal wünscht sie sich mehr Initiative von anderen, aber auf keinen Fall bleibt sie stur zu Hause hocken.
Ich möchte wissen, was die Freundschaft ausgemacht hat, die so lange gehalten hat.
„Da hat keiner bestimmt“, sagt Ilse. Eine Freundschaft auf Augenhöhe. „Ihr Vater war nur ein einfacher Arbeiter und es gab dort nicht viel, aber wenn ich da war, habe ich dort mit Abendbrot gegessen. Vollkommen unkompliziert.“
Im Anschluss an die Handelsschule arbeitete Ilse zunächst auf der Werft. Nach einem halben Jahr Arbeit bei Lürssen wurde sie 1944 zum Kriegsdienst eingezogen und landete als ‚Motorenschlosser‘ auf einem Fliegerhorst in Bayern. Es waren allerdings keine Flugzeuge und keine Soldaten mehr dort.
„Ich habe dort nie einen Motor gesehen“, erklärt sie. 1945 wurde sie entlassen und war zunächst wieder zu Hause. 1946 bis 1949 hat sie für die Schreiber-Reederei auf der ‚Oceana‘ Kaffee gekocht. Die ‚Oceana‘ fährt noch heute im Sommer einmal täglich als Linienschiff vom Bremer Martini-Anleger nach Bremerhaven und zurück. Einmal bekamen wir die Gelegenheit, einen Blick in Ilses damalige Schlafkajüte zu werfen. Im Vergleich dazu ist ihr heutiger Schlafbereich riesig. Im Anschluss an die Zeit bei der Reederei hat Ilse bis 1956 als Schreibkraft bei Rechtsanwalt Fitschen „den ganzen Tag nur geklappert“, wie sie es ausdrückt. Geklappert haben nur die Tasten der Schreibmaschine, auf der sie Schriftsätze für das Amtsgericht schrieb. Bei keiner dieser Stationen hält sich Ilse mit ihrer Erzählung lange auf. Nach einem halbjährigen Ausflug in eine Kaffeefirma in Bremen Aumund kam Ilse im Dezember 1956 zu Weserflug, das sie echt bremisch „Weserfluch“ ausspricht. Sechs Monate war sie in Bremen, danach wurde sie in der Personalstelle in Lemwerder eingesetzt und fuhr fortan mit der Fähre über die Weser zur Arbeit. Dort blieb sie bis zum schönsten Moment ihres Lebens, fünf Jahre nach ihrer Hochzeit.
Der Mann mit den karierten Hosen
1956 wechselte Ilse nicht nur den Arbeitsplatz, sondern verlobte sich auch. Ihren Herbert lernte sie in der Gastwirtschaft Pelikan kennen. Dort arbeitete ihr großer Bruder als Taxifahrer und ihre Eltern tranken dort ihr Bier.
„Dazu sind wir immer rausgegangen“, erklärt Ilse und ich höre das Unverständnis dafür, dass so viele Menschen zu Hause hocken, statt andere Menschen zu treffen.
„Man lernte dort Leute kennen und die Familie Kuhrke stand uns sehr nahe“, sagt sie. „Und da war auch mein Herbert. Den ersten Abend hatte er eine karierte Hose an und das fand ich so schrecklich. Da hab ich gedacht: ‚Hoffentlich zieht er die nie wieder an.‘“ Offenbar hatte die Hose sie nicht so sehr abgeschreckt, dass sie ihm aus dem Weg gegangen ist. Wie sind sie einander nähergekommen? Sie saßen an der Theke, haben wenig getrunken und viel geredet.
„Es war wirklich Unterhaltung“, sagt sie. Unwillkürlich erinnere ich mich, wie mühelos ich mich einige Jahrzehnte später mit ihrem Sohn unterhalten konnte. Keine krampfhafte Suche nach Themen oder Worten, keine Selbstdarstellungen, keine Irritation in Gesprächspausen, einfach unkompliziert. Als Ilse nach Hause ging, – „spät natürlich“ – dachte sie sich: „Wenn der liebe Gott mir etwas Gutes tun will, dann kommt er wieder.“ Und sie ergänzt: „Das habe ich mir so richtig gewünscht.“ Ihr Wunsch wurde erhört.
„Er kam wieder und das ist dann so langsam gelaufen“, sagt Ilse ohne weitere Details.
1958 heirateten die beiden und hatten ihr Schlafzimmer zunächst bei Ilses Eltern. Wieder horche ich auf. Sie war 32 Jahre alt, frisch verheiratet und konnte mit ihrem Mann nicht gleich in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Stattdessen ein Zimmer bei den Eltern. Kommt jetzt nicht ein Hinweis darauf, dass das fürchterlich schwere Zeiten waren? Nein. Alles klingt danach, als wären es gute Zeiten gewesen. Das muss ich noch einmal prüfen.
„Mein lieber Herbert hatte wenig Geld“, erklärt Ilse auf meine Nachfrage. Er arbeitete auf der Werft ‚Bremer Vulkan‘ und lebte als Letzter noch zu Hause bei seinen Eltern. Von seinem Wochenlohn musste er zu Hause abgeben. Was war das Besondere? Was hat ihr so gefallen an ihrem Herbert? Der erste Teil ihrer Antwort klingt lustig für mich.
„Er war ein ganz sauberer Typ, hatte immer ein blütenweißes Hemd an“, sagt sie. „Komischerweise sehe ich das heut‘ noch.“ Seine schönen Hände hätten ihr auch sehr gefallen. Noch einmal betont sie: „Wir konnten immer ohne Schwierigkeiten reden.“
Schließlich beschlossen die beiden, sich eine eigene Wohnung zu nehmen, eine mit Wohnzimmer und Küche. Es ist Ilse deutlich anzusehen, was für ein Höhepunkt das war und mit einem Lächeln erzählt sie, wie sie sich eine Lampe kaufen und die Kosten teilen wollten. Sie waren sich schnell einig, welche es sein sollte. Doch die Hälfte des Preises hätte ihr Mann nicht aufbringen können. Also, was nun? „Dann haben wir halt eine billigere genommen und waren damit zufrieden“, sagt Ilse. Bei mir verstärkt sich der Eindruck, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, man könnte anders als partnerschaftlich mit solchen Situationen umgehen. Da alles immer ganz knapp war, haben sie sich ihre Einrichtung Stück für Stück zusammengekauft.
„Wenn meine Mutter wüsste, dass wir heute ohne Geldsorgen leben … ich hätte ihr das mal so gewünscht“, sagt sie.
Nicht beim Gedanken an ihre eigene Situation, sondern an die Situation der Eltern beginnt ihre Stimme zu wackeln. Doch als ich frage, ob die Mutter darunter gelitten hat, antwortet Ilse mit fester Stimme: „Nein, Oma Luise war immer zufrieden. Sie hatte immer ein schönes, glattes Gesicht.“
Die Erfüllung
Der absolute Höhepunkt war für Ilse ganz klar die Geburt ihres Sohnes Rainer. Fünf Jahre haben Herbert und Ilse gearbeitet, eingerichtet und gespart, um sich das ersehnte Kind leisten zu können. Geplanter kann ein Kind kaum sein. Sie waren auf einem Fest in der Nachbarschaft, von dem sie sich augenzwinkernd früh verabschiedeten, damit alles nach Plan lief. Am nächsten Morgen nach dem Kaffee hörte Ilse mit dem Rauchen auf.
„Ich habe empfunden, dass es geklappt hat“, sagt sie dazu. Und sie hat recht behalten. Im Sommer 1963 ging nach sieben Jahren Ilses Geschichte bei Weserflug zu Ende und eine ganz neue Geschichte begann. So lange wie möglich arbeitete sie noch.
„Es war eine schöne Arbeit“, sagt Ilse. „Wir haben Zeit gehabt und viel Spaß.“ Sie merke das heute noch, wenn sie Zusammenkünfte mit ehemaligen Kollegen aus dieser Zeit habe. Die Kollegen sahen genau hin. Als Ilse den Gürtel an ihrem rotblau kariertes Kleid weiterstellen musste, konnte sie die Schwangerschaft nicht mehr lange verbergen. In ihrer kleinen Wohnung war alles vorbereitet: Kinderwagen, Bett, alles war gekauft.
„Man bot mir Babysachen an, aber ich wollte das nicht“, sagt Ilse. Sie wollte es aus eigenen Mitteln schaffen, und sie hat es geschafft. Es war ein Sonntagmorgen, als sie, begleitet von ihrer Freundin Brunhilde, ins Krankenhaus ging. Damals war es noch nicht üblich, dass der Vater bei der Geburt des Kindes dabei war. Zunächst passierte nichts. Den ganzen Sonntag verbrachte Ilse alleine im Zimmer und niemand kümmerte sich oder erklärte etwas.
„Das möchte ich nicht noch einmal erleben“, sagt sie bestimmt. Ihr Sohn wurde erst am Montagabend geboren. Ilses Erzählung stockt und Tränen der Rührung steigen ihr in die Augen.
„Das ist der Höhepunkt“, sagt sie. „Jetzt muss ich heulen.“ Auch als „die Erfüllung“ bezeichnet sie die Geburt. Nur den Kopf des Babys habe man ihr nicht gezeigt. Stattdessen wurde ihr „befohlen“, sich auf die Seite zu legen. Erst am nächsten Morgen erfuhr sie, dass ihr Baby eine große Beule auf dem Kopf hatte. Ilse war entsetzt. Herbert, der seinen Sohn das erste Mal auf dem Krankenhausflur gesehen hatte, wusste Bescheid: Es handelte sich um einen Blutstau, der nach ein paar Tagen wieder verschwinden würde. Bei Ilse im Zimmer lagen mehrere Frauen und es war ein riesiger Trubel.
„An Schlaf war nicht zu denken“, erinnert sie sich. Schön wurde es, als sie wieder nach Hause kam, kochen und das Kind versorgen konnte. Finanziell blieb es knapp. Statt der früheren 30 D-Mark mussten sie für ihre Wohnung mittlerweile 100 D-Mark bezahlen und Ilses Gehalt fiel erst einmal weg. Es wäre nicht gegangen, wenn Herbert nicht den Garten mit gepflegt hätte. Dafür bekamen sie eine Mietminderung.
Als Ilses Mutter 1967 gestorben war, brachte Ilse den noch dreijährigen Sohn in den Kindergarten. Das war ein schwieriger Moment für die Mutter, die sich dachte: „Du gibst jetzt dein Kind hier einfach so ab und gehst wieder nach Hause – und er war so ein Süßer!“
Nun konnte Ilse sich wieder eine Arbeit suchen. „Ich hatte Glück“, sagt sie. „Eine Nachbarin hat aufgehört zu arbeiten und da hab ich gedacht, so ein paar Stunden Arbeit könnten mir gefallen.“ 1967 fing sie zunächst mit zehn Wochenstunden als Schulsekretärin an.
„Das Geld, was ich da verdient habe, hat mich wenig interessiert“, sagt Ilse. „Ich wollte gerne raus und wieder was tun. Denn nur zu Hause zu sitzen, ist nicht mein Ding. Das ist ja heute noch so. Ich weiß auch gar nicht, was ich damals verdient habe.“
Morgens brachte sie ihren Sohn zum Kindergarten. Mittags holte der Opa, der bis 1977 lebte, ihn ab. „Wenn ich dann nach Hause kam, kamen die beiden auch und dann gab es was zu essen und so ging das eine ganze Weile.“
1970 standen zwei Neuerungen an. Der Sohn kam in die Schule und die Familie zog in einen neu errichteten Wohnblock in Rönnebeck, einem weiteren Stadtteil in Bremen Nord. So war für Ilse der Weg zur Arbeit ohne Auto einfacher, und ihrem Herbert machten die paar Kilometer mehr zur Arbeit wenig aus. Der gelernte Bootsbauer wurde mittlerweile bei Weserflug in der Versuchswerkstatt eingesetzt. In einem Wohnblock zu wohnen, war zunächst eine große Umstellung, doch die Wohnung war gut geschnitten und günstig gelegen. Ihr Sohn fuhr mit dem Fahrrad zur Grundschule in Bremen Blumenthal und Ilse arbeitete in der Grundschule Hechelstraße, wo sie insgesamt zehn Jahre blieb.
Es schien alles rund zu laufen und so hätte es wohl zur Zufriedenheit aller weitergehen können. Ilse beginnt von der nächsten beruflichen Station zu erzählen, bevor sie mitten im Satz umschwenkt zur wahrscheinlich schwierigsten Situation ihres Lebens: „… und ja, ich muss ja eigentlich noch erst etwas anderes erzählen …“ Sie redet plötzlich deutlich langsamer.
Abschied von Herbert
„Das war ’73 – da ist Herbert gestorben. Da wohnten wir gerade drei Jahre in der neuen Wohnung“, sagt Ilse. Wochenlang hatte ihr Mann morgens stark gehustet, „aber die Zigarette musste ja sein.“ Nachdem er endlich zum Arzt gegangen war, kam er im Herbst 1972 das erste Mal ins Krankenhaus. Einzelheiten, wie lange er dort genau war, erinnert Ilse nicht mehr. Dass die Lunge betroffen war, wurde ihnen gleich gesagt, aber nicht, welche Behandlung auf ihn zukam. Über Weihnachten und Neujahr kam er noch einmal nach Hause, aber dann ging es schließlich gar nicht mehr und er musste wieder ins Krankenhaus. Dort starb er im März 1973 an Lungenkrebs, noch bevor sein Sohn zehn Jahre alt wurde. Ilse beschreibt das als sehr schwere Zeit und fragt sich bis heute, ob sie sich richtig verhalten hat.
„Der Mann im Krankenhaus, der hat gewartet. Zu Hause der Junge, der hat gewartet“, sagt sie. „Manchmal klappte das nicht mit dem Opa, dass der da war für ihn und aus dem Grunde bin ich aus dem Krankenhaus immer schnell wieder weggefahren. Das bereue ich heute.“ Noch einmal wiederholt sie: „Das bereue ich heute eigentlich immer noch, denn es ging zusehends schlechter mit Herbert.“
Ich bin überrascht. Dass ihr das nach 41 Jahren noch zu schaffen macht, hatte ich nicht gewusst. Konnte sie ihren Sohn nicht mitnehmen ins Krankenhaus? Sie ist sich nicht ganz sicher, meint aber, sie habe ihn nie mitgenommen, hätte es ihm vermutlich nicht zumuten wollen.
„… Aber er durfte in Papas Bett schlafen, das war für ihn ein kleiner Trost“, erzählt sie.
Mit knapp 47 Jahren verlor sie den Mann, mit dem sie sich so gut verstanden hatte. Was hat ihr geholfen, das zu überstehen? Spontan weist sie darauf hin, dass sie zu der Zeit noch in der Schule in der Hechelstraße arbeitete. Sie hatte zu tun. Eine Freundin, die ebenfalls früh ihren Mann verlor, meinte später, sie hätten sich zu wenig um Ilse gekümmert.
„Aber ich habe das gar nicht so empfunden, weil ich ja meine Arbeit hatte, und ich hatte meinen Jungen und das hat mich eigentlich ausgefüllt“, sagt Ilse. Bis heute wird immer wieder deutlich, wie wichtig es ihr ist, sinnvolle Aufgaben zu haben.
Die ersten Monate nach Herberts Tod wurden zusätzlich erschwert, weil die Witwenrente eine lange Zeit nicht ausgezahlt wurde. Ein paar Monate war das Geld so knapp, dass auch die sehr bescheidene Ilse sich zwangsläufig Gedanken über ihr Auskommen machte. Einmal ging sie nach viel Überwindung zum Sozialamt. Dort wurde sie abgewiesen, weil es noch ein Konto mit circa 1.000 DM gab. Erst musste alles Geld weg sein. Die Erlösung kam im September.
„Dann kam die Rente, dann kam die Nachzahlung“, sagt Ilse. „Ich sehe heute noch den Briefträger an meinem Küchentisch sitzen und das Geld da hinlegen. Für die ganzen Monate war das natürlich beträchtlich.“ Erstaunt frage ich, ob sie es wirklich per Post geschickt bekam.
„Ja, ja, ja“, ist die Antwort, und mit jedem „Ja“ höre ich erneut die Last und die Sorge von ihren Schultern fallen. „Das war so eine Besonderheit! Und das hilft einem natürlich enorm. Das macht einen zufrieden und du weißt, es geht weiter, und das war wirklich ein aufregender Moment.“
Sonderschule und angebrochene Schokolade
Wie lange hat es gedauert, bis sich ihr Leben nach Herberts Tod wieder ‚normal‘ anfühlte?
„Das dauert schon ein bis zwei Jahre, sicher“, sagt Ilse. „Aber wenn man sein Auskommen hat – und ich hatte meine Schule, das hat mich immer zufriedengestellt. Du hast ein ganzes Kollegium und du findest Einzelne, mit denen du besonders gut auskommst, und das hält dann ein Leben lang.“ Freundschaften aus dieser Zeit bestehen bis heute.
Nachdem sie das dunkelste Kapitel ihrer Erzählung abgeschlossen hat, spricht Ilse lauter und frischer weiter. Zwei Jahre waren vergangen, der Sohn hatte seine Schule, das Geld reichte wieder aus, die Wohnung war in Ordnung und der Opa war noch da. Die Zeit war gekommen, sich über die Zukunft Gedanken zu machen.
„Was willst du eigentlich? Willst du allein bleiben?“, fragte sich Ilse.
Sie beantwortete sich die Frage selbst, indem sie auf eine Annonce reagierte. Ihr Sohn bekam das spätestens bei den ersten Treffen mit Karl-August mit.
„Ich war aber nicht Feuer und Flamme, überhaupt nicht“, sagt sie. Trotzdem dachte sie wohl zunächst, nicht alleine bleiben zu wollen.
„Und dann hat mein Sohn gesagt: ‚Warum machst du das? Du hast doch mich.‘ Das höre ich immer noch“, erklärt Ilse. Schließlich habe sie es gelassen. Mir wird ein wenig mulmig. Es war doch zu erwarten, dass der Sohn irgendwann das Haus verlässt. Durfte er tatsächlich über ihre Partnerschaft bestimmen? Ganz so war es glücklicherweise doch nicht.
„Der hatte ein Haus in Schwachhausen, aber er war geizig“, sagt Ilse. Hier kommen wir zum Kern. Sein Geiz sei der Hauptgrund gewesen, dass sie mit ihm Schluss gemacht habe. Ein Beispiel erzählt sie: „Karl-August brachte dem Jungen eine angebrochene Tafel Schokolade mit. Das hat ihn damals schon so gestört, glaube ich.“ Offenbar hat es nicht nur ihren Sohn gestört, keine ganze Schokoladentafel zu bekommen.
Nach der schnellen Trennung war Ilse wieder allein. Umso mehr kümmerte sie sich um ihre Schule und ihre Freundschaften. Mit drei Freundinnen war sie regelmäßig unterwegs und ihre erste gemeinsame Busreise führte sie nach Wien. Meistens fuhren sie jedoch in die nähere Umgebung, denn eine von ihnen hatte einen Führerschein und ein Auto.
„Erika hat uns immer mitgenommen“, sagt Ilse. „Die war so unkompliziert. Die hat immer Tisch und Stühle hinten reingepackt und wir hatten zu essen mitgenommen. Da gab es überhaupt keine Probleme.“ Brundorf und Meyenburg in der Gemeinde Schwanewede gehörten genauso zu ihren Ausflugszielen wie Bad Zwischenahn. Irgendwo im Wald packten sie Tisch und Stühle aus und spielten nach dem Essen dort Karten. „Bis uns das dann mal im Wald zu dumm wurde, wegen der Mücken“, erzählt Ilse. „Da haben wir gesagt, wir sind doch doof. Wir hatten doch alle einen Garten.“
Einen guten Draht hatte sie auch zum Schulleiter Erwin H. und seiner Frau, mit der sie bis heute Kontakt hat. Als der Schulleiter an eine andere Schule wechselte, war es auch für Ilse Zeit zu gehen. Nach zehn Jahren in der Hechelstraße wurde sie von Karin K., der Leiterin der ‚Sonderschule‘, wie sie damals noch hieß, angesprochen. Das passte gut mit dem Schulleiterwechsel zusammen und sie konnte dort mehr Stunden arbeiten als bisher. Als Karin K. in Rente ging, löste Fritz-Otto B. sie ab. Auch zu ihm hat Ilse bis heute Kontakt.
„Das waren alles Menschen, mit denen man gut auskam“, sagt sie.
Sie blieb bis zu ihrem Rentenbeginn 1987 in der Schule in der Reepschlägerstraße.
Zum Glück ein Hund
Bis hierher hatten neben der Begegnung mit Herbert und der beglückenden Geburt des Sohnes vor allem die alltäglichen Begegnungen und sinnvollen Aufgaben Ilses Zufriedenheit ausgemacht. Doch einen weiteren Höhepunkt erlebte sie noch vor Rentenbeginn. 1983 holte Ilse sich einen Hund.
„Und sich einen Hund holen, das ist auch ein toller Moment!“ Die Leidenschaft, mit der Ilse diese Worte sagt, ist beeindruckend. Sich einen Hund zu holen, ihn auf dem Schoß zu haben und zu wissen: ‚Das ist jetzt meiner’, ist nach ihren Worten ein Moment, „in dem sich noch einmal Vieles entscheidet“. Sie hat keine Worte für die Bedeutungstiefe, die sie empfindet. ‚Urmel‘ war ein Langhaardackel, der fortan zur Familie gehörte.
„Urmel war unser ein und alles“, sagt Ilse und räumt dann ein, dass der Hund, der offenbar eine Hündin war, auch sehr zickig sein konnte. Wenn Urmel läufig war, beschwerte sie sich über jede von Rainers Bewegungen so sehr, dass er sich lieber in sein Zimmer oben unters Dach verzog.
1983 zog Ilse von Rönnebeck wieder nach Blumenthal. Den Umzug beschreibt sie als „Katastrophe“. Ihr großer Bruder drängte, diesen noch vor Weihnachten über die Bühne zu bringen. Zwar wollte der Nachfolger die Wohnung in Rönnebeck so übernehmen, aber die Wohnungsbaugesellschaft forderte noch Renovierungsarbeiten, und Ilse hätte sie damals „am liebsten aufgefressen.“ Wie bekamen sie es hin? Es packten alle mit an: Bruder, Schwägerin, Nichten und Sohn trugen fleißig alles nach oben. Natürlich sind dabei Dinge oben gelandet, die in den Keller sollten und umgekehrt, doch sie schaffte es. Der neue Wohnort hatte den Nachteil, dass Ilse wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren musste, aber sie schwärmt: „Wir hatten einen Garten.“
Es gab noch einen Grund für den Umzug: Ilse wollte wieder dichter an die Mühlenstraße, in der sie aufgewachsen war.
„Die Straße lebte damals noch“, sagt sie. „Das war dann schlagartig vorbei.“ Heute finden sich in Blumenthal nur noch wenige Läden.
Mit 61 Jahren ging Ilse G. in Rente. Nachdem ihr die Arbeit so wichtig gewesen war, hätte ich erwartet, dass ihr der Schritt in den Ruhestand schwergefallen ist, doch so war es nicht.
„Das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen. Ich hatte ja den Hund“, sagt sie. Wieder bin ich beeindruckt von der Bedeutung dieses Tieres. Nach einer kurzen Pause ergänzt Ilse: „Ich war viel im Garten und Essen kochen musste ich ja auch noch und Freundinnen hatte ich.“ Mit denen ging sie unter anderem in die damals noch belebte Mühlenstraße.
Ich möchte mehr über das Phänomen Hund wissen. Was waren die schönsten Momente? Ilses Antwort zeigt mir, dass es nicht auf die großen Momente ankommt: „Das fügt sich so ineinander“, sagt sie und beschreibt, wie der Hund zur Tagesstruktur beitrug. Morgens direkt nach dem Aufstehen gingen die beiden eine kleine Runde spazieren, nachmittags war die große Runde dran. An der Weser trafen sie andere Hundebesitzer und wenn sie zurückkamen, setzten sie sich zusammen aufs Sofa und genossen die Pause. Ilse ahmt den genüsslichen Hundeseufzer nach, den sie zu hören bekam, während sie Urmel streichelte. Struktur, Bewegung, Verbindung zu anderen ‚Hundefreunden‘ und Gesellschaft auf der Couch – da kommt eine Menge zusammen, was so ein Tier bieten kann.





























