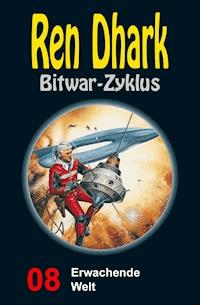Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: (999) Alfred Bekker: Im Land von El Tigre Alfred Bekker: Dunkler Prediger Pete Hackett: Jacob Morgans Höllentrail Pete Hackett: Stern im Schatten des Galgens Pete Hackett: Goldrausch am Rio Bonito Pete Hackett: Wen Latimer in die Knie zwingt Pete Hackett: Die Verschollene der Grand Mesa Luke Sinclair: Die Verfluchten der Blizzard-Hölle Luke Sinclair: Der Teufel mit dem Stern Der hämmernde Hufschlag rollte dem Reiterpulk voraus wie ein Gruß aus der Hölle. Auf den Gehsteigen blieben die Passanten stehen und richteten ihre Blicke nach Süden. Über dem westlichen Horizont glühte der Himmel im Abendrot. Die Reiter tauchten auf. Es waren fünf. Die Hufe ihrer Pferde wirbelten eine dichte Staubwolke auf. Trotzdem war zu sehen, dass in ihren Fäusten die Revolver lagen. In wilder Karriere stoben sie die Main Street hinunter und feuerten nach allen Seiten. Dann rissen sie vor der Bank ihre Pferde zurück. Die Menschen auf den Gehsteigen ergriffen die Flucht. Ein furchtbares Drama hatte seinen Anfang genommen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1082
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pete Hackett, Alfred Bekker, Luke Sinclair
9 Starke Western März 2024
Inhaltsverzeichnis
9 Starke Western März 2024
Copyright
IM LAND VON EL TIGRE
Dunkler Prediger
Jacob Morgans Höllentrail
Stern im Schatten des Galgens
Goldrausch am Rio Bonito
Wen Latimer in die Knie zwingt
Die Verschollene der Grand Mesa
Die Verfluchten der Blizzard-Hölle
Der Teufel mit dem Stern
9 Starke Western März 2024
Pete Hackett, Alfred Bekker, Luke Sinclair
Dieser Band enthält folgende Western:
Alfred Bekker: Im Land von El Tigre
Alfred Bekker: Dunkler Prediger
Pete Hackett: Jacob Morgans Höllentrail
Pete Hackett: Stern im Schatten des Galgens
Pete Hackett: Goldrausch am Rio Bonito
Pete Hackett: Wen Latimer in die Knie zwingt
Pete Hackett: Die Verschollene der Grand Mesa
Luke Sinclair: Die Verfluchten der Blizzard-Hölle
Luke Sinclair: Der Teufel mit dem Stern
Der hämmernde Hufschlag rollte dem Reiterpulk voraus wie ein Gruß aus der Hölle. Auf den Gehsteigen blieben die Passanten stehen und richteten ihre Blicke nach Süden. Über dem westlichen Horizont glühte der Himmel im Abendrot. Die Reiter tauchten auf. Es waren fünf. Die Hufe ihrer Pferde wirbelten eine dichte Staubwolke auf. Trotzdem war zu sehen, dass in ihren Fäusten die Revolver lagen. In wilder Karriere stoben sie die Main Street hinunter und feuerten nach allen Seiten. Dann rissen sie vor der Bank ihre Pferde zurück. Die Menschen auf den Gehsteigen ergriffen die Flucht. Ein furchtbares Drama hatte seinen Anfang genommen ...
Zwei der Reiter sprangen von den Pferden und hetzten zum Eingang der Bank. Einer von ihnen trug leere Satteltaschen. Der andere klinkte die Tür auf, und dann verschwanden die beiden im Schalterraum. Der Kassierer saß wie erstarrt hinter seinem Tresen, seine Augen waren schreckensweit. Ein Kunde hob automatisch die Hände.
„Das ist ein Überfall!", brüllte einer der beiden Eindringlinge scharf und fuchtelte wild mit dem Colt herum. Der andere schleuderte die Satteltaschen auf den Tresen und schnarrte: „Alles einpacken! Auch das Hartgeld!"
Die drei anderen Outlaws trieben auf der Straße ihre Pferde hin und her. Wachsame Blicke tasteten über die Fassaden der Häuser, bohrten sich in Gassen und Seitenstraßen, schnellten die Straße hinauf und hinunter. Wie hineingeschmiedet lagen in ihren sehnigen Fäusten die Colts. Die Pferdehufe rissen Staubfontänen in die noch immer heiße Luft. Die Fahrbahn war wie leer gefegt. Den Bürgern von Conejos saß die Angst wie eine Klammer im Nacken.
In der Bank flog die Tür zum Office des Bankiers auf. Der große, schwergewichtige Mann erschien bleich und mit einer Shotgun bewaffnet im Rechteck. Der Mut der Verzweiflung trieb ihn.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!Verlags geht es hier:
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Erfahre mehr über Bücher aus unserem Verlag:
Bücher von Alfred Bekker
Bücher von Henry Rohmer
Bücher von A.F.Morland
Bücher von Manfred Weinland
Bücher von Hendrik M. Bekker
Bücher von Konrad Carisi
Bücher von Wolf G. Rahn
Bücher von Horst Bieber
Bücher von W.A.Hary
Bücher von G.S.Friebel
Bücher von Theodor Horschelt
Bücher von Pete Hackett
Bücher von Cedric Balmore
Bücher von Bernd Teuber
Bücher von Don Pendleton
Bücher von Freder van Holk
Bücher von Horst Friedrichs
Bücher von Glenn Stirling
Bücher von Horst Weymar Hübner
Bücher von Jo Zybell
Bücher von Joachim Honnef
Bücher von Tomos Forrest
Bücher von Stefan Hensch
IM LAND VON EL TIGRE
von Alfred Bekker
Der Umfang dieses Buchs entspricht 83 Taschenbuchseiten.
Major Reilly reitet über die Grenze nach Mexico - und versucht El Tigre, den ungekrönten König der schlimmsten Banditen, die je das unsichere Grenzland heimgesucht haben, zu stellen.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
1
"Bis jetzt scheint alles ruhig..."
"Das muss nichts heißen, Corporal!"
"Natürlich nicht, Sir..."
Sie ritten an der Spitze einer Kolonne von etwa zwanzig Blauröcken, die den Auftrag hatte, einen Geldtransport zu bewachen.
Auf einem unscheinbaren Kastenwagen befand sich der Monatssold für die Soldaten von Fort Deming, New Mexico - einer kleinen Garnison in der Nähe der mexikanischen Grenze.
Die Räder knarrten über den steinigen, trockenen Boden der Sierra. Die Sonne brannte unbarmherzig vom Himmel. Sie stand jetzt annähernd im Zenit.
Als sie früh am Morgen aufgebrochen waren, war ihnen allen klar gewesen, dass sie am heutigen Tag die schwierigste Etappe ihres Weges vor sich haben würden.
Major Reilly wusste, dass sie sich jetzt im Einflussbereich von El Tigre befanden. Und das machte ihn unruhig.
Reilly studierte aufmerksam den Horizont, sah die Säulen aus flimmernder Luft und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Vor ihnen lag eine zerklüftete Felslandschaft. Reilly kannte sich einigermaßen in der Gegend aus und wusste, dass es keine andere Möglichkeit gab, als durch die langgezogene, schmale Schlucht zu reiten, die die Felsmassive in einer leicht gebogenen Linie durchschnitt.
Früher war diese Schlucht ein Flussbett gewesen, aber daran erinnerte sich kaum noch jemand. Der Fluss war ausgetrocknet und jetzt gab es nur noch Geröll und Staub.
Bevor sie in die Schlucht hineinritten, wandte Major Reilly sich an Wheeler, den Corporal, der neben ihm ritt.
"Weisen Sie die Männer an, ihre Gewehre aus den Sätteln zu nehmen."
"Ja, Sir!"
Sie wechselten einen kurzen Blick.
Corporal Wheeler war klar, was diese Entscheidung seines Vorgesetzten nur bedeuten konnte. Reilly rechnete damit, dass es gefährlich wurde.
Und er hatte allen Grund dazu.
Die Überfälle hatten sich in letzter Zeit gehäuft und sie alle trugen die Handschrift der Bande von El Tigre. Selbst bewaffnete Militäreskorten konnten diese verwegenen Gesetzlosen nicht abschrecken.
Wheeler gab Reillys Anweisung an die Männer weiter. Die Gewehre wurden herausgezogen und durchgeladen. Das Getrappel der Hufe war zu hören und hallte wenig später auch von den Felswänden wider, aber sonst war es still.
Eine gespannte Stille allerdings, der niemand so recht trauen mochte.
Wenn diese Hunde einen Überfall auf diesen Transport geplant haben, dann ist hier der beste Ort dazu!, überlegte Reilly nüchtern. Sie mussten also auf der Hut sein.
Zunächst geschah nichts.
Alles blieb ruhig, während der Zug seinen Weg durch die enge Schlucht fortsetzte. Die Männer schauten misstrauisch hinauf zu den Plateaus auf den schroffen Felsmassiven und den Terrassen, die Wind und Wetter hier und da in den Stein gemeißelt hatten.
Aber da war nichts.
Kein Laut, keine Bewegung.
Nichteinmal eine einsame Wildkatze auf der Jagd.
Sie hatten die Schlucht bereits zu einem Gutteil durchquert, da ging plötzlich Hölle los.
2
Reilly riss sein Pferd zurück, dass sich daraufhin wiehernd auf die Hinterhand stellte. Ein Schwall von Geröll und Steinen brach die Steilwand hinunter. Von überall her kamen die Echos der vom herunterbrechenden Gestein verursachten Geräusche, so dass es im ersten Moment den Anschein hatte, als bräche das Chaos von allen Seiten über die kleine Abteilung herein.
Reilly wusste, dass solche Erdrutsche natürliche Ursachen haben konnten, aber sein Instinkt sagte ihm, dass es diesmal nicht so war.
"Alles kehrt!", rief der Major seinen Männern zu, aber dieser Befehl ging im allgemeinen Getöse unter. Zudem brach nun auch in ihrem Rücken ein Steinhagel los, so dass ihnen gar keine Fluchtmöglichkeit mehr blieb.
Schreie gellten durch die Schlucht und hallten an den Felswänden wider.
Es waren die ersten Todesschreie und ihnen würden noch mehr folgen. Steine zertrümmerten Schädel und Knochen; Pferde spielten verrückt und warfen ihre Reiter ab.
Auch Reilly selbst fand sich im Staub wieder und konnte alles in allem froh sein, sich noch rühren zu können. Er hatte den Army-Revolver aus dem Holster gezogen und blickte sich nach dem bis jetzt unsichtbar gebliebenen Feind um, von dem er wusste, dass er hier irgendwo sein musste...
Und dann - der aufgewirbelte Staub hatte sich kaum gelegt, der Steinhagel war gerade erst verebbt - fielen die ersten Schüsse.
Reilly sah Corporal Wheeler nur wenige Meter von ihm entfernt niedersinken. Eine Kugel hatte ihm den Brustkorb aufgerissen.
Oben auf den Felsplateaus waren Bewegungen zu erkennen. Am Boden liegend und sich herumdrehend legte Reilly an und feuerte.
Schwer zu sagen, ob er jemanden traf.
Es wurde hin und her geschossen und die Echos sorgten für perfekte Verwirrung.
Reilly sah einen nach dem anderen von seinen Männern sterben. Die Schüsse schienen von allen Seiten zu kommen und es war für die Soldaten kaum Deckung vorhanden.
Die Blauröcke feuerten mehr oder weniger ungezielt herum, sich immer wieder umwendend und drehend. Sie waren wie Kaninchen auf freiem Feld... Ein ideales Ziel!
Reilly rappelte sich auf und stürmte in Richtung des Wagens, in dem sich das Geld befand. Einige der Männer hatten versucht, sich dort zu verschanzen.
Zwischendurch stolperte der Major fast über die Leiche eines seiner Untergebenen.
Dann spürte er einen brennenden Schmerz an der linken Schulter, der ihn zusammenzucken ließ.
Eine Kugel hatte ihn erwischt und riss ihn etwas herum.
Taumelnd legte er die letzten Meter bis zum Wagen zurück, ehe er zu Boden strauchelte. Eine weitere Kugel fuhr ihm in den Unterschenkel und ließ ihn laut aufschreien.
"Kommen Sie, Major!"
Das war Edwards, ein junger Offizier, der gerade von West Point gekommen war. Aber das Patent, das er vorweisen konnte, half ihm in einer solchen Lage auch nicht.
Der junge Mann packte den am Boden liegenden Reilly am Arm und zog ihn mit einem kräftigen Ruck unter den Wagen - die einzige Stelle in diesem verfluchten Tal, an dem man ein klein wenig Deckung hatte.
Reilly biss die Zähne zusammen, lud seine Waffe nach und feuerte ein paar Mal. Um seine Wunden konnte er sich nicht kümmern, dazu war einfach keine Zeit.
Edwards war allem Anschein nach unverletzt, obwohl sich an seiner Stirn etwas Blut befand.
Aber das stammte nicht von ihm, sondern von Conrads, dem Kutscher. Der lag auch bei ihnen unter dem Wagen, aber gleich eine der ersten Feuersalven hatten ihn böse zugerichtet.
Unterdessen war er verblutet.
"Es sieht verdammt finster für uns aus, Major", meinte Edwards.
Reilly verzog das Gesicht.
Er hätte so gerne etwas dagegen gesagt, aber der andere hatte unzweifelhaft recht.
"Verkaufen wir uns so teuer wie möglich!", zischte er.
Edwards hatte eine Winchester und mit der holte er zwei Feinde von ihren Stellungen herunter. Wenn die Kugeln sie nicht umbrachten, dann mit Sicherheit der Sturz die Steilwände hinunter.
"Ist das die Bande dieses sagenhaften El Tigre?", fragte Edwards zwischendurch.
Reilly zollte ihm dafür ein heiseres, freudloses Lachen.
"Wer sonst? Wer sonst würde es wagen, sich mit der Armee anzulegen! Und wer sonst wäre so gut bewaffnet!"
"Verdammtes Pack!"
"Kann man wohl sagen, Edwards! Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, dass man die Kerle wahrscheinlich auch diesmal nicht kriegen wird! Sie reiten einfach über die Grenze nach Mexiko!"
3
Es brach über sie herein, wie ein wütender Gewittersturm.
Ein Hagel von Blei ging in ihre Richtung nieder und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich so klein wie möglich zu machen, die Hände vor das Gesicht zu nehmen und zu hoffen, dass sie noch am Leben waren, wenn es vorbei war.
Die Banditen hatten offensichtlich ganz gezielt den Wagen und seine Umgebung unter Feuer genommen, um den letzten Widerstand zu brechen.
Die Kugeln durchsiebten den Wagen förmlich. Das Holz splitterte. Die Schüsse gingen bis in den Boden und wirbelten Staub auf.
Dann ebbte der Hagel ab und als Reilly wieder den Blick zu heben wagte, da sah er ein weit aufgerissenes Augenpaar, dass ihn ungläubig anstarrte.
"Edwards!"
Aber da war nichts mehr zu machen.
Edwards war tot.
Es dauerte nur wenige Augenblicke, da wurde Reillys Aufmerksamkeit von etwas anderem abgelenkt.
Er hörte das Geräusch von herannahenden Pferdehufen.
Mindestens zehn Reiter, so schätzte er. Eher mehr, als weniger.
Sie kamen schnell heran und er konnte ihre Stimmen hören.
Es war ein Gemisch aus Spanisch und Englisch.
"Hey, Burnett! Der Kerl hier lebt noch!"
Dann war ein Schuss zu hören.
"Was soll das, Marquez?" Diese Stimme war rau und befehlsgewohnt. Am Akzent konnte man hören, dass es sich unzweifelhaft um einen Amerikaner handelte.
"Ich möchte nicht erleben, dass irgendwann einmal jemand auf mich zeigt und sagt: Jawohl, der war auch dabei!", rechtfertigte sich jener, der Marquez hieß. In seinem Tonfall lag deutliches Missbehagen darüber, sich von einem Gringo Befehle geben lassen zu müssen!
"Er hätte ohnehin die nächsten zwei Stunden nicht überlebt!", versetzte Burnett kühl.
In Reillys Gehirn arbeitete es.
Wenn diese Kerle auf mich aufmerksam werden und merken, dass ich noch lebe, dann bin ich geliefert!, dachte er.
Er hörte, wie sich einige der Männer aus den Sätteln gleiten ließen.
Dann sah er ihre Stiefel.
Es gab nichts, was er tun konnte, außer abzuwarten und sich tot zu stellen.
Einige der Männer sprangen auf den Wagen.
"Hey, da haben wir einen guten Fang gemacht!", rief jemand.
"Der Boss wird zufrieden sein!"
"Ja, das wird er!", war die Stimme von Burnett zu vernehmen.
"Bei solch einer Beute ist doch wohl ein Zuschlag für jeden von uns drin, was, Burnett?"
Die Antwort war eher zurückhaltend.
"Ich werde mit El Tigre darüber sprechen..."
"Mach das, Burnett! Sollen wir die Pferde auch mitnehmen?"
"Natürlich! Wäre doch schade drum!"
Die Säcke, in denen das Geld war, wurden heruntergenommen und verteilt. Dann zog die Meute so schnell ab, wie sie gekommen war.
4
Als Reilly glaubte, dass die Luft rein war, kroch er unter dem Wagen hervor.
Die Banditen waren auf und davon und ehe auch nur irgendjemand in Fort Deming von dem Überfall erfahren hatte, würden El Tigres Leute über die Grenze nach Mexiko verschwunden sein.
Und dahin konnte ihnen kein Sternträger und schon gar kein Blaurock folgen. Das konnte ernsthafte diplomatische Verwicklungen nach sich ziehen und an denen war gegenwärtig niemand interessiert.
Man wäre auf die Zusammenarbeit mit den mexikanischen Behörden angewiesen gewesen, aber die zeigten sich seltsam passiv, gerade so, als hätten sie gar kein Interesse daran, die Verbrecher zu verfolgen...
Aber im Augenblick hatte Reilly andere Sorgen. Er richtete sich unter unsäglichen Schmerzen auf und drohte kurz darauf wieder zu Boden zu sinken. Er musste sich zunächst am Wagen festhalten.
Der Anblick, der sich ihm bot, war furchtbar.
Der Boden war übersät mit toten Blauröcken, von Steinen erschlagen oder von Kugeln durchsiebt. Pferde lagen mit gebrochen Gliedmaßen in ihrem Blut, manche waren noch am leben und strampelten etwas, über anderen sammelten sich bereits die Fliegen und hoch über der Schlucht kreiste auch schon der erste Geier.
Diese verdammten Hunde!, durchfuhr es Reilly grimmig.
Sie hatten alle Pferde, die noch zu verwenden waren, mitgenommen! Wahrscheinlich würde man sie bald auf den Märkten von San Pedro oder Magdalena wiederfinden können.
Reilly verfluchte sie innerlich, aber es gab nichts, was er im Moment dagegen tun konnte.
Er fühlte sich schwach, so unsäglich schwach...
Die Wunde am Bein würde hinderlich beim Gehen sein, aber eine flüchtige Untersuchung sagte ihm, dass es ein Streifschuss war. Schmerzhaft, aber verhältnismäßig harmlos.
Anders war das mit seiner Schulter...
Ein langer Fußmarsch lag vor ihm.
Schon ein gesunder Mann hätte es kaum lebend bis Fort Deming schaffen können. Für Reilly war die Lage entsprechend aussichtsloser.
Der Major beugte sich nieder und nahm Edwards' Gewehr an sich, das er dann als eine Art notdürftige Krücke benutzte.
Dann lief er über das trostlose Schlachtfeld und suchte nach einer gefüllten Feldflasche.
Er fand eine.
Bevor er dann aufbrach, versorgte er seine Schulter noch mit einem notdürftigen Verband, den er aus dem Hemd eines ermordeten Kameraden fertigte.
Dann humpelte er davon, ohne viel Aussicht, sein Ziel auch zu erreichen. Aber was blieb ihm anderes, als es dennoch zu versuchen?
Er war keiner, der bereit war, sich einfach niederzulegen und aufzugeben.
Er dachte an Wheeler, an Edwards und an all die anderen Männer, die jetzt tot im Staub lagen.
Er hatte für seine Leute die Verantwortung getragen, und jetzt war nichts von ihnen geblieben, als eine Mahlzeit für Geier und Coyoten.
Mit manchen von ihnen - mit Wheeler, dem Corporal zum Beispiel, war er befreundet gewesen.
Diese Teufel hatten ihnen nicht den Hauch einer Chance gelassen!
Es wird Zeit, dass jemand diesem Gesindel endlich das Handwerk legt!, durchfuhr es Reilly. Schritt für Schritt setzte er einen Schritt vor den anderen. Ihm war schwindelig und seine Wunden schmerzten, aber er versuchte, so wenig wie möglich darauf zu achten.
Er musste weiter, immer weiter...
Soweit ihn seine Beine noch trugen.
Er sah sich selbst bereits vor seinem geistigen Auge in den Sand sinken und die Augen endgültig schließen. Aber Reilly versuchte mit aller Kraft, solche Gedanken aus seinem Kopf zu verbannen.
Noch atmete er, noch war ein Rest seiner Kraft in ihm, noch konnte Meter um Meter, Schritt um Schritt hinter sich bringen...
Er verlor das Gefühl für Zeit.
Wie automatisch bewegte er sich vorwärts und bald nahm er kaum noch etwas anderes wahr, als die Beine, die ihn trugen - und seine Wunden.
Er hörte den Wind durch die Felsen pfeifen und das klang in seinen Ohren wie ein gespenstisches Totenlied.
Irgendwann hatte er die langezogene Schlucht hinter sich gelassen, was sich für ihn vor allem dadurch bemerkbar machte, dass es jetzt nirgends mehr Schatten gab.
Er blinzelte.
Vor ihm befand sich eine weite, menschenfeindliche und von der Sonne verbrannte Ödnis. Reilly hielt einen Moment lang an und nahm einen Schluck aus der Feldflasche.
Wie weit mochte das nächste Wasserloch entfernt sein?
Diese Gegend machte den Eindruck, als hätte es hier in den letzten tausend Jahren nicht geregnet. Der Boden war trocken und an vielen Stellen aufgesprungen.
Die wenigen Pflanzen, die sich hier hatten halten können, waren hellbraun.
Säulen aus flimmernder, vibrierender Luft hatten sich in der Ferne aufgerichtet. Irgendwo dahinter kam dann die nächste Bergkette.
Reilly blickte sich kurz um, um sich ein wenig zu orientieren. Er kannte den Weg im Schlaf, aber es würde das erste Mal sein, dass er ihn zu Fuß zurücklegte.
5
Schritt um Schritt legte er wie mechanisch zurück, aber die Berge wollten einfach nicht näherkommen.
Es schien, als käme er kaum vorwärts. Gleichzeitig spürte er, wie ihn die Kräfte verließen.
Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn.
Er hörte sein eigenes, heiseres Keuchen und den Wind.
Sonst war alles still.
Ein Fuß vor den anderen, immer wieder und wieder.
Dann strauchelte er plötzlich. In ihm war nicht mehr genug Kraft, um das Gleichgewicht zu halten. Er fiel hin und schlug hart auf den trockenen, aufgesprungenen Boden.
Einfach liegenbleiben, dachte er. Und die Augen schließen.
Die Versuchung war groß, aber er hatte den festen Willen, nicht aufzugeben.
Einen Augenaufschlag lang geschah gar nichts. Nicht ein Muskel bewegte sich, nicht eine einzige Sehne seines Körpers wurde angespannt.
Wenn ich jetzt nicht bald wieder hochkomme, ist es aus!, durchfuhr es ihm.
Aber es war ihm bei diesem Gedanken nicht so zumute, als würde sich eine eisige Hand auf seine Schulter legen. Ihn fröstelte, aber das lag am Wundfieber, nicht an der Furcht.
Nein, die Wahrheit war, dass es sich um einen ganz nüchternen Gedanken handelte. Fast so, als wäre es gar nicht sein Leben, um das es ging...
Aber wenn er leben wollte, durfte er sich dieser gefährlichen Lethargie nicht hingeben, auch wenn es so naheliegend schien.
Er nahm seine ganze Kraft zusammen, versuchte hochzukommen und brach dann gleich darauf wieder zusammen. Die Winchester, auf die er sich gestützt hatte, knickte ihm weg und fiel in den Staub.
Er atmete tief durch, sammelte neue Kraft und versuchte es noch einmal.
Diesmal hatte er mehr Erfolg. Taumelnd und ein wenig unsicher setzte er seinen Weg fort.
Als es zu dämmern begann, hatte er die Ebene durchquert und die Bergkette erreicht. Sein Orientierungssinn musste trotz allem ganz gut funktioniert haben, denn die Stelle, an der er die Berge schließlich erreichte, war nicht weit vom Pass entfernt, den er nehmen musste.
Er sah zur Sonne, die Horizont versank.
Bald würde sie ihre letzten Strahlen über die Ebene schicken und dann würde es sehr schnell ziemlich dunkel werden.
Und vor allem kalt.
Reilly fror ohnehin schon erbärmlich, obwohl es eigentlich noch warm war. Er fror und gleichzeitig schwitzte er. Das Wundfieber war schlimmer geworden.
Es würde eine schlimme Nacht werden, ganz gleich, ob er sich dazu entschloss, weiter zu marschieren, oder ob er sich etwas Schlaf gönnte.
Zunächst schleppte er sich weiter.
Wenn er sich jetzt niederlegte, wusste er nicht, ob oder in welchem Zustand er am Morgen erwachen würde. Jeder Meter, den er heute noch zurücklegen konnte, wollte er hinter sich bringen.
Als die Dämmerung jedoch soweit fortgeschritten war, dass die Orientierung schwierig wurde, entschloss er sich doch widerstrebend dazu, sich einen Platz zum kampieren zu suchen.
In seinem Zustand konnte er es sich einfach nicht leisten, auch nur eine halbe Meile in die falsche Richtung zu laufen.
Er suchte also ein paar vertrocknete Sträucher zusammen und zündete sie an. Das ganze ergab ein notdürftiges Lagerfeuer.
Burnett...
Marquez...
Diese Namen kamen ihm jetzt wieder in den Sinn. Und auch die Stimmen, die dazu gehörten.
Er würde sie nicht vergessen.
Niemals.
Ihre Gesichter hatte er nicht gesehen, aber wenn es ihm gelang, dies hier zu überleben und er dann eines Tages einem dieser Halunken gegenüberstehen würde, dann würde er ihn an der Stimme wiedererkennen!
Reilly war sich in dieser Beziehung vollkommen sicher. Die Stimmen dieser beiden Männer hatten sich unlöschbar in sein Bewusstsein gebrannt.
Reilly legte sich auf den Boden. Dabei ließ er die Winchester immer in Reichweite. Dann fiel er in einen unruhigen, dumpfen Schlaf.
6
Es war die Kälte, die ihn am nächsten Morgen weckte. Eine Kälte, die alles zu durchdringen schien. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, vielleicht noch eine Stunde, dann würde sie sich über den Horizont schieben.
Es war vielleicht nicht schlecht, die Morgenkühle zum Marschieren zu nutzen.
Er richtete sich mühsam auf und warf einen kurzen Blick auf das Feuer. Es war längst niedergebrannt. Reilly setzte seinen Weg fort, während es langsam heller wurde.
Schritt um Schritt setzte er vorwärts, während die Zeit verstrich. Ein paar Stunden rannen dahin, ehe er den Pass erreicht hatte.
Dann brannte die Sonne wieder unbarmherzig auf ihn hernieder.
Noch ein Schluck aus der Wasserflasche, dann warf er das leere Gefäß weg.
Hier würde er nirgends Aussicht haben, Wasser zu finden.
Hier gab es nur Staub, Felsen und Ödnis.
Wie lange kann man unter diesen Bedingungen überleben?, dachte er.
Es war fruchtlos, näher darüber nachzudenken. Bereits jetzt, nur kurze Zeit, nachdem er den letzten Schluck genommen hatte, fühlte sich seine Kehle bereits wieder staubtrocken an.
Er spürte seine Beine kaum, wie sie einen Fuß vor den anderen setzten. Aber er hörte den Wind sein grausames Lied durch die Felsen pfeifen.
Für einen kurzen Moment wunderte es Reilly geradezu, dass sich noch kein Geier eingefunden hatte.
Mehr und mehr wurde Reilly von Schwindelgefühlen ergriffen.
Schließlich kam er taumelnd zu Boden. Noch einmal spannte er seine Muskeln und Sehnen, um wieder hochzukommen, aber vergeblich. Er konnte den Staub mit den Lippen spüren.
Er wollte nicht aufgeben, wollte sich noch geschlagen geben, obwohl es keine Aussicht auf Überleben mehr für ihn gab.
Aber er hatte einfach keine Kraft mehr.
Das ist es also!, dachte er. Das Ende...
Vor seinen Augen begann sich alles zu drehen.
Gnädige Dunkelheit senkte sich über ihn. Und dann war da gar nichts mehr. Nur noch namenlose Schwärze - und Stille.
7
Es war, als würde er aus einer unvorstellbaren Tiefe wieder auftauchen, hinauf, an die Oberfläche.
Das Licht schien unsagbar grell zu sein und tat in den Augen weh.
Bevor er die Augen öffnete, zögerte er etwas. Dann blinzelte er und hörte Stimmen.
"Wir hatten Sie schon fast aufgegeben, Major Reilly! Aber jetzt sind Sie über den Berg!"
Reilly kannte die Stimme. Sie gehörte Loudon, dem Doc von Fort Deming. Er blickte in die ruhigen, dunklen Augen des Arztes und schluckte.
"Sagen Sie am besten nichts, Reilly! Sie haben einiges mitgemacht und müssen immer noch mit Ihren Kräften haushalten!"
Reilly bemerkte, dass er in einem Bett lag. Es war heller Tag, aber er hatte keine Ahnung welcher. Sein Zeitgefühl war völlig durcheinander.
"Wie...?"
Es war kaum ein Krächzen, was da über seine Lippen kam. Und es klang für Reillys eigene Ohren regelrecht erbärmlich. Er wollte sich aufsetzen, aber der Doc drückte ihn mit sanfter Gewalt zurück auf sein Lager.
"Als der Geldtransport überfällig war, hat der Colonel einen Suchtrupp losgeschickt. Der hat Sie dann gefunden. Es ist erstaunlich, dass Sie es in Ihrem Zustand bis zum Pass geschafft haben..."
"Diese Hunde!", keuchte Reilly. Seine Stimme klang jetzt schon besser, so fand er.
"Es war die Bande von El Tigre, nicht wahr?"
"Ja!"
"Ach, übrigens... Wenn Sie wieder etwas besser beieinander sind, dann will der Colonel mit Ihnen sprechen."
Reilly grunzte etwas, aber das war nicht zu verstehen.
Dann, nach einer kurzen Pause, erkundigte er sich: "Wissen Sie, was er will?"
Der Doc lachte heiser.
"Na, was wohl? Das kann man sich doch an zwei Fingern abzählen!" Er zuckte mit den Schultern. "Ich schätze, dass er Ihnen einen Orden an Ihre Heldenbrust heften wird! Besondere Tapferkeit oder soetwas!"
Pah!, dachte Reilly sarkastisch. Ein Orden machte keinen der Männer wieder lebendig, die unter seinem Kommando gestanden hatten!
Dann schlief er wieder ein.
8
Als er das nächste Mal erwachte, ging es ihm schon wesentlich besser.
Er spürte noch seine Schulter, aber der Verband, den der Doc angelegt hatte, war gut. Von der Wunde am Bein merkte er nur noch etwas, wenn er aufzutreten versuchte.
Ein paar Stunden später stand er frisch gewaschen und in einer neuen Uniform im Dienstzimmer von Colonel Devereaux.
Der Colonel war ein großer, grauhaariger Mann mit einem buschigen Schnurrbart und ruhigen, dunklen Augen, die Reilly wohlwollend musterten.
Er war der Kommandant von Fort Deming stand aufrecht hinter seinem Schreibtisch.
Rechts von ihm befand sich Owens, sein Adjutant, der sich ebenfalls erhoben hatte.
"Nun, wie geht es Ihnen, Major?", fragte Devereaux. Reilly versuchte Haltung anzunehmen, aber der Colonel winkte ab.
"Lassen Sie das, Reilly! Setzen Sie sich!"
"Ich danke Ihnen, Colonel!"
"Es tut mir leid, dass ich Sie nicht länger schonen konnte", erklärte Devereaux.
"Mir geht es gut", unterbrach Reilly. "Ich bin schon fast wieder richtig auf dem Damm!"
Devereaux lächelte nachsichtig.
"Ich weiß, dass Sie ein harter Brocken sind, der einiges einstecken kann, Major. Aber in diesem Fall überschätzen Sie Ihre Kräfte wahrscheinlich... Nun, wie dem auch sei... Der erste Grund dafür, dass ich Sie habe zu mir rufen lassen, ist diese Medaille hier!" Er deutete auf den Tisch und Reilly bemerkte den Orden, der dort bereitlag. "Mit solchen Dingen kann man natürlich auch warten, aber mit der anderen Sache geht das nicht. Wir müssen von Ihnen alles über den Überfall wissen. Alles, jede Kleinigkeit! Waren es El Tigres Leute?"
"Ja. Zwei von der Meute erwähnten diesen Namen."
Der Colonel nickte und sein Gesicht verdüsterte sich ein wenig.
"Das deckt sich mit dem, was Lieutenant McQuade und die Männer des Suchtrupps berichtet haben!", meldete sich Owens zu Wort. "Dieser Überfall trägt eindeutig die Handschrift dieses Teufels!"
"Wir hatten von Anfang an keine Chance", berichtete Reilly an den Colonel gewandt. "Sie waren in der Übermacht und hatten sich einen verdammt guten Ort ausgesucht, um uns zu überwältigen." Dann berichtete der Major, wie es ihm gelungen war, zu überleben. "Diese Leute scheinen es am liebsten zu haben, wenn es keinerlei Zeugen gibt, Colonel! Einer von den Männern lebte noch, als sie herankamen. Sie haben ihn einfach erschossen!"
Reilly hatte unwillkürlich die Hand zur Faust geballt.
"Ich verstehe, was Sie empfinden, Major. Aber mir sind die Hände gebunden." Er machte eine hilflose Geste. "Ich kann meine Soldaten nicht einfach über die Grenze nach Mexiko schicken! Das würde die schlimmsten diplomatischen Verwicklungen nach sich ziehen. Und die Mexikaner scheinen kein allzugroßes Interesse daran zu haben, diesen El Tigre zur Strecke zu bringen... Vielleicht hat er sogar den Provinzkommandanten bestochen, wer will das schon ausschließen?"
"Schlechte Aussichten also", brummte Reilly missmutig. "Aber es kann doch nicht so bleiben, wie es ist! Diese Hunde kommen über die Grenze, überfallen hier Banken, Geldtransporte, Postkutschen und alles, was sonst noch lohnend erscheint verschwinden dann wieder und kommen ungeschoren davon!"
"Wir müssten sie hier, aus amerikanischem Boden stellen. Aber sie sind zu schnell und zu viele. Ich habe einfach nicht genug Leute, um überall präsent zu sein. Tut mir Leid, Reilly, aber ich denke, dieser El Tigre wird uns noch eine Weile nach Belieben zum halten können - selbst wenn es Ihnen und mir nicht gefällt!"
Reilly zog die Augenbrauen hoch.
"El Tigre...", murmelte der Major. "Das ist spanisch und heißt 'der Tiger'."
"Richtig", bestätigte Devereaux. "Passt zu ihm, nicht wahr?"
"Aber das wird doch nicht sein wirklicher Name sein! Wer steckt hinter dieser Bezeichnung? Was wissen Sie über diesen Mann?"
"Nicht viel. Angeblich soll er Amerikaner sein und auf einem Gut, irgendwo südlich von Magdalena sein ergaunertes Geld genießen..."
"Das ist nicht gerade viel, was Sie wissen!"
"Es ist schwer, jemanden zu finden, der bereit wäre, Näheres über ihn preiszugeben. Ihm gehört praktisch die ganze Provinz und wer dort längere Zeit am Leben bleiben will, der muss sich gut mit ihm stellen."
Der Colonel nahm eine Zigarrenkiste hervor, nahm sich eine und bot auch Reilly eine an. "Brasil...", sagte Devereaux.
"Wird Ihnen schmecken!"
Reilly nahm sich eine und steckte sie in die Brusttasche seiner Uniform-Jacke. Er würde sie später genießen, jetzt hatte er dafür keinen Sinn.
"El Tigre scheint aber seinerseits hervorragend informiert zu sein", meinte der Major dann, nicht ohne einen scharfen Unterton in der Stimme. "Er wusste genau, welchen Weg der Geldtransport nehmen würde, wann er erfolgen würde und vermutlich war diesen Halunken auch klar, wie groß die Begleitmannschaft sein würde... Riecht das nicht förmlich nach Verrat, Colonel?"
Devereaux steckte sich die Brasil in den Mund, holte ein Streichholz hervor und riss es an der Stiefelsohle an. Wenige Augenblicke später blies er Reilly dicken Zigarrenrauch entgegen.
"Sie wissen, wie hoch der Sold unserer Leute ist", erklärte er dann gedehnt und Reilly nickte.
"Natürlich."
"Es kostet El Tigre nicht allzuviel, jemanden zu bestechen, selbst Offiziere nicht, oder Stadt-Sheriffs. Von den mexikanischen Amtsträgern mal ganz zu schweigen, die sind auf solcherart Nebeneinkünfte geradezu angewiesen, wenn sie ihre Familien durchbringen wollen..." Dann deutete der Colonel auf den Orden. "Kommen wir zum erfreulichen Teil!"
Keine halbe Minute später hatte Reilly das glitzernde Ding an der Brust hängen, dazu einen warmen Händedruck des Fort-Kommandanten und ein aufmunternd gemeintes 'Weiter so!'
Und dann waren da noch diese unbeholfen wirkenden Lobeshymnen auf seine - Reillys - Tapferkeit und Mut.
Hätte er sich sparen können!, dachte der Major. Er fühlte sich ganz und gar nicht wie ein Held, sondern eher wie das Gegenteil. Die Männer, für die er die Verantwortung getragen hatte, waren jetzt tot und nichts und niemand würde sie je wieder zum Leben erwecken können. Nicht das Geklimper eines Ordens und nicht das 'Weiter so!' des Colonels!
"Lassen Sie's gut sein, Colonel", murmelte er, als Devereaux sich erneut räusperte und damit unzweifelhaft ankündigte, dass er noch etwas hinzuzusetzen gedachte.
Dann, nach kurzer Pause, meinte er: "Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Bande das Handwerk gelegt wird! Das sind wir denen schuldig, die von ihnen kaltblütig umgelegt wurden!"
Colonel Devereaux runzelte die Stirn.
"Wir haben über die Schwierigkeiten gerade doch schon gesprochen. Aber bitte, wenn Sie einen Vorschlag hätten, der durchführbar ist... Nichts wäre mir lieber, als diese Halunken endlich ihrer gerechten Strafe zuführen zu können!"
"Man müsste diesen El Tigre selbst in die Finger bekommen. Dann bricht dieser ganze Haufen auseinander, davon bin ich überzeugt. Sein Geld ist es, was alles zusammenhält. Er ist der Kopf und wenn wir den haben, dann wird sich der Rest schnell von selbst auflösen."
"Mag schon sein, aber das ist leichter gesagt, als getan, Major!" Der Colonel nahm einen kräftigen Zug von seiner Zigarre und blies dann langsam und genussvoll den Rauch hinaus. Schließlich fuhr er fort: "Sie können schließlich nicht einfach mit einem Trupp Soldaten über die Grenze reiten und den Kerl einfach mitnehmen! Und dass er freiwillig kommt, dass glauben Sie doch wohl auch nicht!"
Reilly wirkte nachdenklich.
Dann murmelte er: "Ein ganzer Trupp Blauröcke, das geht nicht... Aber ein einzelner Mann, in Zivil, der hätte eine Chance!"
"Er hätte die Chance jung zu sterben, Reilly, und sonst gar nichts!"
"Das käme auf den Mann an... Colonel, ich habe schon andere Spezialaufträge ausgeführt!"
Devereauxs Mund ging auf und er vergaß für eine ganze Weile, ihn wieder zu schließen.
"So ist das also", brummte er. "Jetzt ist die Katze endlich aus dem Sack! Sie wollen also selbst die Sache in die Hand nehmen!"
"Jawohl, Sir. Ich bin es meinen toten Kameraden schuldig!"
"Kommt nicht in Frage, Reilly!"
"Vielleicht würde es mir gelingen, mich bei der Bande einzuschleichen..."
"Ich kann die Verantwortung nicht übernehmen, Major!"
"Das brauchen Sie auch nicht. Geben Sie mir einfach ausreichend Sonderurlaub."
9
In den folgenden Tagen besserte sich Reillys Zustand zusehends. Doc Loudon verstand sein Handwerk wie kein Zweiter.
Ein paarmal noch sprach er mit dem Colonel über seine Pläne.
"Sie sind ein gottverdammter Dickkopf, Reilly!", schimpfte Devereaux dann einmal bei einer solchen Gelegenheit.
Reilly lachte nur.
"Da mögen Sie recht haben."
"Wie es scheint, gibt es nichts und niemanden, der Sie von Ihrem Vorhaben abhalten kann, was, Major?"
"Richtig."
"Ich könnte Sie versetzen lassen, wissen Sie das?"
"Natürlich. Ich kenne die Dienstvorschriften."
"Wenn Sie tatsächlich nach Mexiko reiten, dann können Sie mich in Teufels Küche bringen, Reilly!"
"Nein, das glaube ich nicht. Sie können jederzeit behaupten, ich hätte auf eigene Faust und ohne jeglichen Befehl gehandelt. Aber wenn ich erfolgreich bin, dann wird der Lorbeer auch Ihnen gelten, Colonel..."
"Ach, was! Darum geht es doch eigentlich nicht!"
Sie wechselten einen nachdenklichen Blick und schließlich meinte Devereaux: "Wissen Sie, was? Sie bekommen Ihren Sonderurlaub! Und was Sie damit machen, ist Ihre Privatsache! Ich weiß also offiziell von nichts!"
"Gut."
"Wann brechen Sie auf?"
"Vielleicht noch eine Woche. Dann bin ich spätestens wieder ganz der Alte!"
"Warten Sie besser noch etwas länger, Reilly! Sie werden jeden noch so kleinen Teil Ihrer Kraft sicher bitter nötig haben, wenn Sie sich erst einmal im Land von El Tigre befinden!"
10
Donovan!, dachte Reilly. Das ist ein passender Name, ein Name, der zu einem Satteltramp paßt. Gewöhnlich genug, um nicht mehr Aufsehen zu erregen, als unbedingt notwendig, aber doch nicht so gewöhnlich, dass jeder ihn von vorn herein für falsch hielt.
Donovan, so würde er sich nächster Zeit nennen.
Früh am Morgen war er in Richtung mexikanischer Grenze aufgebrochen. Vor ihm lag karges Hochland, soweit das Auge reichte.
Die Sonne stand fast im Zenit.
Er ritt in südlicher Richtung und wenn er seinen Weg fortsetzte, musste er bald San Elviro erreichen, das letzte Nest vor der Grenze.
Von dem Major Reilly, den er noch vor ein paar Stunden dargestellt hatte, war nicht viel geblieben. Er hatte seine Uniform in Fort Deming gelassen und trug jetzt die Sachen eines einfachen Cowboys.
Den hellen Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen, um sich vor der Sonne zu schützen. Und um die Hüften trug er ein gewöhnliches, ledernes Revolverholster.
Reilly war fest entschlossen, El Tigre über die Grenze zu holen und ihn dem Gesetz zu überantworten.
Es war ihm klar, dass das nicht einfach werden würde. Er hatte alles andere, als einen gemütlichen Spaziergang vor sich.
Aber andererseits hatte dieser Bandenchef lange genug die Gegend beherrscht. Es wurde Zeit, dass jemand kam und für Ordnung sorgte.
Außerdem war Reilly keiner, der sich von irgendwelchen Unannehmlichkeiten leicht abschrecken ließ.
Er lenkte sein Pferd über das öde, lebensfeindliche Land und in seinem Inneren hörte er wieder jene Stimmen, die er nicht mehr vergessen konnte.
Und diese Stimmen hatten auch Namen.
Burnett und Marquez.
Vielleicht würde er ihnen irgendwann während seiner Mission über den Weg laufen und sie zur Rechenschaft ziehen können, wer konnte das schon ausschließen?
Schließlich hielten sie sich vermutlich - so wie die ganze Bande - irgendwo im Grenzgebiet auf.
11
San Elviro war mehr oder weniger nichts weiter als ein dahingeworfener Pulk von schmucklosen Häusern und Hütten.
Dabei war deutlich der Unterschied zwischen den hellen Lehmhütten der Latinos und den Holzhäusern der anglo-amerikanischen Siedler zu sehen.
Es gab nicht einmal so etwas wie eine Straße in diesem Nest.
Jeder baute mehr oder weniger wild, so wie es ihm passte.
Ein verschlafenes Loch und alles andere, als der Nabel der Welt. Aber heute schien San Elviro in heller Aufregung zu sein.
Reilly hatte es sofort gespürt, als er die ersten Hütten passiert hatte.
Allein schon die Tatsache, dass sich um diese Tageszeit so viele Menschen im Freien befanden, war bemerkenswert.
Gewöhnlich war es so, dass jeder, der die Gelegenheit dazu hatte, den Schatten suchte und Siesta hielt.
Aber an diesem Tag war nichts wie sonst.
Reilly hörte aufgeregte Stimmen von Männern, Frauen und Kindern. Er hörte spanische Zungen ebenso wie englische.
Und dann, als er die Plaza von San Elviro erreichte, sah er es selbst: Vor der Bank lag ein Mann im Staub, um ihn herum eine Gruppe von Menschen.
Der Mann am Boden schien eine Kugel abbekommen zu haben.
Es sah nicht gut für ihn aus.
Reilly ritt heran und stieg vom Pferd
"Was ist geschehen?", erkundigte er sich bei einem der umstehenden Leute.
"Was geschehen ist?" Der Mann war ziemlich außer sich, das nackte Entsetzen stand ihm im Gesicht geschrieben. "Diese Hunde haben die Bank überfallen und dabei den Sheriff erschossen!"
"Und zwei Bankangestellte!", ergänzte jemand anderes.
"Es war eine ganze Horde. Zehn oder zwölf Mann! Verdammt, die sind auf Nummer sicher gegangen!"
Die Leute waren ziemlich erregt. Und dafür gab es gute, verständliche Gründe.
"Meine ganzen Ersparnisse waren auf dieser gottverdammten Band! 34 Dollar! Wer zahlt mir die nun zurück, Amigo?"
"Würde mich nicht wundern, wenn das die Bande von diesem El Tigre war!"
"Diese Hunde! Diese verdammten Hunde!"
"Warum legt keiner diesen Kerlen endlich das Handwerk? Die treiben doch schon weiß Gott lange genug ihr Unwesen hier in der Gegend!"
Reilly blickte auf den am Boden liegenden Sheriff, der noch ein heiseres Röcheln ausstieß. Dann drehte er den Kopf zur Seite und war tot.
"Stellt ein Aufgebot zusammen, Männer!", rief jemand.
"Ach, die sind doch längst in Mexiko!", kam eine heisere Antwort, in der viel Mutlosigkeit mitschwang.
"Verdammt, es ist immer dasselbe! Sie verschwinden über die Grenze und dann niemand mehr etwas tun!"
"Sollen wir denn einfach dastehen und nichts tun?"
"Welche Chance haben wir denn, uns gegen diese Teufel zur Wehr zu setzen? Sie sind in der Übermacht, sie sind hervorragend bewaffnet und haben einen sicheren Unterschlupf!"
Diese Schufte hinterlassen eine blutige Spur!, dachte Reilly grimmig.
Er war fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass diese Spur so bald wie möglich ihr Ende fand.
Reilly wandte sich ab.
Hier gab es nichts, was er tun konnte.
12
Die Grenze war hier nicht viel mehr, als ein Strich auf der Landkarte, für den es in der Wirklichkeit keine Entsprechung gab.
Kein Grenzstein, keine Markierung sagte einem, auf welcher Seite dieser unsichtbaren Linie man sich befand, die sich irgendwo mitten durch diese karge Ebene zog.
Aber wenn man San Pedro erreicht hatte, dann wusste man, dass man sich eindeutig auf mexikanischem Gebiet befand.
Reilly erreichte San Pedro am späten Nachmittag.
Er sah die kleine Ansammlung von hellen Häusern und ein paar heruntergekommenen Bars, in denen sich Viehtreiber von diesseits und jenseits der Grenze Tequila und Whisky einflößten.
Als Reilly zwischen den ersten Lehmhütten daherritt, umringte ihn bald ein Pulk von schmuddeligen Kindern.
"Dinero, Mister! Dinero!"
Reilly warf ihnen ein paar Cents hin, um sie loszuwerden.
Dann lenkte er sein Pferd in Richtung einer Bar. Sie trug keinen Namen, war aber um einiges größer, als die zwei, drei anderen, die es außerdem noch am Ort gab.
Vielleicht würde er sogar ein Zimmer bekommen.
Er machte sein Pferd an einem Stützpfeiler der Veranda fest. Es standen schon ein ein paar Reittiere da, Pferde ebenso wie Esel und Mulis. Schon am Sattelzeug konnte man erkennen, dass diese Tiere nicht etwa besonders wohlhabenden Leuten gehörten.
Manche der Tiere hatten nicht mehr, als eine Decke auf dem Rücken.
Reilly ließ den Blick ein wenig umherschweifen und fühlte sich auf einmal beobachtet.
An einer Hausecke standen zwei Männer in schneeweißen Baumwollhemden und -hosen und riesigen Sombreros auf dem Kopf. Die beiden unterzogen den fremden Gringo einer eingehenden Musterung.
Vielleicht taxieren sie ab, ob es sich lohnt, mir meine Sachen abzunehmen!, überlegte Reilly nüchtern. Der Major sah sehr wohl die Gier, mit der die Männer seine Sachen betrachteten.
Sicherheitshalber nahm er die Satteltaschen vom Rücken seines Pferdes und legte sie sich über die Schulter. Auch die Winchester, die noch im Sattelschuh steckte, nahm er an sich.
Dann wandte er sich in Richtung der Bar und passierte wenige Augenblicke später die quietschenden, ungeölten Schwingtüren.
Reilly brauchte eine Sekunde, um sich an das Halbdunkel zu gewöhnen, das hier herrschte. Dann bemerkte er, dass sich alle Blicke auf ihn konzentrierten.
Alles Latinos, kein einziger Gringo. Reilly sah es schon an den großen Sombrero-Hüten.
Sie sahen ihn an, als wäre er eine Heiligenerscheinung.
Die Gespräche waren abrupt abgerissen, niemand sagte jetzt ein Wort.
Reilly schritt langsam zur Theke, behielt die Winchester in der Linken und schlug mit der flachen Rechten auf den Tisch, so dass der dicke Barkeeper mit dem gezwirbelten Schnurrbart fast etwas zusammenzuckte.
"Einen Whiskey!"
Der Keeper nickte.
"Si, Senor! Sofort!"
Ein Glas wurde auf den verkratzten Schanktisch gestellt und aufgefüllt. Reilly führte es zum Mund und leerte es in einem kräftigen Zug. Seine Kehle war wie ausgedörrt.
"Como se llama, Senor?"
Einer von den Männern war aufgestanden und hatte sich neben Reilly an die Theke gestellt.
Reilly sah mit den Augenwinkeln das Doppelholster, das sein Gegenüber um die Hüften trug. Es war schwer abzuschätzen, ob er wirklich beidhändig schießen konnte.
"Sie reden besser Englisch mit mir, Mister. Mein Spanisch ist nicht besonders...", murmelte der Major, ohne sich vollends umzuwenden.
"Also gut, Senor! Wie heißen Sie?"
"Donovan."
Der Mexikaner runzelte die Stirn.
Er schien dem Braten nicht so recht zu trauen. Reilly musste aufpassen. Er hatte eine Aufgabe vor sich. Irgendwelchen kleinen Händeln und anderem Ärger würde er am besten so gut es ging aus dem Weg gehen.
"Donovan? Wirklich Donovan?"
"Ja." Reilly versuchte gleichgültig zu wirken und zuckte mit den Schultern. "Aber wenn Sie das besser wissen..."
"Woher kommen Sie?"
Jetzt wurde Reilly endgültig zu bunt.
"Sie fragen mir ein bisschen zuviel, Mister!"
Einen Augenblick lang glaubte Reilly, es würde ernste Schwierigkeiten geben, aber dann zog der Mann ab und verschwand durch die Schwingtüren.
Reilly war sich nicht im klaren darüber, was er von diesem Vorfall zu halten hatte. Jedenfalls hoffte er, dass die Sache ausgestanden sei, aber da sollte er sich getäuscht haben.
Er wandte sich an den Keeper.
"Haben Sie auch Zimmer?"
"Si, Senor."
"Ich möchte heute Nacht hier bleiben."
"No problemo, Senor."
"Und wie steht es mit etwas zu Essen? Ich bin den ganzen Tag geritten und hungrig wie ein Bär!"
"Meine Frau macht ausgezeichnete Tortillas!"
Reilly verzog den Mund.
"Naja", brummte er. "Meinetwegen..."
13
Die Männer in der Bar hatten sich bald wieder ihren Gesprächen zugewandt. Ein Mann, der Tortillas isst, ist auf die Dauer eben doch nicht so sonderlich interessant, selbst wenn es sich um einen Gringo handelt.
Reilly hatte gerade zu Ende gegessen, da sah er vier schwerbewaffnete Kerle durch die Schwingtüren treten. Sie wurden von jenem Mann angeführt, der ihn soeben nach dem Namen gefragt hatte.
"Hey, Gringo, ist das der Mann?", fragte er, aber das war nicht an Reilly gerichtet, sondern an einen der anderen Männer, offensichtlich ebenfalls Amerikaner.
Reilly erstarrte, als er das Gesicht erkannte.
Einen Moment lang hatte es gedauert, denn der Mann steckte jetzt in Zivil. Aber es konnte keinen Zweifel geben. Es handelte sich um Owens, den Adjutanten von Colonel Devereaux!
"Ja", erklärte Owens kalt lächelnd. "Das ist er!"
Diese Ratte!, dachte Reilly. Wie es schien lag die Sache klar auf der Hand: Owens stand im Sold von El Tigre. Und da er bei der Besprechung mit dem Colonel zugegen gewesen war, wusste die Bande jetzt, dass jemand unterwegs war, um ihrem Boss das Handwerk zu legen!
Reilly fluchte innerlich.
Seine Mission stand nicht gerade unter einem guten Stern!
Im Gehirn des Majors arbeitete es fieberhaft.
Ein Blick in die Gesichter dieser Männer genügte, um ihm zu sagen, dass es jetzt ernst wurde.
Reilly hatte die Winchester in Reichweite auf den Schanktisch gelegt, daneben die Satteltaschen. Aber es war ihm klar, dass es in dieser Lage wenig Sinn machte, nach dem Gewehr zu greifen.
Seine Gegenüber würden sofort schießen, noch ehe er seine Finger an der Waffe hatte.
Blieb ihm nur der Revolver.
Er war ein relativ guter Schnellschütze, aber er wusste nicht, wie es um die Fähigkeiten seiner Gegenüber auf diesem Gebiet bestellt war.
Langsam drehte Reilly sich herum.
"Es überrascht mich, Sie hier anzutreffen, Owens!", zischte er.
Owens zuckte mit den Schultern.
"Ich für mein Teil wusste, dass Sie irgendwann auftauchen würden..."
"Natürlich..."
Reillys Hand glitt zur Hüfte und berührte nun den Revolvergriff. Von seinen Gegenübern trug einer ein Gewehr im Anschlag. Den würde er sich zuerst vornehmen müssen, denn der konnte sofort feuern.
Die anderen trugen Revolver, die erst aus den Holstern gezogen werden mussten.
"Sie werden verstehen, dass wir Sie nicht gut am leben lassen können, Reilly!", meinte Owens.
"Was gibt Ihnen El Tigre für Ihre Dienste, Owens?"
Owens verzog höhnisch den Mund.
"Kann Ihnen doch gleichgültig sein!"
14
Für einen Augenblick hing alles in der Schwebe. Muskeln und Sehnen spannten sich. Reilly musterte die Gesichter seiner Gegner und fragte sich, wer von ihnen wohl zuerst ziehen würde.
Der Barkeeper verzog sich unterdessen klammheimlich durch eine Hintertür. Einige der anwesenden Zecher wichen etwas zur Seite.
Dann ging es los.
Reilly warf sich augenblicklich zur Seite, während dort, wo er vor einem Sekundenbruchteil noch gestanden hatte, bereits ein Hagel von Bleikugeln fast gleichzeitig in den Schanktisch fuhr.
Löcher wurden in das Holz gerissen, aber es waren weder die ersten, noch würden es die letzten sein.
Noch im Fallen feuerte Reilly auf den Mann mit dem Gewehr und streckte ihn nieder. Ein kleines rundes Loch hatte sich auf seiner Stirn gebildet. Die Kugel, die ihm in den Kopf gefahren war, riss ihn nach hinten und ließ ihn mit ausgestreckten Armen und Beinen durch die Schwingtüren taumeln.
Am Boden liegend drehte Reilly sich blitzschnell herum.
Links und rechts von ihm schlugen die Kugeln seiner Gegner ein.
Sein nächster Schuss traf Owens, den Verräter, der gerade noch einmal auf den Major angelegt hatte.
Zwar spannte er noch den Hahn, aber dann versagten dem Adjutanten des Colonels die Finger den Dienst. Es löste sich kein Schuss und er sackte in sich zusammen.
Die letzten beiden Schergen ballerten noch eifrig in Reillys Richtung.
Aber sie waren lausige Schützen.
Reilly rappelte sich hoch und war mit einem eleganten Sprung hinter dem Schanktisch, den er nun als Deckung verwenden konnte. Die Revolverkugeln der beiden Kerle ließen die Flaschen in den Regalen splittern.
Reilly duckte sich.
Ein Regen aus Tequila, Whisky und Glasscherben ging über ihn nieder.
Dann wagte er sich wieder kurz hervor und brachte einen wohlgezielten Schuss an, der einen der beiden außer Gefecht setzte.
Den anderen - es war der Mann mit dem Doppelholster, der Reilly nach dem Namen gefragt hatte - hatte offensichtlich das Entsetzen gepackt.
Er ballerte noch ein paarmal mehr oder weniger schlecht gezielt in Reillys Richtung und stürzte dann durch die Schwingtüren hinaus.
Reilly sandte ihm eine Kugel hinterher, aber die ging in den Türrahmen, wo sie einen Holzsplitter herausriss. Der Mann war weg und die Zecher, die sich hinter ihren Tischen verschanzt hatten blickten nun mit einer Mischung aus Furcht und Ehrfurcht in Reillys Richtung.
Sie warteten ab, was der Gringo als nächstes tun würde.
Draußen waren schnelle Schritte zu hören, dann das Wiehern eines Pferdes.
Reilly sprang erneut über den Schanktisch, wobei er sich mit der linken auf der verkratzen Holzfläche aufstützte. Sein Colt war leergeschossen, also steckte er ihn zurück ins Holster und nahm die Winchester von der Theke, die sich noch immer dort befand, wo er sie hingelegt hatte.
Er lud die Waffe mit einer energischen Bewegung durch.
Dann lief er an den Männern vorbei zu den Schwingtüren.
Als er sie passiert hatte und draußen, vor der Bar stand sah den Mann mit dem Doppelholster auf einem Apfelschimmel davonpreschen.
Sein erster Impuls war, sein eigenes Pferd zu besteigen, und ihm nachzujagen. Aber sein Gaul hatte den ganzen Tag über seinen Dienst getan und war nun entsprechend müde.
Zudem wurde es dunkel und dieser Kerl kannte die Gegend sicherlich besser als er.
Die Wahrscheinlichkeit, ihn noch einzuholen, war also entsprechend gering, und so legte Reilly den Gewehrlauf über die Schulter und wandte sich zurück zu den Schwingtüren der Bar.
Jetzt weiß El Tigre also Bescheid!, dachte er grimmig. Wenn er es nicht schon zuvor gewusst hatte, und diese vier Halunken direkt in seinem Auftrag hier auf ihn gewartet hatten, dann würde dieser Kerl jetzt nichts Dringenderes zu tun haben, als auf kürzestem Wege zu seinem Boss zu reiten.
Owens hatten sie gebraucht, um ihn zu identifizieren, aber das konnte der soeben geflüchtete Mexikaner von jetzt an ebenso gut...
Reilly wusste, dass er sich auf weitere, ähnliche Zwischenfälle gefasst machen musste. Er befand sich im Land von El Tigre und jeder konnte hier insgeheim auf der Lohnliste dieses Bandenchefs stehen...
Er musste auf der Hut sein.
Als er wieder in das Halbdunkel der Bar trat, war der Keeper unterdessen wieder aufgetaucht. Er wedelte mit den Armen herum und schien ziemlich aufgeregt zu sein.
"Dios! Wer bezahlt mir das, Gringo?", fauchte er Reilly an, als er vor dem Scherbenhaufen seines Spirituosenvorrats stand.
Reilly legte sich die Satteltaschen wieder über die Schulter.
"Schicken Sie die Rechnung an El Tigre!", meinte er.
Der Barkeeper erbleichte sichtlich bei der Nennung dieses Namens und schluckte.
15
Reilly verbrachte eine ruhige, angenehme Nacht in San Pedro.
Einen Mietstall gab es in diesem Nest nicht und so stellte er seinen Gaul in den Stall des Barbesitzers, der ihm dafür ein paar Pesos extra berechnete.
Der Barkeeper hieß Paco und war von äußerst redseliger Natur. Aber wenn man ihn nach El Tigre fragte oder einem Gringo namens Burnett, dann wurde er schnell stumm und schwieg wie ein Grab.
Das Zimmer, das Reilly bekam, war verwanzt und zu dem Schloss an der Tür konnte man auch nicht allzuviel Vertrauen haben.
Aber die Auswahl in San Pedro war nicht eben groß und so nahm er es. Und dieses Zimmer war alles in allem immer noch besser, als die Nacht unter freiem Himmel in der Sierra zu verbringen.
Den Revolver hatte er allerdings immer in Griffweite, die ganze Nacht über. Sein Schlaf war leicht. Er war sich ziemlich sicher, dass er es rechtzeitig bemerken würde, wenn sich jemand die Treppe hinauf bis zur Tür seines Zimmers schleichen würde...
Die Sonne war kaum aufgegangen, da war er bereits wieder hellwach, packte seine Sachen und ließ sich dann von Paco ein karges Frühstück machen.
Er verzog den Mund, als er den stark gerösteten Kaffee in sich hineinschlürfte.
"Sie wissen, wer dieser El Tigre ist, nicht wahr, Paco?"
Reilly sagte es, als wäre es eine Beiläufigkeit. Zwischen zwei Schluck Kaffee.
Aber dem Mexikaner schien das nicht recht zu sein, obgleich sie allein waren und nicht anzunehmen war, dass jemand ihr Gespräch belauschte.
"Senor, Sie sollten nicht dauernd diesen Namen in den Mund nehmen!"
"Warum nicht?"
"Das ist nicht gut. Und wenn Sie es nicht lassen können, dann tun Sie es bitte nicht in meinem Haus!"
"Pah!"
"Ich habe Frau und Kinder, Senor!"
"Wissen Sie den wirklichen Namen von El Tigre?"
"Nein."
"Ist er tatsächlich ein Americano?"
"Si, Senor! Ein Gringo! Aber ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen! Und ich weiß auch nicht, wie sein wirklicher Name ist!"
"Sie lügen, Paco."
"Und wenn schon! Ich möchte nicht eines morgens mit durchschnittener Kehle am Straßenrand liegen, so wie es anderen ergangen ist, die ihre Klappe nicht halten konnten oder den Anordnungen von El Tigre nicht gefolgt sind..."
"Ich verstehe..."
Aber Paco schüttelte energisch den Kopf.
"No, Senor! Das glaube ich nicht! Ich glaube nicht, dass Sie wirklich verstanden haben!"
Reilly runzelte die Stirn und zog dann nachdenklich die Augenbrauen in die Höhe.
"Was soll das heißen?"
"Senor, ich weiß nicht, in welchen Händel Sie mit El Tigre verwickelt sind, oder was Sie sonst von ihm wollen. Und ich will es auch gar nicht wissen, denn wer weiß, ob mich das nicht eines Tages das Leben kosten kann. Aber ich sage Ihnen eines: Sie haben sich den Falschen ausgesucht, Senor! An El Tigre haben sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen!"
Reilly erhob sich von seinem Frühstück, legte dem Barkeeper ein paar Münzen hin und zuckte dann mit den Schultern.
"Ich bin nicht übermäßig ängstlich, Mister..."
"Vielleicht sollten Sie sich das in diesem Fall aber angewöhnen, Senor! Vorausgesetzt, Sie wollen noch etwas älter werden!"
Reilly verzog das Gesicht.
Dann nahm er seine Sachen und ging hinaus, in den Stall, sattelte sein Pferd, legte die Satteltaschen über den Rücken des Tieres und steckte die Winchester in das Futteral.
Als er dann losreiten wollte und bereits im Sattel saß, tauchte Paco noch einmal auf.
"Adios, Amigo", meinte Reilly kurz, aber der Barkeeper schien noch etwas von ihm zu wollen.
"Senor..."
"Was ist?"
Er sprach leise und ängstlich.
"Sie haben gestern nach einem Gringo gefragt."
"Ja?"
"Burnett, nicht wahr?"
"Richtig."
"Es ist noch keine drei Tage her, da hat ein Americano mit diesem Namen genau auf dem Platz gesessen, auf dem Sie heute morgen gefrühstückt haben!"
Es versetzte Reilly einen Stich in der Magengegend. Alles in ihm krampfte sich zusammen. In seinem Innern hörte er erneut diese Stimme...
"Ein übler Kerl...", drangen wieder Pacos Worte an sein Ohr.
Reillys Verstand arbeitete wieder glasklar.
"Kommt er öfter nach San Pedro?"
"Nein, nicht oft."
"Was wissen Sie noch über ihn?"
"Nicht viel. Er arbeitet für El Tigre, aber das wissen Sie vermutlich selbst."
"Und wo kann man ihn antreffen?"
"Reiten Sie nach Magdalena. Dort ist die Wahrscheinlichkeit wohl am größten." Er machte eine bedauernde Geste. "Wie gesagt: Nach San Pedro kommt er nicht allzu oft, Senor."
Reilly sah auf Paco herab und bedachte ihn mit einem nachdenklichen, misstrauischen Blick, der den Mexikaner nach ein paar Sekunden zu beunruhigen begann.
"Sie glauben mir nicht?"
"Ich weiß nicht, Paco!"
Er zuckte mit den Schultern.
"Es ist Ihre Sache, ob Sie mir glauben. Ich weiß nicht, weshalb Sie hinter diesem Burnett her sind, aber was auch immer Sie mit Ihm vorhaben: Ich habe nichts dagegen!"
"Warum erzählen Sie mir das jetzt? Woher der plötzliche Mut?"
Pacos Gesicht wurde bitter. Reilly bemerkte, wie der Barkeeper die Hände unwillkürlich die Hände zu Fäusten ballte.
"Dieser Kerl hat sich einmal an meiner Tochter vergriffen!", erklärte er dann fast tonlos. "Wie gesagt, er ist ein mieser Kerl und ich hätte nichts dagegen, ihn ans Messer zu liefern!"
Tränen des Zorns waren jetzt in die dunklen Augen des Mexikaners getreten und er wischte sie hastig fort.
Reilly nickte.
Die Gefühle dieses Mannes schienen echt zu sein und so konnte er davon ausgehen, dass die Geschichte stimmte.
Jedenfalls stand sein weiterer Weg jetzt fest. Er würde nach Magdalena reiten und sich dort etwas umhören. Vielleicht hatte er Glück und traf auf diesen Burnett, der ihn vielleicht zu El Tigre selbst führen konnte.
Vielleicht aber brauchte er auch gar nicht besonders zu suchen und die Schergen kamen von selbst hervor, um ihn - Reilly - unter die Erde zu bringen!
Er musste mit dieser Möglichkeit rechnen, aber er war bereit. Leichtes Spiel würden sie nicht mit ihm haben!
16
Ein paar Stunden waren vergangen, seit Reilly San Pedro verlassen hatte. Der Major kannte den Weg nur ungefähr. In Fort Deming hatte er vor seinem Aufbruch das vorhandene Kartenmaterial eingehend studiert und so wusste er einigermaßen, wie er reiten musste, um nach Magdalena zu kommen.
Die urwüchsige, steinige Landschaft, die sich vor ihm ausbreitete, musste Gott im Zorn geschaffen haben. Bizarre Felsmassive ragten schroff in den Himmel.
Dieses zerklüftete Hochland glich einer Art steinernem Labyrinth und war wie geschaffen für Leute, die sich - vor wem auch immer - versteckt halten wollten.
Ein paar Indianerhorden lebten hier, die man anderswo vertrieben hatte. Ein Weißer konnte hier auf sich allein gestellt nicht lange über die Runden kommen.
Reilly nahm zwischendurch kurz den Hut vom Kopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Aufmerksam musterte er immer wieder die Umgegend, aber bisher hatte er nie etwas entdecken können.
Seit seinem Aufbruch von San Pedro war er noch nicht einem einzigen Menschen begegnet. Und das war gut so, denn jedem, den er hier antraf, würde er misstrauen müssen.
Reilly orientierte sich am Stand der Sonne.
Besondere Eile hatte er nicht, nach Magdalena zu gelangen.
El Tigres Leute würden ihn dort so oder so erwarten. Sie konnten ihn aus ihrer Sicht der Dinge einfach nicht davonkommen lassen.
Es war nicht anzunehmen, dass sie ihm davonliefen.
Zudem wollte er Kräfte sparen - seine und die seines Pferdes. Schließlich konnte niemand vorhersagen, ob er sie nicht noch dringend brauchen würde.
Eine weitere Stunde war dahingegangen und die Sonne stand mittlerweile bereits recht hoch. Die heißeste Zeit des Tages kündigte sich an und Reilly überlegte schon, ob es nicht am besten wäre, irgendwo nach Schatten zu suchen und erst am späteren Nachmittag weiterzureiten.
Aber dann nahm er auf einem etwas entfernteren Felsplateau eine kaum merkliche Bewegung war und das ließ ihn seinen Entschluss augenblicklich revidieren.
Reilly kniff die Augen zusammen und blinzelte, während er die Gegend mit dem Blick nach allen Seiten absuchte. Schwer zu sagen, ob alles nur Einbildung war, oder ob sich dort wirklich etwas bewegt hatte.
Vielleicht ein Tier...
Wenn, dann musste es beträchtliche Größe gehabt haben, sonst wäre es auf diese Entfernung nicht zu sehen gewesen. Coyoten konnten nicht so hoch klettern, schieden also aus.
Und sonst?
Es wimmelte in dieser lebensfeindlichen Umgebung nicht gerade von großen Tieren...
Reilly lenkte sein Pferd vorsichtig weiter, die Rechte jetzt in der Nähe des Revolvers.
Er wurde das untrügliche Gefühl nicht los, dass er beobachtet wurde. er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen und dennoch sehr auf der Hut zu sein.
Vielleicht waren es herumstreunende Indianer, durch deren Jagdgründe er kam und die ihn nur etwas im Auge behalten wollten.
Aber ebenso gut konnte es sich El Tigres Meute handeln, die ihn gleich hier und jetzt, an einem Ort, an dem es keine Zeugen und keine Hilfe gab, umlegen wollten.
Ein gut gezielter Schuss...
Kein Hahn würde ihm nachkrähen. Sie brauchten ihn nicht einmal verscharren, das würde der nächste Sandsturm schon erledigen.
Da!
Jetzt war Reilly sich sicher. Das waren weder Tiere noch Indianer, denn beide verstanden sich besser auf das Anschleichen und Beobachten.
Das mussten Weiße sein, vermutlich sogar eine ganze Anzahl, denn es hatte sich an mehreren Stellen gleichzeitig bewegt.
Reilly überlegte, was er tun konnte.
Er zügelte sein Pferd.
Gerade noch rechtzeitig war ihm klargeworden, was hier gespielt wurde.
Dann donnerten die ersten Schüsse in seine Richtung und er riss das Tier brutal herum. Dann hing er seitlich im Sattel und benutzte sein Pferd auf diese Weise als Deckung.
Aus fünf oder sechs Winchester-Gewehren wurde auf ihn geballert, während Reilly seitwärts davonpreschte.
Auf Grund der ziemlichen Entfernung ging das Blei zumeist in den Sand oder ins Leere. Aber die Schützen hatten nicht länger warten können, denn in dem Moment, als Reilly sein Pferd gezügelt hatte, musste ihnen klar sein, dass der Major etwas bemerkt hatte.
Wenige Augenblicke später befand Reilly sich in einer engen, langgestreckten Schlucht. Er hetzte seinen Gaul voran, ohne zu wissen, ob es auch einen Ausgang gab.
Dann stoppte er ziemlich abrupt und wandte sich um.
Die Meute war noch nicht zu sehen, aber sie würde jeden Moment um die Ecke biegen. Reilly zog die Winchester aus dem Sattelschuh, riss das Wurfseil vom Sattelknauf, sprang aus dem Sattel und scheuchte sein Pferd davon.
Dann kletterte er einen steilen geröllhaltigen Hang hinauf, an dem ein paar braune Büsche klebten, die ihm vielleicht etwas Sichtschutz bieten konnten. Kaum fünf Meter kam er hinauf, dann war Schluss. Er hatte ein kleines Plateau erreicht von wo aus es keinen weiteren Aufstieg mehr gab. Von hier aus gingen die Felswände steil und schroff gen Himmel.
Dann vernahm Reilly Geräusche von galoppierenden Pferden, die über den trockenen Boden stampften.
17
Sie waren sieben Mann, alle bis auf die Zähne bewaffnet. El Tigre hatte sie hier her, in diese Einöde geschickt, um den fremden Gringo auszuschalten, der aufgetaucht war, um den ungekrönten Herrscher dieser Provinz herauszufordern.
Ein Blaurock war er, aber die Army würde ihm hier nicht helfen können. Hier konnte dem Major niemand helfen...
"Wir hätten ihn gleich mit dem ersten Schuss erwischen müssen!", meinte einer der Männer ärgerlich. "Wenn er uns jetzt durch die Lappen geht, dann ziehe ich euch eigenhändig das Fell über die Ohren!"
Er hatte ein hartes, sonnenverbranntes Gesicht, trug den Namen Coolidge und war für seine Männer in diesem Augenblick mindestens ebenso furchterregend, wie jener Mann, dem sie nachjagten.
"Verdammt, Ihr hättet ihn näher herankommen lassen müssen! Dann wäre das eine todsichere Angelegenheit gewesen!"
"Er hatte etwas bemerkt!", verteidigte sich einer der Männer, ein Mexikaner mit zwei Revolverholstern. "Wir konnten nicht länger warten!"
Sie zügelten ihre Pferde. Coolidge ließ den Blick umherschweifen. Nirgends etwas zu sehen. Irgendwo in der Ferne konnte man Pferdehufe hören.
"Aber du bist dir sicher, dass es der Richtige war, ja, Lopez?"
"Si, Amigo! Ich habe ihm schließlich in Pacos Bar gegenübergestanden! Dios! Er hat drei von uns über den Haufen geknallt! Mit dem ist nicht zu spaßen!"
In diesem Moment sah Coolidge die Spuren im Sand.
"Dorthin, Männer!"
18
Reilly sah aus seinem Versteck, wie seine Verfolger die schmale Schlucht entlangritten. Ihre Pferde schienen unterschiedlich schnell zu sein, jedenfalls kamen sie nicht in einer geschlossenen Kolonne, sondern einzeln oder in Zweiergruppen.
Allen voran ritt Coolidge, dann kam Lopez mit beträchtlichem Abstand. Keiner von ihnen blickte zurück zu den Gefährten. Ihre Aufmerksamkeit war nach vorn gerichtet, dorthin, wo sie den Major vermuteten.
Das Getrappel von Reillys Pferd war nicht mehr zu hören, aber sie sahen die Spuren seiner Hufe und hetzten ihnen nach.
Sie wusste nicht, dass sie einem Phantom nachjagten, das nicht mehr war, als ein reiterloser Gaul.
Einen Moment lang war Reilly sich unschlüssig darüber, ob er den Plan, den er hatte, auch verwirklichen konnte.
Die ersten zwei von der Meute waren bereits hinter der nächsten Biegung verschwunden, da kam der nächste herangeritten. Und dann noch einer und noch einer.
Für Reilly war es entscheidend zu wissen, wie viele es waren. Sechs Mann? Sieben? Er konnte es nur schätzen und er musste sich auf diese Schätzung verlassen.
Reilly zählte bis sieben.
Die Nummer sieben war ein gutes Stück zurückgefallen, die Vorreiter waren bereits außer Sicht.
Der Major hörte den Mann herankommen; dann, wenige Augenblicke später, sah er ihn auch. Es war ein schwarzbärtiger Mexikaner. Der Sombrero hing ihm auf dem Rücken und in der Rechten hielt er ein Gewehr.
Reilly beschloss, sein Glück herauszufordern.
Es schien wie eine einmalige Chance, aber es konnte sich auch als ein verhängnisvoller Fehler entpuppen, wenn jetzt noch einer dieser Banditen auftauchte...
Reilly ließ seine Winchester zu Boden gleiten und nahm sein Lasso mit beiden Händen.
Der Mexikaner preschte genau in diesem Moment an ihm vorbei, aber dann erfasste ihn urplötzlich ein kräftiger Ruck.
Reillys Lassoschlinge hatte sich um die Schultern des Mannes gelegt und riss ihn aus dem Sattel, so dass er sich wenige Sekundenbruchteile später auf der Erde wiederfand.
Das Pferd stieg wiehernd auf die Hinterhand, denn sein Reiter hatte zunächst vergebens versucht, sich am Sattel festzuklammern. Für einen Moment drohte es zu straucheln. Es lief noch ein paar Schritte und blieb dann stehen.
Währenddessen versuchte der Mexikaner, sich aufzurappeln.
Er fluchte furchtbar und schien im ersten Moment kaum fassen zu können, was geschehen war.
Sein Gewehr lag irgendwo im Staub und so wollte er zum Revolver greifen.
Die rechte glitt zur Hüfte, berührte den Griff der Waffe, ließ sie dann aber doch stecken. Der Mexikaner stand wie erstarrt da und blickte direkt in die Mündung von Reillys Winchester, der sich plötzlich hinter den Sträuchern erhoben hatte.
Der Major lud seine Waffe mit einer energischen Bewegung durch.
"Keine Bewegung, Hombre!", zischte er. Der Mexikaner wusste, dass er keine Chance hatte, wenn er doch noch zu schießen versuchte.
Ohne, dass Reilly das ausdrücklich gefordert hatte, hob er daher die Hände.
"Nicht schießen, Senor!"
"Was würdest du mit mir tun, wenn die Sache andersherum stände, Amigo?"
Der Mexikaner erbleichte.
Aber Reilly hatte keineswegs vor, ihn einfach über den Haufen zu schießen.
Er war kein Killer.
Wenn er jemanden tötete, dann nur, wenn es keine andere Möglichkeit gab.
"Revolvergurt abschnallen!", befahl Reilly knapp und sein Gegenüber beeilte sich, dem nachzukommen.
Reilly kam den Hang hinunter, sammelte den Revolver und das Gewehr des Mexikaners auf. Er sah die Anspannung auf Seiten seines Gegenübers.