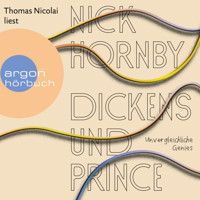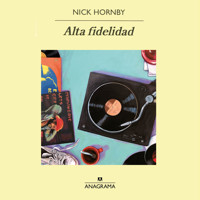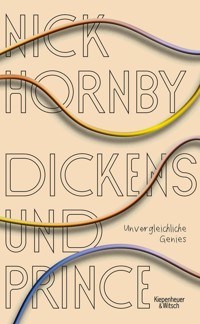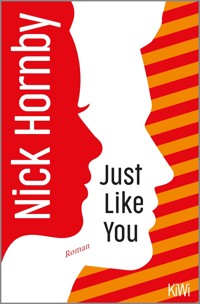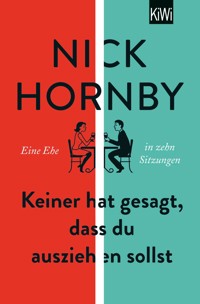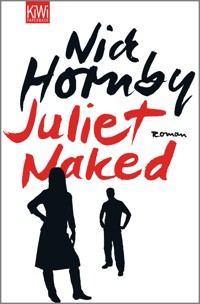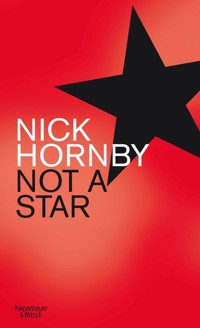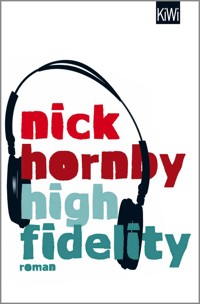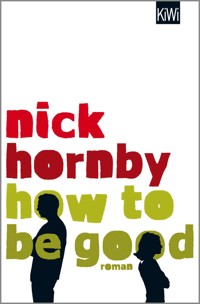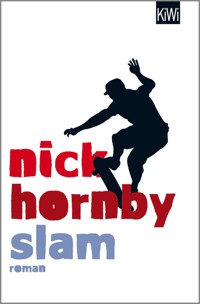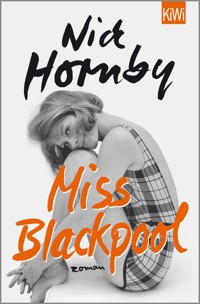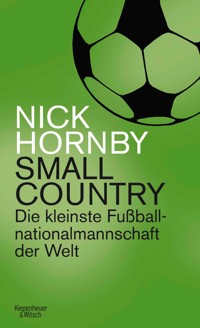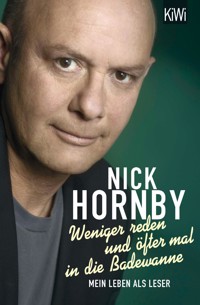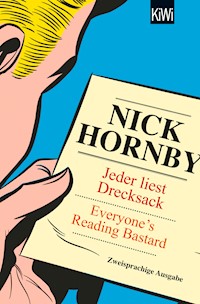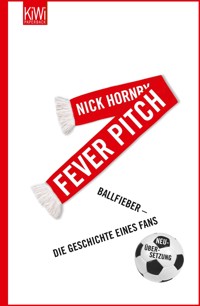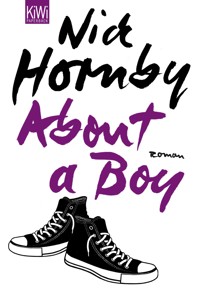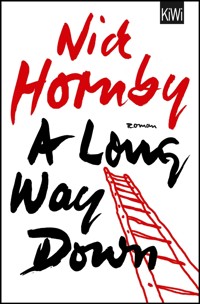
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Komisch, rasant und mit viel schwarzem Humor Vier Menschen auf dem Dach eines Londoner Hochhauses, die sich an Silvester das Leben nehmen wollen, schließen einen Pakt: neuer gemeinsamer Selbstmord-Termin ist der Valentinstag. Es bleiben sechs Wochen, die gemeinsam überlebt werden müssen... Silvester, auf dem Dach eines Hochhauses: Pech, dass gleich vier Menschen auf die Idee gekommen sind, sich dort das Leben zu nehmen. Da man sich schlecht umbringen kann, wenn einem andere dabei zusehen, steigt die seltsame Gruppe erst mal vom Dach, um das Problem der jüngsten Kandidatin, die nicht weiß, warum ihr Freund sie verlassen hat, zu lösen. Nach und nach erzählen sie sich ihre Geschichten. Da ist die altjüngferliche Maureen, deren Sohn Matty schwerstbehindert ist und die diese Belastung allein tragen muss, da ist Martin, der berühmte Talkmaster, den nach einem Gefängnisaufenthalt niemand mehr auf dem Bildschirm sehen will, Jess, die aufmüpfige Tochter eines Politikers, ist so direkt, dass sie alle vor den Kopf stößt, und JJ, der von seinem besten Freund, dem Sänger seiner Band, im Stich gelassen wurde. Die vier verabreden, mit dem finalen Sprung bis zum Valentinstag zu warten – und so findet eine Gruppe von Menschen zueinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die einander doch auf wundersame Weise zu helfen wissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelVorwortTEIL 1TEIL 2TEIL 3BuchAutorÜbersetzerImpressumVorwort
»Das Beste gegen Unglücklichsein ist Glücklichsein, und es ist mir egal, was die anderen sagen.« – Elizabeth McCracken, »Niagara Falls All Over Again«
TEIL 1
MARTIN
Ob ich erklären kann, warum ich von einem Hochhaus springen wollte? Selbstverständlich kann ich erklären, warum ich von einem Hochhaus springen wollte. Ich bin ja kein Vollidiot. Ich kann es erklären, weil es nicht unerklärlich ist: Es war eine logische Entscheidung, das Ergebnis reiflichen Nachdenkens. Wenn auch wieder nicht allzu ernsthaften Nachdenkens. Damit meine ich nicht, dass es eine reine Schnapsidee war – das soll bloß heißen, es war nicht so schrecklich kompliziert, dass ich lange hin und her überlegen musste. Sagen wir es mal so: Angenommen, Sie sind, tja, ich weiß nicht, stellvertretender Filialleiter einer Bank in Guildford. Sie haben mit dem Gedanken gespielt auszuwandern, und da bekommen Sie das Angebot, eine Filiale in Sydney zu leiten. Tja, auch wenn es eine klare Sache ist, müssen Sie sich das doch nochmal durch den Kopf gehen lassen, oder? Sich zumindest überlegen, ob Sie sich einen Umzug zumuten sollen, ob Sie Ihre Freunde und Arbeitskollegen missen möchten, ob Sie Ehefrau und Kinder aus ihrem vertrauten Umfeld reißen können. Vielleicht setzen Sie sich vor ein Blatt Papier und machen eine Liste mit den Pros und Contras. Sie wissen schon:
Contra – betagte Eltern, Freunde, Golfklub.
Pros – mehr Geld, höherer Lebensstandard (Haus mit Pool, Grillmöglichkeit etc.), das Meer, Sonne, keine linken Stadträte, die »Zehn kleine Negerlein« verbieten, keineEU-Richtlinien, die britische Wurst verbieten etc.
Da gibt’s nicht viel zu überlegen, oder? Der Golfklub! Dass ich nicht lache. Wegen der betagten Eltern geht man natürlich einen Moment in sich, mehr aber auch nicht – einen und zudem nur einen kurzen Moment. Sie würden in weniger als zehn Minuten das Reisebüro anrufen.
Nun, so ging es mir. Es gab einfach nicht genügend Contras, aber dafür jede Menge guter Gründe zu springen. Das Einzige auf meiner Contra-Liste waren die Kinder, doch ich konnte mir ohnehin nicht vorstellen, dass Cindy mir je wieder erlauben würde, sie zu sehen. Ich habe keine alten Eltern und ich spiele auch nicht Golf. Selbstmord war mein Sydney. Ohne den rechtschaffenen Bürgern von Sydney zu nahe treten zu wollen, natürlich.
MAUREEN
Ich habe ihm gesagt, ich ginge zu einer Silvesterparty. Im Oktober habe ich es ihm gesagt. Ich weiß nicht, ob Leute im Oktober schon Einladungen zu Silvesterpartys verschicken. Wohl eher nicht. (Woher sollte ich das wissen? Ich bin seit 1984 auf keiner mehr gewesen. Bei June und Brian von gegenüber war eine, kurz bevor sie wegzogen. Und selbst da bin ich nur für ein Stündchen rübergegangen, nachdem er eingeschlafen war.) Aber ich konnte es nicht länger für mich behalten. Es ging mir seit Mai oder Juni durch den Kopf, und ich brannte darauf, es ihm zu erzählen. Eigentlich blöd. Er versteht mich nicht, da bin ich sicher. Sie sagen mir, ich soll auch weiter mit ihm sprechen, aber man sieht, dass nichts zu ihm durchdringt. Und was war es schon, das ich nicht erwarten konnte! Aber daran sieht man, wie oft ich mich auf etwas freuen konnte, nicht?
Kaum hatte ich es ihm gesagt, wäre ich am liebsten direkt zur Beichte gegangen. Ich hatte schließlich gelogen, nicht? Ich hatte meinen eigenen Sohn belogen. Oh, es war nur eine kleine, dumme Lüge: Ich erzählte ihm Monate im Voraus, dass ich auf eine Party gehen würde, eine Party, die ich mir ausgedacht hatte. Und zwar in allen Einzelheiten. Ich habe ihm erzählt, wessen Party es war, warum ich eingeladen war, warum ich hingehen wollte und wer sonst noch kommen würde. (Die Party war bei Brigid, Brigid aus der Kirche. Und ich war eingeladen, weil ihre Schwester aus Cork zu Besuch kam und ihre Schwester sich in einigen Briefen nach mir erkundigt hatte. Und ich wollte hingehen, weil Brigids Schwester mit ihrer Schwiegermutter in Lourdes gewesen war und ich alles darüber in Erfahrung bringen wollte, weil ich dort mit Matty auch eines Tages hin wollte.) Aber Beichten war unmöglich, weil ich wusste, dass ich bis zum Ende des Jahres bei dieser Sünde, dieser Lüge würde bleiben müssen. Nicht nur Matty gegenüber, sondern auch gegenüber den Leuten im Pflegeheim, und … Na ja, sonst gab es da eigentlich niemanden. Vielleicht jemanden aus der Kirche oder einem Geschäft. Es ist schon fast komisch, wenn man darüber nachdenkt. Wenn man Tag und Nacht damit verbringt, sich um ein krankes Kind zu kümmern, hat man kaum Zeit zu sündigen – ich habe seit ewigen Zeiten nichts getan, das zu beichten sich gelohnt hätte. Und dann geht es nahtlos mit einer so schlimmen Sünde weiter, dass ich es nicht einmal dem Pfarrer sagen konnte, weil ich nun weiterlügen musste bis zum Tag meines Todes, an dem ich die größte aller Sünden begehen würde. (Und warum ist es die größte aller Sünden? Dein ganzes Leben lang wird dir gesagt, dass du an einen wunderbaren Ort kommst, wenn du abtrittst. Und ausgerechnet das, was du tun kannst, um die Sache zu beschleunigen, ist das, wonach du auf keinen Fall mehr dort hinkommst. Ja, ich sehe ein, man drängt sich irgendwie vor. Aber wenn sich jemand am Postschalter vordrängt, murren die Leute nur. Oder sie sagen, »Entschuldigen Sie, aber ich war zuerst hier.« Sie sagen nicht, »Sie werden für alle Ewigkeit in der Hölle schmoren.« Das wäre ein bisschen stark.) Es konnte mich nicht davon abhalten, weiterhin zur Kirche zu gehen. Aber ich bin nur weiter hingegangen, weil die Leute sonst gemerkt hätten, dass etwas nicht stimmte.
Während der Termin näher und näher rückte, gab ich ihm weitere Informationen, die ich angeblich aufgeschnappt hatte. Jeden Sonntag tat ich so, als hätte ich etwas Neues in Erfahrung gebracht, denn sonntags traf ich immer Brigid. »Brigid sagt, es würde auch getanzt.« »Brigid hat Angst, dass Wein und Bier alleine nicht ausreichen, deswegen besorgt sie auch härtere Sachen.« »Brigid weiß nicht, wie viele Leute vorher schon gegessen haben werden.« Wenn Matty in der Lage gewesen wäre, irgendetwas zu verstehen, wäre er zu dem Schluss gekommen, dass diese Brigid eine Irre ist, sich wegen einem kleinen Umtrunk so anzustellen. Ich wurde jedes Mal rot, wenn ich sie in der Kirche sah. Und ich hätte natürlich gerne gewusst, was sie Silvester nun tatsächlich plante, habe aber nie gefragt. Wenn sie tatsächlich eine Party geplant hätte, hätte sie sich dann womöglich verpflichtet gefühlt, mich einzuladen.
So im Nachhinein schäme ich mich. Nicht wegen der Lügen – ans Lügen habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Nein, ich schäme mich dafür, wie erbärmlich das alles war. An einem Sonntag ertappte ich mich dabei, dass ich Matty erzählte, wo Brigid den Schinken für die Sandwiches kaufen wollte. Aber Silvester stand mir vor Augen, natürlich tat es das, und dies war eine Art, darüber zu reden, ohne eigentlich etwas darüber zu sagen. Und ich denke, ich glaubte mit der Zeit selbst ein bisschen an diese Party, so in der Art, wie man an die Geschichte in einem Buch glaubt. Ab und zu stellte ich mir vor, was ich anziehen würde, wie viel ich trinken und wann ich gehen würde. Ob ich mit dem Taxi nach Hause fahren würde. Solche Dinge eben. Zum Schluss kam es mir vor, als wäre ich wirklich dort gewesen. Aber selbst in meiner Phantasie konnte ich mir nicht vorstellen, wie ich mit irgendwem auf der Party redete. Ich war immer ganz froh, wieder gehen zu können.
JESS
Ich war bei einer Party eins tiefer in der besetzten Wohnung. Die Party war beschissen, alles nur uralte Crusties, die auf dem Boden rumsaßen, Cider tranken, riesige Joints qualmten und sich so schrägen, abgedrehten Reggae anhörten. Punkt Mitternacht klatschte einer von denen sarkastisch, ein paar andere lachten, und das war es auch schon – Frohes Neues Jahr. Man hätte als glücklichster Mensch von ganz London zu dieser Party kommen können und hätte fünf Minuten nach zwölf auch vom Dach springen wollen. Und ich war keineswegs der glücklichste Mensch in ganz London. Versteht sich wohl von selbst.
Ich bin nur da hingegangen, weil jemand im College gesagt hatte, Chas wäre dort, war er aber nicht. Ich hab zum milliardsten Mal sein Handy angerufen, aber es war ausgeschaltet. Als wir uns gerade getrennt hatten, hat er mich als Stalker bezeichnet, aber das ist wohl eher so ein Reizwort, Stalker, oder? Ich glaube nicht, dass man von Stalking sprechen kann, wenn es nur um Anrufe, Briefe, E-Mails und An-die-Tür-klopfen geht. Und ich bin nur zweimal bei ihm auf der Arbeit aufgetaucht. Dreimal, wenn man seine Weihnachtsfeier mitzählt, was ich nicht tue, denn dahin wollte er mich sowieso mitnehmen. »Stalking« ist doch wohl, wenn man Leute beim Einkaufen oder in den Urlaub und so verfolgt, oder? Na also, ich bin nie in die Nähe von irgendeinem Geschäft gekommen. Und überhaupt kann es wohl kaum Stalking sein, wenn einem jemand eine Erklärung schuldet. Wenn einem jemand eine Erklärung schuldet, ist das so, als würde er einem Geld schulden, und ich rede nicht bloß von einem Fünfer. Eher so fünf- oder sechshundert Pfund, Minimum. Wenn einem irgendwer mindestens fünf- oder sechshundert Pfund schuldet und dieser Mensch einem aus dem Weg geht, muss man ja spätabends an seine Tür klopfen, weil man weiß, dass er dann zu Hause ist. Bei solchen Summen hört der Spaß auf. Andere wenden sich da an Geldeintreiber und brechen den Leuten die Beine, aber so weit bin ich nie gegangen. Ich hab mich bewundernswert zurückgehalten.
Also, obwohl ich gleich sah, dass er nicht auf dieser Party war, bin ich noch etwas geblieben. Wo sollte ich auch sonst hin? Ich tat mir selber Leid. Wie kann man achtzehn sein und nicht wissen, wo man Silvester hin soll, abgesehen von einer Scheißparty in einer besetzten Scheißwohnung, wo man keinen kennt? Na ja, ich hab’s hingekriegt. Irgendwie krieg ich das jedes Jahr hin. Ich finde zwar schnell neue Freunde, aber irgendwann sind sie dann total genervt von mir, so viel weiß ich selber, auch wenn mir nicht klar ist, wieso. Und damit verschwinden die Leute und die Partys wieder.
Jen war total genervt von mir, so viel ist sicher. Sie ist verschwunden, genau wie alle anderen.
MARTIN
In den letzten paar Monaten hab ich mir im Internet immer wieder gerichtliche Untersuchungen von Selbstmorden rausgesucht, nur so aus Neugier. Im Bericht des Coroners steht fast immer dasselbe: »Man geht von einer Kurzschlusshandlung aus.« Und dann liest man die Geschichte von dem armen Schwein: Seine Frau schlief mit seinem besten Freund, er hatte seinen Arbeitsplatz verloren, seine Tochter war einige Monate zuvor bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen … Hallo, Mr. Coroner? Jemand zu Hause? Tut mir Leid, aber ich kann da keine Kurzschlusshandlung erkennen, guter Mann. Ich würde sagen, er ist zum richtigen Schluss gekommen. Es kommt schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis man es nicht mehr ertragen kann, und dann geht’s mit dem Familien-Kombi und einem Stück Gummischlauch ab ins nächste Parkhaus. Das ist ja wohl nur recht und billig. Da sollte doch im Bericht des Coroners stehen: »Nach reiflicher und nüchterner Bestandsaufnahme setzte er seinem gründlich verpfuschten Leben ein Ende.«
Nicht ein einziges Mal habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, der mich davon überzeugt hätte, dass der Verblichene nicht richtig tickte. Sie wissen schon: »Der Stürmer von Manchester United, verlobt mit der derzeitigen Miss Schweden, landete kürzlich einen einzigartigen Doppeltreffer: Er ist der einzige Mann, der jemals in ein und demselben Jahr den FA Cup und einen Oscar als bester Schauspieler gewonnen hat. Die Rechte an seinem ersten Roman sind gerade für eine nicht genannte Summe von Steven Spielberg gekauft worden. Einer seiner Angestellten fand ihn erhängt in seinem Reitstall.« Tja, ich habe noch keinen so oder ähnlich lautenden Bericht eines Coroners gesehen, aber falls es Fälle gibt, in denen sich glückliche, erfolgreiche, hochtalentierte Menschen umbringen, darf man mit gutem Grund davon ausgehen, dass bei ihnen eine Sicherung durchgebrannt ist. Damit will ich nicht sagen, man wäre gegen Depressionen gefeit, wenn man Miss Schweden heiratet, für Manchester United spielt und Oscars gewinnt – ich bin überzeugt, dem ist nicht so. Ich sage nur, dass solche Dinge einem gut tun. Sehen Sie sich die Statistiken an. Die Wahrscheinlichkeit, dass man sich umbringt, steigt, wenn man gerade eine Scheidung durchgemacht hat. Oder magersüchtig ist. Oder arbeitslos. Oder Prostituierte. Oder wenn man aus einem Krieg heimkehrt, oder vergewaltigt wurde oder jemanden verloren hat … Es gibt so viele Faktoren, die Menschen zum Äußersten treiben; kaum einer dieser Faktoren ist geeignet, etwas anderes als beschissene Gefühle wachzurufen. Vor zwei Jahren hätte sich Martin Sharp wohl nicht mitten in der Nacht auf einem schmalen Betonsims wiedergefunden, wie er auf einen betonierten Fußweg dreißig Meter tiefer blickt undsich fragt, ob er wohl das Geräusch seiner Knochen hören wird, wenn sie in tausend Stücke zerschmettert werden. Aber vor zwei Jahren war dieser Martin Sharp ein anderer Mensch. Ich hatte noch meinen Arbeitsplatz. Ich hatte noch eine Frau. Ich hatte noch nicht mit einer Fünfzehnjährigen geschlafen. Ich hatte noch nicht im Gefängnis gesessen. Ich hatte mit meinen kleinen Töchtern noch nicht über den Aufmacher eines Revolverblatts reden müssen, mit der Schlagzeile »DRECKSACK!« über einem Foto von mir, auf dem man mich auf dem Bürgersteig vor einem bekannten Londoner Nachtclub liegen sieht. (Wie hätte die Schlagzeile wohl gelautet, wenn ich über den Jordan gegangen wäre? »SENDESCHLUSS FÜR SHARP!« vielleicht. Oder auch »SHARP: ABGESCHMIERT«.) Man darf also getrost sagen, dass ich damals weniger Grund hatte, auf einem Sims zu sitzen. Also erzählen Sie mir nicht, mein seelisches Gleichgewicht wäre gestört gewesen, denn das Gefühl hatte ich ganz und gar nicht. (Und was heißt das überhaupt, »seelisches Gleichgewicht«? Ist das ein wissenschaftlicher Fachausdruck? Geht es im Gehirn wirklich auf und ab wie auf einer Waage, je nachdem, wie durchgeknallt man ist?) Der Wunsch, mich umzubringen, war eine angemessene und vernünftige Reaktion auf eine ganze Kette unglückseliger Ereignisse, die mir das Leben vergällt hatten. Ach ja, ich weiß, die Seelenklempner würden sagen, sie hätten mir helfen können, aber das ist doch gerade das Kranke in diesem Land, oder? Niemand ist bereit, sich seiner Verantwortung zu stellen. Immer ist irgendein anderer schuld. Buu-huu-huu. Tja, ich bin zufällig einer der wenigen Menschen, die glauben, dass das, was mit Mummy und Daddy war, nichts damit zu tun hat, dass ich eine Fünfzehnjährige gebumst habe. Ich bin vielmehr sicher, dass ich auf jeden Fall mit ihr geschlafen hätte, unabhängig davon, ob ich gestillt wurde oder nicht, und es war an der Zeit, dem ins Auge zu blicken, was ich getan hatte.
Und was habe ich getan? Ich habe mein Leben im Klo runtergespült. Im wahrsten Sinne des Wortes. Na gut, nicht im Wortsinn des Wortes. Ich habe mein Leben nicht in Urin verwandelt und in meiner Blase gesammelt und so weiter und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mein Leben in dem Sinne im Klo runtergespült habe, wie man sein Geld im Klo runterspülen kann. Ich hatte einmal ein Leben, mit jeder Menge Kinder und Frauen und Jobs und all dem Üblichen, und ich hab’s irgendwie geschafft, dass es mir abhanden kam. Nein, Moment, das stimmt so nicht. Ich wusste, wo mein Leben abgeblieben ist, genau so, wie man weiß, wo das Geld hin ist, wenn man es im Klo runterspült. Es ist mir durchaus nicht abhanden gekommen. Ich habe es verballert. Ich habe meine Kinder und meinen Job und meine Frau für Mädchen im Teenageralter und an Nachtclubs verballert: All diese Dinge haben ihren Preis, den ich bereitwillig zahlte, und plötzlich war mein Leben nicht mehr da. Was gab ich schon auf? Am letzten Tag des Jahres schien es mir, als würde ich mich von einer Art Wachkoma und einem semi-funktionierenden Verdauungssystem verabschieden – beides äußere Anzeichen für Leben, aber es fehlt der entsprechende Inhalt. Ich war nicht einmal besonders traurig. Ich kam mir nur sehr dumm vor, und ich war sehr wütend.
Ich sitze jetzt nicht hier, weil ich plötzlich zur Vernunft gekommen bin. Ich sitze jetzt hier, weil der bewusste Abend genauso in die Hose ging wie alles andere auch. Ich konnte nicht mal von einem dämlichen Hochhaus springen, ohne es zu verbocken.
MAUREEN
Am Silvesterabend schickte das Pflegeheim einen Krankenwagen für ihn vorbei. Dafür muss man extra zahlen, aber das machte mir nichts. Warum auch? Letztendlich würde Matty sie eine Menge mehr kosten, als sie mich gekostet hatten. Ich zahlte nur für eine Nacht, und sie würden zahlen müssen, solange er lebte.
Ich hatte daran gedacht, einige von Mattys Sachen zu verstecken, weil sie einen komischen Eindruck machen könnten, aber es brauchte ja niemand zu wissen, dass sie ihm gehörten. Ich konnte ja jede Menge Kinder haben, nach allem, was sie wussten, deswegen ließ ich sie, wo sie waren. Sie kamen um sechs, und zwei junge Burschen schoben ihn raus. Ich durfte nicht weinen, als sie gingen, denn dann hätten die jungen Burschen gewusst, dass etwas nicht stimmte; sie dachten ja, ich würde ihn am nächsten Morgen gegen elf wieder abholen kommen. Ich küsste ihn bloß auf den Kopf und erklärte ihm, er solle sich im Heim gut benehmen, und ich hielt alles zurück, bis ich sie hatte wegfahren sehen. Dann weinte und weinte ich, rund eine Stunde lang. Er hatte mein Leben ruiniert, aber er war immer noch mein Sohn, und ich würde ihn nie wieder sehen, und ich konnte ihm nicht einmal richtig Lebewohl sagen. Ich schaute eine Weile fern und, ja, ich gönnte mir ein oder zwei Gläser Sherry, denn ich wusste, draußen würde es kalt sein.
Ich wartete zehn Minuten an der Bushaltestelle, aber dann beschloss ich zu laufen. Wenn man weiß, dass man sterben will, ist man gleich weniger ängstlich. Ich hätte mir sonst nie einfallen lassen, so spät am Abend den ganzen Weg zu laufen, besonders nicht, wenn die Straßen voller Betrunkener sind, aber was machte das jetzt noch aus? Obwohl ich mir dann natürlich Sorgen machte, überfallen, aber nicht umgebracht zu werden – halb tot dazuliegen, aber nicht wirklich zu sterben. Dann würde man mich ja ins Krankenhaus bringen, und sie würden meine Personalien feststellen und von Matty erfahren, und all die Monate der Planung wären vergeudete Zeit gewesen, und ich würde aus dem Krankenhaus entlassen werden und dem Pflegeheim Tausende Pfund schulden, und wo sollte ich die hernehmen? Aber es überfiel mich niemand. Ein paar Leute wünschten mir ein frohes neues Jahr, aber mehr war nicht. Da ist gar nicht so viel, wovor man Angst haben muss, auf der Straße. Ich weiß noch, wie ich dachte, dass das ja komisch ist, dass ich das am letzten Abend meines Lebens herausfinde, nachdem ich vorher immer vor allem Angst hatte.
Ich war zuvor noch nie im Topper’s House gewesen. Ich bin lediglich ein- oder zweimal mit dem Bus daran vorbeigefahren. Ich wusste nicht mal sicher, ob man immer noch auf das Dach konnte, aber die Tür war offen, und ich stieg einfach die Treppen rauf, bis es nicht mehr weiterging. Ich weiß nicht, wieso ich nicht bedacht hatte, dass man da nicht einfach so nach Lust und Laune runterspringen konnte, aber in dem Moment, als ich es sah, begriff ich, dass man versuchen würde, so etwas zu verhindern. Sie hatten dort Maschendraht gespannt, bis ganz oben, und dazu so ein gebogenes Gitter mit Stacheln … ja, da geriet ich in Panik. Ich bin nicht groß und nicht sehr kräftig, und auch nicht mehr so jung, wie ich mal war. Ich wusste nicht, wie ich da überall drüber kommen sollte, und es musste doch an diesem Abend sein, wegen Matty im Heim und so weiter. Da begann ich, noch mal alle anderen Möglichkeiten durchzugehen, aber keine taugte etwas. Ich wollte es nicht in meinem eigenen Wohnzimmer machen, wo mich jemand finden würde, den ich kannte. Ich wollte von einem Fremden entdeckt werden. Und ich wollte auch nicht vor einen Zug springen, denn ich hatte im Fernsehen einen Bericht über die armen Lokführer gesehen, denen die Selbstmorde furchtbar zu schaffen machen. Und ich besaß kein Auto, daher konnte ich auch nicht an eine abgeschiedene Stelle fahren und die Abgase einatmen …
Und dann sah ich Martin, gleich da auf der anderen Seite vom Dach. Ich versteckte mich im Schatten und beobachtete ihn. Ich konnte sehen, dass er die Dinge richtig angepackt hatte: Er hatte eine kleine Stehleiter mitgebracht und eine Drahtschere, und hatte es so geschafft, obendrüber zu klettern. Er saß nur so auf dem Sims, ließ die Beine baumeln, starrte hinunter, nippte an einem Flachmann, rauchte und dachte nach, während ich wartete. Und er rauchte und rauchte, und ich wartete und wartete, bis ich es nicht mehr aushielt. Ich weiß, es war seine Leiter, aber ich brauchte sie. Er würde ja keine Verwendung mehr dafür haben. Ich habe nie versucht, ihn zu schubsen. Ich habe gar nicht die Statur, einen erwachsenen Mann vom Sims zu schubsen. Ich bin gar nicht kräftig genug gebaut, um einen erwachsenen Mann vom Sims zu stoßen. Und ich hätte es auch nie versucht; es war seine Entscheidung, ob er sprang oder nicht. Ich ging nur zu ihm hin, steckte meine Hand durch die Zaunmaschen und tippte ihm auf die Schulter. Ich wollte ihn bloß fragen, ob er noch lange brauchte.
JESS
Bevor ich in die Besetzer-WG ging, hatte ich nie die Absicht gehabt, rauf aufs Dach zu steigen. Ehrlich nicht. Ich hatte an diese Sache mit Topper’s House gar nicht gedacht, bis ich anfing, mich mit diesem Typen zu unterhalten. Ich glaube, er mochte mich, was nicht viel heißen will, da ich wohl die einzige Frau unter dreißig war, die noch gerade stehen konnte. Er gab mir eine Kippe und sagte, er hieße Bong, und als ich ihn fragte, warum er Bong heißt, sagte er, das wär deshalb, weil er sein Gras immer mit einer Bong rauchen würde. Und ich sag, dann heißen alle anderen hier Tüte? Aber er nur, nee, der Typ da hinten heißt Mike der Mongo. Der da drüben heißt Pfütze. Und der da hinten, das ist Nicky der Scheißer. Und so weiter, bis er alle im Zimmer durchhatte, die er kannte.
Aber die zehn Minuten, die ich mit Bong redete, machten Geschichte. Gut, nicht Geschichte wie 55 v. Chr. oder 1939. Nicht historische Geschichte, es sei denn, einer von uns ginge hin und erfände eine Zeitmaschine oder würde verhindern, dass England von der Al-Qaida heimgesucht wird oder so. Aber wer weiß, was aus uns geworden wäre, hätte Bong nicht auf mich gestanden? Denn bevor er anfing, mich vollzuquatschen, war ich drauf und dran, nach Haus zu gehen, und Maureen und Martin wären jetzt höchstwahrscheinlich tot, und … na ja, alles wär anders.
Als Bong mit seiner Aufzählung durch war, sah er mich an und sagt: Du willst doch wohl nicht rauf aufs Dach, oder? Und ich dachte mir, mit dir jedenfalls nicht, Kiffersack. Und er: Denn ich kann den Schmerz und die Verzweiflung in deinen Augen sehn. Zu dem Zeitpunkt war ich schon ziemlich hacke, daher bin ich mir jetzt im Nachhinein ziemlich sicher, dass er in meinen Augen nur sieben Bacardi Breezer und zwei Dosen Special Brew sehen konnte. Ich sagte bloß, ach ja? Und er, ja, weißte, ich bin hier als Selbstmörder-Wache eingeteilt, um auf Leute zu achten, die bloß hier sind, weil sie nach oben gehn wollen. Und ich so, was ist denn oben los? Und er lachte und sagt, du machst wohl Witze. Mensch, das hier ist Topper’s House. Hier bringen sich doch dauernd Leute um. Und ich wär nie darauf gekommen, hätte er das nicht gesagt.
Alles passte plötzlich zusammen. Ich war zwar gerade im Begriff gewesen, nach Haus zu gehen, konnte mir aber nicht vorstellen, was ich machen sollte, wenn ich dort wäre, und ich konnte mir nicht vorstellen, am nächsten Morgen aufzuwachen. Ich wollte Chas, aber er wollte mich nicht, und ich begriff plötzlich, dass es mit Abstand das Beste wäre, mein Leben nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Beinahe hätte ich gelacht, es passte so gut: Ich wollte meine Lebenszeit möglichst kurz halten, und ich war auf einer Party in Topper’s House, und dieses Zusammentreffen war einfach zu viel. Es war wie eine Botschaft von Gott. Na schön, es war enttäuschend, dass Gott mir nicht mehr zu sagen hatte als, Spring vom Dach, aber ich machte dem lieben Gott keine Vorwürfe. Was sollte er mir sonst schon raten?
In dem Moment konnte ich die ganze Last spüren – die Bürde der Einsamkeit, von allem, was schief gelaufen war. Es kam mir heldenhaft vor, die letzten paar Stockwerke bis zum Dach des Gebäudes hochzusteigen und diese Last mit mir zu schleppen. Runterspringen erschien mir die einzige Möglichkeit, sie loszuwerden, die einzige Möglichkeit, sie zu meinem Vorteil statt zu meinem Nachteil einzusetzen; ich kam mir so beladen vor, dass ich mir sicher war, ich würde in Nullkommanichts unten aufschlagen. Den Weltrekord im Vom-Hochhaus-fallen brechen.
MARTIN
Keine Frage, hätte sie nicht versucht, mich umzubringen, wäre ich jetzt tot. Aber wir alle haben so was wie einen Selbsterhaltungstrieb, oder? Auch wenn er anspringt, während wir gerade versuchen, uns umzubringen. Ich weiß nur, dass ich diesen Stoß im Rücken verspürte, und ich drehte mich um, packte das Geländer hinter mir und fing an zu brüllen. Zu dem Zeitpunkt war ich schon betrunken. Ich hatte eine Zeit lang immer wieder aus dem Flachmann getrunken und auch schon ganz schön einen sitzen gehabt, bevor ich hergefahren war. (Ich weiß, ich weiß, ich hätte nicht fahren sollen. Aber ich wollte die gottverdammte Leiter nicht im Bus mitnehmen.) Und darum, ja, ich hab ihr so einiges an den Kopf geworfen. Hätte ich gewusst, dass es Maureen war, wie Maureen war, hätte ich mich wahrscheinlich etwas zurückgehalten, aber ich tat es nicht; womöglich habe ich sogar das böse F-Wort benutzt, wofür ich mich entschuldigt habe. Aber Sie müssen zugeben, es war schon eine beispiellose Situation.
Ich stand auf und drehte mich vorsichtig um, denn ich wollte nicht runterstürzen, bevor ich mich selbst dazu entschlossen hatte, und brüllte sie an, und sie glotzte nur.
»Ich kenne Sie«, sagte sie.
»Was?« Ich war nicht ganz bei der Sache. Leute treten in Restaurants, Shops, Theatern, an Tankstellen und in öffentlichen Bedürfnisanstalten in ganz England an mich heran und sagen: »Ich kenne Sie«, und sie meinen damit stets genau das Gegenteil; sie meinen: »Ich kenne Sie nicht. Aber ich habe Sie im Fernsehen gesehen.« Und dann wollen sie ein Autogramm oder darüber reden, wie Penny Chambers privat ist, im wirklichen Leben. Aber an dem Abend rechnete ich einfach nicht damit. Das erschien mir alles ein bisschen irrelevant, diese Seite meines Lebens.
»Aus dem Fernsehen.«
»Du lieber Himmel. Eigentlich wollte ich mich gerade umbringen, aber kein Problem, für ein Autogramm ist immer Zeit. Haben Sie einen Stift? Oder ein Stück Papier? Und bevor Sie fragen, sie ist ein abgefeimtes Luder, das sich alles reinzieht und mit jedem fickt. Aber was machen Sie eigentlich hier oben?«
»Ich wollte … ich wollte auch runterspringen. Ich wollte mir Ihre Leiter borgen.«
Darauf läuft es letztendlich immer hinaus: Leitern. Na schön, nicht im Wortsinn; der Friedensprozess im Nahen Osten läuft nicht letztendlich auf Leitern hinaus und die Geldmärkte auch nicht. Aber durch meine Sendung und die Interviews habe ich gelernt, dass sich auch die größten und kompliziertesten Themen auf kleinste Kleinigkeiten reduzieren lassen, als wäre das Leben ein Airfixmodell. Ich habe gehört, dass ein religiöser Führer seine Erweckung auf einen defekten Riegel an einem Gartenschuppen zurückführte (er hatte sich als Kind für eine Nacht darin eingesperrt, und Gott stand ihm in der Finsternis bei); ich habe eine Geisel schildern hören, dass sie überlebte, weil einer der Geiselnehmer so fasziniert von ihrer ermäßigten Familienkarte für den Londoner Zoo war, die der Mann im Portemonnaie bei sich trug. Man will über die wichtigen Dinge reden, aber es sind die Riegel am Gartenschuppen und die Eintrittskarten für den Londoner Zoo, die einem Anknüpfungspunkte geben, ohne sie wüsste man nicht, wo man anfangen sollte. Jedenfalls nicht als Moderator von Guten Morgen mit Martin und Penny. Maureen und ich konnten nicht darüber reden, warum wir so unglücklich waren, dass wir wollten, dass unser Gehirn wie ein Milchshake von McDonald’s über den Asphalt spritzte, und deshalb redeten wir über die Leiter.
»Bedienen Sie sich.«
»Ich warte, bis Sie … Gut, ich warte.«
»Sie wollen also einfach dastehen und zugucken?«
»Nein. Natürlich nicht. Ich könnte mir denken, dass Sie gerne ungestört dabei wären.«
»Da denken Sie richtig.«
»Ich werd dahinten rübergehen.« Sie zeigte auf die andere Seite des Daches.
»Ich rufe dann, wenn ich auf dem Weg nach unten bin.«
Ich lachte, sie jedoch nicht.
»Kommen Sie. Der Witz war nicht schlecht. Unter den gegebenen Umständen.«
»Ich vermute, ich bin nicht in der Stimmung, Mr Sharp.«
Ich glaube nicht, dass es witzig gemeint war, aber was sie sagte, brachte mich noch mehr zum Lachen.
Maureen ging auf die andere Seite des Daches und setzte sich mit dem Rücken an die Mauer gelehnt hin. Ich drehte mich um und setzte mich wieder auf den Sims. Aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich hatte den richtigen Moment verpasst. Sie denken wahrscheinlich, wie viel Konzentration braucht man schon, um sich vom Dach eines hohen Gebäudes zu stürzen? Tja, da wären Sie überrascht. Bevor Maureen kam, war ich vollkommen losgelöst; ich war an dem Punkt, an dem es ein Leichtes gewesen wäre, runterzuspringen. Ich war völlig auf die Gründe konzentriert, aus denen ich eigentlich dort oben war; ich verstand mit schrecklicher Klarheit, dass ich gar nicht erst zu versuchen brauchte, mein Leben da unten wieder aufzunehmen.
Aber der Wortwechsel mit ihr hatte mich abgelenkt, mich wieder in die Welt zurückgeholt, in die Kälte und den Wind und den Klang der wummernden Bässe sieben Stockwerke tiefer. Ich kam nicht mehr in Stimmung; es war so, als wäre eins der Kinder genau in dem Moment wach geworden, als Cindy und ich miteinander schlafen wollten. Für mich hatte es nichts geändert, und ich wusste immer noch, dass ich es irgendwann würde tun müssen. Aber ich wusste, dass ich in den nächsten fünf Minuten nicht dazu kommen würde.
Ich rief Maureen zu: »He! Möchten Sie Plätze tauschen? Sehen, ob Sie es schaffen?« Und ich lachte wieder. Ich fühlte mich wie der geborene Komiker, betrunken und wohl auch geistig zerrüttet genug, um zu glauben, einfach alles, was ich sagte, wäre zum Brüllen komisch.
Maureen trat aus dem Schatten und näherte sich vorsichtig der Lücke im Maschendraht.
»Ich möchte auch alleine dabei sein«, sagte sie.
»Das werden Sie. Ich gebe Ihnen zwanzig Minuten. Danach will ich meinen Platz wiederhaben.«
»Wie wollen Sie wieder hier rüber kommen?«
Daran hatte ich nicht gedacht. Die Trittleiter funktionierte tatsächlich nur in eine Richtung: Auf meiner Seite des Gitters war nicht genug Platz, um sie auszuklappen.
»Sie müssen sie wohl festhalten.«
»Wie meinen Sie das?«
»Sie reichen sie mir oben rüber. Ich lehne sie direkt ans Gitter. Und Sie halten sie von Ihrer Seite aus.«
»Die kann ich unmöglich festhalten. Sie sind zu schwer.«
Und sie war zu leicht. Sie war klein, und sie hatte überhaupt nichts auf den Rippen. Ich fragte mich, ob sie sich vielleicht umbringen wollte, weil sie langsam und qualvoll an irgendeiner Krankheit starb.
»Dann werden Sie sich damit abfinden müssen, dass ich hier bin.«
Ich war mir sowieso nicht sicher, dass ich wieder auf die andere Seite klettern wollte. Das Gitter markierte nun eine Grenze: Vom Dach aus konnte man ins Treppenhaus und vom Treppenhaus auf die Straße und von der Straße zu Cindy und den Kindern und Tina und ihrem Dad und all dem anderen, das mich hier hochgewirbelt hatte wie eine leere Chipstüte im Sturm. Der Sims gab Sicherheit. Dort gab es keine Erniedrigung und Scham – abgesehen von dem Gefühl der Erniedrigung und Scham, das sich zwangsläufig einstellt, wenn man am letzten Tag des Jahres allein auf einem Dachsims sitzt.
»Warum können Sie nicht ums Dach herum auf die andere Seite gehen?«
»Das Gleiche gilt für Sie. Es ist meine Leiter.«
»Sie sind nicht gerade ein Gentleman.«
»Scheiße, das bin ich wahrhaftig nicht. Das ist mit einer der Gründe, warum ich hier oben bin. Lesen Sie denn keine Zeitung?«
»Ich überfliege manchmal die Lokalzeitung.«
»Und was wissen Sie über mich?«
»Sie waren immer im Fernsehen.«
»Mehr nicht?«
»Ich glaub nicht.« Sie sann einen Moment nach. »Waren Sie mit einer von ABBA verheiratet?«
»Nein.«
»Oder einer anderen Sängerin?«
»Nein.«
»Ach ja. Sie mögen Pilze, das weiß ich.«
»Pilze?«
»Sagten Sie. Das weiß ich noch. Da war einer von diesen Fernsehköchen im Studio, und der hat Ihnen was zum Probieren gegeben, und Sie haben gesagt: ›Mmmmm, ich liebe Pilze. Ich könnte den ganzen Tag nur Pilze essen.‹ Waren Sie das nicht?«
»Kann sein. Aber mehr fällt Ihnen nicht ein?«
»Nein.«
»Und warum, glauben Sie, will ich mich dann umbringen?«
»Ich habe keine Ahnung.«
»Sie verarschen mich.«
»Würden Sie bitte auf Ihre Ausdrucksweise achten? Ich finde das beleidigend.«
»Verzeihung.«
Aber ich konnte es einfach nicht fassen. Ich konnte nicht fassen, dass ich jemanden gefunden hatte, der es nicht wusste. Bevor ich ins Gefängnis musste, lauerten die Hyänen von der Boulevardpresse schon vor der Haustür, wenn ich morgens wach wurde. Ich hatte Krisensitzungen mit Agenten und Managern und Fernsehverantwortlichen. Es erschien mir unmöglich, dass irgendwer in England kein Interesse an dem haben sollte, was ich getan hatte, hauptsächlich, weil ich in einer Welt lebte, in der es das einzig Wichtige zu sein schien. Vielleicht hatte Maureen hier auf dem Dach gelebt, überlegte ich. Wenn man hier oben lebte, wäre es ein Leichtes, den Anschluss zu verlieren.
»Was ist mit Ihrem Gürtel?« Sie wies mit dem Kopf auf meine Taille. Für Maureen waren dies die letzten Augenblicke auf Erden. Die wollte sie nicht mit Gerede über meine Vorliebe für Pilze vergeuden (eine Vorliebe, die, fürchte ich, ohnehin nur für die Kamera geheuchelt gewesen war). Sie wollte, dass es zügig weiterging.
»Was ist damit?«
»Machen Sie Ihren Gürtel ab und schlingen Sie ihn um die Leiter. Schnallen Sie ihn auf Ihrer Seite des Gitters zu.«
Ich kapierte, was sie meinte und dass es funktionieren würde, und die nächsten paar Minuten arbeiteten wir in einvernehmlichem Schweigen; sie hob die Leiter über den Zaun, und ich nahm meinen Gürtel ab, führte ihn um Leiter und Gitter, zog ihn fest, verschloss ihn und ruckelte daran, um zu sehen, ob er hielt. Ich wollte wirklich nicht rückwärts fallend sterben. Ich kletterte obendrüber zurück, und wir schnallten den Gürtel ab und stellten die Leiter wieder an ihren ursprünglichen Platz.
Und als ich Maureen gerade friedlich runterspringen lassen wollte, da stürzte diese Irre brüllend auf uns zu.
JESS
Ich hätte nicht so einen Krach schlagen sollen. Das war mein Fehler. Will sagen, das wär mein Fehler gewesen, wenn ich mich hätte umbringen wollen. Ich hätte einfach heimlich, still und leise zu der Stelle gehen sollen, wo Martin den Zaun durchtrennt hatte, auf die Leiter klettern und dann springen sollen. Aber das tat ich nicht. Ich brüllte so was wie: »Weg da, ihr Penner«, und machte so ein Indianergeheul, als wär alles nur ein Spiel – für mich war’s das in dem Moment ja auch –, und Martin tackelte mich wie beim Rugby, bevor ich nur den halben Weg geschafft hatte. Und dann kniete er sich irgendwie auf mich und drückte mein Gesicht in dieses raue Pseudo-Asphalt-Zeug, das sie jetzt auf die Flachdächer machen. Da wollte ich dann wirklich tot sein. Ich wusste nicht, dass es Martin war. Eigentlich sah ich gar nichts, bis er meine Nase in den Dreck rieb, und dann sah ich bloß Dreck. Aber in dem Moment, in dem ich das Dach betrat, wusste ich, was die beiden da oben machten. Man muss kein Genie sein, um darauf zu kommen. Na, jedenfalls, als er auf mir saß, sag ich, wie kommt es, dass ihr beide euch umbringen dürft und ich nicht? Und er so, weil du zu jung bist. Wir haben unser Leben verpfuscht. Du nicht, noch nicht. Und ich sag, woher wollen Sie das wissen? Und er, niemand hat in deinem Alter schon sein Leben verpfuscht. Und ich so, was ist, wenn ich zehn Leute umgebracht hab? Einschließlich meiner Eltern und, was weiß ich, meiner neugeborenen Zwillinge? Und er meinte, und, hast du? Und ich, yeah, hab ich. (Obwohl das nicht stimmte. Ich wollte nur sehen, was er sagen würde.) Da sagt er, tja, da du hier oben bist, bist du wohl nicht erwischt worden, oder? Ich würde an deiner Stelle in den nächsten Flieger nach Brasilien steigen. Und ich sag, was, wenn ich dafür büßen will, was ich mit meinem Leben angestellt hab? Und er sagt, halt die Klappe.
MARTIN
Das Erste, woran ich dachte, nachdem ich Jess zu Boden geworfen hatte, war, dass Maureen sich nicht alleine davonstehlen sollte. Nicht, dass ich ihr das Leben retten wollte; es hätte mich einfach nur geärgert, wenn sie Vorteil daraus gezogen hätte, dass ich beschäftigt war, und gesprungen wäre. Gut, logisch ist das nicht; zwei Minuten zuvor hatte ich ihr praktisch noch rübergeholfen. Aber ich sah nicht ein, warum die Verantwortung für Jess nur an mir allein hängen bleiben sollte, und ich sah auch nicht ein, warum sie die Leiter benutzen sollte, die ich den ganzen Weg hier raufgeschleppt hatte. Meine Motive waren somit überwiegend egoistischer Natur; nichts Neues also, wie Cindy Ihnen sagen würde.
Nachdem Jess und ich unseren bescheuerten Dialog darüber geführt hatten, wie sie Unmengen von Leuten umgebracht hatte, rief ich Maureen zu, sie solle rüberkommen und mir helfen. Sie guckte furchtsam und kam dann zu uns herübergetrottet.
»Jetzt machen Sie schon.«
»Was soll ich denn tun?«
»Setzen Sie sich auf sie drauf.«
Maureen setzte sich auf Jess’ Hintern, ich kniete auf ihren Armen.
»Lass mich los, du perverser alter Sack. Da geht dir wohl noch einer bei ab, was?«
Tja, in Anbetracht der vorausgegangenen Ereignisse gab mir das verständlicherweise einen kleinen Stich. Einen Augenblick lang dachte ich, Jess wüsste, wer ich war, aber nicht mal ich bin so paranoid. Wenn einen mitten in der Nacht jemand rugbygerecht von den Beinen holt, wenn man gerade im Begriff ist, sich von einem Hochhausdach zu stürzen, denkt man wahrscheinlich nicht an Frühstücksfernsehmoderatoren. (Das wäre für Frühstücksfernsehmoderatoren natürlich ein echter Schock. Die meisten von ihnen sind felsenfest davon überzeugt, die Leute dächten beim Frühstück, Mittag- und Abendessen nur an sie.) Ich war erwachsen genug, Jess’ Häme zu ignorieren, auch wenn ich ihr gerne die Arme gebrochen hätte.
»Wenn ich loslasse, bist du dann brav?«
»Ja.«
So stand Maureen denn auf, und Jess balgte sich mit ermüdender Vorhersehbarkeit mit ihr um die Leiter, sodass ich sie wieder zu Boden drücken musste.
»Was nun?« fragte Maureen, als wäre ich ein Veteran zahlloser ähnlicher Situationen und müsste darum wissen, wo es langging.
»Ich habe nicht die blasseste Ahnung.«
Weiß der Himmel, warum keiner von uns daran gedacht hatte, dass es an einem bekanntermaßen für Selbstmörder attraktiven Ort am Silvesterabend zugehen würde wie auf dem Picadilly Circus, aber an diesem Punkt der Ereignisse akzeptierte ich die schnöde Realität: Wir waren auf dem besten Weg, aus einem feierlichen und privaten Moment eine Farce und ein Massenspektakel zu machen.
Und genau im Moment dieser Einsicht wurden aus uns dreien vier. Jemand hüstelte höflich, und als wir uns umdrehten, sahen wir einen großen, gut aussehenden, langhaarigen Mann, vielleicht zehn Jahre jünger als ich, der unterm Arm einen Sturzhelm und in der freien Hand zwei große, quadratische Kartons hatte.
»Hat von euch jemand Pizza bestellt?« sagte er.
MAUREEN
Ich wüsste nicht, dass ich vorher schon einmal einem Amerikaner begegnet wäre. Ich war mir gar nicht sicher, dass er einer war, bis die anderen etwas sagten. Man rechnet schließlich nicht damit, dass die Pizza von Amerikanern ausgeliefert wird, oder? Ich jedenfalls nicht, aber vielleicht bin ich ja bloß nicht mehr ganz auf dem Laufenden. Ich bestelle nicht sehr oft Pizza, aber wenn, wurde sie bislang immer von jemandem ausgeliefert, der kein Englisch konnte. Amerikaner liefern keine Sachen aus, richtig? Sie bedienen einen auch nicht in Geschäften oder kassieren den Fahrpreis im Bus. Zu Hause in Amerika wahrscheinlich schon, nehme ich zumindest an, aber nicht hier. Inder und Leute aus der Karibik ja, und in dem Krankenhaus, wo sie sich um Matty kümmern, auch viele Australier, aber keine Amerikaner. Wahrscheinlich hielten wir ihn deswegen anfangs für ein bisschen verrückt. Nur so konnten wir ihn uns erklären. Er sah ein bisschen verrückt aus mit diesen Haaren. Und er glaubte, wir hätten vom Dach des Topper’s House aus Pizza bestellt.
»Wie sollen wir von hier aus Pizza bestellt haben?« fragte ihn Jess. Wir hockten immer noch auf ihr, daher klang ihre Stimme sonderbar.
»Mit dem Cellphone«, sagte er.
»Was ist ein Cellphone?« fragte Jess.
»Na schön, mit dem Handy meinetwegen.«
Das muss man ihm lassen, so hätten wir es machen können.
»Bist du Amerikaner?« fragte ihn Jess.
»Yeah.«
»Wieso lieferst du Pizza aus?«
»Wieso sitzt ihr auf ihrem Kopf?«
»Die sitzen auf meinem Kopf, weil dies kein freies Land ist«, sagte Jess. »Hier darf man nicht machen, was man will.«
»Was wolltest du denn machen?«
Sie antwortete nicht.
»Sie wollte runterspringen«, sagte Martin.
»Du ja auch!«
Er ignorierte sie.
»Ihr wolltet alle runterspringen?« fragte uns der Pizzamann.
Wir blieben stumm.
»F…, oder?« sagte er.
»F…, oder?« sagte Jess. »F… oder was?«
»Amerikaner fassen sich kurz«, sagte Martin. »›F…, oder?‹ heißt so viel wie ›Na, das ist ja ein Zufall‹. In Amerika sind sie so beschäftigt, dass sie für ganze Sätze keine Zeit haben.«
»Würden Sie bitte Ihre Ausdrucksweise mäßigen?« sagte ich zu ihnen. »Wir sind doch nicht im Schweinestall groß geworden.«
Der Pizzamann setzte sich einfach auf den Boden und schüttelte den Kopf. Ich glaubte, wir täten ihm Leid, aber später erzählte er uns, dass es gar nicht so war.
»Okay«, sagte er nach einer Weile. »Lasst sie los.«
Wir rührten uns nicht.
»He, ihr da. Wollt ihr wohl hören? Muss ich erst rüberkommen und euch zwingen?« Er stand auf und kam auf uns zu.
»Ich glaube, sie ist jetzt okay, Maureen«, sagte Martin, als würde er jetzt aus eigenem Entschluss aufstehen und nicht, weil der Amerikaner ihn verprügeln könnte. Er stand auf, ich stand auf, und Jess stand ebenfalls auf, klopfte sich die Sachen ab und fluchte wüst. Dann starrte sie Martin an.
»Du bist doch dieser eine«, sagte sie. »Dieser Typ aus dem Frühstücksfernsehen. Der mit einer Fünfzehnjährigen geschlafen hat. Martin Sharp. F…! Martin Sharp hat auf meinem Kopf gesessen. Du perverser alter Sack.«
Von irgendwelchen Fünfzehnjährigen wusste ich natürlich nichts. Ich lese solche Zeitungen nicht, außer beim Friseur oder wenn jemand im Bus eine liegen gelassen hat.
»F…?« fragte der Pizzabote. »Der Typ, der im Gefängnis war? Ich hab davon gelesen.«
Martin gab ein Ächzen von sich. »In Amerika weiß auch jeder Bescheid?« fragte er.
»Klar«, sagte der Pizzabote. »Ich hab’s aus der New York Times.«
»Oh Mann«, sagte Martin, aber man merkte, dass er sich geschmeichelt fühlte.
»Das war bloß ein Witz«, sagte der Pizzabote. »Sie haben eine Sendung im englischen Frühstücksfernsehen moderiert. In den USA kennt Sie kein Mensch. Bleiben Sie mal auf dem Teppich.«
»Dann gib uns wenigstens was von der Pizza«, sagte Jess. »Was für welche hast du dabei?«
»Keine Ahnung«, sagte der Pizzabote.
»Lass mich mal gucken«, sagte Jess.
»Nein, ich meine … das sind ja nicht meine, verstehst du?«
»Mensch, sei nicht so ein Weichei«, sagte Jess. (Ehrlich. Das waren ihre Worte. Ich weiß auch nicht warum.) Sie beugte sich und nahm ihm die Pizzakartons ab. Dann machte sie die Kartons auf und stocherte in den Pizzas herum.
»Die hier ist mit Pepperoni. Aber keine Ahnung, was das für eine ist. Gemüse.«
»Vegetarisch«, sagte der Pizzabote.
»Egal«, sagte Jess. »Wer will was haben?«
Ich wählte die Vegetarische. Pepperoni hörte sich wie irgendwas an, das mir nicht bekommen würde.
JJ
Ich hab einer ganzen Reihe von Leuten von dieser Nacht erzählt, und das Schräge ist, dass sie den Selbstmord eher nachvollziehen können als das mit der Pizza. Selbstmord können die meisten Menschen verstehen, schätze ich; selbst wenn es tief drinnen in ihnen vergraben ist, können sich die meisten an Phasen ihres Lebens erinnern, in denen sie nicht wussten, ob sie wirklich am nächsten Morgen noch mal aufwachen wollten. Sterben zu wollen scheint zum Leben zu gehören. Na, jedenfalls, wenn ich Leuten von dieser Silvesternacht erzähle, kommt keiner mit: »Waaaas? Du wolltest dich umbringen?« Nein, dann heißt es eher: »Ja, klar, deine Band war im Arsch, du kamst mit deiner Musik nicht weiter, die dir immer das Wichtigste im Leben war, und dann hat auch noch deine Freundin mit dir Schluss gemacht, wegen der du überhaupt nur in diesem Scheißland warst … Klar, kann ich verstehen, wieso du da oben warst.« Aber praktisch im nächsten Atemzug wollen sie dann wissen, wie ein Typ wie ich dazu kommt, verfickte Pizzas auszufahren.
Okay, ihr kennt mich nicht, deswegen müsst ihr mir einfach abnehmen, dass ich nicht blöd bin. Ich verschlinge jedes verdammte Buch, das ich in die Finger kriege. Ich steh auf Faulkner und Dickens und Vonnegut und Brendan Behan und Dylan Thomas. Grade in der Woche – am ersten Weihnachtstag, um genau zu sein – hatte ich Zeiten des Aufruhrs von Richard Yates ausgelesen, ein absolut irrer Roman. Ich wollte beim Runterspringen sogar ein Exemplar mitnehmen – nicht nur, weil das irgendwie cool gewesen wäre und der Sache etwas Geheimnisvolles gegeben hätte, sondern weil man damit vielleicht mehr Menschen dazu gebracht hätte, das Buch zu lesen. Aber wie die Dinge sich dann entwickelten, blieb mir keine Vorlaufzeit, und ich ließ es zu Haus. Ich muss einschränkend sagen, es empfiehlt sich nicht, das Buch am ersten Weihnachtstag auszulesen, und das in einem möblierten Zimmer ohne Warmwasser in einer Stadt, in der man eigentlich niemanden kennt. Das hat nicht direkt dazu beigetragen, dass ich mich besser fühlte, wisst ihr, denn der Schluss zieht einen echt runter.
Egal, die Leute kommen gerne zu dem vorschnellen Urteil, dass einer, der am Silvesterabend mit einem beschissenen kleinen Moped für einen Hungerlohn im Londoner Norden Pizzas ausliefert, ein echter Loser sein muss, der aller Wahrscheinlichkeit nach nicht gerade die Pizza Calzone erfunden hat. Okay, wir sind Loser per definitionem, Pizzabote ist nun mal ein Job für Loser. Aber wir sind nicht alle verblödete Arschlöcher. Genau genommen war ich sogar trotz Faulkner und Dickens wahrscheinlich der Dümmste von allen Jungs in dem Laden, zumindest der mit dem niedrigsten Bildungsniveau. Bei uns gab es afrikanische Ärzte, albanische Rechtsanwälte, iranische Chemiker … ich war der Einzige ohne akademischen Grad. (Ich begreife nicht, wieso es in unserer Gesellschaft nicht mehr Gewalttaten durch Pizzaboten gibt. Stellt euch bloß vor, ihr wärt eine große Nummer in Zimbabwe, Hirnchirurg oder was auch immer, und dann müsstet ihr nach England abhauen, weil das faschistische Regime euren Arsch an die Wand nageln will, und am Schluss müsst ihr euch von einem zugekifften Teenager, der um drei Uhr morgens Fressanfälle kriegt, großkotzig behandeln lassen … Sollte man da nicht offiziell berechtigt sein, ihm den Unterkiefer zu brechen?) Egal. Es gibt viele Arten, ein Loser zu sein. Es gibt zweifellos viele Arten zu verlieren.
Ich könnte also erklären, dass ich Pizzabote bin, weil England scheiße ist, genauer gesagt, englische Mädchen scheiße sind und ich keinen legalen Arbeitsplatz kriege, weil ich kein Engländer bin. Oder Italiener oder Spanier oder meinetwegen auch nur ein bescheuerter Finne. Deswegen machte ich die einzige Arbeit, die ich kriegen konnte; Ivan, dem lettischen Besitzer des Casa Luigi in der Holloway Road, war es egal, dass ich aus Chicago und nicht aus Helsinki kam. Und eine andere Erklärung wäre, dass so was nun mal vorkommt und es keinen Ort gibt, der zu klein, zu dunkel, zu stickig und zu hoffnungslos ist, um sich darin zu verkriechen.
Das Problem meiner Generation ist, dass wir uns alle für Genies halten. Irgendwas zu produzieren reicht uns nicht, auch nicht, irgendwas zu verkaufen, zu unterrichten, überhaupt einfach irgendwas zu tun, nein, wir müssen etwas darstellen. Das ist unser unveräußerliches Recht als Bürger des 21. Jahrhunderts. Wenn Christina Aguilera oder Britney oder irgendein Wichser von Amerika sucht den Superstar was darstellen kann, warum nicht auch ich? Wann komme ich dran? Meine Band, also, wir haben die besten Liveshows geboten, die man in Clubs zu sehen kriegt, und wir haben zwei Alben gemacht, die vielen Kritikern und wenigen normalen Leuten gefallen haben. Aber Talent reicht einem ja nie zum Glücklichsein, oder? Ich mein, müsste es ja eigentlich, denn ein Talent ist ein echtes Geschenk, für das man Gott danken sollte, aber das tat ich nicht. Es ging mir nur auf den Sack, weil mir niemand Geld dafür gab und es mich nicht aufs Cover des Rolling Stone brachte.
Oscar Wilde hat mal gesagt, unser wirkliches Leben ist oft ein Leben, das wir gar nicht führen. Kann ich voll unterschreiben, Oscar. In meinem wahren Leben gab es Auftritte als Hauptact in Wembley und im Central Park und Platinalben und Grammys, aber dies war nicht das Leben, das ich führte, was der Grund dafür gewesen sein mag, dass ich glaubte, es wegwerfen zu können. Das Leben, das ich führte, erlaubte mir nicht … ich weiß auch nicht, der Mensch zu sein, für den ich mich hielt. Es erlaubte mir nicht mal den aufrechten Gang. Es kam mir vor, als ginge ich durch einen Tunnel, der enger und enger wurde, dunkler und dunkler, und mit Wasser vollzulaufen begann, und ich musste mich schon total klein machen, und vor mir war eine Felswand, und mein einziges Werkzeug waren meine Fingernägel. Vielleicht empfindet es jeder so, aber das ist kein Grund, daran festzuhalten. Na jedenfalls, an diesem Silvesterabend hatte ich es endgültig satt. Meine Fingernägel waren völlig abgewetzt und meine Fingerspitzen wund gescheuert. Ich konnte nicht weiterscharren. Nachdem es die Band nicht mehr gab, war meine einzige Möglichkeit, mich noch auszudrücken, aus meinem unwahren Leben auszuchecken: Ich würde von diesem Scheißdach fliegen wie Superman. Nur wurde natürlich nichts daraus.
Einige tote Menschen, Menschen, die zu empfindsam waren, um weiterzuleben: Sylvia Plath, van Gogh, Virginia Woolf, Jackson Pollock, Primo Levi und Kurt Cobain natürlich. Und hier ein paar Lebende: George W. Bush, Arnold Schwarzenegger, Osama Bin Laden. Kreuzt die Leute an, mit denen ihr gerne ein Bier trinken würdet, und guckt dann mal, ob sie bei den Lebenden oder bei den Toten stehen. Nagut, ihr könntet einwenden, dass ich geschummelt habe und auf meiner Liste der Lebenden ein paar Leute fehlen, ein paar Dichter, Musiker und so, die mir meine Beweisführung versauen würden. Ihr könntet außerdem sagen, dass Stalin und Hitler nicht so toll waren und ebenfalls nicht mehr unter uns weilen. Aber lasst mich trotzdem gewähren; ihr wisst, wovon ich rede. Empfindsame Menschen kommen hier schwerer zurecht.
Daher war die Entdeckung, dass Maureen, Jess und Martin Sharp auch im Begriff waren, den Jackson-Pollock-Weg aus dieser Welt zu nehmen (ja, schon gut, ich weiß, dass Jackson Pollock nicht vom Dach eines Hochhauses im Londoner Norden gesprungen ist), ein echter Schock. Eine nicht mehr ganz junge Frau, die aussah, wie irgendjemandes Putzfrau, eine kreischende, pubertierende Irre und ein Fernsehmoderator mit orangeroter Birne … Das passte nicht ins Bild. Für solche Leute ist der Selbstmord nicht erfunden worden. Er wurde für Leute wie van Gogh und Woolf und Nick Drake erfunden. Und für mich. Selbstmord hat etwas Cooles zu sein.
Silvesterabend war eine Nacht für sentimentale Loser. Es war mein eigener dummer Fehler. Natürlich musste heute ein Trupp von kleinen Lichtern da oben sein. Ich hätte einen schickeren Termin wählen sollen – den 28. März, an dem Virginia Woolf ins Wasser ging, oder den 25. November (Nick Drake). Wäre in einer dieser Nächte noch jemand auf dem Dach gewesen, dann vermutlich eine verwandte Seele und nicht ein paar hoffnungslose Nieten, die sich eingeredet hatten, das Ende eines Kalenderjahres wäre irgendwie bedeutsam. Das lag nur daran, dass mir die Gelegenheit zu günstig erschien, als ich die Order bekam, Pizzas in die besetzte Wohnung in Topper’s House zu liefern. Ich hatte vorgehabt, zuerst aufs Dach zu steigen, mich umzusehen, um die Lage zu peilen, dann unten die Pizza abzuliefern und es anschließend zu tun.
Und dann sitze ich plötzlich mit drei potenziellen Selbstmördern da, die mir die Pizzas wegfressen, die ich eigentlich hatte ausliefern sollen, und mich anstarren. Offenbar erwarteten sie so eine Art Gettysburg-Rede, wieso ihr angeschlagenes und sinnloses Leben lebenswert wäre. Das war die reine Ironie, denn mir war’s scheißegal, ob sie sprangen oder nicht. Ich kannte sie ja gar nicht, und keiner von ihnen sah aus, als würde er der Summe menschlicher Errungenschaften noch viel hinzufügen können. »Also«, sagte ich. »Na toll. Pizza. Eine kleine, gute Sache in einer Nacht wie dieser.« Raymond Carver, wie ihr vermutlich wisst, aber an diese Typen war das verschwendet.
»Und jetzt?« fragte Jess.
»Jetzt essen wir unsere Pizza.«
»Und dann?«
»Warten wir eine halbe Stunde, okay? Dann sehen wir weiter.« Ich weiß nicht, woher das kam. Warum eine halbe Stunde? Und was sollte danach passieren?
»Wir brauchen alle eine kleine Auszeit. Für mich sieht es aus, als wär es hier oben gerade ein bisschen würdelos zugegangen. Dreißig Minuten? Sind wir uns einig?«
Einer nach dem anderen zuckten sie mit den Schultern, dann nickten sie, und wir mampften schweigend unsere Pizza. Es war das erste Mal, dass ich eine Pizza von Ivan probierte. Sie war ungenießbar, wenn nicht gar gesundheitsschädlich.
»Ich werd hier doch keine halbe Stunde rumsitzen und in eure blöden Jammermienen glotzen«, sagte Jess.
»Aber genau damit hast du dich gerade in dieser Minute einverstanden erklärt«, erinnerte sie Martin.
»Na und?«
»Was hat es für einen Sinn, etwas zuzustimmen und sich dann nicht daran zu halten?«
»Keinerlei Sinn.« Jess machte dieses Eingeständnis offenkundig nichts aus.
»Beständigkeit ist die letzte Zuflucht der Phantasielosen«, sagte ich. Wieder Wilde. Ich konnte nicht widerstehen.
Jess funkelte mich wütend an.
»Er ist nur nett zu dir«, sagte Martin.
»Und trotzdem hat alles keinen Sinn, oder?« sagte Jess. »Deswegen sind wir doch hier oben.«
Also, das war jetzt mal eine interessante philosophische Frage. Jess sagte damit, dass wir alle Anarchisten waren, solange wir uns auf dem Dach befanden. Absprachen sind nicht verbindlich, Regeln sind außer Kraft. Wir könnten uns gegenseitig vergewaltigen und ermorden, ohne dass jemand Notiz davon nimmt.
»To live outside the law you must be honest«, sagte ich.
»Was soll der Scheiß jetzt wieder heißen?« fragte Jess.
Also, um die Wahrheit zu sagen, hab ich auch nie ganz begriffen, was das heißen soll. Es ist von Bob Dylan, nicht von mir, und ich fand immer, dass es sich gut anhörte. Aber jetzt bot sich mir zum ersten Mal eine Situation, in der ich den Grundsatz anwenden konnte, und ich sah, dass er nichts taugte. Wir lebten außerhalb des Gesetzes und konnten uns jederzeit schamlos belügen, wenn wir wollten, und ich wusste auch nicht recht, was dagegen spräche.
»Nichts«, sagte ich.
»Dann halt die Klappe, Yankee.«
Und das tat ich. Damit blieben uns noch ungefähr achtundzwanzig Minuten von unserer Auszeit übrig.
JESS
Vor Ewigkeiten, als ich acht oder neun war, hab ich mal so einen Fernsehfilm über die Beatles gesehen. Jen stand auf die Beatles, es war also sie, die mich genötigt hatte, mir das anzusehen, aber ich hatte auch nichts dagegen. (Wahrscheinlich hab ich ihr gegenüber behauptet, ich hätte was dagegen. Wahrscheinlich hab ich einen Riesenaufstand gemacht und sie total genervt.) Na jedenfalls, als Ringo dazustieß, da kriegte man so eine kleine Gänsehaut, denn da war es so weit, da waren sie zu viert und hatten, was sie brauchten, um die berühmteste Band aller Zeiten zu werden. Na ja, genauso kam es mir vor, als JJ