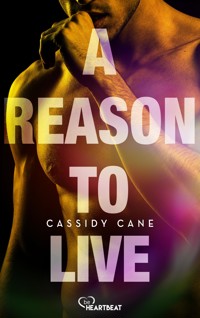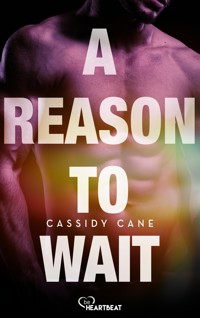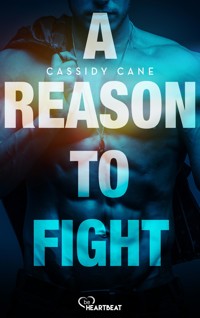
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Plötzlich Single-Dad
Dean ist Soldat bei der Army und hat schon viel erlebt. Er glaubt, dass ihn nichts mehr schockieren kann - bis er plötzlich erfährt, dass er Vater geworden ist. Die Mutter des Kindes ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Dean ist völlig überfordert, ist er doch nach seinem Auslandseinsatz nur noch ein Schatten seiner selbst. Wie soll er der Vater sein, den das Neugeborene braucht? Dann trifft er auf Morgan: Krankenschwester bei Tag, Soldaten-Retterin bei Nacht. Sie unterstützt ihn, wo sie nur kann - und weicht Dean nicht mehr von der Seite. Trotz schlafloser Nächte und völliger Erschöpfung funkt es zwischen den beiden gewaltig. Doch das Vater-Mutter-Kind-Spiel wird von Wunden überschattet, die jeden Moment aufzureißen drohen ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Einatmen
Neuanfang
Schwarz auf weiß
Das Leben ist scheiße
Rückzug
Eiskaffee mit Sahne
Ausatmen
Kleine Kämpferin
Happy End
Keine Geheimnisse
Selbst-Therapie
Das Ende
Lächerlicher Hornochse
Stromstoß
Chloe-Louise Morgan
Autogespräche
Wunderschön
Irgendein Thor
Schwanz schlägt Kopf
Schokopraline
Sehnsucht
Einmal Soldat, immer Soldat?
Wundertüten und Mörder
Monster und Held
Bald
Ben und Jerry
Kein Ohne dich
Kontrolle
Jetzt
Das zweite Bad
Standardprozedere, Baby
Boom!
Scheiße-still
Einspruch
Das Beste
Großer Bruder
Der gefallene Soldat
Epilog
Über die Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Dean ist Soldat bei der Army und hat schon viel erlebt. Er glaubt, dass ihn nichts mehr schockieren kann – bis er plötzlich erfährt, dass er Vater geworden ist. Die Mutter des Kindes ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Dean ist völlig überfordert, ist er doch nach seinem Auslandseinsatz nur noch ein Schatten seiner selbst. Wie soll er der Vater sein, den das Neugeborene braucht? Dann trifft er auf Morgan: Krankenschwester bei Tag, Soldaten-Retterin bei Nacht. Sie unterstützt ihn, wo sie nur kann – und weicht Dean nicht mehr von der Seite. Trotz schlafloser Nächte und völliger Erschöpfung funkt es zwischen den beiden gewaltig. Doch das Vater-Mutter-Kind-Spiel wird von Wunden überschattet, die jeden Moment aufzureißen drohen …
Einatmen
Dean
Ich hätte sie loslassen sollen.
Jetzt ist mir ihr Tod zuvorgekommen.
Immer wieder geht mir dieser Gedanke durch den Kopf, während ich abwesend auf die sonnengelbe Wand mir gegenüber starre, obwohl sie lieber pechschwarz hätte sein sollen. Das wäre für diesen Ort und die Nachrichten, die man hier erhält angemessener gewesen.
Ich wollte zurückkommen.
Zumindest am Anfang.
Penelope hat so oft versucht, mich zurückzuholen. Sie hat mich sogar vor einem halben Jahr auf einer Militärbasis in Houston besucht. Grenzt es nicht an Ironie, dass ich erst jetzt – durch ihren Tod – tatsächlich wieder hier in Deepwater bin?
In Houston habe ich Penelope auch das letzte Mal gesehen, und ich hätte verdammt noch mal ehrlich zu ihr sein sollen.
Ich hätte ihr sagen müssen, dass wir keine gemeinsame Zukunft haben würden, weil ich keine Zukunft für mich sehe. Weil ich sie mit in den Abgrund ziehen würde, wenn sie bei mir bliebe.
Stattdessen habe ich mich im Moment verloren und genommen, was sie mir geboten hat. Was ich in einem anderen Leben mehr zu schätzen gewusst hätte.
Ich schließe die Augen und lehne meinen Kopf gegen die Wand hinter mir.
Ein betrunkener Geisterfahrer.
Wie kann das Leben so grausam sein?
Im Schlachtfeld lassen Soldaten durch Bomben und Kugeln ihr Leben, und hier stirbt der zivile Rest durch dumme Entscheidungen anderer?
Entscheidungen, die einen für den Rest des Lebens verfolgen müssten. Aber es wird keine Vergeltung für Pen geben, denn der Fahrer war, laut der Polizei, sofort tot.
Zynisch lache ich auf und öffne meine Augen wieder.
Selbst wir Soldaten haben öfter das Pech, nicht direkt den Löffel abzugeben. Zwar ist das Bein ab und mehr Blut um einen herum, als in einem drinnen, aber trotzdem ist man weiterhin am Scheißleben.
»Sir?«
Warum hat es Penelope getroffen?
Ich vergrabe mein Gesicht in den Händen.
Warum ausgerechnet sie?
»Sir!«
Eine leichte Berührung an meinem Oberarm reißt mich aus den Gedanken, katapultiert mich zurück in die brutale Realität und aktiviert den Soldaten in mir.
In der Geschwindigkeit, mit der ich vom Plastikstuhl hochfahre, haue ich beinahe die Pflegerin um, die vor mir steht und einen Pappbecher in der Hand hält.
»Entschuldigen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich hab mir nur gedacht, Sie könnten einen heißen Kaffee gebrauchen.« Sie macht einen Schritt zurück, denkt nach und kommt den Schritt wieder vor. »Hier, bitte.«
»Nein, mir tut es leid. Es ist bloß –« Ich möchte nicht berührt werden.
»Ja. Ich weiß.« Die Krankenschwester nickt mitfühlend und hält mir noch immer den Becher entgegen.
»Danke«, murmele ich und nehme ihn ihr ab.
Zwar dampft es aus dem Kaffeebecher und ich fühle die hohe Temperatur der Beschichtung, die braune Brühe ist allerdings zu durchsichtig, um wirklich als Kaffee durchzugehen. Doch ich habe schon weitaus Schlimmeres getrunken, weshalb ich einen kräftigen Schluck nehme, in der Hoffnung, dass die Hitze mein Innerstes wegbrennt. Bis auf ein sengendes Gefühl in meinem Magen passiert nichts – der Schmerz in meiner linken Brust ist immer noch da, und ich stelle den Becher enttäuscht auf dem Beistelltisch neben mir ab. Dabei fällt mein Blick auf eine Cosmopolitan und ich werde augenblicklich an einen Moment mit Penelope erinnert.
Es war vor meinem Einsatz in Afghanistan.
Penelope hatte ihren Milchkaffee über meiner ganzen Autokonsole verteilt und versucht, die Flüssigkeit panisch mit dem Ärmel ihres Kleides aufzuwischen.
Meine Lippen wollen sich bei der Erinnerung zu einem Lächeln verziehen, aber gleichzeitig verkrampft mein Mund, weil es keinen Grund dafür gibt.
Pen wird mich nie mehr mit ihren großen Augen anschauen und sich tausendmal dafür entschuldigen, meine Karre ruiniert zu haben.
Sie wird nie mehr anzügliche Wiedergutmachungen vorschlagen, und ich werde nie wiedergutmachen können, dass ich –
»Sir? Ist alles in Ordnung? Okay, ganz ruhig. Sie müssen langsam atmen.«
Ich blinzele und merke, dass ich vollkommen weg gewesen sein muss, denn erst jetzt fällt mir wieder die Krankenschwester von eben auf, die immer noch vor mir steht und mich nun besorgt ansieht.
»Schauen Sie zu mir. Ich atme auch ganz langsam ein und wieder aus.«
Irritiert beobachte ich sie dabei, wie sie diese dämlichen Atemübungen macht, und nehme einen Druck auf meiner Brust wahr. Als ich meine Hand auf sie lege und mein Brustkorb sich unter ihr rasant hebt und senkt, begreife ich, dass diese Übungen an mich gerichtet sind.
»Einatmen, anhalten, ausatmen. Einatmen, anhalten, ausatmen.«
Panisch greife ich die Marken unter meinem T-Shirt und umfasse sie, während ich versuche, der Schwester nachzuahmen.
Atmen.
Es ist das Einfachste auf der Welt, warum fällt es mir so schwer?
»Tief einatmen.«
Die Pflegerin macht es mir nun nach und platziert ihre Hand auf ihrer Brust. »Ja, prima. Genau so.«
Es dauert einige Momente, bis ich synchron mit ihr bin, aber obwohl meine Lunge sich nun in allmählich regelmäßigeren Abständen füllt und leert, der Kloß im Hals bleibt. Ich habe das Gefühl, nie wieder richtig durchatmen zu können.
Was vollkommen lächerlich ist, denn ich habe schon Männer gesehen, denen der Kopf weggeblasen worden ist. Selbst da habe ich normal weitergeatmet. Weil ich gewusst hatte, worauf ich mich einließ, wenn ich der US Army beitrat.
»Geht es wieder?«
Die Krankenschwester schaut mich weiterhin besorgt an.
Doch sobald ich stumm nicke, verschwindet die Sorgenfalte auf ihrer Stirn und sie zupft erleichtert an den Enden ihrer zwei Zöpfe, in die sie ihre langen dunklen Haare aufgeteilt hat. Ihre Erscheinung passt nicht ins Bild. In mein Bild.
Diese Frau hat eine Ausstrahlung, als hätte sie noch nicht den Glauben an die Menschheit verloren. Als würde sie die Welt noch in tausend leuchtenden Farben sehen, obwohl sie längst trist und grau geworden ist. Jede Wette, dass die Wände wegen ihr gelb angestrichen worden sind.
Wo sind die grantigen Schwestern, die einen behandeln, als wäre man höchstpersönlich verantwortlich für ihre unzähligen Überstunden? So jemanden brauche ich. Nicht diese Pflegerin mit Helferlein-Komplex und dem hoffnungsvollen Funkeln in ihren braunen Augen.
»Soll ich Ihnen vielleicht eine Flasche Wasser holen? … Ich besorge Ihnen eine.« Sie deutet zum Getränkeautomaten am Ende des Raumes und steuert ohne meine Antwort darauf zu. Dabei quietschen ihre Schuhe mit jedem Schritt, als würde sie auf Hundespielzeug treten. Ihr scheint es nicht einmal aufzufallen. Oder sie hat sich bereits daran gewöhnt. Ich tippe auf Letzteres. Diese Art von Frau wirkt auf mich, als könnte sie nichts aus der Ruhe bringen.
Nachdem sie einen Dollar aus ihrer Hosentasche gezogen hat, kauft sie ein Wasser und quietscht damit zurück zu mir.
Penelope hätte sich über sie lustig gemacht, aber dazu muss man sagen, dass Madame auch eine astreine Vorlage dafür liefert.
Penelope.
Die Quietscheente mag mich kurzzeitig abgelenkt haben, aber jetzt ist das Wissen wieder da, dass Penelope nichts von all dem mehr machen wird.
Die Schwester stellt das Wasser neben meinem Kaffeebecher ab. »Falls Sie es sich anders –«
»Ich will sie sehen«, unterbreche ich sie forsch. Dafür bin ich schließlich hergekommen, oder?
»Ich werde mich erkundigen, ob sie schon bereit ist.«
Zum Dank nicke ich einmal. Sobald die Pflegerin weg ist, lasse ich mich erschöpft zurück auf den Stuhl sinken und greife abermals meine Marken.
Untypisch für einen Soldaten, trage ich drei an meinem Hals.
Eine davon, um nicht zu vergessen, wie scheiße das Leben ist. Die zwei anderen als Erinnerung, dass ich es irgendwie immer lebend rausgeschafft habe und auch das hier durchstehen werde – selbst, wenn es sich gerade nicht so anfühlt.
Das Zimmer, in dem Penelope liegt, ist weiß gestrichen, weiß gefliest und kalt. Alle Fenster sind offen und die Geräuschkulisse, das befreite Campusleben nach einem langen Vorlesungstag, reicht bis hierhin.
Ohne einen Blick auf Pen zu werfen, laufe ich an ihrem Bett vorbei und schließe sämtliche Fenster. Nicht weil es zu laut ist, sondern weil ich die dadurch gewonnenen Sekunden brauche, um mich vorzubereiten.
Heute habe ich mit einem Drill und Scharfschützen-Training gerechnet, nicht damit, dass ich ins Krankenhaus gerufen werde, um mich von meiner verstorbenen Freundin zu verabschieden.
Sobald das letzte Fenster geschlossen und die Geräuschkulisse erloschen ist, hole ich tief Luft und drehe mich zu Pen um.
Mir stockt bei ihrem Anblick der Atem. Sie sieht aus wie Schneewittchen, nur mit dem Unterschied, dass ihre Lippen nicht mehr apfelrot sind, wie sie es sonst immer waren, sondern einen bläulichen Ton angenommen haben.
»Hey«, flüstere ich und gehe vor dem Bett auf die Knie. »Es tut mir so leid.« Ich nehme ihre kalte und steife Hand in meine. »Ich bin hier.«
Viel zu spät.
Um einen klaren Kopf zu bekommen, schließe ich die Augen. Doch wie klar kann er sein, wenn der Leichnam der eigenen Freundin vor einem liegt?
Einen Moment gebe ich mir, dann öffne ich die Augen und zwinge mich, Penelope wieder anzusehen. Noch immer kann ich nicht glauben, dass sie durch einen beschissenen Autounfall ums Leben gekommen ist. Sie sieht so … so unversehrt aus.
Wie viele Männer ich schon gesehen habe, die in schlimmerer Verfassung gewesen sind. Und wie viele davon heute noch mit ihrer Nahtoderfahrung prahlen.
Pen hingegen … bis auf eine kleine Schramme an ihrem Kinn, fehlt ihr optisch nichts. Fassungslos schüttele ich den Kopf und streiche über ihre Wange, fahre ihre Gesichtskonturen nach.
Sie sieht so friedlich aus.
»Ich hätte da sein müssen«, flüstere ich mit gebrochener Stimme und umfasse Penelopes Hand noch fester – wenn auch nur, um zu überspielen, wie sehr ich zittere. »Es hätte nicht passieren dürfen.«
Der Geruch des Bettlakens steigt mir in die Nase, als ich meine Stirn gegen die Matratze lehne. Eine chemische Frische, die sich in mein Gedächtnis einbrennen und mich für alle Zeit an diesen Moment erinnern wird.
Plötzlich springt die Tür auf.
»Penny?«
Ned?
Mein bester Freund stützt sich am Türrahmen ab und starrt mit geweiteten Augen zu uns herüber. Er sieht mitgenommen aus und trägt einen dieser schäbigen Krankenhauskittel. Seine blonden, mittlerweile nicht mehr kurz geschorenen Haare, stehen in sämtliche Richtungen ab, und darunter entdecke ich einen Verband. Seine Lippen beben.
»Dean!« Als er mich entdeckt, drückt er seine Faust gegen die Lippen, als wolle er das Zittern stoppen.
Ich brauche keine zwei Sekunden um eins und eins zusammenzuzählen.
Er war bei ihr.
Ned humpelt auf Penelope zu, während ich mich aufrichte.
»Wag es ja nicht«, knurre ich. Er ignoriert mich, fällt vor Pen auf die Knie und flennt wie ein Scheißkind. Das Wimmern und Winseln löst etwas in mir aus, und ehe ich es begreife, gehe ich auf Ned los.
In dem Moment betritt die Krankenschwester das Zimmer, doch ich nehme sie nur am Rande wahr.
Wütend packe ich Ned am Kragen und ziehe ihn auf die Füße, bis wir auf Augenhöhe stehen. Mir ist scheißegal, dass er verletzt ist. Es mag mir an Worten fehlen, um meinen Zorn auszudrücken, aber ich habe zwei Fäuste, die das vorzüglich können, und so verpasse ich Ned einen Kinnhaken. Er taumelt zwar, fällt aber nicht nach hinten, also setze ich mit der anderen Faust nach.
»Du warst bei ihr!«, brülle ich und schlage erneut zu.
Im Hintergrund ertönt ein schriller Schrei, doch mein ganzer Fokus liegt auf Ned. Der wehrt sich nicht einmal, was mich bloß noch mehr in Fahrt bringt.
»Nur zu«, murmelt er, seine Lippe längst aufgeplatzt. Blut tropft auf den Boden, doch das scheint ihm genauso egal zu sein, denn er lenkt seinen Blick wieder auf Pen.
»Wie konntest du sie sterben lassen!«, fauche ich.
Ned ignoriert mich weiter, daher schüttele ich ihn, damit er wieder zu mir schaut. Dabei verrutscht sein Verband, und eine zusammengeklebte Wunde kommt zum Vorschein.
Dieses Arschloch. Das ist alles?
Pen ist tot und er hat nur eine beschissene Platzwunde?
Als ich erneut aushole, spüre ich den Schmerz in den Knöcheln kaum.
»Fuck, Ned! Du solltest … Ich hab sie dir … und jetzt ist sie …«
»Stopp! Sofort aufhören! Security!«
Eine laute Männerstimme durchschneidet den Raum, und bevor ich erneut zuschlagen kann, werde ich von hinten gepackt und auf den Boden gedrückt.
Zuerst wehre ich mich, als ich aber sehe, dass Ned ebenfalls von einem Sicherheitsmann auf den Boden gepresst wird, gebe ich nach.
»Mir ist das Herz rausgerissen worden, Dean!«, lispelt Ned und spuckt Blut auf die Fliesen. »Ich habe sie geliebt, Mann. Und sie mich!«
Was?
Einen Moment bin ich zu verdutzt, um irgendetwas zu fühlen. Dann überkommt mich eine neue Welle von Wut und ich versuche, mich von dem Sicherheitsmann loszureißen.
Der presst mich daraufhin fester auf den Boden.
Schließlich taucht Doctor Reed in meinem Blickfeld auf. Der Arzt, der mir als Notfallkontakt von Pen die Nachricht ihres Todes überbracht hat.
Penelopes Eltern sind auf einer Kreuzfahrt in Griechenland – womöglich wissen sie bis jetzt noch nicht Bescheid, sondern genießen weiterhin die Wellen des Mittelmeeres.
Reed hat die Arme vor der Brust verschränkt und schaut ausdruckslos zu uns. Er sieht aus, wie aus dem Lehrbuch gestiegen: vollständig in weiß gekleidet und mit einer Brille auf der Nase, die er vorhin noch nicht aufgehabt hat. Damit wirkt er älter, obwohl er sicher in meinem Alter sein muss.
Das Einzige, was seine stoische Erscheinung ruiniert, ist die schwarze Strähne, die ihm ins Gesicht fällt und die er genervt immer wieder nach hinten streicht.
»Danke, Jungs. Ich denke, ab jetzt kann ich übernehmen.«
»Wir verständigen augenblicklich die Polizei, Sir.«
»Nein, das wird nicht nötig sein.« Er fährt sich durch die Haare, und die Locke fällt ihm wieder in die Stirn. »Ich habe noch etwas mit den Herren zu besprechen.«
»Sir, Protokoll wäre –«, sagt eine Stimme hinter mir. Sie muss zu dem Typen gehören, der mich unten hält.
»Ich kenne das Protokoll. Aber ich bin noch nicht fertig mit ihnen«, erwidert der Arzt. Sein Mund ist eine einzige weiße Linie.
Hinter ihm entdecke ich die Krankenschwester von vorhin. Sie starrt mit großen Augen von mir zu Ned und wieder zurück. Wir müssen ein tolles Bild abgeben. Bestimmt bereut sie ihre Freundlichkeit und das Geld, das sie für Kaffee und Wasser ausgegeben hat.
»Wenn die Sicherheitsmänner euch freigeben, geht ihr dann noch einmal aufeinander los?«, fragt Reed unbeeindruckt. Gleichzeitig macht er einen Schritt nach vorn. Die Pflegerin will ihm folgen, aber er gibt ihr ein Handzeichen und sie bleibt stehen.
Ned gibt einen Laut von sich, ich schweige.
»Es wäre für Sie wirklich besser, wenn Sie sich gleich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen. Ich habe noch Wichtiges mit Ihnen zu besprechen.«
»Don«, flüstert die Schwester und erntet einen strengen Blick vom Arzt.
»Schwester Morgan«, erwidert er mahnend.
Was läuft zwischen den beiden? Ist es unerwiderte Liebe? Oder eine Affäre? Ausgerechnet jetzt muss ich an so einen Scheiß denken? Weil es so lächerlich ist, lache ich auf.
»Ihr könnt Sie loslassen. Aber seid jederzeit bereit für einen weiteren Zugriff.«
Langsam und spürbar widerwillig lockert der Kerl hinter mir seinen Griff. Sobald ich genug Bewegungsfreiheit zurückerlangt habe, schubse ich ihn von mir weg und rappele mich selbstständig auf. Ned macht es mir wesentlich lahmer nach und benötigt schließlich doch die Hilfe vom Doc. Dieser streckt ihm bereitwillig den Arm entgegen.
»Okay. Das habe ich mir so jetzt nicht unbedingt vorgestellt, aber ich kann Ihre Lage nachvollziehen.« Reed wischt die Hand an seinem Kittel ab und räuspert sich. »Gut, es gibt keinen einfachen Weg, es Ihnen zu sagen. Eigentlich wäre es ein Grund zur Freude.«
»Es ist immer noch ein Grund zur Freude«, korrigiert ihn sein Schatten vorlaut und tritt ebenfalls vor.
»Wären es andere Umstände, dann ja, Schwester Morgan.« Wieder der mahnende Blick. Aber keine Konsequenzen für ihr vorlautes Mundwerk. Doch, die vögeln sicher.
»Hat sie überlebt?«, fragt Ned beinahe lautlos und lenkt meinen Fokus auf sich.
Hat wer überlebt?
»Es ist uns tatsächlich gelungen, vor dem Ableben von Ms Diaz … einen Kaiserschnitt durchzuführen. Das Baby, ein Mädchen, zeigt bisher keinerlei Spuren des Unfalls. Dennoch werden wir sie zur Beobachtung für einige Zeit in die Neugeborenenstation –«
»Ein Kind?«, stoße ich geschockt aus.
Neds undefinierbare Laute übertönen meine Stimme. Mit angehaltenem Atem versuche ich, die Information zu verarbeiten.
Sie hat ein Baby erwartet?
»Oh, ich danke Ihnen!«, flennt Ned derweil, während ich mir vorkomme, als wäre ich im falschen Film.
»Pen war –«
»Ich muss sie sehen! Oh mein Gott!« Mein ehemaliger Kamerad fällt auf die Knie. Angewidert von seinem Verhalten gehe ich einen Schritt zur Seite und distanziere mich von ihm.
»Kannst du mal die Schnauze halten?«, fahre ich ihn an und schaue genervt zum Arzt. »Noch mal. Penelope war schwanger?«
Ich fühle mich wie der letzte Vollidiot. Anscheinend hat jeder im Raum es gewusst. Nur ich erfahre es als Letzter.
Doctor Reed nickt. »Allerdings haben wir uns dazu entschieden, Sie beide erst mal nicht zu ihr zu lassen. Da Sie, Mr Andrews, der Lebenspartner von Ms Diaz gewesen sind … und Sie, Mr Dawson, … ebenfalls mit ihr verkehrt ha– … nun, ich würde gern einen Vaterschaftstest anordnen.«
Einen Vaterschaftstest?
Ned scheint das Gleiche zu denken, nur dass er es laut ausspricht. »Aber –«, er wird leiser und sieht zu mir. Dann nickt er. »Okay, einverstanden.«
»Nein, wozu brauchen wir einen … Ich habe Pen …« Houston, fällt mir plötzlich ein. Reed wartet darauf, dass ich den Satz beende.
»Na schön.«
»Wunderbar. Schwester Morgan wird Sie beide – nacheinander – begleiten. Es dauert zwei bis drei Tage, bis wir das Ergebnis haben. Bis dahin würde ich Ihnen dringlichst empfehlen, dem Krankenhaus fernzubleiben. Wir werden Sie informieren, sobald wir mehr wissen.«
Ned seufzt ergeben, ehe er antwortet. »Alles, was Sie wollen.«
Um zuerst dran zu sein, stelle ich mich vor den Trottel und schaue zur Pflegerin. »Bringen wir es hinter uns.« Je schneller ich von hier wegkomme, desto besser.
»Möchten Sie sich noch von Ms Diaz verabschieden, ehe wir sie verlegen?«, fragt Doctor Reed und deutet auf das Bett, in dem Penelope liegt.
Eine Frau, die ich nicht loslassen konnte, die mich anscheinend jedoch ohne Probleme hat gehen lassen, um mit meinem – ehemals – besten Freund in die Kiste zu steigen.
»Nope. Wir haben uns schon vor langer Zeit voneinander verabschiedet«, erwidere ich, bis ich merke, dass gar nicht ich, sondern Ned angesprochen war.
»Dean …«
»Du solltest auf sie aufpassen, Ned. Mir doch scheißegal, dass ihr … du solltest nur auf sie aufpassen …«
Ned blickt betreten zu Boden.
»Lassen Sie uns gehen«, fordere ich die Pflegerin auf. Sie geht daraufhin zur Tür und hält sie mir demonstrativ auf.
»Schwester Morgan? Wenn Sie Mr Andrews weggebracht haben, legen sie Mr Dawson bitte einen neuen Verband an.«
»Aber natürlich.« Dann dreht sie sich viel zu überschwänglich wieder zu mir.
»Mr Andrews? Wenn Sie mir bitte folgen würden.«
Neuanfang
Morgan
Hätte ich heute Morgen damit gerechnet, dass sich mein Tag wie eine Folge von Greys Anatomy entwickelt, wäre ich so was von zu Hause geblieben.
Ich bin ausgebildet und vorbereitet worden, mit Blut und halluzinierenden Patienten umzugehen, und darauf, oft mit dem Tod konfrontiert zu werden. Das kann ich alles ab, sonst wäre ich keine Krankenschwester.
Doch zwei sich prügelnde Soldaten, von denen der eine gerade erfahren hat, dass seine hochschwangere Freundin gestorben ist? Und dann weiß auch noch keiner, wer von ihnen der Vater ist, weil besagte Freundin eine Beziehung mit beiden hatte? Nein danke. Da wird einem ja schon schwindlig, wenn man bloß daran denkt. So was brauche ich wirklich nicht.
Wahrscheinlich sollte ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich wirklich auf die Neugeborenenstation wechseln möchte, denn da werde ich solchen Situationen womöglich regelmäßig begegnen.
»Bloß eine weitere Ausrede, die du nicht mehr länger akzeptieren wirst, Morgan«, ermahne ich mich kopfschüttelnd, bevor ich den Vorhang wegschiebe und in die Behandlungskabine eintrete, in der Donovan momentan ein junges Mädchen verarztet. Sie scheint sichtlich angetan von meinem besten Freund, sodass sie nicht mal bemerkt, als ich dazustoße.
Donovan sieht kurz zu mir und schmunzelt. »Sicher, dass du all das hinter dir lassen möchtest, um Säuglingen ihre Milch vorzubereiten?«
»Es ist nicht nur die Milch, und das weißt du«, erwidere ich und nehme die Schere und den Tapeverband von ihm entgegen.
»Dafür hast du mich gerufen?«, frage ich enttäuscht. Er hätte mir ruhig mal einen herausfordernden Fall besorgen können, solange ich noch in der Notaufnahme arbeite.
»Nebenan behandelt Curtis einen Abszess. Du kannst jederzeit ihm assistieren«, erwidert Don trocken und begutachtet den makellos angelegten Verband.
»Danke, aber nein danke.« Ich rümpfe die Nase und mache mich an die Arbeit.
»Klebestreifen, bitte.«
»Ich bin keine Maschine«, sage ich, drücke ihm jedoch wenig später die Streifen in die Hand.
»Hast du dir schon überlegt, wohin wir übermorgen gehen?«
Ich schüttele den Kopf.
»Du denkst doch nicht ernsthaft, dass wir dich einfach so gehen lassen?«
»Don, du weißt, dass ich –«
»Heute Morgen hast du noch gesagt, dass du … mit dem Wechsel auf die Neugeborenenstation wieder … na du weißt schon, Kontrolle erlangen möchtest.«
»Hab ich?« Ich beobachte das Mädchen und zwinkere ihr aufmunternd zu, als sie zu mir sieht, aber sie reagiert nicht. Jetzt komme ich mir blöd vor und widme mich wieder den Klebestreifen.
»Wie wäre ein Drink im Beckys? Es ist fast um die Ecke, du kennst die meisten Besucher, und die Musik gefällt dir dort doch auch. Das wäre der perfekte Ort, um deine falsche Entscheidung zu zelebrieren, oder?«
»Meinetwegen«, stimme ich zu, da ich keine Lust habe, mit ihm zu diskutieren – schon gar nicht vor einer anderen Person. Und ja, kann gut sein, dass ich heute Morgen beim Frühstück lautstark verkündet habe, dass ich bereit dazu bin, mein Leben wieder so zu leben, wie ich es möchte. Es ist an der Zeit, die Erlebnisse im zweiten Semester endlich hinter mir zu lassen.
Mittlerweile sind Jahre vergangen, und ich bekomme trotzdem immer noch schwitzige Hände, wenn ich abends allein durch die Stadt laufen muss – was nicht oft geschieht, dafür sorgt Donovan.
Etwas muss langsam mal passieren. Bisher besteht mein Leben nur aus Arbeit, Schlafen, Arbeit, Essen, Arbeit, Arbeit, Arbeit.
Das macht es zumindest Donovan einfacher, mich herumzukutschieren, denn es gibt im Grunde nur drei Orte, zwischen denen ich hin und her pendeln muss: das Krankenhaus, der Supermarkt um die Ecke und unser Zuhause.
Anfangs war ich froh darüber, jetzt habe ich es satt, ihn so sehr zu brauchen. Selbst wenn er frei hat, holt er mich ab.
Ich komme damit klar, dass mein Leben stagniert. Das gibt mir jedoch kein Recht, ihn in seinem auszubremsen. Damit ist nun Schluss.
Zuerst der Wechsel von der Notaufnahme auf die Neugeborenenstation. Dann irgendwann der Schritt, mir eine eigene Wohnung zu suchen. Ich bin bereit, mein Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen.
Dass ich mich beruflich jetzt nur noch mit Säuglingen auseinandersetze, sagt doch alles oder? Ich habe mein Schicksal akzeptiert und bin bereit für den Neuanfang.
»Es ist immer noch schade. Was ist, wenn irgendwann wieder so etwas wie heute passiert? Dann bist du nicht hautnah dabei gewesen!«
»Ich bin nicht sensationsgeil«, erwidere ich und schnappe mir die Akte von Donovans Patientin. »Außerdem, die beiden machen gerade etwas Furchtbares durch. Daran sollte man sich nicht ergötzen, Don.«
Donovan blickt schließlich doch hoch zu mir. »Du hast recht. Woran man sich aber durchaus ergötzen könnte, wenn man den Beschluss gefasst hat, wieder ein normales Leben führen zu wollen …«, er macht eine Pause und ich schaue von der Akte hoch.
»Ja?«
»… wäre doch der Anblick von Sunnyboy Mike, oder nicht?«
»Machst du Witze? Mike?«
»Ich hab ihn eingeladen.«
»Mike ist immer überall, wo gefeiert wird. Der braucht keine Einladung. Außerdem –«
»Für diesen Kerl würde ich meine Hände ins Feuer legen. Und du weißt, wie wichtig sie mir sind.« Er wedelt demonstrativ mit seiner Hand, die in einem Latex-Handschuh steckt, ehe er sich wieder seiner Patientin widmet. »Kein Geräteturnen für mindestens einen Monat, hörst du?«
»Es sind Ferien«, erwidert das Mädchen.
»Dann … klettere eben nicht auf Bäume, bis dein Handgelenk wieder verheilt ist.«
»Ich bin fünfzehn! Da klettert man nicht mehr auf Bäume.«
»Will ich überhaupt wissen, wie du dir dein Handgelenk dann verstaucht hast?« Donovan klebt die letzten Streifen auf den Verband und inspiziert sein Werk erneut, ehe er das Mädchen prüfend ansieht. »Nein, will ich nicht«, beschließt er und schnappt sich die Akte. »Gut. Wir sind fertig.«
Die Patientin springt von dem Behandlungsstuhl, aber Donovan hält doch noch einmal seine Hand hoch. »Moment, ich hätte beinahe etwas übersehen. Hier steht, dass du außerdem über Bauchschmerzen geklagt hast.«
»Ist schon besser«, erwidert das Mädchen plötzlich nervös.
»Brooklyn, du bist in einem Jahr sechzehn. Ein Junge, der ganz klar in der Pubertät ist, liefert dich hier mit knallrotem Kopf ab. Nicht nur, weil du dir das Handgelenk verrenkt hast, was durchaus auch beim Umrühren von Pancake-Teig passieren kann, da will ich dir gar nichts unterstellen. Aber du hast immer noch Bauchschmerzen, oder nicht? Wäre es so verkehrt, wenn ich einen Schwangerschaftstest anordnen würde?«
Donovan rollt auf seinem Drehhocker zu mir und wartet auf ihre Antwort.
»Erzählen Sie es dann meiner Mom?«
»Natürlich nicht.«
Sie atmet tief durch – nicht erleichtert, sondern wie ein Stier, der kurz vor dem Angriff steht. »Ich bringe Danny um.«
»Nach dem Test kannst du das gern machen«, murmelt Donovan und nickt mir zu. »Schwester Morgan wird dich zum Labor begleiten. Je nachdem, wie das Ergebnis ausfällt, bitte ich dich jedoch, noch einmal Rücksprache mit deinem Hausarzt zu halten, okay? Für heute gebe ich dir leichte Schmerzmittel wegen deiner Hand mit, das sollte genügen.«
Brooklyn nickt und zieht sich ihre Jacke über, während Donovan die Handschuhe von seinen Fingern zieht und lässig in die Mülltonne wirft.
»Schaffst du es nachher allein mit dem Taxi nach Hause, Morgan?«
Überrascht halte ich dabei inne, Schere und Klebeband zu verstauen. »Was steht an?«
Es gibt nur einen Grund, wieso er mich in ein Taxi stecken würde: Eine ziemlich spannende und seltene Operation.
»Ich hab ein Date«, gesteht er und stupst mit dem Finger gegen seine Nase, als wolle er seine Brille hochschieben, die er aber momentan nicht trägt.
Ungläubig starre ich ihn an. »Mit wem?«
»Courtney Devoire«, entgegnet er und lässt zeitgleich Stolz und Nervosität durchblitzen.
»Oh mein Gott!«, stoße ich aus und umarme ihn, bis mir Brooklyn wieder einfällt. Schnell lasse ich ihn los.
»Ist das hier wirklich so wie in den ganzen Krankenhausserien?«, fragt sie neugierig. Anscheinend hat sie unsere Unterhaltung mitbekommen.
Ich schüttele den Kopf und lege ihr meinen Arm um die Schultern. »Es ist noch viel skandalöser«, sage ich in einem verschwörerischen Flüsterton und führe sie zu dem Vorhang. »Du wirst mir alles erzählen«, raune ich Donovan zu, bevor ich mich von ihm entferne und Brooklyn zum Labor bringe.
Soso. Don hat es also geschafft, Courtney zu einem Treffen mit sich zu überreden. Dieser Tag muss im Kalender rot angekreuzt werden! Seit diese Powerfrau in unserem Apartmentkomplex eingezogen ist, träumt Don von ihr. Wenn heute die Chance besteht, dass sie gemeinsam den Abend beenden, dann schaffe ich es natürlich in einem Taxi nach Hause. Für Donovans erfolgreiches Sexleben würde ich sogar die halbe Stunde zu Fuß laufen.
Okay, das ist gelogen.
Trotzdem, ich werde es ja wohl schaffen, mich von einem wildfremden Taxifahrer nach Hause fahren zu lassen. Besser gesagt, ich muss es schaffen, wenn ich diesen Neuanfang haben möchte – und ich möchte.
Schwarz auf weiß
Dean
Meinen Kameraden sind Gliedmaße von ihren Körpern geflogen. Wir haben Nächte im Gestank von Schwefel und Verwesung ausgeharrt und tagelang nichts gegessen. Von nichts davon war mir schlecht geworden. Doch seitdem ich das Ergebnis des Vaterschaftstestes in den Händen gehalten habe, und das Baby schwarz auf weiß von mir ist, ist mir kotzübel.
Ich weiß nicht, was surrealer ist. Dass Penelope tot ist, sie fast neun verdammte Monate schwanger gewesen ist, ohne es mir zu sagen, oder die Tatsache, dass sie die ganze Zeit mein Kind erwartet hat. Würde ich nicht sitzen, dann würde ich womöglich noch umkippen, so sehr kreisen meine Gedanken.
Was soll ich mit einem Baby?
Oder eher, was soll das Baby mit mir?
Ich kann kein Kind großziehen. Selbst einen Tag am Leben zu bleiben, ohne mit dem Tod zu liebäugeln, fällt mir schon schwer. Nachwuchs stand nie auf dem Plan. Penelope und ich haben nicht einmal über das Thema gesprochen, so selbstverständlich war das für uns gewesen.
Als Lieutenant habe ich Prioritäten im Leben, und Penelope wusste das von Anfang an. Mein Job steht an erster Stelle, und mehr kann ich mir nicht leisten. Dafür ist mein Leben zu unberechenbar, und niemals hätte ich einem Baby das Schicksal des Soldaten-Kindes aufgezwungen. Das wäre egoistisch von mir gewesen.
Wie hätte eine Familie mit Penelope funktioniert, wenn für sie jedes Mal das Risiko bestand, sich ausdenken zu müssen, warum Daddy dieses Mal nicht nach Hause kommt? Warum er womöglich nie mehr zurückkehrt?
So beliebt diese dämlichen Videos auf YouTube sind, in denen Soldaten zu ihren Liebsten heimkehren und alle heulen, so grausam ist die Realität. Niemand filmt die Witwen und Hinterbliebenen, wenn ein Kamerad im Kampf fällt. Niemand will wissen, dass Soldaten öfter in einem Sarg nach Hause kommen als unversehrt.
Dieses Leben wollte ich nie für Penelope und schon gar nicht für ein Kind. Nicht einmal vor Afghanistan, als ich noch grün hinter den Ohren gewesen bin, noch nicht alles gesehen hatte und vollgepumpt war mit dem Wunsch, ein Held zu sein.
Hätten wir ein normales Leben geführt, dann vielleicht.
Ja, dann hätte ich mir eine Familie mit ihr vorstellen können. Aber so? In meiner Situation wäre Nachwuchs nur ein rücksichtsloser Fehler gewesen. Kinder sind für Finanzheinis und Prominente mit Nannys, die sich eine schöne heile Welt leisten können. Punkt.
Nichts da ›Punkt‹, Dean. Du kannst keinen Punkt nach etwas setzen, auf das du keinen Einfluss mehr hast.
Ich grunze und reibe mir die Wangen, aber die Gedanken bleiben, also gehe ich in mein mickriges Badezimmer. Dort drehe ich den Hahn auf und tauche mein Gesicht in kaltes Wasser.
Ich bin Vater. Ich habe eine Tochter. Eine Verantwortung.
Augenblicklich ziehe ich meinen Kopf aus dem Becken und starre in mein Spiegelbild. Eine nasse, müde Version von mir starrt zurück.
Ich habe im Leben schon oft beschissen ausgesehen. Der typische Soldaten-Haarschnitt – Seiten kurz, oben lang – und ein beinah vollständig glatt rasiertes Gesicht sind nicht besonders praktisch, um Augenringe zu kaschieren. Mein blondes, nasses Haar hängt mir in die Stirn, meine Wangen sind rot von dem kalten Wasser und meine braunen Augen groß und panisch.
Jep, ich habe noch eine ordentliche Schippe an beschissen draufgelegt.
Um mir das Gesicht abzutrocknen, packe ich mein T-Shirt am unteren Saum. Dann entscheide ich mich um, schäle mich ungeduldig aus meinen Klamotten und steige stattdessen in die Dusche.
Das Wasser stelle ich absichtlich auf die kälteste Stufe, damit mein Kopf die kühle Nässe verarbeiten muss und kein Platz für andere Gedanken bleibt. Mir fehlt die Energie, um mich mit irgendetwas auseinanderzusetzen.
Ich bin so verdammt müde.
Erschöpft.
Und Vater.
Frustriert stöhne ich. Damit der Wasserstrahl gnadenlos auf meine nackte Haut prallt und es mir unmöglich macht zu denken, drehe ich ihn vollständig auf.
Aber nach nur wenigen Minuten hat sich mein Körper an die Kälte gewöhnt und bringt mir rein gar nichts mehr. Deshalb erledige ich das Nötigste, seife meinen Körper ein und stelle mich dann mit dem Gesicht frontal dem Duschkopf entgegen.
Ich bin Vater.
Fuck.
Auch Stunden später wühlt mich die Tatsache noch extrem auf, und in meinem Schuhkarton von Apartment habe ich nicht viel Platz, um gebürtig durchzudrehen, weshalb ich in meinen Range Rover steige und ziellos durch die Stadt fahre.
Als ich jedoch eine halbe Stunde später vor einem kleinen Einfamilienhaus parke, stelle ich fest, dass es gar keine so ziellose Fahrt gewesen ist.
Ich schalte den Motor ab, steige aus und starre eine gefühlte Ewigkeit lang auf das Backsteinhaus, in dessen Vorgarten neben einer Hollywoodschaukel allerlei an Dekoration steht.
Das Haus gehörte Penelope. Sie hatte es nach dem Tod ihrer Großmutter geerbt, und obwohl es stark vernachlässigt und renovierungsbedürftig gewesen war, hatte sie sich sofort darin verliebt.
Mit meiner Hilfe hatte sie zumindest innerhalb der nächsten Woche heißes Wasser. Tausende Stunden und literweise Schweiß später, war es zu dem Zuhause geworden, das sie sich immer vorgestellt hatte.
An diesem Haus hängen viele Erinnerungen … Ein Stück weit war es auch mein Zuhause gewesen, auch wenn ich seit Monaten keinen Fuß mehr hineingesetzt habe.
Wenn ich ehrlich bin, dann war meine Beziehung mit Pen schon lange vorbei gewesen. Das Einzige, was uns zusammengehalten hat, war die Bequemlichkeit. Wahrscheinlich ist es sogar meine Schuld, dass aus uns dieses Geister-Paar geworden ist, denn ich habe Pens Versuche nach Nähe jedes Mal mit noch mehr Distanz zwischen uns abgeschmettert.
Mein Blick streift zur amerikanischen Flagge über der Eingangstür.
Ja, Penelope hatte immer mehr von uns gewollt. Kein Wunder, dass sie mich aufgegeben hat, als ich ihr das nicht geben konnte.
Ich bin nicht einmal richtig angekotzt, dass Ned sie mir ausgespannt hat … oder es vorgehabt hat. Ned ist ein netter Kerl, der mit Sicherheit nicht gezögert hat, alles in seiner Macht Stehende zu unternehmen, um sie glücklich zu machen.
Es ist daher pure Ironie, dass ich es nun bin, der mit einem Neugeborenen dasteht.
Mit einem Mal redebedürftig, blicke ich in den dunkler werdenden Himmel. »So hast du dir das wohl nicht gedacht, was? Du hast dir einen neuen Lebensabschnitt mit Ned gewünscht. Bestimmt warst du auch überzeugt davon, dass es sein Kind ist und nicht meins. Weißt du, was? Das wäre verdammt noch mal besser gewesen!«, brülle ich in die Wolken hinein. »Es ist von mir, hörst du? Von mir! Du hast die ganze Zeit mein Kind in dir getragen! Ist das nicht ironisch? Endlich hast du deinen Wunsch nach Mehr erfüllt bekommen! Und jetzt? Jetzt hab ich ein beschissenes Baby, und du bist –« Wütend balle ich die Hände zu Fäusten und ziehe scharf die Luft ein, als sie vor Schmerz ziepen. »Du bist tot, verdammt! Wie kannst du tot sein und mich mit diesem – was jetzt, Pen?«
Verzweiflung überkommt mich, weil mir mit einem Mal die Schwere der Situation bewusst wird. Ich habe ein Baby und keine Ahnung, was ich machen soll.
Ein Kind, das ohne Mutter aufwachsen wird.
Aber sie hat dich.
»Nein!«, belle ich, als ich die Stimme in meinem Kopf der von Pen zuordnen kann.
Ich drehe durch. Ich drehe vollkommen durch!
Mit großen Schritten haste ich zurück zu meinem Auto, steige ein und verriegele die Tür.
Ich kann unmöglich ihr Vater sein! Ausgerechnet ich soll ein Kind großziehen? Das kann ich nicht!
Nicht, nachdem ich eins getötet habe.
Panik überkommt mich und schnürt mir den Hals zu.
Langsam ein- und ausatmen.
Die Stimme der Krankenschwester hallt in meinem Kopf wider und ich versuche, die dämlichen Atemübungen nachzumachen, die sie mir gezeigt hat. Es hilft kein bisschen, um mich zu beruhigen. Doch bevor ich an meinen Dämonen ersticke, setzt ein Urinstinkt ein und ich schreie.
Ich schreie, bis ich heiser bin und mein Hals kratzt. Dabei schlage ich immer wieder gegen das Lenkrad, bis meine Knöchel nicht mehr nur geschwollen sind, sondern die Haut aufplatzt und ich blute.
Aber weil es alles ist, was ich machen kann, schlage und brülle ich weiter, bis ich schließlich erschöpft und emotional ausgelaugt auf mein Handschuhfach starre.
Es wäre so einfach.
Meine Finger wandern wie von selbst zu dem Griff, öffnen das Fach und umfassen wenige Sekunden später den Griff eines Revolvers.
Erschießen Sie mich, bitte! Bitte! Mr Dean, ich flehe Sie an. Geben Sie mir einen ehrenvollen Tod.
Schlagartig lasse ich die Waffe fallen und presse meine Lider zusammen. Dann halte ich mir die Ohren zu.
Doch egal, wie fest ich meine Augen zudrücke, wie stark ich mein Trommelfell abdichte, ich schaffe es nicht, die Stimme in meinem Kopf loszuwerden, die zu jenem Kind gehört, das durch meine Hand getötet wurde.
Sein Tod hat mein ganzes Leben verändert.
Omar Jassim war zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.
Er wollte nur helfen, aber dann … dann war er selbst zu schwer verletzt. Seine Blutungen waren zu stark, um eine Nacht zu überleben und zu schwach, um sofort zu sterben.
Nicht einmal vierzehn Jahre alt ist er geworden.
Weil ich ihn erschossen habe.
Nimm die Waffe!
Meine Sicht verschwimmt, gleichzeitig sehe ich Omar und mich glasklar in den Trümmern und höre meine Stimme, laut, deutlich und feige.
Mit zitternden Fingern hebe ich den Revolver vom Boden hoch.
Nein, ich kann nicht.
Ich kann mir keine Kugel ins Gehirn jagen. Es wäre eine Beleidigung für all die unschuldigen Menschen, die sterben mussten, damit wir überleben.
Eine Beleidigung für all die Veteranen, die lernen mussten, mit ihren Dämonen zu leben.
Und es wäre unverzeihlich gegenüber dem Baby, das ohne mich niemanden mehr hätte.
Ein weiteres Mal lasse ich die Waffe fallen, als es mich mit ganzer Wucht trifft.
Ich habe auch niemanden mehr.
Das Leben ist scheiße
Morgan
Die Tür meines Spindes fällt ins Schloss, und nachdem ich den anderen Kolleginnen eine schöne Schicht gewünscht habe, verlasse ich die Umkleide.
Das war er also. Mein letzter Tag in der Notaufnahme.
So kitschig es klingt, ich verlasse die Abteilung mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Die Pöbeleien, Junkies und das allgegenwärtige Sicherheitsteam werde ich definitiv nicht vermissen, aber mein Herz weint, weil ich Donovan von nun an seltener sehen werde.
Weil sein Name ein dutzend Mal auf dem OP-Brett steht und er auch privat unglaublich gefragt ist, bekomme ich ihn ohnehin nicht oft zu Gesicht. Er kehrt meist erst am nächsten Morgen heim, wenn ich allein in der WG hocke und vor einem Tom-Cruise-Film eingeschlafen bin.
Deswegen war es immer so praktisch gewesen, dass ich ihm als Krankenschwester assistieren konnte, wann immer er nach mir gerufen hat. So haben wir uns wenigstens auf der Arbeit gesehen. Das werde ich ganz schön vermissen.
Außerdem wird er mir noch wochenlang den Wechsel nachtragen.
Aber es ist an der Zeit.
Vor dem zweiten Semester, bevor mein Leben auf den Kopf gestellt wurde, war die Neugeborenenstation mein großes Ziel gewesen. Danach war die Notaufnahme mein Rettungsboot gewesen, und Donovan mein Kapitän.
Doch es wird Zeit, das sichere Gewässer zu verlassen.