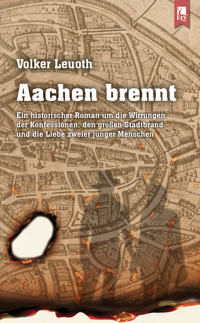
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Aachen im Jahr 1656. Zwischen der streng katholisch erzogenen Anna Maria und dem Protestanten Johannes hat sich eine zarte Liebe entwickelt. Sie leiden wie viele Bürger der Stadt unter religiöser Intoleranz, den Wirrungen in Glaubensfragen und der Angst vor dem Inquisitionsgericht. Es folgen dramatische Entwicklungen mit Auswirkungen auf ihr Alltagsleben, die Familien und ihre Liebe. Beide werden an unterschiedlichen Orten in die Katastrophe des großen Stadtbrandes hineingezogen, der Aachen nahezu vollständig zerstört. Trotz dieser Spannungen wollen sie zueinander finden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Volker Leuoth
Aachen brennt
Über den Autor:
Volker Leuoth ist promovierter Lehrer für Sonderpädagogik. Er arbeitete viele Jahre in der Lehrerausbildung und hatte einen Lehrauftrag an der Universität zu Köln. Der Autor ist Mitverfasser verschiedener Schulbücher. Zuletzt unterrichtete er am College der VHS Aachen. Volker Leuoth ist verheiratet und lebt in Aachen.
Der Nachfolgeroman zu dem vorliegenden Buch um den Großen Stadtbrand »Der Himmel bestimmt deine Zeit« erscheint 2021 ebenfalls im Eifeler Literaturverlag.
Die Erstauflage seines historischen Romans »Aachen brennt« sowie der Roman »Gefährliche Grenze« erschienen 2012 bzw. 2015 im Aachener Einhard Verlag. Die Romanbiografie »Alis Reise nach Aachen« wurde 2017 vom Verlag Mainz in Aachen herausgegeben.
Volker Leuoth
Aachen brennt
Ein historischer Roman um die Wirrungen der
Konfessionen, den großen Stadtbrand
und die Liebe zweier junger Menschen
Eifeler Literaturverlag 2021
Impressum2., ergänzte Auflage 2021
© Eifeler Literaturverlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Erstausgabe 2012, Einhard Verlag, Aachen
Eifeler Literaturverlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.eifeler-literaturverlag.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Abbildungsnachweis (Umschlag):
Illustration Dietrich Betcher
Innen:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Aachen-Stadtansicht-Merian-1645.png
https://picryl.com/media/ansicht-der-stadt-aachen-und-ihren-umgebungen-vue-de-aix-la-chapelle-et-de-9b8f6b
Print:ISBN-10: 3-96123-019-6
ISBN-13: 978-3-96123-019-8
E-Book:
ISBN-10: 3-96123-029-3
ISBN-13: 978-3-96123-029-7
Stadtplan von Aachen um 1645
1
An einem Morgen im April des Jahres 1656 verließ der Geigenbauer Anton Sander bei Sonnenaufgang sein Haus in der Scherpgasse in Aachen.
Vorsichtig zog er die schwere Eichentür hinter sich ins Schloss, drehte den mächtigen Schlüssel herum und steckte ihn in sein Wams, das er wie immer trug, um sich vor der rauen Witterung zu schützen, für die Aachen und seine Umgebung bekannt war. An diesem Morgen hätte er darauf verzichten können, denn die Sonne war zur frühen Stunde bereits so angenehm warm, wie er es zu dieser Jahreszeit selten erlebt hatte. Er spürte die Wärme, die von der Hauswand zurückgeworfen wurde. Prüfend schaute er nach oben und sah vor den dahinziehenden Wolken die Silhouette seines stattlichen Hauses.
Trotz des herrlichen Wetters schien Sander bedrückt. Sein von der Arbeit leicht gebeugter Rücken war stärker als sonst nach vorn gerichtet und bildete einen merkwürdigen Kontrast zu seiner jugendlich wirkenden Haarpracht.
Noch war es in der Gasse ruhig. Einzig der Kater von gegenüber hockte auf dem Fensterbrett und wartete wohl darauf, nach seinem nächtlichen Streifzug ins Haus gelassen zu werden. Die Wärme der frühen Morgensonne tat auch ihm sichtlich gut.
Die meisten Bürger dieses Viertels zwischen Münster, Jakobgasse und Graben brauchten nicht so früh aus den Betten zu kriechen. Sie hatten weder Vieh zu versorgen, noch gingen sie schwerer körperlicher Arbeit nach. Hier lebten Kaufleute, deren Geld zu so früher Stunde auch ohne sie arbeitete, und es wohnten Handwerker hier wie Anton Sander, der als Geigenbaumeister bereits in der dritten Generation dieses Handwerk ausübte.
Die hoch aufragenden Giebel der Fachwerkhäuser zeugten von einem gewissen Wohlstand ihrer Bürger. In nur wenigen Straßen und Gassen der Stadt konnte man das Geschaffene so stolz herzeigen. Kleine Lehmhäuser, verstärkt mit Holzbalken und mit Grasdächern darauf, prägten ansonsten überwiegend das Bild der Reichsstadt. Sie duckten sich im Schatten der riesigen Stadtmauer mit ihren mächtigen Stadttoren, umgaben das Münster und das Rathaus.
Wie ein Bollwerk Gottes wachte vorn am Anfang der Scherpgasse das Benediktinerinnenkloster darüber, dass hier alles seinen ruhigen, geregelten Gang nahm. Einige Juden hatten es geschafft, in die Welt der christlichen Kaufleute und Zünfte vorzudringen und sich in diesem Viertel niederzulassen.
Wäre Anton Sander in Richtung des Klosters gegangen, hätten ihn bald die stampfenden Geräusche und die Stimmen der Löher erreicht. Jenseits des Grabens, dort wo sie ihrem übel riechenden Handwerk nachgingen, standen die Lehrbuben bereits zu früher Stunde bis zu den Knien in den Güllebütten und walkten Leder. In dem Gemisch von beißendem Gestank und halblauten Flüchen über das kalte Wasser träumte der eine oder andere vergeblich davon, eventuell einmal die hübsche Tochter des Meisters zu heiraten, die ihn damit von dieser Arbeit befreien könnte.
Anton Sander wandte sich aber zur anderen Seite, dem Münster zu. Noch war alles um ihn herum still.
Kaum hatte er die Scherpgasse hinter sich gelassen, trat er in eine scheinbar andere Welt. Auf dem Rund des Fischmarktes herrschte schon reges Treiben. Pferdewagen waren, mit allerlei Gütern vollgepackt, angefahren und wurden entladen. Bereits ausgespannte Pferde soffen aus dem Paubach, der den Platz querte. Ein paar Hunde balgten sich um Fischabfälle. Seitlich des Münsterhofes bauten Marktfrauen zusammen mit Fuhrknechten die ersten Stände auf. Es schien allen Beteiligten recht zu sein, bereits so früh zu arbeiten, denn die teils anzüglichen Zurufe zwischen den Geschlechtern ließen auf gute Stimmung an diesem hellen Morgen schließen.
Das alles nahm Anton Sander nicht wahr, als er schnellen Schrittes den Fischmarkt in einem Bogen umging und auf den Münsterhof zusteuerte. Gerade hatte er das riesige Eisentor durchschritten, das wie ein Grenzzaun die sakrale Welt des Münsters vom Übrigen trennte. Er schaute sich noch einmal um, so, als würde er von irgendetwas Abschied nehmen wollen und tauchte ins feierliche Dunkel der Kirche ein.
Sander durchschritt die Vorhalle, die mit ihrer Kühle und Stille stets eine besondere Feierlichkeit in ihm auslöste. Heute ließ ihn das alles frösteln. Am liebsten hätte er kehrt gemacht und wäre wieder hinaus in die helle Morgensonne gestürzt.
Nachdem er das schwere Bronzetor am Oktogon hinter sich geschlossen hatte und ein paar Schritte gegangen war, tauchte er seine rechte Hand in das am Pfeiler angebrachte Weihwasserbecken. Schon zu früher Stunde waren Gläubige zum Gebet hier gewesen. Sander konnte es am frischen Kerzengeruch erkennen. Im Moment schien er aber der einzige Besucher zu sein. Durch die oberen Fenster des Gotteshauses drangen inzwischen die ersten Sonnenstrahlen.
Er sah sie nicht, denn ein Schatten löste sich aus dem südlichen Pfeiler der Kirchenrunde und kam näher. Im Halbdunkel erkannte er einen im Mönchshabit gekleideten Mann. Er war groß. Der kahl geschorene Schädel mit dem Haarkranz passte zu der spitzen, hässlichen Nase. Sander drängte sich der Vergleich zu dem Schnabel eines Raubvogels auf.
Fast lautlos näherte sich der Mann. Nun stand er vor Sander. Es verwirrte ihn, dass über dem Haupt des Mönches von weit her die Madonna mit dem Strahlenkranz herüberblickte und den Geheimnisvollen wie einen Heiligen erscheinen ließ.
Ohne Sander einen Gruß zukommen zu lassen, sagte er mit einer ziemlich hohen und angesichts des heiligen Ortes gedämpften Stimme, die nicht recht zu der großen Gestalt passen wollte: »Ihr seid der Geigenbauer Sander?« Als dieser stumm nickte, fuhr der Mönch fort: »Folgt mir!«
Ohne sich noch einmal umzublicken, schritt der Mönch vor Sander her in Richtung der Nikolauskapelle. Sander hatte keine Vorstellung, wohin es gehen würde. Noch nie war er in die Räume außerhalb des Oktogons vorgedrungen. Natürlich kannte er die Matthiaskapelle oder die Annakapelle, durch die man auch in das Gotteshaus gelang. Ansonsten war die Kirche ein Ort, den man zur Messe betrat und danach gleich wieder verließ. Um herumzulaufen und den Ort zu erkunden, war hier alles für ihn viel zu heilig.
Seine Nerven waren angespannt. Er fühlte sich immer elender, je mehr Schritte es wurden, die er, wie magisch angezogen, hinter der unbekannten Gestalt ging.
Schließlich steuerte der Mönch auf eine kleine Tür zu und trat in den Kreuzgang ein, von dem Sander nur wusste, dass es ihn gab.
Unvermittelt blieb der Mönch stehen und blickte zum Inneren des Kreuzganges. Vor ihnen breitete sich ein Garten mit vielfältigen Gewächsen aus. Wege kreuzten sich. Aber zu sehen war niemand, der sie hätte benutzen können. Hier im Hellen wurde es Sander wieder besser.
Plötzlich starrte ihn der Mönch mit seinem Raubvogelgesicht über die Schulter hinweg an und sagte mit fester Stimme: »Ihr werdet gleich vor dem Vertreter des Inquisitionstribunals stehen. Überlegt genau, was Ihr vorzubringen habt!«
Damit wandte er sich einer eisenbeschlagenen Eichentür zu, klopfte kurz ohne auf eine Reaktion zu warten und öffnete sie.
Sander schaute in einen ziemlich kahlen, zellenähnlichen Raum. Das kleine Fenster gegenüber der Tür spendete etwas Licht. Ein breiter Tisch beherrschte fast den gesamten Raum. Geruch nach Gebratenem hing in der Luft, woraus Sander schloss, dass sich die Herrschaften vor dem Verhör gestärkt hatten. Wie viel Wein oder Bier dabei zu so früher Stunde bereits schon geflossen war, wollte er sich gar nicht ausmalen.
Auf dem Tisch stand ein großes Kruzifix aus Bronze. Vor einem der Anwesenden lag ein Schriftstück, sonst befand sich nichts auf dem Tisch.
Um den Tisch herum saßen drei Geistliche. Zwei von ihnen hatten wie der Mönch, der ihn im Oktogon abgeholt hatte, geschorene Schädel mit einem kleinen Haarkranz. Nach Sanders Einschätzung gehörten sie dem Orden der Dominikaner oder der Franziskaner an. So genau kannte er sich damit nicht aus. Es war ihm in diesem Moment aber auch gleichgültig. Die Männer schauten regungslos auf die beiden Eintretenden. Der Mönch an der Stirnseite des Tisches thronte wie ein feistes Schwein. Das Habit spannte sich über seinen Leib. Die kurzen Arme hatte er in den Ärmeln vergraben und hielt sie verschränkt vor sich. Auffallend war, dass er eine ziemlich dunkle Gesichtsfarbe hatte, jedenfalls dunkler, als es Sander von den Aachener Bürgern kannte und er selbst aussah.
Als er vor den Tisch trat, lächelte der Mönch hintergründig aus seinen verfetteten Äuglein. Die beiden anderen schienen jünger zu sein, waren schlank und hatten wohl die Aufgabe, irgendwelche Dienste zu verrichten. Der rechts Sitzende trug kein Mönchshabit, sondern eine Soutane.
Unvermittelt und geräuschlos stand der junge Mönch auf, ging zu einem Wandschränkchen, aus dem er einen Stapel Papier und Feder mit Tinte nahm, und setzte sich wieder hin. Er legte die Sachen vor sich hin, baute Tinte und Feder sorgfältig auf und zog das Papier so dicht an die Tischkante, dass er auf Geheiß sofort mit dem Schreiben beginnen konnte.
Noch hatte niemand etwas gesagt. Der Mönch, mit dem Sander gekommen war, hatte die Tür hinter sich geschlossen und lehnte sich wie ein Wächter an diese. Sander fiel auf, dass keine Sitzgelegenheit für ihn vorgesehen war.
Niemand schien ihn weiterhin zu beachten.
Plötzlich räusperte sich der dicke Mönch, beugte sich nach vorn, stützte die Arme auf und sprach Sander in einer Sprache an, die er nicht verstand. Harte, raue Laute drangen an sein Ohr. So etwas hatte er noch nie gehört. Ihm fiel besonders auf, wie schnell die wenigen Worte gesprochen wurden. Ganz anders, als es in seiner Aachener Sprache vorkam.
Obwohl er nicht wusste, was mit ihm geschah, hatte er den Eindruck, dass der Mönch ihm gegenüber gut gesinnt war, denn seine Worte klangen ruhig.
Als der Dicke mit seinem Satz fertig war, lehnte er sich zurück. Er schaute zu dem Priester, der bislang nur scheinbar unbeteiligt dabei gesessen hatte und nickte ihm zu.
Erst jetzt bemerkte Sander, dass der junge Mann eine ähnlich dunkle Hautfarbe hatte wie der dicke Mönch. Seine Haare waren kurz geschnitten. Ein gepflegter Backenbart umrahmte das ovale, schöne Gesicht. Die blauen Augen schienen nicht zu dem dunklen Äußeren zu passen, gaben ihm aber ein interessantes Aussehen. Seine schlanken Hände zeigten, dass sie keine schwere Arbeit verrichten mussten. Unwillkürlich stellte sich Sander vor, wie der junge Mann im weißen Wams und mit einem lustigen Hut auf dem Kopf hübschen Mädchen beim Tanz auf der Kirmes den Kopf verdrehte.
Eine Bewegung lenkte Sanders Aufmerksamkeit wieder auf das Geschehen. Der junge Geistliche richtete sich auf, wandte sich Sander zu, schaute ihm ins Gesicht und begann mit wohlklingender Stimme in leicht gebrochenem Deutsch: »Der Beauftragte des Inquisitionstribunals wird Euch nun befragen, was Ihr gegen die Hebamme Klara Janssen aus dieser Stadt vorzutragen habt. Fasst Euch kurz, denn es stehen heute noch viele Befragungen an.«
Sander vermutete, dass der Übersetzer die letzten Worte eigenmächtig hinzugefügt hatte, denn so lange hatte der Fettwanst gar nicht gesprochen.
Derweilen hatte der Schreiber eilig seine Feder in das Tintenfass getaucht, beugte sich nun tief über das Papier und begann kratzend zu schreiben.
Sander holte tief Luft, denn er wusste, dass es jetzt kein Zurück mehr gab.
Der kurze Brief, den er vor einigen Tagen an das Tribunal geschrieben hatte, nachdem dieses von Süden kommend, in der Stadt eingetroffen war, lag nun als Dokument vor. Ein anonymer Bote war gestern am späten Abend bei ihm aufgetaucht und hatte ihm die Aufforderung überbracht, am heutigen Morgen zu früher Stunde in das Münster zu kommen. In der Nacht hatte er sich auf seinem Lager unruhig von einer Seite zur anderen gewälzt. Albträume bereiteten ihm furchtbare Ängste. Noch nie seit dem Tod seiner Frau hatte er so schlecht geschlafen.
Nun stand er vor dem geistlichen Tribunal, über das er manche schlimme Sache gehört hatte. Aber konnten sich die Gottesmänner irren, wenn es darum ging, Seelen zu retten, den Fluch von jemandem zu nehmen oder alte Frauen und auffallend hübsche Rothaarige zu bestrafen, wenn sie nachts dämonische Messen abhielten und den Teufel in der Gestalt von Böcken anbeteten?
Sander war ein treuer Sohn der Kirche. Mit dieser Stärkung im Rücken begann er nun wie von selbst zu sprechen: »Die Hebamme Klara Janssen ist eine Zauberin!«
Er machte eine Pause, um seine Worte wirken zu lassen.
»Ich klage sie daher an, als Hebamme das Neugeborene meiner Tochter Johanna in den Arm genommen und fest an sich gedrückt zu haben, als die junge Mutter noch nicht wieder bei sich war, und so den Samen des Teufels in das Kind gepflanzt zu haben. Das Kleine ist blau angelaufen. Es hat nur kurz gelebt. Bald darauf ist es gestorben. Die Alte hatte vorher noch versucht, das Kind mit Heilkräutern zu verhexen.«
Sander hatte sich in Wut geredet. Die Sätze seiner Anklage kamen stoßweise und ohne Zusammenhang. Er hatte so schnell gesprochen, dass der Übersetzer kaum nachkam und ihm mit einer kurzen Handbewegung Einhalt gebot, damit der dicke Mönch auch etwas davon verstehen konnte.
»Und meine Tochter ist darüber krank geworden an ihrer Seele.« Sander war nicht zu bremsen. Wie gehetzt wollte er alles los sein. Schweiß stand auf seiner Stirn.
Still war es in dem Verhandlungsraum, mäuschenstill. Nur das unangenehme Kratzen des Kiels war zu hören. Der Schreiber kam mit seinem Protokoll fast nicht nach. Sander wusste, dass alle seine Worte nunmehr festgehalten waren, unauslöschlich. Es sei denn, es würde brennen!
Nicht nur sein Hals brannte, auch sein Herz – und einen Moment lang wünschte er sich, dass alles hier wie ein Fegefeuer lichterloh in Flammen aufginge!
Zu gern hätte sich Sander hingesetzt, aber niemand machte Anstalten, ihm einen Schemel anzubieten.
Schließlich blickte der dicke Mönch auf und sprach Sander an, als ob dieser seine Sprache inzwischen verstehen würde. Dabei verschwanden seine Schweinsäuglein fast unter den wulstigen Augenbrauen.
Der junge Geistliche übersetzte sofort: »Man möchte von Euch wissen, ob bei der Geburt ein Heilkundiger anwesend war.«
Auf diese Frage war Sander nicht vorbereitet.
Ihm fiel plötzlich ein, dass aus den bruchstückhaften Sätzen seiner Tochter und ihres Mannes hervorgegangen war, dass ein heilkundiger Mönch aus dem Alexianerkloster sich kurz vor den einsetzenden Wehen im Haus aufgehalten hatte und dann nicht mehr gesehen wurde.
Dies berichtete Sander und fügte noch hinzu: »Die Hebamme hatte dem Heilkundigen eine glatte Geburt vorgetäuscht, um das Kind für sich haben und es dem Teufel überlassen zu können.«
Nach ein paar Momenten des Schweigens schlug der dicke Mönch mit der flachen Hand auf den Tisch, wandte sich kopfnickend an die anderen und stand auf, indem er sich auf die Armlehnen stützte und seinen massigen Körper aus dem Sessel stemmte.
Der Übersetzer erhob sich ebenfalls, und Sander stand ihm nun genau gegenüber. Es war ihm wohl die Aufgabe übertragen worden, Sander den weiteren Fortgang des Verfahrens zu erklären.
»Wir werden«, setzte er an und starrte auf Sander, als ob er ihm sein eigenes Todesurteil verkünden würde, »die Hebamme Klara Janssen im Namen der Kirche vorführen lassen. Vor dem weltlichen Schöffenstuhl wird bald eine peinliche Befragung stattfinden. Ihr seid entlassen – gelobt sei Jesus Christus.«
»In Ewigkeit Amen«, hörte sich Sander noch sagen und befand sich bereits draußen im Kreuzgang.
Wie im Fieber lief er den Weg zurück, den er vor geraumer Zeit gegangen war. Er durchquerte hastig das Oktogon, schaute schnell weg, als er einen Nachbarn beim Gebet erblickte und verließ das Gotteshaus, ohne dem Herrn Referenz zu erweisen, wie er es seit Kinderzeit fast täglich in einer der Aachener Kirchen getan hatte.
Sander zog die frische Morgenluft in tiefen Zügen ein, wischte sich den Schweiß von der Stirn und steuerte auf den Fischmarkt zu. Der Platz hatte sich inzwischen mit Bürgersfrauen, Händlern und allerlei sonstigem Volk gefüllt. All das sah er nur wie durch eine Nebelwand.
Erst an der Haustür, als er den Schlüssel wieder aus dem Wams zog und sie aufschloss, gewann er seine Sicherheit zurück.
2
Um die gleiche Zeit stand einige Gassen weiter, in der Jakobgasse, Bäckermeister Peter Maw am Backtrog seiner Backstube. Mit einem Blick sah er, dass sein Lehrling nach wie vor nicht damit fertig wurde, schon kurz nach Mitternacht von seinem warmen Strohsack hoch zu müssen und bald danach, noch halb schlafend, auf seinen Meister in der Backstube zu treffen.
Heute war der Dreizehnjährige besonders fahrig und nicht bereit, auch nur ein Wörtchen mit seinem Meister zu wechseln, obwohl sich der Arbeitstag bald dem Ende näherte.
Peter Maw war dem schmächtigen, strohblonden Burschen zugetan. Seit einem Jahr lebte er mit im Haushalt von Meister Peter, und die Meisterin Elisabeth hatte ihn wie an Kindes Statt angenommen, nachdem klar war, dass sie selbst keine Kinder mehr bekommen konnten.
Gustav oder Gustl, wie sie ihn nannten, wenn es nach Feierabend familiärer zuging, hatte trotz seiner Jugend schon viel Finsteres erlebt. Seine Eltern waren weit entfernte Verwandte der Meisterin aus Stolberg gewesen. Der Vater war bei der Arbeit tödlich verunglückt, und die Mutter starb bald danach wohl eher aus Gram über die unvermittelt hereingebrochene Armut.
So war Gustav ins Haus der Maws gekommen.
Trotz seines Schicksals war er fast immer vergnügt. Wenn ihn der Meister lobte, nachdem er dann und wann schon einmal Brot oder Brezeln selbst hergestellt und es zur Zufriedenheit des Meisters geschafft hatte, konnte er besonders fröhlich sein. Bäcker jedoch wollte er nicht werden. Trotzdem wusste er, dass er kaum eine andere Möglichkeit haben würde, als später Brote zu backen.
Er hatte die Aufgabe, tagsüber daran zu denken, die Glut im Ofen aufrecht zu halten. Ihm war das gar nicht recht, denn es unterbrach sowohl den nötigen Schlaf – und er war fast immer müde – als auch seine freie Zeit, die kärglich genug war.
Wie so oft, schickte ihn die Meisterin auch heute zum Markt. Dort musste er, wie er glaubte, die unangenehmsten Besorgungen machen, die man sich vorstellen konnte. Es war ihm jedes Mal ein Graus, sich zwischen den feilschenden und zänkischen Weibern einen Weg zu bahnen. Schlimm waren deren anzügliche Bemerkungen, wenn er den Auftrag hatte, Eier zu kaufen. Die beiden Hühner der Meisterin konnten den Bedarf nämlich oft nicht decken. Sollte er einige Rüben mitbringen, war es nicht besser. Mit feixendem Gesicht drehte so manche Marktfrau eine Rübe in der Hand, bevor sie sie an Gustl weiterreichte. Und der Gestank der Fische auf dem Fischmarkt war ihm sowieso unerträglich.
Nicht nur die Meisterin, auch der Meister beschäftigte ihn tagein, tagaus.
Dazu gehörte, das Backwerk auszutragen. Der Korb mit den Laiben aus Roggen und den Halbweißen wog beachtlich, und obwohl die schwere Arbeit wie das Teigkneten, das Schleppen der Getreidesäcke und der Körbe seinen jungen Körper gestählt hatte, war Gustl jedes Mal froh, wenn er seine Runde hinter sich gebracht hatte.
Seitdem Brot erschwinglich geworden war, hatten die Leute im Viertel Jakobgasse, Fischmarkt, Scherpgasse bis hin zum Münster und dem Radermarkt aufgehört, sich vorwiegend von Brei zu ernähren. Daher lief das Geschäft gut. Schon vor langer Zeit war daher sein Meister zusammen mit dessen Vater auf die Idee gekommen, sich ein eigenes Backhaus zuzulegen und nicht mehr mit den anderen Bäckern im stadteigenen Backofen zu backen. Darüber gab es immer Streit, und schließlich hatte der Zunftmeister die ständigen Händel zu schlichten.
»Gustl, wo ist der Vater?« Er hörte die fragende Stimme aus der Küche, nachdem er die Haustür hinter sich geschlossen hatte.
»Ich weiß dass der Meister in der Zunftversammlung ist. Das hat er mir heute Mittag vor Feierabend noch gesagt. Er wird bald zurückkommen, weil er seinen Krug für den frühen Abend bestellt hat, bevor er sich hinlegen wird«, gab Gustl zurück. Er war von der Schänke schräg gegenüber zurückgekommen, aus der er für den Meister Bier holen sollte.
Als er eintrat, sah er Anna Maria am Küchentisch sitzen. Sie schaute hoch und lächelte Gustl zu.
Anna Maria war jetzt zwanzig Jahre alt und das einzige Kind der Maws. Freier gab es genug, denn sie war im heiratsfähigen Alter und fiel durch die Anmut ihrer Bewegungen jedem ins Auge. Schwarze Locken umspielten ihr ovales Gesicht und fielen auf die schmalen Schultern. Die dunklen Augen und das schwarze Haar passten gar nicht zum Aussehen der Eltern, denn Vater und Mutter waren beide blond.
Nachdem Anna Maria das Schreiben und Lesen sowie die Grundrechenarten in der Sonntagsschule recht leicht erlernt hatte, war weiteres Lernen nicht mehr gefragt. Sie half der Mutter im Haushalt und war zuständig für alles, was Haus und Backstube betraf.
Heimlich befreundet war sie mit Johannes, einem feinsinnigen jungen Mann von zweiundzwanzig Jahren, der sich mit Musikinstrumenten auskannte, die Schalmei spielte und auch Bilder malte. Er wohnte im Nachbarhaus. Vater Maw aber hatte andere Pläne, als seine einzige Tochter einem nutzlosen Burschen und dazu noch einem Protestanten zu überlassen.
Trotz der Angst vor möglichen Strafen des Vaters, wandte sich Anna Maria mehr und mehr Johannes zu und bewunderte ihn vor allem, wie er seinen Glauben aktiv lebte. Am Sonntag ging er nämlich schon früh am Morgen in Richtung Vaals, um dort den Gottesdienst zu besuchen. In Aachen war das den Protestanten ja nicht möglich, weil ihnen keine Kirche zur Verfügung stand. Seit geraumer Zeit konnten sie in Weiden, Stolberg oder in Vaals ihren Glauben ausüben, wobei sie innerhalb der Stadt auf der Hut sein mussten, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten.
Anna Maria versuchte, sonntags recht früh aufzustehen und schlich sich dann von ihrer Kammer hinunter ans Küchenfenster, wo sie, wenn sie sich weit vorbeugte, Johannes sehen konnte. Oft drehte er sich um und winkte verstohlen, in der Annahme, sie sei da.
Die beiden jungen Leute hatten einen Weg gefunden, sich heimlich Nachrichten zukommen zu lassen, um ihre Zuneigung einander zeigen zu können. Das war schwer genug, denn Meister Peter wachte mit scharfem Blick über seine Tochter. Sie fühlte sich sogar beobachtet, wenn er schon am frühen Abend in seine Kammer ging, um den Schlaf vorzuholen, den er brauchte, wenn er nach Mitternacht den Backofen anfachte.
Gustl hatte inzwischen den Krug auf den Tisch gestellt und sich auf die Bank in der Ecke gesetzt. Bier für den Meister zu holen, war etwas, das Gustl gern tat, weil Gundula, die blonde Wirtstochter, neuerdings auffallend oft an der Durchreiche zur Straße stand, wenn er den Krug für seinen Meister füllen kam. Oft aber war es der Wirt selbst, ein bärbeißiger Rohling, der ihn bediente. Vor ihm hatte Gustl mehr Angst als Respekt.
Gundula war für ihre sechzehn Jahre schon recht drall. Und Gustl trieb es stets das Blut ins Gesicht, wenn sie sich weit zu ihm herüber beugte, um ihm den Krug anzureichen. Während er auf ihr Mieder starrte, berührten sich ihre Fingerspitzen, und es regte sich in ihm etwas, das er nicht einordnen konnte. Sie aber entließ ihn mit einem geheimnisvollen Blick, und Gustl fasste den Krug fest und sicher wie eine Trophäe nach einer gewonnenen Schlacht. Am liebsten hätte er vor lauter Zwicken und Zwacken im Bauch den Krug über sich ausgeleert.
Wenn er dann den Riegel der Haustür zurückgeschoben hatte, umfing ihn erneut die dunkle, leicht muffige Atmosphäre des Handwerkerhauses, obwohl es großzügig gestaltet war, jedenfalls im Vergleich zu manch anderem, das er kannte. Hier gab es gleich hinter der Haustür einen geräumigen Eingangsbereich, von dem es links zur Küche und rechts zur Wohnstube ging, die nur an Feiertagen oder bei besonderem Besuch genutzt wurde.
Die Küche war groß und stets geheizt. Hier spielte sich, wie auch an diesem Tag, das gesamte Leben der Maws ab. Um den mächtigen Eichentisch herum, der durch seine Lage im Raum und mit dem Blick auf die Straße so etwas wie den Mittelpunkt des Hauses bildete, befand sich eine Bank. Rechts lag die Feuerstelle mit einer schweren Metallplatte, in die herausnehmbare Ringe eingelassen waren. Die Glut darunter wurde immer wieder angefacht. Darüber hing an einem gezähnten Eisen der Wasserkessel.
Die beiden Frauen im Haus hatten dafür gesorgt, dass in einem Regal an der längeren Wand hübsche Töpfereien standen, bemalt mit Blumen und Engeln, wie man sie aus der Gegend um Raeren her kannte. Das Kruzifix in der oberen Ecke, geschmückt mit Buchsbaumzweigen, zeugte von Religiosität, und über der Tür hing ein Büschel Stroh gegen die Macht der bösen Geister.
Anders als in vielen anderen Häusern der Gegend, führte eine breite Treppe nach oben in die Schlafkammern und zum Speicher. Manche Häuser hatten nur zwei hintereinander liegende Räume, und nach oben kam man lediglich über eine enge Wendeltreppe.
In der Küche war es still. Ein großer Haufen Wäsche lag vor Anna Maria, Schürzen und sonstige Wäsche für die Backstube. Sie faltete alles sorgfältig und achtete darauf, dass die Stücke ordentlich auf einem Stapel lagen. Fast traute sich Gustl nicht, diesen friedlichen Moment durch irgendetwas zu stören. Er schaute Anna Maria an. Obwohl sie nur wenige Jahre auseinander waren, erschien sie ihm wie eine Erwachsene. Sie war nett zu ihm, ohne ihn als Mann zu sehen. Das wurmte ihn. Zu gern hätte er erfahren, wie sie sich anfühlt. Gerochen hatte er sie schon oft, wenn sie verschwitzt in der Küche am Herd stand und das Essen bereitete. Dann mochte er sie besonders. Ihr erhitztes Gesicht strahlte dabei viel Weiblichkeit aus.
Einmal war Annas Kammertüre im oberen Geschoss nur angelehnt gewesen, als er an ihr vorbeikam. Dort hatte er eigentlich nichts zu suchen. Sein Revier war nur der untere Bereich des Hauses. Und die Nacht verbrachte er in einem Verschlag hinter der Küche. An diesem Tag aber sollte er für den Meister die Gewürze vom Speicher holen. Als er an Anna Marias Kammer vorbeikam, konnte er der Versuchung nicht widerstehen, dem Geräusch hinter der Türe nachzugehen. Er hielt in seinem Schritt inne.
Was er sah, ließ ihn den Atem stocken: Anna wusch ihren entblößten Oberkörper mit einem Lappen. Dabei beugte sie sich über die Schüssel, und Gustl sah ihre wohl geformten Brüste. Auf Zehenspitzen bewegte er sich weiter, denn er wusste genau, würde er entdeckt werden, hätte er sowohl von ihr als auch vom Meister Schlimmes zu erwarten. Essensentzug für eine bestimmte Zeit durch die Meisterin zum Beispiel wäre für ihn der Todesstrafe gleichgekommen! Erst weiter unten traute er sich wieder, normal aufzutreten. Anna Maria und er hätten jetzt ein Geheimnis miteinander, meinte er, und er würde sie ab sofort mit anderen Augen anschauen, darin war er sich sicher. Fröhlich pfeifend ging er zur Backstube und verstaute dort die Gewürzbeutel in dem dafür vorgesehenen Regal.
Ein »So!« von Anna brachte Gustl wieder in die Gegenwart zurück. Sie schob den Wäsche-berg vorsichtig zur Seite, stützte die Ellenbogen auf den Tisch, legte den Kopf in die geöffneten Hände und schloss die Augen.
Plötzlich schien Gustl der Teufel zu reiten. Jetzt wollte er es wissen!
»Anna«, flüsterte er halblaut und schaute dabei aus dem kleinen Fenster hinaus auf das gegenüberliegende Fachwerkhaus mit seinen Blumenkästen und der grün gestrichenen Haustür. Dieses friedliche Bild machte ihm Mut. Obwohl er in dem Augenblick gar nicht wusste: War er es selbst, der den Anstoß zum nächsten Satz gab oder hatte irgendeine fremde Macht Besitz von ihm ergriffen?
»Was ist, Gustl?« fragte sie leise. Seine Zunge funktionierte jetzt wie bei dem Schnellredner, den er neulich auf dem Markt am Rathaus gehört hatte.
»Anna«, wiederholte er, als ob er sich noch einmal Mut machen wollte, »hat dir der Johannes schon mal beigelegen?«
Während die Worte fast wie von selbst über seine Lippen kamen, drehte er den Kopf leicht in ihre Richtung, schaute aber nur aus den Augenwinkeln hinüber. In seinem Nacken entwickelte sich dabei eine unerklärliche Hitze.
Gustl hatte den Satz kaum vollendet, als ein Schatten das abendliche Licht in der Küche durchbrach. Meister Peter stand unvermittelt im Türrahmen. Gustl starrte erschrocken zwischen ihm und Anna Maria hin und her. Sie hatten ihn nicht kommen hören. Hatte er sie überraschen wollen?
Sie richtete sich auf und stotterte verwirrt: »Vater, da bist du ja schon. Wie war es in der Zunftsitzung?«
Meister Peter warf seinen Hut auf die Eckbank und trat vollends in die Küche. Ohne sichtbare Regung machte er mit dem Handrücken das Zeichen, seine Tochter möge ihm am Tisch etwas Platz machen und setzte sich neben sie. Erst jetzt schien er seinen Lehrling zu beachten, der nicht so recht wusste, was gleich geschehen würde.
»Gustav, hast du den Krug füllen lassen?«, fragte er und schaute ihn dabei an. Gustl spürte, dass er noch einmal davongekommen war, denn sonst hätte ihn der Meister aus der Bank geholt, kurz verhört und ihm eine Ohrfeige gegeben.
»Er ist dort hinter dem Wäscheberg«, antwortete er erleichtert, stand auf, ging um Anna Maria herum, wobei er versucht war, ihr kurz übers Haar zu streichen und stellte den Krug vor seinen Meister.
Als Gustl wieder auf seinem Platz saß, schaute er Anna Maria an. Sie aber schien ihn nicht zu bemerken und starrte nur zu dem Wäscheberg.
Inzwischen hatte Meister Peter einen tiefen Schluck aus dem Krug genommen, rülpste, lehnte sich müde, aber zufrieden zurück und schloss die Augen.
»Endlich haben wir den Lennarz Karl so weit, dass er sich an die Zunftordnung hält«, murmelte er schläfrig. »Hatte er doch Burschen aus der Eifel eingestellt, die er nicht ausbilden wollte, weil er zu faul war, sich um Lehrbuben zu kümmern. Außerdem hat er aus dem Jülicher Land billiges Getreide in die Stadt geschmuggelt. Das hätte ihm die Zunft nie erlaubt. Das wusste er auch und hat es trotzdem getan. Morgen könnt ihr ihn dafür einen halben Tag lang an der Katsch bewundern!« Dabei blinzelte er Gustl zu. »Aber seine Familie darf ihn vor Anspucken und Steinwürfen schützen. Das habe ich durchgedrückt!«
Gustl wurde es ganz flau im Magen. Schon ein paar Mal hatte er diese Prozedur am Pranger auf dem Kaxhoff erlebt. Dabei steckte der Verurteilte mit Kopf und Händen wie ein Gekreuzigter in einem Holzblock und konnte sich kaum rühren. So hatte er sich immer den Herrn Jesus am Kreuz hängend vorgestellt, wenn der Pfarrer von Sankt Paul in der Osternacht aus der Bibel auf Lateinisch vorlas und die Gottesdienstbesucher an dieser Stelle auf das Kreuz vor ihnen schauten. Verstanden hatte er ja nie etwas, weil es nicht seine Aachener Sprache war. Besonders schlimm war die Demütigung, von jedem an der Katsch angespuckt und verhöhnt zu werden, jedenfalls, wenn es nicht wie beim Lennarz Karl durch die Familie unterbunden werden durfte. Die Verurteilten konnten nur hoffen, dass ihnen das Wetter nicht zusätzliche Pein bereitete. Und wie es ihnen zumute war, wenn sie mal pinkeln mussten, das wollte Gustl gar nicht zu Ende denken!
Meister Peter scheuerte seinen Rücken genüsslich an der Banklehne. Gustl kam es vor, als würde sich eine Sau an der Eiche reiben. Währenddessen fragte er, zu Anna Maria gewandt: »Wo ist Mutter?«
»Sie ist bei Tante Gerdi«, gab sie zurück.
»Mutter kann stolz auf mich sein, und ihr auch«, sagte der Meister. Dabei öffnete er die Augen, richtete sich auf und schien etwas verkünden zu wollen. »Demnächst bin ich Mitglied des Großen Rates. Die anderen Bäckermeister aus unserem Gaffel haben mich vorgeschlagen, nachdem der Lennarz Karl wohl nicht mehr dazugehören wird. Jetzt werde ich direkt mitbestimmen können, was mit den Protestanten in der Stadt passiert!«
Anna Maria hatte die Worte kaum verarbeitet, als sie ruckartig aufstand, den Wäschekorb packte und vom Tisch zog. Ohne ihren Vater anzuschauen, setzte sie den Korb auf die linke Hüfte, als würde sie ein Kleinkind tragen, und verließ hastig die Küche.
Der Meister verzog sein Gesicht zu einem leichten Grinsen, schaute seinen Lehrbuben an, nickte ihm zu und meinte: »So, dann will ich mich mal hinlegen. Solltest du auch!«
Damit verließ auch er die Küche und stieg die Treppe zu seiner Schlafkammer hinauf.
3
An diesem lichten Aprilabend war Johannes kurz nach Sonnenuntergang aus der oberen Luke seines Elternhauses in der Jakobgasse geklettert. Dafür hatte er vorher den gepichten Holzdeckel und den mit einem dünnen Ziegenfell bespannten Rahmen, der etwas Licht in die ansonsten fensterlose Kammer brachte, herausgenommen. Nur mit Mühe war es ihm gelungen, sich hochzustemmen und nach außen zu zwängen.
Hier oben konnte ihn niemand sehen. Er hatte sich vorsichtig auf einen alten Balken gesetzt, der zwischen den hölzernen Dachschindeln verhakt und nach der Bauzeit wohl vergessen worden war.
In Ruhe beobachtete er die Dächer der umliegenden Häuser. Sie schmiegten sich so eng aneinander, als wären sie ein Ganzes. Hier oben war die Sonne noch nicht vollständig untergegangen. Die Kamine duckten sich zwischen den Schindeln wie die Stummelschwänze von Kaninchen. Nahezu alle waren verrußt, einige halb zerfallen, und Johannes wunderte sich, dass der Kaminfeger so etwas zuließ. Wie leicht konnte da ein Funke das Dach zerstören und in der Umgebung ein furchtbares Unglück anrichten!
Nur wenige Geräusche drangen bis zu ihm herauf, denn die Handwerker hatten bereits Feierabend gemacht. Lediglich einige junge Burschen lärmten bereits in den Gassen und begannen mit den abendlichen Saufritualen in den Schänken.
Johannes wandte den Kopf, um nachzusehen, wo noch Sonnenlicht war. Sein Blick blieb am Rathaus hängen. Die wuchtigen Türme wurden noch vom schwachen Sonnenschein beleuchtet. Dieses gigantische Bauwerk hatte ihn immer schon beeindruckt. Wenn er daran vorbeiging, fühlte er sich immer ganz klein. Und dazu blickte ihn auch noch Kaiser Karl von oben herab ziemlich abschätzig an.
Johannes wusste, dass dort früher die mächtigen Könige nach ihrer Krönung gefeiert hatten und sich ausgiebig feiern ließen. Bettler und fahrendes Volk, das aus solchem Anlass in der Stadt zusammengeströmt war, hatten dann stets auch etwas abbekommen. So war es Brauch. Geben stimmt den Himmel gnädig – davon waren die Fürsten überzeugt. Schließlich war der frisch Gekrönte von nun an berechtigt, sich in Rom zum Kaiser krönen zu lassen und Herrscher des Heiligen Römischen Reiches zu sein. Da wollte man sich großzügig zeigen.
Wie gebannt schaute Johannes auf die Rathaustürme. Während sie allmählich vom Nachthimmel aufgesogen wurden, verschmolzen sie vor seinem Auge zu einem Bild heiterer Tänze, ausladender Festtafeln mit dem Herrscher in der Mitte und neben ihm anmutige, vom vielen Wein angeregte Frauen in prächtigen Kleidern. Der Gastgeber prostete ihnen zu. Seine zweideutigen Anspielungen, die er ihnen ungeniert zurief, wurden von ihnen lachend beantwortet. Oder war es ganz anders gewesen, und die Krönungsmahle fanden nach einem genau festgelegten, feierlichen Ritual statt?
Johannes sah sich plötzlich in einem kostbaren Kostüm vor dem Herrscher stehen. Es war das eines Herzogs. Vielleicht hatte er die Aufgabe des Mundschenks, des Truchsess’ oder Senneschalls übertragen bekommen. So genau wusste er nicht, was sie im Einzelnen zu tun hatten. Feierlich soll es ja gewesen sein im Krönungssaal. In den Gassen war es dagegen sicherlich hoch her gegangen. Der spendierte Wein und die feinen Speisen aus der Hofküche hoben die Stimmung. In dunklen Toreinfahrten gab man sich den körperlichen Freuden hin. Je länger das Fest dauerte, um so öfter gingen die Fenster des Krönungssaales auf und die wundervollsten Delikatessen wie gebratene Hasen, Geflügel, Fisch oder ganze Lämmer, am Spieß gebraten, kamen auf den Markt geflogen. Unten prügelten sich Bettler mit manch einem Bürger um die feinen Sachen. Die hohen Herrschaften da oben schienen schon recht satt zu sein.
Johannes malte sich aus, wie es gewesen wäre, mit einer Horde Burschen durch die Gassen zu ziehen und vielleicht die warmen Schenkel einer feurigen Zigeunerin zu spüren. In seiner Vorstellung löste er gerade die langen Schnüre ihres Mieders, während sie sich leidenschaftlich küssten, als ein Windstoß die Luke gegen die Dachbalken knallen ließ und ihn aus seinen Träumen riss.
Es war ein Zeichen, sich daran zu erinnern, weshalb er eigentlich hier hinaufgeklettert war. Der Tagtraum ließ ihn aber nicht los. Innerlich unruhig stand er auf und balancierte auf der Bohle zum Dachfirst.
Tief in seinem Herzen war ihm nicht wohl. Mit welchem Recht lebten die anderen ungezügelt, während er aus der Sicht dieses Ochsen von Meister Maw sein Leben nicht mit Anna Maria teilen durfte? Wut stieg in ihm auf.
Vorsichtig rutschte er an den Rand des Daches. Das Haus seiner Liebsten war fast zum Greifen nah.
Vor ihm lag nun ein dunkler, gespenstisch wirkender Spalt, etwas breiter als eine Elle. Diesen Spalt sah man von der Gasse aus nicht, denn dort war er zugemauert. An der Rückseite dagegen hatte man ihn damals beim Bau der Häuser aus irgendeinem Grund offen gelassen. Mittlerweile war sein Eingang von Gebüsch überwuchert. Seit ewigen Zeiten hatte niemand mehr daran gedacht, es zu beseitigen.
Johannes kannte diesen geheimnisvollen Ort gut. Als Kind war er manchmal mutig hierher geschlichen und hatte dann die Wolken über sich hinweg ziehen sehen. Immer nur kurze Fetzen, wie rasende Pferde, von denen er meinte, sie seien auf dem Weg von Holland in Richtung Köln. Das Gebüsch grenzte an die Backstube, das Reich des Meisters Peter, und wenn man sich daran vorbei drückte, war es möglich, von oben eine Nachricht zu bekommen.
Das alles hatte Johannes längst vorher ausgekundschaftet.
Indem er sich nun mit dem einen Fuß an der Dachkante absicherte, holte er aus seinem Hosensack eine lange Schnur und ließ sie durch seine Hände gleiten und in dem Spalt verschwinden. Neugierig und vorsichtig zugleich schaute er über den Rand des Daches, ob sie denn am Ziel angekommen sei.
Die Schnur hing dort, wohin er sie sich gewünscht hatte. Ein triumphales Gefühl überkam ihn. Sollten die Edlen ihre Spiele treiben und Meister Peter weiter so mies sein. Die Reize des Heimlichen waren allemal schöner!
Und bald würde auch diese Nachricht ihren Weg gehen. Johannes befestigte seine Schnur an einem Balken und kletterte leichtfüßig zur Dachluke zurück.
Er hatte es kaum erwarten können, dass die Nacht endlich vorüber war und ein neuer Tag anbrach.
Nachdem er sich erneut aus der Dachluke gestemmt hatte, bewegte er sich vorsichtig bis zum Rand der Schindeln. Regen hatte sie in der Nacht glitschig werden lassen. Johannes musste aufpassen, nicht abzurutschen.
Es war noch nicht ganz hell. In Richtung des Kölntores, wo sonst die Sonne zu so früher Stunde stand, waren nur Wolkenfetzen zu erkennen, die einige höhere Gebäude der Stadt wie im Nebel erscheinen ließen. Trotz der Gefahr abzustürzen oder jemandem aufzufallen, war er hier oben sein eigener König.
Das Herz klopfte ihm nicht nur wegen der erheblichen Anstrengung. Er konnte es nicht erwarten, Anna Marias Antwort zu erhalten. Längere Zeit hatten sie sich nicht sehen können. Nun hoffte er, dass zur vereinbarten Zeit am unteren Ende der Schnur ein kleines Zettelchen hängen würde, auf dem sie mit ihrer etwas ungelenken Schrift die ersehnte Antwort geschrieben hätte.
Johannes näherte sich dem Spalt zwischen den beiden Häusern. Er fasste die Schnur und zog sie hoch.
Komm morgen beim Mittagläuten zum Sandkaultor. Wir werden Zeit haben. Ich muss erst bei Sonnenuntergang zu Hause sein, las er auf dem kleinen Fetzen Papier.
Sie muss die Mitteilung erst vor wenigen Minuten an die Schnur gehängt haben, denn in der Nacht hatte es geregnet, dann wäre wohl nichts mehr zu lesen gewesen, folgerte er. Wie war sie wohl an ihrem Vater vorbeigekommen?
Johannes’ Herz schlug wild. Obwohl ein geplanter Tagesablauf bei ihm nur selten vorkam, fing er gleich an, den nächsten Tag zu überdenken und war dabei in seiner Aufregung gefährlich nahe an den Rand des Daches geraten. Er setzte sich schließlich auf den Balken in die Nähe des Kamins und dachte über sich und die Welt nach.
Eine Mischung aus Vorfreude und Nachdenklichkeit überkam ihn. Eigentlich war er unabhängig. Nur seine oft kränkelnde, immer traurige Mutter musste versorgt werden. Da half in diesem Fall sicher die alte Lisbeth, die gelegentlich nach ihr sah. Aber seine Stallhasen mussten versorgt werden. Wenigstens ihnen sollte es gut gehen.
Ansonsten hatte er nicht viel zu regeln, denn mit seinem Broterwerb war es sowieso nicht weit her. In Wahrheit lebte er in den Tag hinein und schämte sich von Zeit zu Zeit sogar dafür, vor allem, wenn er an Anna Maria dachte, der er dadurch wenig bieten konnte. Außer seiner Geradlinigkeit, der Art, die Dinge zu sehen, die um ihn herum geschahen, und seinem festen protestantischen Glauben, konnte Anna nichts von ihm erwarten. Trotzdem bestand ein festes Band zwischen ihnen. Auch seine künstlerischen Fähigkeiten gefielen ihr. Allerdings warfen sie nichts ab, und das wusste sie – und vor allem ihr Vater!
Für Johannes war Geld nicht so wichtig. Er wurde darin bestärkt, als es sich herumsprach, dass der große Maler Rembrandt van Rijn in Amsterdam mit seinem Kunsthandel genau in diesem Jahr Schiffbruch erlitten hatte. Da war es ihm schon lieber, die bedeutenden Niederländer in aller Bescheidenheit nachzuahmen und darauf zu hoffen, das eine oder andere Bild los zu werden, was allerdings bisher noch nicht passiert war.
Seine Malstücke standen wie zum Beweis dafür ordentlich aufgereiht hintereinander an der Wand. Daneben lehnte die Staffelei. Schon länger hatte er sie nicht mehr benutzt, denn Farben zu mischen war aufwändig. Seine Bilder hatte er auf Holz gemalt, weil Leinwand und Rahmen ebenfalls zu teuer und nur für Aufträge von hohen Herrschaften gedacht waren, die alles bezahlten. Johannes wusste, dass ihm ein Gönner fehlte, aber er kannte keinen, der ihn hätte unterstützen können.
Vielleicht hätte jemand ein Bild gekauft, auf dem Anna Maria zu sehen war: als reiche Kaufmannstochter, mit teurem Schmuck behangen und um sie herum wertvolle Möbel, Gefäße und Blumen. Schon an diesen Äußerlichkeiten wäre ein Bild gescheitert, denn er hätte keine Vorlagen dafür gehabt. Oder sollte er sie als hübsche Bauerntochter beim Brotschneiden am Küchentisch darstellen? Wer hätte so etwas haben wollen?
Ja, solch einer wie Hans von Aachen, der hatte es geschafft. Um ihn rauften sich die Herrscher Europas, weil sie ihn alle als Maler an ihrem Hof haben wollten. Zuletzt hatte er in Prag in Saus und Braus gelebt. Und welche glanzvollen Bilder hatte er gemalt: von schönen Frauen, dem Bacchus und seinen Gespielinnen, wie sie splitternackt und eng umschlungen irgendwo herumsitzen, von edelsten Speisen und Getränken, Schmuck und Möbelstücken umgeben, die man dem Hofmaler Hans nur zu gern zur Verfügung stellte, um sie auf einem Bild wieder zu sehen. Damit konnte man prahlen! Er war damals aus der engen Stadt in Richtung Antwerpen losgezogen, um zu lernen und hatte sich in Flandern schon einen Namen gemacht. Von dort war er nach Venedig und ins sonstige Europa gegangen. Was für ein Kerl!
Johannes hatte stets den Gedanken an einen ähnlichen Weg verworfen und sich nach wie vor darauf beschränkt, sich in die großen niederländischen Meister hineinzuversetzen und sie mehr oder minder gelungen nachzuahmen.
Eigentlich mochte er sein ungebundenes Leben und schaute neidlos, manchmal auch abschätzig, auf die herab, denen das Geldverdienen und der Wunsch nach Höherem oft die Luft zum Atmen nahm.
Begabter war er auf der Schalmei. Damit gelang es ihm, auf Hochzeiten und Kirchweihfesten aufzuspielen. Das brachte einige Münzen ein. Wenn er die fröhlichen Gäste beim Tanz beobachtete, dachte er sehnsüchtig an Anna Maria, mit der er noch nie eine öffentliche Feier besuchen konnte. Nur zu gern wäre er mitten zwischen den Leuten gewesen und hätte mit ihr jeden erdenklichen Tanz gemacht. Es würde ihm gefallen, wenn sich die anderen nach ihnen umschauen würden, während sie sich auf der Tenne drehten und dabei tief in die Augen schauten.
Urplötzlich wurde seine Vorfreude auf den nächsten Tag und die Zufriedenheit mit seinem bescheidenen Dasein von quälender Traurigkeit überlagert.
Wie weggefegt waren seine heiteren Gedanken. Ein solcher Stimmungswandel machte ihm immer wieder zu schaffen. Die hellen Farben des heraufkommenden Morgens hatten sich aufgelöst und machten grauen Schleiern Platz, mit denen er nun fertig werden musste. Selbst jetzt, da er sich über die schöne Nachricht hätte freuen können, überfielen ihn die ständig wiederkehrenden Fragen: Warum musste ich ohne Vater aufwachsen, obwohl er nicht tot ist? Warum lässt man Andersgläubige nicht in Ruhe leben? Warum lässt Anna Marias Vater nicht zu, dass wir zueinanderkommen dürfen?
Johannes verbrachte den Tag so gut es ging. Seine Mutter hatte die Nachricht von dem Treffen der beiden mit einem liebevollen Augenzwinkern aufgenommen und ihnen schöne Stunden gewünscht. Schon immer hatte sie das Nachbarkind gemocht und hätte es gern gesehen, wenn beide ein Paar werden würden. Doch selbst sie verspürte Angst vor Anna Marias Vater, der sich mit seiner Abneigung ihrer Familie gegenüber nicht zurückhielt.
Nachdem Mutter und Sohn bis zum späten Nachmittag die anstehenden Aufgaben erledigt hatten, musste Johannes noch seine drei Hasen versorgen.
Er hatte auf dem Anger vor der Stadt frischen Löwenzahn gestochen und Gras geschnitten. Sein Korb war randvoll, Sichel und Messer lagen obenauf. Für seine Mutter hatte er einen Strauß Margeriten gepflückt und oben drauf gelegt. Auf dem Rückweg in die Stadt plante er den Bau eines Stalles für den vierten Hasen.
Johannes hatte das im Dunkel des beginnenden Abends liegende Königstor noch nicht ganz passiert, als sich zwei Gestalten aus einer Mauernische lösten und mit wenigen Sprüngen vor ihm standen. Einer der beiden humpelte leicht. Seine überaus hagere Gestalt bedeckte eine Art Soutane, die ihm nur bis zu den Knien reichte. Die Beine steckten in Pluderhosen, Schuhe trug er nicht.
Angsterfüllt erkannte Johannes in dem Hageren den Anführer eines sonderbaren Zuges Verrückter, den er neulich in den Gassen zwischen dem Münster und St. Paul beobachtet hatte. Er hatte ein Kreuz vor sich hergetragen. Ein in Pfauenfedern gekleideter, über und über mit Schellen behangener Tamburinspieler hatte dabei kraftvoll den Takt geschlagen. und starr vor sich hingeschaut, während er einem Storch gleich daher geschritten war. Andere hatten das Gesicht mit Farben beschmiert, Augen und Münder waren grell geschminkt. Einige der Frauen ließen aufreizend ihre Brüste aus den zerlumpten Kleidern hängen und vollführten dabei, in wilde Verzückung geraten, obszöne Bewegungen oder warfen sich im wiederkehrenden Rhythmus der Trommel auf die Straße, ohne den ekligen Schweine- und Kuhdreck zu beachten, der dort zuhauf herumlag. Dabei riefen oder murmelten wie in einer Litanei: »Tod den Andersgläubigen! Hängt sie ans Kreuz!«
Werd ich jetzt hier überfallen? Wie passt das verrückte Getue mit einem Raub zusammen, dachte Johannes in großer Not.
Der zweite vermeintliche Räuber hatte sich währenddessen drohend vor ihm aufgebaut. Er war von bulliger Gestalt, glatzköpfig, mit langem Bart und gekleidet nach neuer Mode: Wams, Kniehosen und Schuhe mit Absätzen.
In panischer Angst, jetzt etwas falsch zu machen, schaute sich Johannes aus den Augenwinkeln verstohlen um. Die Rettung schien die im Korb obenauf liegende Sichel zu sein, mit der er sich verteidigen wollte. Er wusste, dass für die beiden Strolche Ort und Zeit günstig für einen Raub waren. Zu solch vorgerückter Stunde – die Tore wurden bald geschlossen – hielt sich hier kaum jemand auf. Selbst die Hufschmiede hatten ihr rhythmisches Schlagen eingestellt und waren irgendwo in den Schänken verschwunden.
Hilfe war also nicht zu erwarten, daher zog er schnell seine Hand wieder weg von der Sichel, um die beiden nicht unnötig zu reizen. »Was wollt ihr?«, stammelte Johannes. »Ich habe nichts!«
Dabei versuchte er einen Schritt nach rückwärts, um den beiden zu entwischen. Aber schon hatte der Hagere einen Sprung gemacht, ihn gepackt und von hinten umklammert. Johannes spürte den Schweißgeruch und die Ausdünstungen seines Atems ganz dicht am rechten Ohr.
Leise, fast so, als ob es niemand hören sollte, hauchte ihm der Hagere ins Ohr, wobei der Griff um seinen Oberkörper spürbar fester wurde: »Wir wollen dir nichts klauen, du hast sowieso nichts! Aber wir warnen dich! Wir wissen, dass ihr dem neuen Glauben anhängt. Ihr verweigert dem Heiligen Vater und dem Klerus die Gefolgschaft und glaubt nicht, dass die Ablasszahlung zur Befreiung vom Höllenfeuer führt. Was sagst du, Bürschlein, dazu?«
Johannes hatte sich gerade von dem Schrecken erholt, Opfer eines Raubes zu werden, als ihm klar wurde, dass ihm eine weitaus größere Gefahr drohte. Panische Angst überfiel ihn, denn von den Verfolgungen und Ausweisungen der Protestanten, den schicksalhaften Prozessen, in denen es um das nackte Leben ging, und den damit verbundenen Demütigungen und dem Elend, wusste er nur zur Genüge. Er erlebte es ja gerade am eigenen Leib!
»Lasst mich in Ruhe! Ich bin noch zu jung, um das alles zu verstehen«, gab er zitternd zurück, während er versuchte, sich aus der Umklammerung zu befreien.
»Du bist keinesfalls zu jung«, raunzte ihn der Bullige an, dessen Gesicht von einer hässlichen Narbe bedeckt war, die vom Kinn bis zu einem Ohr reichte. »Wir wissen, dass du und Deinesgleichen regelmäßig nach Vaals in die Kirche zu den Gottlosen geht und euch dort gegen unsere heilige Kirche verbündet. Und wir wissen, dass ihr an Fronleichnam noch nie der Monstranz die Ehrerbietung bezeugt habt und dafür vor das Sendgericht kommen werdet. Nur mit Glück seid ihr bisher davongekommen. Wir beobachten euch. Seht euch vor! Und nun verschwinde!«
Damit ließ ihn der Hagere los und versetzte ihm einen Tritt, so dass der Inhalt des Korbes samt Sichel und Messer auf die Pflastersteine fiel.
So plötzlich wie sie aufgetaucht waren, waren die beiden wieder verschwunden und ließen Johannes völlig verwirrt im Dunkel des Gemäuers zurück. Er lehnte sich an den kühlen Stein, wischte sich den Schweiß von der Stirn und rutschte an der Wand hinunter, bis er in der Hocke Halt fand.
Minutenlang blieb er so sitzen. Sein Herz raste. Vorhin hatte er Hilfe herbeigesehnt, jetzt war er froh, dass ihn niemand in dieser Verfassung sah.
Schließlich raffte er sich auf und sammelte die herumliegenden Werkzeuge zusammen. Das Hasenfutter war ihm nun nicht mehr wichtig. Sollte es zwischen dem ganzen Gassendreck bleiben. Nur die Blumen nahm er mit.
Dem furchtbaren Geschehen nachhängend, schleppte er sich nach Hause. Ihm war übel vor Angst um seine Mutter, um sich und um seine Zukunft.
Er war in die religiösen Wirrungen geraten!
4
Ohne jemanden anzutreffen, war Johannes nach dem Zwischenfall die Stufen zu seiner Kammer hochgestiegen und hatte sich auf sein Lager geworfen, verschwitzt und mit trockenem Mund. Die Zunge klebte ihm am Gaumen. Ihm war, als hätte man ihn tatsächlich verprügelt. Er hatte keine Kraft, sich wenigstens einen Krug Wasser zu holen. Die Pantinen waren ihm von den Füßen gerutscht.
Wie gelähmt lag er nun da und richtete seinen Blick zu der kleinen Luke mit den darüber hinwegziehenden Wolken. Sie wechselten im abendlichen Licht von hellgelb nach sonnenverhangen dunkel. Ihn überkam wieder die unendliche Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Niemand hatte sie bisher stillen können, weder die Mutter, noch Anna Maria – und seinen Vater kannte er sowieso nicht.
Nur der Großvater, der alte Freund aus Kindertagen, war stets für ihn da, wenn er mit seinen Sorgen zu ihm kam. Und so schob sich der große, gütige Mann mit seinem vollen grauen Haar und den kräftigen Händen, die zugleich so zärtlich sein konnten, vor Johannes’ Gesicht.
Der Alte hatte stets Freude am Erzählen und konnte nicht genug berichten über seine Jugendzeit, die politischen Zustände in Aachen, über die Verwandten, die Katholiken und Protestanten, ihren Stärken und Schwächen und von Land und Leuten.



























