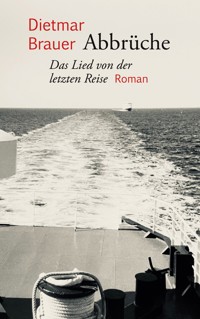
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Roman erzählt aus dem ganz normalen Alltag eines nordöstlich gelegenen Dorfes der DDR. Landwirtschaft und ein Tagebaubetrieb bieten den Arbeitern, Angestellten und Genossenschaftsbauern ein Auskommen. Es wird gearbeitet und gefeiert, gestritten, geliebt, gelacht und geweint - ein turbulentes Miteinander in den ideologischen Strömungen der Auseinandersetzung zwischen Ost und West. In einer Hafenkneipe im nahegelegenen Rostock lernen sich zwei ehemalige Seeleute kennen: Den einen hat es aus familiären Gründen in den Osten Deutschlands verschlagen, der andere war Zweiter Offizier auf einem Fischtrawler, bis er wegen unerlaubter Kontakte mit westdeutschen Bürgern sein Seefahrtsbuch abgeben musste. Die Männer freunden sich an. Eines Tages beschließen sie, mit einem Faltboot die Flucht über die Ostsee in den Westen zu wagen. Sie sind nicht die Einzigen, die sich Gedanken über diese unumkehrbare Reise machen ... Der Roman ist ein Mosaiksteinchen im großen Bild der Existenz und des Scheiterns der DDR.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TEIL I
Vorwort
1. Ankunft im Dorf Heidesand
2. Von der Liebe und dem Tod in Heidesand
3. Der Keiler, Erntedankfest und Tatjana
4. Ein Gerücht geht um in Heidesand
5. Weihnachten in Heidesand und andere Probleme
6. Die dicke Berta, ein Exportschlager und die Frauentagsfeier
7. Schiff in Seenot
TEIL II
1. Die Rückkehrtwende
2. Jörg Klaasen
3. Das Meer ruft
4. Der Besuch
5. Die Probleme vor der großen Reise
6. Noch mehr Probleme
7. Novembernebel
8. Lebenswege
TEIL III
1. Anfang eines Aufstiegs
2. Uwe wird erwachsen
3. Im Leben angekommen
TEIL IV
1. Alte und neue Probleme
2. Die Flucht
3. Jeder kämpft für sich allein
4. Es kommt anders
Epilog
TEIL I
Vorwort
Dieses Buch will sich als ein winziges Mosaiksteinchen im großen Bild der Existenz und des Scheiterns der DDR verstanden wissen. Dieser Staat sollte eine Alternative zu einem Deutschland sein, das immer wieder in sich selbst scheiterte und bis heute seine Schwächen nicht überwindet.
Die hier geschilderten Geschichten fußen zum Teil auf wahren Begebenheiten. Wenn sie von der Realität abweichen, betrifft das vor allem die Personen, die in dieser Region nicht lebten.
Wenn dennoch Ähnlichkeiten in den Schilderungen auffällig werden, so sind sie eine Hommage an unverwechselbare Zeitgenossen, die ich verstehen und in den überwiegenden Fällen auch achten gelernt habe. Und zwar jeden auf seine Art.
DIETMAR BRAUER
1
Ankunft im Dorf Heidesand
Auch relativ kleine Dörfer in Mecklenburg können mitunter auf recht stattliche Kirchen verweisen. Wie in diesem nordöstlich in Deutschland gelegenen Ort, wo in grauer Vorzeit fleißige Bauern in mühseliger Arbeit die oft zentnerschweren Feldsteine grob behauten und mit ihnen das imposante Gotteshaus errichteten. Auch die den Kirchhof umgebende Friedhofsmauer sowie das sich daran eng anschmiegende Gemeindehaus bestanden zu großen Teilen aus dem gleichen Granitgestein. Für die Mauerabschlüsse und Laibungen kamen dann allerdings überwiegend Backsteine zum Einsatz, die durch die früher verwendete Zwickelsteintechnik noch ergänzt wurde.
Ja, Steine gab es genug in dieser Gegend. Eine kies- und geröllhaltige Endmoränenlandschaft prägte seit Jahrtausenden die Struktur der sanften Erhebungen, des lichten Mischwaldes und der natürlich entstandenen Seen.
Die hier ansässigen Menschen passten sich im Laufe der Zeit gut den vorgefundenen Bedingungen an. Für die Bauern bedeuteten Steine und Kies erst einmal kräfte- und materialverschleißende Bodenbearbeitung sowie schnell versickerndes Oberflächenwasser bei Dürre. Doch sie bauten Kulturen an, die ihre Früchte oberirdisch ausbildeten, wie Getreide und Raps, und die bei Trockenheit noch so viele Erträge einbrachten, dass es für das Vieh reichte. Auch bewirtschafteten sie große Flächen Weideland, die Bereiche der Seeufer und geeignete Waldflächen mit einschlossen.
Als für die Dorfgemeinde noch vorteilhafter erwies sich der vor allem im zwanzigsten Jahrhundert landesweit voranschreitende Kiesabbau für den immer größer werdenden Bedarf an Beton. Dort, wo die fruchtbare Scholle nur eine Pflugschar tief reichte, wurde der den Grund und Boden besitzende Landwirt zum industriellen Unternehmer und seine Pächter und Knechte zu Vorarbeitern und Tagelöhnern. Sie bebauten nicht mehr den sandigen Acker mit Feldfrüchten, sondern trugen dafür Schicht für Schicht das Erdreich ab. Zuerst geschah dies in mühseliger Knochenarbeit mit Spitzhacke und Schaufel ohne Siebmaschine und Förderband. Nach und nach mechanisierte man den Kiesabbau mit Rüttelsieben und Verladetrichtern. Mit Einzug der Elektrifizierung auf dem flachen Lande entwickelte sich die kleine Kieskuhle zu einer industriellen Gewinnungs- und Aufbereitungsanlage für Zuschlagstoffe.
Ein mehrere Hektar großer und auch fischreicher, zum Dorf gehörender See stand bisher für Fischer, Angler und Badelustige als das einzige Gewässer weit und breit zur Verfügung. Doch mit dem rasanten Anwachsen des Tagebaues und der Ausbeutung der Kieslagerstätten auch unterhalb des Grundwasserspiegels entstand schon bald ein viel größeres Gewässer. Dieser Baggersee, der sich mittlerweile von den neu entstandenen Wohnblöcken am Ortseingang bis zu den waldreichen Gemarkungen des einige Kilometer entfernten Nachbarortes erstreckt, ist stellenweise sehr tief und besitzt kristallklares, azurfarbenes bis smaragdgrünes Wasser. Nur in unmittelbarer Nähe des sich Tag und Nacht vorwärts fressenden Schwimmgreifbaggers ist es milchig trübe und gelbliche Schaumkronen schwimmen auf der Oberfläche. Darüber hinweg jagen Möwen im Sturzflug nach Würmern und Insekten, die sie in den gewaltigen, immer wieder nachrutschenden Erdmassen finden. Eben noch im Schwarm den pflügenden Traktor begleitend, schert so manches Tier plötzlich aus, um wenige hundert Meter weiter hinter einem künstlich entstandenen Wall aus Ackerboden und rotbraunem Kies ins Nichts zu verschwinden. Über den Kiestagebau hinweg segelt es aber sicher zur abgelegenen Sandbank, wo es in Geborgenheit seine Nachkommen versorgen kann.
Es mag wohl Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gewesen sein, als ein junger Mann auf einem Feldweg nahe der Abbaukante seine Schritte so lenkte, als wollte er sehen, ob hinter dem Erdwall und unter dem Himmel die Welt nun zu Ende sei oder nicht. Trotz eines sich allmählich verstärkenden Lärms, der von quietschenden Förderbändern und sich ergießenden Wassermassen herrührte, kletterte der Wanderer unbekümmert auf den vor ihm liegenden Absperrhügel. Doch oben angekommen, stoppte er unter dem Eindruck des sich vor ihm ausbreitenden Tagebaus seine Schritte. Über eine zerklüftete Abbruchkante hinweg sah er unter sich in großer Tiefe den See mit dem Schwimmbagger und den angekoppelten Förderbändern. Von hier oben ähnelte die Förderanlage einer riesigen Schlange mit einem überdimensionalen Kopf. Fortwährend schien das Ungetüm im Wasser etwas gefangen zu haben, wenn sein tonnenschwerer Greiferkorb im Gewässergrund sich mit einem einzigen Biss mehrere Kubikmeter Rohkies einverleibte. Dabei bebte und dröhnte der Koloss, und mit der enormen Kraft seiner Elektromotoren riss er mit einem Hub gewaltige, aus Kies und Wasser bestehende Massen aus der Tiefe. Die so gefangene Beute hob er hoch über die Wasseroberfläche, ließ die flüssigen Lehm- und Tonbestandteile in Sturzbächen zurückströmen und schluckte den tropfnassen Kies in seinen Schlund, einen stählernen Trichter. Dabei konnte der staunende Ankömmling beobachten, wie Biss um Biss und Hub um Hub der Kies auf lange Förderbänder schwappte und, um bei dem Vergleich zu bleiben, wie in einem offenen Darm weitergeleitet wurde.
Plötzlich veränderte sich jäh die Situation. Direkt vor den Füßen des Betrachters löste sich ein mehrere Meter breites Erdreichmassiv der Steilwand und stürzte in Bruchteilen von Sekunden zunächst lautlos in die Tiefe. Kurz darauf hörte er ein donnerndes Geräusch wie die Meeresbrandung an Felsenklippen bei Sturm und sah eine Fontäne aus Gischt, Wasser und Kies über den Schwimmbagger spritzen. Dabei hob die Flutwelle den stählernen Koloss wie ein Spielzeug in die Höhe, um ihn im nächsten Augenblick in ein Wellental zu versenken, wo er, von gewaltigen Sturzseen überflutet, erneut Auftrieb bekam. Dieser Impuls übertrug sich zeitversetzt auf die ihm anhängenden Schwimmpontons der Förderbänder, die an den Drehpunkten einknickten und unter den wuchtigen Stößen der Elementarkräfte metallisch quietschten. Durch die Energie der sich ringförmig ausbreitenden Wellen bewegte sich das gesamte System noch eine Weile sehr heftig, bis es schließlich abflaute und der geschilderte Zyklus erneut begann.
Trotz des imposanten Anblicks der durch die Menschen entfesselten Naturgewalten hechtete der eben noch staunende Betrachter instinktiv einige Meter zurück, als plötzlich wie das Rumpelstilzchen aus der Erdspalte eine zierliche Gestalt erschien. Sie steckte in einem blauen Overall oder, wie man damals sagte, einer Kombi. Ihrer hohen Stimme nach zu urteilen, war sie weiblichen Geschlechts, wenn auch ihr Aufzug eher neutral war, dafür aber respekteinflößend wirkte.
»Sind Se verriggt, Se gännen doch nich hier so ohne Weiteres rumlatschen. Wenn de Steilwand glei wieder abbricht, liejen Se da unten in der Priehe! Wer sin Se überhaupt und wo gomm Se her?«
Dem so Angesprochenen verschlug es erst einmal die Sprache. Die ersten Worte an seinem zukünftigen Arbeitsort ertönten nicht wie erwartet in Platt oder wenigstens auf Hochdeutsch. Nein, dieses kleine Teufelsweib mit dem großen gelben Schutzhelm auf dem Kopf konnte vor Aufregung ihren – um es schonend zu sagen – eher süddeutschen Dialekt nicht unterdrücken.
Es entstand eine Pause, in der beide einige Schritte gelassen auf einander zuschlenderten, sich dabei gegenseitig taxierend.
»Sie befinden sich auf dem Gelände des VEB Kiesgewinnungs- und Verarbeitungsbetrieb Heidesand und dürfen sich hier nicht aufhalten. Ich arbeite hier als Sicherheitsinspektor. Mein Name ist Tatjana Schulze.«
Sie sagte das alles sehr beherrscht und in akzentfreiem Hochdeutsch. Er wollte zunächst etwas Freches erwidern, weil dieses erwachsene Mädchen ihm aufgeblasen, zickig und unnatürlich schien. Aber da er hier fremd war und offenbar den richtigen Weg nach Heidesand verfehlt hatte, verzichtete er auf eine Kraftprobe. Vielleicht gehörte diese kleine Maus schon bald zu den Vorgesetzten des Betriebes, in dem er heute seine Arbeit aufnehmen wollte.
Ohne auf ihre zuerst aufgeworfenen Fragen einzugehen, erkundigte er sich nur nach dem Weg zum Verwaltungsgebäude, und zwar dem kürzesten, da er sich beeilen müsse. Sie wies in eine Richtung, die von der Abbruchkante der Steilwand wegführte, und er machte sich ohne weitere Worte auf den beschriebenen Weg.
Rein dienstlich überwachte Tatjana noch eine Weile den Abgang des Mannes, bis er hinter den Abraumhalden und den die Felder begrenzenden Hutungen nicht mehr zu sehen war. Dann entledigte sie sich, wie um sich abzureagieren, der knitterfreien Kopfbedeckung und überließ ihre schulterlangen Haare dem Wind.
Im Speiseraum der Betriebsküche stand die Frühschicht als erste Essensempfängerin vor der geöffneten Klappe. Das musste so sein, weil die Kiesproduktion nur bei technischorganisatorisch bedingten Störungen gestoppt werden durfte und die Kumpel, die schon seit sechs Uhr im Betrieb arbeiteten, sich dann gut ablösen konnten. So schlang zunächst die halbe Mannschaft der Baggerbesatzung zusammen mit den Kollegen der Kiessiebe- und Verladestation ihre warme Mahlzeit hinunter. Das ging meistens noch glimpflich ab, weil die Pause für spitzfindige Gespräche viel zu kurz war. Wenn aber die Produktionsarbeiter der Normalschicht anrückten, gingen auch die Verwaltungsangestellten zu Tisch. In der Warteschlange an der Essensausgabe standen vom Betriebsdirektor bis zum Hilfsschlosser alle bunt durcheinander. Zum Beispiel die ahnungslose Trägerin einer blütenweißen Bluse vor dem ölverschmierten Schlosser, der gerade seinem hinter ihm stehenden Kollegen mit weit ausladenden Armbewegungen demonstrierte, wie er vorhin die Dieselleitung der Lok repariert hatte. Auch kleine Frotzeleien wurden ausgetauscht. Aber meistens verlief alles ziemlich harmlos. An den Tischen wurde das dann wesentlich schärfer formuliert. Aber auch nur für die unmittelbar zusammenarbeitenden Kollegen unter sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Man unterhielt sich fast überall, und meist ging es um die Arbeit, die Familien, das Wetter, aber auch um Probleme der Landwirtschaft. Der überwiegende Teil der Belegschaft dieses Tagebaubetriebes, ob Arbeiter oder Angestellter, war mit Leib und Seele immer noch Bauer. Und die Jüngeren von ihnen, die schon eine Ausbildung über den Betrieb absolviert hatten, waren oftmals Töchter und Söhne ehemaliger Mittelbauern, Kleinbauern und Landarbeiter. Viele besaßen ein kleines Stückchen Acker, Wiese oder einen Garten, aber auch ein, zwei Schweine, ein Rind, Schaf oder eine Ziege. Wem das alles neben seiner Arbeit im Kieswerk zu viel war, fütterte Kaninchen, Gänse, Enten oder Hühner. Also, ein Mensch, der überhaupt kein Tier sein Eigen nannte, war in den Augen der Dorfbevölkerung entweder krank oder ein neu Zugezogener. Wenigstens Hund, Katze oder Kanarienvogel musste es schon sein.
Doch zurück zum Mittagstisch. An einem hatten drei Arbeiter hinter vorgehaltener Hand etwas zu munkeln: »Die Ollsch vom Technischen hat hinten auf der Bluse einen schwarzen Fleck. Das war bestimmt Achi, der stand doch vorhin direkt hinter ihr!« Und dann rief einer von den dreien laut durch den ganzen Speisesaal, an die Adresse des Lokschlossers gerichtet: »Eh, Achi, du musst dir vor dem Essen die Finger waschen. Dann kann man auch nicht gleich sehen, wenn du fremde Frauen betatschst!«
Sofort verstummten die Gespräche im Raum, und alle Blicke gingen zu den weiblichen Mittagsgästen und ziemlich schnell zu derjenigen, die es betraf. Sie selbst konnte nichts entdecken, da der hässliche, schwarze Fleck ihre rückwärtige Partie verunzierte, aber ihre Tischnachbarinnen bestätigten schnell ihre schlimmsten Befürchtungen.
Das nehmen Frauen nicht so ohne Weiteres hin und also auch nicht die Frau des stellvertretenden Betriebsdirektors »Die Bluse bezahlen Sie mir«, rief sie spontan dem Schmierfinken zu und verließ, in ihrer Frauenehre zutiefst gekränkt, im Sturmschritt die Szene.
Hinter der Essensausgabe in der Betriebsküche konnten von den Köchinnen alle wichtigen Ereignissee genüsslich mitverfolgt werden. So auch die leibliche Ehefrau des Beschuldigten, die aber beim Namen Achi der Jähzorn packte. Sie umschloss die Schöpfkelle in ihrer Hand fester und zwängte ihren fülligen Oberkörper nebst heftig geschwungenem Küchengerät durch die Luke. »Achim, hierher!«, schrie sie in den Speiseraum. Das war endlich mal wieder etwas nach dem Geschmack der Dorfleute, die derbe Späße so sehr liebten.
Gerade als der so Angebrüllte mit gesenktem Blick aufstand, um seinem Eheweib das Missverständnis zu erklären, rückte plötzlich schlagartig ein anderes Ereignis in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit. Ein Fremder betrat den Essenraum, stellte sich ziemlich selbstbewusst vor die etwa zwanzig anwesenden Kollegen und wollte den Betriebsleiter sprechen. Da er wegen des anhaltenden Lärms nicht so richtig verstanden wurde, folgte sofort der nächste Schalk. Der Kranfahrer Heinrich, auch der kleine Küsser genannt, sprang vom Stuhl hoch, stellte sich hemdsärmlig wie er war vor dem Ankömmling auf die Zehenspitzen und verkündete lauthals: »Du kannst gleich mit mir verhandeln, ich bin hier der Boss!«
Nun brach das Gelächter der Leute so richtig los. Und der Neue konnte sich überhaupt nicht mehr zurechtfinden. Was hatte er an sich, das ihn lächerlich machte? Oder lag es mehr an der Posse dieses kleinen Wichtigtuers da vor ihm?
»Ich möchte zu Herrn Ehlich, hier ist mein Vorvertrag. Ich soll hier heute anfangen zu arbeiten.« Er wendete sich dabei an einen Angestellten, der mit einem blauen Nylonkittel bekleidet als solcher unschwer erkennbar an einem der vorderen Tische saß und sich ebenfalls amüsierte, wenn auch beherrschter.
»Wenn das so ist, dann komm mal mit. Ich bring dich zu seiner Sekretärin, der Chef ist nicht mehr der Herr Ehlich. Der neue Chef heißt Herr Schöller und der ist zur Zeit nicht im Hause.«
Das sagte der schon etwas ergraute Materialversorger Martens in väterlichem Ton, erhob sich ächzend von seinem Stuhl und schob den jungen Mann aus dem Lärm des Speiseraumes.
Doch im Vorzimmer des Direktors war die Chefsekretärin für mindestens eine Stunde ebenfalls abwesend. Sie hatte sich eine Strickjacke über die verschmutzte Bluse gezogen, das Fahrrad aus dem Ständer gezerrt und war so schnell, wie ihr enger Rock es gerade noch zuließ, nach Hause ins Dorf zum Umziehen geradelt.
Heidesand bestand aus Oberdorf und Unterdorf. Zu den wichtigsten Persönlichkeiten des Ortes, um es gleich einmal vorwegzunehmen, zählten die Leiter der beiden Großbetriebe Kieswerk und LPG, der Schuldirektor, die Postfrau, der Abschnittsbevollmächtigte als Vertreter der Polizeigewalt, der Bürgermeister und die beiden Verkaufsstellenleiterinnen des Konsums Ober- und Unterdorf; alle in ungeordneter Reihenfolge aufgeführt. Pfarrer und Gemeindeschwester übten eher schwächeren Einfluss auf die öffentliche Meinung im Dorf aus, was sie aber nicht hinderte, bei Problemen, die ihre Kompetenzen betrafen, kräftig mitzumischen.
Heidesand Oberdorf, das bedeutete Neubaublöcke, Polytechnische Oberschule, Arztpraxis, Bahnhof, Poststelle, die Gaststätte Zum wilden Hirsch und Konsum 1, während Unterdorf mit Kirche, Gutshaus, Bauernstellen und Katen den traditionellen Kern Heidesands bildete. Hier befand sich auch die Genossenschaft LPG Roter Oktober, die nach Enteignung des Rittergutsbesitzers von Ruckwitz dessen Anwesen übernommen hatte und diesen Ortsteil mit neu errichteten Großviehanlagen, Silos und Betonplattenwegen dominierte. Am Gutshaus hatte man einen saalartigen Anbau vorgenommen, der sich fortan Kulturhaus nannte. Dort wurden mindestens dreimal im Jahr mit allen Bewohnern die Feierlichkeiten des Dorfes wie Republikgeburtstag, Erster Mai und Erntefest vollzogen.
Gleich neben dem Friedhof und der Kirche befand sich der Kindergarten und auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Konsum 2. Beide Ortsteile verbindet eine Straße, auf der sich noch heute wie eh und je landwirtschaftliche Fahrzeuge und Kieslaster begegnen. Da heißt es Tempo drosseln, ausweichen und nicht nur auf Schulkinder achten, sondern auch auf die schon schwerhörigen Alten des Dorfes, die ausgebüxten Hühner und Hunde sowie Radfahrer, die manchmal eine Fernverkehrsstraße so benutzen, als wäre sie ein abgelegener Landweg.
So weit brauchte die mit voller Kraft in die Pedale tretende Chefsekretärin nicht zu radeln, denn sie bewohnte eine schöne Dreieinhalbzimmer-Neubauwohnung in Oberdorf. Doch wenn einmal der Wurm drinnen ist, wie man sagt, so passierte ihr gleich das nächste Malheur: Die Fahrradkette sprang ab. Sie versuchte zwar die verschmierten, aber in seitlicher Richtung schier unbeweglichen Glieder wieder zurück auf den Zahnkranz zu schieben, aber spätestens unter dem Kettenschutz versagten ihre handwerklichen Fähigkeiten und sie musste das heruntergefallene Endlosband erneut Zahn um Zahn und Glied um Glied auflegen. Als sie bemerkte, dass sich nun auch auf ihrer pinkfarbenen Jacke deutliche Spuren schwarzer Schmiere abzeichneten, fing sie vor Wut an zu heulen und begann den defekten Drahtesel nach Hause zu schieben. Aber zu allem Unglück war das Hinterrad blockiert, weil die Kette jetzt zwischen Rahmen und Speichen festklemmte. Mit Schrecken dachte sie an das baldige Ende ihrer Mittagspause und dass die Telefonzentrale nicht besetzt war.
Doch der Retter in der Not ließ nicht lange auf sich warten. Hinter ihr hatte sich ein Traktor mit Hänger ziemlich schnell genähert und direkt neben ihr angehalten. Der Fahrer hatte für die Küche des Kieswerkes Speisekartoffeln gebracht und wollte nun zur LPG zurückkehren; und als er die junge Frau begrüßt und ihr Problem erkannt hatte, wurde kurzerhand das Fahrrad auf den Hänger verfrachtet und sie kletterte, da sie sich ohnehin von Kopf bis Fuß eingedreckt fühlte, auf den ebenfalls über und über verstaubten Beifahrersitz. Nur schnell zu Hause sein, war ihr sehnlichster Wunsch.
Kurze Zeit später kamen sie dort auch mit Vollgas angeknattert und hielten direkt vor dem Hauseingang. Der Traktorist half der vom Pech Verfolgten vom Sitz und übergab das defekte Fahrrad einem alten Mann, dem ehemaligen Hufschmied August Präzas.
»August, du sitzt hier nur faul rum. Guck doch mal, vielleicht kriegst du es wieder in Gang!«
»Maak dat doch sölwenst, du Klaukschieter!«, entgegnete der bissig, machte sich aber trotzdem ohne Umschweife an die Reparatur des Fahrrads und ruckzuck war der Schaden behoben. Er stellte es an die Hauswand, steckte sich sein Pfeifchen in Brand und ging seelenruhig zu seiner zweiten Tochter, die im selben Häuserblock wohnte.
Jürgen Belt, so hieß der Neue, hatte sich seinen ersten Arbeitstag völlig anders vorgestellt. Erst dieser falsch eingeschlagene Weg zum Betrieb mit dieser gefährlichen Szene an der Steilwand und der eigenartigen Sicherheitstante. Da überkam ihn schon das Gefühl einer Niederlage, das beim Betreten des Verwaltungs- und Sozialgebäudes noch verstärkt wurde. Nach dem Auftritt im Speiseraum musste er lange Zeit auf einem Stuhl sitzend auf die Sekretärin warten, und als diese dann ziemlich außer Puste erschien, empfand er ihre Fragen für die Erstellung der Kaderakte wie ein Verhör bei der Kripo: »Sind Sie Mitglied einer Partei oder Massenorganisation, welche Arbeitsstelle hatten Sie zuletzt inne, und sind Sie Verfolgter des Naziregimes?« Die letzte Frage löste bei ihm Unverständnis aus, weil er 1945 noch ein Kleinkind gewesen war und von den internierten Kindern der Vernichtungslager der Nazis keine Kenntnis gehabt hatte. Er beantwortete alle Fragen mit abgehackten Sätzen und wünschte sich ein baldiges Ende der Prozedur, das dann auch mit der Unterschrift auf dem Arbeitsvertrag erfolgte.
Mit dem Laufzettel in der Hand hieß es nun alle betrieblichen Institutionen abzuklappern, um die erforderlichen Sichtvermerke einzuholen. So stolperte er mehr oder weniger ungeschickt über eine Bürotürschwelle zur anderen, dabei den BGL-er als den Vertreter der Gewerkschaft flüchtig kennen lernend und auch die Vertreter der anderen gesellschaftlichen Organisationen. DSF hieß der letzte Anlaufpunkt im Verwaltungsgebäude, dann ging es zum Umkleideraum ins Nebengebäude.
Als er eintrat, empfing ihn ein übler Geruch von Schweiß und vergammelten Arbeitssocken. Noch schlimmer als an Bord auf dem dreckigsten Bananendampfer der Billigflaggenländer, dachte er, sich seiner Fahrenszeit bei der christlichen Seefahrt erinnernd. Und dann erst der Spind, der ihm mit Nummer und Schlüssel für das Vorhängschloss zugedacht war! Er bestand aus Blech und war zweiteilig, eine Seite für die Arbeitssachen und daneben der Teil für die private Kleidung. Jede Abteilung war höchstens dreißig Zentimeter breit und zwei Meter hoch. Die Tiefe betrug eine Bügelbreite, aber nur knapp. Oben und unten klafften Lüftungsschlitze, aber durch das Einquetschen des textilen Inhalts war eine Zirkulation der Luft im Schrank völlig ausgeschlossen. Um das einigermaßen zu kompensieren, wurden Schuhe, Socken und auch nasse Oberbekleidung nach Belieben auf die Schränke und die Heizkörper zum Ausmiefen gelagert. Und so stank es dann auch.
Im Waschraum fehlten bei einigen Becken die Stöpsel, und die Wasserhähne waren überdreht. Deshalb tropfte und rieselte an den defekten Armaturen der Duschen das Wasser so vor sich hin. Die Fliesen wiesen dunkle Flecken auf und in den Ecken lagen Reste von Seife, leere Shampookissen und anderer Plastikmüll.
Dieses beklemmende Gefühl, in eine völlig neue Welt eingetaucht zu sein, die beim näheren Betrachten nicht besser war als die, die er gerade hinter sich gelassen hatte, änderte sich auch nicht, als er im Lager sein Bündel mit Arbeitsanzug, Schutzhelm, Schuhen und Regenzeug empfing. Der Verwalter warf ihm hier ohne Kommentar die Sachen auf den Tisch, nachdem er sich vorher lediglich kurz nach der Konfektionsgröße erkundigt hatte. Es interessierte ihn eigentlich sehr, wo der Neue herkam, wo er wohnen werde und ob er verheiratet war. Aber der echte Mecklenburger weiß seine Neugier zu beherrschen und gibt sich erst einmal wortkarg.
Als Jürgen Belt sich verabschiedete und die Tür hinter sich zumachte, wurde aus dem Lager sofort telefoniert: »Hallo Otto, was macht dein Kies? Hast du alles verscheuert oder will keiner mehr was von dir? Ha, ha, sag mal, kannst du dich an den Neuen von heute Mittag erinnern? Ich meine den langen Blonden, der mit seiner Brille und der hohen Stirn aussieht wie Karl Eduard von Schnitzler vom ›Schwarzen Kanal‹. Was, so etwas siehst du nicht? Ist mir auch egal, aber mich wundert nur, warum die da oben so viele Leute einstellen. Das geht alles zu Lasten des ohnehin zu geringen Lohnfonds und wir sind wieder mal die Dummen. Also, ich habe seine Unterlagen gesehen. Der Neue kommt aus Weimar, spricht aber ganz normales Hochdeutsch und ist fünfunddreißig Jahre alt. Mal sehen, wie lange der es hier aushält. Er soll übrigens als Bandwärter in Brigade vier anfangen, es kann aber auch sein, dass er als Schlosser arbeiten wird. Ich konnte das hier nicht genau entziffern. Ich muss jetzt Schluss machen, hier kommen wieder welche rein.«
Jürgen Belt wurde, nachdem er alle Positionen seines Laufzettels abgearbeitet hatte, vom Schichtleiter der Spätschicht kurz in sein Aufgabengebiet eingewiesen. Die Erstbelehrung für den Arbeitsschutz erfolgte ebenfalls ziemlich schnell. »Immer schön aufpassen, und wenn mal was schiefgeht, Reißleine ziehen. Hier, unterschreib mal! Jetzt musst du noch mal ins Büro, da sagt man dir, wo du pennen kannst. Ach so, arbeiten brauchst du heute nicht mehr. Aber morgen früh um sechs geht deine Schicht los. Du meldest dich beim Kollegen Burmeister, das ist die Brigade vier. Nicht verschlafen!«
Er machte alles so, wie es für die Neuen vorgeschrieben war, und landete schließlich in einem möblierten Zimmerchen direkt über der Verkaufstelle Konsum Oberdorf gleich neben dem Wirtshaus.
»Gehmse dem Schmidt, ich meine dem Hufschmied August Präzas da drüben mal einen … äh, ich wollte sagen …«
»Ja, Paulchen, einen Spezi«, wird ihm geholfen.
»Gott sei Dank, sei verstahn mir, junge Fru.« Das alles sagt Herr Paul Zick ganz langsam und bedächtig. Dann steckt er sich eine Zigarre an und nimmt erneut Anlauf für seine Bestellung: »Ich meine, dass Sie dem Schmied, also Herrn Präzas einen … ich will ihm den spendieren, na, Sie wissen schon.«
»Einen Spezi für Herrn Präzas!«, wiederholt die junge Kellnerin vom Wilden Hirsch noch einmal mit einem netten Lächeln, ihren älteren Gästen besonders viel Geduld entgegenbringend.
Der Spezi wird gebracht, und der auch nicht mehr ganz neue Herr Präzas trinkt auf das Wohl des Spenders erst einmal per Distanz.
Ein wenig später sitzen beide zusammen am Tisch und sprechen ihr Plattdeutsch so, wie es sich auf dem flachen Lande durch den wechselnden Gebrauch mit dem Hochdeutschen eingeschliffen hat.
»Wi beid sünn ümmer Fründs west, August«, sagt der Ältere, und der andere bestätigt ihm schulterklopfend: »Ja, dat sünn wi ümmer west.«
Der Ältere darauf: »Verstahst du, wi wolln uns nich bedrinken, öwer mit nem gooden ollen Fründ, da … He Muddi, einen Spezi und einen Deutschen wulln wi hebben!«
Der wird auch prompt gebracht.
»Wie old büst du igentlichs, Paul?«
»Ick bün nun sößunachtich Johr, und du?« Hier bläst der Frager seinem Gegenüber eine gewaltige Tabakswolke ins Gesicht, als wollte er ihm die Bedeutung seines hohen Alters unterstreichen.
Schon etwas kleinlauter antwortet der andere: »Ick bün jetzt negenunsößdich, öwer förrich Johr is miene groode Dochter mit fiefunvierdich gestorben un unsereins leevt ümmer noch!«
Der Ältere sagt zu dem Thema erst einmal nichts, so dass der jüngere Herr Präzas seinen Faden weiterspinnen kann: »Hüt wier ick uppen Friedhoff mit mien Ollsch. Dor wier sonn Gedrängel wie bi de Kirmes, so väl Lüd wiern dor. Ick häv nämlich för mi un mien Fru ´ne niege Gravstell köfft.« Jetzt muss er erst einmal unterbrechen, um den Schnaps zu trinken. Da der andere damit schon fertig ist, gelingt es Herrn Zick leicht, das Gespräch wieder an sich zu ziehen.
»Ja, ja, August, so is dat all. De oll Karl Knaak, de wier ook een feinen Kierl. Ümmer anständig, ümmer sauber. Öwer ick heff tau em seggt: Wat müsst du ümmer Dubbelde drinken, heff ick seggt, ümmer Dubbelde, verstahst du? Heff ick tau em seggt!«
Trotz dieser überzeugenden Geschichte vom verstorbenen Karl Knack, dem ehemaligen Gastwirt vom Wilden Hirsch, knüpft sein Gesprächspartner jedoch unbeeindruckt an seinem durch das Trinken unterbrochenen Gedankenfaden an und bleibt thematisch bei seiner Familie: »Ja, ja, und mien Fru hett säggt: Links ick, un rechts Vadder und dat Mädel in de Midde.«
Da er diese Erklärung ziemlich hastig hervorgebracht hat, muss er erst einmal verschnaufen. Dadurch kommt der andere wieder zum Reden.
»Ja, ja, ein feinen Kierl wier dat west. Na, ick hew em de Rauh gönnt. Un jedem Annern gönn ick se ook. Hier is schön ruhig in, bi den dicken Knaak wier veel miehr los. Muddi, noch einen Spezi un einen Deutschen wulln wie hebben!«
Doch August Präzas fährt in seiner Rede unbeeindruckt fort: »Dat hett de leif Herrgott falsch makt mit uns Dochter, feines Mädel wier dat, un so fleißig.«
Das Thema Sterben scheint sich zu erschöpfen, so dass Herr Zick zu einem anderen überleitet. »Ja, so is dat all. Wi beid wiern doch ümmer goode Fründ west, bit up de Sach von damals vör tein orer föftein Johr … nee, twinnig Johr möt dat tröch leggen. Öwer dat is allens vörbi: Un darup drinken wi noch eenen, nich, August?«
Doch der ist in Gedanken immer noch bei seinem Familiengrab. »Öwer de Gravstell is tau düer west. Achtich Mark möt ick för dat Ding betalen.«
Ein Haus weiter über der Konsumverkaufstelle saß zu gleichen Zeit Jürgen Belt auf der Bettkante in seiner Mansarde und starrte hinunter auf die Dielen des Fußbodens. Seine Situation erinnerte ihn an die von Seeleuten, die ihr Schiff verloren hatten und nun im fremden Hafen unter unbekannten Menschen leben mussten. In die Gaststätte wollte er nicht mehr gehen. Er brauchte jetzt keine neuen Gesichter mehr und schon gar keine neuen Probleme. Und morgen früh klingelte um fünf der Wecker, wenn er es denn auch wirklich tat. Waschen konnte er sich in einer Schüssel, die er mit einem bereitstehenden irdenen Krug füllte. Warmes Wasser machte er sich mit einem Tauchsieder, den die Wirtin für ihn hingelegt hatte. Auf den Nachttisch stellte er noch ein Foto von einer Frau, nahm es dann aber wieder weg und legte sich schlafen.
Doch im Wirtshaus Zum wilden Hirsch war am Stammtisch in der Zeit gegen einundzwanzig Uhr an Feierabend nicht zu denken. Die einen unterhielten sich, während die anderen Karten spielten. Die älteren Gäste, die Herren Zick und Präzas, hatten das Feld längst geräumt, denn sie tranken mäßig, doch nicht übermäßig. Das bedeutet im fortgeschrittenen Alter, einen kleinen bis mäßigen Schwips ohne körperfremde Unterstützung und größere Schwankungen nach Hause zu tragen.
Jetzt saß nur noch der harte Kern von Heidesand vereint am runden Tisch. Man unterhielt sich angenehm und gut, doch auf sehr verschiedene Weise.
»Deine Frau hat sich heute Mittag aufgeführt wie eine olle Zicke!«, sagte einer der Zecher, der selbst Junggeselle war, zu Achim und lachte dabei schelmisch in die Runde. Der konterte prompt mit einem Spruch seines Vaters von anno Knips: »Beder ´ne Zick in`t Huus, as gar kein Viech im Stall!« Das war nun wieder zweideutig und rief den Protest eines Skatspielers hervor, der gerade am Geben war.
»Wat meckerst du immer über deine dicke Ollsch, siehst doch selbst aus wie so`n verhungerter Ziegenbock, Achi!« Und zu den ungeduldigen Mitspielern gewandt: »Ja, ich gebe.«
»Weil du gerade Ziegenbock sagst, Karl«, versuchte Achim das Gespräch in eine weniger verfängliche Bahn zu lenken und begann zu erzählen: Als Junge habe er so richtige Sehnsucht nach einem kleinen Zicklein gehabt. Sein Vater, mit seinem mittelbäuerlichen Hof, wollte von solchem Vieh, das der Dorfarmut vorbehalten war, nichts wissen. »So wat kümmt mi nich upp`n Hoff!«, sagte er barsch zu dem zwölfjährigen zukünftigen Hoferben. Und das war dann auch schon alles, was in dieser Angelegenheit von ihm zu hören war.
Die Skatspieler hatten ihre letzte Runde beendet, waren aber noch nicht spielmüde. Mit verhaltener Stimme und nur an die infrage kommenden Mitspielern gewandt, sagte der in der Gastwirtschaft oft gesehene Technische Direktor fragend und zugleich auffordernd: »Pokern wir?«
Zustimmendes Nicken und erneutes Mischen und Ausgeben der Karten. Dann wurde Geld auf den Tisch gelegt, viel Geld.
Doch Achim erzählte weiter. Er hatte beschlossen, seinen jungen, aber echt mecklenburgischen Dickkopf durchzusetzen. Der Bauer, also sein Vater, würde auf diesem großen Hof mit den vielen Ställen und Schuppen ja sowieso nichts merken.
»Einen kleinen Holzverschlag habe ich mir an der Rückseite der Scheunenwand, da, wo jedes Jahr die Kletten wuchern, gebaut«, erzählte er den teilweise schon gelangweilten Zuhörern. Kein Mensch sei je dahin gekommen. Und so trug er eines Abends in einem großen Rucksack versteckt ein junges Zicklein herbei. Er war mit dem Fahrrad ins Nachbardorf gefahren, hatte dort von einem Bekannten das Tier gekauft und brachte es überglücklich auf seinem Rücken nach Hause. Dabei schlug sein eigenes Herz noch schneller als das des kleinen Zickleins in seinem dunklen, ungewohnten Gefängnis. Zu Hause angekommen, schlich er sich wie ein Dieb zum Versteck. Nur der Vollmond sah zu, als er den kleinen, vor Angst zitternden Körper des Zickleins aus dem Sack befreite. Das Köpfchen war so wuschelig und schmiegte sich sofort an seine streichelnde Hand.
An dieser Stelle der Erzählung von Achim über sein Abenteuer mit dem Zicklein wurde in der Pokerrunde abgezockt. Vor aller Augen strich sich ein Mitspieler den satten Betrag der Bank ein, indem er alle auf dem Tisch liegenden Geldscheine hastig in seine Jacketttasche steckte. Die anderen Zocker sogen nervös an ihren Zigaretten oder kratzten sich stumm am Hinterkopf.
Die am Spiel nicht Beteiligten mussten sich aber wohl oder übel den Rest der Ziegengeschichte anhören, wobei sie sich, hier und da schon mal gähnend, wieder dem Erzähler zuwendeten.
Das Zicklein wurde in seiner neuen Behausung auf Stroh gebettet und schlief beim Schein der Stalllaterne auch sofort ein. Als der stolze Besitzer nun in sein Zimmer schlich, gedachte er, fortan sein Haustier auch ohne väterlichen Segen großziehen zu können, und er träumte sich diesen Wunsch bis in den Schlaf hinein.
Als dann am Morgen die Familie gemeinsam mit dem gestrengen Patriarchen am Frühstückstisch saß, platzten jedoch jäh alle diesbezüglichen Pläne. Denn laut ertönte in die noch morgendliche Stille über den Bauernhof hinweg ein fröhliches Määh, Määh!. Und das Echo trug es noch über die Kiefernwipfel am Waldrand weiter und, wie es Achim erschien, bis ans Ende der Welt und auch seiner Träume vom eigenen Zicklein.
»Feierabend, meine Herren. Auch der Gast macht sich strafbar«, verkündete der neue Gastwirt, der wohl mehr auf das Ende der kleinen Geschichte gewartet hatte als auf eine neue Runde beim Pokern. Da ohnehin schon offiziell Gaststättenschluss angesagt war, zahlten alle noch Anwesenden ohne Murren ihre Rechnung und verließen das Lokal. Stark Angetrunkene, die es mit dem guten Betragen nicht so ernst nahmen, pinkelten allerdings noch schnell übers Rosenbeet vor der Eingangstür, welches von der jungen Kellnerin am Tage sorgsam gepflegt wurde, aber spät abends nicht mehr vor den letzten Zechern geschützt werden konnte. Trotz dieser unschönen Prozedur, die sich fast jeden Abend abspielte, blühten die Rosen Jahr für Jahr immer üppiger und prachtvoller bis in den späten Herbst hinein.
2
Von der Liebe und dem Tod in Heidesand
Am Bahndamm, der Hauptverkehrsader zwischen dem Norden und dem Süden der Republik, blühen in der Gegend um Heidesand im Sommer mehr die Unkräuter als die Wildblumen. Diese sind gegen die chemischen Keulen, die zur Niederhaltung des unerwünschten Gleisbettbewuchses angewendet werden, nicht resistent genug, aber die Unkräuter scheinen sich daran zu gewöhnen. Meterhohe Klettenstauden und die sich gierig schlängelnde Ackerwinde erklimmen immer wieder aufs Neue die Anhöhe, die den Schienenstrang trägt. Dagegen sieht man die blaue Wegwarte oder die rosafarbene Wildmalve in dieser Flora sehr selten.
Auf der Dammkrone donnern die Züge am Tagebau in weniger als einer Minute vorbei. Die Fahrgäste sehen auf der einen Seite dichten Kiefernwald und gegenüber das große Areal des Kieswerkes hinter dem Abteilfenster in Sekundenfrist auftauchen. Die riesigen Schüttguthalden und die gewaltigen Gitterkonstruktionen für die Förderbandbrücken erscheinen aus der Perspektive des Reisenden, vom hohen Bahndamm und vom Fenster aus, klein und unbedeutend. Er sieht von weitem eine winzige Diesellok mit Waggons rangieren, vielleicht noch einen nadeldünnen Förderstrom Kies auf die Halden rieseln, und schon schließt sich die eben noch offene Landschaft wieder. Zurück bleibt dieser Eindruck: eine riesige Kieskuhle, die mit dem großen Baggersee ziemlich trostlos wirkt.
Aber dort, wo das monotone Schmatzen der Förderbänder ankündigte, dass sich der Gummigurt ablöste und über die Tragrollen schepperte, wo das zerrissene Band in kurzer Zeit meterhohe Kiesberge auftürmen ließ, wo in jedem Moment ein spitzer Stein zwischen den Abweiswinkel und die Umlenktrommel geraten und damit den gesamten Betrieb zum Stillstand bringen konnte, agierten im ständigen Wechsel von Erfolg und Misserfolg miteinander oder auch gegeneinander Natur und Mensch sowie die von ihm mal mehr und mal weniger beherrschte Technik.
Die Bahnlinie begrenzte damals noch den westlichen Abschnitt der Kieslagerstätte. Als Magistrale zwischen Rostock und Berlin fungierend, wurde auf ihr der überwiegende Teil der Kiestransporte durchgeführt. Wollte man alle Geschichten aufschreiben, welche die im Schotter verankerten Schienen im Laufe der Jahre hier gesehen und gehört haben könnten, so würden dabei zwangsläufig wichtige Episoden der entstehenden, gereiften und absterbenden DDR widergespiegelt. Da wurden zum Beispiel Granitsteine aus dem ganzen Land für den Überseehafen transportiert, ebenso eine komplette Fußballmannschaft aus Thüringen nach Rostock. Es folgten hohe Staatsmänner und Parteifunktionäre sowie Künstler und Spitzensportler. Einige, die den Slogan Rostock – das Tor zur Welt auf ihre Art und ohne Rückreise umsetzten, kamen erst nach dem Umbruch wieder, weil sie plötzlich feststellten, dass sie hier ihre Wurzeln hatten; von ihrer Ausbildung wollen wir an dieser Stelle einmal absehen.
Aber viel deutlicher und detaillierter als die Erinnerung an die Prominenten des Arbeiter-und-Bauernstaates sind im Bewusstsein der hier lebenden Menschen die glücklichen und tragischen Begebenheiten verankert.
Der Bahndamm, der vieles gesehen hat, schweigt natürlich. Die Blumen und Gräser können nicht sprechen und die unbelebte Natur kann nur das wiedergeben, was der Mensch und die Erosion an ihr verändert haben. Dennoch scheint es manchmal, als wollte der eiserne Schienenstrang eine Nachricht übermitteln. Streckenwärter brauchen noch nicht einmal den Kopf auf die Gleise zu legen. Ein fast grillenartiges Summen liegt in der Luft und wird stärker und stärker. Der Zug ist noch kilometerweit entfernt, doch das Geräusch seines Triebwerkes übertönt allmählich das Zwitschern der Waldvögel auf der einen Seite des Bahndamms und auf der anderen das metallische Quietschen der Tagebaugeräte. Wer jetzt nicht schnellstens vom Bahnkörper verschwindet, ist taub oder hat mit sich und der Welt abgeschlossen, lange bevor der Zug heranbraust.
Tatjana Schulze, die Sicherheitsinspektorin des Kieswerkes, war ihrem Wesen nach eher unkompliziert und zurückhaltend. Aber in ihrem Blick lag etwas Suchendes und zugleich Forderndes. Mit einem Hochschulabschluss als Diplomingenieur an der Bergakademie Freiberg verfügte die sechsundzwanzigjährige Dresdnerin über Kenntnisse, die weit über dem Niveau lagen, das in diesem Betrieb erforderlich war. Aber sie tat das, was die meisten Absolventen beim Eintritt ins Berufsleben machten: Mit vollem Einsatz stürzte sie sich auf die Bewältigung der Aufgaben, die man ihr übertrug. Dabei vergaß sie viel zu oft, dass sie bei aller Arbeit auch einen Anspruch auf das Ausleben ihrer Jugend hatte.
In ihrer freien Zeit las sie Romane oder unternahm ausgedehnte Wanderungen in die Umgebung des Tagebaus. Wenn sie in den Wald gelangen wollte, musste sie den Bahndamm kletternd überwinden, da der nächste passierbare Übergang kilometerweit entfernt lag. Aber das machte sie gern und meist an derselben Stelle. Denn dort, wo sie auf





























