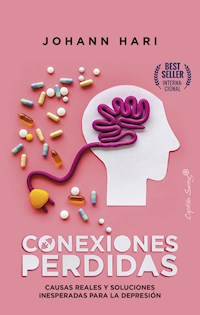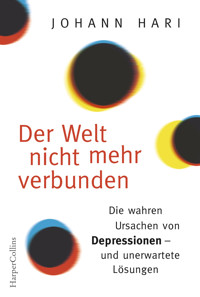15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
Warum haben wir unsere Fähigkeit verloren, uns zu konzentrieren? Was sind die Gründe dafür? Und am wichtigsten: Lässt sich Aufmerksamkeit wieder antrainieren? Um diese und viele weitere spannende Fragen zu beantworten, hat Johann Hari über drei Jahre lang Forschungen betrieben. Er hat vom Silicon Valley über eine Favela in Rio bis zu einem Büro in Neuseeland mit den weltweit führenden Experten und Fachleuten gesprochen, 12 entscheidende Gründe, die für den Verlust unserer Aufmerksamkeit verantwortlich sind, entlarvt und zeigt Wege auf, wie wir unseren Fokus endlich wieder zurückgewinnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
JOHANN HARI
ABGELENKT
JOHANN HARI
ABGELENKT
Wie uns die Konzentration abhandenkam und wie wir sie zurückgewinnen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtiger Hinweis
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
3. Auflage 2025
© 2022 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2022 bei Bloomsbury Publishing PLC unter dem Titel Stolen Focus: Why You Can’t Pay Attention. Copyright © Johann Hari 2022. All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Simone Fischer
Redaktion: Susanne Meinrenken
Umschlaggestaltung: Karina Braun
Umschlagabbildung: Shutterstock.com/bookzv
Satz: Christiane Schuster | www.kapazunder.de
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2238-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2018-3
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.riva-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für meine Großmütter Amy McRae und Lydia Hari
Ich habe die englischen Audioclips von allen Personen, die in diesem Buch interviewt werden, auf die Webseite gestellt, sodass Sie während der Lektüre des Buchs unseren Gesprächen zuhören können.
Gehen Sie auf www.stolenfocusbook.com/audio.
Inhalt
Einleitung: Walking in Memphis
Kapitel 1: Ursache 1: Die Zunahme von Geschwindigkeit, der Druck des Umschaltens und Filterns
Kapitel 2: Ursache 2: Die Beeinträchtigung unseres Flows
Kapitel 3: Ursache 3: Die zunehmende körperliche und geistige Erschöpfung
Kapitel 4: Ursache 4: Der Niedergang des nachhaltigen Lesens
Kapitel 5: Ursache 5: Die Störungen des Mind-Wanderings
Kapitel 6: Ursache 6: Das Aufkommen von Technologien, die uns verfolgen und manipulieren können Teil eins
Kapitel 7: Ursache 6: Das Aufkommen von Technologien, die uns verfolgen und manipulieren können Teil zwei
Kapitel 8: Ursache 7: Das Aufkommen des grausamen Optimismus
Kapitel 9: Erste Einblicke in die tiefere Lösung
Kapitel 10: Ursache 8: Die Zunahme von Stress und wie dies Wachsamkeit auslöst
Kapitel 11: Die Orte, an denen man herausfand, wie man die Zunahme von Geschwindigkeit und Erschöpfung umkehren kann
Kapitel 12: Ursachen 9 und 10: Unsere schlechter werdende Ernährung und die zunehmende Umweltverschmutzung
Kapitel 13: Ursache 11: Das Aufkommen von ADHS und wie wir darauf reagieren
Kapitel 14: Ursache 12: Die physische und psychische Gefangenschaft unserer Kinder
Schlussfolgerung Die Aufmerksamkeits-Rebellion
Gruppierungen, die bereits für die Verbesserung der Aufmerksamkeit kämpfen
Danksagung
Quellenangaben
Über den Autor
Einleitung
Walking in Memphis
Als er neun Jahre alt war, entwickelte mein Patensohn eine kurze, aber wahnsinnig intensive Elvis-Presley-Besessenheit. Er fing an, Jailhouse Rock aus voller Kehle zu singen, intonierte all die tiefen Töne und ließ sogar seine Hüften kreisen wie der King selbst. Er wusste nicht, dass dieser Stil mittlerweile zur Lachnummer mutiert war, und so sang er mit der herzergreifenden Aufrichtigkeit eines Heranwachsenden, der glaubt, cool zu sein. In den kurzen Pausen, die er einlegte, bevor er wieder anfing zu singen, wollte er alles (»Alles! Alles!«) über Elvis wissen, und so erzählte ich ihm den groben Umriss dieser inspirierenden, traurigen, dummen Geschichte.
Elvis wurde in einer der ärmsten Städte in Mississippi geboren – an einem weit, weit entfernten Ort, erzählte ich. Er kam als Zwilling auf die Welt, doch sein Zwillingsbruder starb ein paar Minuten nach der Geburt. Seine Mutter erklärte dem kleinen Elvis, dass sein Bruder seine Stimme hören könne, wenn er jede Nacht zum Mond singen würde, und so sang und sang Elvis. Er begann, öffentlich aufzutreten, gerade als das Fernsehen seinen Siegeszug antrat – und wurde so mit einem Schlag berühmter als je ein anderer Mensch zuvor gewesen war. Überall, wo Elvis hinkam, rasteten die Leute aus und kreischten, sodass seine Welt irgendwann einer Folterkammer voller Geschrei glich. Er zog sich in einen selbst gebauten Kokon zurück, in dem er seine Besitztümer als Ersatz für seine verlorene Freiheit verherrlichte. Für seine Mutter kaufte er einen Palast, den er Graceland nannte.
Den Rest der Geschichte behandelte ich nur flüchtig – den Abstieg in die Sucht, das schwitzende, Grimassen schneidende Auftreten in Vegas, den Tod im Alter von 42 Jahren. Immer wenn mein Patensohn – den ich im Folgenden Adam nennen werde, da ich einige Details geändert habe, damit er nicht identifiziert werden kann – Fragen zum Ende der Geschichte stellte, brachte ich ihn stattdessen dazu, mit mir im Duett Blue Moon zu singen. You saw me standing alone, sang er mit seiner zarten Stimme, without a dream in my heart.Without a love of my own.
Eines Tages sah Adam mich sehr ernst an und fragte: »Johann, nimmst du mich mit nach Graceland?« Ohne wirklich nachzudenken, stimmte ich zu. »Versprichst du es mir? Versprichst du es wirklich?« Ich bejahte. Und ich verschwendete nie wieder einen Gedanken daran, bis eines Tages alles aus dem Ruder lief.
Zehn Jahre später war Adam verloren. Er hatte mit 15 die Schule abgebrochen und verbrachte praktisch seine gesamte Zeit zu Hause, wo er nur mit leerem Blick auf verschiedene Bildschirme starrte – auf sein Handy, auf dem unendlich viele WhatsApp- und Facebook-Nachrichten eintrudelten, und auf sein iPad, auf dem er sich YouTube-Clips und Pornos ansah. In manchen Momenten konnte ich in ihm immer noch Spuren des fröhlichen kleinen Jungen sehen, der Viva Las Vegas sang, aber es war, als wäre seine Persönlichkeit in viele kleine, unzusammenhängende Fragmente zerfallen. Es fiel ihm schwer, sich länger als ein paar Minuten mit einem Gesprächsthema zu befassen, ohne auf einen Bildschirm zu starren oder abrupt das Thema zu wechseln. Er schien mit der Geschwindigkeit von Snapchat umherzuschwirren, irgendwohin, wo ihn nichts Stilles oder Ernstes erreichen konnte. Er war intelligent, vernünftig, freundlich – aber es war, als könne nichts in seinen Gedanken einen Halt finden.
In dem Jahrzehnt, in dem Adam zum Mann geworden war, schien diese Zerrissenheit bis zu einem gewissen Grad vielen von uns zu widerfahren. Das Lebensgefühl des frühen 21. Jahrhunderts bestand in der Empfindung, dass unsere Fähigkeit zur Aufmerksamkeit – zur Konzentration – Risse bekam und dann verloren ging. Ich konnte spüren, wie es mir erging – ich kaufte stapelweise Bücher und sah sie schuldbewusst aus einem Augenwinkel an, während ich, wie ich mir vormachte, nur noch einen einzigen Tweet abschickte. Ich las immer noch viel, aber mit jedem Jahr, das verging, fühlte es sich mehr und mehr an, als würde ich in eine Abwärtsspirale geraten. Ich war gerade 40 geworden, und wo auch immer meine Generation zusammenkam, beklagten wir uns über unsere verlorene Konzentrationsfähigkeit, als wäre sie ein Freund, der eines Tages auf hoher See verschwunden und seitdem nicht mehr gesehen worden war.
Eines Abends, als wir auf einem großen Sofa gammelten und jeder von uns auf seinen unaufhörlich dröhnenden Bildschirm starrte, sah ich Adam an und spürte ein leises Grauen. So können wir doch nicht weiterleben, dachte ich.
»Adam«, sagte ich leise. »Lass uns nach Graceland fahren.«
»Was?«
Ich erinnerte ihn an das Versprechen, das ich ihm vor so vielen Jahren gegeben hatte. Er konnte sich weder an diese Blue Moon-Tage noch an mein Versprechen erinnern, aber ich konnte sehen, dass der Gedanke, diese betäubende Routine zu durchbrechen, etwas in ihm auslöste. Er sah zu mir auf und fragte, ob ich es ernst meine. »Ja«, antwortete ich, »aber es gibt eine Bedingung. Ich bezahle diese Reise über viertausend Meilen. Wir fliegen nach Memphis und nach New Orleans – und wir fahren durch den ganzen Süden, wohin du willst. Aber ich kann das nicht tun, wenn du nur auf dein Handy starrst, wenn wir dort ankommen. Du musst mir versprechen, dass du es nur noch abends einschaltest. Wir müssen in die Realität zurückkehren. Wir müssen uns wieder mit etwas verbinden, das uns wichtig ist.« Er versprach es, und ein paar Wochen später hoben wir von London Heathrow ab, in das Land des Delta-Blues.
Wenn man an den Toren von Graceland ankommt, gibt es dort kein menschliches Wesen mehr, dessen Aufgabe es ist, einen herumzuführen. Man bekommt ein iPad in die Hand gedrückt, steckt sich kleine Ohrstöpsel in die Ohren, und das iPad sagt einem, was man tun soll – nach links gehen, nach rechts gehen, vorwärts gehen. In jedem Raum erzählt einem das iPad mit der Stimme eines längst vergessenen Schauspielers etwas über das Zimmer, in dem man sich gerade befindet, und auf dem Bildschirm erscheint ein Foto des Raums. Auf diese Weise liefen wir also allein durch Graceland und starrten dabei auf unsere iPads. Wir waren umgeben von Kanadiern und Koreanern und Menschen aller Nationen mit leeren Gesichtern, die nach unten blickten und nichts um sich herum wahrnahmen. Niemand schaute lange auf etwas anderes als auf seinen Bildschirm. Ich beobachtete die anderen, während wir weitergingen, und wurde dabei immer angespannter. Gelegentlich wandte jemand seinen Blick vom iPad ab, und in diesen Momenten spürte ich ein Aufflackern von Hoffnung, und versuchte, Augenkontakt mit diesem Menschen herzustellen, mit den Schultern zu zucken und zu sagen: Hey, wir sind die Einzigen, die sich umsehen, wir sind diejenigen, die Tausende von Meilen gereist sind und beschlossen haben, die Dinge, die vor uns liegen, tatsächlich zu betrachten – aber jedes Mal, wenn dies geschah, stellte ich fest, dass dieser Mensch den Kontakt zum iPad nur unterbrochen hatte, um sein Handy zu zücken und ein Selfie zu machen.
Als wir den Jungle Room erreichten – Elvis’ Lieblingsraum in der Villa –, plapperte das iPad munter vor sich hin, als ein Mann mittleren Alters, der neben mir stand, sich umdrehte, um etwas zu seiner Frau zu sagen. Vor uns standen die großen künstlichen Topfpflanzen, die Elvis gekauft hatte, um diesen Raum in seinen persönlichen künstlichen Dschungel zu verwandeln. Die falschen Pflanzen standen immer noch an Ort und Stelle und ließen ihre Blätter traurig herunterhängen. »Schatz«, sagte der Mann, »das ist unglaublich. Schau mal.« Er wedelte mit dem iPad in ihre Richtung und begann dann, mit dem Finger darüber zu streichen. »Wenn du nach links wischst, kannst du den Jungle Room auf der linken Seite sehen. Und wenn du nach rechts wischst, siehst du den Jungle Room auf der rechten Seite.« Seine Frau blickte ihn kurz an, lächelte und begann dann, auf ihrem eigenen iPad zu wischen.
Ich beobachtete sie. Sie wischten hin und her und betrachteten die verschiedenen Dimensionen des Raums. Ich lehnte mich vor. »Aber Sir«, sagte ich, »es gibt eine altmodische Form des Swipens, die Sie hier durchführen können. Sie müssen nur den Kopf drehen. Denn wir sind hier. Wir sind im Jungle Room. Sie müssen ihn sich gar nicht auf Ihrem Bildschirm ansehen. Sie können ihn direkt vor Ihren Augen sehen. Hier. Sehen Sie.« Ich winkte mit der Hand, und die künstlichen grünen Blätter raschelten ein wenig.
Der Mann und seine Frau wichen ein paar Zentimeter von mir zurück. »Sehen Sie!«, sagte ich mit lauterer Stimme als beabsichtigt. »Begreifen Sie es denn nicht? Wir sind hier. Wir sind wirklich hier. Sie brauchen Ihren Bildschirm nicht. Wir sind im Jungle Room.« Sie verließen eilig den Raum und warfen mir kopfschüttelnd einen Blick zu, als sei ich ein armer Irrer. Und ich spürte, dass mein Herz plötzlich schneller schlug. Ich drehte mich zu Adam um, bereit mit ihm über die Situation zu lachen, die Ironie mit ihm zu teilen, meine Wut loszuwerden – aber er saß in einer Ecke, hielt sein Handy versteckt unter der Jacke und scrollte durch Snapchat.
Er hatte zu jedem Zeitpunkt dieser Reise sein Versprechen gebrochen. Als das Flugzeug zwei Wochen zuvor in New Orleans gelandet war, holte er sofort sein Handy heraus, während wir noch auf unseren Sitzen saßen. »Du hast versprochen, es nicht zu benutzen«, ermahnte ich. Er antwortete: »Ich habe das so verstanden, dass ich nicht telefoniere. Aber ich kann doch nicht auf Snapchat und WhatsApp verzichten, das ist ja wohl klar.« Er sagte dies mit einer so ehrlichen Verblüffung, als hätte ich ihn gebeten, zehn Tage lang die Luft anzuhalten. Ich beobachte, wie er im Jungle Room schweigend durch sein Handy scrollte. An ihm vorbei schob sich ein Strom von Leuten, die ebenfalls auf ihre Bildschirme starrten. Ich fühlte mich so allein, als stünde ich in einem leeren Maisfeld in Iowa, meilenweit von jeglichen anderen Menschen entfernt. Ich ging zu Adam und riss ihm das Handy aus der Hand.
»So können wir doch nicht leben!«, rief ich. »Du weißt ja gar nicht, wie man präsent ist! Du verpasst dein Leben! Du hast Angst, etwas zu verpassen – deshalb siehst du die ganze Zeit auf deinen Bildschirm! Aber auf diese Weise verpasst du garantiert etwas! Du verpasst dein ganzes Leben! Du siehst die Dinge nicht, die direkt vor dir sind, die Dinge, nach denen du dich gesehnt hast, seit du ein kleiner Junge warst! Keiner dieser Menschen kann das! Sieh sie dir nur an!«
Ich war laut geworden, aber in ihrer iPad-Isolation nahmen die meisten Leute um uns herum das gar nicht wahr. Adam schnappte sich sein Handy wieder zurück, sagte mir (nicht ganz zu Unrecht), dass ich mich wie ein Freak aufführe, und stapfte davon, vorbei an Elvis’ Grab und hinaus in die Morgenstunden von Memphis.
Ich verbrachte Stunden damit, lustlos zwischen Elvis’ zahlreichen Rolls Royce-Limousinen umherzulaufen, die im angrenzenden Museum ausgestellt sind, und entdeckte Adam irgendwann, als es bereits dunkel wurde, im Heartbreak Hotel auf der anderen Straßenseite wieder, wo wir untergebracht waren. Er saß neben dem Swimmingpool, der wie eine riesige Gitarre geformt ist, ein Elvis-Medley lief in einer Endlosschleife. Und Adam saß nur da und sah traurig aus. Als ich mich zu ihm setzte, wurde mir klar, dass meine Wut auf ihn, die sich während der gesamten Reise aufgestaut hatte, in Wirklichkeit eine Wut auf mich selbst war, eine brodelnde Wut, die kurz vorm Explodieren stand. Seine Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, seine ständige Ablenkung, die Unfähigkeit der Menschen in Graceland, den Ort zu sehen, zu dem sie gereist waren, war etwas, das ich in mir selbst aufsteigen fühlte. Ich zerbrach, so wie sie zerbrochen waren. Auch ich verlor meine Fähigkeit, präsent zu sein. Und ich hasste es.
»Ich weiß, dass etwas nicht stimmt«, sagte Adam leise zu mir und hielt sein Handy fest in der Hand. »Aber ich habe keine Ahnung, wie ich es in Ordnung bringen kann.« Dann schrieb er wieder irgendeine Nachricht.
Ich war mit Adam weggefahren, um unserer Unfähigkeit, uns zu konzentrieren, zu entkommen – und ich musste feststellen, dass es kein Entkommen gab, denn dieses Problem war überall. Für die Recherche zu diesem Buch reiste ich um die ganze Welt, doch das Problem verfolgte mich überall hin. Selbst als ich mir eine Auszeit von meinen Recherchen nahm, um einige der berühmtesten und ruhigsten Orte der Welt zu besuchen, lauerte es mir auf.
Eines Nachmittags saß ich in der Blauen Lagune auf Island, einem riesigen und unendlich ruhigen See mit geothermalem Wasser, das die Temperatur einer heißen Badewanne hat, während um mich herum Schnee fiel. Als ich die herunterfallenden Schneeflocken beobachtete, die sich sanft im aufsteigenden Dampf auflösten, wurde mir klar, dass ich von Menschen umgeben war, die Selfie-Sticks in der Hand hielten. Sie hatten ihre Handys in wasserdichte Hüllen gesteckt und posierten und posteten wie wild. Einige von ihnen übertrugen das Ganze per Livestream auf Instagram. Ich fragte mich, ob das Motto für unsere Zeit lauten sollte: Ich habe versucht zu leben, aber ich wurde abgelenkt. Dieser Gedanke wurde von einem muskelbepackten Deutschen unterbrochen, der wie ein Influencer aussah und in sein Fotohandy brüllte: »Ich bin hier in der Blauen Lagune und lebe mein bestes Leben!«
Ein anderes Mal schaute ich mir die Mona Lisa in Paris an, nur um festzustellen, dass sie jetzt permanent hinter einem Gedränge von Menschen aus allen Teilen der Welt versteckt ist, die sich alle nach vorne drängeln, nur um ihr dann sofort den Rücken zuzuwenden, ein Selfie von sich selbst vor dem Gemälde zu knipsen und sich wieder nach draußen zu kämpfen. An dem Tag, an dem ich dort war, beobachtete ich die Menge mehr als eine Stunde lang von der Seite. Niemand – keine einzige Person – betrachtete die Mona Lisa länger als ein paar Sekunden. Ihr Lächeln scheint nicht mehr rätselhaft zu sein. Es kommt mir so vor, als ob sie uns von ihrem Sitzplatz im Italien des 16. Jahrhunderts aus anschaut und uns fragt: »Warum seht ihr mich nicht einfach so an, wie ihr es früher getan habt?«
Das passte ganz gut zu einem viel umfassenderen Gefühl, das sich seit einigen Jahren in mir festgesetzt hatte und das weit über schlechte touristische Gewohnheiten hinausging. Es fühlte sich an, als wäre unsere Zivilisation mit Juckpulver bestäubt worden, sodass wir unsere Zeit damit verbrachten, mit dem Kopf hin und her zu rucken und zu zucken, unfähig, uns einfach den Dingen zu widmen, die wichtig sind. Aktivitäten, die eine längere Konzentration erfordern – wie das Lesen eines Buchs – sind seit Jahren auf dem Rückzug. Nach meiner Reise mit Adam las ich die Arbeit des weltweit führenden Wissenschaftlers auf dem Gebiet der Willenskraft, eines Mannes namens Professor Roy Baumeister, der an der Universität von Queensland in Australien tätig ist, und führte ein Interview mit ihm. Er befasst sich seit mehr als dreißig Jahren mit der Wissenschaft der Willenskraft und der Selbstdisziplin und ist für einige der berühmtesten Experimente verantwortlich, die jemals in den Sozialwissenschaften durchgeführt wurden. Als ich dem 66-Jährigen gegenübersaß, erklärte ich ihm, dass ich vorhabe, ein Buch darüber zu schreiben, warum wir anscheinend unsere Konzentrationsfähigkeit verloren haben und wie wir sie zurückgewinnen können. Ich blickte ihn hoffnungsvoll an.
Es sei merkwürdig, sagte er, dass ich dieses Thema ausgerechnet bei ihm anspreche. »Ich habe das Gefühl, dass ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr so gut kontrollieren kann wie früher«, erklärte er. »Früher konnte ich stundenlang irgendwo sitzen, lesen und schreiben, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass meine Gedanken viel mehr hin und her springen.« Er erklärte, dass er in letzter Zeit gemerkt habe, »dass ich Videospiele auf meinem Handy spiele, wenn ich mich schlecht fühle, und mir das dann Spaß macht.« Ich stellte mir vor, wie er sich von seiner enormen wissenschaftlichen Leistung abwandte, um Candy Crush Saga zu spielen. Er fuhr fort: »Ich merke, dass ich die Konzentration nicht mehr so aufrechterhalten kann, wie ich es früher vielleicht getan habe.« Und er fügte hinzu: »Ich gebe einfach irgendwie nach und fühle mich dann schlecht.«
Roy Baumeister ist der Autor eines Buchs mit dem Titel Die Macht der Disziplin: Wie wir unseren Willen trainieren können, und er hat dieses Thema mehr als jeder andere auf der Welt erforscht. Ich dachte mir – wenn sogar dieser Mann einen Teil seiner Konzentrationsfähigkeit verliert, passiert das dann nicht allen anderen auch?
Ich beruhigte mich lange Zeit damit, dass diese Krise in Wirklichkeit nur eine Illusion sei. Auch frühere Generationen hatten das Gefühl, dass ihre Aufmerksamkeit und ihre Konzentration schlechter wurden – man kann nachlesen, dass mittelalterliche Mönche vor fast einem Jahrtausend darüber klagten, dass sie unter Aufmerksamkeitsproblemen litten. Je älter die Menschen werden, desto weniger können sie sich konzentrieren, daher kommen sie zu der Überzeugung, dass dies ein Problem der Welt und der nächsten Generation ist und nicht ein Problem ihres eigenen nachlassenden Verstandes.
Man hätte dies erforschen können, wenn Wissenschaftler schon vor Jahren etwas ganz Einfaches getan hätten. Sie hätten zufällig ausgewählten Personen Aufmerksamkeitstests geben und denselben Test über Jahre und Jahrzehnte hinweg durchführen können, um etwaige Veränderungen zu beobachten. Aber niemand hat das getan. Diese Langzeitdaten wurden nie gesammelt. Es gibt jedoch noch einen anderen Weg, wie wir meiner Meinung nach zu einer verlässlichen Schlussfolgerung kommen können. Bei meinen Recherchen zu diesem Buch habe ich erfahren, dass es alle möglichen Faktoren gibt, die wissenschaftlich erwiesen die Konzentrationsfähigkeit der Menschen beeinträchtigen. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass viele dieser Faktoren in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben – teilweise dramatisch. Dagegen konnte ich nur eine einzige Ausnahme finden, die unsere Aufmerksamkeit verbessert haben könnte. Deshalb bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um eine echte Krise handelt, und zwar um eine dringende Krise.
Ich habe außerdem festgestellt, dass die Beweise dafür, wohin uns diese Entwicklungen führen, eindeutig sind. In einer kleinen Studie wurde beispielsweise untersucht, wie oft ein durchschnittlicher amerikanischer College-Student seine Aufmerksamkeit auf irgendetwas richtet. Die beteiligten Wissenschaftler installierten eine Tracking-Software auf den Computern der Studenten und überwachten, was diese an einem typischen Tag taten. Sie fanden heraus, dass ein Student im Durchschnitt alle 65 Sekunden die Aufgabe wechselte. Die durchschnittliche Zeit, die Studenten sich auf eine Sache konzentrierten, betrug nur 19 Sekunden. Wenn Sie als Erwachsener nun versucht sind, sich überlegen zu fühlen, halten Sie sich zurück. In einer anderen Studie von Gloria Mark, Professorin für Informatik an der Universität von Kalifornien in Irvine, die ich interviewt habe, wurde nämlich untersucht, wie lange ein Erwachsener, der in einem Büro arbeitet, im Durchschnitt an einer Aufgabe dranbleibt. Es waren drei Minuten.
Also habe ich mich auf eine 30.000 Meilen lange Reise begeben, um herauszufinden, wie wir unsere Konzentration und Aufmerksamkeit zurückgewinnen können. In Dänemark habe ich den ersten Wissenschaftler interviewt, der mit seinem Team nachgewiesen hat, dass die Konzentrationsfähigkeit in unserer Gesellschaft tatsächlich rapide abnimmt. Anschließend habe ich mich mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt getroffen, die herausgefunden haben, warum das so ist. Am Ende hatte ich über 250 Experten befragt – von Miami bis Moskau, von Montreal bis Melbourne. Meine Suche nach Antworten führte mich an die unterschiedlichsten Orte, von einer Favela in Rio de Janeiro, wo die Aufmerksamkeit auf besonders katastrophale Weise nachgelassen hatte, bis zu einem abgelegenen Büro in einer kleinen Stadt in Neuseeland, wo man einen Weg gefunden hatte, die Konzentration grundlegend wiederherzustellen.
Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass wir zutiefst missverstanden haben, was eigentlich mit unserer Aufmerksamkeit geschieht. Über Jahre hinweg gab ich mir selbst die Schuld, wenn ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich sagte mir dann: Du bist faul, du bist undiszipliniert, du musst dich zusammenreißen. Oder ich schob die Schuld auf mein Telefon, verfluchte es und wünschte, es wäre nie erfunden worden. Die meisten Menschen, die ich kenne, reagieren auf die gleiche Weise. Aber ich habe gelernt, dass hier etwas viel Tieferes passiert als persönliches Versagen oder eine einzelne neue Erfindung.
Eine erste Ahnung davon bekam ich, als ich nach Portland, Oregon, fuhr, um Professor Joel Nigg zu interviewen, einen der weltweit führenden Experten für die Aufmerksamkeitsprobleme von Kindern. Er teilte mir mit, dass es mir beim Verständnis der Entwicklung helfen könnte, die zunehmenden Aufmerksamkeitsprobleme mit den steigenden Fettleibigkeitsraten zu vergleichen. Vor fünfzig Jahren gab es nur sehr wenig Fettleibigkeit, heute jedoch ist sie in der westlichen Welt endemisch. Das liegt nicht daran, dass wir plötzlich gierig oder zügellos geworden sind. Er sagte: »Fettleibigkeit ist keine medizinische Epidemie, sondern eine soziale Epidemie. Dass die Menschen zu dick werden, liegt unter anderem an unserer schlechten Ernährung.« Die Art und Weise, wie wir leben, hat sich dramatisch verändert – unsere Lebensmittelversorgung hat sich geändert, und wir haben Städte gebaut, in denen man sich nur schwer zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegen kann. Und diese Veränderungen in unserer Umwelt haben zu Veränderungen in unseren Körpern geführt. Ähnlich verhält es sich seiner Meinung nach mit den Veränderungen bei unserer Aufmerksamkeit und Konzentration.
Professor Nigg erläuterte, dass er nach jahrzehntelanger Erforschung dieses Themas der Meinung sei, dass wir uns fragen müssen, ob wir gerade eine »pathogene Aufmerksamkeitskultur« entwickeln – ein Umfeld, in dem es für uns alle extrem schwierig ist, uns dauerhaft und tief zu konzentrieren, und in dem wir immer gegen den Strom schwimmen müssen, um dies zu erreichen. Es gebe wissenschaftliche Beweise für viele Faktoren, die zu einer schlechten Aufmerksamkeit führen, sagte er, und bei manchen Menschen lägen die Ursachen in ihrer Natur. Auf der anderen Seite, meinte er, müssten wir uns auch die Frage stellen: »Treibt unsere Gesellschaft die Menschen so oft an diesen Punkt, weil wir eine Epidemie haben, die durch dysfunktionale Faktoren in unserer Gesellschaft verursacht wird?«
Später fragte ich ihn: »Wenn ich Ihnen die Verantwortung für die Welt übertragen würde und Sie die Konzentrationsfähigkeit der Menschen zerstören wollten, was würden Sie tun?« Er dachte einen Moment darüber nach und sagte dann: »Wahrscheinlich genau das, was unsere Gesellschaft tut.«
Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass unsere nachlassende Konzentrationsfähigkeit nicht in erster Linie ein persönliches Versagen meinerseits oder Ihrerseits oder seitens Ihres Kindes ist. Das wird vielmehr mit uns gemacht, und zwar von sehr mächtigen Kräften. Zu diesen Kräften gehören die Big Tech-Unternehmen, aber sie gehen auch weit darüber hinaus. Es handelt sich um ein systemisches Problem. Die Wahrheit ist, dass wir in einem System leben, das jeden Tag Säure auf unsere Aufmerksamkeit schüttet, und dann wird uns gesagt, dass wir uns selbst die Schuld geben und an unseren eigenen Gewohnheiten feilen sollen, während die Aufmerksamkeit der Welt verbrennt. Als ich das alles erfuhr, wurde mir klar, dass es eine Lücke in all den Büchern gibt, die ich darüber gelesen hatte, wie man seine Aufmerksamkeit verbessern kann. Sie war riesig. Es wurde weitgehend versäumt, über die eigentlichen Ursachen unserer Aufmerksamkeitskrise zu sprechen – die hauptsächlich in diesen größeren Kräften liegen. Auf der Grundlage dessen, was ich gelernt habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass zwölf tiefgreifende Kräfte am Werk sind, die unserer Aufmerksamkeit schaden. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass wir dieses Problem nur dann langfristig lösen können, wenn wir sie verstehen – und dann gemeinsam verhindern, dass sie weiterhin ihre Wirkung auf uns ausüben.
Jeder kann als Einzelperson konkrete Schritte unternehmen, um dieses Problem für sich selbst zu verringern, und in diesem Buch erfahren Sie, wie Sie sie durchführen können. Ich bin sehr dafür, dass Sie auf diese Weise Ihre persönliche Verantwortung wahrnehmen. Aber ich muss ehrlich zu Ihnen sein, auf eine Art und Weise, wie es frühere Bücher zu diesem Thema möglicherweise leider nicht waren: Diese Veränderungen werden Sie nur bedingt weiterbringen. Sie werden nur einen Teil des Problems lösen. Doch sie sind wertvoll. Ich führe sie selbst auch durch. Aber wenn Sie nicht sehr viel Glück haben, werden sie trotz dieser Veränderungen der Aufmerksamkeitskrise nicht entkommen. Systemische Probleme erfordern systemische Lösungen. Wir müssen die individuelle Verantwortung für dieses Problem übernehmen, das ist klar, aber gleichzeitig müssen wir gemeinsam die kollektive Verantwortung für die Bewältigung dieser tieferen Faktoren übernehmen. Es gibt eine echte Lösung – eine, die es uns tatsächlich ermöglichen wird, mit der Heilung unserer Aufmerksamkeit zu beginnen. Sie verlangt von uns, das Problem radikal neu zu betrachten und dann zu handeln. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie wir damit beginnen können.
Es gibt meines Erachtens drei entscheidende Gründe, warum es sich lohnt, mit mir auf diese Reise zu gehen. Der erste ist, dass ein Leben voller Ablenkungen auf persönlicher Ebene eine Beeinträchtigung darstellt. Wenn man nicht in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, kann man die Dinge, die man erreichen möchte, nicht erreichen. Man möchte ein Buch lesen, wird aber von den Pings und Verrücktheiten der sozialen Medien abgelenkt. Man möchte ein paar ungestörte Stunden mit seinem Kind verbringen, aber man schaut immer wieder ängstlich in seine E-Mails, um zu sehen, ob der Chef gerade eine Nachricht geschickt hat. Man will ein Unternehmen gründen, aber das Leben löst sich stattdessen in einem Wirrwarr von Facebook-Posts auf, die nur Neid und Ängste wecken. Ohne dass wir selbst daran schuld sind, scheint es nie genug Stille zu geben – genug kühlen, klaren Raum –, um innezuhalten und nachzudenken. Wie eine Studie von Professor Michael Posner von der Universität Oregon ergab, dauert es im Durchschnitt 23 Minuten, bis man sich wieder genau so fokussiert wie zuvor auf eine Sache konzentrieren kann, wenn man unterbrochen wurde. Eine andere Studie über Büroangestellte in den USA zeigte, dass die meisten von ihnen an einem normalen Tag nie auch nur eine Stunde ununterbrochen arbeiten können. Wenn sich dies über Monate und Jahre hinzieht, verliert man die Fähigkeit, herauszufinden, wer man ist und was man will. Man verliert sich in seinem eigenen Leben.
Als ich nach Moskau reiste, um den weltweit bedeutendsten Philosophen der Aufmerksamkeitsproblematik zu interviewen, Dr. James Williams, der an der Universität Oxford über die Philosophie und Ethik der Technologie arbeitet, meinte er: »Wenn wir in irgendeinem Bereich – in jedem Lebenskontext – das tun wollen, worauf es ankommt, müssen wir in der Lage sein, den richtigen Dingen Aufmerksamkeit zu schenken ... Wenn wir das nicht können, ist es wirklich schwer, irgendetwas zu tun.« Er sagte, wenn wir die Situation, in der wir uns gerade befinden, verstehen wollen, hilft es, sich etwas vorzustellen. Stellen Sie sich vor, Sie fahren ein Auto, aber jemand hat einen großen Eimer Schlamm über die Windschutzscheibe geschüttet. In diesem Moment werden Sie mit vielen Problemen konfrontiert – Sie laufen Gefahr, Ihren Rückspiegel abzubrechen, sich zu verfahren oder zu spät an Ihrem Ziel anzukommen. Doch bevor Sie sich über diese Probleme Gedanken machen, müssen Sie zuerst Ihre Windschutzscheibe reinigen. Solange Sie das nicht getan haben, wissen Sie nicht einmal, wo Sie sind. Wir müssen uns mit unseren Aufmerksamkeitsproblemen befassen, bevor wir versuchen, irgendein anderes längerfristiges Ziel zu erreichen.
Der zweite Grund, warum wir über dieses Thema nachdenken müssen, ist, dass diese Zersplitterung der Aufmerksamkeit nicht nur uns als Individuen Probleme bereitet, sondern unsere gesamte Gesellschaft in eine Krise stürzt. Als Spezies stehen wir vor einer Reihe von noch nie dagewesenen Hindernissen und Fallstricken – wie der Klimakrise –, und im Gegensatz zu früheren Generationen machen wir uns meist nicht daran, unsere größten Herausforderungen zu lösen. Und warum? Ich denke, dass dies zum Teil daran liegt, dass bei nachlassender Aufmerksamkeit auch die Problemlösungskompetenz nachlässt. Die Lösung großer Probleme erfordert eine anhaltende Aufmerksamkeit von vielen Menschen über viele Jahre hinweg. Demokratie erfordert die Fähigkeit einer Bevölkerung, lange genug zuzuhören, um echte Probleme zu erkennen, sie von Hirngespinsten zu unterscheiden, Lösungen zu finden und ihre politischen Entscheidungsträger zur Verantwortung zu ziehen, wenn sie diese nicht liefern. Wenn wir das nicht mehr schaffen, verlieren wir unsere Fähigkeit, eine voll funktionierende Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass diese Aufmerksamkeitskrise zur gleichen Zeit stattfindet wie die schlimmste Krise der Demokratie seit den 1930er-Jahren. Menschen, die sich nicht konzentrieren können, fühlen sich eher zu simplen, autoritären Lösungen hingezogen – und sehen seltener klar, wenn diese scheitern. Eine Welt voller aufmerksamkeitsgestörter Bürger, die abwechselnd auf Twitter und Snapchat surfen, wird eine Welt der sich ständig häufenden Krisen sein, in der wir keine einzige davon in den Griff bekommen.
Der dritte Grund, aus dem wir über Konzentration nachdenken müssen, ist für mich der hoffnungsvollste. Wenn wir verstehen, was geschieht, können wir beginnen, es zu ändern. Der Schriftsteller James Baldwin, der für mich der größte Schriftsteller des 20. Jahrhunderts ist, sagte: »Nicht alles, womit man konfrontiert wird, kann man ändern, aber man kann nichts ändern, solange man nicht damit konfrontiert wird.« Diese Krise ist von Menschen gemacht, und sie kann auch von uns gelöst werden.
Ich möchte Ihnen gleich zu Beginn mitteilen, wie ich die Beweise gesammelt habe, die ich Ihnen in diesem Buch vorstellen werde, und warum ich sie ausgewählt habe. Bei meinen Nachforschungen habe ich eine große Anzahl wissenschaftlicher Studien gelesen und dann die Wissenschaftler befragt, die meiner Meinung nach die wichtigsten Erkenntnisse gesammelt hatten. Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen haben sich mit Aufmerksamkeit und Konzentration beschäftigt. Eine Gruppe sind die Neurowissenschaftler, von denen Sie hier natürlich etwas lesen werden. Die Wissenschaftler, die sich am intensivsten mit der Frage beschäftigt haben, warum sich die Aufmerksamkeit verändert, sind Sozialwissenschaftler, die untersuchen, wie sich Veränderungen in unserer Lebensweise auf uns als Einzelpersonen und als Gruppen auswirken. Ich habe an der Universität Cambridge Sozial- und Politikwissenschaften studiert und bin dort gründlich darin geschult worden, die von diesen Wissenschaftlern veröffentlichten Studien zu lesen, die von ihnen vorgelegten Beweise zu bewerten und – wie ich hoffe – auch entsprechende Rückfragen zu stellen.
Diese Wissenschaftler sind sich oft nicht einig darüber, was passiert und warum es passiert. Das liegt nicht daran, dass die Wissenschaft mangelhaft ist, sondern daran, dass der Mensch äußerst komplex ist und es wirklich schwierig ist, etwas so Kompliziertes wie die Beeinträchtigung unserer Konzentrationsfähigkeit zu messen. Das war beim Schreiben dieses Buchs natürlich eine Herausforderung für mich. Wenn wir auf perfekte Beweise warten, werden wir ewig warten. Ich musste nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der besten Informationen vorgehen, die uns zur Verfügung stehen, wobei ich mir stets bewusst war, dass diese Wissenschaft fehleranfällig und angreifbar ist und mit Sorgfalt behandelt werden muss.
Deshalb habe ich versucht, Ihnen an jeder Stelle dieses Buchs ein Gefühl dafür zu vermitteln, ob und wie umstritten die von mir vorgelegten Erkenntnisse sind. Einige der Themen wurden von Hunderten von Wissenschaftlern untersucht, die sich sehr einig darüber sind, dass die Aussagen, die ich hier darlegen werde, richtig sind. Das ist natürlich das Ideal, und wo immer es möglich war, habe ich nach Wissenschaftlern gesucht, die einen Konsens in ihrem Bereich repräsentieren, und meine Schlussfolgerungen auf den soliden Felsen ihres Wissens gebaut. Es gibt jedoch einige andere Bereiche, in denen sich nur eine Handvoll Wissenschaftler mit der Frage befasst haben, die ich verstehen wollte, sodass die Beweise, auf die ich in diesen Fällen zurückgreifen kann, dünner sind. Hinzu kommen einige andere Themen, bei denen sich verschiedene angesehene Wissenschaftler nicht einig sind, was wirklich vor sich geht. In diesen Fällen werde ich Ihnen dies im Voraus mitteilen und versuchen, unterschiedliche Sichtweisen zu dieser Fragestellung darzustellen. In jeder Phase habe ich versucht, meine Schlussfolgerungen auf die stärksten Beweise zu stützen, die ich finden konnte.
Ich habe immer versucht, diesen Prozess mit Bescheidenheit anzugehen. Ich bin in keiner dieser Fragen ein Experte. Ich bin ein Journalist, der sich an Experten wendet und deren Wissen so gut wie möglich prüft und erklärt. Wenn Sie sich eingehender mit diesen Debatten befassen möchten, finden Sie auf der Webseite zu diesem Buch über 400 Literaturstellen, in denen ich die mehr als 250 wissenschaftlichen Studien näher erläutere, auf die ich mich in diesem Buch gestützt habe. Manchmal habe ich auch meine eigenen Erfahrungen genutzt, um zu erklären, was ich herausgefunden habe. Meine persönlichen Anekdoten sind natürlich keine wissenschaftlichen Beweise. Sie erzählen Ihnen etwas Einfacheres: warum ich die Antworten auf diese Fragen so dringend wissen wollte.
Als ich von der Reise mit Adam nach Memphis zurückkam, war ich entsetzt über mich selbst. Denn ich verbrachte eines Tages drei Stunden damit, immer wieder dieselben ersten Seiten eines Romans zu lesen, wobei ich mich jedes Mal in abschweifenden Gedanken verlor, fast so, als wäre ich bekifft. Das war der Punkt, an dem ich dachte: So kann ich nicht weitermachen. Das Lesen von Belletristik war immer eines meiner größten Vergnügen gewesen, und es zu verlieren, wäre wie der Verlust eines Körperteils. Also verkündete ich meinen Freunden, dass ich etwas Drastisches tun würde.
Ich war der Meinung, dass mir das passierte, weil ich nicht diszipliniert genug war und weil ich von meinem Handy übernommen worden war. Damals dachte ich, die Lösung läge auf der Hand: Sei disziplinierter und schmeiß dein Handy weg. Ich ging online und buchte mir ein kleines Zimmer am Strand in Provincetown, an der Spitze von Cape Cod. Ich würde dort drei Monate lang bleiben, verkündete ich triumphierend, ohne Smartphone und ohne internetfähigen Computer. Ich war fertig. Ich war durch. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren würde ich offline gehen. Ich sprach mit meinen Freunden über die doppelte Bedeutung des englischen Wortes »wired«. Es bedeutet sowohl, dass man sich in einem manischen, überdrehten Zustand befindet, als auch, dass man online ist. Diese beiden Definitionen schienen mir miteinander verbunden zu sein. Ich war es leid, so aufgedreht zu sein. Ich musste meinen Kopf frei bekommen. Und so tat ich es. Ich kündigte. Ich richtete eine automatische Antwort in meiner Mailbox ein, die besagte, dass ich für die nächsten drei Monate nicht erreichbar sein würde. Ich gab das Getöse auf, in dem ich zwanzig Jahre lang vibriert hatte.
Ich versuchte, diesen extremen digitalen Entzug ohne jegliche Illusionen anzugehen. Ich wusste, dass der völlige Verzicht auf das Internet keine langfristige Lösung für mich sein konnte – ich wollte mich ja nicht den Amischen anschließen und für immer auf die Technologie verzichten. Mehr noch, ich wusste, dass dieser Ansatz für die meisten Menschen nicht einmal eine kurzfristige Lösung sein kann. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie – meine Großmutter, die mich aufgezogen hat, hat Toiletten geputzt, mein Vater war Busfahrer. Ihnen zu sagen, dass die Lösung für ihre Aufmerksamkeitsprobleme darin besteht, ihren Job zu kündigen und in einer Hütte am Meer zu leben, wäre absolut unverschämt. Das können sie nämlich gar nicht tun.
Ich habe es getan, weil ich dachte, ich würde andernfalls einige entscheidende Aspekte meiner Fähigkeit zu tiefem Denken verlieren. Ich habe es aus Verzweiflung getan. Und ich habe es getan, weil ich das Gefühl hatte, dass ich, wenn ich eine Zeit lang alles zurückschraube, vielleicht einen Blick auf die Veränderungen werfen könnte, die wir alle auf eine nachhaltigere Weise vornehmen könnten. Dieser drastische digitale Entzug hat mir eine Menge wichtiger Dinge beigebracht – unter anderem, wie Sie sehen werden, die Grenzen des digitalen Entzugs.
Es begann an einem Morgen im Mai, als ich mich auf den Weg nach Provincetown machte, während mich die grellen Bildschirme von Graceland immer noch verfolgten. Ich dachte, das Problem läge in meiner eigenen Ablenkbarkeit und in unserer Technologie, und ich war im Begriff, meine mobilen Geräte wegzugeben – Freiheit, oh Freiheit! – für eine lange, lange Zeit.
Kapitel 1
Ursache 1: Die Zunahme von Geschwindigkeit, der Druck des Umschaltens und Filterns
»Ich verstehe nicht, was Sie wollen«, sagte der Mann bei Target in Boston immer wieder zu mir. »Das sind die billigsten Telefone, die wir haben. Die haben super langsames Internet. Das wollen Sie doch, oder?« »Nein«, erwiderte ich. »Ich will ein Telefon, das überhaupt nicht auf das Internet zugreifen kann.« Er betrachtete die Rückseite der Verpackung und sah verwirrt aus. »Das hier ist wirklich langsam. Sie könnten wahrscheinlich Ihre E-Mails damit abrufen, aber Sie würden nicht ...« »E-Mail ist immer noch das Internet«, warf ich ein. »Ich verreise für drei Monate, um vollkommen offline zu gehen.«
Mein Freund Imtiaz hatte mir bereits seinen alten, kaputten Laptop gegeben, der schon seit Jahren nicht mehr online gehen konnte. Er sah aus, als stamme er vom Set des Original-Star-Trek-Films, ein Überbleibsel aus einer gescheiterten Zukunftsvision. Ich wollte ihn benutzen, hatte ich mir vorgenommen, um endlich den Roman zu schreiben, den ich seit Jahren geplant hatte. Jetzt brauchte ich ein Telefon, mit dem ich in Notfällen von den sechs Personen, denen ich die Nummer geben wollte, angerufen werden konnte. Ich brauchte ein Telefon ohne Internetanschluss, damit ich, wenn ich nachts um 3 Uhr aufwachte und meine Entschlossenheit mich verließ und ich versuchte, online zu gehen, es nicht schaffte, egal, wie sehr ich mich bemühte.
Wenn ich den Leuten erklärte, was ich vorhatte, bekam ich immer eine von drei Antworten. Die erste war genau wie die des Mannes bei Target: Sie konnten anscheinend nicht verstehen, was ich sagte. Sie dachten, ich würde meinen, dass ich meine Internetnutzung einschränken wolle. Die Idee, komplett offline zu gehen, erschien ihnen so bizarr, dass ich sie immer wieder erklären musste. »Sie wollen also ein Telefon, das überhaupt nicht online gehen kann?«, fragte er. »Warum sollten Sie das wollen?«
Die zweite Antwort – die dieser Mann als Nächstes gab – war eine Art leiser Panik in Bezug auf meine Sicherheit. »Was werden Sie in einem Notfall tun?«, fragte er. »Das scheint nicht richtig zu sein.« Ich fragte: »In welchem Notfall muss ich denn online gehen? Was wird denn passieren? Ich bin nicht der Präsident der Vereinigten Staaten – ich muss keine Befehle erteilen, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert.« »Na ja. Halt irgendetwas«, antwortete er. »Es kann ja alles Mögliche passieren.« Ich erklärte den Leuten in meinem Alter – ich war damals 39 – immer wieder, dass wir unser halbes Leben ohne Handy verbracht hatten, sodass es nicht so schwer sein sollte, sich vorzustellen, zu der Lebensweise zurückzukehren, die wir so lange geführt hatten. Niemand schien dies überzeugend zu finden.
Und die dritte Reaktion war Neid. Die Leute fingen an, darüber zu fantasieren, was sie mit all der Zeit, die sie mit ihrem Handy verbrachten, anfangen würden, wenn sie plötzlich frei wären. Sie begannen damit, die Anzahl der Stunden aufzulisten, die sie laut Apple Screen Time täglich mit ihrem Handy verbringen. Beim Durchschnittsamerikaner sind es drei Stunden und fünfzehn Minuten. Wir berühren unsere Handys an einem Tag, in 24 Stunden, 2.617 Mal. Manchmal erwähnten die Leute wehmütig etwas, das sie geliebt und aufgegeben hatten – zum Beispiel Klavierspielen –, und starrten in die Ferne.
Target hatte nichts für mich. Ironischerweise musste ich das offenbar letzte verbliebene Mobiltelefon in den Vereinigten Staaten, das keinen Internetzugang hat, online bestellen. Es heißt Jitterbug. Es ist für sehr alte Menschen gedacht und dient gleichzeitig als medizinisches Notrufgerät. Ich öffnete die Schachtel, lächelte über die riesigen Tasten und sagte mir, dass es einen zusätzlichen Bonus hat: Wenn ich hinfalle, wird es mich automatisch mit dem nächsten Krankenhaus verbinden.
Ich legte alles, was ich mitnehmen wollte, auf dem Hotelbett aus. Vorher war ich alle Routineaufgaben durchgegangen, für die ich normalerweise mein iPhone benutze, und hatte für jede Aufgabe ein Ersatzgerät gekauft. Zum ersten Mal, seit ich ein Teenager war, kaufte ich eine Armbanduhr. Ich kaufte einen Wecker. Ich kramte meinen alten iPod hervor und lud ihn mit Hörbüchern und Podcasts, fuhr mit dem Finger über den Bildschirm und dachte daran, wie futuristisch mir dieses Gerät erschienen war, als ich es vor zwölf Jahren kaufte; jetzt sah es aus wie etwas, das Noah vielleicht auf der Arche dabeihatte. Ich hatte den kaputten Laptop von Imtiaz – der jetzt praktisch zu einem Textverarbeitungsprogramm im Stil der 1990er Jahre umfunktioniert worden war – und daneben einen Stapel klassischer Romane, die ich schon seit Jahrzehnten lesen wollte, wobei Krieg und Frieden ganz oben auf der Liste stand.
Ich nahm ein Uber, um zu einer Freundin zu fahren, die in Boston lebte, und bei ihr mein iPhone und mein MacBook abzugeben. Ich zögerte, bevor ich die Geräte auf ihren Tisch legte. Schnell drückte ich eine Taste auf meinem Handy, um ein Uber zu rufen, das mich zum Fährterminal bringen sollte, und dann schaltete ich es aus und ging zügig davon weg, als ob es mir hinterherrennen würde. Ich spürte einen Anflug von Panik. Ich bin nicht bereit dafür, dachte ich. Dann erinnerte ich mich irgendwo im Hinterkopf an etwas, das der spanische Schriftsteller José Ortega y Gasset einmal gesagt hatte: »Wir können das Leben nicht aufschieben, bis wir bereit sind ... Das Leben wird direkt auf uns abgefeuert.« Wenn du es jetzt nicht tust, sagte ich mir, wirst du es nie tun, und du wirst dann irgendwann auf deinem Sterbebett liegen und nachsehen, wie viele Likes du auf Instagram bekommen hast. Ich stieg ins Auto und weigerte mich, noch einmal zurückzuschauen.
Jahre zuvor hatte ich von Sozialwissenschaftlern gelernt, dass eines der wirksamsten Werkzeuge, die wir zur Überwindung jeglicher Art von destruktiven Gewohnheiten haben, präventive Selbstverpflichtung (Precommitment) heißt. Es kommt in einer der ältesten überlieferten Geschichten der Menschheit vor, in Homers Odyssee. Homer erzählt, dass es einst eine Stelle im Meer gab, an der immer wieder Seeleute umkamen, und zwar aus einem seltsamen Grund: Im Meer lebten zwei Sirenen – eine einzigartige Mischung aus Frau und Fisch –, die die Seeleute anlockten und aufforderten, mit ihnen ins Meer zu gehen. Wenn sie dann ins Wasser stiegen, um ein wenig mit den Meerjungfrauen rumzumachen, ertranken die Seeleute. Doch eines Tages fand der Held der Geschichte – Odysseus – heraus, wie er diese Verführerinnen besiegen konnte. Bevor sich das Schiff dem Meeresabschnitt der Sirenen näherte, ließ er sich von seinen Besatzungsmitgliedern mit Händen und Füßen fest an den Mast binden. Er konnte sich nicht bewegen. Als er die Sirenen hörte, konnte Odysseus nicht ins Wasser springen, egal, wie sehr er sich danach sehnte.
Ich hatte diese Technik schon einmal angewandt, als ich versucht hatte, abzunehmen. Ich habe früher Unmengen von kohlenhydratreichen Lebensmitteln gekauft und mir eingeredet, dass ich stark genug sein würde, sie langsam und in Maßen zu essen, aber dann habe ich sie um 2 Uhr morgens verschlungen. Also kaufte ich sie nicht mehr. Weil ich wusste, dass ich mich um 2 Uhr nachts nicht mehr in einen Laden schleppen würde, um eine Dose Pringles zu kaufen. Das Ich, das in der Gegenwart – genau jetzt – existiert, möchte seine tieferen Ziele verfolgen und ein besserer Mensch sein. Aber Sie wissen, dass Sie fehlbar sind und angesichts der Versuchung wahrscheinlich einknicken werden. Also verpflichten Sie die zukünftige Version Ihrer selbst. Sie schränken Ihre Wahlmöglichkeiten ein. Sie binden sich selbst an den Mast.
Es gibt einige wenige wissenschaftliche Experimente, in denen untersucht wurde, ob dies zumindest kurzfristig wirklich funktioniert. Beispielsweise führte die Psychologieprofessorin Molly Crockett, die ich in Yale interviewt habe, im Jahr 2013 ein Experiment mit Männern durch, die sie in zwei Gruppen einteilte. Jeder von ihnen sollte sich einer Herausforderung stellen. Den Männern wurde gesagt, dass sie sofort ein leicht erotisches Bild sehen könnten, wenn sie wollten, aber wenn sie in der Lage wären, zu warten und eine Weile nichts zu tun, würden sie ein super erotisches Bild zu sehen bekommen. Der ersten Gruppe wurde gesagt, sie solle ihre Willenskraft einsetzen und sich in diesem Moment disziplinieren. Der zweiten Gruppe wurde jedoch die Möglichkeit gegeben, sich vor dem Betreten des Labors zu verpflichten, also laut zu beschließen, dass sie warten würden, um das erotischere Bild sehen zu können. Die Wissenschaftler wollten herausfinden, ob die Männer, die eine Selbstverpflichtung eingingen, häufiger und länger aushielten als die Männer, die dies nicht taten. Es stellte sich heraus, dass die Selbstverpflichtung erstaunlich erfolgreich war – wenn sie sich klar zu etwas entschlossen und versprachen, sich daran zu halten, hielten die Männer deutlich besser durch. In den folgenden Jahren haben Wissenschaftler in einer Vielzahl von Experimenten denselben Effekt nachgewiesen.
Meine Reise nach Provincetown war eine extreme Form der Selbstverpflichtung, und wie der Sieg des Odysseus begann auch sie auf einem Boot. Als die Fähre nach Provincetown auslief, blickte ich zurück auf den Hafen von Boston, wo sich die Mai-Sonne auf dem Wasser spiegelte. Ich stellte mich ans Heck des Schiffes, neben ein nasses und flatterndes Sternenbanner, und beobachtete die Gischt des Ozeans, die hinter uns aufsprühte. Nach etwa 40 Minuten tauchte Provincetown langsam am Horizont auf, und ich erblickte die dünne Spitze des Pilgrim Monuments.
Provincetown ist ein langgezogener, üppig bewachsener Sandstreifen, an dem die Vereinigten Staaten in den Atlantik ragen. Es ist die letzte Station auf dem amerikanischen Kontinent, das Ende des Landes. Wenn man dort steht, so der Schriftsteller Henry David Thoreau, kann man die gesamten Vereinigten Staaten im Rücken spüren. Ich empfand ein schwindelerregendes Gefühl der Leichtigkeit, und als der Strand durch die Gischt auftauchte, begann ich zu lachen, obwohl ich nicht wusste, warum. Ich war fast betrunken vor Erschöpfung. Ich war 39, und seit meinem 21. Lebensjahr hatte ich ununterbrochen gearbeitet. Ich hatte fast keinen Urlaub genommen. Ich hatte mich jede wache Stunde mit Informationen vollgestopft, um ein produktiverer Journalist zu werden, und ich hatte angefangen zu glauben, dass meine Lebensweise ein wenig dem Prozess ähnelte, bei dem eine Gans in einer Massentierhaltung zwangsgefüttert wird, damit ihre Leber zu Pastete verarbeitet werden kann. In den vergangenen fünf Jahren war ich über 80.000 Meilen gereist, um zu recherchieren, zu schreiben und für zwei Bücher Gespräche zu führen. Jeden Tag versuchte ich, noch mehr Informationen aufzusaugen, noch mehr Leute zu interviewen, noch mehr zu lernen, noch mehr zu reden, und mittlerweile sprang ich manisch zwischen den Themen hin und her, wie eine Schallplatte, die durch Überbeanspruchung zerkratzt ist, und es fiel mir schwer, etwas zu behalten. Ich war schon so lange müde, dass es mir zur Gewohnheit geworden war, die Müdigkeit einfach zu übergehen.
Als die Leute begannen, von Bord zu gehen, hörte ich irgendwo auf der Fähre das Klingeln einer eingehenden Textnachricht und griff instinktiv nach meiner Tasche. Ich geriet in Panik – wo ist mein Handy? –, und dann erinnerte ich mich und lachte noch mehr.
In diesem Moment musste ich daran denken, wie ich zum ersten Mal ein Mobiltelefon gesehen hatte. Ich war ungefähr 14 oder 15 Jahre alt – es war also 1993 oder 1994 – und befand mich auf dem Heimweg von der Schule im Oberdeck des Busses 340 in London. Ein Mann im Anzug sprach laut in ein Objekt, das in meiner Erinnerung die Größe einer kleinen Kuh hatte. Wir alle auf dem Oberdeck drehten uns um und sahen ihn an. Es schien ihm zu gefallen, dass wir ihn ansahen, und er redete noch lauter. Das ging eine Weile so, bis ein anderer Passagier zu ihm sagte: »Kumpel?« »Ja?« »Du bist ein Wichser.« Und die Leute im Bus brachen die Grundregel des öffentlichen Nahverkehrs in London. Wir sahen uns an und lächelten. Ich erinnere mich, dass diese kleinen Rebellionen in ganz London stattfanden, als die Handys aufkamen. Wir empfanden sie als eine absurde Invasion.
Meine erste E-Mail schickte ich etwa fünf Jahre später ab, als ich zur Universität ging. Ich war 19 Jahre alt. Ich schrieb ein paar Sätze, drückte auf Senden und wartete darauf, etwas zu spüren. Es kam keine Welle der Erregung. Ich fragte mich, warum man so viel Aufhebens um diese neue E-Mail-Sache machte. Wenn Sie mir damals gesagt hätten, dass innerhalb von zwanzig Jahren eine Kombination dieser beiden Technologien, die mir anfangs erst abstoßend, dann gähnend langweilig erschien, mein Leben so sehr beherrschen würde, dass ich ein Boot besteigen und fliehen müsste, hätte ich gedacht, Sie hätten den Verstand verloren.
Ich schleppte meine Tasche von Bord und holte die Karte heraus, die ich aus dem Internet ausgedruckt hatte. Seit Jahren hatte ich mich nirgendwo mehr ohne Google Maps zurechtgefunden, aber zum Glück besteht Provincetown aus einer einzigen langen Straße, sodass es buchstäblich nur zwei Richtungen gibt, die man angeben kann – nach links oder nach rechts. Ich musste nach rechts gehen, zum Büro des Immobilienmaklers, von dem ich meine Strandhaus-Wohnung gemietet hatte. Die Commercial Street führt mitten durch Provincetown, und ich ging an den hübschen Neuengland-Läden vorbei, die Hummer und Sexspielzeug verkaufen (das bekommt man natürlich nicht beides in einem Laden – das ist eine Nische, die selbst Provincetown nicht bedient). Ich erinnerte mich daran, dass ich diesen Ort aus mehreren Gründen ausgewählt hatte. Ein Jahr zuvor war ich für einen Tag aus Boston herübergekommen, um meinen Freund Andrew zu besuchen, der dort jeden Sommer lebt. Provincetown ist eine Mischung aus einem malerischen Cape-Cod-Dorf im alten Neuengland-Stil und einem SM-Schuppen. Lange Zeit war es ein Fischerdorf der Arbeiterklasse, bevölkert von portugiesischen Einwanderern und ihren Kindern. Dann zogen Künstler ein, und es wurde zu einer Bohème-Enklave. Dann wurde es ein beliebtes Ziel für Schwule. Heute leben hier in den alten Fischerhütten Männer, deren Hauptaufgabe darin besteht, sich als Ursula, die Bösewichtin aus Die kleine Meerjungfrau, zu verkleiden und den Touristen, die im Sommer die Stadt bevölkern, Lieder über Cunnilingus vorzusingen.
Ich entschied mich für Provincetown, weil ich es reizvoll, aber nicht kompliziert fand. Ich war (etwas arrogant) der Meinung, dass ich in meinen ersten 24 Stunden dort die wesentliche Dynamik der Stadt verstanden hatte. Ich war entschlossen, einen Ort aufzusuchen, der meine journalistische Neugier nicht zu sehr anregen würde. Hätte ich mich beispielsweise für Bali entschieden, hätte ich sicher bald versucht herauszufinden, wie die balinesische Gesellschaft funktioniert, hätte angefangen, Leute zu interviewen, und wäre ziemlich schnell wieder bei meiner manischen Informationsaufnahme angelangt. Ich wollte ein hübsches, kleines Örtchen, in dem ich mich entspannen konnte, und nichts weiter.
Der Immobilienmakler, Pat, fuhr mich zum Strandhaus. Es lag in unmittelbarer Nähe zum Meer, 40 Minuten Fußweg vom Zentrum von Provincetown entfernt, eigentlich fast in der Nachbarstadt Truro. Es war ein einfaches Holzhaus, das in vier Wohnungen unterteilt war. Meine lag unten links. Ich bat Pat, das Modem zu entfernen – für den Fall, dass ich in einem Anfall von Wahnsinn ein Gerät mit Internetanschluss kaufen würde – und alle Kabelfernsehprogramme abzuschalten. Ich hatte zwei Zimmer. Hinter dem Haus führte ein kurzer Kiesweg zum Meer, das dort auf mich wartete − weit, offen und warm. Pat wünschte mir viel Glück, und ich war allein.
Ich packte meine Bücher aus und begann, sie durchzublättern. Zu dem, das ich in die Hand nahm, fand ich keinen Zugang, also legte ich es beiseite und ging zum Meer. Es war noch früh in der Saison in Provincetown, daher sah ich nur etwa sechs weitere Menschen in beiden Richtungen, die sich über Meilen erstreckte. Da spürte ich plötzlich die Gewissheit – ein solches Gefühl hat man nur wenige Male im Leben –, dass ich absolut das Richtige getan hatte. So lange hatte ich meinen Blick auf Dinge gerichtet, die sehr schnell und sehr vorübergehend waren, wie einen Twitter-Feed. Wenn man seinen Blick auf das Schnelle richtet, fühlt man sich nachdenklich, aufgeregt und droht, weggespült zu werden, wenn man sich nicht bewegt, winkt oder schreit. Jetzt starrte ich auf etwas sehr Altes und sehr Dauerhaftes. Dieser Ozean war schon lange vor dir da, dachte ich, und er wird noch da sein, wenn deine kleinen Sorgen längst vergessen sind. Twitter gibt dir das Gefühl, dass die ganze Welt von dir und deinem kleinen Ego besessen ist – sie liebt dich, sie hasst dich, sie spricht jetzt gerade über dich. Der Ozean gibt dir das Gefühl, dass die Welt dich mit einer weichen, nassen, einladenden Gleichgültigkeit begrüßt. Er wird dir nie widersprechen, egal, wie laut du schreist.
Ich stand eine lange Zeit so da. Es hatte etwas Schockierendes an sich, so still zu sein – nicht zu scrollen, sondern statisch zu sein. Ich versuchte, mich an das letzte Mal zu erinnern, als ich mich so gefühlt hatte. Ich ging mit hochgekrempelten Jeans durch das Meer in Richtung Provincetown. Das Wasser war warm, und meine Füße sanken ein wenig in den Sand ein. Kleine Fische schwammen an meinen blassweißen Beinen vorbei und schwirrten um sie herum. Ich beobachtete Krabben, die sich vor mir in den Sand eingruben. Dann, nach etwa 15 Minuten, sah ich etwas so Seltsames, dass ich es immer wieder anstarrte, und je mehr ich starrte, desto verwirrter wurde ich. Da stand ein Mann auf dem Wasser, mitten auf dem Ozean. Er befand sich weder auf einem Boot noch auf irgendeinem schwimmenden Gerät, soweit ich sehen konnte. Aber er war weit draußen auf dem Meer, und er stand aufrecht und sicher. Ich fragte mich, ob ich in meiner Erschöpfung irgendwie zu halluzinieren begonnen hatte. Ich winkte ihm zu, er winkte zurück, dann wandte er sich ab und stand mit ausgestreckten Handflächen auf dem Wasser. Er stand lange Zeit so da, und ich stand ebenso lange da und beobachtete ihn. Dann begann er auf mich zuzugehen, scheinbar auf dem Meer.
Er sah meinen verwirrten Gesichtsausdruck und erklärte mir, dass die Flut in Provincetown den Strand bedeckt – aber was man nicht sehen kann, ist, dass der Sand unter dem Wasser uneben ist. Unter der Wasseroberfläche gibt es Sandbänke und Inseln mit aufgeworfenem Sand, und wenn man an ihnen entlangläuft, hat man den seltsamen Eindruck, dass man auf Wasser läuft. Im Laufe der Wochen und Monate sah ich diesen Mann oft im Atlantik stehen, die Handflächen nach außen gerichtet, stundenlang still und unbeweglich. Das, so dachte ich mir, ist das Gegenteil von Facebook – ganz still stehen, auf den Ozean hinausschauen und die Handflächen nach außen strecken.
Schließlich kam ich zum Haus meines Freundes Andrew. Einer seiner Hunde lief mir entgegen. Wir schlenderten in die Stadt, um gemeinsam zu Abend zu essen. Andrew hatte sich im Jahr zuvor auf eine lange, stille Klausur begeben – kein Telefon, keine Gespräche –, und er sagte mir, ich solle dieses Gefühl der Glückseligkeit genießen, denn es würde nicht lange anhalten. Wenn man seine Ablenkungen beiseitelegt, so erklärte er, beginnt man zu erkennen, wovon man sich ablenkt. »Oh, Andrew, du bist so eine Drama-Queen«, sagte ich, und wir lachten beide.
Später ging ich die Commercial Street hinunter, vorbei an der Bibliothek, dem Rathaus, dem AIDS-Denkmal, dem Cupcake-Laden und den Dragqueens, die Flyer für ihre Auftritte an diesem Abend verteilten, bis ich Gesang hörte. In einem Pub, dem Crown and Anchor, waren Leute um ein Klavier versammelt und sangen Musical-Lieder. Ich ging hinein. Zusammen mit diesen Fremden sang ich den größten Teil des Soundtracks von Evita und Rent. Mir fiel auf einmal ein großer Unterschied auf – es war etwas ganz anderes, in einer Gruppe von Fremden zu stehen und mit ihnen zu singen, als mit einer Gruppe von Fremden über Bildschirme zu interagieren. Im ersten Fall wird das eigene Ego aufgelöst, im zweiten Fall wird es angegriffen und auf die Schippe genommen. Das letzte Lied, das wir sangen, war A Whole New World.
Um 2 Uhr nachts ging ich allein zum Strandhaus zurück. Dabei dachte ich über den Unterschied zwischen dem glühenden blauen Licht, in das ich so viel Zeit meines Lebens gestarrt hatte und das einen immer wachhält, und dem natürlichen Licht nach, das um mich herum verblasst war und das zu sagen schien: Der Tag ist vorbei, ruh dich aus. Das Strandhaus war leer. Es warteten keine SMS, Sprachnachrichten oder E-Mails auf mich – und wenn doch, würde ich es drei Monate lang nicht erfahren. Ich kletterte ins Bett und fiel in den tiefsten Schlaf, an den ich mich erinnern kann. Erst 15 Stunden später wachte ich auf.
Ich verbrachte eine Woche in diesem schwebenden Zustand, meine Anspannung nach und nach zu verlieren, und fühlte mich fast berauscht von einer Mischung aus Erschöpfung und Stille. Ich saß in Cafés und unterhielt mich mit Fremden. Ich schlenderte durch die Bibliothek von Provincetown und die drei Buchläden der Stadt und suchte mir noch mehr Bücher aus, die ich lesen wollte. Ich aß so viel Hummer, dass ich, sollte diese Spezies jemals ein Bewusstsein entwickeln, als ihre Stalinfigur in die Geschichte eingehen werde, die sie in industriellem Maßstab vernichtet hat. Ich lief den ganzen Weg bis zu der Stelle, an der die Pilgerväter vor 400 Jahren zum ersten Mal amerikanischen Boden betraten. (Sie wanderten umher, fanden vor Ort nicht viel, segelten weiter und landeten auf dem Plymouth Rock.)
Seltsame Dinge begannen in meinem Bewusstsein aufzusteigen. Ich hörte in meinem Kopf immer wieder die Anfangszeilen von Liedern aus meiner Kindheit in den 1980er und 1990er Jahren, an die ich seit Jahren nicht mehr gedacht hatte – Cat Among the Pigeons von Bros oder The Day We Caught the Train von Ocean Colour Scene. Ohne Spotify hatte ich keine Möglichkeit, mir die Lieder in voller Länge anzuhören, also sang ich sie mir vor, während ich am Strand entlanglief. Alle paar Stunden spürte ich ein ungewohntes Gefühl in mir aufsteigen, und ich fragte mich: Was ist das? Ah, ja. Gelassenheit. Aber du hast doch nur zwei Metallklumpen zurückgelassen; warum fühlt sich das so anders an? Es fühlte sich an, als hätte ich jahrelang zwei schreiende, von Koliken geplagte Babys im Arm gehalten, die nun einem Babysitter übergeben worden waren, und deren Schreien und Brechanfälle aus meinem Blickfeld verschwunden waren.