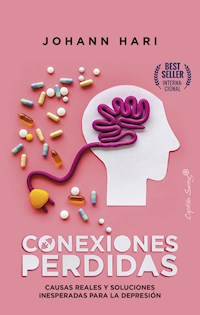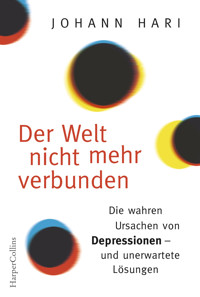9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»Hari vereint präzise Recherche mit einer zutiefst menschlichen Erzählung. Dieses Buch wird eine dringend notwendige Debatte auslösen.« Glenn Greenwald Der Krieg gegen die Drogen gilt inzwischen als gescheitert, der Handel mit Drogen ist ein blühendes Geschäft, alle Maßnahmen gegen den Konsum sind weitgehend erfolglos. Woran liegt das? Der britische Journalist Johann Hari begibt sich auf eine einzigartige Reise – von Brooklyn über Mexiko bis nach Deutschland – und erzählt die Geschichten derjenigen, deren Leben vom immerwährenden Kampf gegen Drogen geprägt ist: von Dealern, Süchtigen, Kartellmitgliedern, den Verlierern und Profiteuren. Mit seiner grandiosen literarischen Reportage schreibt Hari sowohl eine Geschichte des Krieges gegen Drogen als auch ein mitreißendes und streitbares Plädoyer zum Umdenken. »Hervorragender Journalismus, packend erzählt.« Naomi Klein »Phantastisch!« Noam Chomsky
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 739
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Johann Hari
Drogen
Die Geschichte eines langen Krieges
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Josh, Aaron, Ben und Erin
Hinweis: Alle als Zitate gekennzeichneten Beiträge können, sofern sie direkt dem Autor gegenüber geäußert wurden, in Audioform und ganzer Länge auf www.chasingthescream.com gehört werden. So können Sie während der Lektüre die Stimmen aller Menschen hören, die in diesem Buch vorkommen.
Einführung
Fast hundert Jahre nach Beginn des Drogenkrieges war ich auf einem seiner unbedeutenderen Schlachtfelder gestrandet. Kokain trieb im Norden Londons eine meiner nahen Verwandten erneut in eine tiefe Krise, während mein Exfreund gerade mit seiner Ostlondoner Heroinromanze Schluss machte und stattdessen zur Crackpfeife griff. Ich verfolgte beides mit einer gewissen Distanz, nicht zuletzt, weil ich seit Jahren Händevoll dicker weißer Narkolepsie-Pillen schluckte. Dabei bin ich kein Narkoleptiker. Vor Jahren hatte ich nur irgendwo gelesen, man könne mit diesen Pillen wochenlang ohne Pause oder Schlaf schreiben; und es funktionierte – ich stand wie unter Strom.
All das war mir vertraut. In früher Kindheit hatte ich versucht, einen Verwandten aus drogenvernebeltem Schlaf zu wecken, was mir nicht gelang. Seither finde ich Süchtige oder Süchtige auf Entzug seltsam faszinierend – mir ist, als gehörten sie zu meinem Clan, meinem Stamm, meinem Volk. Irgendwann fragte ich mich dann, ob ich nicht selbst zum Junkie geworden war. Meine langen, von Drogen gepuschten Schreibexzesse fanden nur ein Ende, wenn ich vor Erschöpfung zusammenbrach und tagelang nicht wieder wach wurde. Eines Morgens begriff ich, dass ich wie mein Verwandter wirken musste, den ich vor all den Jahren vergebens aufzuwecken versucht hatte.
Von meiner Regierung, meiner Gesellschaft war mir beigebracht worden, wie ich in einer solchen Lage zu reagieren hatte. Nämlich mit einem Krieg. Wir alle kennen das Drehbuch: Es wurde uns so eingeschärft wie die richtige Richtung, in die man zu blicken hat, wenn man die Straße überquert. Behandle Drogenkonsumenten und Süchtige wie Verbrecher! Unterdrücke sie! Mache ihnen ein schlechtes Gewissen! Zwinge sie, mit den Drogen aufzuhören! Das ist die herrschende Meinung in nahezu allen Ländern der Erde. Jahrelang habe ich mich öffentlich dagegen ausgesprochen. Ich schrieb Zeitungsartikel und bemühte mich, bei Fernsehauftritten deutlich zu machen, dass es nur noch schlimmer wird, wenn man Süchtige bestraft und ihnen ein schlechtes Gewissen macht – was zudem eine Menge neuer Probleme für die Gesellschaft nach sich zieht. Ich setzte mich für eine andere Strategie ein: Legalisiert die Drogen schrittweise und verwendet das Geld, das für die Bestrafung von Süchtigen ausgegeben wird, lieber für eine vernünftige, einfühlsame Pflege!
Doch während ich mit drogenvernebeltem Blick die Menschen ansah, die ich liebte, zweifelte etwas in mir daran, dass ich tatsächlich meinte, was ich sagte. Eine autoritäre Stimme in meinem Kopf blaffte: Du bist ein Idiot. Eine Schande. Du bist dumm, wenn du nicht damit aufhörst. Man sollte dich daran hindern, dich bestrafen.
Selbst wenn ich also den Drogenkrieg mit Worten kritisierte, tobte er weiterhin in meinem Kopf. Ich kann nicht behaupten, ich hätte in meiner Entscheidung gewankt – mein Verstand ist immer für die Reform gewesen –, aber der innere Konflikt wollte einfach nicht aufhören.
Jahrelang hatte ich nach einem Ausweg aus diesem Patt gesucht – bis mir eines Morgens ein Gedanke kam: Du und die Menschen, die du liebst, ihr seid nur winzige Farbtupfer auf einer großen Leinwand. Wenn du weitermachst wie bislang – dich allein auf deine eigenen kleinen Tupfer konzentrierst, dieses Jahr wie letztes Jahr und das Jahr zuvor –, wirst du nie mehr als jetzt verstehen. Warum versuchst du nicht, einen Schritt zurückzutreten und einen Blick auf das ganze Bild zu werfen?
Ich notierte mir ein paar Fragen, die mich seit Jahren beschäftigten. Warum hatte der Drogenkrieg angefangen? Und wieso dauerte er noch an? Warum können manche Menschen ohne Probleme Drogen nehmen, andere nicht? Was genau verursacht eigentlich Sucht? Was würde passieren, wenn man sich für eine radikal andere Politik entschiede? Um Antworten darauf zu finden, beschloss ich, mich auf eine Reise an die Fronten des Drogenkrieges zu begeben.
Also warf ich meine letzten Pillen in die Toilette, schloss die Wohnung ab und brach auf. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt nur, dass der Drogenkrieg in den Vereinigten Staaten begonnen hatte, bloß hatte ich damals noch keine Ahnung, wann und wo. Für meine Reise nach New York steckte ich mir eine Liste mit den Namen von Experten auf diesem Gebiet ein. Heute weiß ich, wie gut es war, dass ich kein Rückflugticket buchte, konnte ich doch nicht ahnen, dass mich diese Reise 30000 Meilen weit durch neun Länder führen würde und dass sie drei Jahre dauern sollte.
Unterwegs hörte ich Geschichten, wie ich sie mir zu Beginn kaum hätte ausmalen können, Geschichten von Menschen, die Antworten auf jene Fragen gaben, die mich so lange gequält hatten. Geschichten von einem transsexuellen Crackdealer in Brooklyn, der wissen wollte, wer seine Mutter umgebracht hatte. Von einer Krankenschwester in Ciudad Juárez, die auf der Suche nach ihrer Tochter durch die Wüste lief. Von jemandem, der als Kind während des Holocaust aus dem Ghetto von Budapest geschmuggelt worden war und der die wahren Ursachen für Abhängigkeit und Sucht entdeckte. Von einem Junkie, der in Vancouver eine Revolte anführte. Von einem Serienkiller in einem Käfig in Texas. Von einem portugiesischen Arzt, der sein Land dazu brachte, das Verbot aller Drogen aufzuheben, von Cannabis bis Crack. Von einem Wissenschaftler in Los Angeles, der einem Mungo Drogen gab, nur um zu sehen, was geschehen würde.
All diese Menschen – und viele mehr – waren meine Lehrer. Mich erstaunte, was sie mir beibrachten, denn wie sich zeigte, sind viele unserer grundlegenden Annahmen falsch. Drogen sind nicht, wofür wir sie halten. Abhängigkeit von Drogen bedeutet nicht, was man uns weismacht. Der Drogenkrieg ist nicht das, als was ihn uns die Politiker seit über hundert Jahren verkaufen. Uns erwartet dort draußen eine völlig andere Geschichte, wenn wir nur bereit sind, sie zu hören – eine, die uns große Hoffnung macht.
Teil IMount Rushmore
Kapitel 1Die Schwarze Hand
Während ich vor der Zollabfertigung auf dem New Yorker Flughafen John F. Kennedy in der neonbeleuchteten Warteschlange verschlafener Passagiere stand, versuchte ich mich daran zu erinnern, wann genau der Drogenkrieg begonnen hatte. Hatte man das Schlagwort ›Drogenkrieg‹ oder die Formulierung ›Krieg gegen Drogen‹ zum ersten Mal in den 1970er Jahren unter Richard Nixon gehört? Oder doch erst unter Ronald Reagan in den 1980er Jahren, einer Zeit, in der ›Just Say No‹ wie Amerikas zweite Nationalhymne geklungen hatte?
Als ich in New York begann, Experten der Drogenpolitik zu befragen, wurde mir rasch klar, dass diese Geschichte in Wahrheit viel weiter zurückreicht. Das Gelöbnis, einen »gnadenlosen Krieg« gegen Drogen zu führen, wurde zum ersten Mal bereits in den 1930er Jahren von einem Mann abgelegt, der heute fast vergessen ist – obwohl er stärker als jeder andere Mensch die Drogenwelt prägte, in der wir heute leben. Ich fand heraus, dass die Pennsylvania State University stapelweise Papiere dieses Mannes aufbewahrt – sein Tagebuch, seine Briefe, seine Akten –, also nahm ich den nächsten Greyhound-Bus, um alles von und über Harry Anslinger zu lesen, dessen ich habhaft werden konnte. Und allmählich wurde mir klar, wer er wirklich gewesen war – und was er für uns alle bedeutet.
Die Akten verrieten mir, dass drei Menschen am Beginn des Krieges gegen Drogen standen: Gäbe es ein Mount Rushmore des Drogenverbots, fände man ihre Köpfe in den Gipfel gemeißelt, von dem herab sie uns unbeteiligt und langsam verwitternd anschauten. In vielen Archiven, aber auch bei noch lebenden Zeitzeugen suchte ich Informationen über sie zusammen. Mit ihren Porträts möchte ich diese Geschichte beginnen.
1904 lief ein zwölfjähriger Junge in Altoona im Westen Pennsylvanias durch das Maisfeld zum Haus der Nachbarn, weil er einen Schrei gehört hatte. Der Schrei war aus einem der oberen Zimmer gekommen und hatte so verzweifelt geklungen, so schmerzvoll, dass der Junge völlig verstört reagierte. Was war hier los? Warum schrie eine erwachsene Frau wie ein Tier? Ihr Mann rannte die Treppe hinab und rief dem Jungen zu: Nimm Pferd und Wagen, fahr in die Stadt, so schnell du kannst! Hol eine Bestellung aus der Drogerie ab! Bring sie her! Sofort! Der Junge schlug mit der Peitsche auf das Pferd ein, weil er überzeugt war, die Frau werde sterben, wäre er nicht schnell genug wieder zurück. Kaum hatte er die Tüte mit Medikamenten gebracht, rannte der Farmer zu seiner Frau. Ihr Schreien hörte auf, sie kam wieder zur Ruhe. Der Junge aber würde in dieser Sache keine Ruhe mehr geben – nie wieder.
»Ich konnte diese Schreie nie mehr vergessen«, schrieb er Jahre später. Von diesem Tag an war er überzeugt, dass es Menschen gibt, die vielleicht normal wirken, sich aber schon im nächsten Augenblick »emotional, hysterisch, abartig, bösartig und wie geistig minderbemittelt« aufführen können, falls man zulässt, dass sie Drogen nehmen.
Als Erwachsener griff er auf einige der schlimmsten Ängste der amerikanischen Kultur zurück – die Angst vor rassischen Minderheiten, die Angst vor dem Rausch, die Angst davor, die Beherrschung zu verlieren – und bündelte sie zu einem globalen Krieg, der diese Schreie verstummen lassen sollte. Es wurde ein Krieg, der seinerseits viele Schreie erzeugte. Man kann sie heute in fast allen Städten der Erde hören.
So begann für Harry Anslinger der Krieg gegen Drogen.
An einem anderen Nachmittag, einige Jahre früher, bot sich einem reichen Händler, einem orthodoxen Juden, ein Anblick, den er nicht verstand. Sein dreijähriger Sohn beugte sich über den schlafenden, älteren Bruder, ein Messer stoßbereit in der Hand. »Warum, mein Junge, warum?«, fragte der Händler. Der Kleine antwortete, er hasse seinen Bruder. Er sollte in seinem Leben viele Menschen hassen – eigentlich fast alle. Später bekannte er, dass »die Mehrheit der menschlichen Rasse hirnlose Trottel und Blödmänner mit kümmerlichem Urteilsvermögen sind«. Er versenkte sein Messer in viele Leiber, sobald er ausreichend Macht und Reichtum besaß, um andere Leute die schmutzige Arbeit machen zu lassen. Normalerweise wäre ein Mensch mit seiner Persönlichkeit wohl im Gefängnis geendet, er aber nicht. Ihm öffnete sich ein Betätigungsfeld, auf dem seine Veranlagung zu grausamer Gewalt nicht nur belohnt, sondern auch gebraucht wurde: der neue Markt für illegale Drogen in Nordamerika. Als man ihn schließlich erschoss – ihn trennten 20 Wohnblocks, zahllose Morde und viele Millionen Dollar von seinem Bruder – starb er als freier Mann.
So begann für Arnold Rothstein der Krieg gegen Drogen.
Um 1920 lag an wieder einem anderen Nachmittag ein sechsjähriges Mädchen in einem Bordell in Baltimore auf dem Fußboden und hörte sich Jazzplatten an. Für ihre Mutter war diese Musik Teufelswerk, weshalb die Kleine sie zu Hause nicht hören durfte und sich daraufhin erboten hatte, leichtere Putzarbeiten für die Madam des örtlichen Puffs zu erledigen, wenn auch unter einer Bedingung: Statt eines Nickels, wie ihn andere Kinder bekamen, nahm sie ihre Bezahlung hier auf dem Boden entgegen, verzückte Stunden, in denen sie nur der Musik lauschte. Die verlieh ihr ein Gefühl, das sie nicht beschreiben konnte, aber sie war fest entschlossen, dieses Gefühl eines Tages auch in anderen Menschen zu wecken. Selbst nachdem sie vergewaltigt worden war, als Prostituierte gearbeitet und begonnen hatte, sich gegen Schmerz und Kummer Heroin zu spritzen, sollte diese Musik noch für sie da sein.
So begann für Billie Holiday der Krieg gegen Drogen.
Als Harry Anslinger, Arnold Rothstein und Billie Holiday geboren wurden, konnte man überall auf der Welt problemlos Drogen kaufen. Man ging in irgendeine amerikanische Drogerie und erwarb Mittel, die aus denselben Inhaltsstoffen wie Heroin und Kokain bestanden. Die gebräuchlichsten Hustensäfte in den Vereinigten Staaten enthielten Opiate, ein neuer Softdrink namens Coca-Cola wurde aus derselben Pflanze wie Schnupfkokain hergestellt, und in Großbritannien boten die angesehensten Warenhäuser Heroindöschen für die Damen der feinen Gesellschaft an.
Allerdings lebten sie in einer Zeit, in der die amerikanische Kultur angesichts einer wachsenden Flut von Ängsten in einer Welt, die sich rascher wandelte, als ihre Eltern und Großeltern sich dies hätten vorstellen können, nach einfachen Lösungen suchte – man entschied sich für ein Drogenverbot. 1914 – vor über einem Jahrhundert – wurde beschlossen: Zerstört die Drogen. Fegt sie von der Erde. Befreit euch davon.
Als diese Entscheidung fiel und Harry Anslinger, Arnold Rothstein und Billie Holiday ins Kampfgeschehen verwickelt wurden, waren sie weit über jenes erste Schlachtfeld verteilt.
Billie Holiday stand auf der Bühne, das Haar straff nach hinten gebunden, das runde Gesicht schimmernd im Rampenlicht, die Stimme rau vor Schmerz. Man schrieb das Jahr 1939, als sie an einem Abend jenen Song anstimmte, der Kultstatus erreichen sollte:
Southern trees bear a strange fruit,
Blood on the leaves and blood at the root.
Bis dahin waren schwarze Frauen – mit wenigen Ausnahmen – auf der Bühne nur als grinsende Karikaturen bar aller echten Gefühle geduldet gewesen. Nun aber stand Billie da als Lady Day, eine Schwarze, die von ihrer Trauer und Wut über den Massenmord an ihren Brüdern und Schwestern im Süden sang, deren zerschundene Leichen an den Bäumen hingen.
»Wenn man es recht bedenkt, war es außerordentlich mutig«, erklärte ihr Patenkind Lorraine Feather. Damals handelte »jedes Lied von der Liebe. In Hotels oder sonst wo hörte man einfach keine Songs, in denen Morde oder sonst irgendwelche schändlichen, grausamen Tatsachen beim Namen genannt wurden. Das tat man nicht. Unter keinen Umständen.« Und eine Afroamerikanerin konnte solch ein Lied – über das Lynchen – schon gar nicht singen. Billie Holiday jedoch tat es, weil darin »alles ausgesprochen wurde«, was ihren Vater Clarence im Süden umgebracht hatte. Das Publikum lauschte wie gebannt. Viele Jahre später würde man diesen Moment den »Beginn der Bürgerrechtsbewegung« nennen. Die Behörden verboten Lady Day, dieses Lied weiterhin zu singen. Sie tat es trotzdem.
Die Schikanen durch Harry Anslingers Federal Bureau of Narcotics begannen am nächsten Tag. Schon bald sollte die Behörde eine entscheidende Rolle bei Billie Holidays Ermordung spielen.
Seit seinem ersten Tag im Amt im Jahre 1930 plagte Harry Anslinger ein Problem, das allgemein bekannt war. Man hatte ihn zum Chef der Drogenbehörde ernannt, des Federal Bureau of Narcotics, einer winzigen, tief in den grauen Eingeweiden des Finanzministeriums in Washington, D.C., versteckten Abteilung, die allem Anschein nach bald aufgelöst werden würde. Seine Truppe unterstand dem ehemaligen Department of Prohibition, nur war die Prohibition abgeschafft, weshalb seine Männer eine neue Aufgabe brauchten, und zwar schnell. Wenige Jahre, bevor er Billie Holiday zu verfolgen begann, ließ Anslinger den Blick über seine Mitarbeiter schweifen und sah eine geschlagene Armee, die gerade 14 Jahre lang den Alkohol bekämpft hatte, nur um zu erleben, wie jener gewann – und das im großen Stil. Seine Männer waren berüchtigt dafür, korrupt und gesinnungslos zu sein – und jetzt erwartete man von Anslinger, sie zu einer Truppe zusammenzuschmieden, die Drogen ausrotten sollte.
Das aber war nur ein Hindernis. Viele Drogen, darunter auch Marihuana, waren zu dieser Zeit noch legal. Das Oberste Bundesgericht hatte erst kurz zuvor entschieden, dass alle, die von härteren Drogen abhängig waren, der Obhut von Ärzten und nicht jener von Sperr-sie-weg-Typen wie Anslinger anvertraut werden sollten. Außerdem war Anslingers Budget – beinahe noch ehe er auf seinem Bürostuhl Platz nehmen konnte – um 700000 Dollar gekürzt worden. Was hatte dieses Department, seine Arbeit, da für einen Sinn? Es schien, als würde sein neues Königreich der Drogenprohibition bald nur noch bürokratische Geschichte sein.
Der Stress, diese Abteilung zusammenzuhalten und eine Aufgabe für sich zu finden, würde Anslingers Haar innerhalb weniger Jahre ausfallen lassen, weshalb er bald, so ein Mitglied seines Stabs, wie das Abbild eines in verblassenden Grundfarben dargestellten Ringkämpfers aussehen sollte. Anslinger aber fand: Wer ein schlechtes Blatt ausgeteilt bekommt, muss den Einsatz radikal erhöhen. Er schwor, sämtliche Drogen abzuschaffen, überall – und innerhalb der nächsten 30 Jahre verwandelte er sein sieches Department voll desillusionierter Mitarbeiter in das Hauptquartier für den weltweiten Krieg gegen Drogen. Das gelang ihm, weil er ein bürokratisches Genie war – entscheidender aber war, dass es in der amerikanischen Kultur ein tiefsitzendes Verlangen nach einem Mann wie ihm gab, einem Mann mit festen, eindeutigen Antworten auf alle Fragen hinsichtlich der Drogen.
Seit seinem frühen Erlebnis im Haus der Nachbarn wusste Harry Anslinger, dass er später einmal die Truppe anführen würde, die sämtliche Drogen vom Antlitz der Erde tilgen würde. Niemand aber hatte ihm zugetraut, dass er es unter diesen Startbedingungen auch schaffen könnte, schon gar nicht so schnell. Sein Vater war ein Schweizer Friseur, der aus seiner Heimat in den Bergen geflohen war, weil er nicht zur Armee eingezogen werden wollte. Er ließ sich in Pennsylvania nieder, wo er neun Kinder zeugte. Eine ausreichende Erziehung für seine Kinder konnte er sich nicht leisten, weshalb Harry, sein achtes Kind, mit 14 Jahren von der Schule abgehen und bei der Eisenbahn arbeiten musste. Harry war ein willensstarker Junge und bestand darauf, nur nachmittags und abends zu arbeiten, um weiterhin jeden Morgen zur Schule gehen zu können. Allerdings war es die Arbeit, die ihn am stärksten prägte; während er Eisenbahnschwellen quer durch den Staat Pennsylvania verlegte, erhaschte er einen ersten flüchtigen Blick auf etwas Dunkles und Verborgenes, auf etwas, das seine zweite lebenslange Obsession werden sollte. Zu seinen Aufgaben gehörte es, eine große Gruppe kürzlich eingewanderter Sizilianer zu beaufsichtigen. Harry hielt ihre Gedanken im Stil jener Groschenromane fest, die er über alles liebte. Und manchmal, schrieb er, hörte er sie geheimnisvoll über etwas flüstern, das sie die ›Schwarze Hand‹ nannten. Man redete vor Fremden nicht darüber. Wenn es sich vermeiden ließ, erwähnte man sie nicht einmal im Kreis der Familie. Sie konnte dich mit einem Schlag vernichten. Was aber war die Schwarze Hand? Niemand wollte es ihm verraten. Eines Morgens fand Harry einen Mann aus seinem Trupp – einen Italiener namens Giovanni – blutend in einem Graben liegen. Er hatte mehrere Schüsse abbekommen. Als Giovanni im Krankenhaus aufwachte, saß Harry an seiner Seite, bereit, sich anzuhören, was passiert war, nur hatte der Arbeiter zu viel Angst, um zu reden. Harry verbrachte viele Stunden bei ihm und versicherte ihm immer wieder, dass er für Giovannis Sicherheit und die seiner Familie sorgen werde. Endlich machte Giovanni den Mund auf. Er sagte, man zwinge ihn, Schutzgeld an einen Mann namens Big Mouth Sam zu zahlen, einen Gangster, der zu einer aus Sizilien in die Vereinigten Staaten eingewanderten Bande – der Mafia – gehörte, die sich allein aus italienischen Immigranten rekrutierte. Die Mafia, so Giovanni, habe ihre Finger in allen möglichen Arten von Verbrechen, und die Bahnarbeiter müssten eine ›Terror-Steuer‹ zahlen – entweder gab man der Mafia Geld oder man endete wie er im Krankenhausbett, wenn es nicht noch schlimmer kam. Harry stellte Big Mouth Sam zur Rede – einen »untersetzten, schwarzhaarigen, breitschultrigen« Einwanderer – und sagte: »Wenn Giovanni stirbt, sorge ich dafür, dass man dich hängt. Kapiert?« Big Mouth Sam wollte antworten, aber Harry setzte nach: »Sollte er überleben und du machst ihm oder einem meiner Männer noch mal Ärger oder du versuchst, ihnen Geld abzuknöpfen, bringe ich dich mit meinen eigenen Händen um.«
Danach war Anslinger von der Mafia wie besessen, und das zu einer Zeit, als sich die meisten Amerikaner weigerten, auch nur an ihre Existenz zu glauben. Heute fällt es schwer, sich das vorzustellen, aber die offizielle Ansicht jedes Beamten im Polizeiapparat bis in die 1960er Jahre – von J. Edgar Hoover abwärts – lautete, die Mafia sei das Hirngespinst einer wilden Verschwörungstheorie und ebenso real wie das Monster von Loch Ness. Anslinger aber hatte das Wirken der Mafia hautnah miterlebt und war überzeugt, wenn er der Spur von Big Mouth Sam zu den Ganoven über ihm und weiter bis zu denen ganz oben folgte, würde sich ihm ein riesiges, weitgespanntes Netz offenbaren, vielleicht eine »unsichtbare Weltregierung«, die hinter der Bühne das globale Geschehen kontrollierte. Er fing an, jede noch so kleine Information zu sammeln, die sich über die Mafia auftreiben ließ, selbst wenn die Quelle unbedeutend oder trivial war. Er schnitt Geschichten aus Groschenheften aus und hob sie auf: Eines Tages, sagte er sich, würde er diese Informationen gebrauchen können.
Kaum war der Erste Weltkrieg ausgebrochen, meldete Anslinger sich freiwillig zum Militär, aber er war auf einem Auge blind – sein Bruder hatte ihn viele Jahre zuvor mit einem Stein getroffen – und wurde abgewiesen. Da er jedoch fließend Deutsch sprach, bot man ihm einen Posten als diplomatischer Agent in Europa an. In Hamburg und Den Haag gehörte es zu seinen Aufgaben, den Diplomaten vor Ort Informationen zu entlocken und sich um Amerikaner in Not zu kümmern. Mehrere, wegen Heroinsucht aus der Armee entlassene Matrosen wurden ihm für die Heimfahrt überstellt. Anslinger starrte in ihre knochigen Gesichter und spürte, wie der Hass, den er schon als kleiner Junge empfunden hatte, weiter wuchs. Dies, schwor er sich, musste aufhören.
Gegen Ende des Krieges schickte man ihn auf seine bislang wichtigste Mission: Er sollte dem besiegten deutschen Herrscher eine geheime Nachricht zukommen lassen. Er wurde, so erzählte er die Geschichte später, in die niederländische Kleinstadt Amerongen geschickt, wo sich der Kaiser in einem Schloss aufhielt und seine Abdankung vorbereitete. Anslingers Aufgabe lautete, sich als deutscher Gesandter auszugeben und eine Botschaft des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson zu überbringen: Nicht abdanken! Die Vereinigten Staaten wollten den Kaiser auf dem Thron halten, um drohende »Aufstände, Streiks und chaotische Zustände« zu verhindern, die sein plötzlicher Abgang provozieren könnte. Die niederländischen Wachen am Schlosseingang befahlen Anslinger, sich auszuweisen. »Weist ihr euch lieber selbst aus!«, blaffte er sie wütend auf Deutsch an. Da die Wachen fürchteten, es mit einem Mann des Kaisers zu tun zu haben, ließen sie ihn passieren. Anslinger gelang es, seine Nachricht zu überbringen, aber er kam zu spät. Die Entscheidung war bereits gefallen: Der Kaiser gab auf. Für den Rest seines Lebens sollte Anslinger glauben, man hätte, wäre die Bitte des Präsidenten nur ein wenig früher zum Kaiser durchgedrungen, »einen anständigen Frieden aushandeln können, mit dem verhindert worden wäre, dass einer wie Hitler an die Macht kam und ein Zweiter Weltkrieg ausbrach«. Es war das erste Mal, dass Anslinger glaubte, die Zukunft der Zivilisation hinge von seinem Handeln ab, aber es sollte nicht das letzte Mal sein.
Er reiste durch ein Europa in Ruinen. »Der Anblick einer großen, völlig vernichteten Stadt, in der kein Gebäude mehr steht, weckt nur schwer zu beschreibende Empfindungen«, schrieb er in sein Tagebuch. Zerbombte Brücken waren bloß noch Trümmerhaufen. Fabriken waren entweder völlig zerstört oder aber von sämtlichen Maschinen entkernt, die dann oft achtlos am Straßenrand lagen, so verbogen und nutzlos wie metallene Geister einer vergangenen Zeit. Er sah riesige Bombenkrater und Felder voller Stacheldraht. Was immer man sich auch vorgestellt haben mag, schrieb er, »es ist zwanzigmal schlimmer!« Am meisten schockierten Anslinger aber die Auswirkungen des Krieges auf die Menschen. Sie schienen jedes Gefühl für Anstand und Ordnung verloren zu haben. Halbverhungert zettelten sie Aufstände an; berittene Truppen wurden eingesetzt; ganze Straßenzüge standen in Flammen. Anslinger hielt sich in einer Hotellobby in Berlin auf, als sozialistische Revolutionäre plötzlich mit Maschinenpistolen in die Menge feuerten und das Blut eines unbeteiligten Zuschauers auf seine Hände spritzte. Die Zivilisation, schloss er, war so verletzlich wie die Persönlichkeit der Farmersfrau in Altoona. Sie konnte in die Brüche gehen und zerfallen. Von diesem Tag an war Anslinger bis zum Ende seines Lebens davon überzeugt, dass sich die amerikanische Gesellschaft ebenso rasch auflösen konnte, wie es die europäische getan hatte.
1926 wurde er aus den grauen Ruinen Europas auf die vom blauen Meer umspülten Inseln der Bahamas versetzt, nur war Anslinger kein Mann, der daran dachte, sich zu entspannen. Dies war die Hochphase der Prohibition: Amerikaner wollten Alkohol trinken, Schmuggler wollten ihn verkaufen, also gab es auf den Bahamas Whisky in Überfluss. Anslinger war empört. Die Schmuggler stammten aus der Karibik oder aus Zentralamerika, und er glaubte, sie seien randvoll gespickt mit »widerlichen, schlimmen Krankheiten«, mit denen sie einen ansteckten, wenn man dumm genug war, den Fusel zu trinken, den sie vertrieben. »Gebt mir ein Hochleistungsgewehr und ich halte die Mistkerle auf«, sagte einer von Anslingers Kollegen, und ganz in diesem Sinne kündigte Anslinger seinen Vorgesetzten an, dass es einen Weg gebe, die Prohibition konsequent durchzusetzen: Mit aller Gewalt. Schickt die Marine los, um die Schmuggler entlang der amerikanischen Küsten zu jagen! Verbietet den Verkauf von Alkohol für medizinische Zwecke! Hebt die Gefängnisstrafen für Alkoholschmuggler drastisch an, bis alle hinter Gittern sitzen! Führt den Krieg gegen Schnaps, bis das Zeug nur noch eine vage Erinnerung ist!
In wenigen Jahren schaffte Anslinger den Sprung von einem kompetenten, jedoch frustrierten Prohibitionsagenten zum Leiter eines Departments in Washington, D.C. Und wie? Das lässt sich nicht genau nachvollziehen, doch dürfte ihm geholfen haben, dass er Martha Denniston heiratete, die aus einer der reichsten Familien Amerikas stammte, den Mellons. Finanzminister Andrew Mellon war ein naher Verwandter – und das Department of Prohibition unterstand dem Finanzministerium.
Von dem Moment an, in dem er die Leitung des Departments übernahm, wusste Anslinger um die Schwäche seiner neuen Position. Ein Krieg gegen harte Drogen allein – Kokain und Heroin waren seit 1914 verboten – würde nicht genügen. Diese Drogen wurden nur von einer kleinen Minderheit eingenommen, und kein Department konnte von derart wenigen Krumen gedeihen. Er brauchte mehr.
Mit diesen Gedanken im Hinterkopf begann er, Geschichten aus Zeitungen zu sammeln, die Schlagzeilen wie jene folgende hatten, die am 6. Juli 1927 in der New York Times erschien: MEXIKANISCHE FAMILIE DREHT DURCH. Der Artikel führte aus: »Eine Witwe und ihre vier Kinder verfielen dem Wahn, nachdem sie eine Marihuanapflanze gegessen hatten. Laut Aussagen der Ärzte besteht keine Hoffnung, das Leben der vier Kinder zu retten; die Mutter wird für den Rest ihres Lebens verrückt bleiben.« Ihr hatte es an Geld gefehlt, Lebensmittel kaufen zu können, weshalb sie beschloss, ein paar Marihuanapflanzen zu essen, die in ihrem Garten wuchsen. Bald darauf hörten »Nachbarn irres Gelächter, eilten zum Haus und stellten fest, dass die ganze Familie verrückt geworden war«.
Lange Zeit hatte Anslinger Marihuana bzw. Cannabis nur für ein Ärgernis gehalten, das ihn davon abhielt, die eigentlich wichtigen Drogen zu bekämpfen. Er wusste, dass Cannabis nicht abhängig machte, und erklärte, es sei »sicher bloß ein absurder Irrtum«, zu glauben, Cannabis könne an schweren Vergehen schuld sein. Fast über Nacht aber begann er, die entgegengesetzte Meinung zu vertreten. Warum? Er vermutete, dass die beiden meistgehassten Bevölkerungsgruppen der Vereinigten Staaten – Mexikaner und Afroamerikaner – die Droge viel häufiger als Weiße konsumierten, weshalb er dem Haushaltsausschuss seine albtraumhafte Version einer drohenden Zukunft darlegte. Man habe ihm, führte er aus, von »farbigen Studenten an der University of Minnesota erzählt, die mit weißen Studentinnen Partys feierten und mit ihren Storys über Rassenhass Mitleid zu wecken versuchten. Resultat: Schwangerschaft.« Dies waren die ersten Anzeichen für vieles, was noch kommen sollte.
Er schrieb 30 wissenschaftliche Experten an und stellte ihnen eine Reihe von Fragen zu Marihuana. 29 schrieben zurück, dass es nicht ratsam sei, Marihuana zu verbieten, und dass die Auswirkungen in der Presse meist falsch dargestellt würden. Anslinger entschied, diese 29 Wissenschaftler zu ignorieren und stattdessen jenen einen Experten zu zitieren, der Marihuana für ein großes Übel hielt, das ausgerottet gehörte. Auf dieser Grundlage warnte Anslinger die Öffentlichkeit vor der Wirkung dieses Krautes: Als Erstes verfällt man einem »irren Taumel«, dann packen einen »Träume … erotischer Natur«, anschließend »verliert man jede Fähigkeit für zusammenhängendes Denken«. Und schließlich kommt es zum unausweichlichen Ende, dem »Wahnsinn«. Man könne leicht high werden, losziehen und einen Menschen umbringen, ehe man auch nur begriffen habe, dass man sein Zimmer verlassen hat, sagte er, denn Marihuana »verwandelt den Menschen in ein wildes Tier«. Ja, »falls das grässliche Monster Frankenstein dem Monster Marihuana von Angesicht zu Angesicht gegenüberstünde, würde es vor Angst tot umfallen«.
Der Arzt Michael V. Ball meldete sich bei Anslinger, um seiner Auffassung zu widersprechen, und schrieb, er habe als Medizinstudent Hanfextrakt eingenommen, es habe ihn aber nur schläfrig gemacht. Er gehe davon aus, dass die im Zusammenhang mit der Droge genannten Behauptungen falsch seien. Vielleicht, fuhr er fort, könne Cannabis in einer winzigen Zahl von Fällen die Menschen tatsächlich in den Wahn treiben, doch nehme er an, dass jeder, der auf diese Weise reagiere, bereits ein tiefer liegendes psychisches Problem habe. Er bat Anslinger, wissenschaftliche Laborstudien zu finanzieren, damit die Wahrheit ans Licht käme. Anslinger antwortete in strengem Ton: »Das Übel Marihuana kann nicht weiter auf die lange Bank geschoben werden.« Er hat weder damals noch später eine unabhängige Untersuchung veranlasst.
Jahrelang meldeten sich Ärzte mit Beweisen bei ihm, die belegten, dass er sich irrte, doch fertigte er sie meist kurz und bündig ab und teilte ihnen mit, sie bewegten sich »auf gefährlichem Terrain« und sollten lieber Ruhe geben. Stattdessen schrieb er im ganzen Land Polizeibeamte an und bat sie, Fälle zu melden, in denen Marihuana ursächlich zum Tod von Menschen geführt habe. Bald trudelten jede Menge Berichte ein. Der für Anslinger wie für Amerika entscheidende Fall wurde der von Victor Lacata aus Florida, 29 Jahre alt und in der Nachbarschaft als »vernünftiger, recht stiller junger Mann« bekannt, bis er dann eines Tages – so die Berichte – Cannabis rauchte. Er sei in einem »Marihuana-Traum« gefangen gewesen, der ihm suggerierte, er werde von Männern angegriffen, die ihm die Arme abschneiden wollten, weshalb er sich wehrte, seinerseits zur Axt griff und seine Mutter, seinen Vater, zwei Brüder und eine Schwester in Stücke hackte. Auf Anslingers Veranlassung hin machte die Presse Lacatas Fall berühmt. Die Menschen begannen zu glauben, dass der eigene Sohn, falls er Marihuana rauchte, sie gleichfalls in Stücke hacken könnte. Anslinger war nicht der Erste, der solche Befürchtungen in die Welt setzte – sie waren schon Ende des 19. Jahrhunderts etwa in Mexiko weit verbreitet gewesen, wo die Ansicht vorherrschte, dass man von Marihuana ›loco‹ wurde. Anslinger war auch nicht der Einzige, der diese Ängste in den Vereinigten Staaten schürte – die Presse liebte solche Geschichten, insbesondere die Massenmedien von William Randolph Hearst. Zum ersten Mal aber fanden diese Befürchtungen dank Anslinger nun die Unterstützung einer Regierungsbehörde, die sie gleichsam mit einem offiziellen, den Inhalt bestätigenden Regierungsstempel versah. Aus den Cannabiswolken, warnte Anslinger, tauchten überall um uns herum Menschen wie Victor Lacata auf.
Die Warnungen zeigten Wirkung. Die Öffentlichkeit verlangte, die Behörde mit mehr Mitteln auszustatten, um das Land vor dieser schrecklichen Bedrohung zu schützen. Anslingers Sorgen um die ungewisse Zukunft seines neuen Reiches wurden kleiner.
Viele Jahre später hat sich der Juraprofessor John Kaplan die Krankenakte Victor Lacatas noch einmal vorgenommen. Die Psychiater, von denen er untersucht wurde, hatten ausgesagt, er habe schon seit langem an »akuter und chronischer« Geisteskrankheit gelitten. In seiner engeren Verwandtschaft hatte es mehrere Personen gegeben, die an ähnlich extremen psychischen Problemen litten – drei waren in Nervenkliniken eingewiesen worden –, und die Polizei hatte schon ein Jahr vor den Morden versucht, Lacata in eine Heilanstalt zu überweisen, doch hatten seine Eltern darauf bestanden, ihn zu Hause zu betreuen. Die untersuchenden Psychiater hatten Victor Lacatas Cannabiskonsum für so irrelevant gehalten, dass sie ihn in der Krankenakte nicht einmal erwähnt hatten.
Anslinger aber hatte jetzt seine Geschichte. In einem berühmt gewordenen Radiointerview sagte er: »Eltern, passt auf! Euren Kindern … droht eine neue Gefahr in Gestalt einer mit Drogen versetzten Zigarette: Marihuana. Die jungen Leute werden Sklaven einer narkotischen, langanhaltenden Abhängigkeit, bauen geistig ab, werden verrückt und schließlich zu gewaltsamen Verbrechern und Mördern.« Trotz aller ihm vorgelegten Bedenken beharrte er darauf, dass Marihuana verrückt mache.
Mit der Mafia war es ihm ähnlich ergangen: Alle hatten sich über ihn lustig gemacht, als er behauptete, dass es die Mafia gebe. »Wo sind denn die Beweise?«, hatten sie mit ätzendem Spott gefragt. Mit Hilfe seiner Agenten fand Anslinger nun nicht nur Belege für die Existenz der Mafia, sondern auch dafür, dass sie weit größer war als angenommen. Er legte eine Akte mit Namen und Einzelheiten über achthundert in den Vereinigten Staaten operierenden Mafiosi an. Durchsuchungsaktionen bewiesen, dass er recht hatte, trotzdem weigerten sich die Behörden, ihm zu glauben, und zogen es beschämt vor, auf diesem Auge blind zu bleiben. Manche waren korrupt, manche wollten von so einem schwierigen, dreckigen Kreuzzug nichts wissen, und wieder andere hatten einfach Angst. Als David Hennessy, der Polizeichef von New Orleans, in Sachen Mafia zu viel Neugier an den Tag legte, wurde er umgebracht.
Anslinger begann zu glauben, dass es ihm mit all seinen Ahnungen so ergehen würde. Er brauchte bloß den vermeintlichen ›Experten‹ zu trotzen und seinem Instinkt zu folgen, dann würde sich schon zeigen, dass er richtiger lag, als alle vermutet hatten.
Anslinger intensivierte seine Kampagne und warnte, dass Marihuana bei Schwarzen die fürchterlichsten Wirkungen zeige. Die Droge ließe sie alle Rassenschranken vergessen – und entfessele eine Gier nach weißen Frauen. Obwohl man in den 1930er Jahren noch anders über die Rassenfrage redete, war man aber schon damals schockiert über Anslingers extreme Ansichten, und als herauskam, dass er in einem offiziellen Memorandum das Wort ›Nigger‹ verwendet hatte, verlangte Senator Joseph F. Guffey aus Anslingers Heimatstaat Pennsylvania seine Entlassung. William B. Davis, einer von Anslingers wenigen schwarzen Agenten, wehrte sich Jahre später dagegen, in der Behörde mit ›Nigger‹ angeredet zu werden – und wurde prompt von Anslinger vor die Tür gesetzt.
Bald begann Anslinger, gegen alle seine Kritiker vorzugehen. Als die amerikanische Ärzteschaft einen Bericht herausbrachte, der einige von Anslingers überzogenen Behauptungen widerlegte, kündigte er an, jeden Agenten zu feuern, der mit einem Exemplar dieses Berichtes erwischt werde. Und als ein Professor namens Alfred Lindesmith behauptete, Drogensüchtigen müsse man Fürsorge und Mitgefühl angedeihen lassen, wies Anslinger seine Männer an, Lindesmiths Universität warnend darauf hinzuweisen, dass der Professor mit einer »kriminellen Organisation« kooperiere, ließ ihn überwachen und ihm schließlich ausrichten, den Mund zu halten. Anslinger merkte, dass er zwar den Drogenstrom nicht kontrollieren, dafür aber den Ideenstrom lenken konnte – und das auch, weil er nicht nur Wissenschaftler zum Schweigen brachte.
Aus Anslingers Schriften wurde deutlich, dass er von Billie Holiday wie besessen gewesen ist, und ich ahnte, dass es da mehr zu erzählen gab. Also spürte ich jeden noch lebenden Bekannten von Billie Holiday auf, um Fragen zu stellen, und einer – ihr Patenkind Bevan Dufty – erklärte, seine Mutter sei Billies beste Freundin und davon überzeugt gewesen, dass Billie in Wahrheit von den Behörden umgebracht worden war. Was an Geschriebenem von ihr noch existierte, liege seit Jahren ungesichtet auf seinem Dachboden. Ob ich, fragte er, einen Blick in ihre Papiere werfen wolle? Als ich sie mit Anslingers Akten abglich, mit dem, was ihre Freunde erzählten, und den Schriften ihrer Biographen, nahm Billie Holidays Geschichte langsam Konturen an.
Jazz war das Gegenteil von allem, woran Anslinger glaubte. Jazz improvisiert, ist entspannt, ist frei und kaum an Noten gebunden. Jazz folgt seinem eigenen Rhythmus. Schlimmer noch, Jazz ist ein Gemisch aus europäischen, karibischen und afrikanischen Einflüssen, die sich auf amerikanischem Boden kreuzen. Für Anslinger war Jazz musikalische Anarchie und ein Beleg für die Existenz primitiver Triebe, die in den Schwarzen nur darauf lauerten, ausbrechen zu können. »Jazz klingt«, so eines seiner internen Memos, »wie der Dschungel bei Nacht.« Ein weiteres Memo warnte vor den »unfassbaren, uralten Riten der Karibik, die in der Musik des schwarzen Mannes wiedererwachen«. Das Leben der Jazzmusiker, schrieb er, »stinke vor Dreck«. Seine Agenten berichteten ihm, dass »viele Jazzmusiker glauben, sie könnten unter dem Einfluss von Marihuana ganz wunderbar spielen, dabei hören sie sich nur hoffnungslos verwirrt und grässlich an«.
Das Federal Bureau of Narcotics glaubte, Marihuana verlangsame die Wahrnehmung von Zeit und deshalb klinge Jazz so verrückt – die Musiker lebten buchstäblich in einem anderen, unmenschlichen Rhythmus. »Musik hat durchaus ihren Zauber«, heißt es in den Memos, »nur diese Musik nicht.« Für Anslinger war Jazz sogar ein weiterer Beweis dafür, dass Marihuana verrückt machte. So kommt in dem Song ›That Funny Reefer Man‹ die Zeile vor: »Any time he gets the notion, he can walk across the ocean.« Und Anslingers Agenten warnten: »Die denken tatsächlich, sie könnten über Wasser laufen.«
Anslinger behielt die Jazzszene um die Musiker Charlie Parker, Louis Armstrong und Thelonious Monk im Blick und hätte sie am liebsten – so der Journalist Larry Sloman – hinter Gittern gesehen. Agenten, die er auf ihre Spur setzte, wies er an: »Bereitet alle Fälle in eurem Zuständigkeitsbereich vor, bei denen es um Verstöße von Musikern gegen die Marihuana-Gesetze geht. Wir werden die betroffenen Personen landesweit an einem einzigen Tag verhaften. Den genauen Termin gebe ich noch bekannt.« Bei Drogenrazzien lautete sein Rat an die Männer: »Erst schießen!«
Den Kongressabgeordneten versicherte er, diese Razzia richte sich »nicht gegen die guten Musiker, sondern gegen Jazzer«. Sooft Anslinger sich aber einen Verdächtigen greifen wollte, setzte die Jazzwelt die einzige Waffe ein, die sie retten konnte: ihre absolute Solidarität. Anslingers Männer vermochten kaum jemanden zu finden, der einen Jazzmusiker verpfeifen wollte, und wenn doch einmal jemand eingesperrt wurde, legten alle Musiker zusammen, um ihn auf Kaution wieder freizubekommen.
Letztlich teilte das Finanzministerium Anslinger mit, er vergeude seine Zeit mit einer Gemeinschaft, die sich nicht gegeneinander ausspielen ließ, also reduzierte er seine Anstrengungen und konzentrierte sich schließlich nur noch auf ein einziges Ziel – auf die womöglich größte Jazzsängerin aller Zeiten.
Billie Holiday wurde 1915 nur wenige Monate nach dem Erlass jenes Harrison-Betäubungsmittelgesetzes geboren, das zum ersten Mal Kokain und Heroin verbot, ein Gesetz, das in ihrem Leben noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Schon bald nach Billies Geburt wurde die 19-jährige Mutter Sadie zur Prostituierten, der 17-jährige Vater machte sich aus dem Staub. Er starb später im Süden an einer Lungenentzündung, weil er kein Krankenhaus finden konnte, dass einen Schwarzen behandeln wollte.
Billie wuchs in den Straßen von Baltimore auf, trotzig und allein. Baltimore war die letzte Stadt in den Vereinigten Staaten, die noch keine Kanalisation besaß, und Billies Kindheit war von den stinkenden Qualmwolken brennender Abfallhaufen durchzogen. Ihr Slum war als Pigtown bekannt, als ›Schweinestadt‹, in der die meisten Menschen in baufälligen Hütten lebten. Jeden Tag wusch die kleine Billie ihre Urgroßmutter und hörte sich Geschichten über deren Jugend und die Zeit an, in der sie noch Sklavin auf einer Plantage in Virginia gewesen war.
Billie begriff bald, dass es viele Orte gab, an denen sie sich nur deshalb nicht aufhalten durfte, weil sie schwarz war. In einem Geschäft verkaufte man ihr Hotdogs, aber nur, wenn sie keiner sah, und man machte ihr die Hölle heiß, wenn sie drinnen essen wollte, weil man fürchtete, sie könne dabei gesehen werden. Billie wusste in ihrem Innersten, dass das falsch war und sich ändern musste, weshalb sie sich ein Versprechen gab: »Ich beschloss einfach, dass ich irgendwann nichts mehr sagen oder tun würde, was ich nicht auch meinte. Kein ›Bitte, mein Herr‹ mehr, kein ›Danke, Madam‹. Nichts, wenn ich es nicht wirklich meinte. Man muss schon arm und schwarz sein, um zu wissen, wie oft man Prügel für so etwas Simples beziehen kann.« Dieses Versprechen sollte ihr Leben ändern – und ihre Einstellung zu Anslinger.
Als sie elf Jahre alt war, tauchte einer ihrer Nachbarn auf – ein Mann um die vierzig namens Wilbur Rich – und erklärte, ihre Mutter habe ihn geschickt, um sie zu holen. Er brachte Billie zu einem Haus und sagte, sie solle warten. Billie saß da und wartete, aber ihre Mutter kam nicht. Der Abend brach an, und Billie erklärte, sie sei müde. Der Mann zeigte ihr ein Bett. Als sie sich hinlegte, fiel er über sie her und vergewaltigte sie. Sie jammerte, schlug nach dem Mann und schrie um Hilfe; irgendwer musste sie gehört haben, denn die Polizei kam. Als die Beamten ins Zimmer stürmten, war ihnen gleich klar, was hier vor sich ging. Billie, erklärten sie, sei eine Prostituierte, die den armen Mann verführt habe. Man sperrte sie für zwei Tage in eine Zelle ein. Monate später wurde Wilbur Rich zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, Billie bestrafte man mit einem Jahr Besserungsanstalt.
Die Nonnen, die dieses ummauerte, von der Welt abgeschiedene Strafkloster leiteten, warfen einen Blick auf Billie und wussten, dass sie ein böses Kind war, das dringend strenger Disziplin bedurfte. Billie wehrte sich mit Händen und Füßen gegen jeden Versuch, sie zu bändigen – also wurde beschlossen, ihr eine »Lektion zu erteilen«. Man steckte sie in eine Kammer, die leer war bis auf eine dort aufgebahrte Leiche, schlug die Tür hinter ihr zu und ließ sie über Nacht eingesperrt. Billie hämmerte an die Tür, bis ihre Hände bluteten, aber niemand kam.
Sobald ihr die Flucht gelungen war – aus dem Kloster und aus Baltimore –, war sie fest entschlossen, ihre Mutter zu finden, von der sie zuletzt aus Harlem gehört hatte. An einem eisigen Wintertag stieg Billie schließlich aus dem Bus, taumelte zu der Adresse, die man ihr genannt hatte, und stellte fest, dass sie vor einem Bordell stand. Ihre Mutter arbeitete dort für einen Hungerlohn und sah keine Möglichkeit, sie bei sich zu behalten. Also landete Billie wieder auf der Straße und war so hungrig, dass ihr selbst das Atmen weh tat. Sie entschied, dass es für sie nur eine Lösung gab. Eine Puffmutter bot ihr an, zum halben Lohn bei ihr zu arbeiten. Billie war 14 Jahre alt.
Bald hatte Billie ihren eigenen Zuhälter, einen brutalen, fluchenden Schläger namens Louis McKay, der ihr die Rippen brach und sie blutig prügelte. Entscheidender aber war, dass dieser Mann viele Jahre später Anslinger kennenlernen und für ihn arbeiten sollte. Billies Mutter riet der Tochter nach kurzer Zeit, Louis zu heiraten, er sei doch ein netter Kerl.
Billie wurde von der Polizei beim Anschaffen aufgegriffen. Statt sie vor ihrem Zuhälter zu retten und ihr weitere Vergewaltigungen zu ersparen, wurde sie erneut bestraft. Sie kam ins Gefängnis auf Welfare Island, und sobald sie wieder draußen war, begann sie, Drogen zu nehmen. Anfangs bevorzugte sie White Lightning, ein übles Gebräu aus 70-prozentigem Alkohol, doch je älter sie wurde, desto härter wurde auch der Stoff, mit dem sie sich zu betäuben versuchte. Ein junger Weißer aus Dallas namens Speck zeigte ihr, wie man sich Heroin spritzte. Man erhitzt es auf einem Löffel und jagt es sich direkt in die Vene. Wenn Billie nicht high oder betrunken war, versank sie in schwärzesten Depressionen und war so schüchtern, dass sie kaum reden konnte. Nachts wachte sie immer noch schreiend auf, weil sie von Haft oder Vergewaltigung träumte. »Ich bin süchtig und weiß selbst, dass das nicht gut ist«, erzählte sie einer Freundin, »aber nichts sonst gibt mir das Gefühl, dass ein Mensch namens Billie Holiday existiert. Ich bin Billie Holiday.«
Dann entdeckte sie etwas Neues. Eines Tages lief sie halbverhungert ein Dutzend Häuserblocks in Harlem ab und fragte in jeder Spelunke, ob man Arbeit für sie habe, wurde jedoch überall abgewiesen. Schließlich betrat sie eine Kneipe namens Log Cabin und erklärte, sie könne tanzen, doch schon nach wenigen Schritten war klar, dass ihr Können nicht ausreichte. Verzweifelt fragte sie den Besitzer, ob sie es mit Singen probieren dürfe. Er wies auf den alten Klavierspieler in der Ecke. Kaum fing sie an, ›Trav’llin’ All Alone‹ zu singen, setzten die Gäste ihre Gläser ab und hörten zu. Und als ›Body and Soul‹, ihr nächster Song, zu Ende ging, liefen ihnen die Tränen über die Wangen.
Sie blieb beim Singen stets hinter dem Takt zurück, lebte dafür aber umso schneller. Einmal, an Silvester, sah ein Matrose, wie man sie in einer Bar bediente, und er fragte: »Seit wann werden hier Niggerfotzen bedient?« Sie hieb ihm die Flasche ins Gesicht. Ein anderes Mal begann eine Meute Soldaten und Matrosen, Zigaretten auf ihrem Nerzmantel auszudrücken. Sie bat eine Freundin, den Mantel für sie zu halten, schnappte sich einen rautenförmigen Aschenbecher und schlug einen der Kerle bewusstlos.
Wenn es um die Männer in ihrem Leben ging, verebbte jedoch der Impuls, sich zu verteidigen. Louis McKay avancierte vom Zuhälter zum Manager und Ehemann: Er stahl ihr fast das gesamte Vermögen. Nach ihrem größten Auftritt in der Carnegie Hall begrüßte er sie mit einem so heftigen Faustschlag ins Gesicht, dass sie rückwärts zu Boden flog. Die Auseinandersetzung mit Anslinger stand ihr noch bevor. Wie sich herausstellte, hatte er sie die ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen.
Anslinger hatte munkeln hören, dass der aufsteigende schwarze Star Heroin nahm, also beauftragte er den Agenten Jimmy Fletcher, jeden ihrer Schritte zu beobachten. Anslinger hasste es, schwarze Agenten einsetzen zu müssen, aber hätte er Weiße nach Harlem oder Baltimore geschickt, wären sie aufgefallen wie bunte Hunde. Fletchers Job war es, die eigenen Leute hinter Gitter zu bringen, Karriere jedoch konnte er in Anslingers Bureau nicht machen. Er war ein »Archivmann« und würde auch immer einer bleiben – ein Straßenagent, der herausfinden sollte, wer verkaufte, wer Nachschub besorgte und wen man verhaften sollte. Meist hatte er große Mengen Drogen dabei, und um das Vertrauen derjenigen zu gewinnen, die er verhaften wollte, durfte er auch mit Drogen dealen. Viele Agenten in seiner Position spritzten sich mit ihren Kunden Heroin, um zu ›beweisen‹, dass sie keine Polizisten waren. Wir wissen nicht, ob Fletcher es auch so hielt, allerdings wissen wir, dass er für Süchtige kein Mitleid empfand: »Ich kenne keine Opfer«, sagte er. »Wer zum Junkie wird, hat sich selbst zum Opfer gemacht.«
Billie Holiday traf er zum ersten Mal in der Wohnung ihres Schwagers, wo sie riesige Mengen Kokain schniefte und Alkohol trank in Mengen, die ein Pferd betäubt hätten. Das nächste Mal sah er sie in einem Bordell in Harlem, wo sie es nicht anders hielt. Außer fürs Singen besaß Billie Holiday nur noch fürs Fluchen ein einzigartiges Talent – wenn sie jemanden ›Motherfucker‹ nannte, war das ein großes Kompliment. Wir wissen nicht, wann sie Fletcher zum ersten Mal ›Motherfucker‹ nannte, wir wissen nur, dass ihr dieser Mann bald auffiel, der ständig in ihrer Nähe blieb und sie beobachtete; sie begann, ihn zu mögen.
Als Fletcher eine Razzia bei ihr durchführen sollte, klopfte er an die Tür und gab vor, ein Telegramm überbringen zu wollen. Ihre Biographin Julia Blackburn las das einzig erhalten gebliebene Interview mit Jimmy Fletcher – inzwischen ist es in den Archiven verloren gegangen – und schrieb auf, woran Fletcher sich erinnerte.
»Schieb’s unter der Tür durch!«, schrie Billie.
»Geht nicht, ist zu dick!«, fauchte er zurück.
Sie ließ ihn eintreten. Sie war allein. Fletcher fühlte sich nicht wohl in seiner Haut.
»Warum kürzt du die ganze Sache nicht ab, Billie? Falls du was hast, gib’s einfach her«, sagte er. »Dann brauchen wir hier nicht zu suchen und dir die Kleider vom Leib zu reißen. Also, wie sieht’s aus?« Aber dann kam Fletchers Partner und ließ eine Polizistin holen, um eine Leibesvisitation durchzuführen. »Das ist nicht nötig. Ich zieh mich schon aus«, sagte Billie Holiday. »Ich will nur wissen – durchsucht ihr mich und lasst mich dann gehen? Will mir eure Kollegin bloß in die Möse glotzen?« Sie zog sich aus, stand da und pisste ihnen dann trotzig vor die Füße.
Wenn Billie Holiday »Loverman, where can you be?« sang, dann weinte sie nicht um einen Mann – sie wollte Heroin. Als sie aber herausfand, dass in der Jazzwelt viele Kollegen dieselbe Droge nahmen, flehte sie ihre Freunde an, damit aufzuhören. Macht es nicht wie ich, rief sie, niemals.
Sie versuchte, von der Droge wegzukommen. Sie zog zu Freunden, schloss sich tagelang in deren Häuser ein und ging auf Entzug. Wenn sie wieder zu ihren Dealern zurücklief, verfluchte sie sich als »Memme Holiday«. Warum konnte sie nicht einfach Schluss damit machen? »Es ist schwer genug, wenn du jemanden hast, der dich liebt, an dich glaubt und dir vertraut«, schrieb sie. »Ich hatte niemanden.« Eigentlich, sagte sie dann, stimmte das nicht ganz. Sie hatte Anslingers Agenten, »die ihre Zeit, ihre Schuhsohlen und ihr Geld darauf verwetteten, dass sie mich kriegen würden. Niemand kann so leben.«
An dem Morgen, an dem er zum ersten Mal eine Razzia bei ihr durchführte, nahm Fletcher Billie Holiday beiseite und versprach ihr, persönlich ein Wort bei Anslinger für sie einzulegen. »Ich will nicht, dass du deinen Job verlierst.« Bald darauf traf er sie zufällig in einer Bar, und sie unterhielten sich stundenlang, Billies Schoßhund Moochy, ein Chihuahua, an ihrer Seite. Eines Abends tanzten sie dann im Club Ebony zusammen – Billie Holiday und Anslingers Agent wiegten sich im Takt der Musik.
»Und ich führte so viele vertraute Gespräche mit ihr«, erinnerte er sich Jahre später, »über so viele Dinge. Sie war der Typ, der in jedem Menschen Mitgefühl weckte, einfach, weil sie zur liebevollen Sorte gehörte.« Der Mann, der von Anslinger geschickt worden war, um Billie Holiday zu beobachten und zu verhaften, hatte sich offenbar in sie verliebt. Unmittelbar mit einer echten Süchtigen konfrontiert, fiel der Hass von ihm ab.
Anslinger sollte allerdings etwas gegen Billie Holiday in die Hand bekommen, was ihm zuvor in der Jazzwelt nie gelungen war. Billie Holiday war es gewohnt, vor Auftritten von Louis McKay so übel zusammengeschlagen zu werden, dass man ihr manchmal die Rippen verbinden musste, ehe sie auf die Bühne gezerrt werden konnte. Sie hatte zu große Angst vor der Polizei – endlich aber brachte sie den Mut auf, sich von ihrem Mann zu trennen.
»Wieso soll ich mir das von dieser Nutte gefallen lassen? Dieser Prollnutte?«, tobte McKay. »Wenn ich mir ein Flittchen halte, schafft es Geld ran, oder ich will mit der Schlampe nichts mehr zu tun haben. Ich will keine blöde Fotze.« Er hatte gehört, dass Anslinger Informationen über Billie Holiday sammelte; und das reizte ihn. »Die ist mit zu viel Scheiß ungeschoren davongekommen«, sagte McKay und setzte hinzu, er wolle »Holidays Arsch im Abwasserkanal des East River schwimmen sehen«. Das gab den Ausschlag. »Ich hab genug gegen sie in der Hand, um sie fertigzumachen«, gab er an. »Und ich mach sie so verdammt fertig, dass sie das ihr Lebtag nicht mehr vergisst.« Er fuhr nach Washington, D.C., um Anslinger zu treffen; und dieser erklärte sich bereit, sie ans Messer zu liefern.
Als Billie Holiday wieder einmal verhaftet wurde, machte man ihr den Prozess. Blass und wie betäubt stand sie vor Gericht. »Es hieß: ›Die Vereinigten Staaten von Amerika gegen Billie Holiday‹«, sagte sie, »und genauso fühlte es sich auch an.« Sie weigerte sich, auf der Anklagebank zu weinen, und sagte dem Richter, sie wolle kein Mitleid, sie wolle einfach nur in ein Krankenhaus, damit sie die Drogen aufgeben und gesund werden könne. »Bitte«, flehte sie den Richter an, »lassen Sie mich den Entzug machen.«
Stattdessen wurde sie zu einem Jahr Haft in einem Gefängnis in West Virginia verurteilt, wo man sie – unter anderem – zu kaltem Entzug und zur Arbeit in einem Schweinestall zwang. Während ihrer Zeit hinter Gittern sang sie keinen einzigen Ton. Als Jahre später ihre Autobiographie veröffentlicht wurde, spürte sie Jimmy Fletcher auf und schickte ihm ein signiertes Exemplar. Sie hatte ihm folgende Widmung geschrieben: »Die meisten Bundesagenten sind nette Menschen. Sie haben einen schmutzigen Job, aber sie müssen ihn erledigen. Einige der netteren Agenten besitzen immerhin so viel Anstand, dass sie sich für das hassen, was sie machen … Vielleicht wären Sie netter zu mir gewesen, hätten Sie sich schlimmer benommen, denn dann hätte ich Ihnen nicht vertraut und nicht dem geglaubt, was Sie mir gesagt haben.« Sie sollte recht behalten: Fletcher hörte nie auf, ein schlechtes Gewissen wegen der Dinge zu haben, die er Lady Day angetan hatte. »Billie hat ›ihre Schuld‹ gegenüber der Gesellschaft beglichen«, schrieb einer ihrer Freunde, »die Gesellschaft aber hat nie bereut, was sie ihr angetan hat.«
Als ehemaliger Strafgefangenen wurde Billie Holiday die Auftrittserlaubnis entzogen, die sogenannte Kabarettkarte; als Grund gab man an, ihre Songs schädigten die öffentliche Moral. Dies wiederum bedeutete, dass sie nirgendwo mehr singen durfte, wo Alkohol ausgeschenkt wurde – und das schloss alle Jazzclubs der Vereinigten Staaten ein.
»Wie geht man am grausamsten vor?«, hat mich 2013 Billies Freundin Yolande Bavan gefragt. »Man nimmt einem Menschen, was ihm am liebsten ist.« Billie hatte alles ertragen – aber das jetzt? »Man verzweifelt, weil man keine Kontrolle mehr hat. Man kann nicht mehr tun, was man mit aller Leidenschaft tun möchte und was allen Menschen auf der Welt Freude bereitet«, sagte Bavan. Billie war zum Verstummen gebracht worden. Sie besaß kein Geld, um für sich sorgen oder auch nur anständig essen zu können. Sie konnte nicht einmal mehr unter eigenem Namen eine Wohnung mieten.
Eines Abends fiel Billie Holiday betrunken hin, und ihre Freundin Greer Johnson fand sie schluchzend am Boden.
»Scheiß drauf, Baby! So wahr mir Gott helfe, ich werde nie wieder singen.«
»Was zum Teufel willst du dann tun?«, soll ihre Freundin Julia Blackburn zufolge gefragt haben.
»Ist mir doch scheißegal!«
»Na schön! Und was genau stellst du dir vor, Billie?«
Sie murmelte: »Ich sing, was sonst?«
»Da hast du verdammt recht!«
Eine andere Freundin sagte ihr immer wieder, sie solle Geld sparen und sich ein Haus mit einem Garten anschaffen, um dort Babys großzuziehen. »Meinst du, ich könnte das? Hältst du das wirklich für möglich?«, fragte sie ungläubig. Sie träumte davon, sich irgendwo eine große Farm zu kaufen und sie in ein Heim für Waisenkinder umzubauen, wo sie dann die Küche leiten wollte. Manchmal besuchte sie ihr kleines Patenkind Bevan Duffy in der Wohnung in der 94th Street und legte sich den Jungen an die Brust. Sie hatte keine Milch, aber sie fand es beruhigend. »Das ist mein Kleiner«, sagte sie zur Mutter und lachte.
Die einzige andere Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, bestand für sie darin, zu den Gewohnheiten ihrer Kindheit zurückzukehren. Dann lag sie den ganzen Tag im Bett, las Superman-Comics und kicherte vor sich hin. Einmal ging sie mit einer Jugendfreundin in den Central Park, fütterte die Pferde mit LSD und machte anschließend eine Kutschfahrt. Der Kutscher war völlig entgeistert: Warum hielten die Pferde sich nicht an die übliche Route? Billie Holiday gackerte vor Vergnügen.
In ihrem Umgang mit anderen Menschen wurde sie allerdings immer paranoider. Wenn Jimmy Fletcher einer von DENEN war, wer gehörte dann noch dazu? Sie glaubte – zu Recht, wie sich herausstellen sollte –, dass Leute aus ihrem Bekanntenkreis an Anslingers Armee berichteten. »Man wusste einfach nicht, wem man trauen konnte«, erzählte mir ihre Freundin Yolande Bavan. »Sogenannte Freunde – waren das wirklich Freunde? Oder doch nicht?« Wo immer sie hinging, holten Agenten Informationen über sie ein, verlangten nach Einzelheiten.
Billie Holiday begann, sich auch von den wenigen noch verbliebenen Freunden zu distanzieren, weil sie Angst hatte, die Polizei könnte ihnen ebenfalls Drogen unterschieben – und das war das Letzte, was sie den Menschen wünschte, die sie liebte.
Eines Tages berichtete man Anslinger, es gebe einige weiße Frauen, berühmt wie Billie Holiday, die ebenfalls Drogenprobleme hätten – und er reagierte darauf vollkommen anders. So bestellte er etwa Judy Garland zu sich, die auch heroinsüchtig war. Sie hatten eine freundliche Unterhaltung, und er empfahl, zwischen den Dreharbeiten längere Pausen einzulegen; dann schrieb er an ihr Studio und versicherte, die Schauspielerin habe nicht das geringste Drogenproblem. Als er herausfand, dass eine ihm bekannte Gesellschaftsdame in Washington – »eine schöne, überaus liebenswürdige Frau«, wie er schrieb – drogensüchtig war, erklärte er, sie unmöglich verhaften zu können, da das den »makellosen Ruf einer der ehrenwertesten Familien des Landes zerstören« würde. Ohne die Behörden einzubeziehen, half er ihr, sich langsam von der Sucht zu befreien.
Während ich in den Archiven saß und mich durch die Stapel der vergilbten Papiere las, die aus der Zeit vom Beginn des Krieges gegen Drogen überdauert hatten, stieß ich auf etwas Interessantes, das mir vollkommen neu war.
Die heute vorgebrachten Argumente lauten, dass wir Teenager vor Drogen in Schutz nehmen und die Gefahren der Sucht meiden müssen. Rückblickend gehen wir davon aus, dass dies auch die Gründe waren, die zum Drogenkrieg geführt haben. Aber das stimmte nicht. Sie tauchten zwar gelegentlich auf, aber nur am Rande. Der eigentliche Grund, Drogen zu verbieten – der Grund, von dem die Männer, die diesen Krieg begannen, wie besessen waren –, lautete, dass drogensüchtige Schwarze, Mexikaner und Chinesen ihren angestammten Platz in der Gesellschaft vergaßen und zur Gefahr für die Weißen wurden.
Ich brauchte eine Weile, bis ich begriff, dass der gegen Billie Holiday gerichtete Rassismus und das für drogensüchtige weiße Stars wie Judy Garland geäußerte Mitgefühl keine kuriosen Fehlzündungen des Drogenkrieges waren, sondern dass es sich genau anders herum verhielt.
Anslinger erklärte der Öffentlichkeit, »die Zunahme (der Drogenabhängigkeit) fände praktisch zu 100 Prozent allein bei den Negern« statt, was, wie er betonte, ziemlich besorgniserregend war, da »der Anteil der Neger schon jetzt auf 10 Prozent der Gesamtbevölkerung angewachsen ist, er aber 60 Prozent der Süchtigen ausmacht«. Anslinger konnte den Krieg gegen Drogen nur deshalb führen – konnte tun, was er tat –, weil er sich eine Angst des amerikanischen Volkes zunutze machte. Selbst der beste Surfer braucht eine große Welle. Und Anslingers Welle kam in Gestalt einer Rassenpanik.
Im Vorfeld zur Verabschiedung des Harrison-Betäubungsmittelgesetzes erschien in der New York Times eine für die damalige Zeit typische Geschichte. Die Schlagzeile lautete: SCHWARZE KOKAIN-TEUFEL NEUE PLAGE IM SÜDEN. Darin hieß es, einem Polizeichef in North Carolina sei gemeldet worden, »ein bis dahin friedfertiger, ihm gut bekannter Neger laufe im Kokainwahn Amok und habe versucht, einen Ladenbesitzer zu erstechen … Da er wusste, dass er den Mann töten musste, wenn er nicht selbst getötet werden wollte, zog der Beamte seinen Revolver, hielt dem Neger die Mündung auf die Brust und schoss ihm ins Herz – ›um ihn so rasch wie möglich zu erlösen‹, wie der Beamte sich ausdrückte, nur sei der Mann vom Schuss nicht einmal ins Stolpern geraten.« Kokain, so hieß es damals allgemein in der Presse, verwandle Schwarze in Supermenschen, die auch bei einem Herzschuss kaum zusammenzuckten. Dies war die offizielle Begründung dafür, weshalb die Polizei in den Südstaaten mit Waffen eines größeren Kalibers ausgestattet wurde. Ein medizinischer Experte erklärte rundheraus: »Der Kokainnigger ist verdammt schwer zu töten.«
Viele weiße Amerikaner wollten nicht glauben, dass schwarze Amerikaner rebellierten, weil sie wie Billie Holiday leben mussten – in ›Schweinestädten‹, in denen sie daran gehindert wurden, ihre Talente zu entfalten. Da war der Gedanke tröstlicher, ein weißes Pulver sei für die Wut der Schwarzen verantwortlich, denn dann brauchte man nur das weiße Pulver loszuwerden, damit die Schwarzen wieder fügsam kuschten. (Der Hintergrund hierzu sollte Jahre später in Michelle Alexanders bemerkenswertem Buch The New Jim Crow aufgearbeitet werden.)
Es gab noch eine weitere Bevölkerungsgruppe, die man nach Anslingers Meinung im Zaum halten musste. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts strömten chinesische Einwanderer in die Vereinigten Staaten und konkurrierten mit den Weißen um Jobs und Karrierechancen. Schlimmer noch, Anslinger glaubte, sie konkurrierten mit weißen Männern auch um weiße Frauen. Er warnte, dass die Chinesen mit ihrer »typisch orientalischen Unbarmherzigkeit eine Vorliebe für den Charme weißer Mädchen aus gutem Hause« entwickelt hatten. Sie lockten sie in »Opiumhöhlen« – wie man sie aus der Heimat kannte –, machten die jungen Frauen süchtig und zwangen sie dann, den Rest ihres Lebens »unvorstellbar verdorbene Sexualpraktiken« zu vollziehen. Anslinger beschrieb in allen Einzelheiten, was in den Bordellen vor sich ging: Wie die weißen Mädchen langsam ihre Kleider auszogen, wie ihre »Höschen« zum Vorschein kamen, wie sie ausgiebig den Chinesen küssten und was dann geschah … Hatten die chinesischen Dealer sie erst süchtig gemacht, lachten sie ihnen ins Gesicht und verrieten den wahren Grund, warum sie den Stoff verkauften: Auf diese Weise stellten sie sicher, dass »die chinesische Rasse die Welt beherrschte«. »Sie sind zu weise, einen Sieg in der Schlacht zu suchen, aber dank ihres Scharfsinns werden sie gewinnen, werden die weiße Rasse mit Rauschgift angreifen und die Welt beherrschen, sobald die Zeit dafür reif ist«, erklärte ein Vorsitzender Richter.
Anfangs hatten einfache Bürger den Kampf gegen die Gelbe Gefahr in ihre eigenen Hände genommen. In Los Angeles wurden 21