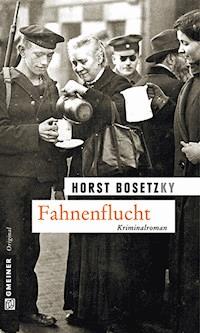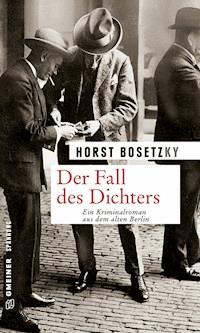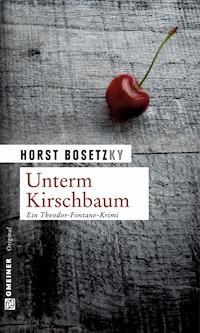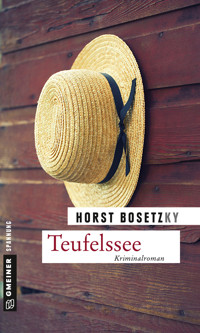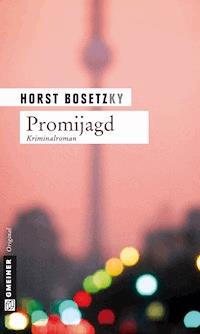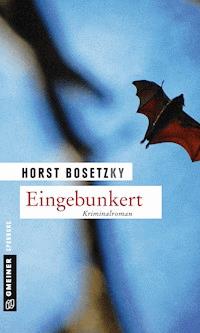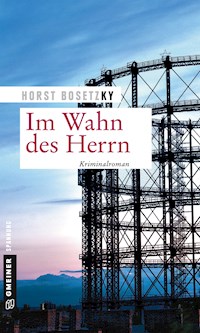Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Mannhardt und Schneeganß
- Sprache: Deutsch
Carlo Kolbatzki ist im Leben gescheitert und lebt ärmlich in einer Laube, als er von seinem Neurologen die Diagnose Gehirntumor erhält - lange wird er nicht mehr zu leben haben. Kolbatzki will Selbstmord begehen, doch als er den Lauf an die Schläfe setzt, besinnt er sich eines anderen und beschließt, zunächst alle die umzubringen, die sein Leben ruiniert haben. Auf seiner Abschussliste steht auch Hansjürgen Mannhardt, der ihn einst hinter Gitter gebracht hat. Die ersten vier Namen konnte Kolbatzki abhaken, nun wäre Mannhardt an der Reihe …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Abgerechnet wird
zum Schluss
Kriminalroman
Zum Buch
Neuer Berlin-Krimi vom Altmeister -ky Der 40-jährige Carlo Kolbatzki ist im Leben gescheitert und lebt ärmlich in einer Laube, als er von seinem Neurologen die Diagnose Gehirntumor erhält – lange wird er nicht mehr zu leben haben. Er will Selbstmord begehen, eine alte Pistole mit Schalldämpfer hat er bereits im Bettkasten liegen. Doch als er den Lauf an die Schläfe setzt, besinnt er sich eines anderen und beschließt, zunächst alle die umzubringen, die sein Leben ruiniert haben. Er schreibt eine Abschussliste mit acht Namen. Da ist ein Professor, der ihn durchfallen ließ; ein Chef, der ihn gefeuert hat; ein Fußballer, der ihn beim Spiel verletzt und seine Karriere beendet hat; eine Ex-Ehefrau, die ihn mit seinem besten Freund betrog; ein Hauswirt, der ihn auf die Straße setzte; ein Kulturjournalist, der ihn als Sänger lächerlich machte – und Hansjürgen Mannhardt, der ihn einst hinter Gitter brachte. Die ersten vier Namen auf seiner Abschussliste hat Kolbatzki bereits abgehakt, nun wäre Mannhardt an der Reihe! Wird Hansjürgen Mannhardt Kolbatzki aufhalten und weitere Morde verhindern können?
Dr. Horst Bosetzky (ky) wurde 1938 in Berlin geboren. Der emeritierte Professor für Soziologie veröffentlichte neben etlichen belletristischen und wissenschaftlichen Arbeiten zahlreiche, zum Teil verfilmte und preisgekrönte Kriminalromane. 1992 erhielt er den Ehren-Glauser des SYNDIKATS für das Gesamtwerk und die Verdienste um den deutschsprachigen Kriminalroman. 2005 wurde ihm der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Zehn Jahre lang war Horst Bosetzky Sprecher des SYNDIKATS und Gründungsmitglied von QUO VADIS. Besuchen Sie: www.horstbosetzky.de
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Die Brüder Sass – Geliebte Ganoven (2017)
Teufelssee (2017)
Eingebunkert (2016)
Witwenverbrennung (2015)
Fahnenflucht (2013)
Der Fall des Dichters (2012)
Nichts ist so fein gesponnen (2011)
Promijagd (2010)
Unterm Kirschbaum (2009)
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © jock+scott / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5606-0
Zitat
Berlin! Berlin! du großes Jammertal,/Bei dir ist nichts zu finden, als lauter Angst und Qual.
Heinrich Heine (1797–1856), Das Buch der Lieder, JungeLeiden (gedruckt 1817–1821)
EINS
Wenn die Leute sagten, Carlo Kolbatzki lebte in einer Laube an der Forckenbeckstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, so stimmte das nicht ganz. Er hauste in einer Laube an der Forckenbeckstraße, wäre richtiger gewesen. Wenn man ihn sah, dann hieß es: »Da kommt ja der Penner wieder!«, denn sein Äußeres ließ nicht vermuten, dass er einmal das Abitur gemacht hatte und in Berlin wer gewesen war. Irgendwann, es musste so um 2002 gewesen sein, konnte er aber nur noch mit Hildegard Knef singen: »Von nun an ging’sbergab.« Da war nichts mit dem, was in klugen Ratgebern stand, dass man aus Niederlagen nur lernen könne und das endgültige Scheitern keine beschlossene Sache sei. Er war in allem der große Loser.
Ein Sozialarbeiter aus der Fraktion der Gutmenschen hatte ihm einen Termin im Salernitana-Krankenhaus verschafft, als er immer häufiger unter Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Krampfanfällen zu leiden hatte.
Er raffte sich auf. Es waren nur etwas mehr als zwei Kilometer zu Fuß, ihm erschien es aber wie ein Halbmarathon. Das Geld für eine Taxe hatte er nicht, woher denn auch, und Freunde mit einem Auto schon lange nicht mehr.
Auf dem Flur der Neurologie gab es für Wartende Klappsessel wie im Kino oder Theater, nur dass sie hier nicht gepolstert waren, sondern aus härtestem Sperrholz gefertigt. Vier Sitze waren belegt, Carlo Kolbatzki nahm den fünften. Kurz darauf erhob sich die Frau links von ihm, obwohl sie nicht aufgerufen worden war, und schlenderte zum halb offenen Fenster. Klar, er müffelte ihr zu sehr. Irgendwie erinnerte ihn diese Frau an eine andere. Dann zuckte es wie ein Blitz durch sein Gehirn:
Flashback I
Er hat es unzählige Male im Kino und vor der Glotze gesehen, wie jemand einen Bankraub begeht: Maske übers Gesicht gezogen, Waffe gezückt und in den Schalterraum gestürzt: »Hände hoch! Keiner rührt sich! Dies ist ein Überfall!« Dann dicht vor dem Kassierer: »Geld her, oder …!« Schuss in die Decke. Nun ist er selber dieser Jemand. Träumt er das? Nein, es ist alles wirklich. Er fühlt sich reif für die Psychiatrie, als er Woody Allen vor sich am Werke sieht, wie er dem Kassierer einen Zettel hinüberreicht, auf dem Waffel steht, Waffel statt Waffe. Hat er, Kolbatzki, auch Waffel statt Waffe gerufen? Es ist der helle Wahnsinn. Eine der wartenden Kundinnen stürzt auf ihn zu. »Die Waffe weg! Hände hoch! Ich bin Polizistin, Sie haben keine Chance!« Da reißt er seine Pistole herum und feuert auf sie. Sie sinkt zu Boden.
Carlo Kolbatzki presste die Hände auf die pochenden Schläfen und suchte in die Realität zurückzufinden. Er lag nicht in seiner Laube auf dem Bett und starrte an die Decke, er saß im Krankenhaus und wartete auf seine Diagnose. Wie Gespenster, die sich in weiße Bettlaken gehüllt hatten, sausten Pulks von Schwestern, Ärztinnen und Ärzten an ihm vorbei. Alle hatten es eilig, alle hatten ein Ziel, alles, was sie taten oder ließen, hatte seinen Sinn. Und am Ende eines jeden Monats hatten sie eine Menge Geld auf ihrem Konto. Welch schöne Welt! Er hielt es nicht mehr aus, still dazusitzen und zu warten, sondern stand auf, um ein wenig hin und her zu wandern. Aus einem Papierkorb ragte eine leere Plastikflasche. Instinktiv nahm er sie heraus und steckte sie in seine Hosentasche. Wenn sein Leben wie geplant verlaufen wäre, hätte er keine Flaschen gesammelt, sondern Preise und Pokale.
Da kam der Neurologe auf ihn zu, der ihn untersucht hatte, Doktor Gruschwitz oder so ähnlich. Er hielt eine aufgeschlagene Krankenakte in der Hand und blätterte darin, um sich noch kurz kundig zu machen. Dann sah er flüchtig auf.
»Herr Kolbatzki …?«
»Ja …«
»Ich bin Professor Granschütz, kommen Sie bitte mit ins Besprechungszimmer.«
»Ja …« Carlo Kolbatzki folgte dem Arzt wie ein Hund seinem Herrchen.
Sie kamen in einen Raum, der so kärglich eingerichtet war, dass ihn sogar Ikea-Möbel zu einem Salon gemacht hätten. Der Tisch wackelte, und die Stühle schienen aus alten DDR-Zeiten zu stammen. Carlo Kolbatzki staunte ein wenig, denn das hier war sein Milieu. Von einem der besten Krankenhäuser Berlins hätte er anderes erwartet.
Professor Granschütz musterte ihn eine Weile, und es war ihm anzusehen, dass er bei aller Routine nach den passenden Worten suchte. Beide waren etwa im selben Alter, um die 40 herum, aber der Arzt sah wie 30 aus und Carlo Kolbatzki wie 60.
»Herr Kolbatzki«, begann der Neurologe schließlich, »ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie.«
Carlo Kolbatzki reagierte mit einer Übersprungshandlung, beziehungsweise so, wie er es von einem Comedian auf der Bühne erwartet hätte, und lachte lauthals los. »Dass ich bald sterben muss, ist doch eine gute Nachricht: endlich befreit sein von allem, die Erlösung!«
Eine solche Reaktion hatte Professor Granschütz nicht erwarten können, und so wich er den Blicken seines Patienten aus, vertiefte sich in seine Unterlagen und sprach wie zu sich selbst: »Wir haben bei Ihnen einen Gehirntumor festgestellt …«
»… der bösartig und inoperabel ist«, ergänzte Carlo Kolbatzki mit anhaltender Heiterkeit. »Wie lange geben Sie mir denn noch?«
»Das kann man nie so genau vorhersagen, aber …«
»Ihr aber reicht mir!«, rief Carlo Kolbatzki und stürzte aus dem Zimmer.
Auf dem Weg zurück in seine Laube war Carlo Kolbatzki, als hätte der Arzt gesagt, dass er höchstens noch drei Monate zu leben habe. Aber er lebte ja sowieso schon seit Jahren nicht mehr, er vegetierte nur noch dahin. Auf der Bühne hätte er gesagt: »Früher war ich Vegetarier, jetzt vegetiere ich nur noch.« Wie ein Tier lebte er. Und wenn er starb, konnte er sich nur verbessern. Er sprach jetzt mit sich selbst und wiederholte immer wieder: »Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!« Der Schrecken ohne Ende, das wäre das Dahinsiechen in einem Hospiz, wenn es überhaupt eines gab, das ihn aufnahm.
Als er wieder in seiner Laube war, hob er eine lockere Diele an und holte eine Walther PPQ mit Schalldämpfer hervor, Kaliber 9x19. Kutte, ein alter Kumpel aus der JVA Tegel, hatte sie ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. Für so manche Gefälligkeit. Seines Wissens steckten noch etliche Kugeln im Magazin. Er dachte noch einmal an Kutte.
»Gleich sehen wir uns wieder.«
Carlo Kolbatzki zögerte nun nicht mehr lange, sondern setzte sich die Pistole an die Schläfe und begann wie beim Start einer Weltraumrakete zu zählen.
»Zehn – neun – acht – sieben – sechs – fünf – vier – drei – zwei …«
Da brach er ab. Warum sollte er sterben und die, die ihn zum Opfer gemacht hatten, weiterleben? Das war höchst unlogisch. Er war zu intelligent, um die ganze Gesellschaft für sein Scheitern verantwortlich zu machen und sich ohne Ansehen der Person an ihr zu rächen, so wie es Amokläufer oder Selbstmordattentäter taten. Er wusste ganz genau, wer an seinem Elend schuld war und wer es verdient hatte, vorzeitig wie er auf dem Friedhof zu landen.
Also warf er seine Pistole aufs Bett und machte sich daran, eine Abschussliste zu schreiben. Nach einer Viertelstunde intensiven Nachdenkens hatte er acht Namen notiert, mit den Gründen für seine Rache:
Johann Sebastian Zabakuk, der Professor, der mich aus reiner Willkür hat durchfallen lassen.
Sören Möller, der Chef, der mich gefeuert hat, wodurch ich angefangen habe zu trinken.
Michael Kuhnert, der mich beim Fußball absichtlich so schwer verletzt hat, dass es mit meiner großen Karriere vorbei war.
Sandra Schwarz, meine Ex-Ehefrau, die mich verraten und mit meinem besten Freund betrogen hat.
Marcel Rackow, das ist dieser beste Freund.
Hansjürgen Mannhardt, der Kriminalbeamte, der mich hinter Gitter gebracht hat.
Bernhard Sandberg, der Hauswirt, der mich aus meiner Wohnung geworfen hat.
Christian Schloch, Pseudonym A. R. Schloch, der Kulturjournalist, der mich als Sänger und Comedian lächerlich gemacht und meine Karriere verhindert hat.
Er war nun, als er alles beschlossen hatte, so heiter und gelöst, dass er zum Heidelberger Platz lief, um sich am Kiosk unter der Autobahnbrücke einen Döner zu gönnen. Dabei überlegte er schon, wie er es am besten anstellen konnte, Professor Zabakuk zu erlegen. Er dachte es in der Jägersprache.
ZWEI
Johann Sebastian Zabakuk … Etwas kürzer: Johann S. Zabakuk. Er hasste seinen Nachnamen, denn der sorgte bei den einen für die Assoziation: »Ah, ein Syrer!«, und bei den anderen für: »Oh, einer vom Zirkus!« Dabei leitete er sich vom Dorfe Zabakuk her, das im Jerichower Land gelegen war und heute zur Stadt Jerichow gehörte. Schlimmer aber noch wäre es gewesen, wenn man Zabakuk aus dem Altslawischen übersetzt hätte, denn dann hätte »Froschesser« auf seinem Türschild gestanden. Das hatte ihm sein Großvater verraten, und seitdem vermied er alle grünen Kleidungsstücke. Trotzdem lag das mit dem Frosch wie ein Fluch über ihm. Seine Augen traten ein wenig unter den Brauen hervor. Klar: Froschaugen. Beim Gehen watschelte er ein wenig. Klar: wie bei einem Frosch. Und einen Froschbauch hatte er auch. Als sie ihm bei einer Schulaufführung angeboten hatten, den Froschkönig zu spielen, hatte er einen Tobsuchtsanfall bekommen. Auch das »Johann Sebastian« machte ihn nicht glücklich, denn schon immer hatte man gespottet: »Deine Eltern haben wohl die Elbe für einen Bach gehalten.« In der ersten Klasse hatten ihn alle Kuckuck genannt und bei seinem Anblick Vogellaute ausgestoßen oder Kuckucksuhr gespielt. Na, immerhin besser Kuckuck als Frosch. Gebildete Leute, sein Pfarrer etwa, hatten ihn ab und an auch Habakuk gerufen, denn das war einer der drei Heiligen Ärzte aus Persien.
In der DDR war Zabakuk gut über die Runden gekommen, da es sein Vater mit Hilfe der SED zu Amt und Würden gebracht hatte. Wie es in Betrieben zuging, hatte Zabakuk in Magdeburg im SKET gelernt, dem Schwermaschinenbau-Kombinat Ernst Thälmann. Um zu promovieren, war er nach der Wende nach Berlin gegangen, hatte eine Assistentenstelle an der Humboldt-Universität bekommen und nach diversen Veröffentlichungen und seiner Habilitation einen Lehrstuhl an der Freien Universität. Obwohl er weiß Gott kein Adonis war, hatte er die Frau fürs Leben gefunden, denn zum Glück liefen ja auch auf deren Seite nicht nur Topmodels à la Heidi Klum herum. Was ihn und Uta betraf, so hatten sie unter der Überschrift »Frosch sucht Fröschin« zueinandergefunden und, obwohl das ihre Freunde anatomisch für unmöglich hielten, zwei Kinder gezeugt. Sie wohnten in einem prächtigen Altbau in Friedenau, genauer gesagt in der Schwalbacher Straße.
Zabakuk wusste, dass ihn seine Studenten nicht liebten, und so war er immer auf der Suche nach Menschen, die das taten und die ihm dankten und ihm Respekt entgegenbrachten. Da waren ihm die Flüchtlinge gerade recht gekommen, die im alten Rathaus Wilmersdorf eine halbwegs annehmbare Unterkunft gefunden hatten. Seine Frau zählte zu der Schar ehrenamtlicher Helfer und Helferinnen, ohne die keine deutsche Gemeinde auskam, Berlin mit seiner kaputt gesparten Verwaltung schon lange nicht. Zabakuk hatte in etlichen Aufsätzen und Interviews die menschenunwürdigen Zustände vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin in Moabit kritisiert und dadurch endlich den Prominentenstatus erreicht, von dem er so lange Jahre vergeblich geträumt hatte. Auch jetzt wieder, als er seine Frau zur Flüchtlingsunterkunft gefahren hatte, kamen die Journalisten scharenweise mit Mikrofonen und Kameras auf ihn zu. Dies nicht vor dem Haupteingang des Rathauses am Fehrbelliner Platz, sondern etwas versteckt am Nebeneingang, der auf der Rückseite des Gebäudekomplexes in der Mansfelder Straße gelegen war.
»Herr Professor Zabakuk, haben Sie neue Ideen, wie man die vielen Flüchtlinge und Asylanten hier auf die ganze Stadt verteilen und sie damit besser integrieren kann?«
»Ja, man sollte alle Pegida-Aktivisten aus ihren Wohnungen holen und hier im Rathaus, in den vielen Traglufthallen in ganz Berlin oder in den Hangars des alten Flughafens Tempelhof unterbringen – und dafür Hunderte von Flüchtlingen und Asylanten in ihren leergemachten Wohnungen unterbringen.«
Zabakuk konnte sich sicher sein, dass ihm das hohe PR-Werte einbringen würde, und wenn der shitstorm des Hasses aller Rechtsradikalen über ihn hereinbrach, wurde er schnell zu einer Kultfigur der sogenannten Gutmenschen. Das schien sich nicht schlecht zu entwickeln, und bald würden die Macher der großen Talkshows bei ihm anrufen.
Derart beschwingt, setzte er sich in seinen Porsche, um vom Fehrbelliner Platz zur Garystraße 21 in Dahlem zu fahren, wo sie im Flachbau der alten WiSo-Fak den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft angesiedelt hatten. Das war, nahm man den Weg über Schmargendorf und die Pacelliallee, in einer Viertelstunde zu schaffen. Seinen angestammten Parkplatz aber hatte er für ein Semester einem Gastprofessor aus Stanford freundlicherweise überlassen, und so musste er ein wenig durch die Gegend kurven, um seinen Porsche schließlich in der Eppinger Straße abzustellen. Von dort führte ein Pfad zur Garystraße. Schon nach wenigen Minuten hatte er den grauen Flachbau mit seinen Hörsälen und Büros erreicht. Seine Sekretärin befand sich im Urlaub, sodass er zwar die Zeit einsparte, die für die nötige Konversation einzusetzen gewesen wäre, dafür aber selber den Computer hochfahren und nebenbei einige Briefumschläge aufschlitzen musste. Um nicht gestört zu werden, hatte er die Tür hinter sich wieder abgeschlossen. Ein paarmal wurde angeklopft, und er freute sich über diese Vorsichtsmaßnahme, denn er hatte weder Lust, mit IQ-80-Studenten zu plaudern, noch mit Kollegen, bei denen er eine paranoide Persönlichkeitsstörung diagnostiziert hatte, vor allem, was ihre Selbstüberschätzung betraf. Sein Kurzzeitwecker klingelte. Es war Zeit, in den Hörsaal zu eilen.
Während sich einige Kollegen als Wissenschafts-Entertainer verstanden und munter drauflos plauderten und andere nur Anhängsel an ihren Beamer waren, nahm Zabakuk eine Vorlesung noch als das, was sie vom Begriff her war, und las seinen Studierenden etwas vor. Studierende empfand er zwar als Unwort, aber nur Studenten für alle durfte man ja nicht mehr sagen, und Studenten und Studentinnen beziehungsweise StudentInnen war ihm zu umständlich oder einfach zu blöd.
Sein Thema hatte eine erstaunlich große Zahl von Studierenden angelockt. Oder vielleicht waren sie nur durch seine erhöhte Medienpräsenz auf ihn aufmerksam geworden, denn »Die bedeutendsten Vertreter der allgemeinen Betriebswirtschaftslehre im 20. Jahrhundert«riss ja eigentlich so keinen richtig vom Hocker.
»Meine Damen und Herren«, begann er. »Wir wollen heute über Eugen Schmalenbach reden. Auf die Welt gekommen ist er am 20. August 1873 in Halver-Schmalenbach als Sohn eines Kleineisenwarenfabrikanten, dessen Betrieb er auch übernahm, nachdem er in Velbert eine kaufmännische Lehre absolviert hatte. Obwohl er das Gymnasium ohne Abitur verlassen hatte, konnte er sich 1898 an der neu gegründeten Handelshochschule Leipzig immatrikulieren und reüssierte bald mit einer Arbeit über die damals völlig neue Deckungsbeitragsrechnung. Nachdem er die Handelshochschule mit der Note 1,0 abgeschlossen hatte, studierte er in Leipzig bei Karl Blücher Nationalökonomie und wurde später dessen Assistent. 1903 wurde er dann Dozent an der Handelshochschule Köln und habilitierte sich dort mit der Arbeit ›Die buchhaltungstechnische Darstellung der Betriebsgebarung‹. Lassen Sie mich darauf noch kurz eingehen …«
*
In der Sekunde, in der Zabakuk dies sagte, erblickte ihn Carlo Kolbatzki von der Freifläche aus, die sich zwischen dem Komplex der Wirtschaftswissenschaften in der Garystraße und den Gebäuden der Juristen und der ELSA-Berlin erstreckte. Man konnte ohne Mühe in die Hörsäle hineinsehen. Wo Zabakuk wohnte, das wusste Carlo Kolbatzki nicht, und ihn hier in Dahlem auf dem Freien Universitäts-Gelände aufzuspüren, war kein großes Kunststück gewesen. Darum sollte der BWL-Professor ja auch als Erster dran glauben, bei den anderen Kandidaten auf seiner Abschussliste würde er mehr Mühe haben. Carlo Kolbatzki ging weiter. Nur nicht auffallen! Dass er hier mit seinen 40 Jahren kaum mehr als Student durchging, war ihm schon klar, obwohl sich angeblich ja auch viele Senioren in den Hörsälen tummelten. Vielleicht nahm man ihn als Dozenten wahr. Er hatte sich extra einen dunklen Anzug aus einem schlecht gesicherten Altkleidercontainer beschafft. Hier in seiner alten Trainingshose und als Penner herumzulaufen, war ja schlecht möglich. So aber fiel er niemandem auf, keiner war in der Lage, der Mordkommission später wichtige Hinweise zu liefern. Sein Jackett war weit genug, die Walther PPQ samt Schalldämpfer darunter zu verbergen.
Sein Blick ging zu dem Raum hinauf, in dem die entscheidende Prüfung bei Professor Zabakuk stattgefunden hatte. Zwölf Jahre war es nun her, aber er hatte alles noch deutlich vor Augen …
Flashback II
Er hat nach 20 Minuten das sichere Gefühl, dass Professor Zabakuk wild entschlossen ist, ihn bei der Magister-Prüfung durchfallen zu lassen. Wie der Mann ihn ansieht! Das kann nur heißen, dass er ihn hasst. Vielleicht sieht er, Carlo Kolbatzki, einem Sohn zu ähnlich, mit dem Zabakuk seit Jahren gebrochen hat, vielleicht auch dem jugendlichen Lover seiner Frau.
Zabakuk fixiert ihn. »Kommen wir zur Leitungsspanne.«
»220 Volt.« Carlo Kolbatzki ist so durcheinander, dass er gedacht hat: Spannung in der Leitung. Er fährt zusammen. Da ist der Komiker mit ihm durchgegangen.
»Span of control«, wiederholt Zabakuk und wird richtig bissig. »We may also like to talk in English, if you prefer.«
»Nein, nein!« Carlo Kolbatzki reißt sich noch einmal zusammen. »Die Leitungsspanne ist die Anzahl der einer Führungskraft unmittelbar unterstellten Mitarbeiter, also, äh, wie viele Mitarbeiter … und Mitarbeiterinnen sich hierarchisch direkt unter einer Person befinden.« Er merkt, wie zweideutig das sein kann, und will sich sofort korrigieren. »Ich meine, nicht unter dem Chef liegen und … na ja, sondern sich seinen Anweisungen fügen müssen.«
Zabakuk wirft einen bösen Blick zu seinem Protokollführer hinüber, der grinst, weil er sich bildlich vorstellt, wie das angeht, wenn ein Chef gleichzeitig an die sieben Frauen penetrieren will, die unter ihm liegen. Carlo Kolbatzki bemerkt das und geht in seiner Not sofort darauf ein.
»Eine Leitungsspanne sollte nur so groß sein, dass der Chef nicht überfordert ist.«
Nun kann der Protokollführer, ein Assistent, der von einem anderen Lehrstuhl kommt und Zabakuk nicht sonderlich mag, nicht mehr an sich halten und prustet los. Damit verschlechtert sich Zabakuks Laune noch weiter.
»Sagen Sie, Herr Kolbatzki …«
Offensichtlich sucht Zabakuk nach einer Frage, bei der Carlo Kolbatzki unweigerlich sehr blass aussehen muss.
»… was würde passieren, wenn es in unseren Großorganisationen gar keine Hierarchie mehr gäbe?«
»Da … äh …«
»Ährenberg, genauer gesagt: Herbert Ehrenberg, hat damit nichts zu tun. Der war zwar 1976 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in der Regierung von Helmut Schmidt, hat sich aber um die Leitungsspanne nicht gekümmert.«
»Also …« Carlo Kolbatzki weiß keine rechte Antwort auf Zabakuks Frage und beginnt wiederzugeben, was er gelernt hat. »Wenn eine Leistungsspanne zu groß ist, so führt dies zur Überlastung des Vorgesetzten …«
»Ah ja!« Zabakuk grinst. »Gratuliere, Kolbatzki, Sie haben soeben einen neuen Begriff in unserer Wissenschaft kreiert: die Leistungsspanne. Die gab es bisher nur bei der Deutschen Jugendfeuerwehr.«
Carlo Kolbatzki bemüht sich, den Begriff »Leitungsspanne« zu vermeiden. »In der Erweiterung der Führungsspanne wird in vielen Firmen eine Möglichkeit zu Einsparungen gesehen.«
Zabakuk ringt die Hände. »Das habe ich Sie nicht gefragt! Ich habe Sie gefragt: Was würde passieren, wenn es in unseren Großorganisationen gar keine Hierarchie mehr gäbe?«
Die Antwort, die der Prüfer erwartet, ist so einfach, dass Carlo Kolbatzki sie nicht finden kann: »Na, dann könnte niemand mehr aufsteigen!«
Zabakuk wartet noch ein paar Sekunden, dann ruft er: »Schluss, aus!«
DREI
Dass er mit 49 Jahren einmal Erster Kriminalhauptkommissar (EKHK) sein würde, hatte sich Gunnar Schneeganß als Junge in seinen kühnsten Träumen nicht erhoffen können. Er kam aus einer total zerrütteten Familie. Sein Vater war Alkoholiker, andauernd arbeitslos und schlug, wenn ihn die große Wut überkam, auf alles ein, was in seiner Nähe war. Die Mutter hatte immer wieder in ein Frauenhaus flüchten müssen, mal mit, mal ohne das Kind, wenn ihn die Leute vom Jugendamt gerade in ein Heim gesteckt hatten. Zudem hatte es Schneeganß in seinem Schöneberger Kiez als Deutscher ungemein schwer gehabt, zu groß war die Dominanz von Klassenkameraden mit Migrationshintergrund. Aber er hatte es geschafft sich durchzuboxen und war nach Abschluss der Hauptschule von der Schutzpolizei genommen worden, denn sein IQ lag weit über dem Durchschnitt, seine Allgemeinbildung war besser als die vieler Abiturienten, und sportlich war er ein Ass. In allen seinen Stationen war er glänzend beurteilt worden, hatte sich von Besoldungsgruppe zu Besoldungsgruppe hochgearbeitet und sich durch seine Mitgliedschaft in der Polizeigewerkschaft und der SPD ein ansehnliches Netzwerk aufgebaut, sodass man ihn schließlich, nachdem er in der Abendschule das Abitur gemacht hatte, als Kommissarsanwärter zum Studium an die damalige Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege geschickt hatte. Nach drei Jahren hatte er es als Jahrgangsbester geschafft, war Beamter des gehobenen Dienstes geworden, bei der Kripo gelandet und langsam, aber sicher aufgestiegen.
Vor drei Jahren hatte er, eigentlich unfassbar für ihn, doch noch geheiratet. Silke passte zu ihm. Sie war Physiotherapeutin und hatte ihn behandelt, als man ihn beim Betriebssport durch einen Tritt gegen den Knöchel arg lädiert hatte. Sie hatte gerade ihre Scheidung hinter sich und ließ sich gerne trösten. Ihr Ex war in den tiefen Süden geflohen und hatte ihr ein kleines Grundstück mit einem Häuschen in der Krokusstraße in Rudow hinterlassen.
Dort im Keller hatte sich Schneeganß ein kleines Fitnessstudio eingerichtet, und zu dem gehörte auch eine nicht eben billige Steeldartscheibe aus Sisalfasern. Er trainierte in jeder freien Stunde und träumte davon, in dieser »Sportart« einmal so groß rauszukommen wie Phil Taylor. Kein Freund oder Verwandter, der ihn in Rudow besuchte, blieb von der Einladung zu einer Runde Darts verschont, so auch Huschel, sein Schwager, eigentlich Hubert Schel. Sein Spitzname war aber nicht nur aus der ersten Silbe seines Vornamens und seinem Nachnamen entstanden, sondern er lag auch darin begründet, dass er furchtbar verhuscht war. Einen Beruf hatte er nicht gelernt, sein täglich Brot verdiente er sich damit, dass er Hausflure und Treppenhäuser reinigte. Seine Allgemeinbildung wie auch seine Intelligenz hielten sich in engen Grenzen, er hielt sich aber dennoch für den Größten, weil er irgendwie »um x Ecken« mit dem Kunstmaler Sebastian Schel verwandt war (* um 1480; † 1554). Er selbst beglückte zu Weihnachten und zu Geburtstagen alle Freunde und Verwandten mit Gemälden aus der Schublade »Malen nach Zahlen«.
»Weißt du eigentlich, wo das Dartspiel erfunden worden ist?«, fragte Huschel, als sie die Kellertreppe hinuntergingen.
Schneeganß musste da nicht lange überlegen. »Na, in England.«
»Und wo genau?«
»Keine Ahnung …«
Huschel lachte überlegen. »Na, in Dartmoor, im Gefängnis. Als die Knackis Langeweile hatten.«
Schneeganß machte ein erstauntes Gesicht. »Ich dachte immer, das kommt von dart gleich Pfeil.«
»Denken und Wissen sind eben zweierlei, und arrow ist übrigens der Pfeil.«
Schneeganß musste bei Huschel immer an Helmut Schmidt denken. Bei dessen Ableben hatten verschiedene Zeitungen getitelt: »Jetzt erklärt er Gott die Welt«.
Sie spielten »Around the clock«, wobei ein Spieler, nacheinander im Uhrzeigersinn, beginnend bei der 1, alle Zahlen auf der Scheibe einmal treffen musste. Dabei war es egal, ob sein Pfeil in ein Single-, Double- oder Treble-Segment einschlug. Schneeganß hatte so oft geübt, dass er die Reihenfolge der Zahlen mit geschlossenen Augen fehlerfrei in Dreierblöcken aufsagen konnte: 1-18-4 || 13-6-10 || 15-2-17 || 3-19-7 || 16-8-11 || 14-9-12 || 5-20. Da jeder Spieler pro Runde drei Pfeile zur Verfügung hatte, konnte ein Könner in sieben Runden das Ziel erreicht haben. Bei Schneeganß im Keller brauchte man aber im Schnitt dreimal so lange, und Huschel hatte immer noch mit der 1 zu tun, als Schneeganß schon bei der 19 angelangt war.
Jetzt traf Huschel die 20, die ja links von der 1 gelegen war, und riss die Arme hoch. »Hurra, wer zuerst die 20 trifft, der ist Sieger, und das bin ich! Das ist wie bei dem Märchen vom Hasen und dem Igel: ›Ick bün al dor!‹«
Schneeganß drückte ihm die Hand. »Gratuliere.«
Huschel freute sich und erklärte ihm zum Dank dafür, warum der neue Berliner Flughafen, der BER, bestenfalls fünf Jahre später als geplant in Betrieb gehen konnte.
»Da stecken die Grünen dahinter, die sabotieren da alles, weil sie das Fliegen abschaffen wollen. Wegen der Luftverschmutzung.«
Mit Rücksicht auf seine Frau, die ihren komischen Bruder irgendwie liebte, verkniff sich Schneeganß jede Bemerkung und flehte das herbei, was er sonst immer verfluchte: einen Anruf vom Koordinator aller Berliner Mordkommissionen, dass er bitte zu einem Tatort eilen möge. Er spottete immer über alle, die an Psi-Phänomene glaubten, und war deshalb wie vom Schlag gerührt, als sein Handy Laut gab und der Kollege Koordinator ihn zu sprechen wünschte.
»Du, Gunnar, sofort rein ins Auto und ab nach Dahlem in die Eppinger Straße, da ist ganz offenbar ein Mann erschossen worden. Und hol die Jessica Schamp von zu Hause ab!«
»Okay!«
*
Für eine Kriminalbeamtin hatte Jessica Schamp ziemlich viel zu verbergen. Vor allem ihre ungewöhnliche hohe Allgemeinbildung und ihre wache Intelligenz, aber auch die Tatsache, dass sie lesbisch war. Wäre sie von Gunnar Schneeganß durchschaut worden, hätte es wieder einmal geheißen: »Gerissen!« Bei der wachen Öffentlichkeit heute wäre sie wohl nicht gemobbt worden, höchstens auf sehr subtile Art und Weise, aber es gab viele Möglichkeiten, sie bei anstehenden Beförderungen ganz legal zu übergehen. »Gerissen!« Dieses Urteil war sozusagen das Damoklesschwert, das über ihr schwebte. Mit 15 Jahren hatte sie mit dem Stabhochsprung begonnen, orientiert an der großen Jelena Issinbajewa, die drei Jahre älter war als sie. Als junge Himmelsstürmerin war sie angetreten, die Welt zu erobern. 2005 hatte sie deutsche Meisterin werden wollen, war aber schon an der Einstiegshöhe gescheitert. Dreimal gerissen. Diesen Schock hatte sie nie überwunden. Verletzungen waren dazugekommen, und so hatte sie schließlich aufgegeben. Mit einer Bestleistung von 4,35 Metern. Der deutsche Rekord von Silke Spiegelberg lag inzwischen bei 4,82 Meter. Doch Jessica hatte nicht nur auf die Karte Stabhochsprung gesetzt – mit anschließender Karriere als Fernsehreporterin und -moderatorin, sondern nach dem Abitur auch begonnen, Jura zu studieren. Immer so nebenbei und nach dem Prinzip des muddlingthrough, des Sich-Durchwurstelns. Nun, beim Jurastudium kam es nicht so sehr auf die Höhe des IQ an, sondern auf die Fähigkeit, stumpfsinnig seinen Stoff zu pauken, ohne dabei krank zu werden oder an Selbstmord zu denken. Und diese Gabe hatte ihr die Natur nicht mitgegeben, sodass sie beim ersten Staatsexamen gescheitert war. »Gerissen!« Ein Freund aus der Leichtathletikabteilung ihres Vereins hatte ihr geraten, sich um einen Studienplatz an der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) zu bewerben, und so hatte sie dort Kriminologie und Kriminalistik studiert. Diesmal war es ihr gelungen, jede geforderte Höhe zu überspringen. Pech allerdings, dass sie nach bestandenem Examen ausgerechnet Gunnar Schneeganß zugeteilt worden war. Der schien ihr von seiner politischen Einstellung her rechts von der CSU angesiedelt zu sein, jedenfalls sah sie ihn als leicht faschistoiden Macho, kurz: einen Mann von gestern. So war ihr Dienst nicht gerade eine ständige Freude. Aber sie hatte ja als Ausgleich noch ihren geliebten Stabhochsprung, wenn auch nur noch als Trainerin.
Ihr hoffnungsvollstes Talent war Mia Kissenbrück. Sie kam vom einfachen Hochsprung, war 21 Jahre alt und studierte an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Tourismus. »Mia, den Stab bitte auf der Seite halten, der deinem Absprungbein entgegengesetzt ist, also rechts, wenn du mit links abspringst. Wenn du den Stab vor dem Anlauf anhebst, dann musst du die rechte Hand so drehen, dass der Handrücken oben ist.«
Sie zeigte es Mia, und als sich dabei ihre Hände berührten, spürte sie das berühmte Kribbeln im Bauch. Mia war genau der Typ von Frau, auf den sie abfuhr. Bei Männern hätte man gesagt, sie entspräche voll und ganz ihrem Beuteschema. Aber durfte man sich als Trainerin auf eine Liebesbeziehung mit einer Sportlerin einlassen? Ja, warum nicht, da gab es einige Beispiele für. Aber ob Mia auch auf Frauen stand?
»Der Anlauf ist ein Steigerungslauf, nur musst du, anders, als du es gewohnt bist, immer daran denken, den Stab kontinuierlich so zu senken, dass er auf den letzten drei bis fünf Schritten vor dem Einstichkasten in Hüfthöhe in eine waagerechte Position kommt.«
Jessica Schamp konnte sich nur schwer konzentrieren, weil sie ununterbrochen darüber nachdachte, ob Mia sich nach dem Training zu einem kleinen Imbiss in eine Sushi-Bar einladen ließ.
»Alles kommt nun darauf an, dass bei der Abfolge Einstich-Absprung alles klappt, wobei …«
Weiter kam sie nicht, denn ihr iPhone gab Laut. Sie zog es aus der Tasche ihrer Trainingshose und meldete sich. Es war Gunnar Schneeganß. »Ein toter Mann in Dahlem«. So ein Mist!
»Ich bin hier auf dem Dominiscus-Sportplatz am Priesterweg beim Stabhochsprung!«
»Dann fahr nach Hause und zieh dich um. Ich bin in etwa 20 Minuten bei dir und hole dich ab. Das schaffst du dicke!«
Jessica Schamp blieb nichts anderes übrig, als dem Folge zu leisten, was ihr Vorgesetzter von ihr verlangte. Wie gern hätte sie Mia beim Abschied in die Arme genommen, doch nun musste sie es bei einem Händedruck belassen. Sie rannte zum Parkplatz. Vom Sportplatz bis zur Akazienstraße waren es nur knapp über zwei Kilometer, und die waren in etwa sieben Minuten zu schaffen, aber die Parkplatzsuche in ihrem angesagten Kiez konnte ewig dauern. Also ließ sie ihren Wagen stehen und rief sich eine Taxe.
*
Schneeganß bog in die Akazienstraße ein, sah Jessica Schamp am Straßenrand warten, hielt an und kurbelte das Fenster hinunter.
»Was kostet es heute bei dir?«
Sie lächelte verführerisch. »Mit oder ohne?«
»Ohne … Ich meine: ohne kugelsichere Weste, denn der Täter wird ja nicht auf uns gewartet haben, um sich nach einem heftigen Schusswechsel gefangen nehmen zu lassen.«
»Besonders, wenn es um einen Selbstmörder geht.« Jessica Schamp stieg ein und machte es sich auf dem Beifahrersitz bequem.
Schneeganß sah zu ihr hinüber. »Nun wird dein Schützling ohne Training die Latte schon bei drei Metern unterqueren.«
»Die Mia, ja …«
»Mamma mia!«