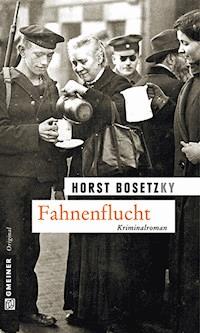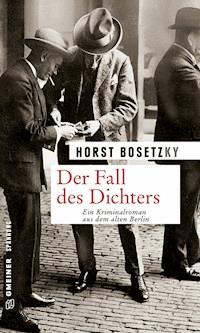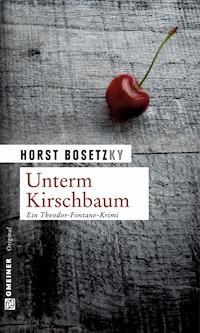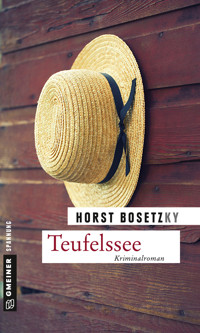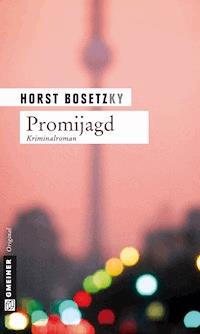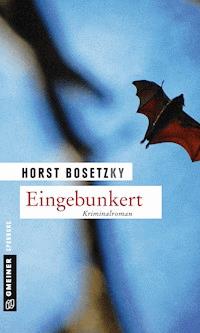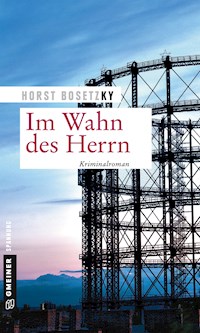Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Mannhardt und Schneeganß
- Sprache: Deutsch
In einer brennenden Villa im vornehmen Dahlem wird die Leiche von Sandra Roßwein entdeckt. Sie ist die Witwe des Inhabers einer deutsch-indischen Handelsfirma, der auf einer Indienreise ums Leben gekommen ist. Ihr Mann war vollkommen von der alten indischen Kultur besessen und legte in seinem Testament fest, seine Frau solle sich nach seinem Tode verbrennen lassen. Hat sie sich also tatsächlich selbst verbrannt oder hat jemand Roßweins letzten Willen vollstreckt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Witwen-
verbrennung
Kriminalroman
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Fahnenflucht (2013), Der Fall des Dichters (2012),
Nichts ist so fein gesponnen (2011), Promijagd (2010),
Unterm Kirschbaum (2009)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © tiefpics / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4606-1
Widmung
Gewidmet Kerstin, meiner Schwiegertochter, und Sascha, meinem Sohn, die beide Indologie studiert haben und denen ich herzlich für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und ihre wertvollen Hinweise und Ergänzungen danke.
EINS
»Nein!«, schrie Sunayani. »Ich will nicht sterben!«
Todesangst hatte sie erfasst. Sie saß auf einem Scheiterhaufen, der Kopf ihres toten Mannes war in ihren Schoß gebettet. Über beiden ragte eine Art hölzerne Hütte in den Himmel, deren Eingang man verbarrikadiert hatte. Sie hatte sich gegen sati entschieden, gegen die Witwenverbrennung, doch die Familie ihres Mannes hatte sie mit Rauschmitteln betäubt und zum Scheiterhaufen getragen. Ihr Schwiegervater und ihr minderjähriger Schwager hatten allen erzählt, dass Sunayani ihrem Mann freiwillig in den Tod folgen wolle.
Im indischen Bundesstaat Rajasthan, auf Hindi राजस्थान geschrieben, lebten an die 70 Millionen Menschen, davon allein drei Millionen in der Hauptstadt Jaipur. Knappe 80 Kilometer nördlich der Stadtgrenze lag ein Dorf, in dem die Zeit stehen geblieben war, und die 19-jährige Sunayani Gujral, eine junge Frau mit so reizenden Augen, wie sie ihr Vorname verhieß, war ihrem Mann nach der Heirat in dieses Dorf gefolgt. Maal Gujral war Lehrer gewesen und an einer Salmonellenvergiftung gestorben. Seine Leiche musste, so der religiöse Brauch, verbrannt werden.
Die Wirkung des Betäubungsmittels ließ weiter nach, und Sunayanis Schreie wurde immer lauter und immer verzweifelter.
»Ich will nicht mit ihm sterben!«
Die Dorfbewohner, die ausnahmslos zum Scheiterhaufen geeilt waren, überhörten es. Frauen, die sati begingen, genossen eine hohe Wertschätzung und wurden nahezu als Göttinnen verehrt.
»Endlich anzünden!«, kamen die Rufe aus der Menge.
Sunayani gelang es jetzt, die Zweige der Hütte über ihr auseinander zu drücken und sich aufzurichten, doch mehrere Männer, ihr Schwiegervater allen voran, brachten sie mit langen Bambusstäben wieder zu Fall.
Da hatte ihr Schwager den Scheiterhaufen auch schon angezündet, und in Rauch und Qualm hatte sie schnell das Bewusstsein verloren.
Unter Gesängen und religiösen Ritualen nahm die Verbrennung ihren Lauf.
»Jetzt reinigt sich ihr Geist«, verkündete der Schwiegervater. »Mein Sohn und sie werden so viele lange Jahre im Paradies verbringen dürfen, wie ich Körperhärchen habe. Und jetzt ist sie auch aus ihrem Frauenleib erlöst. Mag auch ihr Schmerz eben groß gewesen sein, umso größer ist nun ihr Glück als eine satimata, und vielleicht wird man sogar einen Tempel für sie bauen.«
*
Die Fernsehleute vom rrb waren zum Prager Platz gekommen, um in den Büroräumen der Firma Ganesha Indien Im- und Export einen Teil einesspecialsüber Indien zu drehen. Insbesondere über die Lage der indischen Frauen wurde im Augenblick heftig diskutiert. Gerade hatten fünf Männer in der Nähe des Taj Mahal eine Schweizer Touristin vergewaltigt. Genau vier Monate war es her, als am Abend des 16. Dezember eine indische Studentin und ihr Freund von mehreren Männern in einem Bus überfallen worden waren. Die junge Frau war mehrfach vergewaltigt und mit einer Eisenstange gefoltert worden. Zwei Wochen nach der brutalen Tat war sie ihren Verletzungen erlegen. Moritz Roßwein hatte mit E-Mails an die Rundfunk- und Fernsehanstalten und Leserbriefen an die Tageszeitungen lauthals gegen das verzerrte Indienbild protestiert, das man in Deutschland seiner Meinung nach derzeit zeichne. Nun sollte er das vor der Kamera präzisieren.
Die Journalistin, die das Gespräch mit ihm führen sollte, blickte auf den Spickzettel, den sie von der Redaktion bekommen hatte.
Moritz Roßwein
Geboren am 23. November 1970 in Berlin-Schöneberg
Aufgewachsen an der Retzdorffpromenade, Friedenau
Vater: Amtsrat im Bezirksamt Schöneberg
Mutter:???
Schule: Abitur 1989 am Rheingau-Gymnasium
Studium der BWL an der FU Berlin von1989-1992 und 1997 – 2001
Erste Indienreise als Student 1992, weitere sollten folgen
Zeit bei Hare Krishna (ISKCON – International Society for Krishna Consciousness) in Abentheuer (Hunsrück) 1994 – 1997
Arbeit bei Mittal Steel 2001 – 2006
Heirat Arzttochter Sandra 2003
Eigene Firma Ganesha Indien Im- und Export 2006, Firmensitz Prager Platz
Eigene Villa in der Furtwänglerstraße, Berlin-Grunewald
Über Roßweins Schreibtisch hing in Schrifttypen, die dem Sanskrit nachempfunden waren, ein Spruch des Erhabenen aus der Bhagavadgita, 3. Gesang:
Vollbringe die notwend’ge Tat, denn Tun ist besser als Nichttun.
Die Journalistin stellte Roßwein anhand ihres Notizzettels kurz vor, dann kam die Frage, um die es in ihrer Sendung primär ging.
»Sprechen wir über das Frauenbild in Indien …«
Roßwein lächelte. »Um das in seiner ganzen Komplexität und Widersprüchlichkeit auch nur zu skizzieren, bräuchten wir ein ganzes Semester. Um es auf den Punkt zu bringen: Alles ist möglich. Einerseits kann eine Frau eine starke Autorität ausstrahlen und extrem selbstbewusst sein, siehe Indira Gandhi, und indische Ministerpräsidentin werden, auf der anderen Seite des Kontinuums aber kann sie ihrem Manne in einem Maß unterwürfig sein, dass sie sich sogar, wenn er sich das gewünscht hat, nach seinem Tode zusammen mit seinem Leichnam verbrennen lässt. Nach dem Gesetz sind Frau und Männer in Indien völlig gleichgestellt, und wir haben nahezu unzählige Ministerinnen, Richterinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen und viele ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen, aber gleichzeitig gilt Indien als das frauenfeindlichste Land innerhalb der G 20-Staaten.«
»Und woran liegt das Ihrer Meinung nach?«
Roßwein überlegte lange, und seine Antwort kam sehr zögerlich. »Tja … viel hängt von der sozialen Schicht ab, und es geht auch um Karma und Wiedergeburt, aber ich will mal so sagen: Mädchen sind das ungeliebte Geschlecht. Jungen können selbst Geld verdienen, Mädchen aber kosten ihrer Familie nur. Häusliche Gewalt, sexuelle Belästigung und Vergewaltigungen gehören zu ihrem Alltag. Gehen sie zur Polizei, passiert zumeist gar nichts. Die Polizei ist zum Schutz der Reichen und der Politiker da, nicht zu ihrem. Das gilt vor allem für den indischen Norden. Wir denken immer, Indien sei total verwestlicht – ist es aber nicht. Vielerorts gilt noch immer das indische Kastensystem – und in dem heißt es: ›Als junges Mädchen gehört die Frau ihrem Vater, als Verheiratete ihrem Ehemann und als Witwe ihren Söhnen und Verwandten, denn eine Frau darf niemals unabhängig sein‹.«
»Trotzdem allem sagt man von Ihnen, Herr Roßwein, dass sie der indischen Welt, dem indischen Wertsystem geradezu verfallen sind …?«
Roßwein winkte lächelnd ab. »Nein, nein, das ist vorbei, heute bin ich ein ganz nüchterner Kaufmann, der sich mit Indien nur beschäftigt, um sein Geschäft am Laufen zu halten. Aber ich habe der intensiven Lektüre der Bhagavadgita viel zu verdanken. Nehmen Sie da die Worte des Erhabenen im 18. Gesang: Wo man ruht nach ernster Arbeit und an der Mühsal End’ gelangt, / Glück, das am Anfang Gift erscheint, am End’ dem Nektar ähnlich ist, / Ein solches Glück ist wahrhaft gut, durch Geistesheiterkeit erzeugt. Diese Geistesheiterkeit ist es, nach der ich strebe.«
Insgesamt drehten sie eine halbe Stunde, und hinterher war er so erschöpft, dass er sich erst einmal den Mantel anzog, um einige Male den Prager Platz zu umrunden und sich ein wenig zu erholen. Die Trautenau-, Prinzregenten-, Aschaffenburger-, Motz- und Prager Straße mündeten hier. Die Fahrbahn war mit rotem Granit gepflastert, und auf der Mittelinsel gab es Rasen, Blumenrabatten, Hecken und einen Brunnen mit hübscher Fontäne. Die war allerdings noch abgestellt, und in diesem bitterkalten März mit seinen Nachttemperaturen an die minus zehn Grad saß natürlich noch niemand auf den Bänken. Wie überall in Berlin waren die Straßen nur schlecht von Eis und Schnee geräumt. Es gab zwar Gesetze, aber deren Einhaltung zu überwachen, fehlte den Bezirken das Geld für ihre Ordnungsämter. Die Stadt sei arm, aber sexy, hatte der Regierende Bürgermeister verkündet, und seine Berliner übersetzten sexy mit schlampig und anarchistisch. Trautenaustraße, Ecke Bundesallee, verstauten die Fernsehleute ihr Equipment im Wagen. Ein Stadtführer hatte sich hierher ins Abseits verirrt und erzählte seiner Gruppe gerade von Erich Kästners Emil und die Detektive.
»Die Bundesallee war früher die Kaiserallee, und hier lässt Kästner seinen Helden aus der Straßenbahn steigen, der Linie 177, und den Mann verfolgen, der ihm im Eisenbahnabteil sein Geld gestohlen hat. Von hier ziehen die Kinder dann zum Nikolsburger Platz.«
Roßwein konnte sich nur noch dunkel an Emil Tischbein erinnern.
»Der Prager Platz ist im Krieg weithin zerstört worden«, fuhr der Stadtführer fort, »und war lange Zeit eine öde Freifläche. Erst im Juni 2002 ist seine Neubebauung mit der Eröffnung der ›Prager Passage‹ abgeschlossen worden. Sie finden hier 17 Gewerbeeinheiten und einen Fitnessklub. Die Kopfbauten an den Straßeneinmündungen fallen besonders ins Auge. In der Architektur nennt man dieses Stilmittel eine Eckbekrönung.«
Das hatte Roßwein auch noch nicht gewusst, und derart belehrt kehrte er nun in seine Eckbekrönung zurück. Elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte er. »Warum gerade elf? Weil jede indische Cricketmannschaft aus elf Spielern besteht.« Den Einwand, dass dies beim Fußball nicht anders sei, wischte er beiseite. »Cricket ist ein edles, Fußball ein proletarisches Spiel.« Um dann hinzuzufügen, dass die Inder schon eine einzigartige Hochkultur gehabt hätten, als die Germanen noch mit Speeren bewaffnet und in Felle gehüllt durch die Auen gelaufen seien und in Lehmhütten gehaust hätten.
Seine wichtigste Mitarbeiterin war Sabine Scharrach, seine Schwägerin. Sie meldete ihm, dass sein indischer Freund und Geschäftspartner Mangal Mukherjee soeben aus Bombay angerufen habe. Er möge sich doch bitte einmal melden.
»Aus Mumbai, ja, danke.«
Roßwein eilte ins Chefzimmer und wählte eine endlos lange Nummer. Mukherjee war sofort am Apparat.
»Hi, Moritz, I hope you are doing well and happy. In a few weeks you’re back again in India, and we have to discuss a few details.«
Die nächste Indienreise, ach ja …
*
»Es wird immer schlimmer. Ich verspüre jeden Tag den Drang, meine Handgranate abzuziehen und in einen Supermarkt zu werfen. Ich hasse alle Menschen, ich will sie vernichten!«
Der Therapeutin fiel es schwer, zu ihrem professionelles Lächeln zurückzufinden, denn die rechte Jacketttasche ihres Klienten war gefährlich ausgebeult.
»Was macht Sie so aggressiv?«, fragte sie schließlich.
»Die Antwort besteht aus einem Wort: Berlin.«
Die Therapeutin legte sich ihren Notizblock zurecht. »Das müssten Sie mir bitte einmal näher erklären …«
»Ja. Alles nervt hier. Die Autofahrer, die den grünen Pfeil als Freibrief sehen, mich abzuschießen. Die Radfahrer, die einen über den Haufen fahren – mitten auf dem Bürgersteig. Die alten Weiber mit ihren Hunden, die alles voll kacken und mir beim Laufen in die Waden beißen wollen. Die Trottel von Politiker, die den Flughafen nicht fertig gebaut kriegen, aber Hunderttausende kassieren und blöde Sprüche ablassen. Die Kulturfuzzis, die einen pausenlos mit ihrem intellektuellen Gewäsch auf die Nerven gehen. Die andauernd heftig bewegten Leute, die nichts mehr hinnehmen können und von einer Demo zur nächsten rennen. Die Art der Leute, überall zu drängeln – ohne Rücksicht auf Verluste. Keiner weicht mir höflich aus, wenn er mir auf dem Fußweg entgegenkommt, ich nach rechts, er nach links, nein, es gilt nur: freie Bahn für mich. Ich bin das Maß aller Dinge. Apropos: Bahn. Diese scheiß S-Bahn, bei der ich andauernd frierend auf dem Bahnsteig stehen und mir anhören muss: ›Wegen einer Weichenstörung am Bahnhof Ostkreuz verzögert sich die Ankunft des Zuges der S 41 auf unbestimmte Zeit‹. Und ist es keine Weichen-, dann ist es eine Signalstörung, der Ausfall eines Stellwerks, ein liegen gebliebener Zug, Personen am Gleis, der Einsatz eines Notarztes oder ein Kabeldiebstahl oder -brand. ›Wir bitten Sie um Ihr Verständnis!‹ Nein, ich habe kein Verständnis mehr. Diese Stadt macht mich kaputt – und was haben sie früher immer gerufen: ›Macht kaputt, was euch kaputtmacht!‹ Und darum habe ich meine Handgranate!«
*
»So, Belinda und Ann-Kathrin, dann legt mal los. Performance ist heutzutage nahezu alles. Also: Indien …«
Michael Saleske, von allen nur Mike genannt, ging nach hinten. Das tat er bei allen Referaten, die seine Schülerinnen und Schüler hielten, denn von dort aus hatte er alle im Blick und konnte nicht nur jede Unruhe unterbinden, sondern auch beurteilen, ob und wie es den Referentinnen gelang, die Klassenkameraden in ihren Bann zu schlagen. So kommunikativ die jungen Menschen auch waren und pausenlos twitterten, posteten und sich austauschten, das Zuhören im Klassenraum fiel ihnen zunehmend schwerer. Wer vorn vor Tafel oder White Board keine Show abzog und sich verhielt wie die Gleichaltrigen bei ›Deutschland sucht den Superstar‹, der hatte kaum eine Chance, den Beifall der Menge zu finden. Man wollte auch in der Schule gut unterhalten werden, bespaßt, wie das neuerdings genannt wurde. Ernsthaft zu sein, war uncool. So vermerkte er geradezu mit Schrecken, dass Belinda und Ann-Kathrin wissenschaftlich trocken begannen, das heißt, wiedergaben, was sie bei Wikipedia und sonst noch im Internet gefunden hatten.
»Indien ist eine parlamentarische Bundesrepublik, die von 28 Bundesstaaten gebildet wird. Die Hauptstadt ist Neu-Delhi, die Amtssprachen sind Hindi und Englisch. Indien bedeckt eine Fläche von 3.287.590 km² und hatte 2011 etwa über 1,2 Milliarden Einwohner unterschiedlichster Ethnien. Währung ist die Rupie. Indien grenzt an Pakistan, die chinesische autonome Region Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar und Bangladesch. Der Himalaja bildet die natürliche Grenze im Norden, im Süden umschließt der Indische Ozean das Staatsgebiet.«
Die ersten Klassenkameraden begannen, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, versuchten sich als Comic-Zeichner, schrieben Liebesbriefe, sahen aus dem Fenster, hoffend, hübsche Frauen beim Lüften oder Putzen zu entdecken, oder dösten einfach vor sich hin. Hätten sie Saleske nicht im Rücken gehabt, wären sie schon längst mit ihren iPhone zugange gewesen. Die beiden Schülerinnen vorn bemerkten natürlich, dass das Echo auf ihre Darbietungen immer geringer wurde, und reagierten zunehmend verunsichert. Saleske mochte die beiden und suchte ihnen zu Hilfe zu kommen.
»Goethe!«, rief er nach vorn.
Beide sahen ihn entgeistert an. »Wie …?«
»Faust, Mephisto: Ich bin des trocknen Tons nun satt … Erzählt doch mal was von der Witwenverbrennung …«
»Das kommt erst später.«
»Dann zieht es vor und bringt die anderen Fakten später.«
»Gut … Also …« Ann-Kathrin blätterte in ihren Unterlagen. »Wir reden nun über die Witwenverbrennung, indisch sati.«
Saleske ging erneut dazwischen. »Nicht sati wie Satire, sondern mit einem scharfen S vorne, mehr einem Z … wie … wie …« So schnell wollte ihm da nichts einfallen. »… wie Zatopek. Emil Zatopek. Legendärer Langstreckenläufer aus der CSSR, mehrfacher Olympiasieger.«
»Sex ist als Beispiel aber besser als Zatopek!«, rief einer der pubertierenden Knaben.
»Darüber zollten wir einmal einen Bezinnungsaufzatz schreiben«, schlug Saleske vor. »Wie auch immer: Mit einer kleinen sprachlichen Bezonderheit kann man heutzutage auf ein paar Aufmerkzamkeitzwerte mehr kommen als sein Konkurrent. Aber nun wirklich zur Witwenverbrennung.«
»Gibt’s auch eine Witwerverbrennung?«, kam es aus der letzten Reihe.
»Komm, Eddie, das ist hier keine Com-edy!«
Endlich konnten Belinda und Ann-Kathrin fortfahren. »Das Wort sati kommt aus dem Sanskrit und bedeutet die Frau, die den richtigen Weg geht. Frauen, die sati begingen, wurden in hohen Ehren gehalten. In früheren Zeiten ließen sich die Frauen im Krieg gefallener Fürsten mit den Leichnamen ihrer Männer verbrennen, um nicht den Feinden in die Hände zu fallen. Es war also ihre eigene Entscheidung, später aber wurde in einigen indischen Religionsgemeinschaften der Flammentod neben der Leiche des Mannes auch eingefordert und bei Widerstand erzwungen. Der älteste Sohn hatte den Scheiterhaufen zu entzünden. Wollte die Witwe fliehen, wurde sie mit Bambusstäben ins Feuer zurückgestoßen.«
»Mann, wenn wir das bei uns im Fernsehen hätten, gäbe das riesige Einschaltquoten!«, merkte Edmund an.
Diesmal ließen sich die beiden Referentinnen nicht beirren und kamen auf die Gründe der Witwenverbrennung zu sprechen. »Da sind zunächst die sozialen. Die Witwe genießt wenig Ansehen, ist rechtlos und vom ältesten Sohn abhängig. Da sieht manche den Tod als das kleinere Übel an. Am wichtigsten sind aber die religiösen Gründe. In Ratjasthan sind verbrannte Witwen, die satimatas, sogar als lokale Göttinnen verehrt worden. Die treue Hingabe zu ihrem Mann wird als hohes Ideal angesehen.«
Daran sollte sich später eine heftige Diskussion entzünden.
»Das ist doch die wahre und die größte Liebe, wenn ich nicht mehr weiterleben will, wenn mein Partner gestorben ist«, argumentierte Edmund. »Bis dass der Tod euch scheidet … Nein, nicht einmal der kann uns scheiden!«
»Verlangst du also von deiner Frau, dass sie sich verbrennen lässt, wenn du selbst das Zeitliche gesegnet hast?«, wollte Saleske wissen.
»Ja, eigentlich schon.«
»Sie ist doch nicht dein Eigentum!«, rief Ann-Kristin.
»Und umkehrt?«, fragte Bettina. »Würdest du dich auch verbrennen lassen, wenn sie …?«
Als Edmund mit einer Antwort zögerte, riefen seine Mitschülerinnen wie aus einem Munde: »Siehste!«
Saleske ergänzte die Ausführungen der beiden Mädchen dahingehend, dass Witwenverbrennungen und die Verehrung der satimatas im heutigen Indien natürlich per Gesetz verboten seien und als Morde angesehen würden, ihm sei aber noch ein Fall aus dem Jahre 2008 in Erinnerung.
Nach der letzten Stunde machte sich Saleske auf zu seinem Freund Moritz Roßwein. Freund war eigentlich ein viel zu schwacher Begriff. Blutsbrüder, wie sie Karl May mit Old Shatterhand und Winnetou geschaffen hatte, wäre schon passender gewesen, vielleicht auch siamesische Zwillinge. An sich hätten sie mit einer ›eingetragenen Lebensgemeinschaft‹ durchs Leben gehen müssen, aber beide waren sie in keiner Weise schwul, sondern ohne Wenn und Aber auf Frauen fixiert. Ihre Wege hatten sich im zarten Alter von drei Jahren in einer Kita in der Friedenauer Lefevrestraße zum ersten Mal gekreuzt. Da waren sie auf dem Weg zum Stuhlkreis zusammengestoßen und hatten sich aneinander geklammert, um nicht umzufallen. Das hatte sich vier Jahrzehnte hindurch nicht geändert. Sie waren gemeinsam in die Grundschule gegangen, hatten zusammen auf dem Rheingau-Gymnasium das Abitur gemacht und waren am selben Tag vom Indienfieber erfasst worden. Und wie Moritz Roßwein hatte Saleske einige Zeit im Hare-Krishna-Tempel in Abentheuer verbracht, ehe er seinen Eltern melden konnte, er habe sich selbst als »geheilt entlassen« und wolle nun ein Studium auf Lehramt beginnen. Das hatte er dann auch 2001 erfolgreich abgeschlossen und war nun an einem Wilmersdorfer Gymnasium als Fachlehrer für Deutsch, Geografie und Geschichte angestellt. Berlin verzichtete ja darauf, neue Lehrer zu verbeamten, was Saleske bei aller wissenschaftlichen Zurückhaltung nicht anders als »idiotisch« bezeichnen konnte.
Moritz und er hatten immer davon fantasiert, einmal Zwillingsschwestern zu heiraten, am besten eineiige, doch daraus war nichts geworden. Roßwein hatte mit seiner Sandra mehr Glück gehabt als er mit seiner Bettina. Sie waren seit zwei Jahren geschieden, und die beiden Kinder lebten bei der Mutter. Saleske schätzte sein Single-Dasein und konnte die Rolle des lonely wolfe auch prächtig ausfüllen, war aber dennoch ständig auf der Suche nach ›der Frau fürs Leben‹. Doch aus keinem seiner one-night-stands wollte sich etwas Ernsthaftes entwickeln. Eigentlich hätte er längst die berühmten Verbitterungsstörungen entwickeln müssen, doch dazu war er ein viel zu fröhlicher Mensch – und außerdem hatte er den Klassenraum als eine Bühne, auf der er sich jeden Tag voll entfalten konnte, und zum Klatschen und Tratschen und sonstigem kommunikativen Austausch ja seinen Freund Moritz Roßwein.
Zu dem strebte er nun, in der Umhängetasche drei DVDs, die ihm eine Kollegin geborgt hatte, die Verfilmung des Weltbestsellers Palast der Winde. Den Roman hatte er x-mal gelesen: Der junge Engländer Ashton wächst als Hindu auf und verliebt sich in die wunderschöne indische Prinzessin Anjuli. Die muss aber den Rana von Bhithor heiraten – und soll, als dieser stirbt, als seine Witwe verbrannt werden. Bis dann Ash …
Ein Radfahrer, der ihm auf dem Bürgersteig entgegenkam, zwang ihn, zur Seite zu springen. »Arschloch!«, rief er ihm hinterher, und hoffte, dass keiner seiner Schüler in der Nähe war.
Roßwein hatte seine Villa in der Furtwänglerstraße im Ortsteil Grunewald. Vornehmer ging es kaum. Saleske war zu sehr Linker und von der Devise ›Friede den Hütten, Krieg den Palästen!‹ erfüllt, als dass er gern in diese Gegend ›reiste‹. Seine geschiedene Frau hatte immer gemeint, der wahre Grund dafür sei recht eigentlich der Neid auf Roßwein, doch da irrte sie. Saleske war nun nicht gerade derart auf die Armut eingeschworen wie ein Franziskaner, brauchte aber wenig, nicht einmal ein Auto. Also musste er, wenn er den Freund besuchen wollte, die S-Bahn nehmen und in Halensee in den Bus X 10 umsteigen.
Als er auf dem Bahnhof Bundesplatz stand und auf die S-Bahn wartete, suchte er sich an die Schlussszene des Films zu erinnern. Vergeblich. Da geschah ein Wunder: Der Zug der S 41 kam pünktlich.
Auch der Mann neben ihm konnte es nicht fassen und reagierte damit, dass er die übliche Lautsprecherdurchsage imitierte. »Wir bitten Sie um Ihr Verständnis.«
»Nein, habe ich nicht!«, rief Saleske.
Er fand den Ausruf des Mannes so sophisticated, dass er ihn zu seinem Einfall am liebsten beglückwünscht hätte. Über ihre S-Bahn zu schimpfen und zu klagen, war den Berlinern in einem solchen Maße zur lieben Gewohnheit, ja zu einem echten Bedürfnis geworden, dass es gemein und herzlos war, ihnen das alles zu nehmen.
Der Zug kam, er stieg ein und stellte sich an die Tür gegenüber dem Einstieg. Er hatte nur drei Stationen zu fahren, und da lohnte es nicht, sich einen Sitzplatz zu suchen. Nun konnte das Abenteuer beginnen. Was hatte die große Bühne Berliner S-Bahn heute zu bieten? Einen Obdachlosen, der das Verslein seiner Not herunter leierte und ihm die ›Motz‹ verkaufen wollte? Einen Musiker, der an seiner Gitarre zupfte und einen selbst komponierten Song zum Besten gab? Ein rumänisches Kind, das ihm einen Zettel und einen Plastikbecher hinhielt? Handwerker mit Bierflaschen in der Hand, die sich anpflaumten? Mütter, die ihre Kinder verzogen? Lover und Heimkehrende, die ihrer Lebensgefährtin per Handy ihren derzeitigen Standort mitteilten? Das Gezwitscher von Teenies über die Supershows von Dieter Bohlen und Heidi Klum? Den abrupten Halt des Zuges wegen eines ›Notfalleinsatzes‹ oder ›einer Person am Gleis‹, wie es hinterher in den Durchsagen hieß, das heißt, wegen eines Selbstmordes?
Nichts von alledem gab es heute. Saleske nahm sich vor, an die S-Bahn zu schreiben. »Bei diesem Tatbestand verlange ich nicht nur mein Fahrgeld zurück, sondern dazu auch noch eine Entschädigung für entgangenes Entertainment.«
Halensee stieg er aus und lief so schnell zum Kurfürstendamm hinauf, als gelte es für den Treppenlauf zu trainieren, der alljährlich in einem Hochhaus in der Gropiusstadt ausgetragen wurde. Dennoch fuhr ihm sein Bus vor der Nase weg. Der Fahrer grinste noch höhnisch. Saleske bedauerte, keine Schusswaffe bei sich zu haben. Sofort hatte er die Stimme des Gurus im Ohr, den Roßwein und er in einem Dorf bei Karnal getroffen hatten: Geduld verlieren heißt, Würde verlieren. Das wollte er nicht, also machte er sich zu Fuß auf den Weg zu Roßwein. Überschlägig waren es zwei Kilometer, ein Klacks für einen Jogger und Marathonläufer wie ihn. Er überquerte den Trog der S-Bahn, lief die letzten 100 Meter Kudamm entlang, überquerte den Rathenauplatz mit der wunderbaren Skulptur Wolfs Vostells – zwei in Beton gegossene Cadillacs -, bog ein in die Hubertusallee und gelangte über die Bismarckallee in genau 22 Minuten ans Ziel.
Roßwein kam, kaum dass Saleske auf den Klingelknopf am kunstvoll gemauerten Tor gedrückt hatte, durch den Garten geeilt, um ihn zu begrüßen. Natürlich mit brüderlicher Umarmung. Dabei stießen sie mit den Köpfen so gegeneinander wie ansonsten nur Fußballer bei Flanken in den Strafraum.
»Eine Gehirnerschütterung ist immer etwas Schönes«, merkte Saleske an, während er sich den Wangenknochen massierte. »Weiß man doch nach der Diagnose ganz genau, dass man ein Gehirn besitzt.«
»Soll ich dich ins Martin-Luther-Krankenhaus bringen?«, fragte Roßwein. »Das ist hier gleich um die Ecke.«
Saleske überlegte kurz, ob er mit »Ah, du willst mich also um die Ecke bringen« reagieren sollte, aber das erschien ihm zu primitiv. Was dann? Schnell entschied er sich für ein Wortspiel. »Nein, bitte nicht ins Martin-Luser-King-Krankenhaus. Es ist schon blöd, dass die Amerikaner, nimmt man das th nicht so genau, unseren guten Martin Luther immer so aussprechen, als sei er der große Verlierer, der loser.«
»Vielleicht ist er das auch«, gab Roßwein zu bedenken. »Wo unser bayerischer Papst die Evangelischen nicht als Kirche gesehen hat, sondern irgendwie als spinnerte Sekte.«
Sie gingen ins Haus und setzten sich in die Bibliothek, wo man eine Leinwand von der Decke herabziehen konnte. Eine Flasche ›Sula‹, indischen Rotwein, weich und doch vollmundig, hatte Roßwein schon bereitgestellt. Während sie ihn tranken, schwelgten sie in Erinnerungen. An ihre Reisen durch Indien, an ihre Zeit im Hare-Krishna-Tempel in Abentheuer.
Roßwein nahm die Bhagavadgita zur Hand und zitierte Wort des Erhabenen aus dem 10. Gesang: »Ich bin der Ursprung des Alls, aus mir geht dieses All hervor … Ich bin die Seele dieser Welt, in aller Wesen Herz bin ich, / Ich bin der Anfang, Mitte ich und Ende auch der Wesen all. Ich bin die Zeit, die nie vergeht, bin der Schöpfer, der allhin schaut, / Ich bin der Tod, der alles raubt, der Ursprung des, was werden soll …«
Derart quasi-religiös eingestimmt legte Roßwein dann die erste DVD ein, und beide genossen Bilder und Szenen aus ihrem Indien.
Als Sandra Roßwein nach Hause kam, lästerte sie wie immer über die Indienleidenschaft der beiden Männer.
»Was seht ihr denn da?«
»Palast der Winde.«
»Aha. Spielt das auf der gastroenterologischen Station eines Krankenhauses?«
Ihr Mann, wenig erbaut über diese Störung, sah sie unwirsch an. »Wo?«
»Da, wo alle die behandelt werden, die was am Magen-Darm-Trakt haben, also auch die mit krankhaften Blähungen, Menschen, die ständig ihre Winde wehen lassen.«
Saleske lachte. »Das sind nun die Folgen, wenn einer einen Arzt zum Vater hat.«
Roßwein dagegen reagierte böse auf die Worte seiner Frau. »Pech für dich, dass wir uns nicht an das gehalten haben, was Jürgen Rüttgers mal gefordert hat: Kinder statt Inder.«
Das war ein Handkantenargument, das sie sofort verstummen ließ und aus dem Zimmer trieb, denn erst hatte sie keine Kinder bekommen wollen und dann keine bekommen können. Und was er mit seiner Bemerkung hatte ausdrücken wollen, lag auf der Hand: Wenn wir Kinder hätten, bräuchte ich mich nicht in alles Indische zu flüchten.
ZWEI
Es waren Schulferien in Berlin, und Silvio schlief noch. So konnten Mannhardt und die Gefährtin seines Lebens frühstücken, ohne unter den Launen ihres pubertierenden Knaben leiden zu müssen. Die Kommunikation war auch ohne ihn schon nervig genug.
Heike hatte die halbe Nacht über an einem Artikel gesessen, in dem es um die Asylanten ging, die nach Berlin gekommen waren, um gegen die Residenzpflicht, die fehlende Arbeitserlaubnis und ihre zu primitiven Unterkünfte zu protestieren. Nun kampierten sie in Kreuzberg auf dem Oranienplatz und zogen immer mal wieder ins Regierungsviertel, um sich dort lautstark bemerkbar zu machen.
»Die Heime sind Lager, sagen sie, und Lager sind Gefängnisse. Ich stehe voll auf ihrer Seite«, bekannte Heike.
»Ich auch«, gab Mannhardt zu Protokoll. »Und unser Nachbar, der alte Knoll, meint sogar, dass man ihnen Zimmer im Adlon reservieren sollte.«
»Das ist menschenverachtend!«, erregte sich Heike. »Und ich möchte nicht, dass du so etwas kolportierst.«
»Nein, natürlich nicht. Meinst du denn, ich will mich mit dem ZK der Gutmenschen anlegen?«
»Mit dir kann man überhaupt nicht mehr diskutieren«, hielt sie ihm vor.
Sie waren daran, sich wieder einmal in die Haare zu geraten, als anhaltend geklingelt wurde.
Mannhardt fluchte. »Bestimmt wieder einer, der uns seine bescheuerten Werbeflyer in die Briefkästen stecken will.«
»Lass ihn bitte rein, das sind doch alles nur arme Teufel, die sich ein paar Euro dazuverdienen müssen.«
Mannhardt erhob sich, ging zur Gegensprechanlage und gab sich so unfreundlich, wie es eben ging. »Ja, bitte …? Was gibt es?«
»Zum Essen, im Fernsehen oder in der großen Politik? Das müssen Sie schon etwas präziser formulieren, Herr Kommissar. Wohl lange keine Vernehmung mehr durchgeführt, wie?«
»Mensch, Orlando!«
Sein Enkel kam wieder einmal zu Besuch. Als er oben angekommen war, umarmten sie sich.
»Der Herr Jurastudent, sieh da! Mal wieder ’ne Vorlesung geschwänzt?«
»Oppa, es sind noch Semesterferien.«
Das Klingeln hatte auch Silvio hochschrecken lassen. Er kam aus seinem Zimmer, wischte sich den Schlaf aus den Augen und staunte, den Enkel seines Vaters im Korridor stehen zu sehen.
»Das ist Orlando«, verriet ihm Mannhardt.
»Lando – or what?«, fragte Silvio.
»Very correctly. My name is Joe Lando not Or Lando. I’m born in the year 1961 in Illinois and I’ve made me a name as an actor, see Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart. The voyage home.«
Orlando begrüßte Heike, dann setzten sich alle, um das Frühstück gemeinsam fortzusetzen.
»Es wird und wird nicht wärmer«, klagte Orlando.
Mannhardt erinnerte sich an ein Gedicht von Emanuel Geibel, das er vor gefühlten 100 Jahren in der Schule hatte lernen müssen: »Hoffnung. – Und dräut der Winter noch so sehr / Mit trotzigen Gebärden, / Und streut er Eis und Schnee umher, / Es muss d o c h Frühling werden.«
Orlando klatschte Beifall. »Da sieht man mal, was die Schule zu deiner Zeit alles vermocht hat.«
»Und damals hat noch keiner den General Winter gekannt«, stellte Mannhardt fest.
»Welchen General Winter?«, wollte Heike wissen.
»Na, den Russen. Der war es doch, der die deutschen Soldaten 1942 in Russland gestoppt hat.«
»Papa hat wieder vergessen, seine Medikamente zu nehmen«, warf Silvio ein.
Orlando berichtete davon, dass er Montagabend einen Freund in Alt-Tempelhof besucht hatte, um mit ihm ein Referat zu Ende zu bringen. »Und kurz nach 23 Uhr haben wir dann im Dunkeln gesessen.«
Mannhardt freute sich. »Eine Stromsperre zum Gedenken an die Berliner Blockade – eine prima Idee.«
»Denkste! Eine Ratte hatte in einer Netzstation ein Kabel angefressen und dabei einen Kurzschluss ausgelöst. Die war am Verhungern gewesen und ist dabei getötet worden.«
Mannhardt sah Silvio an. »Also: Wenn der Kühlschrank mal leer ist und du es vor Hunger nicht mehr aushalten kannst, dann bitte in kein Kabel beißen – das Plastikzeug macht nicht satt.«
»Wie witzig!« Silvio griff sich sein iPhone, um der öden Konversation mit den Alten zu entrinnen.
»Dieses scheiß Ding zertrete ich noch mal!«, rief Mannhardt.
Er hatte gehofft, mit zunehmendem Lebensalter gelassener zu werden, doch das genaue Gegenteil war eingetreten: Über alles und jedes konnte er sich fürchterlich aufregen. Beispielsweise über das info-Radio des rrb, das Heike gerade eingeschaltet hatte.
»Inhaltlich haben sie ausgezeichnete Beiträge, Hut ab, aber dann entwerten sie alles wieder durch Werbeeinblendungen, die an Schwachsinn nicht mehr zu überbieten sind. Und das auch noch als öffentlich-rechtliche Anstalt!«
»Oppa!«, rief Orlando. »Piano!«
»Wieso?«, fragte Silvio. »Papa kann doch gar nicht Klavier spielen …«
»In der Musiksprache bedeutet piano leise. Das Gegenteil ist forte gleich laut.«
Heike runzelte die Stirn. »Und warum sagt man für Klavier auch Pianoforte?«
»Wahrscheinlich, weil es beides kann.«
Mannhardt stöhnte auf. »Das ist ja, als hätte ich Deutschlandradio Kultur eingeschaltet.«
»Solltest du öfter mal tun, Oppa«, fand Orlando.
»Wohin fahren wir denn übermorgen mit dem Auto?«, wollte Silvio wissen.
Mannhardt verstand die Frage nicht. »Wieso …?«
»Na, weil übermorgen doch Carfreitag ist.«
Heike verdrehte die Augen. »Der Karfreitag – mit K vorne – kommt vom Althochdeutschen kara gleich Klage, Kummer, Trauer. Weil Jesus an diesem Tag am Kreuz gestorben ist.«
Das Wort kara löste bei Mannhardt aber ganz andere Assoziationen aus. »Da muss ich immer an Karl May denken, Durch die Wüste und so weiter: Kara ben Nemsi … Karl, Sohn der Deutschen.«
Silvio hatte noch kein einziges Karl-May-Buch gelesen und musste erst aufgeklärt werden.
Als das geschehen war, entbrannte eine heftige Diskussion darüber, ob man im Fall des Jungen nicht doch lieber zu seinem eigentlichen Taufnamen zurückkehren sollte, zu Silvester. Er hatte ihn erhalten, weil er zu Silvester gezeugt worden war, was aber Heike und Mannhardt nicht zugaben, sondern immer sagten, sie hätten ihn nach Papst Silvester I., einem Heiligen, genannt.
»Silvio geht wirklich nicht mehr«, sagte Mannhardt. »Alle denken doch da an Silvio Berlusconi, diesen unsäglichen italienischen Politclown.«
»Und damit nicht genug«, fügte Orlando hinzu. »Man muss nur genügend Fantasie besitzen … War nicht Heike zur fraglichen Zeit als Journalistin in Italien und hat mit Berlusconi gesprochen … Und wie man den kennt, da wird er doch sogleich …«
Heike zückte ihr Brötchenmesser. »Noch ein Wort, Orlando, und …!«
»Geil!«, rief Silvio. »Meine Mutter ersticht meinen Neffen! Da kommen wir endlich mal ins Fernsehen. ZDF-Drehscheibe, kurz nach zwölf.«
Mannhardt wechselte das Thema. »Wisst ihr, was wirklich grotesk ist: Da fahren doch elfmal am Tag leere S-Bahn-Züge zum stillgelegten Flughafen Berlin-Brandenburg, um den Tunnel zu entlüften. Das sind die sogenannten Entlüftungsfahrten.«
»So etwas brauchte die katholische Kirche auch«, fand Orlando.
Heike stand auf. »Jetzt wird’s mir doch zu sehr Stammtisch.«
»Eher Kabarett«, fand Orlando.
»Egal. Ich muss los, einkaufen. Heute um 17.30 Uhr soll ich auch noch in der Stierstraße sein.«
»Sind da Stierkämpfe?«, wollte Silvio wissen.
»Nein, da verlegen sie Stolpersteine.«
»Das ist doch gemein!«, rief der Junge.
Alle drei Erwachsenen erklärten ihm die Sache, und Mannhardt schlug vor, dass sie doch alle hingehen sollten. Das wurde dann einstimmig beschlossen. Vorher aber war der Programmpunkt Deutsches Technikmuseum abzuhaken, das hatten Mannhardt und Orlando dem Jungen versprochen.
»Wir fahren mit der U-Bahn«, verkündete Mannhardt.
Silvio maulte. »Lieber mit dem Auto!«
»Denkste, Carfreitag ist erst morgen.«
Mannhardt wohnte seit Jahren in einem der postmodernen Gebäude, die zwischen 1985 und 1988 im Rahmen der IBA auf dem Gelände des ehemaligen Tegeler Industriehafens entstanden waren. Ein Hafenbecken, das wie ein überdimensioniertes Planschbecken für Kleinkinder aussah, gab es immer noch, und hier ließen er und sein Sohn gern ihre ferngesteuerten Modellboote zu Wasser. Am östlichen Ufer erhob sich die Humboldt-Bibliothek, die an eine alte Fabrikhalle erinnerte, aber auch ein Neubau war. Hier gab es jedes Jahr im Herbst die Reinickendorfer Kriminacht, die Mannhardt aber nur selten besuchte. Sicher, er schätzte das Genre, glorifizierte und mystifizierte es ja seinen Berufsstand über alle Maßen, doch er hatte in seinem Leben zu viel true crime erlebt, als dass er sich an literarischen Ausformungen noch sonderlich erfreut hätte.
Sie liefen zum Bahnhof Alt-Tegel, und Silvio gab im Verteilergeschoss einen Laut von sich, der an einen Affenkäfig denken ließ.
»Uuuu …! Weil es doch die U-Bahn ist.«
Es gab einen kleinen Disput über den Weg zum Museum in der Trebbiner Straße.
»Mit der U 6 bis zum Leopoldplatz, dann mit der U 9 zum Zoo und von dort mit der U2 bis zum Gleisdreieck«, war Mannhardts Vorschlag.
»Ich will aber über Hallesches Tor fahren!«, rief Silvio. »Und von da mit der Hochbahn bis Gleisdreieck. Hochbahn ist cool, und im Tunnel sieht man nichts.«
Orlando hatte einen weitergehenden Vorschlag. »Ich fände es am besten, wenn wir mit dem Bus nach Kladow fahren, dann mit der BVG-Fähre nach Wannsee übersetzen, uns da in die S-Bahn setzen, bis Anhalter Bahnhof fahren und von da zum Museum laufen.«
Mannhardt sah ihn böse an. »Willst du uns verscheißern?«
»Nein, das ist doch ein schöner Tagesausflug.«
»Gut, fahren wir über Hallesches Tor«, sagte Mannhardt schließlich. »Wer nachgibt, hat mehr vom Leben.«
Mannhardt hatte seine Seniorenmonatskarte 65plus und Silvio eine Schülermonatskarte, nur Orlando musste an den Automaten treten und sich einen Fahrschein lösen.
»Du Armer«, sagte Silvio. »Mama hat mal einen Artikel geschrieben, wo jemand herausgefunden hat, dass am Touchscreen unzählige Viren und Bakterien kleben, Killerbakterien.«
»Danke für die Warnung!« Orlando zog seine Zunge wieder ein. »Ich wollte ihn gerade ablecken. Kann man denn auch mit dem Finger auf das tippen, was man haben will? Ich dachte immer, das geht nur mit der Zungenspitze.«
Mannhardt hatte schnell etwas gefunden, um sich wieder einmal aufzuregen.
»Jeder Mensch sagt Fahrschein, nur die BVG nennt das Ding Fahrausweis!«
Sein Sohn hatte die Lösung des Problems: »Papa, das ist ein Ticket.«
Der Fahrausweis wurde offenbar frisch gedruckt, und dieser Vorgang dauerte so lange, dass sie fast den Zug verpasst hätten. Endlich hatte ihn der Automat mitsamt dem Wechselgeld ausgespuckt.
Orlando riss ihn aus der Spendermulde und lief damit zum gelben Knipskasten. »Ich muss mein Ticket erst noch validieren.«
»Wie?«
»Na, steht doch hier drauf: Validate your ticket. To validate gleich für gültig erklären.« Es machte Pling. »So, eben war mein Ticket noch ungültig, jetzt darf ich damit fahren.«
Sie schafften es gerade noch, in den schon abgefertigten Zug zu springen. Da Alt-Tegel Endstation war, bekamen sie in einer der Buchten Plätze nebeneinander beziehungsweise gegenüber.
Vor ihnen war ein Mann in den Zug gestiegen, der sich sofort in der Mitte des Waggons aufbaute, um in der Manier eines Stadtführers den Fahrgästen die Welt zu erklären.