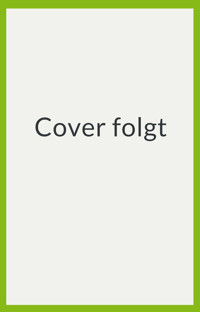8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclam Kompaktwissen XL
- Sprache: Deutsch
Das Oberstufenwissen im Fach Deutsch, praxisnah und anschaulich präsentiert. Folgende Module werden behandelt: Sprache und Kommunikation / Literarische Texte und Sachtexte analysieren / Epochen und Strömungen der deutschen Literatur / Klausuren schreiben: Strategien der Aufgabenlösung / Sprachliche Darstellung: Grammatik – Rechtschreibung – Stil Ein Glossar wichtiger Fachbegriffe rundet das kompakte Nachschlagewerk ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Yomb May
Abiturwissen Deutsch
Kompaktwissen XL
Reclam
2., verbesserte und erweiterte Ausgabe
Kompaktwissen XL | Nr. 15237
2018 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG,
Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH,
Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961338-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-015237-9
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
Modul I: Sprache und Sprachgebrauch
1 Was ist Sprache?
2 Sprache in Funktion: Kommunikationsmodelle
3 Sprache im Wandel
Modul II: Literarische Gattungen – Sachtexte – Lesestrategien
1 Lyrik
2 Epik
3 Dramatik
4 Sachtexte
5 Lesestrategien
Modul III: Grundzüge der deutschsprachigen Literaturgeschichte
1 Kurzübersicht: Epochen und Strömungen der deutschen Literatur
2 Barock (ca. 1600–1720)
2.1 Zeitgeschichtlicher Kontext
2.2 Leitgedanken
3 Aufklärung (ca. 1720–1785)
4 Sturm und Drang (ca. 1765–1789)
5 Klassik (ca. 1786–1805/32)
7 Biedermeier – Junges Deutschland / Vormärz (ca. 1815–1850)
8 Realismus (ca. 1848–1890)
9 Naturalismus (ca. 1880–1900)
10 Literatur der Jahrhundertwende (ca. 1890–1910)
11 Expressionismus (1910–1925)
12 Neue Sachlichkeit (1918–1933)
13 Nationalsozialismus – Innere Emigration – Exil (1933–1945)
14 Nachkriegsliteratur (1945–1949)
15 Literatur der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz (1949–1990)
16 Literatur der DDR (1949–1990)
17 Gegenwartsliteratur (ab 1990)
Modul IV: Rhetorik und Redeanalyse
1 Kurzübersicht: Redeformen
2 Rhetorische Strategien
3 Vorbereitung einer Rede – Techniken
4 Schriftliche Analyse einer Rede
5 Stilmittel und rhetorische Figuren (Auswahl)
Modul V: Filmisches Erzählen. Grundlagen der Filmanalyse
1 Montagetechniken
2 Die Kamera
3 Zeitgestaltung
4 Filmmusik und Filmgeräusche
5 Literaturverfilmung
6 Sequenzanalyse
Modul VI
1 Die schriftliche Prüfung
2 Die mündliche Prüfung
Modul VII: Wiederholungskurs: Grammatik, Rechtschreibung, Zeichensetzung
1 Grammatik
2 Rechtschreibung und Zeichensetzung
Weiterführende Literatur
Vorwort
Abiturwissen Deutsch hilft Schülerinnen und Schülern bei der Vorbereitung auf Klausuren und die Abiturprüfung im Fach Deutsch.
Die bundesweiten Bildungsstandards für die allgemeine Hochschulreife erfordern nicht nur ein gut geplantes und straff organisiertes Lernen in der Oberstufe, sondern auch umfangreiches und strukturiertes Wissen.
Das vorliegende Buch bietet in komprimierter und übersichtlicher Form das Prüfungswissen an, das im Laufe der Ober- bzw. Kursstufenzeit, meist verstreut über die Jahre und über verschiedene Schulbücher hinweg, vermittelt wird. Es bündelt und strukturiert dieses Wissen, so dass es schnell aufzufinden ist.
Durch die modularisierte und kompakte Darstellung tritt das Prüfungswissen in diesem Buch deutlicher hervor, als es in den Lehrbüchern geschehen kann. Die einzelnen Module konzentrieren sich auf Wissensgebiete, Gegenstände und Themen, die in den Richtlinien und Lehrplänen zentral sind. Damit lassen sich alle abiturrelevanten Stoffgebiete rasch wiederholen und vertiefen.
Darüber hinaus hat dieses Buch den Anspruch, Schülerinnen und Schülern eine praktische Orientierungshilfe für den kompetenten Umgang mit Texten an die Hand zu geben. Neben bewährten Methoden und Arbeitstechniken zur Lösung der häufigsten Abituraufgaben bietet es daher zahlreiche Formulierungshilfen und Tipps, die zu einer guten sprachlichen Darstellungsleistung bei Klausuren führen.
Das Register am Ende des Buches hilft, schnell die richtigen Seiten zu einem prüfungsrelevanten Themengebiet zu finden. Auf diese Weise fällt die Vorbereitung auf die Abiturprüfung leichter, kann gezielter ablaufen und daher Zeit sparen.
Autor und Verlag wünschen Ihnen viel Erfolg!
Modul I
Sprache und Sprachgebrauch
1 Was ist Sprache?
1.1 Unterschiedliche Erklärungsansätze
Es gibt zahlreiche Ansätze, die sich mit dieser Frage befassen. Ihre Antworten fallen unterschiedlich aus. Das liegt vor allem daran, dass menschliche Sprache verschiedene Eigenschaften aufweist. Einige davon sind:
Sprache ist anthropologisch fundiert;
sie beschreibt den Kontext zwischen Menschen und der Welt;
sie beruht auf Sinneswahrnehmung;
sie unterliegt der kulturellen Evolution;
sie trägt zur kulturellen Identität einer Gruppe bei;
sie ist anfällig für Manipulationen.
Einzelne Sprachen lassen sich bestimmten Sprachfamilien zuordnen (z. B. indoeuropäische Sprachen, Turksprachen). Sprachfamilien werden durch umfassende lexikalische (den Wortschatz betreffende) und morphologische (die Struktur der Wörter betreffende) Vergleiche zwischen Sprachen eines Gebietes oder eines Kontinents ermittelt.
1.2 Die Ebenen der Sprache
Die wissenschaftliche Beschreibung und Untersuchung von Sprache fällt in den Zuständigkeitsbereich der Sprachwissenschaft. Allerdings ist der Untersuchungsgegenstand ›Sprache‹ sehr komplex. Denn Sprache lässt sich auf verschiedenen Ebenen betrachten. Daher gibt es unterschiedliche Teilgebiete der Sprachwissenschaft. Folgende Sprachebenen und die jeweils zugordneten Teildisziplinen lassen sich unterscheiden:
1.3 Sprachursprung und Spracherwerb
Seit der Antike beschäftigt sich die Wissenschaft mit der Frage nach der Entstehung der Sprache in der Geschichte der Menschheit. Mittlerweile ist bewiesen, dass sich der bereits vor 400 000 Jahren lebende Neandertaler der Sprache bedient hat. Aber wie kam der Mensch überhaupt zur Sprache? Über diese Frage gibt es zahlreiche, zum Teil einander widersprechende Meinungen und Theorien.
Sprachursprungstheorie von Johann Gottfried Herder
Als Antwort auf die Preisfrage der Berliner Akademie der Wissenschaften nach dem Wesen der menschlichen Sprache verfasst Johann Gottfried Herder (1744–1803) seine Abhandlung über den Ursprung der Sprache (1772). Darin formuliert er die These, dass sich Sprache auf natürliche Weise entwickelt habe. Beim Vergleich von Mensch und Tier gelangt er zu der Erkenntnis, dass auch Tiere mit ihren verschiedenen Lauten über eine Art Sprache verfügen, womit sie ihre Empfindungen unmittelbar ausdrücken können. Nach Herder grenzt sich der Mensch vom Tier wesentlich dadurch ab, dass er über Vernunft und Besonnenheit verfügt und somit der Reflexion fähig ist, während Tiere nur instinktgeleitet seien. Vernunft und Sprache befinden sich Herder zufolge in einer Wechselbeziehung zueinander. Die Vernunft habe die Entwicklung der menschlichen Sprache erst ermöglicht und die Sprache wiederum zur Weiterentwicklung der Vernunft beigetragen. Herder betrachtet die menschliche Sprache als Ergebnis der Nachahmung von Tönen aus der Natur und ihrer Weiterentwicklung durch die Reflexion. Sprache sei daher nicht durch Zufall entstanden, sondern sie liege in der Natur des Menschen.
Spracherwerbstheorien
Als Ontogenese bezeichnet man die Entwicklung eines Phänomens, hier: der Sprache, im Individuum. Ontogenetische Ansätze beobachten also den individuellen Erwerb der Sprache und deren Entwicklung beim einzelnen Kind. Demnach sind die einzelnen Phasen der individuellen Sprachentwicklung mit dem vierten oder fünften Lebensjahr abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt beherrscht das Kind, dessen Sprachvermögen sich von einfachen Lauten bis hin zu komplexen Sätzen entwickelt, schließlich die wesentlichen Elemente des Sprachsystems, in dem es sozialisiert wird. Man unterscheidet folgende Spracherwerbstheorien:
Behavioristische Theorie: Der von den amerikanischen Psychologen John B. Watson und B. F. Skinner (Verbal Behavior, 1957) vertretene Ansatz postuliert, dass das Sprechen des Kindes ein konditioniertes Verhalten darstellt, das dem Reiz-Reaktions-Schema folgt. Das bedeutet: Kinder lernen eine Sprache, weil sie die Sprache der Eltern bzw. Erwachsenen imitieren. Mit anderen Worten: Kinder eignen sich Sprache durch die Aufnahme der Sprachinformationen ihrer akustischen Umwelt an. Die kindliche Sprache wird durch die Reaktionen der Umwelt geprägt und ist folglich die Summe einzelner konditionierter Sprechgewohnheiten.
Kognitivistische Theorie: Für den Schweizer Entwicklungspsychologen Jean Piaget (Le language et la pensée chez l’enfant, 1923, dt. Sprechen und Denken beim Kinde, 1972) gibt es eine Verknüpfung zwischen Sprache und Denken. Ihm zufolge bildet das sinnliche Erfahren der Umwelt die Basis für die sprachliche und kognitive bzw. intellektuelle Entwicklung. Je ausgeprägter das Sprachvermögen, umso besser die Fähigkeit zu abstraktem Denken.
Interaktionistische Theorie: Der amerikanische Psychologe Jerome S. Bruner (Child’s Talk. Learning to use language, 1975) vertritt die Theorie, dass Sprache durch Interaktion angeeignet wird. Das bedeutet, dass sich der individuelle Spracherwerbsprozess des Kindes durch seinen handelnden Umgang mit seinen primären Bezugspersonen, in der Regel seinen Eltern, entwickelt. Später überträgt das Kind das Gelernte schließlich auf andere soziale Situationen.
Nativistische Theorie: Der amerikanische Linguist Noam Chomsky kritisiert in seinen Aspects of the Theorie of Syntax (1965) den Behaviorismus. Ihm zufolge kann mit dieser Theorie die Vielfältigkeit und Kreativität der Sprache nicht erklärt werden. Nach Chomsky sind die spezifischen syntaktischen Regeln der Muttersprache so komplex, dass Kinder sie nur durch eine angeborene, d. h. genetische Ausstattung erwerben. Die Umwelt liefert dabei nur Gelegenheiten, die Sprache zu sprechen. Spracherwerb ist daher in erster Linie eine sprachspezifische Fähigkeit, die Kinder von Geburt an besitzen und die es ihnen ermöglicht, Regeln aus der gehörten Sprache abzuleiten.
Konstruktivistische Theorie: Für die Vertreter dieses Erklärungsmodells erfolgt der Spracherwerb aus dem Zusammenspiel von genetischen Anlagen und der Interaktion mit der Umwelt. Demnach konstruieren Kinder beispielsweise grammatische Strukturen aufgrund ihrer allgemeinen Lernfähigkeit aus der Sprache, die sie in ihrem Umfeld hören.
Phasen des Spracherwerbs
Nach heutigem Kenntnistand vollzieht sich der Spracherwerbsprozess des Kindes in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen. Dabei hängt der Entwicklungsstand des Sprachvermögens mit der Altersstufe des Kindes zusammen:
1.4 Sprache – Denken – Wirklichkeit
Positionen zum Verhältnis von Sprache und Denken
Die Beziehung von Sprache, Denken und Wirklichkeit stellt ein Problemfeld dar, das seit der Antike zum Nachdenken herausfordert. Im Mittepunkt stehen dabei die Fragen, ob Sprache und Denken eine Einheit bilden oder getrennt voneinander zu betrachten sind und ob es ein Denken ohne Sprache gibt. Bis heute haben sich dazu zwei grundsätzliche Positionen herausgebildet:
Bis Ende des 19. Jahrhunderts herrscht die Ansicht vor, dass Sprache und Denken eine völlige Identität bilden. Diese Ansicht geht auf den griechischen Philosophen Platon (427–347) zurück. Denken ist für Platon eine lautlose Form des Sprechens. Noch der Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889–1951) greift die von Platon angenommene gegenseitige Abhängigkeit von Sprache und Denken auf und drückt sie so aus: »Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt«. Das bedeutet so viel wie: Der Mensch kann nicht außerhalb seiner Sprache denken.
Im 20. Jahrhundert entwickelt sich unter dem Einfluss von sprachpsychologischen Forschungen eine andere Position: Danach bilden Denken und Sprache zwar eine sogenannte Funktionssymbiose, d. h., sie sind aufeinander bezogen und voneinander abhängig, aber sie bilden keine Einheit, da es intuitives Sprechen ohne bewussten Denkakt ebenso geben kann wie Bereiche des abstrakten Denkens (z. B. in der Mathematik), die sprachlich nicht mehr formuliert werden können.
Beide Positionen legen den Schluss nahe, dass sich das Verhältnis von Sprache und Denken kaum objektiv erfassen lässt. Eine weitere Schwierigkeit liegt darin, dass sich Sprache und Denken begrifflich nur schwer voneinander trennen lassen.
Sprache als Weltansicht (Wilhelm von Humboldt)
Der Universalgelehrte und Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt (1767–1835) stellt in seiner Abhandlung Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts (1836) die These auf, dass Sprache »die äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker« sei. »Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache. Man kann sich beide nie identisch genug denken.« Humboldt vertritt die Ansicht, dass sich die Verschiedenheit der Weltansichten verschiedener Völker aus der Verschiedenheit ihrer Sprachen ableiten lasse. Jeder Sprache, so Humboldt, liege »eine eigentümliche Weltansicht« zugrunde. Das Erlernen einer Fremdsprache sieht er daher als Erwerb eines neuen Standpunkts jenseits der bisherigen Weltansicht an.
Was das Verhältnis von Sprache und Denken anbetrifft, so vertritt Humboldt die Ansicht, dass Denken ohne Sprache nicht möglich ist. Sprache ist für ihn »das bildende Organ des Gedankens«. Dabei unterscheidet er zwischen Ergon (griech. érgon ›Werk‹), d. h. dem Zeichensystem, dessen der Mensch sich bedient, um zu kommunizieren (der Sprache an sich), und Energeia (griech. enérgeia ›Tätigkeit‹), d. h. der geistig produktiven Tätigkeit des Menschen (dem Geist an sich). Humboldt versteht Sprache als die »sich wiederholende Arbeit des Geistes, den artikulierten Laut zum Ausdruck des Gedankens fähig zu machen.« Die Schlüsselfunktion von Sprache bringt er mit den Worten zum Ausdruck: »Der Mensch ist nur Mensch durch Sprache.«
Die Sapir-Whorf-Hypothese
Auf den amerikanischen Anthropologen Benjamin Lee Whorf (1897–1941) und seinen Lehrer Edward Sapir (1884–1939) geht die sogenannte Sapir-Whorf-Hypothese (auch »linguistisches Relativitätsprinzip« genannt) zurück. Sie vergleichen die Sprache der nordamerikanischen Hopi-Indianer mit den europäischen Sprachen, da sich die Sprache der Indianer getrennt von diesen entwickeln konnte. Aus den Ergebnissen ihres Vergleichs leitet sich die nach ihnen benannte Hypothese ab. Diese hat zum Inhalt, dass die Art und Weise, wie die Menschen denken, durch das linguistische System, d. h. durch die Grammatik und den Wortschatz ihrer Muttersprache beeinflusst oder bestimmt wird. Die Sapir-Whorf-Hypothese setzt sich aus zwei wichtigen Thesen zusammen:
Prinzip der sprachlichen Relativität: Was wir erkennen und denken können, ist relativ, d. h., die Wahrnehmung der Wirklichkeit ist vom Sprachsystem (Wortschatz und Grammatik) der jeweiligen Sprache abhängig. Demnach erfassen unterschiedliche Sprachgemeinschaften die außersprachliche Wirklichkeit auch unterschiedlich.
Prinzip des sprachlichen Determinismus: Menschen denken nur das, was sie in ihrer Sprache ausdrücken können. Das bedeutet: Die Grammatik einer Sprache ist nicht nur dazu da, um Gedanken zum Ausdruck zu bringen. Sie determiniert das Denken und die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Demnach vollzieht sich das Formulieren von Gedanken nicht unabhängig von der Sprache, sondern diese Tätigkeit unterliegt dem Einfluss des linguistischen Systems der jeweiligen Sprache. Verfügt eine Sprache beispielsweise nicht über den Konjunktiv oder über das Passiv, wird das Vorstellungsvermögen in diesem Bereich eingeschränkt.
Diese Gedanken finden wir bereits bei Humboldt (vgl. S. 18 f.) vorgebildet. Geht man von der These des linguistischen Determinismus aus, so folgt daraus, dass fremdsprachliche Texte prinzipiell nicht übersetzbar sind. Bis heute ist die Sapir-Whorf-Hypothese unter Fachleuten umstritten.
Die Sprachphilosophie Jean Piagets
Der Entwicklungspsychologe Jean Piaget (1896–1980) hat eine weitere wichtige Strömung der Sprachphilosophie geprägt. Ausgehend vom Spracherwerb bei Kleinkindern (vgl. S. 16 f.) stellt Piaget die These auf, dass das Denken des Kindes der Sprache vorausgehe. Er kommt folgerichtig zu dem Schluss, dass Denken unabhängig von Sprache sei. Piaget ist der Meinung, dass sich logische Strukturen des Denkens bei Kindern erkennen lassen, lange bevor sie zu sprechen beginnen.
Bestätigt wird diese These von dem britischen Soziologen Basil Bernstein (1924–2000). Dieser hat nachgewiesen, dass Kinder aus der Unterschicht mit einem eingeschränkten Muster sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten, also einem restringierten Code, aufwachsen. Kinder aus der Mittelschicht dagegen wachsen nach Bernstein mit vielfältigen sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, also einem elaborierten Code, auf.
Der linguistische Universalismus
Dem amerikanischen Sprachwissenschaftler Noam Chomsky (geb. 1928) zufolge verfügt der Mensch über einen angeborenen universellen Mechanismus für den Spracherwerb und die Sprach- verwendung (vgl. S. 15). Die Verschiedenheit der Sprachen sei demnach nur ein Oberflächenphänomen. Allen Sprachen gemeinsam sei eine tiefenstrukturelle Universalgrammatik. Damit meint Chomsky ein angeborenes Inventar allgemeiner Prinzipien der Sprachstruktur. Der Begriff »Universalgrammatik« stellt eine Weiterentwicklung des von Chomsky geprägten Konzepts des Language Acquisition Device (LAD) dar. Damit ist ein angeborener Spracherwerbsmechanismus gemeint. Chomskys Annahme wurde in den 1990er Jahren von dem amerikanischen Psychologen Steven Pinker (geb. 1954) bestätigt. In seinem Buch The Language Instinct (1994, dt. Der Sprachinstinkt. Wie der Geist die Sprache bildet, 1996) vertritt Pinker die These, dass unsere Gedanken in eine wortlose Gedankensprache (er nennt sie »Mentalesisch«) eingekleidet seien. Er postuliert, dass diese Gedankensprache bei allen Menschen identisch sei.
1.5 Sprache als System von Zeichen
Das Zeichenmodell von Ferdinand de Saussure
Wie hängen Worte und ihre Inhalte zusammen? Eine Antwort auf diese Frage formuliert der Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure (1857–1913) zu Beginn des 20. Jahrhunderts. In seiner Theorie des sprachlichen Zeichens (Cours de linguistique générale, 1916; dt.: Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft, 1931) definiert er das sprachliche Zeichen als eine Verbindung aus dem Lautbild (Ausdruck) und der Vorstellung von dem Gegenstand (Inhalt):
Abb. 1: Lautbild und Vorstellung
Mit dem Lautbild »Baum« (vgl. S. 23) wird der Gegenstand ins Bewusstsein gehoben; umgekehrt holt die Wahrnehmung des Gegenstands das Lautbild hervor. Demnach sind Vorstellung und Lautbild eng miteinander verbunden und entsprechen einander. Allerdings resultiert die Zuordnung einer Vorstellung zum Lautbild und umgekehrt nicht aus logischen Erwägungen. De Saussure schreibt dem sprachlichen Zeichen zwei wesentliche Eigenschaften zu:
Arbitrarität (Beliebigkeit): Die Verbindung zwischen Inhalt und Ausdruck ist völlig willkürlich, denn es gibt keinen natürlichen Zusammenhang zwischen dem Lautbild des Zeichens und dessen Inhalt.
Konventionalität: Die Zuordnung von Vorstellung und Lautbild wird innerhalb einer bestimmten Sprachgemeinschaft festgelegt. Daher können Bezeichnungen nicht beliebig durch andere ersetzt werden.
Abb. 2: Vergleich Lautbild und Vorstellung: »Baum« – »tree«
Nach de Saussure ist das Bezeichnende das Lautbild, d. h. die äußere Form eines sprachlichen Zeichens, während das Bezeichnete die Vorstellung dieses sprachlichen Zeichens ist, also der Zeicheninhalt. So erklärt er, dass es in verschiedenen Sprachen verschiedene Bezeichnungen für ein und dasselbe Bezeichnete gibt (»arbre« – »Baum« – »tree«).
Das semiotische Dreieck von Ogden und Richards
Das semiotische Dreieck ist ein dreiseitiges Zeichenmodell. Es wurde von Charles Kay Ogden (1889–1957) und Ivor Armstrong Richards (1893–1979) entwickelt. Grundthese dieses Modells ist, dass zwischen dem sprachlichen Ausdruck und dem durch ihn bezeichneten Sachverhalt in der Realität keine unmittelbare Relation besteht. Sprachliche Ausdrücke verweisen nur über ihr Konzept auf eine außersprachliche Wirklichkeit.
Abb. 3: Das semiotische Dreieck
Das sprachliche Zeichen (symbol) ruft einen entsprechenden Bewusstseinsinhalt (reference) hervor, der sich auf das Objekt (referent) bezieht. Die grau gestrichelte Linie weist darauf hin, dass zwischen dem Begriff und dem Objekt selbst keine notwendige Verbindung existiert. Diese wird erst durch den Sprecher (Zeichenbenutzer) hergestellt.
2 Sprache in Funktion: Kommunikationsmodelle
Die Sprache dient der zwischenmenschlichen Kommunikation. Kommunikationsmodelle zielen darauf ab, den Ablauf von Kommunikation zwischen Menschen theoretisch zu erfassen (was sich in grafischen Darstellungen veranschaulichen lässt). Jedes Modell beschreibt unterschiedliche Aspekte, die allesamt Grundeigenschaften der menschlichen Kommunikation bilden. Die Modelle zeigen also Sprache in Funktion.
2.1 Das Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation (Shannon und Weaver)
Das Sender-Empfänger-Modell ist ein bekanntes und als Klassiker vielzitiertes Kommunikationsmodell. Entwickelt wurde es in den 1940er Jahren von Claude E. Shannon (1916–2001) und Warren Weaver (1894–1978; daher Shannon-Weaver-Modell). Das Modell beschreibt Kommunikation als Austausch von Informationen zwischen Sender und Empfänger mit Hilfe von Zeichen. Für eine erfolgreiche Kommunikation ist ein zumindest teilweise identisches Zeichen- und Bedeutungswissen (z. B. eine bestimmte Sprache) notwendig. Zudem ist es wichtig, dass der Code sowohl dem Sender als auch dem Empfänger bekannt ist.
Abb. 4: Das Sender-Empfänger-Modell der Kommunikation
Wenn wir miteinander kommunizieren, werden wir zu Sendern und Empfängern von Botschaften bzw. Nachrichten: Möchte der Sender einem Empfänger etwas mitteilen, so codiert bzw. verschlüsselt er die Nachricht. Transportiert wird die Botschaft zum Empfänger durch Sprache, Schrift oder Körpersprache. Das ausgesendete Signal muss dann vom Empfänger decodiert, d. h. entschlüsselt werden. Erst wenn ihm dies gelingt, kann er angemessen darauf reagieren. Durch sein Feedback wird er selbst zum Sender und der ursprüngliche Sender zum Empfänger.
2.2 Das Organon-Modell (Karl Bühler)
1934 entwickelt der Sprachwissenschaftler Karl Bühler (1879–1963) das sogenannte Organon-Modell. Er orientiert sich dabei an der antiken Sprachphilosophie Platons. Sein Modell basiert auf der These, dass Sprache ein Organon (griech., ›Werkzeug‹ oder ›Mittel‹) bildet, mit dem man anderen etwas über die Dinge mitteilt. Das Sprachzeichen übt dabei drei wichtige Funktionen aus, die Bühler wie folgt veranschaulicht hat:
Abb. 5: Das Organon-Modell
Nach Bühler sind drei Elemente beim Sprechen beteiligt:
Sender, der ein Schallphänomen produziert
Empfänger, der den Schall als Reiz wahrnimmt
Gegenstände oder Sachverhalte, die den Anlass für die Kommunikation bilden
»Z« steht für Zeichen und der Kreis für das reine Schallphänomen. Das sprachliche Zeichen stellt den Sinnbezug zwischen Sender, Empfänger und Gegenstand her. Jede sprachliche Mitteilung weist demnach folgende drei Funktionen auf:
Darstellungsfunktion: Das sprachliche Zeichen hat die Aufgabe, die bezeichnete Wirklichkeit darzustellen, d. h. Informationen über einen Gegenstand weiterzugeben.
Ausdrucksfunktion: Das sprachliche Zeichen vermittelt das Innenleben des Senders.
Appellfunktion: Das Zeichen fungiert als Signal, welches das Verhalten des Empfängers steuern soll.
In Kommunikationssituationen sind zwar grundsätzlich alle drei Funktionen vorhanden, allerdings entscheidet die Intention des Sprechers, welche Funktion in einer sprachlichen Äußerung jeweils in den Mittelpunkt rückt.
2.3 Die fünf Axiome zur menschlichen Kommunikation (Paul Watzlawick)
Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick (1921–2007) fasst in seiner Theorie die Grundeigenschaften menschlicher Kommunikation in fünf Axiomen (Grundannahmen) zusammen:
2.4 Das Kommunikationsquadrat (Friedemann Schulz von Thun)
Der Psychologe Friedemann Schulz von Thun (geb. 1944) hat in Kombination der Modelle von Karl Bühler und Paul Watzlawick das sogenannte Kommunikationsquadrat (auch Vier-Seiten-Modell genannt) entwickelt. Kernaussage dieses Modells ist, dass jede Nachricht von einem Sender zu einem Empfänger eine Einheit bildet, die sich aus vier Botschaften bzw. Aspekten zusammensetzt:
Abb. 6: Das Kommunikationsquadrat nach Friedemann Schulz von Thun
Die vier Aspekte des Kommunikationsquadrats erfüllen unterschiedliche Funktionen in der Kommunikationssituation:
Sachinhalt (oder Sachaspekt): das, worüber der Sender informiert, d. h. die Sache an sich
Selbstkundgabe: das, was der Sender über sich selbst sagt
Beziehungsaussage: das, was der Sender vom Empfänger hält und in welcher Beziehung er zu ihm steht
Appell: das, wozu der Sender den Empfänger veranlassen möchte
Auch der Empfänger ist mit »vier Ohren« ausgestattet und nimmt diese vier Aspekte wahr. Nach Schulz von Thun ist der Empfänger auf dem Beziehungsohr am empfindlichsten, während das Selbstoffenbarungsohr am wenigsten ausgeprägt ist. Stellen Sender und Empfänger unterschiedliche Seiten in den Vordergrund, entstehen Kommunikationsstörungen. Kommunikation gelingt erst dann, wenn das Gespräch in allen vier Dimensionen stimmig ist.
3 Sprache im Wandel
Es liegt auf der Hand, dass wir heute anders sprechen als beispielweise die Menschen im Mittelalter. Grund dafür ist, dass die Sprache sich permanent, auch heutzutage, wandelt und verändert.
Grundsätzlich kann man zwei Weisen der Sprachbetrachtung unterscheiden:
diachron: Dieses Verfahren befasst sich mit der geschichtlichen Entwicklung und Veränderung der Sprache durch verschiedene Epochen.
synchron: Dieses Verfahren bezieht sich auf den Ist-Zustand eines funktionierenden Sprachsystems zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Die Untersuchung des Sprachwandels ist also diachrone Sprachbetrachtung.
3.1 Geschichte der deutschen Sprache
Entstehung der deutschen Sprache
Wo kommt die deutsche Sprache her? Die Sprachwissenschaftler sind sich darin einig: Deutsch ist eine indoeuropäische Sprache. Damit wird eine Gruppe von Sprachen bezeichnet, die ursprünglich zwischen Indien und Europa gesprochen wurden. Dazu zählen beispielsweise italische, slawische, indische, keltische und germanische Sprachen. Man fasst diese Sprachen unter der Bezeichnung »Sprachfamilie« zusammen, da sie Gemeinsamkeiten aufweisen.
Aber auch hinsichtlich der Grammatik lassen sich Gemeinsamkeiten bei Verbformen der 3. Person feststellen:
Etwa um 2000 v. Chr. vollzieht sich die Trennung des Germanischen vom Indoeuropäischen. Als Ursache vermutet man das Zusammentreffen indogermanischer Stämme mit der Bevölkerung des Ostseeraums. Dieses Zusammentreffen löst eine wichtige sprachliche Veränderung aus, die als germanische bzw. erste Lautverschiebung bezeichnet wird. Jacob Grimm (1785–1863) hat 1822 das Gesetz der ersten Lautverschiebung beschrieben (Grimmsches Gesetz). Demnach wechseln beim Übergang vom indogermanischen zum germanischen Konsonantensystem die indogermanischen stimmhaften Verschlusslaute b, d, g zu germanischen stimmlosen Verschlusslauten p, t, k. Beispiele:
Die aus dem Indoeuropäischen entstandenen germanischen Sprachen lassen sich in drei Gruppen unterteilen:
nordgermanische Sprachen (u. a. Dänisch, Norwegisch, Schwedisch)
westgermanische Sprachen (u. a. Deutsch, Englisch, Niederländisch)
ostgermanische Sprachen (u. a. das Gotische)
Das Ostgermanische ist heute ausgestorben.
Historische Entwicklung der deutschen Sprache
Die deutsche Sprache, wie wir sie heute sprechen, hat sich im Laufe der Jahrhunderte allmählich entwickelt. Diese Entwicklung lässt sich in gegeneinander abgegrenzten Sprachstufen darstellen. Allerdings sind die zeitlichen Grenzen uneinheitlich und in der Wissenschaft umstritten. Um die Entwicklung der deutschen Sprache plausibel zu machen, orientieren sich die Wissenschaftler entweder an innersprachlichen Kriterien (z. B. lautlichen Veränderungen, Änderungen des Wortbestandes, des Satzbaus) oder an außersprachlichen Kriterien (z. B. literarischen, kulturellen Epochen oder wichtigen historischen Ereignissen). Die folgende grobe Gliederung orientiert sich an der Periodisierung von Jacob Grimm.
Althochdeutsch (um 750–1050)
Althochdeutsch (Ahd.) gilt als älteste Sprachstufe des Deutschen. Seine Entwicklung geht auf die Vereinigung ehemals einzeln lebender germanischer Stämme zu sogenannten Stammesverbänden nach dem Zerfall des Römischen Reiches (4. Jh. n. Chr.) und nach der Völkerwanderung (4.–6. Jh.) zurück. In der Periode des Althochdeutschen entsteht das Adjektiv diutisc (»deutsch«), d. h. ›zum Volk gehörig‹, ›in der Sprache des Volkes‹. Das Wort bezeichnet den Unterschied zur Sprache der Gelehrten, dem Lateinischen (und zunächst nicht den zu anderen Volkssprachen). Da im frühen Mittelalter Latein die Sprache der Kirche ist, spielt das Althochdeutsche zunächst nur eine unbedeutende Rolle. Zudem ist Althochdeutsch keine einheitliche Sprache. Es gliedert sich in verschiedene Dialekte (z. B. Alemannisch, Altfränkisch, Altbairisch, Sächsisch).
Bedeutendster innersprachlicher Anstoß für die Entstehung des Althochdeutschen ist eine lautliche Veränderung vom Germanischen zum Althochdeutschen im 6. Jahrhundert. Diese lautliche Veränderung wird als hochdeutsche oder zweite Lautverschiebung bezeichnet. Sie betrifft die germanischen Laute p, t, k. Diese verwandeln sich in die hochdeutschen Laute f, s, h (nach einem Vokal) bzw. pf, tz, ch (im Anlaut bzw. bei Verdoppelung).
Diese Verschiebung nimmt ihren Ausgangspunkt im Südwesten Deutschlands und hat sich bis etwa Köln nach Norden verbreitet (sogenannte »Benrather Linie« oder »maken-machen-Grenze«). In den nord- bzw. niederdeutschen Dialekten setzt sie sich jedoch nicht durch. Die Verschiebung von kk zu ch bleibt sogar nur auf den alemannischen (schweizerdeutschen) Raum beschränkt. »Hochdeutsch« bezeichnet deswegen ursprünglich eine regionale, nämlich süddeutsche Sprachform.
Im Zuge der Christianisierung germanischer Stämme im Frankenreich unter Karl dem Großen (768–814) kommt es zudem zu einer Erweiterung des Wortschatzes. Ab dem 8. Jahrhundert entstehen die ersten schriftlichen Zeugnisse in althochdeutscher Sprache. Als bedeutendes Beispiel gilt das Evangelienbuch des elsässischen Mönchs Otfrid von Weißenburg (ca. 800–870).
Mittelhochdeutsch (um 1050–1350)
Das Mittelhochdeutsche (Mhd.) ist die zwischen 1050 und 1350