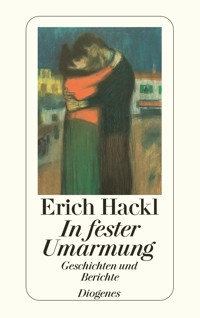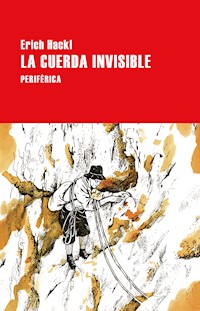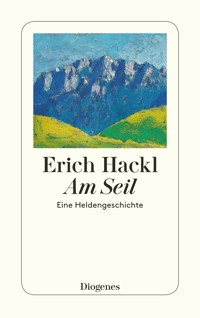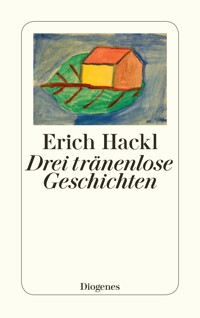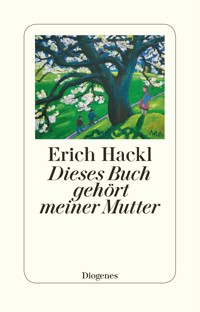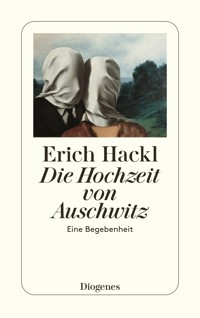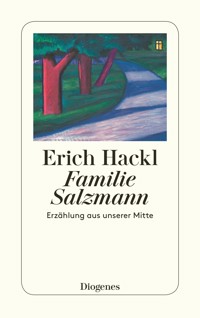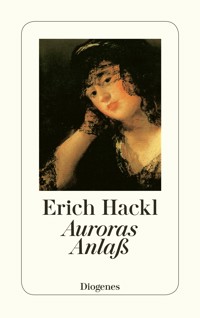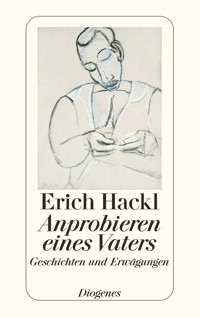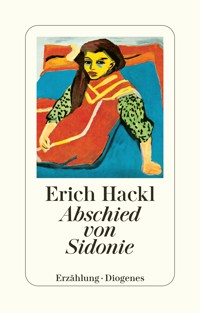
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am achtzehnten August 1933 entdeckte der Pförtner des Krankenhauses von Steyr ein schlafendes Kind. Neben dem Säugling, der in Lumpen gewickelt war, lag ein Stück Papier, auf dem mit ungelenker Schrift geschrieben stand: »Ich heiße Sidonie Adlersburg und bin geboren auf der Straße nach Altheim. Bitte um Eltern.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Erich Hackl
Abschied von Sidonie
Erzählung
Die Erstausgabe erschien 1989
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration: Ernst Ludwig Kirchner,
›Sitzendes Mädchen, Fränzi‹,
um 1910 (Ausschnitt)
Mit freundlicher Unterstützung
von Dr. Wolfgang Henze und
Ingeborg Henze-Ketterer,
Wichtrach/Bern
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 22428 3 (28. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60092 6
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Man sieht nur, was man nicht berührt.
[7] 1
Am achtzehnten August 1933 entdeckte der Pförtner des Krankenhauses von Steyr ein schlafendes Kind. Neben dem Säugling, der in Lumpen gewickelt war, lag ein Stück Papier, auf dem mit ungelenker Schrift geschrieben stand: »Ich heiße Sidonie Adlersburg und bin geboren auf der Straße nach Altheim. Bitte um Eltern.«
Der Mann, ein gewisser Mayerhofer, grau, schlank, 63 Jahre alt, hatte im Zimmer hinter der Portiersloge, das ihm als Dienstwohnung zugewiesen war, geschlafen, ehe er, kurz nach Mitternacht, hochschreckte. Ihm war gewesen, als habe er die Torglocke schellen gehört. Sicher war er sich nicht; schon mehrmals in letzter Zeit hatte ein schrilles Läuten seine Träume zerrissen, war er aufgesprungen und zum Portal gelaufen, hatte aber erkennen müssen, daß ihm sein überreiztes Gehör einen Streich gespielt hatte. Deshalb blieb er jetzt noch halb aufgerichtet auf seiner Pritsche sitzen und horchte in die Dunkelheit. Es blieb still. Trotzdem entschloß er sich endlich, Nachschau zu halten. Mayerhofer stieß die Decke von sich, schwang seine Beine über den Bettrand und tappte im Finstern nach den Schuhen. Etwas vornübergebeugt, den eckigen Kopf zwischen die Schultern gestemmt, so schlurfte er in den Flur, wo das Nachtlicht [8] brannte, spähte durch die Scheiben hinaus auf die Auffahrt, öffnete und trat ins Freie.
Am Abend war ein Gewitter über der Stadt niedergegangen, das nach einer langen Hitzewelle die ersehnte Abkühlung gebracht hatte. Aber zur Sperrstunde, um zehn Uhr, hatte der Regen bereits nachgelassen. Jetzt waren die Pflastersteine der Rampe, auf der die Krankenwagen bei Bedarf hielten, bis auf die Ränder schon wieder trocken. Vom Westen her wehte ein kühler Wind. Den Mann fröstelte; er hörte keine Stimmen, nur das Rauschen der Blätter, sah nichts als den hellen Streifen der Straße, konnte die Wipfel der Bäume dahinter kaum ausmachen und glaubte sich in seinem Verdacht, einer Sinnestäuschung erlegen zu sein, bestätigt. Mißmutig drehte er sich um.
Das Bündel lag im Windfang rechts neben der Tür, im toten Winkel der Portiersloge. Mayerhofer begriff nicht gleich, bückte sich schwerfällig, lief dann zurück ins Gebäude, in den Händen nichts als den Zettel, den er hilflos schwenkte, während er, nun schon an der Glastür zur Krankenabteilung, die Nachtschwester rief.
Das Kind war von einer heimlichen und doch lebhaften Schönheit, ein schwarzer Flaum beschattete das dunkle Oval des Gesichts, dem die dichten Brauen über den verkrusteten Augen eine seltsam ergreifende Fremdheit verliehen. Der Arzt, den die von Mayerhofer aufgeschreckte Krankenschwester aus dem Schlaf riß, zweifelte keinen Moment lang, daß Zigeuner das [9] Mädchen weggelegt hatten. In den Auwiesen der Steyr unterhalb des Spitals, gleich hinter der Straße, sah man immer wieder ihre Wagen stehen, bunte Wäsche dazwischen gespannt, nachts den Schein von Feuerstellen, und nur wenige Kilometer weiter westlich, neben der Straße nach Sierning, befindet sich eine Anhöhe, die noch heute Zigeunerberg heißt, weil in ihrer Mulde fahrendes Volk ein, zwei Nächte lang Station machte, ehe es von den Sierninger Gendarmen wieder verscheucht wurde. Es wäre also der Kindesmutter, oder einer anderen Person ihrer Sippe, ein leichtes gewesen, sich nachts ungesehen dem Krankenhaus zu nähern und das Schicksal der Neugeborenen der Fürsorge anderer zu überantworten.
Die Nachforschungen des Steyrer Jugendamtes verliefen vorerst im Sand. Dabei wurden sie alsbald mit einer Hartnäckigkeit durchgeführt, die sich durch Rückschläge nicht beirren ließ. Diese Geschäftigkeit entfachte ein Anruf aus Wels, neun Tage nach Auffindung des Mädchens, in dem sich eine Adlersburg, Anna, nach eigener Aussage die Kindesmutter, nach dem Befinden der kleinen Sidonie erkundigte. Auf den Vorwurf des Verwalters, daß sie ihre Tochter auf Gedeih und Verderb ausgesetzt habe, erklärte sie, völlig mittellos zu sein und keinen anderen Weg gewußt zu haben, um dem Mädchen zur notwendigen Behandlung zu verhelfen. Sie wolle Sidonie wieder zu sich nehmen, sobald es ihr die Umstände erlaubten. Freilich sehe sie sich außerstande, für die Kosten der Spitalspflege [10] aufzukommen. Der Verwalter des Krankenhauses nahm ihr das Versprechen ab, daß sie das Kind Mitte September persönlich abholen würde, und versicherte ihr, es werde aufs beste für die kleine Patientin gesorgt.
Am fünfundzwanzigsten September meldete sich die Frau erneut, dieses Mal ohne Angabe ihres gegenwärtigen Aufenthaltsortes. Weil sie selbst erkrankt sei, könne sie ihr Kind vorläufig nicht zu sich nehmen. Nähere Angaben zu ihrer Person verweigerte sie, ließ sich im Gespräch mit dem Verwalter, einem promovierten Altphilologen, der seiner Arbeit mit größter Sorgfalt nachging, aber doch ein paar Aussagen entlocken, so zu ihrem Beruf (sie schlage sich als Hausiererin durch) sowie den Namen und das Gewerbe des Kindesvaters: Robert Larg, Pferdehändler.
Sidonie litt an der Englischen Krankheit, einer mangelhaften Verkalkung des Knochengewebes. Ihre Beine waren nach außen gekrümmt, die Gelenke an Armen und Beinen verdickt, und der Arzt schärfte den Schwestern ein, dem Mädchen eine vitaminreiche Kost zu verabreichen, auf frische Luftzufuhr zu achten und das Bett bei jeder Gelegenheit in die Sonne zu stellen. Dabei wußte er, wie nutzlos und lächerlich solche Anordnungen in einer Stadt klingen mußten, in der chronische Leiden die Regel waren. In Steyr herrschte bittere Not. Jedes zweite Kind in den Baracken der Ennsleite und entlang des Steyr-Flusses, an dem sich im vergangenen Jahrhundert eisenverarbeitende Betriebe angesiedelt hatten, [11] litt an der gleichen Krankheit oder an Tuberkulose. In den Steyr-Werken, die vier Jahre zuvor über sechstausend Beschäftigte aufwiesen, arbeiteten 1933 nur noch knapp 1400 Personen. Von den 22000 Bewohnern der Stadt nahm im selben Jahr jeder zweite öffentliche Hilfe in Anspruch. Die Hälfte aller Einnahmen veranschlagte die Gemeinde für Fürsorgezwecke. Bereits 1929 hatte sich die Stadtverwaltung außerstande gesehen, das erst dreizehn Jahre vorher fertiggestellte Krankenhaus, in dem Sidonie Adlersburg erste Hilfe gewährt wurde, zu erhalten; man mußte es zusammen mit dem kleineren St.-Anna-Spital um 750000 Schilling an die oberösterreichische Landesregierung verkaufen.
Gelegentlich fielen Reporterschwärme über die Stadt her, abgebrühte Korrespondenten ausländischer Blätter, Spezialisten auf dem Feld der Elendsmalerei, die halbgerauchte Stummel auf das Pflaster schnippten und zusahen, wie sich Arbeitslose darum balgten; junge, feinfühlige Redakteure von Arbeiterorganen, die, mit Schirmmütze und fadenscheiniger Jacke mehr kostümiert als getarnt, ein dumpfes Schuldgefühl beschlich, wenn sie in der öffentlichen Ausspeisungshalle saßen und die Leute ringsum beobachteten, die eingebrannten Kohl aus der Menageschale löffelten. Die gut Informierten kamen am Freitag, den die Gemeinde zum Betteln freigegeben hatte; an diesem Tag gab die Stadt ihre Armut unverhüllt preis, wälzte sich ein Menschenstrom über Grünmarkt und Stadtplatz, verzweigte sich in die [12] umliegenden Gassen, riß vor Geschäftslokalen ab, deren Inhaber als großherzig und wohlhabend bekannt waren, und schwoll vor den Brücken über Enns und Steyr wieder an. Seine Wogen umspülten die Stände und Karren der Bauern aus der Umgebung, die beharrlich ihre Butterstriezeln und Speckseiten lobten, ehe sie am späten Nachmittag unverrichteter Dinge zurück auf ihre Höfe fuhren, wo arbeitslose Schneidergesellen, Zimmerleute oder Dachdecker ihre Dienste anboten.
Immer wieder kam es zu Hungerdemonstrationen auf dem Stadtplatz. Die Kundgebungen endeten damit, daß der sozialdemokratische Bürgermeister Sichlrader auf den Balkon des Rathauses trat und den Demonstranten versprach, bei den zuständigen Stellen mit der Bitte um Sonderauslagen vorstellig zu werden. Von der Regierung wagte sich keiner mehr nach Steyr, seit der damalige Bundeskanzler Schober im März 1930 in der Stadt der Not, des Elends, der Armut und des bittersten Jammers, wie Sichlrader zu seiner Begrüßung gesagt hatte, mit den Rufen »Bluthund!« und »Arbeitermörder!« und wilden Tumulten empfangen worden war.
Von Sidonies Mutter kam kein Lebenszeichen mehr. Weil es nicht länger spitalsbedürftig war, wurde das Kind dem Jugendamt zur weiteren Veranlassung übergeben. Dem Magistrat war daran gelegen, die Eltern, genauer: deren Heimatgemeinde, möglichst rasch ausfindig zu machen; nicht um Sidonie ihren Eltern zuzuführen oder diese strafrechtlich zu belangen (das auch, [13] gewiß), sondern um die Pflegekosten auf eine andere, weniger verschuldete, weniger ruinierte Gemeinde abzuwälzen.
Unverdrossen richtete der Magistrat Steyr, Berufsvormundschaft, anfangs lakonische, dann immer umfangreichere, fast flehende Schreiben an die Gemeindeämter von Altheim, St. Laurenz, Karlstein, Ollersbach, Viehofen, Kremsmünster, an das Landes-Gendarmeriekommando Salzburg, die Niederösterreichische Landes-Berufsvormundschaft Waidhofen an der Thaya, die Postenkommandos in Pinsdorf und St. Pölten, das Bezirksgericht von Raabs, an die Gesellschaft für Internationalen Jugendrechtsschutz in Brünn, schließlich über die Bezirkshauptmannschaft Braunau am Inn nochmals an das Gemeindeamt Altheim mit der inständigen Bitte um dringliche Erledigung der Sache, da vom Magistrate Steyr infolge finanzieller Schwierigkeiten für das Kind weiterhin Pflegebeiträge nicht mehr geleistet werden können. Alle Bemühungen waren umsonst. Plötzlich widerrief ein Amtsschreiber seine frühere Mitteilung, wonach an der Landstraße in seinem Gemeindegebiet ein Zigeunerkind geboren sei, hatte ein Pfarrer das Taufregister verlegt, waren die gesuchten Kindeseltern unbekannten Orts verzogen, konnte man ihrer nicht habhaft werden, lag keine Veranlassung vor, wurde von der Sachlage h.o. nichts bekannt.
Um wenigstens die Kosten eines Spitalbettes einzusparen, beschloß die Fürsorgerin des städtischen [14] Jugendamtes, das Mädchen umgehend in Pflege zu geben. Sie nahm die Liste mit den Vormerkungen aus dem Aktenschrank und ging Namen für Namen durch, wobei sie die gesicherte materielle Existenz der Bewerberinnen, noch vor dem Leumund, als oberstes Kriterium in Betracht zog. Ihre Wahl fiel schließlich auf Amalia Derflinger, Schlossergattin in Steyr, Schillerstraße 51, die sich das Kind am sechsten Oktober anschauen ging. Angetan von dem, wie sie es nannte, drolligen Wesen der Kleinen, holte sie Sidonie am nächsten Tag ab und erklärte sich bereit, das Kind bis auf weiteres zu behalten.
Zwei Tage später war Sidonie wieder im Krankenhaus. Amalia Derflinger murmelte etwas von Platzmangel und daß sie die Aufgabe unterschätzt habe, gestand dann aber, daß ihr Mann sie samt dem schwarzen Bankert aus dem Haus gejagt habe.
Als ob’s weiße Kinder nicht auch täten, hatte er sie angeschrien, willst, daß uns alle auslachen, sogar die eigenen Lehrbuben. Jeder ist froh, wenn er mit Zigeunern nichts zu tun hat, und du bringst mir die Plag noch heim! Er wies ihr die Tür, wenn du sie nicht sofort zurückbringst, sind wir geschiedene Leut’.
Amalia schämte sich, auch tat ihr das unschuldige Kind leid, das jetzt gar noch zu schreien begann, daß die ganze Straße zusammenlief. Zwei Nächte schlief Amalia mit Sidonie bei ihren Eltern, dann machten die ihr klar, das könne nicht ewig so weitergehen, die Frau gehöre an die Seite ihres Mannes, der noch dazu ein anständiger [15] Gewerbetreibender sei, sein eigener Herr und Meister, und Handwerk hat goldenen Boden, selbst in diesen Zeiten, Zigeuner gibt es mehr als genug und schlängeln sie sich auch überall durch, Unkraut verdirbt nicht.
[16] 2
Sieben Kilometer außerhalb der Stadt, an der Letten-Straße, die von Sierning hinunter zur Steyr und am anderen Ufer weiter zur Ortschaft Schwaming führt, liegen rechterhand zwei Wohnhäuser, die während des Ersten Weltkrieges für Vorarbeiter der Waffenfabrik errichtet worden waren.
Im ersten Stock eines dieser Häuser, auf Nummer 200, wohnte die Familie Breirather. Hans Breirather war 1899, im Jahr des entsetzlichen Hagelschlags und der Hochwasser, als jüngstes von sechs Kindern eines Landarbeiterehepaares geboren worden. Nach dem frühen Tod der Mutter hatte sein Vater eine Witwe geheiratet, die vier Kinder in die Ehe mitbrachte. Hans wuchs in der Überlände eines Schwaminger Bauern auf, sein Vater kam als Hilfsarbeiter in der Lettener Waffenfabrik unter, die Stiefmutter rackerte sich, als Gegenleistung für das enge, ewig feuchte Quartier, auf dem Kartoffelacker ab. Abends um sechs drückten sich die Kinder an der Fensterscheibe die Nasen platt, in der Hoffnung auf Essensreste vom Tisch des Bauern, die ihre Mutter manchmal in der Schürze heimbringen durfte. Vier Jahre lang, die sich in seiner Erinnerung zur sorglosesten Zeit seines Lebens verklärten, ging Hans zur Schule, wo ihm [17] der Lehrer neben dem Einmaleins und rudimentären Kenntnissen der deutschen Rechtschreibung auch Selbstachtung und Stolz beibrachte. Der Mann, selbst in drückenden Verhältnissen gefangen, verachtete Kirche und Thron und führte einen zähen Kleinkrieg mit dem Pfarrer. Im Kampf um die Gunst der Eltern unterlag er; die Schüler gewann er, weil ihm körperliche Züchtigung ein Greuel war, dem er selbst bei größter Erregung, und trotz Drängen der Erwachsenen, nicht verfiel. Ihm lag daran, die Kinder möglichst lange von schwerer Arbeit fernzuhalten, und er fand nichts dabei, bei den Eltern mit diesem Begehren vorstellig zu werden. Man belächelte ihn deshalb, jagte ihn einmal sogar mit der Peitsche vom Hof. Auch bei Hans, der verlegen danebenstand, nützte die Fürsprache des Lehrers nichts. Zum Heuen mußte ihn dieser vom Unterricht dispensieren; der Wochenlohn von einer Krone nahm Hans immerhin das Gefühl, zu Hause ein unnützer Esser zu sein. Mit zehn kam er als Stallbursche zum Bauern. Die Arbeit mit den Pferden, ihr Festes und Scheues zugleich gefiel ihm. Nichts Schöneres kannte er als eine durchwachte Nacht im Stall, wenn eine Stute geworfen hatte und er achtgeben mußte, daß das Fohlen nicht zu früh aufstand.
Am ersten August 1914, nachts um elf, hörte Hans alle Kirchenglocken der Umgebung läuten. Schon am nächsten Tag trieb der Hausknecht die Pferde zur Militärkommission in Steyr; nachdem die Ernte mühsam, mit störrischen Kühen im Joch, eingebracht worden war, [18] verschwand auch der Knecht, kriegsbegeistert und zuversichtlich, bis Weihnachten zurück zu sein. Zwei Jahre später mußte Hans zur Musterung, wurde mit siebzehn eingezogen, nach Brünn, klapperte, ein Bettelsoldat, die mährischen Bauern ab, fette schwarze Erde, bat um einen Kanten Brot, ein paar Rüben, eine Handvoll Kartoffeln. In der Kaserne litten sie ewigen Hunger, einmal nur konnten ihm die Eltern ein Paket zusammenschnüren, es kam nie an. Dann die Front, Isonzo, Tonale, das Sterben ringsum, für unbekannt, Hunger, der Tod in den Gedärmen, und immer wieder der Hunger.
In den italienischen Lagern lernte Hans begreifen, was die Menschen eint und was sie trennt, auch daß Grenzen anders verlaufen als auf den Landkarten gezogen. Als er im Troß der Kriegsgefangenen von Rom zur Festung Ostiense getrieben wurde, zerlumpt und abgehärmt, wurde er angespuckt und mit Orangen beschenkt, bekam er Schläge und ein Stück Brot. Dieses Erlebnis beschäftigte ihn lange, ebenso die nächtlichen Gespräche der italienischen Häftlinge, Sozialisten und Anarchisten, ihre erregten Stimmen ließen ihn lange nicht einschlafen. Am Morgen mußte er früh heraus, wusch ihnen Hemden und Hosen, dafür steckten sie ihm Geld zu und belohnten ihn mit ihrer Zuversicht, die ihm half, das letzte Lager durchzustehen, Monte Cassino, die Kälte, Schmutz und Seuchen.
An einem Sonntag im September 1919 fand in Sierning [19] ein Heimkehrerfest statt, auf dem die Niederlage in einen Sieg umgelogen wurde und die Toten aufgerufen waren, ihre überlebenden Kameraden rührselig zu stimmen. Es war eine Feier der Beschwichtigung und verspielten Gelegenheit, des Erstickens ungeordneter Träume, zu deren Anlaß die Häuser an der Straße zwischen Forsthof und Kirche beflaggt wurden und die Musikkapelle flotte wie schleppende Märsche anstimmte. Vier junge Kriegerwitwen legten vor dem Sakristeikreuz einen mannshohen Kranz nieder, auch für Hans, der sich drei Monate später, am Christtag, von St. Valentin nach Hause quälte, entkräftet, alle paar Meter hinter einen Baum getrieben, blutiger Abgang, Stuhldrang, Koliken, die sich lange nicht gaben.