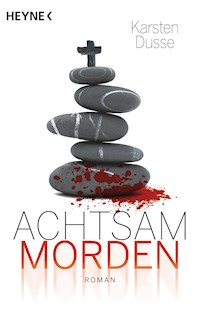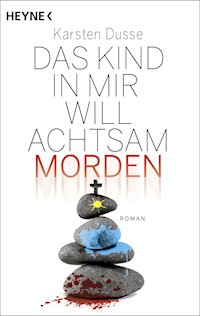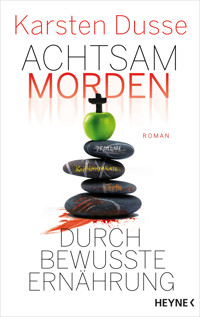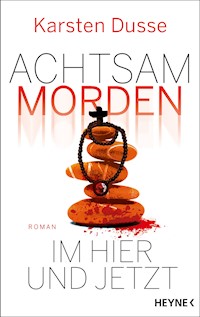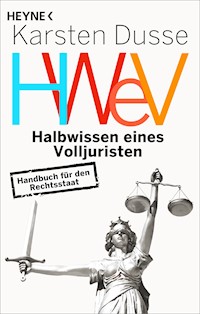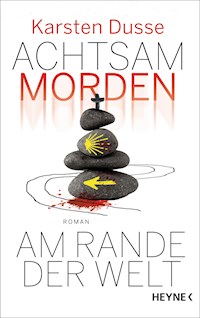
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Achtsam morden-Reihe
- Sprache: Deutsch
Finde dich selbst. Bevor es ein anderer tut.
Um der Midlifecrisis zu entgehen, begibt sich Björn Diemel auf Anraten seines Therapeuten auf Pilgerreise. Schnell stellt sich als Erkenntnis auf dem Jakobsweg heraus, dass Björns Leben die Mitte bereits längst überschritten haben könnte: Ein unbekannter Mitpilger versucht, ihn zu töten.
Während bei den scheiternden Anschlägen auf ihn ein Pilger nach dem anderen seinen Lebensweg verlässt, versucht Björn ganz achtsam, sich seiner Haut zu wehren. Seine Pilger-Fragen nach Leben, Tod und Erfüllung bekommen plötzlich eine sehr praxisnahe Relevanz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Björn Diemel hat, statistisch gesehen, die Mitte seines Lebens erreicht. Und er hat das beängstigende Gefühl, dass das dann auch schon alles gewesen sein könnte, was er bislang im Leben erreicht hat. Um von seiner eigenen Halbzeitbilanz nicht in eine Lebenskrise gezogen zu werden, wendet sich Björn an seinen Therapeuten Joschka Breitner. Schnell wird klar, dass für Björn ganz elementare Fragen der zweiten Lebenshälfte noch völlig unbeantwortet sind. Vor allem, weil Björn sie sich noch nie gestellt hat:
Was ist eigentlich der Sinn des Lebens?
Welches Verhältnis hat Björn zum Tod?
Und was braucht Björn wirklich für ein erfülltes Leben?
Joschka Breitner rät Björn zu pilgern, um die Antworten auf diese Fragen zu finden. Nach einem intensiven Coaching und mit Breitners Ratgeber »Zu Fuß ins Ich – Pilgern als Selbstfindung« im leichten Gepäck, macht sich Björn auf den Jakobsweg. Dumm nur, dass ihm dabei offenbar ein Mörder auf den Fersen ist …
Der Autor
Karsten Dusse ist Rechtsanwalt und seit Jahren als Autor für Fernsehformate tätig. Seine Arbeit wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis und mehrfach mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet sowie für den Grimme-Preis nominiert. Sein Debütroman Achtsam morden und die Fortsetzung Das Kind in mir will achtsam morden standen wochenlang an der Spitze der Bestsellerlisten.
KARSTEN DUSSE
ACHTSAM
MORDEN
AM RANDE
DER WELT
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Heiko Arntz
Covergestaltung: Cornelia Niere, München,
unter Verwendung von Shutterstock-Motiven
Herstellung: Mariam En Nazer
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-26518-2V003
www.heyne.de
Für Lina
Inhalt
Prolog
1 Seelenreinigung
2 Nähe und Distanz
3 Irritationen
4 Eigeninitiative
5 Achtsamkeit als Waffe
6 Inspirationen
7 Pilgern
8 Konsequenzen
9 Midlife-Crisis
10 Jakobsweg
11 Gepäck
12 Gedankenkarussell
13 Saint-Jean-Pied-de-Port
14 Fragen
15 Begegnung
16 Täler
17 Beziehungen
18 Minimierung
19 Zeit
20 Orisson
21 Abendessen
22 Erkenntnisse
23 Suchen
24 Namen
25 IbaÑeta-Pass
26 Rückschritte
27 Vorsätze
28 Pamplona
29 Sorgen
30 Rache
31 Hysterie
32 Wut
33 Irache
34 Herausforderung
35 Dunkelheit
36 Foncebadón
37 Weisheit
38 Mosaik
39 Cruz de Ferro
40 Santiago de Compostela
41 Am Rande der Welt
DANKE
PROLOG
»Jeder Mensch, der geboren wird, stirbt. Das ist unglaublich beruhigend.
Anstatt uns jeden Tag mit der Frage zu belasten, wann wir sterben werden, könnten wir uns auch jeden Tag an der Frage erfreuen, wie wir an all den anderen Tagen leben wollen.«
Joschka Breitner,
»Zu Fuß ins Ich –
Pilgern als Selbstfindung«
DREIKILOMETERWAREN wir schweigend und in Meditation versunken nebeneinander hergepilgert. Dann explodierte der Kopf des Staatsanwaltes wie aus dem Nichts in einer rosaroten Wolke.
Den Schuss vernahm ich erst Sekundenbruchteile später.
Der Teil meines Pilgerfreundes, der eben noch seine Gedanken enthalten hatte, war mit einem Mal auf dem Regenschutz seines Wandergepäcks und auf dem Jakobsweg in der Nähe des Ibañeta-Passes, kurz vor Roncesvalles, verteilt.
Und nur einen Wimpernschlag nachdem ein Projektil seinen Schädel durchdrungen hatte, schoss auch mir etwas durch den Kopf. Ein Gedanke: Pilgern wirkt!
Der Staatsanwalt hatte bereits auf der zweiten Etappe des Camino Francés seinen Frieden gefunden, wenn auch nicht auf sehr friedvolle Weise. Monate voller Angst und Schmerzen, bis der Krebs ihn endgültig dahinraffen würde, waren ihm erspart geblieben. Er hatte es schon in dieser Sekunde hinter sich.
Vor mir aber lag noch ein sehr langer Weg.
Eigentlich hatte ich vor, mich auf der Strecke nach Santiago de Compostela auf drei einfache Fragen zu konzentrieren:
Was ist der Sinn des Lebens?
Welches Verhältnis habe ich zum Tod?
Was brauche ich wirklich für ein erfülltes Leben?
Zu diesen drei Fragen hatten sich nun sehr überraschend zwei weitere, für meine Zukunft nicht weniger entscheidende gesellt:
Wer hatte da gerade geschossen?
Und warum erschießt jemand einen Staatsanwalt, der ohnehin nicht mehr lange zu leben hat?
Auf die letzte Frage gab es eigentlich keine vernünftige Antwort.
1 SEELENREINIGUNG
»Es gibt einen elementaren Unterschied zwischen der Pflege Ihrer Zähne und der Pflege Ihrer Seele. Wenn Sie vergessen, Ihre Zähne zu putzen, stinkt das zuerst den anderen.«
Joschka Breitner,
»Zu Fuß ins Ich –
Pilgern als Selbstfindung«
ICHMÖCHTEVONANFANG an ehrlich sein: Ich war nie ein großer Freund des Pilgerns.
Pilger waren für mich immer Menschen mit Luxusproblemen und Multifunktionskleidung. Wer es sich leisten konnte, wochenlang zur Selbstfindung mit einem Sonnenhut durch Spanien zu wandern, hatte offensichtlich zumindest nicht so banale Probleme wie Kind und Beruf unter welche Kopfbedeckung auch immer zu bringen. Wochenlang gegen seine seelische Armut anzupilgern musste man sich zeitlich und finanziell erst einmal leisten können.
Dass Familie und Arbeit kein Hindernis, sondern vielleicht gerade ein guter Grund für eine Pilgerschaft sein könnten, kam mir in der ersten Hälfte meines Lebens nie in den Sinn. Dass sich das nach fünfundvierzig Jahren ändern könnte, ahnte ich noch nicht, als ich dieses Mal an der Tür meines Therapeuten Joschka Breitner klingelte.
Früher hielt ich Therapeuten für ungefähr so sinnvoll wie Golflehrer. Sie verbessern Handicaps, die im Alltag eher eine untergeordnete Rolle spielen. Doch dann lernte ich Joschka Breitner kennen. Weil mich Katharina, die Mutter meiner Tochter und damals noch meine Frau, zur Entspannung gezwungen hatte.
Joschka Breitner brachte mir die Achtsamkeit näher. Und ein mittleres Wunder geschah: Mithilfe der Achtsamkeit war ich dazu in der Lage, alle drei Arten von Problemen im Leben eines Mannes zu lösen. Die Probleme, die ich schon lange hatte. Die Probleme, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Und die Probleme, die täglich neu in mein Leben traten.
Joschka Breitner und die Achtsamkeit hatten mein Leben verändert. Ich ging jetzt zum Therapeuten, wie die meisten Männer zum Friseur gehen: Sie wollen keine neue Frisur, sie möchten einfach nur weiterhin so aussehen, wie sie nach dem letzten Friseurbesuch ausgesehen haben. Ich spürte eine gewisse Selbstzufriedenheit oder das Gefühl, im Wesentlichen da angekommen zu sein, wo ich sein wollte.
Ich führte ein geregeltes Leben. Hatte ein wunderbares Verhältnis zu meiner fünfjährigen Tochter und ein entspanntes zu meiner Ex-Frau. Ich hatte sogar ein erwachsenes Verhältnis zum neuen Lebensgefährten meiner Ex-Frau. Zudem hatte ich ein mehr als ausreichendes Einkommen, und zwar ohne, dass ich mich allzu sehr dafür anstrengen musste. Ob »geregelt«, »wunderbar«, »entspannt«, »erwachsen«,und »nicht allzu anstrengend« tatsächlich das war, was ich vom Leben erwarten sollte, darüber hatte ich mir bis zu dieser Coaching-Stunde keinerlei Gedanken gemacht.
Die therapeutischen Gespräche mit Herrn Breitner alle vier Wochen waren für mich eine Art Zahnreinigung der Seele.
Bei zu langen Abständen zwischen zwei Zahnreinigungen kann man irgendwann mit der Zunge unangenehme Unebenheiten hinter den Vorderzähnen erfühlen. Die müssen dann beseitigt werden.
Mit meiner Seele war das ähnlich.
Das achtsame Beseitigen meiner seelischen Unebenheiten zwischen zwei Coaching-Sitzungen hatte allerdings bislang das Leben von acht anderen Menschen beendet. Davon wusste Joschka Breitner nichts. Die Toten, die mein Leben begleiteten, waren für mich eine irgendwie logische Folge seines Coachings. Nicht dessen Grund.
Die therapeutischen Sitzungen waren nicht nur eine schöne Routine geworden, sie sorgten auch dafür, dass meine seelischen Unebenheiten so früh beseitigt wurden, dass in letzter Zeit niemand mehr deshalb in Lebensgefahr geraten war. Dass dabei eines Tages auch ein komplett hohler Zahn entdeckt werden könnte, lag außerhalb meiner Vorstellungskraft.
Ich kam regelmäßig und entspannt zehn Minuten vor meinem 17-Uhr-30-Termin vor Joschka Breitners Haustür an. Um jedes Mal aufs Neue festzustellen, dass es in dem Jugendstil-Viertel, in dem seine Praxis lag, keine freien Parkplätze für meinen leicht überdimensionierten Land Rover Defender gab. Gewohnheitsmäßig fuhr ich zweimal vergeblich gemäß Einbahnstraßenregelung um den Block, um im Anschluss auf einem drei Straßen entfernten Supermarktparkplatz zu parken. Ich hetzte dann jedes Mal aufs Neue die achthundert Meter zur Praxis und tauschte dabei mein ehemals entspanntes Zeitpolster gegen eine verspannte Beinahe-Pünktlichkeit ein.
Mit absoluter Zuverlässigkeit betätigte ich dann um Punkt 17.31 Uhr die Türklingel von Joschka Breitner.
Der einzige Unterschied zu dieser seit gut zwölf Monaten währenden Routine bestand an diesem Tag darin, dass ich erst um 17.32 Uhr klingelte. Und mit dem Taxi gekommen war. Der Fahrer war bei der ersten Anfahrt eine Einbahnstraße zu früh abgebogen. Meine Entspannung hielt sich in Grenzen. Ich hatte immer noch einen leichten Hangover vom Vortag. Eine Unpässlichkeit, die mich störend daran erinnerte, dass ich den vorherigen Abend eigentlich vergessen wollte.
Auch diesmal machte mir Herr Breitner mit seiner Heimat bietenden Ausgeglichenheit die Tür auf. Er quittierte meine leichte Unpünktlichkeit mit einem freundlichen Schweigen und ging mir in sein Besprechungszimmer voraus. Ich habe nie herausgefunden, ob Herr Breitner nur einen einzigen Satz Kleidung besaß oder unendlich oft die gleiche ausgeblichene Jeans, das gleiche baumwollene Hemd, die gleiche grobe Strickjacke. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals etwas anderes getragen hätte. Aber nie war diese ewig gleiche Kleidung auch nur im Ansatz schmuddelig. Die scheinbare Bedeutungslosigkeit, die er seiner Garderobe beizumessen schien, unterstrich deren Bedeutung nur zu deutlich.
Ich ließ mich, wie gewohnt, auf dem einen seiner beiden mit Cord bespannten Chromrohrstühle nieder, und mein Blick schweifte zum wiederholten Male über die Bücherrücken in seinem Regal, während Herr Breitner uns beiden von seinem grünen Tee eingoss.
Wie üblich fragte ich mich, warum der Zwischenraum zwischen den Büchern Die Kunst des Krieges von Sun Tsu und den Selbstbetrachtungen von Marc Aurel von Ernest Hemingways Roman Siesta gefüllt wurde.
Ich war darauf vorbereitet, diese Frage unbeantwortet in meinem Kopf verhallen zu lassen, weil ich genau in diesem Moment von Joschka Breitners Einstiegsfrage nach meinem Befinden unterbrochen werden würde.
Doch dem war nicht so.
Herrn Breitners übliche »Schön, dass Sie da sind, wie fühlen Sie sich?«-Frage blieb aus. Und bildete ein nicht zu überhörendes Loch im gewohnten Klangteppich meiner Besuche.
Irritiert durch diese Abweichung von der gewohnten Routine, blickte ich ihn an. Er stand mit zwei Tassen grünem Tee vor mir und lächelte fragend.
»Warum zwei Minuten?«, wollte er wissen, als er mir meine Teetasse reichte.
»Bitte?« Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinauswollte.
»Nun, seit über einem Jahr kommen Sie mit verlässlicher Unpünktlichkeit eine Minute zu spät zu unseren Sitzungen. Heute sind es zwei. Warum?«
Ich hatte von Herrn Breitner viel gelernt. Vor allem darüber, mir achtsam meiner Bedürfnisse bewusst zu werden. In diesem Moment hatte ich eigentlich nur ein Bedürfnis: Mir über diese blöde Frage keine Gedanken machen zu müssen.
Mit preußischer Genauigkeit nach meiner minimal erweiterten Unpünktlichkeit gefragt zu werden ließ mich nur in noch größeren Schlenkern um meine innere Mitte eiern.
»Aber … ich … was macht das für einen Unterschied?«
»Genau das würde ich gerne von Ihnen erfahren. Bezogen auf einen Tag, machen zwei Minuten nicht viel aus. Bezogen auf eine Minute machen zwei Minuten einen Unterschied von hundert Prozent aus. Das ist keine Kleinigkeit. Warum also ist Ihre Verspätung heute doppelt so groß wie üblich?«
Wegen des gestrigen Abends. Den ich eigentlich lieber vergessen wollte.
Wegen der gebrochenen Achse meines Land Rovers. Wegen des Gesangs der beiden Prostituierten. Wegen der beiden chinesischen Geschäftsleute in der Notaufnahme. Wegen all der Dinge, die mich zu sehr störten, als dass ich mich daran erinnern wollte.
Die mich emotional allerdings zu wenig belasteten, als dass ich mit meinem Therapeuten darüber reden wollte.
Wegen Ereignissen, die nun wohl doch Gegenstand meines Coaching-Gesprächs werden sollten.
Ich wand mich noch ein wenig.
»Der Taxifahrer ist falsch abgebogen.«
Herr Breitner schaute mich an, als wäre er eines dieser Pappschilder, das nach Orientierung suchende Menschen immer medienwirksam am Schauplatz von Tragödien hinterlassen.
Auf diesen Schildern steht: Warum?
Ich vermutete, die Frage bezog sich auf die Tatsache, warum ich überhaupt ein Taxi genutzt hatte.
»… weil ich mein Auto gerade nicht benutzen kann …«
Wieder dieser Warum?-Schild-Blick.
»Weil ich gestern ein kleines … Essen mit Mandanten hatte. Ist ein wenig später geworden«, konkretisierte ich verlegen lächelnd und machte lapidar mit der Hand eine Bewegung, wie wenn sich jemand ein eiskaltes Glas Wodka in den Rachen kippt.
Joschka Breitner wusste, welchen Beruf ich ausübte.
Ich übte den Beruf des Rechtsanwaltes aus.
Er wusste allerdings nicht, wie ich diesen Beruf konkret ausübte.
Im Wesentlichen ging es um Drogenhandel, Prostitution, Waffen.
Zu meiner Entlastung: Es gab da auch noch einen Kindergarten, um den ich mich kümmerte.
Meinem Therapeuten war grundsätzlich klar, dass ein festes Standbein meines Einkommens als Strafverteidiger naturgemäß die rechtliche Beratung krimineller Mandanten war.
Er wusste allerdings nicht, dass sich die Anzahl meiner Mandanten auf die Mitglieder zweier einstmals konkurrierender Clans beschränkte, die ich nicht nur rechtlich beriet, sondern de facto vollumfänglich führte.
Weil ich beide Chefs aus Gründen der Seelenreinigung getötet hatte.
Den einen, weil er mich auf einer Zeitinsel gestört hatte.
Den anderen, weil sein Weiterleben nicht mit den Interessen meines inneren Kindes zu vereinbaren war.
Aber das war Vergangenheit.
Seit über einem Jahr verlief meine Gegenwart in geregelten Bahnen.
Und Anwälte mit geregelten Geschäften gehen nun mal regelmäßig mit Mandanten essen. Das musste ich meinem Achtsamkeitscoach nicht verschweigen.
Wertungsfrei betrachtet, war der gestrige Abend eine Zusammenkunft eines Anwalts mit einem Drogendealer, einem Waffenhändler, der Chefin eines Escortservice und einem Kindergartenleiter gewesen.
Liebevoll betrachtet, sollte es gestern ein ganz entspannter Abend mit einer lustigen Mischung aus unkonventionellen Menschen werden.
Realistisch betrachtet, wurde es das aber nicht. Ganz im Gegenteil.
Und ich ahnte, dass Herr Breitner genau das nun haarklein auseinandernehmen würde.
»Herr Diemel – wie alt sind Sie?«, riss mich mein Therapeut mit gewohnter Sensibilität aus meinem Verschweigen.
Herr Breitner kannte die Antwort.
»Fünfundvierzig. Ich hatte gestern Geburtstag.«
Diesmal wusste ich seinen Schilder-Blick nicht zu deuten.
»Warum ich Geburtstag hatte?«
»Warum Sie an Ihrem Geburtstag mit Mandanten ausgehen.«
Das war der erste Stich mit der therapeutischen Lanze der Wahrheit. Ich wurde fünfundvierzig Jahre alt und feierte nicht mit echten Freunden, sondern mit Menschen, die schon aus beruflichen Gründen gar keine andere Wahl hatten, als eine Einladung von mir anzunehmen.
»Ich wollte kein großes Ding aus diesem Datum machen«, druckste ich herum, wohl wissend, dass der krampfhafte Versuch, kein großes Ding aus meinem Geburtstag machen zu wollen, die tatsächliche Bedeutung dieses Datums kein bisschen kleiner machte.
»Fünfundvierzig Jahre … das ist so ziemlich die statistische Lebensmitte. Ungewöhnlich, dieses Ereignis so … wie soll ich sagen … ›neutral‹ zu begehen«, stellte Herr Breitner wertungsfrei fest.
»Ich habe meinen Geburtstag ja gefeiert. Nachmittags wollte meine Tochter mit mir in den Zoo, und danach wollte Katharina, dass wir noch gemeinsam Geburtstagstorte essen.«
Katharina und ich waren seit einem halben Jahr geschieden. Den Umgang mit Emily hatten wir in Freundschaft sehr flexibel geregelt.
»Was davon wollten Sie?«, fragte Herr Breitner.
»Bitte?«
»Es war Ihr Geburtstag. Was Ihre Tochter und Ihre Ex-Frau an Ihrem Geburtstag wollten, weiß ich jetzt. Was wollten Sie?«
Ich verstand nicht ganz.
»Ich? Ich … ich habe mich gefreut, meinen Geburtstag mit meiner Familie zu verbringen …«
»Wären Sie auch alleine an Ihrem Geburtstag in den Zoo gegangen?«
»Natürlich nicht«, sagte ich, ohne darüber nachdenken zu müssen.
»Sie haben also mit Ihrer Familie den Geburtstag gefeiert, den Ihre Familie sich gewünscht hat. Und als die Familie weg war, sind Sie – um das Loch, das Sie alleine zu Hause erwartete, zu umgehen – lieber arbeiten gegangen«, brachte Herr Breitner meine spärlichen Antworten auf den Punkt.
Das lief in die falsche Richtung.
Weil es der Wahrheit sehr nahe kam.
»Nein, auch feiern.«
»Mit Mandanten?«
»Zwischen uns herrscht ein fast freundschaftliches Verhältnis.«
»Wie viele von Ihren Mandanten wussten von Ihrem Geburtstag?«
Touché. Kein einziger.
»Nur damit ich Sie richtig verstehe. Sie wollten Ihren fünfundvierzigsten Geburtstag abends ganz bewusst mit Menschen feiern, die von Ihrem Geburtstag gar nichts wussten?«, fragte Herr Breitner zusammenfassend.
»Um ehrlich zu sein, hätte ich den Abend ja am liebsten alleine zu Hause verbracht.«
»Aber?«
»Mein inneres Kind wollte feiern.«
Herr Breitner kannte mein inneres Kind. Er hatte es mir schließlich gezeigt. »Und da habe ich mir gedacht – Kompromiss. Wir feiern mit Menschen, die gar nicht wissen, dass ich Geburtstag habe.«
Der professionell bleibende Warum?-Blick meines Therapeuten ließ sich nur dadurch erklären, dass er es schon gewohnt war, sich von mir blödsinnige Erklärungen anhören zu müssen.
»Ja … gut … und irgendwie hatte ich auch ein bisschen Lust, mich einfach mal achtsam zu betrinken.«
»Wie soll das gehen?«, fragte Herr Breitner halb irritiert, halb neugierig.
»Achtsames Betrinken ist der liebevolle und wertungsfreie Genuss von Alkohol im Augenblick. Ich berausche mich allein um des Rausches willen. Nicht, um irgendwelche negativen Emotionen zu verdrängen.«
»Achtsames Betrinken ist wie liebevolles Verprügeln«, fuhr mir Herr Breitner ohne jede Anstrengung in die argumentative Parade.
»Bitte?«
»Mit dem ersten Schlag endet die Geschäftsgrundlage. Mit dem ersten Glas betäuben Sie genau die Sinne, die die Grundlage achtsamer Wahrnehmung des Augenblickes sind.«
Den Fehler hätte ich mir sparen können. Man sollte nie einem Künstler die Fälschung seines eigenen Werkes verkaufen.
»Ja, gut. Dann war ›achtsam betrinken‹ der falsche Ausdruck. Ich wollte mich eher ›bewusst‹ betrinken.«
»Wie betrinkt man sich bewusst?«
»Seriös geplant. Ich hatte mit Katharina ausgemacht, dass sie an diesem Abend Emily übernimmt. Ich hatte mir in dem Hotel, in dem das Geschäftsessen stattfinden sollte, bereits im Vorfeld ein Zimmer gemietet – um betrunken ins Bett fallen zu können. Ich hatte mir sogar zwei Extra-Flaschen Mineralwasser eingepackt, um sie nachts gegen den drohenden Kater zu trinken. Ich hatte mich auf einen schönen Abend gefreut, an dem mein inneres Kind und ich, ganz alleine, unter Bekannten, unerkannt die letzten fünfundvierzig Jahre feiern konnten.«
Während ich das so erzählte, fragte ich mich selber, wann ich eigentlich so ein Spießer geworden war, der auch ein Besäufnis präzise planen musste.
»Wenn Sie gestern also doch einen so bewusst geplanten Abend vor sich hatten, warum wirken Sie dann heute wie ein bockiger Teenager, dem man seine Party versaut hat?«
Nun, vielleicht, weil genau das gestern Abend der Fall war.
2 NÄHE UND DISTANZ
»Der Mensch ist ein soziales Wesen. Die Nähe zu anderen Menschen ist lebensnotwendig. Abstand hat für die eigene Seele nur dann einen positiven Aspekt, wenn er freiwillig gewählt wurde, um die vorherige Nähe aus örtlicher und zeitlicher Distanz zu betrachten.«
Joschka Breitner,
»Zu Fuß ins Ich –
Pilgern als Selbstfindung«
TROTZODERVIELLEICHT gerade wegen meines erkennbaren Widerwillens führte mich Herr Breitner mit einer Engelsgeduld behutsam an den Vorabend heran.
»Bevor wir dazu kommen, was gestern Abend passiert ist – gehen Sie oft raus zum Feiern?«
»Ich? Nein – ich gehe abends eher selten weg.«
»›Eher selten‹ heißt wie oft?«
»So gut wie nie.«
»Hat das einen Grund?«
Wie sehr sich die Zeiten ändern. Es gibt Lebensphasen, da muss man sich für sein überbordendes Party-Verhalten rechtfertigen. Und es gibt Lebensphasen, da muss man sich für sein Nicht-Party-Verhalten rechtfertigen.
»Nun, die Hälfte meiner Abende übernachtet meine Tochter bei mir. Da gehe ich selbstverständlich nicht weg. Da trinke ich noch nicht mal Alkohol.«
»Vermissen Sie das?«
»Ganz im Gegenteil«, schoss es ein wenig zu schnell aus mir heraus. »Ich freue mich, jede Sekunde meines Vaterseins mit allen Sinnen ungetrübt genießen zu können.«
»Ein hoher Anspruch«, bemerkte Herr Breitner kritisch.
»Ja. Und bevor Sie fragen – noch mal ja! Vater sein ist manchmal auch anstrengend. Und deswegen freue ich mich auf der anderen Seite auch, wenn ich die andere Hälfte meiner Abende dann einfach mal für mich alleine habe.«
»Was strengt Sie an?«
»Das räumliche Hin-und-her-Gehetze von Kinderschwimmen zu Kindertanz und diversen Kindergeburtstagen, verbunden mit dem emotionalen Hin-und-her-Gehopse auf jeder einzelnen dieser Veranstaltungen. Ich bin am Ende mancher Tage kaum noch in der Lage, meiner Tochter etwas vorzulesen. Tue es aber trotzdem. Und schlafe dann meistens neben ihr ein.«
»Die Hälfte Ihrer Tage opfern Sie sich für Ihre Tochter auf, die andere Hälfte brauchen Sie zum Regenerieren«, fasste Herr Breitner den Sachverhalt mit verstörender Klarheit für sich selbst zusammen, bevor er fortfuhr.
»Dann sind die Gelegenheiten für Sie, abends auszugehen und neue Menschen kennenzulernen, eher begrenzt.«
»Mein Bedürfnis, neue Menschen kennenzulernen, ist begrenzt«, erwiderte ich. Und wegen Breitners Warum?-Blick schickte ich gleich hinterher: »Es ist geschmälert durch die Erkenntnis, dass es bereits ziemlich viele Menschen in meinem Leben gibt, die ich gar nicht näher kennenlernen will. Ich stelle mit zunehmendem Alter immer mehr fest, dass sich der Drang des Menschen-kennen-Wollens auf einen immer kleiner werdenden Personenkreis konzentriert, in dessen Zentrum meine Familie, meine Tochter und am Ende ich selbst stehe.«
»Sofern Sie mal im Zentrum Ihrer Bedürfnisse stehen, dann ganz am Ende«, murmelte Herr Breitner nickend vor sich hin.
»Bitte?«, hinterfragte ich sein Gemurmel.
»Sie haben also manchmal das Gefühl, da fehlt was, richtig?«
Richtig. Sonst hätte ich mich ja nicht zum Geburtstag ganz bewusst mit im Grunde fremden Menschen betrinken wollen. Ich nickte.
»Na, das ist ja mal ein Anfang«, murmelte Herr Breitner beruhigend.
»Ein Anfang wovon?«
»Die Frage ist eher – ein Anfang wofür. Aber das können wir gleich noch erörtern. Erzählen Sie mir lieber zunächst von gestern Abend. Was sind das für Mandanten?«
Es waren die Führungspersonen der Verbrecherorganisation von Dragan Sergovicz. Menschen, die ich seit dem Mord an Dragan nun selber führte.
Wir trafen uns zweimal im Jahr in schöner Atmosphäre, aßen gut, tranken gerne und lachten viel. Ergaben sich nebenbei berufliche Themen, so besprachen wir die.
Diese Treffen steigerten nicht nur die Loyalität und Effektivität. Sie hatten einen für mich persönlich noch viel schöneren Effekt: Diese Treffen machten mir schlicht und ergreifend Freude.
Sie waren für mich ein angenehmer Ausbruch aus meinem gewohnten Alltag als sich einigelnder Vater.
Und ganz egal, was es landläufig für Vorurteile über Callgirl-Chefinnen, Waffen- und Drogenhändler sowie Kindergartenleiter gibt: Carla, Walter, Stanislav und Sascha waren Menschen, auf deren Gesellschaft ich mich freute. Mit ihnen konnte man mit einer unkonventionellen, fast kindlichen Freude an absurdem Blödsinn feiern, wie ich es sonst nur aus meinen Studiennächten oder aus meiner Bundeswehrzeit kannte.
Ich versuchte, meinem Achtsamkeitscoach diesen Sachverhalt zu erklären, ohne den Mord an Dragan zu erwähnen.
»Es gibt da eine Gruppe von Mandanten aus dem Milieu, die ich beruflich berate. Wir treffen uns regelmäßig in lockerer Atmosphäre. Ich mag diese Treffen. Ist mal was anderes. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich ja auch gleich mit meinem Geburtstag verbinden.«
Auch aus dieser lapidaren Information konnte Herr Breitner tiefgründige Schlussfolgerungen ziehen.
»Sie treffen sich also lieber mit Menschen, bei denen die Rollen und die Beziehungen zu Ihnen geklärt sind, als sich auf völlig neue Menschen einzulassen?«
Ich überlegte, was daran falsch sein könnte. Ich kam nicht drauf.
»Richtig. Ist da irgendetwas dran auszusetzen?«
»Es soll Menschen geben, die gehen mit echten Freunden am Geburtstag auf Partys.«
Da ich meinen sehr begrenzten Freundeskreis nicht näher erläutern wollte, erläuterte ich lieber meine Abneigung gegenüber Partys.
»Ich kann mit diesem ganzen aufgetakelten Schaulaufen von Fremden nichts anfangen. Egal ob auf Ü-40-Partys oder bei sonst welchen Feiern. Diese immer gleichen Mein-Haus-mein-Auto-mein-Boot-Gockel-Typen, die ihre Hohlräume mit Alkohol und Designerklamotten auffüllen. Die grotesk bemalten Schnatter-Frauen, die ihre Selbstzweifel und Zukunftsangst mit Prosecco wegspülen. Final tragisch wird’s dann, wenn auf solchen Partys beide Gruppen aufeinandertreffen. Nicht meine Welt.«
In dem auf meinen spontanen Hass-Monolog folgenden Schweigen kam ich mir ein wenig verloren vor.
»Worüber sind Sie so enttäuscht?«, wollte Herr Breitner schließlich wissen.
»Ich … ich …«
»Sie werden fünfundvierzig Jahre alt und haben niemanden, der Sie deswegen abends zum Feiern einlädt, ist es das?«
Aua. Das tat weh. Traf den Kern aber ganz gut.
Ich nickte.
»Das ist also die erste negative Erkenntnis des gestrigen Abends?«, fragte ich resigniert.
»Oder die erste positive Erkenntnis des heutigen Tages. Sie würden Menschen gerne ungeschminkt kennenlernen, wissen aber anscheinend nicht, wo.«
Ich überbrückte die eintretende Gesprächspause mit einem Schluck Tee. Herr Breitner kam nach einem weiteren Schluck wieder auf mich zu.
»Aber bleiben wir bei gestern Abend. Ihr inneres Kind oder Sie – lassen wir das mal offen – hatte sich als Geburtstagsgeschenk gewünscht, feiern zu gehen. Etwas, wofür Sie ansonsten in der Regel zu erschöpft sind. Um sich Ihrer Abneigung gegen Fremde nicht stellen zu müssen, wollten Sie mit Mandanten feiern, die von Ihrem Geburtstag nichts wussten. Sie hatten sich auf den Abend gefreut und sich sogar darauf vorbereitet. Alkohol hatten Sie ganz bewusst mit eingeplant, allerdings weder, um Ihre Hohlräume aufzufüllen, noch, um Ihre Zukunftsangst wegzuspülen. Richtig?«
So zusammengefasst, hörte sich das alles ziemlich behämmert an. Ich nickte zögerlich.
»Was soll daran falsch sein?«
»Nichts. Nur dass Ihre Planung anscheinend nicht funktioniert hat. Sonst wäre der Abend ja nicht – wie auch immer – in die Hose gegangen. Sie wären heute nicht doppelt so viel zu spät wie sonst und obendrein mit dem Taxi gekommen und hätten wahrscheinlich auch bessere Laune. Also, was ist gestern Abend passiert?«
Also begann ich zu erzählen.
3 IRRITATIONEN
»Smartphones unterscheiden sich nur geringfügig von Zigaretten. Gerade wenn Sie selber Ihren eigenen Konsum eingeschränkt haben, weht der Konsum der anderen umso störender zu Ihnen herüber.«
Joschka Breitner,
»Entschleunigt auf der Überholspur –
Achtsamkeit für Führungskräfte«
ICHHATTEFÜRMEINE Undercover-Geburtstagsparty einen Tisch in der Sky-Lounge reserviert, einem Restaurant in der dreiundzwanzigsten Etage eines Fünfsternehotels. Es bot von jedem Platz aus einen fantastischen Ausblick über die Stadt. Bei klarer Sicht konnte man von hier aus bis zum nächsten Mittelgebirge sehen. Die Aussicht wurde bei schönem Wetter nur noch getoppt von der Atmosphäre der Cocktailbar auf der vorgelagerten Dachterrasse.
Hoch über den Dächern der Stadt fühlte man sich auch nüchtern schon den Dingen des Alltags da unten entrückt, erhaben, überlegen.
Als ich eintraf, stand Sascha bereits an der Bar. Sascha war Dragans ehemaliger Fahrer, gelernter Erzieher und nun der Leiter des Kindergartens, den wir nicht ganz selbstlos einer selbstverliebten Elterninitiative abgenommen hatten. Sascha und ich wohnten mittlerweile in verschiedenen Wohnungen über der neu erworbenen Kindertagesstätte.
Zu Sascha hatte ich ein fast freundschaftliches Verhältnis. Er wusste viel über mich. Mein Geburtsdatum gehörte nicht dazu.
Zu meinem bewussten Betrinken gehörte eine vorher von mir festgelegte Getränke-Reihenfolge. Ich hatte geplant, einen Gin Tonic als Aperitif zu trinken, ein Glas Champagner am Tisch, danach zwei Gläser Weißwein beim Essen und zum Abschluss einen doppelten Wodka. Wenn ich dazu parallel zwei Liter Wasser tränke, würde ich bei dem Alkoholkonsum in Relation zu meinem Körpergewicht gut angetrunken ins Bett fallen und am nächsten Morgen fit wieder aufstehen können.
Und sollte meinem völlig untrainierten Magen das Ganze irgendwann sauer aufstoßen, hatte ich für alle Fälle ein paar Talcid-Tabletten dabei.
Mit meinem ersten Gin Tonic in der Hand freute ich mich auf die Ankunft von Carla, Stanislav und Walter, die alle innerhalb der nächsten Viertelstunde eintrafen.
Carla, ein ehemaliges Callgirl, war, aufgrund meiner seriösen Umgestaltung von Dragans Rotlicht-Betrieben, nun die Geschäftsführerin von »S-Exclusive«, einem hochklassigen Escortservice. Sie hätte, rein optisch, auch die weltläufige Empfangschefin eines Fünfsternehotels sein können. Nur ihr derber Humor und das unvermittelt aus ihr herausbrechende lebensbejahende Lachen standen dazu im Kontrast.
Walter, ein ehemaliger Berufssoldat, leitete die Firmensparte »S-Protection«. Offiziell ein Security-Unternehmen. Inoffiziell waren Walters Jungs und Mädels zuständig für einen lukrativen Handel mit Kleinkaliberwaffen sowie die muskuläre Animation von argumentativ unzugänglichen Geschäftspartnern. Walter war der Typ Mann, den Otto Normalbürger im Baumarkt immer um Hilfe bitten kann, wenn er den Rindenmulch für den Vorgarten nicht alleine auf den Wagen hieven kann. Walter würde dem Otto Normalbürger aber auch ohne jede Gefühlsregung den Rindenmulch-Vorgarten in Schutt und Asche legen, wenn er dafür bezahlt würde.
Stanislav hatte nach dem Ableben von Toni – einem weiteren Officer in Dragans Clan – dessen Drogenhandel übernommen. Die Drogen wurden über eine Reihe von Clubs und Diskotheken vertrieben, aus deren Besucherinnen sich auch der Nachwuchs für Carlas »S-Exclusive« rekrutierte. Stanislavs Geschäft firmierte unter dem Namen »S-Events«.
Sascha hielt uns als Leiter des Kindergartens »Wie ein Fisch im Wasser« mit der Vergabe von Kindergartenplätzen all die Menschen gefügig, die wir mit Sex, Drogen und Gewalt alleine nicht genügend unter Druck setzen konnten.
In einer Ecke der Dachterrasse war ein Bereich für ein Firmenevent abgetrennt. Der chinesische Hersteller von Solar-Panels schien hier für Geschäftskunden einen kleinen Umtrunk zu veranstalten. Wie mir der Concierge schon bei meiner Buchung mitgeteilt hatte, fand in diesen Tagen eine Messe für erneuerbare Energien statt, und das Hotel war weitgehend ausgebucht mit deren Besuchern.
Walter teilte uns voller Stolz mit, dass er sich von exakt dieser Firma am letzten Wochenende ein paar Solar-Panels gekauft und aufs Dach gesetzt habe. Selbst montiert.
Ich fühlte mich nach einem Dreiviertel Gin Tonic bereits angenehm angeheitert. Und frei. Als ich gerade anregen wollte, an den reservierten Tisch im Innenbereich zu wechseln, klingelte Carlas Handy.
Ich mochte es nicht, wenn bei Treffen irgendwelcher Art irgendwelche Handys klingelten.
Meinen eigenen Handykonsum hatte ich aus Gründen der Achtsamkeit auf ein Minimum reduziert. Ich hatte zwei Telefone: ein berufliches Smartphone und ein privates »Vintage«-Handy. Teil meiner Digital-Detox-Strategie war es, das Smartphone nur dann einzuschalten, wenn ich es wirklich brauchte. Um trotzdem im Notfall für meine Ex-Frau und Emily erreichbar zu sein, war dafür mein altes Nokia-Handy immer an. Aber niemand außer Katharina und mir kannte dessen Nummer.
Für mich war es nicht nur eine Sache der eigenen Einstellung zur permanenten Erreichbarkeit, nicht permanent erreichbar zu sein. Es war für mich auch eine Frage des Respekts meinem Gegenüber gegenüber, das Telefon zumindest auf lautlos zu stellen, wenn ich meine Zeit gerade bewusst mit anderen teilte.
Carla schien das anders zu sehen.
Da mein Gesicht offensichtlich nicht über die Fähigkeit verfügte, meine innersten Wünsche mimisch verständlich nach außen zu tragen, drehte sie sich zur Seite und nahm das Gespräch an.
Wenn schon anderen meine nicht kommunizierten Regeln egal waren, dann konnte ich mich auch darüber hinwegsetzen. Ich bestellte mir einen ungeplanten Gin Tonic und unterhielt mich mit Walter über die Frage, wie viele Quadratkilometer Solar-Panels wohl nötig seien, um bei Windstille eine Windradfabrik betreiben zu können. Die mangels Fachkenntnis ins Nichts führende Diskussion endete, als ich Carlas sehr lauten Gesprächsfetzen hörte: »… dann verlass sofort das Zimmer und komm rauf auf die Dachterrasse. Ja – notfalls im Bademantel.«
Carla legte auf und wandte sich wieder zu uns.
»Das war gerade Chayenne, sie ist neu bei mir«, erklärte sie.
Niemand heißt gerne Chayenne. Es gibt im Grunde nur drei Gründe, warum jemand Chayenne heißt: Man ist entweder ein zweimotoriges Propellerflugzeug oder man hat Eltern mit einem zweifelhaften Geschmack in Sachen Namensgebung. Alle anderen Chayennes brauchten auf die Schnelle einen Arbeitsnamen als Prostituierte.
»Chayenne ist für heute Abend hier im Hotel gebucht. Der Kunde verlangt Sachen von ihr, die … also … ich hab ihr gesagt, sie soll sofort das Zimmer verlassen und hochkommen. So lasse ich mit meinen Mädels nicht umspringen! Was dagegen, dass ich sie gebeten habe hochzukommen?«
Wer war ich, um Einwände zu erheben?
Ich war zu feige, meinen Mitarbeitern zu sagen, dass ich an meinem Geburtstag nicht alleine sein wollte. Stattdessen spielte ich ihnen vor, dass ich ihnen mit einem Incentive-Essen etwas Gutes tun wolle. Es wäre also völlig inkonsequent, meinen Mitarbeitern zu verbieten, auch ihren Mitarbeitern etwas Gutes zu tun. Nichts sprach dagegen, auch Chayenne auf dem Dach willkommen zu heißen. Bis auf die Tatsache, dass der Grund des Abends, mein ungestörter Undercover-Geburtstag ohne neue Menschen, dabei unter die Räder zu kommen drohte.
Wenige Minuten später traf eine immer noch vor Empörung aufgelöste mittezwanzigjährige Dame auf der Dachterrasse ein. Der Effekt, dass sämtliche Gespräche auf dem Hoteldach sofort verstummten, war den beiden Umständen geschuldet, dass Chayenne zum einen fantastisch aussah und dies zum anderen durch den nur sehr locker um ihre Dessous geschwungenen Bademantel kaum steigerbar unterstrich. Ihre eigentlichen Klamotten trug sie unter dem Arm. Carla nahm Chayenne in den ihren und tuschelte mit ihr wie eine große Schwester.
Um nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf uns zu lenken, bat ich meine beruflichen Freunde und Chayenne schließlich an den reservierten Tisch im Inneren des Restaurants.
Ich legte Chayenne im Gehen mein Sakko um den Bademantel, was dazu führte, dass sie sich auf dem Platz neben mir niederließ. Im Sitzen sah sie nun fast bekleidet aus. Und immer noch verboten attraktiv.
Zwei Kellner gossen uns den gekühlt bereitstehenden Champagner ein.
Chayenne erzählte uns, was im Hotelzimmer vorgefallen war. Ihr Kunde, ein chinesischer Geschäftsmann, der offensichtlich an der gerade stattfindenden Messe für erneuerbare Energien teilnahm, hatte im Vorgespräch ein paar ziemliche schräge Wünsche geäußert.
»Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dieser Typ von mir verlangt hat! Er wollte …«
Es folgte eine Reihe von sexuellen Wünschen, auf die ich, bei aller Fantasie, im Leben nicht selber gekommen wäre. Keiner davon erregte mich. Aber viele Mütter aus dem Kindergarten meiner Tochter erregten mich auch nicht. Und augenscheinlich hatte trotzdem jemand mit ihnen geschlafen. Zum Sex gehören halt in der Regel mindestens zwei Menschen mit der gleichen Vorstellung von Toleranz. Und wenn Chayenne – in meinen Ohren verständlich – den Wünschen ihres chinesischen Kunden die dafür notwendige Toleranz nicht entgegenbringen konnte, dann gab es eben keinen Sex.
»Ich habe Nein gesagt, mich im Bad eingeschlossen, um mit Carla zu telefonieren. Als sie gesagt hat, ich soll sofort auf die Dachterrasse, hab ich meine Sachen gepackt und bin raus. Wo ist denn meine … Mist … ich glaub, ich habe meine Handtasche im Zimmer gelassen …«
Sie hatte Nein gesagt und das Zimmer verlassen. Damit hätte die Sache beendet sein können.
Ich hob mein Champagnerglas, um diese kleine Störung des Abends offiziell für beendet zu erklären.
Aber Stanislav war schneller.
»Er wollte dir was in den …?«
»Leute, bitte!«, unterbrach ich sofort. »Die Sache ist geklärt. Chayenne ist hier. Der Typ nicht. Damit ist das Thema erledigt.«
Alle schauten mich an. Niemand erhob das Glas.
»Sorry, wenn ich da mal kurz interveniere«, machte sich Carla bemerkbar. »Aber ich meine nicht, dass wir hier einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Das ist schlicht frauenverachtend, wenn sich jemand so danebenbenimmt. Wenn wir hier kein Zeichen setzen, lernt der Typ doch nie, dass man so was nicht macht.«
»Es ist aber nicht unsere Aufgabe, chinesische Geschäftsleute pädagogisch zu betreuen«, warf ich ein. Immer noch mit dem Glas in der Hand.
»Was meinst du, Sascha, als Pädagogik-Experte? Was macht man mit solchen Typen?«, wollte Stanislav wissen.
»Sascha ist Leiter eines Kindergartens, kein Experte für asiatische Freier.« Mein Glas schwebte immer noch vor meinem Mund. Vor Saschas Mund schwebte bereits die Antwort.
»Also«, ließ er uns an seinem Wissen als Kindergartenleiter teilhaben, »es ist bei Streitigkeiten immer sinnvoll, die Beteiligten die Rolle des anderen nachvollziehen zu lassen.«
»Okay …«, verarbeitete Carla die Information. »Wie wäre es dann, wenn der Typ einfach mal selber die Erfahrung macht, etwas in den Hintern gesprüht zu bekommen, was er nicht will?«
Das war auf der einen Seite genau der unkonventionelle Humor, den ich an meinen Mitarbeitern so schätzte. Er war mir allerdings ein wenig zu moralisch aufgeladen. Und vor allem drohte dieser Humor gerade, meine achtsam geplante Abendplanung zu unterwandern.
Ich stürzte mein mittlerweile sinnlos in der Luft schwebendes Champagnerglas hinunter und intervenierte.
»Ich glaube nicht, dass das notwendig ist. Wie Chayenne schon gesagt hat, wollte der Typ doch auch selber von Chayenne die Sprühsahne in den …«
Doch Walter überholte mich bereits inhaltlich: »Wie wäre es dann mit Bauschaum? Das ist etwas, was er nicht wollte.«
Fröhlich nickende Gesichter am Tisch. Fassungslosigkeit bei mir.
Mit Menschen aus der Halbwelt konnte man eine Menge Spaß haben. Es war mir allerdings auch nach Jahren der Zusammenarbeit nicht möglich, ihren derb-infantilen Humor komplett zu teilen. Ich war außerdem lange genug dabei, um zu wissen, dass Walter seinen Scherz nicht nur absolut ernst meinte, sondern auch für moralisch gerechtfertigt hielt. Der erfrischend andere Humor, mit dem ich meinen Geburtstag versüßen wollte, drohte, ihn jetzt zu versalzen.
»Ihr könnt doch nicht …«, setzte ich an.
Carla ignorierte mein Bemühen, die Sache gütlich beizulegen.
»Gute Idee. Aber wo sollen wir denn um die Uhrzeit noch Bauschaum herbekommen?«
Interessanterweise sah Carla in Walters Vorschlag lediglich ein logistisches Problem.
»Hab ich im Kofferraum. Brauchte ich, um die Solar-Panel-Verschraubung wasserdicht im Dachstuhl zu befestigen. Das Zeug wird hart wie Kruppstahl.«
»Hat der Bauschaum im Chinesen denn genug Luft, um aufzuschäumen und auszuhärten?«, war Stanislavs einzige Sorge.
»Das Aufschäumen funktioniert, glaube ich, über den Druckabfall. Ist wie beim Ausperlen von Kohlensäure, wenn du die Mineralwasserflasche aufdrehst.«
Ich musste dazwischengehen.
»Leute – ihr könnt doch nicht ernsthaft einem chinesischen Geschäftsmann den Hintern mit Bauschaum auffüllen, nur weil er ein paar exotische Wünsche gegenüber einem unserer Callgirls geäußert hat«, wollte ich die Kirche im Dorf lassen.
»Frauenverachtende exotische Wünsche«, korrigierte mich Stanislav.
»Blanker Sexismus«, ergänzte Carla.
»Wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung als Arbeitgeber«, trug Walter bei.
Das war nicht mehr der unkonventionelle Humor, den ich von früher kannte und mochte. Meine Teilzeitfreunde hatten ihre Unschuld an die Moral verloren.
Ich hörte etwas klicken. Es war der Verschluss eines Kästchens. Es war die Büchse der Pandora.
4 EIGENINITIATIVE
»Wenn Ihre Mitarbeiter Eigeninitiative zeigen, erfordert das von Ihnen Vertrauen. Schauen Sie dazu nicht ängstlich auf mögliche Risiken. Schöpfen Sie achtsam Mut aus dem Moment heraus.«
Joschka Breitner,
»Entschleunigt auf der Überholspur –
Achtsamkeit für FÜHRUNGSKRÄFTE«
MIRWARNICHT ganz klar, was frauenverachtender war: als Kunde ein Callgirl zu fragen, was es gegen Geld zu tun bereit wäre, oder – wie wir alle am Tisch – von dem Geld zu leben, das die Dame dafür bekam, dass sie es tat. Aber es ist immer einfacher, den Teil des Problems zu lösen, den man nicht selber darstellt.
Was mir allerdings sehr klar war, war, dass ich in diesem Kreis keine Sexismus-Debatte führen wollte. Nicht an meinem Geburtstag. Nicht mit alkoholisierten, zeitgeistbeseelten Milieugrößen.
Als Übersprungshandlung goss ich mir selber den Champagner nach und trank das Glas sofort aus, in der Hoffnung, in der Zwischenzeit würde irgendjemand die Büchse der Pandora schon wieder schließen. Aber das war nicht der Fall.
Es mag auch an meinen zwei Gin Tonics und den zwei Gläsern Champagner gelegen haben, dass sich die Diskussion von nun an überschlug. Zumindest fühlte es sich für mich so an.
»Wir sollten jetzt runter zu diesem Mr. Yellow gehen und ein Zeichen setzen. Für Gendergerechtigkeit«, begeisterte sich Walter nicht ganz ohne Pathos.
Sascha schien das kritisch zu sehen.
Als Leiter des Kindergartens nahm er an einer Vielzahl von Fortbildungskursen teil. Schließlich konnte man Kinder nur dann auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam machen, wenn die zuständigen Erwachsenen über die dafür notwendige Sensibilität verfügten.
Früher reichte es, Zwei- bis Fünfjährigen liebevoll den Unterschied zwischen »meins und deins«, »beißen und reden« oder »mit oder ohne Windel« nahezubringen. Heute rückten – völlig zu Recht – fundierte Kenntnisse über Diversität, Gendergerechtigkeit und latenten Rassismus in den Vordergrund. Und über all diese Themen hielt sich Sascha regelmäßig durch Fortbildungskurse auf dem Laufenden. Sein Wissen sollte uns auch hier bereichern. Zumindest in Bezug auf Walters Formulierung.
»Ich bin mir nicht sicher, aber das könnte rassistisch sein …«, merkte Sascha an.
»Was bitte soll an meinem Bauschaum rassistisch sein?«, wollte Walter wissen
»Der Bauschaum ist nicht das Problem«, konkretisierte Sascha. »Aber der Begriff ›Mr. Yellow‹ ist rassistisch. Der würdigt den Typen aufgrund seiner ethnischen Herkunft herab.«
»Mehr, als eine Tube Bauschaum im Hintern es könnte?«, fragte ich ein wenig zu leise und wurde von Chayenne übertönt.
»Wieso? ›Mr. Yellow‹ ist doch lediglich eine Tatsachenbeschreibung. Der Typ in Zimmer 498 kommt schließlich aus dem Land des Lächelns und hat ganz offensichtlich einen Penis.«
»Richtig. Und als Chinese ist er ja wohl auch eine Person of Color. Sonst würden wir ihn ja nicht ›Mr. Yellow‹ nennen«, gab Sascha zu bedenken.
Das wurde mir zu bunt.
»Leute – es ist doch völlig egal, welche Hautfarbe jemand hat«, platzte es aus mir heraus.
»Richtig«, sekundierte mir Walter, um dann in die komplett andere Richtung zu marschieren. »Die Hautfarbe ist keine Entschuldigung für Sexismus. Der Typ bekommt jetzt seine Lektion.«
Er stupste Stanislav an. Beide schienen sich einig zu sein, ihren Bauschaum-Plan in die Tat umzusetzen. Und schauten mich an.
Ich spürte, wie mir vom Zwerchfell aus eine unangenehme Kälte nach oben in Richtung Kehle kroch. Diese Form des Aktionismus ging mir zu weit. Ich musste etwas unternehmen. Und sei es nur gegen die unangenehme Kälte.
Joschka Breitner hatte mich gelehrt, dass nicht eine konkrete Situation das Problem war, sondern immer nur meine Einordnung dieser Situation.
Ich ordnete den Plan, einen wildfremden Mann für die verbale Äußerung seiner sexuellen Vorlieben massiv körperlich zu misshandeln, als moralisch verwerflich ein.
Das rief dieses unangenehme Kältegefühl in mir hervor.
Ich versuchte also, die Situation zunächst einmal nicht einzuordnen, sondern wertungsfrei und liebevoll zu betrachten.
Hier saßen ein paar Mitarbeiter am Tisch, die in Bezug auf eine beruflich aufgetretene Problemstellung Eigeninitiative zeigen wollten.