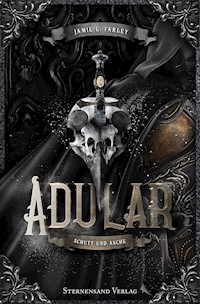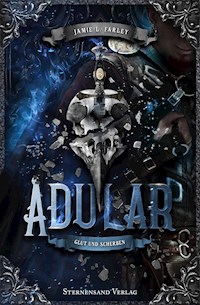
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Adular
- Sprache: Deutsch
Aus Schutt und Asche erhoben sich die Dunkelelfen. Rauch und Feuer brachte ihre Rebellion über Adular. Auf Glut und Scherben kämpfen sie nun für ihre Freiheit. Ein Bürgerkrieg ist im Kaiserreich entbrannt und spaltet Adular. Was einst eine Rebellion war, wurde zu einer Revolution. Auf der einen Seite stehen die Grauwölfe, angeführt vom ehemaligen Assassinen Valion. Ihm ist es gelungen, einen mächtigen Verbündeten zu gewinnen – Theodas, verstoßener Bruder des amtierenden Kaisers. Er vereint die Rebellen unter sich und will mit ihrer Hilfe den Thron beanspruchen. Ihnen gegenüber steht mit Kaiser Galdir allerdings ein schier unbezwingbarer Gegner. Er befehligt ein gewaltiges Heer und selbst die Assassinengilde Umbra gehorcht seinem Wort. Doch der Kampf um die Macht bewegt sich auf dünnem Eis, Verräter lauern nicht nur in den gegnerischen, sondern auch in den eigenen Reihen. Valion weiß, dass dies die letzte Chance für sein Volk ist. Wenn er scheitert, gibt es keine Hoffnung mehr für die Dunkelelfen Adulars.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Landkarte
Prolog – Taremia
Kapitel 1 – Dûhirion
Kapitel 2 – Elanor
Kapitel 3 – Dûhirion
Kapitel 4 – Taremia
Kapitel 5 – Dûhirion
Kapitel 6 – Elanor
Kapitel 7 – Theodas
Kapitel 8 – Maryn
Kapitel 9 – Valion
Kapitel 10 – Nara
Kapitel 11 – Elanor
Kapitel 12 – Valion
Kapitel 13 – Hastor
Kapitel 14 – Casas
Kapitel 15 – Valion
Kapitel 16 – Hastor
Kapitel 17 – Dûhirion
Kapitel 18 – Casas
Kapitel 19 – Taremia
Kapitel 20 – Arik
Kapitel 21 – Elanor
Kapitel 22 – Valion
Kapitel 23 – Maryn
Kapitel 24 – Elanor
Kapitel 25 – Valion
Kapitel 26 – Elanor
Kapitel 27 – Dûhirion
Kapitel 28 – Hastor
Kapitel 29 – Valion
Kapitel 30 – Dûhirion
Kapitel 31 – Maryn
Kapitel 32 – Elanor
Kapitel 33 – Dûhirion
Epilog – Môrien
Dank
Glossar
Jamie L. Farley
Adular
Band 3: Glut und Scherben
Fantasy
Adular (Band 3): Glut und Scherben
Aus Schutt und Asche erhoben sich die Dunkelelfen.
Rauch und Feuer brachte ihre Rebellion über Adular.
Auf Glut und Scherben kämpfen sie nun für ihre Freiheit.
Ein Bürgerkrieg ist im Kaiserreich entbrannt und spaltet Adular. Was einst eine Rebellion war, wurde zu einer Revolution. Auf der einen Seite stehen die Grauwölfe, angeführt vom ehemaligen Assassinen Valion. Ihm ist es gelungen, einen mächtigen Verbündeten zu gewinnen – Theodas, verstoßener Bruder des amtierenden Kaisers. Er vereint die Rebellen unter sich und will mit ihrer Hilfe den Thron beanspruchen.
Ihnen gegenüber steht mit Kaiser Galdir allerdings ein schier unbezwingbarer Gegner. Er befehligt ein gewaltiges Heer und selbst die Assassinengilde Umbra gehorcht seinem Wort.
Doch der Kampf um die Macht bewegt sich auf dünnem Eis, Verräter lauern nicht nur in den gegnerischen, sondern auch in den eigenen Reihen. Valion weiß, dass dies die letzte Chance für sein Volk ist. Wenn er scheitert, gibt es keine Hoffnung mehr für die Dunkelelfen Adulars.
Der Autor
Jamie L. Farley wurde 1990 in Rostock geboren. 2010 zog er nach Leipzig und machte dort eine Ausbildung zum Ergotherapeuten. Schnell merkte er jedoch, dass das nicht der richtige Job für ihn ist, weshalb er sich entschlossen hat Pokémontrainer zu werden. Er ist in Leipzig geblieben und wohnt zusammen mit seiner besten Freundin Anika, einer Ente namens Dave und dem Haus-zombie Bradley in einer WG. Neben der Schreiberei gehören Videospiele zu seiner liebsten Freizeitbeschäftigung. Nach dem Veröffentlichen von zwei Kurzgeschichten, erschien sein Debüt ‚Adular (Band 1): Schutt und Asche‘ Anfang 2019 im Sternensand Verlag.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, Dezember 2021
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2021
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig
Korrektorat Druckfahne: Sternensand Verlag GmbH | Jennifer Papendick
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-229-8
ISBN (epub): 978-3-03896-230-4
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Verena.
Du bist ein wundervoller Mensch und ich bin sehr glücklich,
dass ich dich kennenlernen durfte.
Ganz viel Grüne Liebe für dich,
Schnapper.
Prolog – Taremia
Sechs Monate zuvor
»Canis Lupus ist tot«, eröffnete Kaiser Galdir seine feierliche Ansprache. »Es liegen düstere Wochen hinter uns. Die Gewalt der dunkelelfischen Rebellen schien immer stärker zu werden. Orlean und Malachits Farmen fielen ihnen zum Opfer. Ihr blutiger Angriff auf Kelna war mit Abstand der abscheulichste von allen. Doch mein Adular hat wieder einmal bewiesen, dass es sich von nichts und niemandem in die Knie zwingen lässt. Orlean, die Farmen, Kelna … wir haben sie mit gemeinsamer Kraft wieder aufgebaut.«
Die Oberschicht von Malachit jubelte einstimmig. Sie hoben ihre Kelche in Euphorie oder klatschten begeistert in die Hände. Aus dem Meer der Stimmen stiegen vereinzelnd Rufe hervor wie gewaltige Wellen, die über die glückselige Masse hinwegrauschten.
»Lang lebe Kaiser Galdir von Adular!«, brüllte ein Mann.
»Tod den Rebellen«, johlte ein zweiter, deutlich angetrunkener Kerl. »Qualen und ewige Sklaverei den Grauhäuten.«
»Ich wusste von Anfang an, dass diese Rebellion nichts weiter ist als heiße Luft«, fuhr der Kaiser fort. »Ich wusste, dass Adular zu stark ist, um unter ein paar Grauhäuten zu zerbrechen. Jeder Angriff der Grauwölfe auf mein geliebtes Reich war ein Schritt in ihr Verderben. Der Anschlag auf die Tiefbruch-Minen letztlich der finale Nagel im Sarg. Ja, es war mein verstoßener Bruder Theodas, der den entscheidenden Schlag gegen Canis Lupus ausführte. Doch es war allein meiner Güte zu verdanken, dass Theodas überhaupt nach Adular zurückkehren konnte. Ich ließ ihn gewähren, wollte wissen, ob er sich im Exil gebessert hat. Und er hat meinem Reich einen großen Dienst erwiesen.«
Die Hochelfin Taremia, ihres Zeichens Gildenmeister der Assassinenorganisation Umbra, enthielt sich der allgemeinen Euphorie. Je länger sie seiner blasierten Rede zuhören musste, desto stärker wurde ihre Übelkeit. Es war kaum auszuhalten, wie sehr Galdir versuchte sich mit fremden Federn zu schmücken. Er stand stolz und erhaben auf seiner Empore. Gehüllt in die teuersten roten Stoffe, geschmückt mit allerlei Gold und Diamanten, war er ein Abbild von adeliger Dekadenz und Maßlosigkeit. Die Krone thronte mehr auf seinem Haupt, als dass sie es zierte. Mit großen Gesten breitete er die Arme aus, als wollte er den gesamten Saal umschließen. Die Rubine an seinen zahlreichen Ringen glänzten wie frisches Blut in der untergehenden Abendsonne.
»Ich hätte mir kein schöneres Geschenk für den hundertsten Geburtstag meiner liebreizenden Tochter wünschen können«, fuhr Galdir fort.
Unter neuerlichem Jubel erhob sich die Prinzessin und machte einen vornehmen Knicks.
Taremia schwenkte ihren Weinkelch. Oh, ich denke schon, dass es etwas Schöneres gäbe, dachte sie trocken. Schließlich warst es nicht du, der Canis Lupus zur Strecke gebracht hat.
Die Botschaft von Theodas Eilrans Sieg über den gefürchteten Rebellenanführer hatte sich wie ein Lauffeuer in Adular verbreitet. Aus Galdirs verhasstem Bruder, der als Verräter gebrandmarkt und für hundert Jahre ins Exil geschickt worden war, wurde über Nacht ein Held.
»Heute wollen wir feiern«, rief der Kaiser. »Zu Ehren meiner wunderschönen Tochter. Und natürlich auch, weil die Dunkelelfen mit ihrer Rebellion kläglich gescheitert sind. Esst und trinkt! Seid fröhlich!«
Der Applaus wallte auf, und der Kaiser ließ sich auf seinem Thron nieder. Mit einer simplen Handbewegung gab er zu verstehen, dass der Prinzessin nun die Geschenke überreicht werden durften. Die Barden stimmten das erste Lied des Abends an, und die Adeligen machten sich über das bereitgestellte Festmahl her.
Taremia wand sich leicht auf ihrem Platz und versuchte eine einigermaßen bequeme Sitzhaltung einzunehmen. Dank ihres Unterbrustmieders und der gewölbten Rückenlehne des Stuhls war das nahezu unmöglich. Damit hatte sie gerechnet, Bequemlichkeit war auf diesen Festen stets optional, doch beschwerdefrei atmen wollte sie dennoch. Wenigstens halbwegs.
Missgelaunt ließ sie den Blick schweifen. Der Saal war ein Fest für alle Sinne. Prunkvoll geschmückt mit funkelndem Tand und Juwelen. Malachits Oberschicht saß an langen Tafeln, auf denen die köstlichsten und teuersten Speisen des Landes aufgetischt waren. Wein und Bier flossen in rauen Mengen; geschäftige Sklaven liefen durch die Reihen und boten neue Getränke oder besondere Häppchen an.
Verschiedene Düfte schwängerten die Luft: Parfüms und Speisen, der Schweiß der Gäste und der laue Sommerwind. Gedämpfte Musik mischte sich mit dem heiteren Geplapper aus vielen Mündern, Gelächter, Gesang und Gemurmel.
Taremia hasste alles davon. Aber das durfte sie sich nicht anmerken lassen. Festlichkeiten in Adelskreisen waren immer eine Farce. All die glänzenden Gewänder aus sündhaft teuren Stoffen, die kunstvoll gestalteten Frisuren und aufwendige Schminke – nichts als Maskerade. Keine noch so strahlende Fassade konnte darüber hinwegtäuschen, dass sich dahinter nichts als faules Holz befand. Die meisten Anwesenden hatten mindestens so viele Leichen im Keller wie Taremia selbst.
Die Augen der Oberschicht waren immer wachsam. Suchten nach Schwäche, der kleinsten Trübung des schönen Scheins. Fanden sie ein Opfer, das es wagte, zu viel von seinem Innenleben preiszugeben, würden sie sich darauf stürzen. Nicht mit Zähnen und Klauen, sondern mit wohl gewählten Worten, höhnischen Blicken und einer honigsüßen Verachtung, die ihre Schärfe erst zeigte, wenn sie sich tief ins Sein des Opfers gegraben hatte.
Taremia kannte ihre Rolle in diesem Umfeld. Sie lächelte, wenn es von ihr erwartet wurde, betrieb Konversation mit anderen Gästen und gab sich den alleinstehenden Herren höflich, aber distanziert. Obwohl sie manch einer Edeldame gern das dümmliche Grinsen aus der Visage gebrannt hätte. Nur ein Mal wollte sie einem der aufdringlichen Männer, die sie trotz mehrfacher Abfuhr nicht in Ruhe ließen, eine Gabel oder das Knie zwischen die Beine rammen.
Taremia seufzte innerlich und widmete sich wieder ihrer klein portionierten Mahlzeit. Das Fleisch war zart genug, um ihr förmlich auf der Zunge zu zergehen, angereichert mit einer köstlichen Soße, frischem Brot und Sommergemüse. Da es sich für den Adel nicht schickte, in der Öffentlichkeit zu essen, bis ein Sättigungsgefühl einsetzte, bekam jeder nur etwas für den hohlen Zahn.
»Mädchen, was ist los mit dir? Du bist schon den ganzen Abend so still.« Einer ihrer angeheirateten Onkel, der ihr gegenübersaß, lehnte sich vor. Er lächelte anbiedernd. »Sag! Wie laufen die Geschäfte?«
Oh, wie sie ihn verabscheute. Er erinnerte sie an ihren Vater. Auch der hatte stets von oben herab mit ihr gesprochen. Sie war über zweihundert Jahre alt, dennoch nannte er sie weiterhin ›Mädchen‹. Im Suff hatte ihr Onkel einmal gesagt, dass Frauen keinen Respekt verdienten, und dann ausschweifend erklärt, warum Männer das bessere, wertvollere Geschlecht seien. Eines schönen Tages würde sie ihm seine Zunge im Mund verbrennen und ihn an der Asche ersticken lassen. Die Vorstellung brachte eine gewisse Genugtuung und half ihr, ein Lächeln aufzusetzen. »Gut, danke der Nachfrage.«
»Gab es keine Einbußen wegen der Rebellen?«, wollte er weiter wissen. »Ich habe gehört …«
Ihre Familie wusste nichts von Umbra. Taremia blieb ihnen gegenüber stets kryptisch, wenn es darum ging, wie sie ihr Geld verdiente. Natürlich tuschelten diese Taugenichtse hinter ihrem Rücken darüber, stellten Mutmaßungen an, streuten Gerüchte untereinander. Als würden sie alle einer aufrichtigen Arbeit nachgehen. Der Onkel ihr gegenüber war ein Hehler und Schmuggler, eine ihrer Tanten betrieb mehrere Bordelle und war entsprechend auch in den Sklavenhandel verstrickt. Die Liste ließ sich fortsetzen, aber Taremia hatte keine Lust, sich weiter Gedanken darüber zu machen. Sie hatte das stille Vergnügen, jedem von ihnen einmal im Monat Schutzgeld abzuknöpfen, damit die Gilde ihre wertlosen Leben verschonte.
»Es gab gewisse Engpässe, das ist wahr«, antwortete sie. »Allerdings nichts, was ich nicht wieder geradebiegen könnte.«
Ihr Onkel hob grinsend seinen Kelch. »Nun, wenn du Hilfe brauchst … Du weißt, wo du mich findest, Mädchen.«
Sie stieß lächelnd mit ihm an. »Hab Dank, werter Onkel.«
Und bete heute Nacht zu den Göttern, dass nicht irgendwann eine meiner Schattenklingen erfährt, wo sie dich finden kann.
Eigentlich war es blanker Hohn, ihre Familie als solche zu bezeichnen. Ihr Stammbaum hatte so viele Äste und Zweige, dass sie manchmal das Gefühl hatte, mit halb Adular verwandt zu sein. Bei ihrer inzuchtgeplagten Sippe würde es sie nicht einmal wundern. All die entfernten Cousins, angeheirateten Tanten und Stiefgeschwister, und keiner war zu irgendetwas zu gebrauchen.
Die Barden stimmten ein schnelleres, fröhliches Lied an, das zum Tanz einlud. Einige Elfen, Menschen und Zwerge erhoben sich und strömten in die Mitte des Raumes. Die Herren verneigten sich vor ihren erwählten Damen. Die erkorenen Frauen nahmen die nonverbale Einladung mit einem Knicks an, und gemeinsam bildeten die Paare eine Gasse.
Taremia fand Hastor. Mit seiner beeindruckenden athletischen Statur und einer Körpergröße von über zwei Metern war er auch schwerlich zu übersehen. Sein kurzes schneeweißes Haar war glatt zurückgekämmt und Taremia erwischte sich bei dem Verlangen, diese furchtbare Frisur durcheinanderzubringen. Er war mit Solana, dem Hauptmann der Wache, in ein Gespräch vertieft. Die Waldelfin trug ihre schwere Eisenrüstung mit dem Wappen der Stadt auf der Brust. An ihrer Hüfte befand sich ein Langschwert, auf dem Rücken ein robuster Schild.
In der Öffentlichkeit war Hastor immer der, den die Leute in seinem Umfeld gerade brauchten. Wurde er in die Aschegrube geschickt, um sicherzugehen, dass die Dunkelelfen weiterhin eingeschüchtert waren, zeigte er sich aggressiv und verächtlich. Den Gefangenen im Kerker von Malachit war er der gnadenlose Richter, Folterknecht und Henker zugleich. Sprach er zum Volk, war seine Miene grimmig und entschlossen.
In diesem Moment schien er entspannt, hatte ein leichtes Lächeln auf den Lippen, als würde er sich tatsächlich amüsieren. Dennoch hielten seine stechend gelben Raubtieraugen selten inne, er war stetig auf der Suche nach möglichen Bedrohungen.
Solana nickte, deutete eine Verneigung an und kehrte zu ihrem Posten zurück.
Die Tänzer in der Raummitte liefen eine Promenade. Ein Paar schritt die gesamte Gasse entlang, teilte sich am Ende auf und fand am Anfang wieder zusammen.
Die Blicke der beiden Hochelfen kreuzten sich und Taremia beschloss, dass sie fürs Erste genug von ihrer Familie hatte. Hastor war eine willkommene Ausrede, um sich zu entfernen.
Sie entschuldigte sich und verließ den Tisch. Gemächlich durchschritt sie den Saal, winkte einen dunkelelfischen Sklaven heran und beobachtete den Tanz. Der Jüngling war in feinen Zwirn gehüllt, sein schwarzes Haar ordentlich gekämmt. Um seinen Hals und seine Handgelenke trug er silbern schimmernde Ringe. Er verneigte sich still vor ihr und hielt ihr ein Tablett entgegen, das er auf einer Hand balancierte. Taremia nahm einen neuen Kelch mit Wein und nickte ihm knapp zu. Der Sklave entfernte sich schweigend.
Die Paare auf der Tanzfläche führten seichte Seitensprünge aus – links, rechts und eine Drehung über die linke Schulter. Alle im eleganten Gleichtakt, die Gasse sah aus wie eine große, lebendige Schlange, die ihren langen Leib über den teuren Holzboden bewegte. Rechts, links und eine Drehung über die rechte Schulter. Die Röcke der Damen wehten mit der Bewegung ihrer Körper, schwangen reizvoll um ihre Beine.
Taremia trank einen Schluck, ließ den Wein gemächlich über ihre Zunge wandern, ehe er ihre Kehle hinabglitt. Es war ein edler Tropfen – herb mit einem Hauch Süße. Wenigstens Speis und Trank waren schmackhaft genug, um den Rest dieser Veranstaltung erträglich zu machen.
Kaiser Galdir saß auf seinem Thron und gab sich gönnerhaft. Seine Frau hatte die Empore verlassen, plauderte ausgelassen und gekünstelt lachend mit einer Gruppe Adeliger. Seine Tochter hatte alle Hände voll damit zu tun, die unzähligen Geschenke anzunehmen, die ihr zugetragen wurden. Wenn sie nicht gerade damit beschäftigt war, Hastor schmachtende Blicke zuzuwerfen.
Ob sie ihren Vater jemals angebettelt hat, Hastor heiraten zu dürfen?, rätselte die Hochelfin.
Galdir war mit seiner Familie lange Zeit im Ausland gewesen und hatte die Rebellion gekonnt ignoriert. So lange, bis sie zu einer Bedrohung für das Kaiserreich geworden war. Angeblich war er zwischen den Reichen herumgereist, um Bündnisse zu schließen und Adulars Macht zu stärken. Er wollte seine Tochter endlich verheiraten, damit sie sich schwängern lassen konnte und ihm einen männlichen Thronfolger gebar.
Wenn es nach der werten Prinzessin ginge, hätte sie schon einen Vater für ihre Kinder im Auge, dachte die Hochelfin amüsiert. Sein Glück, dass der Stand sie trennt. Ich habe Hastor noch nicht genug damit aufgezogen.
Taremia glaubte, dass das nur die halbe Wahrheit war. Was Galdir der Bevölkerung ihrer Meinung nach verschwieg, war die Tatsache, dass die Rebellion ihn nicht gekümmert hatte. Dass er lieber alle Verantwortung an seinen Statthalter und Berater übergeben hatte, als seinen kleinen Familienurlaub vorzeitig zu unterbrechen.
Der Tanz neigte sich seinem Höhepunkt zu. Je zwei Paare schlossen sich zusammen, legten sacht ihre Hände aufeinander und liefen im Uhrzeigersinn im Kreis. Aus der Schlange waren zahlreiche Mühlenräder geworden, die sich in langsamen, fließenden Bewegungen um sich selbst drehten. Die Barden spielten den letzten Takt. Alle Tänzer kehrten zu ihrer Eingangsposition zurück und bildeten wieder eine Gasse. Das Lied endete und man dankte einander wortlos. Applaus schallte von den Tischen, und auch der Kaiser ließ sich dazu herab, für die Darstellung zu klatschen.
»Onkel Hastor«, rief eine Frau fröhlich.
Ehe Taremia ihn erreichen konnte, stürmten zwei junge Hochelfinnen, die vielleicht zwanzig Jahre alt waren, von der Tanzfläche auf ihn zu und umarmten ihn herzlich. Hastor, der zunächst überrascht schien, seine Nichten zu sehen, fing sich schnell. Er küsste sie auf die Wangen.
»Schön, dass ihr hier seid.«
Ein Jüngling gesellte sich zu ihnen. Er stand straff und hielt ihm mit strenger Miene die Hand hin. »Grüße, Onkel.«
Hastor schüttelte ihm die Hand. »Guten Abend, Neffe.« Dann zog er ihn auch an seine Brust, drückte ihn kurz an sich und klopfte ihm auf den Rücken. »Du musst nicht so förmlich sein, nur weil wir in der Öffentlichkeit sind.«
Der Jüngling lachte. »Ich wollte dir lediglich zeigen, wie gut das Kriegertraining meinem Benehmen tut.«
»Garrick bewegt sich nur noch, als hätte er einen Stock im Du-weißt-schon-wo.« Die erste Nichte kicherte.
Es war einer der wenigen Momente, in denen Hastors Panzer aus Arroganz, Boshaftigkeit und Herzenskälte aufbrach und ehrliche Zuneigung seine harten Züge wärmte. Für seine Familie ließ er einen Teil seiner Maskerade fallen. In diesem Ausnahmefall war es gesellschaftlich sogar anerkannt. Taremia wartete darauf, dass sie einige Leute miteinander tuscheln hörte, wie schön es sei, den Hochelfen heiter zu sehen. Wie herzerwärmend es sei, dass er die Liebe zu seiner Familie öffentlich zeigte. Er sei ja so ein guter Mann … Taremia verdrehte innerlich die Augen. Hastor war viel, aber sicherlich nicht das. Sie mochte ihn und behauptete, dass sie ihn besser kannte als fast alle hier. Seine Schwestern einmal ausgenommen. Wüsste auch nur einer seiner Verehrer die Dinge über ihn, die Taremia wusste, würden ihnen ihre lobenden Worte schnell im Hals stecken bleiben.
»Wann seid ihr in Malachit angekommen?«, fragte Hastor.
»Gerade eben«, antwortete die erste Nichte. Ihre blassen Wangen waren rosig und die hellgelben Augen leuchteten vor Freude. »Wir wollten dich eigentlich sofort begrüßen, doch wir konnten dem Tanz nicht widerstehen.«
»Tante Hebriel ist auch da und Tante Hiriana wird gleich hier sein«, erzählte die zweite aufgeregt. »Zusammen mit ihren Familien.«
Ein Schatten fiel für den Bruchteil einer Sekunde über Hastors Gesicht, und der Schein trübte sich. Es war zu schnell vorbei, als dass es jemand hätte bemerken können, der ihn nicht genaustens beobachtete. Man konnte es leicht für Einbildung halten, als hätten die Dunkelheit der Nacht draußen und die Lichter im Saal einem einen Streich gespielt.
Taremia wusste es besser.
»Ich verstehe.« Er lächelte wieder. »Wie schön. Es ist lange her, dass wir alle beisammen waren.«
Die Hochelfin runzelte die Stirn. Sie kam näher und räusperte sich vernehmlich. Der hünenhafte Hochelf drehte sich zu ihr um. Er war eine Wohltat für die Augen. Die feine, in dunklen Rottönen gehaltene Kleidung bedeckte, aber verhüllte ihn nicht. Die starke Brust, die breiten Schultern und straffen Oberschenkelmuskeln kamen immer noch ausgezeichnet zur Geltung.
»Frau Taremia, welch angenehme Überraschung, Euch zu begegnen.« Hastor nahm ihre behandschuhte Hand und hauchte einen Kuss auf ihre Fingerknöchel. Er war der Einzige, dem sie das gestattete. Ein angenehmer, erdiger Duft ging von ihm aus.
Taremia vollführte einen eleganten Knicks. »Es freut mich auch, Euch zu sehen, Meister Hastor«, erwiderte sie und nickte seiner Familie zu. »Ich grüße Euch. Erlaubt Ihr mir, einen Moment mit Eurem Onkel zu sprechen?«
»Selbstverständlich.« Der Neffe deutete auf eine Hochelfin. Das war Halvien, Hastors dritte Schwester. »Wir werden bei unseren Müttern auf dich warten.«
»Sagt ihnen, dass ich gleich bei euch sein werde«, antwortete Hastor.
Irgendetwas war seltsam an ihm. Taremia konnte nicht genau sagen, was. Nur eine kleine Nuance in seiner Körpersprache, die anders anmutete als sonst.
Sie wusste, dass die Situation in Adular ihn in den letzten Monaten zunehmend frustriert hatte. Alle Warnungen bezüglich der Rebellen, sowohl von seiner Seite aus als auch von den anderen Beratern, waren beim Kaiser auf taube Ohren gestoßen. Zum ersten Mal war ihr das Ausmaß seines Ärgers beim Verhör von Dûhirion aufgefallen. Nicht dass Hastor jemals zimperlich mit seinen Gefangenen umgegangen wäre. Aber dass er sich derart an der Schuld des Dunkelelfen festgebissen hatte, war selbst für ihn ungewöhnlich gewesen. Zu dem Zeitpunkt, an dem Dûhirion in Umbras Kerker gefangen gehalten wurde, hatte keinerlei Verbindung zwischen ihm und den Grauwölfen bestanden – wenn man von der Freundschaft zu Valion einmal absah.
Taremia musterte Hastor forschend. Unnötig, zu erwähnen, dass sein Missmut nach dem Untergang Kelnas und der wachsenden Stärke der Rebellen nicht weniger geworden war. Er wich ihrem intensiven Blick geschickt aus. Ihr entging das nicht. Stumm fragend zog sie die Brauen hoch.
Er schüttelte kaum merklich den Kopf. »Ich hoffe, Ihr amüsiert Euch?«
»Oh, alles ist wunderbar.« Die Hochelfin schwenkte den Kelch. »Ihr solltet den Wein kosten. Er ist wahrlich eine Gaumenfreude.«
Hastor nickte abwesend. »Das sollte ich wirklich tun …«
Gerade als sie ansetzte, ihn chiffriert zu fragen, was ihn störte, bat der Elf an Galdirs Seite lautstark um Ruhe.
Hastors Kiefer spannte sich an.
»Lasst mich erneut um eure Aufmerksamkeit bitten«, sprach Galdir. »Dieser wundervolle Tanz hat mein Herz berührt.«
Gewagt, diesen Eisklumpen in deiner Brust ein Herz zu nennen, dachte Taremia und nippte an ihrem Wein.
Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Hastor sich auf den Thron zubewegte.
»Selbst wenn es nicht unser Verdienst war, so war es doch ein Befreiungsschlag von der blutigen Tyrannei der Rebellen. Unter diesen Umständen bin ich gewillt, meinem verräterischen Bruder zu verzeihen«, fuhr Galdir fort. »Er hat uns diese räudige Grauhaut vom Hals geschafft und mit Canis Lupus wird auch der Geist dieser Rebellion sterben.«
Daran zweifelte Taremia erheblich. Dem Kaiser blieb kaum etwas anderes übrig, als Theodas zu loben. Die Leute waren erleichtert und begannen wieder, sich in Sicherheit zu wiegen. Sie fragte sich, wann Galdir damit beginnen würde, seinen Bruder erneut als schlechten Mann darzustellen. Lange würde er es nicht aushalten, Theodas als Helden feiern zu lassen.
»Doch bei aller Freude müssen wir uns auch ein gewisses Versagen eingestehen«, sagte Galdir. »Ich habe lange mit meinen Beratern gesprochen … und wir haben uns entschlossen, die Konsequenzen zu ziehen. Ich überlasse das Wort Hastor Adaël.«
Ein erstauntes Raunen ging durch den Saal.
»Bürger von Malachit.« Hastors volltönige, mächtige Stimme schien den gesamten Raum zu füllen. »Ich habe Euch im Stich gelassen. Ich schützte Euch nicht so, wie ich es hätte tun sollen. Wie Ihr es verdient hättet. Ich hätte es sein sollen, der Canis Lupus zur Rechenschaft zieht. Sein Blut hätte hier, in Malachit, vor dem Obsidianturm und zu Ehren unseres großartigen Kaisers Galdir vergossen werden müssen.«
Taremia musterte den Kaiser. Der Hochelf saß mit einem selbstgefälligen Lächeln auf seinem Thron und lauschte andächtig.
»Deshalb werde ich, auch auf Anraten des Hochwohlgeborenen, von meinem Titel zurücktreten«, sagte Hastor. »Ich habe versagt.«
Stille herrschte im Saal.
»Das darf er nicht tun«, zischte ein Mann aufgebracht. Taremia erkannte Hastors Neffen Garrick. »Er ist ein Held. Warum sollte er …«
»Still«, unterbrach ihn seine Mutter.
»Aber …« Der Jüngling verstummte.
Taremia hatte den Blick nicht von Hastor genommen. Sie bemerkte ein kurzes, dennoch außerordentlich gehässiges Zucken seiner Mundwinkel.
»Ja, ich habe versagt. Ein anderer hat es nicht. Theodas Eilran, den wir alle stets einen Verräter geschimpft haben. Den wir einen dreckigen Brudermörder nannten. Ihm ist gelungen, woran ich scheiterte«, fuhr er fort. »Und dafür gebührt ihm nicht nur unser aufrichtiger und ewiger Dank. Nein, dafür gebührt ihm unsere volle Anerkennung. Ich habe meinen Titel abgelegt, doch kraft meiner mir verliehenen und verdienten Position will ich Theodas meinen Respekt zollen. Hiermit verleihe ich Theodas Eilran den Titel ›Löwenherz‹. Denn sein Mut, seine Entschlossenheit und sein Wille waren es, die den Rebellenanführer zu Fall brachten.«
Galdirs Miene wurde immer ungläubiger. ›Löwe‹ war der höchste Titel, der in Adular verliehen werden konnte.
»Lang lebe Theodas Eilran, Löwenherz von Adular«, rief Hastor feierlich.
Und die Menge folgte ihm. Entweder, weil sie von dem überzeugt waren, was er sagte, oder um ihm zu gefallen. Vielleicht war es die Euphorie und die Erleichterung über den Sieg. Und wahrscheinlich half der Alkohol auch dabei, Zustimmung zu geben.
Hastor lächelte zufrieden. »Aber ich werde ebenfalls nicht rasten oder ruhen. Ich werde mir meinen Titel zurückholen und jeden Rebellen, der noch immer Canis Lupus dient, finden. Ich werde sie finden und töten. Und ich schwöre Euch, so wahr mein Name Hastor Adaël ist: Wir werden diese Rebellion zerschlagen.«
Unter Jubel und Applaus verließ Hastor seine Position. Galdir rief rasch wieder zu Tanz, Gesang und Heiterkeit auf. Er winkte den Elfen neben sich zu sich herunter und flüsterte ihm etwas ins Ohr.
Wie es üblich war, endete die Feier um Punkt drei Uhr nachts. Taremia hatte Hastor den restlichen Abend über nicht mehr gesehen, aber sie hätte ihn auch nicht im Kreise seiner Familie stören wollen. Dennoch konnte er sich einem Gespräch mit ihr nicht entziehen. Sie schlenderte bequem durch Malachits dunkle Straßen zu seinem Anwesen.
Schon bevor sie das Tor erreichte, schlugen seine zwei Hunde an. Taremia warf ihnen etwas Fleisch zu, das sie aus dem Saal mitgenommen hatte, und tätschelte ihnen die Köpfe.
»Warum müsst ihr nur immer so laut sein? Ihr solltet mich inzwischen lange genug kennen«, murmelte sie. »Das ist einer der Gründe, warum ich Katzen vorziehe.«
Hastor adoptierte oft die Kriegshunde, die aus irgendwelchen Gründen für untauglich befunden worden waren. Die beiden, die sein Tor bewachten, galten als zu freundlich, um in die Schlacht zu ziehen. Er hatte sie trotzdem zu brauchbaren Wächtern erzogen.
Taremia blickte zum Fenster empor. Im Zimmer dort oben brannte ein Licht. Sie trat durch das Tor und ließ sich mit einem simplen Schlüsselzauber selbst ein. Mit lautlosen Schritten stieg sie die Stufen empor, nahm den wohlbekannten Weg zu seinem Schlafgemach und klopfte an.
»Tritt ein«, drang Hastors gedämpfte Stimme zu ihr durch.
Sie öffnete die Tür und trat über die Schwelle. Vor dem Kamin lag Rhawen, eine schwarzbraune Hündin mit nur drei Beinen. Hastors Lieblingstier. Es war bereits verkrüppelt geboren worden und wohnte seit nunmehr dreizehn Jahren in seinem Haus. Rhawen erhob sich, als sie Taremia bemerkte, und tapste schwanzwedelnd auf die Hochelfin zu. Die ging mit geradem Rücken in die Hocke und gab dem Tier das letzte Stück Fleisch.
Hastor stand mit nacktem Oberkörper im Raum. Ihr Blick wanderte über seine straffen Brustmuskeln und die zahlreichen Narben auf seiner bleichen Haut. Besonders auffällig war ein kantiger Schriftzug, der ihm einst tief eingekerbt worden war. Er zog sich von seinem rechten unteren Rippenbogen schräg über den Bauch zu seinem linken Hüftknochen.
›RATTE‹.
Ein wenig charmantes Andenken von seinem Vater.
Wenn er mich als würdig empfunden hat, nannte er mich Sohn. Taremias Gedächtnis gab die Erklärung für diese Bezeichnung wieder. Wenn nicht, dann schimpfte er mich Ratte. Oder Dunkelelf.
»Sag mir, Hastor«, begann Taremia bedächtig, während sie die Hündin hinter den Ohren kratzte, »wie schmeckt eine Kostprobe deiner eigenen Medizin?«
»Bitter. Wie üblich«, antwortete er. »Dennoch bin ich mit dem Ausgang vollkommen zufrieden.«
Mit der teuren Kleidung und in der privaten Kammer hatte er auch seine Maskerade abgelegt. Sein strenges Gesicht war ausdruckslos-entspannt.
»Das habe ich dir angesehen«, erwiderte Taremia und richtete sich auf. »Wird Galdir dir das heimzahlen?«
»Davon gehe ich aus.«
Taremia musterte ihn forschend. »Ich bin mir nicht sicher, ob du alles ehrlich gemeint hast, was du sagtest.«
»Ehre und Respekt, wem sie gebühren, meine Dame«, entgegnete Hastor. »Theodas hat sich seinen neuen Titel redlich verdient. Selbst wenn er nicht viel darauf geben wird. Er hat uns einen großen Gefallen erwiesen. Nun bleibt abzuwarten, wie er weiter vorgehen wird.«
Plötzlich spürte sie Magie in der Luft knistern. Rhawens Ohren richteten sich auf. Kurz darauf klopfte es zum zweiten Mal in dieser Nacht an der Schlafzimmertür. Taremia zog sich rasch hinter den hölzernen Raumtrenner zurück.
Hastor warf sich einen Morgenmantel über und wies die Hündin an, sich vor den Kamin zu legen. Dann öffnete er dem ungebetenen Gast. »Guten Abend, der Herr. Euch ist bewusst, dass dies nicht der Haupteingang ist?«
»Ich wollte kein Aufsehen erregen«, erklärte ein Mann. »Ich bin auf Kaiser Galdirs Geheiß hier.«
Das ging schnell, dachte Taremia trocken.
Durch einen schmalen Spalt sah sie einen Menschenmann eintreten. Rhawen gab ein mahnendes Grollen von sich und fixierte den Fremden feindselig.
»Still«, befahl Hastor ihr ruhig.
Die Hündin verstummte. Doch ihre Körperhaltung blieb angespannt, das Nackenfell gesträubt.
»Der Hochwohlgeborene möchte, dass Ihr es als Erster erfahrt«, sprach der Mann und hielt Hastor einen versiegelten Umschlag entgegen. »Schließlich geht es um Eure Familie.«
Hastors Miene war unbeweglich, als er das Siegel brach und den Brief herausnahm. Schnell überflog er die Zeilen. Für einen ungeübten Beobachter mochte es erscheinen, als würde er das Schriftstück gleichgültig betrachten.
Taremia jedoch erkannte die kleinsten Veränderungen in seinem Gesicht, die ihr verrieten, dass der Inhalt dieses Schreibens ihn immens aufwühlte.
»Wann ist das passiert?«, fragte Hastor.
»Kurz nachdem sie das Fest verlassen haben.« Der Mann kam einen Schritt näher und senkte die Stimme. »Dem Kaiser hat Eure kleine Ansprache ganz und gar nicht gefallen, Hastor. Das ist die letzte Warnung.«
Taremia verschränkte die Arme vor der Brust. In jeder anderen Situation hätte es lächerlich ausgesehen, wie dieser Mann, der fast zwei Köpfe kleiner war, versuchte den Hochelfen zu bedrohen. Leider hatte er in diesem Fall tatsächlich etwas gegen Hastor in der Hand.
Rhawen erhob sich und stellte sich an die Seite ihres Herrn. Ihr Knurren war tiefer geworden; die hochgezogenen Lefzen entblößten scharfe Zähne.
Der Mann warf ihr einen flüchtigen Blick zu und ging wieder auf Abstand. »Ihr solltet aufhören, Euch Feinde in den eigenen Reihen zu machen«, sagte er. »Hat Euch das Mordkomplott gegen Euch nicht gereicht?«
Hastor streichelte der Hündin besänftigend den Kopf. »Mordkomplott?«, wiederholte er spöttisch. »Ihr meint Adam Kendalls armseliges Vorhaben, meine Position zu übernehmen? Wir beiden wissen, wie das ausgegangen ist.«
Mit drei Toten, dachte Taremia. Und einer fast schicksalhaften Begegnung von Dûhirion und Hastor. Was wäre wohl gewesen, wenn ich einen anderen Assassinen zu ihm und nach Orlean geschickt hätte?
»Wenn das alles war, möchte ich Euch nun höflich bitten zu gehen«, fuhr Hastor fort. »Ansonsten sehe ich mich gezwungen, Euch von meinen Hunden nach draußen geleiten zu lassen.«
Der Mann warf der dreibeinigen Hündin einen abfälligen Blick zu.
Hastor schenkte ihm ein boshaftes Lächeln. »Ihr wärt erstaunt, wie schnell sie auf diesen drei Beinen ist. Ein Befehl reicht, und Ihr macht unangenehme Bekanntschaft mit den Kiefern eines Kriegshundes.«
»Denkt an meine Worte, Hastor«, sagte der Mann und wandte sich ab. »Offiziell waren es die Rebellen, die diesen Überfall zu verantworten haben. Das werden alle Zeugen bestätigen können. Guten Abend.«
Taremia verließ ihr Versteck, als sie erneut Magie in der Luft knistern spürte und sicher sein konnte, dass der Fremde fort war.
Hastor saß hinter seinem Schreibtisch. Er hielt den Brief in der einen Hand und stützte seine Stirn mit den Fingern der anderen. Rhawen kauerte zu seinen Füßen und bettete ihren Kopf auf seinen Oberschenkel.
»Was ist passiert?«, fragte Taremia.
Hastors Kiefer mahlten. »Hebriel und ihre Familie sind attackiert worden«, antwortete er gepresst. Das Papier zerknitterte unter seinem fester werdenden Griff. »Die Angreifer haben Säure benutzt.«
Die Hündin winselte leise.
Er reichte Taremia den Brief. Sie überflog die Schilderung des Vorfalls sowie die detaillierte Liste der Verletzungen, die seine Familie erlitten hatte. Prellungen, ein paar Knochenbrüche und vor allem Verätzungen.
»Vielleicht lässt sich Hebriels Gesicht wiederherstellen«, sagte Hastor düster. »Aber ich fürchte, dass die Heiler angehalten sind, sich nicht allzu viel Mühe zu geben. Was Garricks Augenlicht betrifft … da besteht keine Hoffnung. Er wird blind bleiben.«
Das Antlitz des Jünglings, den sie vor wenigen Stunden getroffen hatte, flackerte vor ihrem geistigen Auge auf. Glücklich und ehrgeizig hatte er seinem berühmten Onkel nachgeeifert und eine vielversprechende Laufbahn als Krieger vor sich gehabt. Nun konnte Garrick froh sein, wenn er sich nicht an einem Brotmesser schnitt, das er zur Hand nahm.
»Galdir oder du«, murmelte Taremia. »Einer von euch beiden spielt gerne mit dem Feuer.«
Hastor rammte seine Faust auf die Tischplatte. Taremia vernahm ein dumpfes Knacken und vermutete, dass er sich soeben ein oder zwei Finger gebrochen hatte. Rhawen bellte erschrocken.
»Mistkerl«, zischte der Hochelf.
Und gerade waren wir noch bei der Frage, wie eine Kostprobe der eigenen Medizin schmeckt, dachte sie.
»Gut, ich habe seine Botschaft verstanden«, brummte Hastor.
Taremia sah ihm in die Augen. Lange hatte sie ihn nicht mehr derart aufgebracht erlebt. In den Tiefen seiner stechend gelben Iriden erkannte sie ein regelrechtes Feuer der Wut. Hastors Stolz anzugreifen, war die eine Sache. Es würde ihn verstimmen, aber keine andauernde Wirkung auf ihn haben. Wollte man ihm wirklich eine Lektion erteilen und dafür sorgen, dass er tatsächlich bereute, was er getan hatte, musste man sich an seiner Familie vergreifen.
»Entdeckst du gerade deine eigene rebellische Ader?«, fragte sie leise. »Ich hoffe, du wirst dich nicht zu weiteren Dummheiten hinreißen lassen?«
Hastor legte seine Hand auf den Kopf der Hündin. Sein Mittel- und Ringfinger waren verkrümmt und schwollen rasend schnell an. »Ich würde es nie wagen.«
Rhawen hob die Schnauze und versuchte, seine Handfläche zu lecken.
Der Hochelf stand wieder auf. »Alles, was ich sagen will, ist, dass die einen im Feuer geschmiedet werden und die anderen darin verbrennen. Die Zeit wird zeigen, wer der Hitze standhält. Und nun entschuldige mich. Ich muss zu meiner Familie.«
Taremia schwieg. Sie beide wussten, dass das schwelende Feuer unter Adular längst nicht erloschen war. Theodas hatte es gebändigt und vielleicht einige Brandherde gelöscht. Doch in absehbarer Zeit würde er es stärker entfachen denn je. Und Galdir hatte bereits gezeigt, dass er die Flammen scheute.
Kapitel 1 – Dûhirion
Gegenwart
Der erste Schnee fiel früh dieses Jahr. Die letzten Herbstblätter hingen noch braun und vertrocknet an den kargen Bäumen, als eine dichte Decke sich über das Kaiserreich Adular legte. Schmutz und Elend verschwanden unter einem reinen, strahlenden Weiß. Alles schien ein wenig stiller, ein wenig heller geworden zu sein. Eigentlich war es ein schöner und friedvoller Anblick. Doch bei Dûhirion löste er ein tief liegendes Unbehagen aus.
Der Dunkelelf starrte gedankenverloren aus dem Fenster und sah dem Flockentreiben zu. Vor seinem inneren Auge erhob sich das Gebirge Sonnenhöhe. Der Tiefbruch kauerte zu seinen Füßen, während auf den schneebedeckten Gipfeln Umbras das Ausbildungslager thronte.
Dieses Bild brachte Erinnerungen. Verdrängte Empfindungen, alte Geschmäcker und Gerüche. Längst verklungene Geräusche hallten als fernes Echo aus seinem Gedächtnis. Er hasste Frost und Kälte. Sie kratzten an alten Verletzungen, bohrten sich in das vernarbte Gewebe, bis sie auf die wunden Punkte stießen. Schlimmer als der Schmerz, der in seinen Narben brannte, war das Jucken. Es lag unter seiner Haut, quälend unerreichbar für ihn. Er wollte seine Nägel in sein Fleisch bohren und kratzen – kratzen, bis es aufhörte. Egal wie viel Blut dafür fließen, ob er sich die Haut von den Gliedern reißen musste – Hauptsache, es hörte endlich auf zu jucken.
Eine kleine Hand klopfte gegen seine Brust. Dûhirion atmete leise durch, schüttelte den Gedanken an seine Kindheit ab und konzentrierte sich auf die Gegenwart. Er befand sich nicht auf Sonnenhöhe, sondern in Amaranth, im Anwesen von Theodas Eilran. Er war nun Teil der Revolution, nicht mehr von Umbra.
Aber sie jagen mich und meine Kinder.
Seine Aufgabe war es jetzt, ein Vater zu sein und den Freiheitskampf seines Volkes zu unterstützen.
Ich war ein besserer Mörder, als ich ein Vater bin.
Sein kleiner Sohn Haldion schmiegte sich daumenlutschend an seine Brust. Dûhirion war mit ihm zu Maryn gegangen. Elanor gab derweil auf ihre Tochter Avariel acht. Sie teilten die Betreuung der Kinder, so gut es ging, untereinander auf. Es war der Waldelfin wichtig, dass immer mindestens einer von ihnen bei den Kleinen war.
»Weil sie uns brauchen«, hatte sie gesagt. »Sie müssen wissen, dass wir für sie da sind. Wir sollten sie wirklich nur in Ausnahmefällen zu den Ammen geben.«
Die Kinder und Elanor brauchen mich. Die Revolution braucht mich.
Hinter ihm spielten Nara, Maryn und Casas Karten. Ihre Stimmen huschten durch den Raum, doch er nahm ihre Worte nicht wahr.
Dûhirion strich gedankenverloren über Haldions Kopf. Der dichte Flaum schwarzer Haare fühlte sich angenehm warm und weich an. Er und Avariel waren vorgestern ein halbes Jahr alt geworden. Umso erstaunlicher waren die Fortschritte, die sie bis heute gemacht hatten. Elfenkinder entwickelten sich sowohl im Mutterleib als auch in den ersten Lebensjahren fast doppelt so schnell wie Menschen. Avariel konnte bereits ohne Unterstützung laufen und war verdammt schnell auf ihren kurzen Beinen. Haldion hatte schon sein erstes Wort gesprochen.
»Nein«, rief sein Sohn und streckte seine Hand aus.
»Schnee«, korrigierte Dûhirion und öffnete das Fenster.
Er holte eine Handvoll vom Sims und hielt Haldion den Schnee entgegen. Der kleine Elf griff danach, schreckte nicht vor der Kälte zurück und beobachtete fasziniert, wie er auf seiner graustichigen Haut schmolz. Er schüttelte seine nasse Hand und richtete den Blick seiner großen dunkelvioletten Augen dann wieder in den Himmel. »Ah!«
»Mhm«, brummte Dûhirion. »Wenn du älter bist, darfst du deinen Onkel Valion damit bewerfen.«
Haldion fuchtelte mit seinem Arm und steckte sich glucksend die Faust in den Mund. »Nein«, nuschelte er abermals.
»Doch. Glaub mir, das wird Spaß machen.«
»Wenn du nicht willst, dass der Kleine sich erkältet, solltest du nicht mit ihm am offenen Fenster stehen«, riet Casas vom Tisch her.
Dûhirion fluchte innerlich und schloss das Fenster eilig. Das hatte er nicht bedacht.
Casas, ein ehemaliger Söldner, agierte als Theodas’ rechte Hand. Sein Äußeres mutete ungewöhnlich für einen Waldelfen an und brachte ihm mit Sicherheit viele spöttische Bemerkungen ein. Er war unrasiert, sein dunkelbraunes Haar zu lang für einen Mann. Statt in den traditionellen Farben seines Volkes – grün, weiß und braun – kleidete er sich in den Rottönen des hochelfischen Adels.
Dûhirion fragte sich manchmal, ob Casas sich bewusst von seinem Volk abgrenzte und sich mehr den Hochelfen zugehörig fühlte. Oder ob er generell wenig Wert auf Konventionen legte und schlichtweg das tat, was seinen persönlichen Geschmack traf.
»Ein bisschen frische Luft wird ihm schon nicht schaden«, erwiderte Maryn und mischte die Karten neu.
Ihr blondes Haar war wesentlich länger als noch im Sommer und reichte inzwischen bis zu den Ellenbogen. Die untere Gesichtshälfte der Zwergin war entstellt; schwere Brandnarben verzerrten ihre Lippen, zogen sich über ihr Kinn bis zu ihrer Kehle. Für gewöhnlich verbarg Maryn sie unter einem Tuch, aber in einer lockeren Gesellschaft wie dieser fühlte sie sich sicher genug, um die Narben offen zu zeigen. Wie Valion und Dûhirion auch war sie eine ehemalige Schattenklinge und hatte sich von Umbra ab- und der Revolution zugewandt.
»Du glaubst gar nicht, wie schnell Kinder eine schmerzhafte Ohrentzündung oder Grippe bekommen können«, widersprach Casas kopfschüttelnd. »Sie sind noch zu jung, um sich gegen Krankheiten zu wehren.«
»Du tust gerade so, als hätte Dûhirion den Knirps fallen gelassen«, sagte Maryn, während sie die Karten verteilte.
Dûhirion drückte Haldion vorsichtig fester an sich und betastete seine Ohrenspitzen. Zu seiner Erleichterung fühlten sie sich nicht kälter an als der Rest seines Körpers.
Casas seufzte. »Ich versuche nur zu helfen.«
Dûhirion wandte sich vom Fenster ab. Das mochte sein, doch seine ständigen Ratschläge und Besserwissereien gingen ihm allmählich auf die Nerven.
Er hatte die unberechtigte Eifersucht, die er gegenüber Casas empfunden hatte, längst abgelegt. Sie war das Ergebnis eines erlittenen Traumas gewesen. Ausgelöst durch die Gefangenschaft in Umbras Kerker, die endlosen Verhöre und schmerzhafte Folter durch Hastor. Lange Zeit hatte er sich unsicher und verängstigt gefühlt. Der Waldelf war zu einem denkbar ungünstigen Moment in sein Leben getreten und Elanor zu schnell zu nahe gekommen. Dûhirion hatte Angst gehabt, sie zu verlieren. Während er nackt und geschunden in Umbras Kerker gekauert hatte, war der Gedanke an sie das Einzige gewesen, was ihn davon abgehalten hatte, den Verstand zu verlieren.
Heute wusste er, dass es nie einen Grund gegeben hatte, eifersüchtig auf Casas zu sein. Dûhirion kam sich immer noch unglaublich dumm vor, überhaupt je so empfunden zu haben.
»Eure Einsätze?« Nara wechselte, zwar wenig elegant, dafür effizient, das Thema. »Ich setze fünf Silberlinge.«
Die Menschenfrau und ihr Zwillingsbruder Arik waren die Köpfe hinter der friedlichen Widerstandsgruppe, die sich ›Weiße Feder‹ nannte, bei der auch Elanor ein jahrelanges Mitglied war. Sie war eine geschickte Jägerin und ging dieser Tätigkeit weiterhin nach.
Auf den ersten Blick hielten Fremde sie oft für einen Jüngling. Ihr schwarzes Haar war kurz geschnitten und hatte die Tendenz, ihr vor die braunen Augen zu fallen. Sie war durch ihre Arbeit kräftig gebaut und kleidete sich bevorzugt in Hemden und Hosen, sodass von ihren weiblichen Rundungen kaum etwas zu erkennen war. Aber Nara kümmerte sich, ähnlich wie Casas, nur wenig um die Meinungen und Eindrücke von Fremden.
»Zehn.« Maryn warf ihre Münzen in die Mitte des Tisches. »Casas?«
»Auch fünf«, murmelte der Waldelf.
»Weiß Theodas eigentlich, dass ihr hier Glücksspiel betreibt?«, fragte Dûhirion.
Casas räusperte sich. »Ich würde nicht so weit gehen, es Glücksspiel zu nennen.«
»Und wie würdest du es stattdessen bezeichnen?«, erkundigte sich Dûhirion trocken.
»Als interessanten Zeitvertreib mit Nebenverdienst«, antwortete Maryn schelmisch und warf eine Karte in die Tischmitte. »Glücksspiel ist in Amaranth nicht verboten. Und solange niemand seine Niere verwettet, wird keinem geschadet.«
»Nein«, rief Haldion und zappelte unruhig auf seinem Arm.
Dûhirion setzte sich mit ihm auf den Boden. »Was der Kleine sagt.«
»Weißt du, ich finde es immer noch bedenklich, dass das erste Wort eures Sohnes ›Nein‹ ist«, bemerkte Nara. »Die meisten Kinder sagen zuerst ›Mama‹ oder ›Papa‹.«
Dûhirion sammelte die hölzernen Bauklötze auf, die noch von seinem letzten Besuch mit den Kindern auf dem Boden lagen. »Die beiden sind nicht wie die meisten Kinder.«
Er spürte den Blick von Casas’ dunkelblauen Augen auf sich – wachsam, urteilend –, während er die Klötze zu einem Turm stapelte. Haldion jauchzte erwartungsvoll.
»Stimmt.« Nachdenklich runzelte Nara die Stirn und sortierte ihre Handkarten um. »Ich glaube, mein erstes Wort war auch so etwas wie ›Happa‹.«
Maryn gluckste. »Happa?«
»›Hunger‹ und ›Essen‹ waren noch zu schwierig.« Nara schmunzelte und legte eine Karte. »Der erste Satz war übrigens laut meiner Mutter: ›Nana will haben.‹ Ich war ein sehr forderndes Kind.«
»Sicherlich auf mehr als eine Weise«, kommentierte Dûhirion trocken.
Nara lachte. »Kann ich nicht bestreiten.«
»Warum eigentlich ausgerechnet ›Nein‹?«, fragte Maryn.
»Ich war sehr oft mit ihm bei Valion«, erwiderte Dûhirion.
Maryn hob die Hände, wohlbedacht darauf, niemandem ihr Blatt zu zeigen. »Danke, keine weiteren Erklärungen notwendig.«
Haldion warf den gerade fertig gestapelten Turm um und klatschte begeistert, als die Einzelteile sich erneut über den Boden verteilten. Einen Klotz steckte er sich schmatzend in den Mund. »Mamm, mamm, mamm.«
»Hungrig?« Dûhirion zog eine Braue hoch.
»Mammm.« Haldion hielt ihm den vor Speichel glänzenden Holzklotz hin.
Der Dunkelelf hob die Hand. »Nein danke. Ich habe gut zu Mittag gegessen.«
Haldion zögerte noch einen Moment, ließ den nassen Klotz fallen und griff sich den nächsten.
»Hey, meinst du nicht, dass er sich daran verschlucken kann?«, merkte die Zwergin an.
Alarmiert sah Dûhirion zu seinem Sohn zurück. Haldion hatte sich den Klotz besorgniserregend weit in den Mund geschoben. Hastig griff er nach seinem Handgelenk. »Die sind nicht zum Verzehr geeignet.«
Das Gesicht seines Sohnes verzog sich unzufrieden. Er quengelte, versuchte sich dem Griff zu entwinden. Das Holzstück entglitt seinen nassen Fingern und fiel auf seinen Oberschenkel. Das war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, und Haldion brach in Tränen aus. Ob es aus Trotz war oder er sich wirklich wehgetan hatte, konnte Dûhirion nicht sagen.
Der Dunkelelf fluchte wüst in sich hinein. »Nicht doch«, raunte er besänftigend und drückte ihn an sich. »Scht.«
Haldion ballte die Fäuste und setzte seinen lautstarken Protest ungeachtet fort. Dûhirion erhob sich und wiegte ihn. Es war nicht das erste Mal, dass der Kleine schrie.
Er wusste, was zu tun war. Was es brauchte, um ihn zu beruhigen. Aber aus irgendeinem Grund war er plötzlich handlungsunfähig. Er spürte die Blicke der anderen bleischwer auf sich liegen.
Plötzlich stand Casas neben ihm. »Theodas erwartet mich erst in ein paar Minuten. Ich kann ihn dir solange abnehmen, wenn du willst.«
»Das ist nicht nötig«, wehrte Dûhirion ab.
»Was willst du außerdem mit dem Knirps bei ihm?«, warf Maryn ein. »Sagtest du nicht, du und Theodas wolltet die Stadt verlassen?«
»Wir brechen erst in einer Stunde auf.« Casas sprach über seine Schulter zu ihr und sah zu Dûhirion zurück. »Ich werde ihn ein wenig durch den Flur tragen. Wenn ihn das nicht beruhigt, wird er spätestens in Theodas’ Arbeitszimmer aufhören zu weinen. Du weißt, wie gerne die Kleinen dort sind.«
Das konnte er nicht leugnen. Avariel und Haldion liebten die verschiedenen Blüten. Möglicherweise wegen der schillernden Farben oder des süßen Duftes. Vielleicht war es auch irgendetwas, was seiner Wahrnehmung als Erwachsener entging und nur von ihnen als Kleinkinder bemerkt wurde. Sie waren jedes Mal vollkommen fasziniert, wenn Theodas ihnen seine Pflanzen zeigte. Außerdem hatte der Hochelf eine bemerkenswerte Wirkung auf die Kleinen. Sein ruhiges Gemüt übertrug sich schnell auf sie, wenn er sie auf dem Arm hatte.
Dennoch sträubte sich Dûhirion. Haldion war sein Sohn. Es sollte ihm doch noch gelingen, ihn zu besänftigen. »Danke für das Angebot, aber das ist nicht nötig.«
Haldions Brüllen schmerzte in seinen Ohren.
Casas hob eine Braue. »Bist du dir sicher? Du wirkst, als könntest du Hilfe gebrauchen.«
»Ich komme zurecht«, entgegnete Dûhirion.
Einige Momente musterte Casas ihn unschlüssig. »In Ordnung. Dann verabschiede ich mich jetzt aus der Runde.«
»Wie lang werdet ihr fort sein?«, fragte Nara.
»Kann ich nicht sagen«, antwortete der Waldelf. »Es ist schwer abzuschätzen.«
Er hatte ihnen auch nicht sagen können, wohin Theodas und er überhaupt gingen und was sie vorhatten. Dûhirion tippte darauf, dass sie entweder einen Informanten trafen oder einen potenziellen Verbündeten, der noch nicht offen agieren wollte.
Casas warf ihm und Haldion einen letzten, vielsagenden Blick zu, der dem Dunkelelfen bedeutete, dass es ein Fehler gewesen sei, sein Angebot auszuschlagen, und verließ den Raum.
»Na, hoffentlich endet diese Geheimniskrämerei, wenn sie zurück sind.« Maryn schnaubte. »Ist ja fast so schlimm wie bei Umbra hier.«
Haldions Kopf war inzwischen hochrot. Er presste das Gesicht in Dûhirions Hemd und krallte sich verkrampft am schwarzen Stoff fest. Minutenlang lief der Dunkelelf durch den Raum, ohne dass es besser wurde.
»Hör auf zu weinen«, murmelte er und schritt unruhig auf und ab. »Das nächste Mal verhindere ich nicht, dass du dir den Holzklotz bis in die Speiseröhre schiebst.«
Nara erhob sich und kam an seine Seite. Sie hielt eine kleine Rassel in der Hand. »Komm, gib ihn ab«, bat sie sanft. »Du kannst eine Pause gebrauchen.«
Dûhirion blieb stehen.
»Es ist kein Zeichen von Schwäche, wenn du unsere Hilfe annimmst«, versicherte Nara.
Er zögerte noch einen Moment länger, ehe er ihr seinen Sohn überreichte. Bei ihr war es erträglicher als bei Casas.
»Hallo, du kleiner Schreihals«, flötete Nara und schüttelte die Rassel. »Schau her! Das ist spannender als ein paar blöde Klötze.«
Sie entfernte sich mit ihm. Haldion schluchzte und wimmerte noch, wurde aber allmählich leiser.
Nara grinste breit. »Sag ich doch, dass die besser ist.«
Resigniert kehrte Dûhirion zum Tisch zurück und ließ sich auf den Stuhl fallen. »Was habe ich verdammt noch mal falsch gemacht?«
»Kinder gezeugt.« Maryn schob ihm ihren Humpen rüber. »Bier?«
»Nein danke.« Er betrachtete den Tisch und nahm Naras Kartenblatt auf. »Was spielt ihr?«
Maryn zog ihren Humpen zurück und trank einen Schluck. »Es heißt ›Kaiser und Bettler‹. Kann dir die Regeln gerne erklären.«
»Ein anderes Mal.«
Dûhirion beobachtete Nara und Haldion. Es war ihr mit Leichtigkeit gelungen, ihn zu beruhigen. Der kleine Elf schüttelte glucksend die Rassel. Rotz, Speichel und Tränen bedeckten sein gerötetes Gesicht, doch er wirkte zufrieden.
»Bei allen anderen sieht es immer so leicht aus«, murmelte der Dunkelelf.
»Die sind ja auch keine Schattenklingen«, entgegnete Maryn schulterzuckend.
Er stützte die Stirn in seine Hand und massierte sich mit Daumen und Ringfinger die Augenlider. »Was hat das damit zu tun?«
»Das Wissen der meisten Schattenklingen reicht nur von einem Auftrag bis zum anderen«, erklärte die Zwergin. »Es ist schwer, ein guter Vater zu sein, wenn das alte Leben vor allem aus Mord und Totschlag bestand.«
Assassinen können keine guten Väter sein, flüsterte eine Stimme aus einer finsteren Ecke seines Kopfes. Es ist nicht möglich. Du wirst ihnen eines Tages wehtun. Du wirst sie schlagen. Sie werden dich fürchten. Elanor wird dir nie verzeihen, wenn dir einmal die Hand ausrutscht.
Gewalt und Furcht waren die Erziehungsmittel gewesen, die er bei Umbra kennengelernt hatte. Jedes Mal, wenn die Kleinen seine Geduld strapazierten, bekam er Angst, dass auch er dazu griff.
Was war, wenn er sie eines Nachts schüttelte, damit sie ihm nicht länger den Schlaf raubten? Was, wenn er die Beherrschung verlor?
Maryn lehnte sich bequem in ihrem Stuhl zurück und legte die Füße auf den Tisch. »Gib dir einfach noch ein wenig Zeit. Das wird schon. Sie sind erst sechs Monate alt.«
Dennoch schien jeder innerhalb dieser sechs Monate ein innigeres Verhältnis zu seinen Zwillingen aufgebaut zu haben als er selbst.
»Ich …« Dûhirion zögerte. »Ich finde keine Verbindung zu ihnen.«
Maryn trank einen weiteren Schluck. »Inwiefern?«
Der Dunkelelf starrte auf die Holzmaserung des Tisches und suchte ratlos nach den richtigen Worten. »Ich fühle nichts, wenn ich sie ansehe. Nicht den Wunsch, sie zu halten. Nicht den Drang, sie zu schützen. Sie sind für mich fremde Wesen, um die ich mich zwangsweise kümmern muss.«
»Sag doch so etwas nicht«, murmelte Nara betroffen.
Haldion war inzwischen eingeschlafen. Die Rassel lag auf seinem Bauch, hob und senkte sich mit den gleichmäßigen Atemzügen.
Nara setzte sich zu ihnen. »Du tust dir unrecht, Dûhirion.«
Schweigend musterte der Dunkelelf seinen Sohn.
»Alles dreht sich nur noch um die Kinder, nicht?« Maryn nahm ihre Füße vom Tisch. »Haldion hier, Avariel da. Schmutzige Windeln und dann noch der unangenehme Moment, wenn sie einem über die Schulter auf den Rücken kotzen. Sie rauben euch den Schlaf, die Zeit und die Kraft.«
»Hör auf, von ihnen zu sprechen, als wären sie nichts weiter als eine Last«, zischte Nara.
»Aber genauso empfindet er, oder?«, fragte die Zwergin.
Ist es wirklich so?, dachte er. Sind sie eine Last für mich?
»Elanor ermutigt mich immer, mehr mit ihnen zu machen«, sagte er abwesend. »Mit ihnen zu sprechen, mich mit ihnen zu beschäftigen. Ohne ihre Hilfe weiß ich nicht, was und wie. Ihr hingegen scheint alles so leicht zu fallen.«
Die Zwergin fuhr mit dem Zeigefinger über den Rand ihres Humpens. »Weißt du, mein Pa sagte immer: Frauen liegt es im Blut, Mutter zu sein. Männer muss man erst erziehen, damit sie Väter werden, was wiederum Aufgabe der Frauen ist.«
»Und den Blödsinn hältst du für wahr?«, hakte Nara skeptisch nach. »Elanor ist zum ersten Mal Mutter geworden und mindestens genauso oft überfordert. Dûhirion, du kannst mir glauben, dass ihr das alles auch nicht leichtfällt. Sie versucht es dir nicht zu zeigen, weil sie dich bestärken will.«
»Sie sorgt gut selbst dafür, dass sie überfordert ist«, entgegnete Maryn. »Die Kinder wollen ständig bespaßt werden, sie nimmt Unterricht bei Arik und schneidert nebenbei noch Kleidung für Theodas. Sei ehrlich, Dûhirion: Wann habt ihr das letzte Mal Zeit miteinander verbracht? Nur ihr zwei? Jeder von euch hat immer eines der Kinder bei sich und geht seinen Pflichten nach. Nur zusammen habe ich euch lange nicht mehr gesehen.«
Dûhirion trommelte unruhig mit den Fingern auf der Tischplatte. »Wir befinden uns mitten in einer Revolution, Maryn. Da bleibt nun mal nicht viel Zeit für Zweisamkeit. Außerdem ist das nichts Neues. Ich war früher oft tagelang in Umbras Namen unterwegs. Manchmal haben wir uns über Wochen nicht gesehen.«
Seine letzte längere Reise im Namen der Gilde hatte er nach Orlean angetreten. Kurz nachdem die kleine Dunkelelfin Faylen in der Aschegrube von Malachit aufgetaucht war. Sein Auftrag hatte damals gelautet, den Hauptmann der Wache, Adam Kendall, zu töten. Als er Orlean erreicht hatte, waren die Rebellen, noch unter der Führung von Canis Lupus, in die Stadt eingefallen. Dûhirion hatte den Hauptmann tot vorgefunden und war eilig geflohen.
»Mach dir nicht so viele Gedanken«, sagte Nara aufmunternd. »Viele frischgebackene Eltern werden von Unsicherheiten gequält. Frag Arik, wie oft er von zweifelnden Müttern und Vätern aufgesucht wird, deren Kinder er entbunden hat!«
»Nun, Casas zumindest scheint die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben«, kommentierte Maryn trocken.
Nara wiegte Haldion sanft. »Na ja, er war selbst Vater, oder nicht?«
»Kein Grund, um den Klugscheißer zu spielen«, brummte die Zwergin und leerte ihren Humpen. Sie rülpste hinter vorgehaltener Hand. »Selbst wenn er mehr Erfahrung hat als wir alle zusammen, muss er Dûhirion das nicht unter die Nase reiben. Theodas hält sich auch mit ungewollten Ratschlägen zurück.«
Dûhirion hörte ihnen nur noch mit halbem Ohr zu. Seine Gedanken kreisten um Faylen. Ob sie inzwischen Geburtstag gehabt hätte? Wie alt wäre sie geworden? Was würde sie zu seinen Zwillingen sagen? Er massierte sich die wulstige Narbe, die sich von seinem blinden Auge über die Wange bis zum Kieferknochen zog. »Danke euch für eure Zeit. Ich bringe Haldion ins Bett.«
Nara übergab ihm vorsichtig seinen Sohn und tätschelte ihm die Schulter. »Lass dir nichts einreden, Dûhirion.«
Er nickte bloß und verließ das Zimmer. Haldion lag warm und sicher in seinen Armen.
Und was ist, wenn ich ihn fallen lasse?
Dûhirion drückte ihn sacht an sich, hielt ihn fest und verlangsamte seine Schritte, um jede seiner Bewegungen unter Kontrolle zu behalten.
Wenn er krank wird, dann ist es deine Schuld, weil du mit ihm am offenen Fenster gestanden hast.
Kapitel 2 – Elanor
Avariels glockenhelles Lachen schien den gesamten Raum zu füllen. Sie lief munter um den Tisch herum, an dem ihre Mutter mit dem Heiler Arik saß. Elanor versuchte sich auf das schwere Buch zu konzentrieren, das vor ihr lag. Doch ihre Aufmerksamkeit wurde immer wieder von den Seiten fort- und zu Avariel hingelenkt. Zu groß war die Sorge, dass ihre Tochter sich wehtun könnte, wenn sie ihre Augen zu lange von ihr ließ.
Die Kleine kam wieder auf sie zu, und kurz bevor sie bei ihr war, tat Elanor so, als wollte sie sie packen. Avariel quietschte vergnügt auf, stoppte, drehte sich ungelenk um und rannte in die andere Richtung, um das Gleiche bei Arik zu wiederholen.
Elanor hatte nicht gezählt, wie oft sie das getan hatten. Avariels Belustigung war ebenso unerschöpflich wie ihr Atem. Ihr hohes Stimmchen trug das Gelächter in jede Ecke, jeden Winkel. Es war ein Moment voller widersprüchlicher Gefühle.
Einerseits berührte das Lachen Elanors Herz, erfüllte es mit Glück und Freude. Andererseits war es laut, regelrecht durchdringend, und hielt sie vom Lernen ab. Sie hatte ihre Tochter gern bei sich, dennoch wünschte sie sich, sie wäre nicht so stur gewesen und hätte sie bei einer Amme gelassen. Wenigstens für die Dauer des Unterrichts.
Aber sie wollte nicht immer auf die Kindermädchen setzen. Es war ihr unangenehm genug, dass sie ihre Zwillinge zu zwei anderen Frauen bringen musste, wenn sie hungrig waren. Aus irgendeinem Grund produzierte ihr Körper keine Milch mehr. Es war schon zu Beginn sehr wenig gewesen, doch inzwischen war der Fluss gänzlich versiegt.
Ihre Tochter erreichte ihr Bein und grinste ihr zu. Elanor sah ihre Gelegenheit und hob sie hoch. »Genug gerannt, Gänseblümchen«, sagte sie und kitzelte die Kleine.
Avariel fiepte, kicherte und ließ sich mit dem Rücken gegen ihre Brust fallen.
Elanor blickte wieder ins Buch. Sie hing immer noch auf der Seite fest, die sie zu Beginn der Stunde aufgeschlagen hatte.
Ariks Geduld mit ihr war schier endlos. Seit sechs Monaten nahm sie Unterricht bei Arik und war noch lange nicht über die Grundlagen der Magie hinausgekommen. Bislang erschienen ihr alle Bereiche der Zauberei gleichsam komplex. Illusionen, Verzauberungen, Elementarmagie.
»Das Geheimnis der Elementarmagie ist, dass wir die Kraft für die Zauber aus der Energie um uns herum beziehen?« Elanor stützte ihre Stirn auf. »Was bedeutet das?«
Avariel kaute mit ihrem zahnlosen Mund auf den Fingern ihrer Mutter.
»Die vier Elemente umgeben uns stetig«, erklärte Arik. »Erfahrene Magier können zum Beispiel aus der eigenen Körperwärme die Kraft für einen Feuerzauber ziehen. Du kannst den Wind auf deiner Haut und die Erde unter deinen Füßen spüren.«
Zweifelnd sah die Waldelfin auf. »Aber wie spüre ich diese Kraft auf? Wie kanalisiere ich sie, um die Luft zu manipulieren? Oder Feuer in meinen Händen erscheinen zu lassen? Und das, ohne mich selbst daran zu verbrennen?«
»Mamamamamama«, rief Avariel und klopfte auf die hölzerne Platte.
Arik streckte seinen Arm über den Tisch aus. »Gib mir deine Hand und schließ die Augen.«
Sie tat wie geheißen und legte ihre Hand in seine.
»Konzentrier dich auf die Wärme, die du fühlst«, sagte Arik leise.
Sie suchte nach allen Hitzequellen im Raum. Der Körper ihrer Tochter, der sich nahe an ihren schmiegte. Ariks Haut, das Blut in ihren Adern, das knisternde Feuer im Kamin. Elanor starrte gegen die Dunkelheit hinter ihren Augenlidern, die Brauen zusammengezogen, die Kiefermuskeln fast schmerzhaft angespannt. Avariel zappelte unruhig, trat ihr gegen die Oberschenkel und kratzte mit ihren kurzen Fingernägeln über ihren Unterarm.
Resigniert öffnete Elanor die Augen wieder und schüttelte den Kopf.
Arik lächelte geduldig. »Sei nicht entmutigt. Es dauert Jahre, um die arkanen Künste zu meistern.«
Elanor erwiderte sein Lächeln. Sie fühlte sich elendig müde.
Der Heiler fügte hinzu: »Du hast große Fortschritte gemacht. Deine Schutzzauber und telekinetischen Kräfte sind stärker geworden. Und du bist sogar schon fähig, Illusionen zu wirken.«
»Die sind allerdings weder überzeugend noch sonderlich stabil«, gab Elanor zurück.
»Aller Anfang ist schwer.« Er drückte ihre Hand und ließ sie los. »Denk an deine ersten Nähte, die du gemacht hast. Waren sie krumm und schief? Sind sie leicht wieder aufgegangen?«
»Du hast ja recht.« Elanor ließ Avariel von ihrem Schoß. »Danke für dein Lob. Vielleicht sind Elementarzauber einfach nicht meine Stärke.«
Die von Arik erwähnten Fähigkeiten waren eine Gabe der Göttin Viriditas, die sie während ihrer Schwangerschaft erhalten hatte. Sie hatten ihr und ihren ungeborenen Kindern mehr als einmal das Leben gerettet. Es war leichter, auf etwas Vorhandenes aufzubauen, als etwas gänzlich Neues zu erlernen.
»Ich bin allerdings auch ein schlechter Lehrer für Elementarzauber«, entgegnete Arik. »Mein Fachgebiet bleibt ›Schutz und Heilung‹. Du solltest darüber nachdenken, an die Akademie Krähenfels zu gehen und deine Kenntnisse zu verbessern. Sobald die Kleinen alt genug sind, versteht sich.« Er machte eine Pause. »Und die Revolution vorbei ist.«
»Gemäß dem Fall, dass sie erfolgreich ist und wir sie überleben«, murmelte Elanor.
Avariel stolperte über ihre eigenen Füße und fiel der Länge nach hin. Eine instinktive Panik packte mit eiskalter Hand Elanors Herz. Jeder Muskel in ihrem Körper spannte sich an, doch sie zwang sich, sitzen zu bleiben.
»Ganz ruhig«, beschwichtigte der Heiler. »Sieh. Es ist nichts passiert.«
Tatsächlich rappelte sich die kleine Elfin wieder auf und setzte ihren Weg unbeirrt fort.
Elanor entließ die Luft, die sie unwillkürlich in ihrer Lunge gehalten hatte. Sie fuhr sich mit der Hand durch das Gesicht und wischte sich eine braune Haarsträhne hinters Ohr. Eigentlich wollte sie nicht so übermäßig besorgt sein. Sie wollte ihren Kindern Sicherheit vermitteln und das würde ihr nicht gelingen, wenn sie jeden Schritt der Kleinen ängstlich verfolgte.
Ich übe mich noch darin, die Ruhe zu bewahren, dachte sie.
Langsam wob sie Magie um ihre Tochter, wickelte sie in einen unsichtbaren Kokon und hob ihr Kind behutsam in die Luft. Avariel kicherte freudig. Wie an vielen hauchdünnen Fäden getragen schwebte die kleine Elfin durch den Raum.
Arik erhob sich von seinem Platz und streckte abwartend die Hände nach dem Kind aus. Die letzten Monate unter Theodas’ Dach hatten Arik merklich gutgetan. Er war vorher ein blasser, müder Mann gewesen; mager genug, um seine Rippen einzeln zählen zu können. Weil er stets alles andere über seine eigenen Bedürfnisse stellte. Sei es seine Arbeit als Heiler, als Oberhaupt der Weißen Feder oder seine Studien der Magie. Alles war ihm wichtiger gewesen, als an Mahlzeiten zu denken oder Pausen einzulegen. Hier hatte er endlich ein paar Kilo zugelegt, bekam regelmäßig eine gesunde Menge an Schlaf. Sein Gesicht war weniger bleich, die Wangen voller und die dunklen Ränder unter seinen bernsteinfarbenen Augen fast verschwunden.
Avariel drehte sich in der Luft auf den Bauch und strampelte, als wollte sie vorwärts schwimmen. Elanor ließ sie näher zum Heiler schweben, der sie schließlich in die Arme schloss. Avariel schenkte ihm ein breites Grinsen und vergrub ihr Gesicht in seine dunkelblaue Robe.
Elanor atmete leise durch und senkte die Hände. Dann schüttelte sie ihre kribbelnden Glieder aus. »Wir sollten Schluss machen für heute. Meine Arme werden schon wieder taub.« Sie warf einen Blick über die Schulter aus dem Fenster. »Außerdem wird es längst Zeit für den Mittagsschlaf. Und ich habe Valion versprochen, ihn heute noch zu treffen und seine Maße zu nehmen.«
Arik musterte sie mit unverkennbarer Sorge. »Ich hoffe, du denkst daran, dich auszuruhen. Der Unterricht bei mir, deine handwerklichen Tätigkeiten und nebenbei noch eure Zwillinge.«