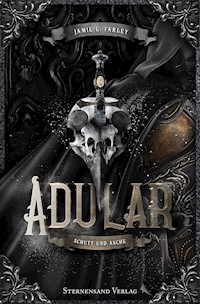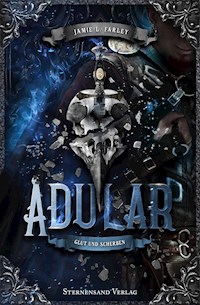Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Rabenjagd
- Sprache: Deutsch
Ich bin die Dunkelheit. Ich bin alles, was du fürchtest, alles, was du hast, und alles, was dir geblieben ist. Der achtzehnjährige Clay ist ein Außenseiter und bekommt das in der Schule täglich zu spüren. Halt findet er bei seinen beiden einzigen Freunden, die ihn jedoch nur begrenzt vor den Attacken seiner Mitschüler schützen können. Seine Faszination für Horrorfilme zieht ihn immer wieder zu den alten Ruinen im Wald. Als er und seine Clique dort auf eine ominöse Kiste in einem Kellergewölbe stoßen, kann Clay nicht anders, als sie zu öffnen – und bricht damit einen uralten Bann. Zweihundert Jahre war der Vampir Krátos in einem Sarg gefangen. Traumatisiert und verzweifelt folgt er der bösen Stimme in seinem Kopf, die ihn antreibt, Rache zu nehmen an jenen, die ihn gequält haben. Die ihm alles nahmen, was er liebte. Und die er in den Jugendlichen wiederzuerkennen glaubt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Widmung
Kapitel 1 – Stan
Kapitel 2 – Krátos
Kapitel 3 – Clay
Kapitel 4 – Krátos
Kapitel 5 – John
Kapitel 6 – Clay
Kapitel 7 – Stan
Kapitel 8 – Krátos
Kapitel 9 – Dawn
Kapitel 10 – John
Kapitel 11 – Krátos
Kapitel 12 – Leander
Kapitel 13 – Krátos
Kapitel 14 – Leander
Kapitel 15 – Danny
Kapitel 16 – Krátos
Kapitel 17 – Clay
Kapitel 18 – Krátos
Kapitel 19 – Dawn
Kapitel 20 – Krátos
Kapitel 21 – Clay
Kapitel 22 – John
Kapitel 23 – Dawn
Kapitel 24 – Krátos
Kapitel 25 – Krátos
Kapitel 26 – Yve
Kapitel 27 – Mendacis
Kapitel 28 – Krátos
Kapitel 29 – Clay
Kapitel 30 – Krátos
Kapitel 31 – John
Kapitel 32 – Krátos
Kapitel 33 – John
Nachwort
Jamie L. Farley
Rabenjagd
Band 1: Dunkles Flüstern
Fantasy
Rabenjagd (Band 1): Dunkles Flüstern
Ich bin die Dunkelheit. Ich bin alles, was du fürchtest, alles, was du hast, und alles, was dir geblieben ist.
Der achtzehnjährige Clay ist ein Außenseiter und bekommt das in der Schule täglich zu spüren. Halt findet er bei seinen beiden einzigen Freunden, die ihn jedoch nur begrenzt vor den Attacken seiner Mitschüler schützen können. Seine Faszination für Horrorfilme zieht ihn immer wieder zu den alten Ruinen im Wald. Als er und seine Clique dort auf eine ominöse Kiste in einem Kellergewölbe stoßen, kann Clay nicht anders, als sie zu öffnen – und bricht damit einen uralten Bann.
Zweihundert Jahre war der Vampir Krátos in einem Sarg gefangen. Traumatisiert und verzweifelt folgt er der bösen Stimme in seinem Kopf, die ihn antreibt, Rache zu nehmen an jenen, die ihn gequält haben. Die ihm alles nahmen, was er liebte. Und die er in den Jugendlichen wiederzuerkennen glaubt.
Der Autor
Jamie L. Farley wurde 1990 in Rostock geboren. 2010 zog er nach Leipzig und machte dort eine Ausbildung zum Ergotherapeuten. Schnell merkte er jedoch, dass das nicht der richtige Job für ihn ist, weshalb er sich entschlossen hat Pokémontrainer zu werden. Er ist in Leipzig geblieben und wohnt zusammen mit seiner besten Freundin Anika, einer Ente namens Dave und dem Haus-zombie Bradley in einer WG. Neben der Schreiberei gehören Videospiele zu seiner liebsten Freizeitbeschäftigung. Nach dem Veröffentlichen von zwei Kurzgeschichten, erschien sein Debüt ‚Adular (Band 1): Schutt und Asche‘ Anfang 2019 im Sternensand Verlag.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, September 2022
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2022
Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski
Lektorat: Sternensand Verlag GmbH | Natalie Röllig
Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (Taschenbuch): 978-3-03896-249-6
ISBN (epub): 978-3-03896-250-2
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Anika.
Du bringst Ordnung in mein Chaos,
Sicherheit in unsteten Zeiten und
Licht in dunkle Tage. Ohne dich wäre ich
heute nicht da, wo ich bin.
Danke für alles.
Kapitel 1 – Stan
Stan trottete noch schlaftrunken die Treppen hinab ins Erdgeschoss. Er war gestern zu lange wach geblieben, und selbst zehn Uhr vormittags fühlte sich in diesem Moment zu früh an.
»Morgen«, sagte er gähnend, als er in die Küche kam.
Sein Freund Leander saß am Frühstückstisch und beschäftigte sich mit dem Smartphone. Den schulterlangen Teil seiner dunkelbraunen Haare trug er offen, er hing über die kurz rasierten Seiten des Schädels. Leander hatte kein T-Shirt an, was Stan einen willkommenen Blick auf seinen athletischen und gebräunten Oberkörper gab.
»Hey«, grüßte er. Ein warmes Funkeln trat in seine nussbraunen Augen. »Gut geschlafen?«
»Ja, aber zu kurz«, brummte Stan und setzte sich ihm gegenüber.
Leander gluckste leise und reichte ihm einen Kaffee. »Hier.« Er schaltete sein Smartphone aus und widmete sich wieder seinem Müsli. »Tu nicht so, als hätte ich dich morgens um sieben geweckt.«
Stan schmierte unmotiviert Butter auf eine Scheibe Brot. »Es ist Samstag, da kannst du mich ruhig bis mittags liegen lassen. Oder selbst mal ein bisschen länger mit mir im Bett bleiben.«
Er und Leander hatten sich noch die halbe Nacht um die Ohren geschlagen, um das Referat über die Mendelschen Regeln abzuschließen. Wäre es nach ihm gegangen, hätten sie das Ganze schon am Nachmittag fertiggestellt und den Abend freigehabt. Doch Leander war versessen darauf, für jede seiner Arbeiten die Bestnote zu bekommen.
»Sind deine Eltern ausgeflogen?«, murmelte Stan, als er von seinem Brot abbiss.
»Schon längst«, erwiderte Leander und warf einen Blick auf die Wanduhr. »Papa ist um vier los zur Klinik. Der kommt auch vor heute Abend nicht wieder.«
Stan blinzelte. »Echt? Hab nicht gehört, dass er das Haus verlassen hat.«
»Wenn mein Vater will, kann er schleichen wie ein Assassine.« Leander brachte seine Schüssel zur Spülmaschine. »Beeil dich mit dem Frühstück! Ich muss gleich zum Englischkurs.«
»So ’n Stress am frühen Morgen.« Stan nahm ihn am Handgelenk und zog ihn mit einem Ruck zu sich. Leander verlor überrumpelt das Gleichgewicht und landete auf seinem Schoß. Grinsend legte Stan die Arme um ihn und drückte ihn an sich. »Kannst du deinen Kurs heute nicht schwänzen und wir gehen zurück ins Bett? Ich sag den anderen beiden, dass ich mich um ein, zwei Stunden verspäte, und wir machen uns noch einen bequemen Vormittag«, nuschelte er und küsste Leanders nackte Schulter. »Bitte, bitte.«
Der lachte, wohl wissend, dass Stan den Vorschlag nicht ernst meinte, und strich ihm durch die kurzen, blonden Locken. »Kannst du vergessen, Merlin.«
Stan hörte seinen Vornamen überhaupt nicht gerne. »Spießer.«
»Kann halt nicht jeder ein so fauler Penner sein wie du.« Leander gab ihm einen Kuss auf die Lippen. »Lässt du mich jetzt los? Würde mich gerne anziehen. Der Schnee draußen liegt mindestens knöchelhoch. Und so, wie ich die Verkehrsbetriebe in Thalbonn kenne, ist wieder keiner darauf vorbereitet.«
Thalbonn war eine mittelgroße Stadt in Norddeutschland. Regen kannte man hier, aber Schnee war eine Seltenheit.
Mit einem wehmütigen Seufzen gab Stan der Bitte nach. Selbst wenn keiner von ihnen etwas vorgehabt hätte – sobald Leanders Mutter nach Hause kam, würde es keine Zweisamkeit mehr zwischen ihnen geben. Wenn sie das Haus verließen oder sich andere in ihrer Nähe befanden, waren sie kein Paar mehr. Dann würde es keine Zärtlichkeiten geben, keine Umarmungen, nicht einmal Händchenhalten gestattete Leander in der Öffentlichkeit.
Stan beendete das Frühstück und ging zu seinem Freund ins Badezimmer.
»Mit wem triffst du dich nachher eigentlich?«, fragte Leander, während er sich das Haar kämmte.
»Mit Dawn und Clay.«
Für den Bruchteil einer Sekunde verfinsterte sich Leanders Gesicht.
»Kann immer noch nicht verstehen, warum du mit denen abhängst. Dawn von mir aus. Aber Clemens?«
»Er bezahlt gut«, scherzte Stan.
Leander warf ihm über den Spiegel einen skeptischen Blick zu. Stan war sich über dessen Abneigung seinen Freunden gegenüber bewusst, doch das hielt ihn nicht davon ab, in seiner Gegenwart über die beiden zu sprechen.
»Wenn du meinst«, antwortete Leander knapp.
Stan würde nicht weiter darauf eingehen, er wollte einen Streit vermeiden. Sie hatten sich gestern schon genug deswegen gezankt. Clay hatte am späten Nachmittag eine neue Zeichnung hochgeladen, die Stan lobend kommentierte. Als Leander ihn gefragt hatte, was wichtiger sei als ihre Biologie-Hausaufgabe, hatte er ihm sein Smartphone gezeigt.
»Manchmal bin ich neidisch«, hatte er gesagt. »Clay hat echt Talent.«
Missbilligend hatte Leander die Zeichnung betrachtet. »Geht so.«
»Als ob du es besser könntest.«
»Das nicht«, hatte Leander gestanden. »Aber wenigstens lackier ich mir nicht die Nägel wie die letzte Gothic-Schwuchtel.«
Wie sehr Stan es hasste, wenn er dieses Wort benutzte. Ihr Gespräch war danach hitziger geworden. Irgendwann hatte Leander sich halbherzig entschuldigt und sie waren zum Referat zurückgekehrt.
Ich habe es ihm zigmal gesagt, dachte Stan frustriert. Warum kann er Clay nicht in Ruhe lassen? Jeder macht sein Ding und geht keinem dabei auf den Wecker. Das KANN nicht so schwer sein.
Er putzte sich die Zähne, zog sich um und verließ eine halbe Stunde später mit Leander das Haus. Gerne hätte er ihm einen Kuss gegeben, als sie sich an der Straßenbahnhaltestelle voneinander verabschiedeten. Doch mehr als ein kurzer, freundschaftlicher Handschlag war ihm nicht vergönnt.
Irgendwann, dachte er, als er in die Bahn stieg. Sobald er mit sich selbst im Reinen ist.
Leander wohnte im Stadtviertel Favern, von dort aus dauerte es eigentlich nur zwanzig Minuten, ehe man mit der Bahn das Zentrum erreichte. Wegen des Wetters benötigte Stan heute doppelt so lang. Schon aus der Ferne sah er Dawns roten Haarschopf, der in der weißen Schneelandschaft regelrecht zu leuchten schien. Neben ihr stand die hagere, schwarz gekleidete Gestalt Clays wie ein mit Kohle gezeichnetes Strichmännchen.
Stan winkte ihnen zu und sie liefen ihm gemächlich entgegen. Wie immer, wenn er von Leander kam und sie traf, musste er gegen sein schlechtes Gewissen kämpfen. Zu deutlich klangen ihm Leanders Worte für Clay in den Ohren. Zu genau wusste er, was die beiden voneinander hielten. Das war ein weiterer Grund, warum sie ihre Beziehung geheim hielten. Leander wollte nicht geoutet werden. Stan fürchtete, seine Freunde zu verlieren.
Ewig kann ich das nicht vor ihnen verstecken.
»Hey.« Dawn umarmte ihn mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen. »Wie geht’s?«
Sie trug ihren hellen Trenchcoat und hatte ihr Haar mit einem blauen Bandana gebändigt. Die plüschigen Ohrschützer waren von der gleichen Farbe.
Stan zuckte mit den Schultern. »Passt schon. Sorry für die Verspätung, aber die Bahn ist mitten auf der Strecke stehen geblieben.«
»Will ich auch hoffen, dass dir das leidtut«, maulte Clay. »Es ist kalt, es ist nass und wir stehen hier seit … seit wann hier?«
»Etwa einer Viertelstunde«, antwortete Dawn mild.
»Seit einer viertel Ewigkeit«, verbesserte Clay. »Ich seh aus wie ein Schneemann.«
Stan grinste. »Dafür bist du nicht fett genug, Kumpel.«
»Und allgemein zu dunkel«, fügte Dawn hinzu. »Obwohl dein Teint dem Schnee Konkurrenz macht.«
Clay strich sich über die vor Kälte rosigen Wangen. »Das ist das Problem.« Er reckte hochnäsig das Kinn. »Ich kann es nicht ertragen, wenn irgendwas blasser ist als ich.«
Dawn pikste ihm mit dem Zeigefinger in die Seite. Er zuckte zusammen und erzeugte ein Geräusch wie ein Meerschweinchen, auf das jemand getreten war. »Stell dir vor, du findest irgendwann raus, wie viele Menschen schlauer sind als du«, neckte sie.
»Oder besser aussehen«, fügte Stan hinzu.
»Deine Welt würde zusammenbrechen«, schloss Dawn.
Clay musterte sie abwechselnd. »Habt ihr mich gerade dumm und hässlich genannt?«
»Würden wir nie«, antwortete Dawn mit einem betont unschuldigen Augenaufschlag.
Stan legte einen Arm um seine Schultern. »Sagen wir es so: Dein Aussehen ist eher unvorteilhaft und du hast … besondere Bedürfnisse.«
»Ihr könnt mich beide mal.«
Doch Clay lachte. Sie durften sich solche Scherze erlauben.
»Wie auch immer.« Stan ließ von ihm ab und setzte sich in Bewegung. »Ich würde gerne zur Ruine. Hab Pläne für meinen achtzehnten Geburtstag.«
»Und was ist mit deinem siebzehnten?«, wollte Dawn wissen. »Der ist schon nächste Woche, und bislang wissen wir nicht, wie und wo du feierst.«
Stan hatte das bislang von sich geschoben. Er würde sich entscheiden müssen, ob er seinen Geburtstag mit Leander verbrachte oder mit seinen Freunden. Und das wollte er nicht.
»Ach, das wird nix Großes«, wiegelte er ab. »Ich lad ein paar Leute zum Chillen ein, das war’s. Aber für meinen achtzehnten will ich was Spektakuläres.«
Das Trio schlenderte bequem durch die verschneiten Straßen ihrer Heimatstadt. Die Ruine, zu der sie wollten, befand sich inmitten des weitläufigen Talinnger Walds. Das Gebiet erstreckte sich vom Norden der Stadt bis weit in den Südosten. Vom Zentrum aus benötigte man etwa eine halbe Stunde zu Fuß, um zu ihrem Ziel zu gelangen.
Aufzeichnungen zufolge hatte hier früher ein gewaltiges Herrenhaus mit weitläufigen Ländereien gestanden, das jedoch bei einem Feuer bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Anschließend war alles verwildert und Mitte der Fünfzigerjahre hatte die Stadt dann daran gearbeitet, den Wald zu erweitern.
»Also, ich habe mir Folgendes gedacht«, begann Stan, als sie den Wald betraten. »Wir benutzen Lichterketten, die sich mit Solarenergie aufladen, und spannen sie über die Mauerreste, hängen Laternen in die Bäume. Wir machen ein Feuer, werfen einen Grill an und bringen sonst auch jede Menge Decken mit. Jeder steuert was zu essen und zu trinken bei, wir sorgen für Musik und … das war es im Grunde auch schon. Ich denke darüber nach, eine Themenparty zu schmeißen und meine Gäste zu zwingen, sich albern zu verkleiden.«
»Kriegen wir im Wald überhaupt genug Sonne zusammen für die Beleuchtung?«, wollte Clay wissen.
»Und das im Winter, wenn die meisten Tage grau und dunkel sind«, fügte Dawn hinzu.
Stan blinzelte. »Äh …« Daran hatte er nicht gedacht. »Dann … holen wir welche mit Batterien. Kein Problem.«
Clay zupfte an einem seiner Piercings. Er hatte zwei Ringe in der Unterlippe, sogenannte ›Snakebites‹. »Ich mag die Idee eigentlich. Aber mitten im Winter draußen feiern? Weiß nicht, ob mir das gefällt. Es wird arschkalt sein, irgendwann sind alle besoffen und am Ende fackeln wir noch den Wald ab.«
»Ist im Winter eher unwahrscheinlich«, warf Dawn ein. »Da ist die Gefahr größer, dass irgendjemand besoffen einschläft und elendig erfriert.«
»Ach, wir ziehen uns alle warm genug an unter den Kostümen und passen aufeinander auf«, beschwichtigte Stan. »Außerdem müssen wir nicht die ganze Nacht hier abhängen. Wenn doch einer friert, dann ziehen wir weiter.«
»Hast du auch mal an die Umweltverschmutzung gedacht? Wie viel Dreck so eine Party macht?«, fragte Dawn.
»Wir räumen natürlich hinterher auf«, unterbrach Stan sie eilig. »Am nächsten Tag, wenn wir ausgenüchtert sind.«
»Und dass wir uns mächtig Ärger einhandeln können, wenn wir hier ohne Erlaubnis feiern?«, fuhr Dawn ungehindert fort.
»Daaawn.« Stan zog ihren Namen jammernd in die Länge. »Sei keine Spaßbremse!«
»Ich hole dich auf den Boden der Tatsachen zurück.« Sie schüttelte den Kopf. »Ganz im Ernst: Das ist eine bescheuerte Idee. Wir denken uns was anderes aus. Von mir aus können wir die Party zu mir verlegen. Meine Eltern haben da sicher nichts gegen, wenn wir sie ein Jahr im Voraus warnen.«
»Und verkleiden können wir uns ja trotzdem«, fügte Clay schulterzuckend hinzu.
»Nimm deinen unerzogenen Köter gefälligst an die Leine!« Ein älterer Mann keifte erbost, zog damit Stans Aufmerksamkeit von ihrem Gespräch weg. »Und leg ihm einen Maulkorb an, ehe er jemanden beißt.«
»Meine Fresse, wer hat Ihnen denn ins Müsli geschissen?«, erwiderte ein Kerl. »Oder blöken Sie jeden an, der an Ihnen vorbeigeht? Mein Hund hat Sie nich mal mit’m Arsch angeguckt.«
Dawns Gesicht hellte sich auf. »Oh, Danny ist auf seiner täglichen Gassirunde.«
»Hä?«, gab Stan wenig geistreich von sich.
Dawn bedeutete ihnen mit kurzer Geste, weiter auf die Stimmen zuzugehen.
»Unverschämtheit«, echauffierte sich eine Frau. »Hier im Wald herrscht Leinenpflicht.«
»Gar nich wahr«, erwiderte der Kerl. »Hab’s nachgelesen. Und Farin beißt niemanden.«
Ein Hund bellte bestätigend.
Stan, Clay und Dawn näherten sich den Streitenden. Vor einem älteren Ehepaar stand ein Jugendlicher, den Stan grob auf 1,90 Meter schätzte. Er hatte einen dunkelviolett gefärbten Iro, trug einen alten Parka, der mit unzähligen Nieten, Buttons und Aufnähern bestückt war, und eine rot karierte Hose. Um seinen Hals hingen große Kopfhörer. Neben seinen Stiefeln saß ein heller Golden Retriever und blickte abwartend zu ihm hoch.
»Schmarotzern wie dir ist es zu verdanken, dass die Gesellschaft den Bach runtergeht«, schimpfte der Alte weiter. »Mit dir könnten wir jedenfalls keinen Krieg gewinnen.«
»Konnten wir mit Ihnen doch auch nich, oder?«, konterte der Punk. Er drehte den Kopf, sein Blick fiel auf Dawn, und er grinste. »Wie auch immer, wir müssen weiter. Wünsche Ihnen noch ’n angenehmen Tag. Genießen Sie das schöne Wetter!«
»Das ist Danny«, sagte Dawn, während der Punk auf sie zugetrottet kam. »Mein neuer Kumpelfreund von der Musikschule.«
Stan erinnerte sich. »Stimmt, du hast ihn neulich erwähnt.«
Das Ehepaar lief entrüstet weiter und hielt sich nicht damit zurück, weiter über Danny zu zetern.
Dawn ging in die Hocke und empfing den Golden Retriever, der schwanzwedelnd auf sie zustürmte. Einen Moment lang fürchtete Stan, der Hund würde sie in seiner Freude umwerfen. Doch er bremste ab und schmiegte sich überraschend sanft an sie.
»Hallo, hallo, Farin«, flötete sie. »Na, geht’s dir gut?«
»Ihm immer.« Danny holte sein Smartphone hervor, und Stan nahm an, dass er seine Musik ausschaltete. »Solange er nich von irgendwelchen Leuten angekeift wird, weil er an ’ner Kastanie schnüffelt.«
Dawn kraulte den Hund unter dem Kinn, der das mit genüsslichem Brummen quittierte. »Die wissen einfach nicht, was für ein guter Junge Farin ist.«
»Richtig.« Danny wandte sich den anderen beiden zu. »Hi übrigens.«
Clay schüttelte die Hand, die ihm entgegengestreckt wurde. »Moin. Ich bin Clemens. Kannst mich aber gerne Clay nennen. Und das neben mir ist Merlin. Wenn du ihm eine besondere Freude machen willst, sagst du Merlin Marcus zu ihm.«
Stan rollte mit den Augen, lächelte dabei aber wohlwollend. »Hör nicht auf ihn. Der Junge ist zu oft auf den Kopf gefallen. Tu mir bitte den Gefallen und sag Stan zu mir, okay?«
Danny nickte. »Ich mag meinen Vornamen auch nicht sonderlich. Aber wie biste von Merlin Marcus auf Stan gekommen?«
»War seine Idee«, antwortete Stan und wies mit dem Daumen auf Clay. »Ist im Grunde eine Abkürzung meines Nachnamens Stanel. Findet meine Mum nicht witzig. Blöde englische Namen und so.«
Clay zuckte mit den Schultern. »Meiner Mutter gefällt mein Spitzname auch nicht. Papa hat damit angefangen und sie ist immer noch angepisst deswegen.«
Allzu sehr verübeln konnte Stan ihr das nicht, obwohl er zugeben musste, dass Clays Vater eine clevere Grauzone nutzte. Sein Freund hatte erzählt, dass ›Clay‹ der Wunschname seines Vaters gewesen war, gegen den seine Mutter sich jedoch erfolgreich zur Wehr gesetzt hatte. Letztlich hatten sich seine Eltern auf Clemens geeinigt, und sein Vater hatte irgendwie doch bekommen, was er wollte.
Danny lachte wieder. »Ich hab das Gefühl, wir hätten in dem Bezug alle dieselben Eltern.«
»Ich bin da raus.« Dawn hob die Hände. Farin gab ihr ein High Five mit seiner Tatze. »Ich mag meinen Vornamen sehr, man kann ihn weder gut verniedlichen noch abkürzen. Und die Zeiten, in denen andere Kinder mich damit gehänselt haben, sind auch lang vorbei. Dafür muss ich überdurchschnittlich oft erklären, wie mein Nachname geschrieben wird. Dass ich tatsächlich McCarthy heiße und dass mein Dad Ire ist und so weiter und so fort.«
»So hat jeder seine eigenen Sorgen und Nöte.« Danny zwinkerte. »Also, was verschlägt euch her? Wollt ihr ein Stück mit mir Gassi gehen?«
Dawn richtete sich auf. »Können wir, oder?« Sie sah die anderen beiden an. »Oder du begleitest uns. Wir wollen zu den Ruinen.«
»Ruinen?«, fragte Danny.
»Kennst du die nicht?«, erwiderte Clay verwundert.
»Danny ist erst vor Kurzem für die Ausbildung hergezogen«, erklärte Dawn. Sie wies in die Richtung, in die sie gehen mussten. »Es gibt hier im Wald ein paar Gebäudeüberreste, die man großzügig ›Ruinen‹ nennt. Es sind im Grunde genommen nur übrig gebliebene Mauerstücke und zwei oder drei halbe Wände.«
»Eine davon hat sogar ein Fenster«, fügte Clay hinzu.
»Also nichts Besonderes«, fuhr Dawn fort. »Ist trotzdem ein beliebter Treffpunkt. In Stans Hirn hat sich die fixe Idee verhakt, seinen achtzehnten Geburtstag dort zu feiern. Im November.«
Danny kratzte sich an der kahl rasierten Seite seines Kopfes. »Eine Waldparty mitten im Winter? Cool. Können Farin und ich mitmachen?«
Stan lächelte. »Klar. Du bist der Erste, der die Idee gut findet.« Er drehte sich zu Dawn. »Ich mag den Typen.«
Kapitel 2 – Krátos
Zweihundert Jahre zuvor
Der barocke Ballsaal war bis in den hintersten Winkel gefüllt, begleitet von Musik, Gelächter und Gesprächen. Verschiedene Düfte schwängerten die Luft – von Speis und Trank, süßen Parfüms, Schweiß und dem Blut der Gäste. Neben Krátos und seiner Familie befanden sich einige andere Vampire unter ihnen. Keine bekannten Gesichter bisher, doch das war ihm ganz genehm. Auf Festen, die von ihresgleichen veranstaltet wurden, traf man fast immer dieselben Personen.
Krátos ließ den Blick schweifen, betrachtete die üppigen Verzierungen aus Gold und Marmor, die filigranen Stuckarbeiten an den Wänden. Über ihren Häuptern spannte sich ein gewaltiges Gemälde.
»Was sagst du dazu?« Die Stimme seines Ziehvaters erklang an seinem linken Ohr.
Arunas hatte, wie Krátos auch, den Kopf in den Nacken gelegt, um das Bild eingehend zu studieren. Sein braunes Haar war sorgfältig nach hinten gekämmt. Krátos hingegen hatte sein schwarzes Haar wie üblich nicht gebändigt bekommen. Es sah immer zerzaust aus, ganz gleich, was er auch tat.
Sie beide trugen teure Anzüge – sein Ziehvater in Dunkelrot, er selbst bevorzugte seine Garderobe in Schwarz. Vier silberne Ringe glänzten an Arunas’ Fingern.
Krátos räusperte sich. »Nun, diese Malerei entfaltet ein äußerst komplexes Bildprogramm mit hierarchischen, narrativen und ikonografischen Strukturen.« Er sprach mit seiner besten Imitation eines blasierten Kunstkritikers. »Auf diese Weise tritt es in eine intensive Kommunikation mit dem Betrachter.«
Arunas gluckste, hielt sich merklich zurück, nicht laut aufzulachen. Er war ein Maler und Bildhauer, hatte Krátos vor etlichen Jahren das Kunsthandwerk beigebracht. Sie hatten sich derlei Ausführungen öfter anhören müssen, als sie zählen konnten. »Fürwahr, mein Herr, Sie sind ein Feingeist sondergleichen. Und nun noch einmal für das Proletariat?«
Krátos zuckte leicht mit den Schultern. »Es ist hübsch.«
»Ich wünschte, die Leute würden es immer so einfach halten, wenn es um Kunstwerke geht«, sagte Arunas.
»Aber wo bliebe denn der Spaß, wenn man nicht ein wenig schlau daherreden kann?«, entgegnete Krátos belustigt.
Eine Frau rief seinen Namen. Er blickte in die Richtung und sah seine Adoptivtochter Ophelia, die sie liebevoll Felia nannten, auf sich zukommen. Sie trug an diesem Abend ein blaugraues Kleid. Ihr hellblondes Haar hatte sie zu einer aufwendigen Frisur verflochten und hochgesteckt. Im Gegensatz dazu war ihre Schminke dezent, ließ ihre Wangen rosiger und die Lippen voller wirken.
»Lykaon wird gleich wieder spielen. Tanz mit mir«, bat sie und streckte die zierlichen Hände nach ihm aus.
Krátos drehte den Kopf in die Richtung der Musiker. Er sah seine Ziehmutter Helena, die neben ihrem Bruder stand und ihm seine Geige reichte. Beide hatten sich in helle Farben gekleidet, die einen ansehnlichen Kontrast zu den schwarzen Locken und ihrer bronzenen Haut bildete.
»Felia, du weißt, dass ich ein miserabler Tänzer bin«, hob er an.
»Hat mich das jemals gestört?«, gab sie zurück.
Ihre blaugrünen Augen funkelten vor Freude. Wie konnte er zu diesem Blick Nein sagen? Mit einem resignierten Seufzen ließ er sich auf die Tanzfläche ziehen.
Arunas schmunzelte amüsiert. »Viel Vergnügen. Ich werde meine liebe Gattin suchen und sie ebenfalls zum Tanz bitten.«
Er schob sich an den anderen Gästen vorbei und schlenderte gemächlich Helena entgegen, die ihn offenbar schon erwartete.
Krátos war absolut unmusikalisch. Er hatte weder ein Gefühl für Rhythmus noch konnte er Instrumenten ein paar halbwegs gerade Töne entlocken. Dennoch würde er Lykaons Spiel unter Tausenden erkennen.
Er ließ seine Adoptivtochter führen. Angestrengt starrte er auf seine Füße, hielt mühsam Schritt und tat sein Möglichstes, sie nicht zu treten.
»Nimm den Kopf hoch!« Felia kicherte. »Du wirst schon nicht stürzen.«
Sie zog ihn mit sich durch die Reihen der anderen Tänzer, ihr Rock wehte elegant um ihre Beine. Die Herzen aller Anwesenden schienen in diesem Moment im Gleichtakt zu schlagen, miteinander und mit der Musik. Er konnte hören, wie das Blut durch die Adern der Menschen um ihn herum rauschte, und es schien fast so, als würde es sich der Melodie im Raum unterordnen.
Krátos hob das Kinn. Ein strahlendes Lächeln erhellte Felias blasses Gesicht. Es war schön zu sehen, dass sie sich amüsierte. Nur selten kam sie so aus sich heraus wie heute.
»Muss ich dich daran erinnern, dass ich damals meinen eigenen Hochzeitstanz verstolpert habe?«, fragte Krátos trocken. »Beide, um genau zu sein. Und dass sowohl die erste als auch die zweite Ehe in Katastrophen endeten?«
Felia neigte skeptisch den Kopf. »Du meinst, weil du dich ein bisschen ungeschickt angestellt hast, waren deine Ehen von Anfang an zum Scheitern verurteilt?«
»Nun, es war auf jeden Fall ein schlechtes Omen.« Krátos merkte, dass er ihr auf den Fuß trat, und sah sie frustriert an. »Tut mir leid.«
Felia lächelte aufmunternd. »Irgendwann wirst du es lernen. Wir haben eine Ewigkeit, um zu üben.«
Das klang in seinen Ohren fast wie eine Drohung.
In der Menge sah Krátos seine Zieheltern Arunas und Helena, die sich im Takt der Musik wiegten. Sie schienen förmlich durch den Saal zu schweben. Ihre Bewegungen waren erhaben und fließend wie die Wellen auf der Meeresoberfläche. Sowohl ihre Anmut faszinierte ihn als auch sein exorbitant kitschiger Vergleich.
»Ich weiß zwar nicht, wie man einen anständigen Tanz beginnt und führt, aber immerhin kann ich ihn halbwegs elegant zum Schluss bringen«, sagte er.
Das Lied neigte sich dem Ende zu. Er hob Felias Arm, drehte sie einmal um die eigene Achse und ging mit ihr auseinander. Mit einem Lächeln hauchte er einen Kuss auf ihre behandschuhten Fingerknöchel. Felia vollführte einen vornehmen Knicks, und die Musik verklang.
Lykaon senkte die Geige und lächelte zufrieden zu sich selbst.
»Egal, wie oft ich ihn spielen höre, ich werde wohl immer stolz auf ihn sein«, sagte Helena.
Sie und Arunas hatten sich still zu ihnen gesellt.
»Krátos, es wird langsam Zeit, dass wir uns zum Hafen begeben. Das Schiff legt in zwei Stunden ab«, bemerkte Helena.
Krátos warf einen überraschten Blick aus dem Fenster. Er hatte nicht mitbekommen, dass der Abend schon so weit fortgeschritten war. »Danke, dass du mich daran erinnerst. Ich hätte es fast vergessen.«
»Wie gut, dass wenigstens eine von uns organisiert ist.« Arunas drückte sacht den Arm seiner Frau, mit dem sie sich bei ihm untergehakt hatte. »Was würden wir nur ohne dich tun?«
»Zu spät kommen«, antwortete Helena schlicht.
Sie warteten noch ein Lied ab, ehe sie die Veranstaltung verließen. Von Lykaon hatten sie sich bereits verabschiedet, denn er konnte sie nicht begleiten.
»Wir bleiben noch etwa einen Monat in der Stadt«, erklärte Arunas, als sie den Hafen eine halbe Stunde später erreichten. »Lykaon hat noch einige Auftritte, und ein Adeliger hat mich angesprochen, als ich mich auf den Weg zu Helena gemacht habe. Er möchte ein Familienporträt anfertigen lassen und zahlt gut.«
Sie waren extra für Lykaons Konzert angereist und Krátos hatte seinen Streifzug durch Norwegen unterbrochen, um seine Familie zu treffen.
»Wir kehren dann im Januar alle gemeinsam zurück nach Schottland«, fügte Arunas hinzu.
Das Schiff, das Krátos zurück nach Oslo bringen sollte, lag bereits vor Anker. Sein Gepäck war schon am Nachmittag abgeholt und verstaut worden. Nachtfahrten zu organisieren, war nicht immer einfach. Es gab einige Unternehmer, die sich auf vampirische Reisende spezialisiert hatten. Doch gerade Schiffsüberfahrten stellten häufig ein Hindernis dar. Mit diesem hier hatte er wahrlich Glück gehabt.
»Wie lange wirst du unterwegs sein?«, fragte Felia.
Der Abschiedsschmerz klang deutlich aus ihren Worten heraus. Krátos wusste, dass sie ihn immer schrecklich vermisste, wenn er unterwegs war.
»Ein paar Monate«, antwortete er wahrheitsgemäß. »Ich habe noch einige Stationen vor mir. Von Schweden und Finnland habe ich bisher noch nichts gesehen. Ich denke, im Herbst kehre ich zurück.«
»Hab eine sichere Weiterreise.« Helena umarmte ihn und gab ihm einen sanften Kuss auf die Wange. »Vergiss nicht zu schreiben.«
»Natürlich nicht.« Krátos lächelte. »Gleiches gilt für dich. Ich erwarte einen fertigen Roman, wenn ich zurück bin.«
Helena gluckste. Er hatte immer wieder versucht, ihr Details über ihr neustes Werk zu entlocken, doch sie hatte sich hartnäckig in Schweigen gehüllt. »Du könntest Glück haben. Je nachdem, wie sehr meine Muse mir zugeneigt ist.«
Felia schlang die Arme um ihn und drückte ihn fest. »Du wirst mir fehlen.«
Krátos strich ihr sanft über den Rücken. »Ihr alle mir ebenfalls. Wir sehen uns bald wieder«, versprach er.
Widerwillig löste sie sich von ihm. Arunas drückte ihm zum Abschied die Hand.
»Ich wünsche dir frohes Schaffen. Bring uns reichlich Bilder mit.«
Krátos ging an Bord des Schiffes. Er winkte ihnen ein letztes Mal, ehe er sich auf den Weg in seine Kabine machte.
In der nächsten Nacht platzierte er seine Staffelei auf dem Deck. Die See war ruhig und der Himmel klar, ein fast runder Mond warf ein weiches, kühles Licht auf die Erde. Es war das perfekte Wetter, um das Bild zu beenden, das er vor einigen Nächten begonnen hatte.
Es zeigte einen der berühmten Fjorde Norwegens in den frühen Abendstunden. Das Firmament war in ein tiefes Orange getaucht, die warmen Strahlen der untergehenden Sonne reflektierten auf der glatten Wasseroberfläche.
Heute wollte er sich daran wagen, die steilen Klippen zu gestalten. Die nackten Felswände waren voller Vegetation – Bäume, Büsche und Gräser wucherten ungehindert und wunderschön.
Krátos war kein Künstler, der Galerien füllte und sich in die Riege großer Namen wie Leonardo da Vinci oder Rembrandt van Rijn einreihen durfte. Das war auch nicht sein Ziel. Er verdiente sein Geld mit Auftragsarbeiten, seine Spezialität waren Porträts und Landschaftsmalereien. Gemälde von Sonnenaufgängen und lichtgefluteten Herbstwäldern erfreuten sich vor allem bei seinen vampirischen Kunden großer Beliebtheit. Aus nachvollziehbaren Gründen.
Er stupste den Pinsel in die Farbe auf seiner vorbereiteten Palette und setzte ihn vorsichtig auf die Leinwand. Der erste Strich war jedes Mal eine kleine Überwindung, getrieben von der perfektionistischen Sorge, das Bild mit einer falschen Bewegung zu ruinieren. Danach wurde es leichter, und Krátos tauchte in sein Gemälde ein.
Er lauschte dem Wind und dem sanften Rauschen des Meeres, während er den vorher kahlen Klippen Leben einhauchte.
Die Schritte in seinem Rücken bemerkte er erst, als es fast zu spät war. Ein bekannter Geruch vermischte sich mit dem von Salzwasser, Holz und Ölfarben, und Krátos wurde klar, dass er in Schwierigkeiten steckte.
Er hörte ein verräterisches Klicken und machte einen schnellen Satz zur Seite. Ein langer Armbrustbolzen sauste an ihm vorbei und durchbohrte seine Leinwand.
Krátos wirbelte herum und wehrte gerade rechtzeitig einen verheerenden Schlag ab, der genug Kraft gehabt hätte, ihm den Schädel zu brechen.
Sein Angreifer war ein Mann in den Vierzigern, mit breiten Schultern und einem harten Gesicht. Sein schulterlanges Haar und der dichte Bart waren von einem schmutzigen Blond, die kalten Augen auffällig hell.
Der Vampir wich zurück, um sich den Raum zu geben, auf die nächste Attacke vorbereitet zu sein. Von allen Jägern war Jonathan einer der gefährlichsten. Gerüchten zufolge war seine Familie seit Generationen mit dunklen Mächten im Bunde. Er war viel zu schnell und zu stark für einen gewöhnlichen Menschen. Seine Reflexe konnten problemlos mit denen eines Vampirs mithalten.
»Genießt du die Fahrt, Mistvieh?«, fragte Jonathan spöttisch.
»Bis eben habe ich das«, antwortete Krátos. »Dann musste ich dein Gesicht sehen und bin seekrank geworden.«
Er durfte keine Schwäche zeigen, musste die Nervosität, die sich in ihm ausbreitete, mit allen Mitteln verbergen.
Es war unglücklich, dass der Jäger ihn hier gestellt hatte. Andererseits bedeutete es, dass Arunas, Helena, Felia und Lykaon in Sicherheit waren.
»Ich nehme an, du hast die Crew bestochen, damit sie nach deiner Pfeife tanzen?«, wollte Krátos wissen.
Der Jäger schnaubte. »Für wen hältst du mich, Blutsauger?«
»Für eine Person mit ernsthaften emotionalen Problemen.«
Krátos hörte, wie das Herz des Jägers einen Satz machte. Wut trieb seinen Puls in die Höhe.
»Ich habe den Kapitän über dich informiert«, fuhr der Mann verbissen fort. »Wir wissen beide, dass du eine Gefahr für ihn und seine Männer bist. Morgen werden sie eine blutleere Leiche mit einer Bisswunde am Hals finden.«
Krátos verzog verächtlich das Gesicht. Dass dieser Kerl über Leichen ging, verwunderte ihn längst nicht mehr. »Filius Meretricis.«
Die Mundwinkel des Jägers zuckten. »Es wäre nur in deinem Interesse, wenn du dich kooperativ zeigst.«
Der Vampir näherte sich rücklings der Reling. Es war buchstäblich hundert Jahre her, seit er das letzte Mal versehentlich einen Menschen beim Trinken getötet hatte. Es brauchte Willenskraft, Übung und Disziplin, um sich nicht von der Gier nach Blut überwältigen zu lassen.
›Ein kluger Vampir hat niemals zu viele Leichen im Keller‹, pflegte Arunas zu predigen.
Und Krátos hielt sich an den Rat seines Ziehvaters. Gleichermaßen den Leben der Menschen und anderer Vampire zuliebe und für sein eigenes Wohlergehen. Je weniger ihrer Art gefährlich für die Sterblichen waren, desto seltener gab es einen wirklichen Grund für Jäger, sie zu verfolgen.
Jonathan jedoch war das alles gleichgültig. Für diesen Mann zählte nicht, dass Krátos und seine Familie friedliche Vampire waren. Die sich zwar von Menschenblut ernährten – bis auf Helena, die Tierblut vorzog –, aber auch problemlos unter ihnen leben konnten.
»Von meinem Kopf abgesehen: Was willst du von mir?«, fragte Krátos schließlich.
Jonathan hatte seine Armbrust nachgeladen und richtete sie erneut auf den Rumpf des Vampirs. »Das weißt du genau. Wo sind sie?«
»Falls du deine Würde, Anstand und Intelligenz meinst: Ich würde es auf dem Meeresgrund versuchen«, erwiderte Krátos trocken.
Das Gesicht des Jägers verfinsterte sich.
Krátos stieg auf die Reling, ohne ihn aus dem Blick zu lassen. Er grinste, entblößte für einen kurzen Moment seine spitzen Fangzähne.
Je wütender Jonathan auf ihn wurde, desto impulsiver würde er handeln. Wenn der Zorn überhandnahm, würde der Jäger kaum noch in der Lage sein zu planen. Außerdem musste Krátos zugeben, dass es hilfreich war, seine steigende Sorge unter Spott und vorgeblicher Arroganz zu begraben.
»Nichts in diesem Ärmel.« Er zog seinen Mantel am rechten Handgelenk nach unten. »Und nichts in diesem.« Er wiederholte die Bewegung mit der linken Seite, ehe er beide Hände nach oben hielt. »Abrakadabra.«
Der Jäger feuerte einen Schuss ab. Krátos nahm seine Rabengestalt an, wich dem Geschoss aus und stieg in den dunklen Nachthimmel auf. Das Festland war zu weit entfernt, um die restliche Strecke fliegend zu überwinden. Er flog eine Schleife, landete hinter Jonathan und verwandelte sich zurück.
Der Jäger wirbelte herum, und Krátos verpasste ihm einen Schlag ins Gesicht. Er taumelte, der Vampir setzte nach, schlug abermals zu und drängte ihn auf die Reling zu.
Jonathan duckte sich unter dem nächsten Hieb weg, zückte ein Messer und versenkte die Klinge tief in Krátos’ Brust. Nur wenige Zentimeter weiter links hätte sie sein Herz durchbohrt und ihn gelähmt, der Gnade des Jägers ausgeliefert.
Den Schmerz ignorierend, packte Krátos seinen Gegner an der Kehle und stieß ihn über das Schiffsgeländer ins schwarze Meer.
Er wartete, bis Jonathan an die Oberfläche kam, und sah zu, wie er sich immer weiter entfernte.
Dann ließ er sich auf den Boden sinken. Die Anspannung fiel von ihm ab, und er zitterte.
Jonathan würde sich von der Niederlage nicht aufhalten lassen. Er würde auch nicht den Anstand haben zu ertrinken. Nein, Krátos hatte sich lediglich ein wenig Zeit verschafft.
Er biss die Zähne zusammen und zog das Messer aus seinem Leib. Sobald er sich etwas erholt hatte, musste er die Leiche finden, von der Jonathan gesprochen hatte, und sie loswerden. Dann einen Brief an seine Familie schreiben und in Norwegen untertauchen.
Krátos stand auf, als sich die Wunde in seiner Brust vollständig geschlossen hatte, und ging zu seiner Leinwand zurück.
Er entfernte den Bolzen und betrachtete betrübt den hinterlassenen Schaden. Vielleicht ließ sich das Bild noch retten, wenn er es unter abstrakter Kunst verbuchte.
Kapitel 3 – Clay
Heute
Clay liebte die Ruinen. Es war ein kleines Stück Zivilisation, das die Natur sich zurückerobert hatte. Dawn hatte diesen Ort nicht einmal annähernd so schön beschrieben, wie er in seinen Augen war.
Zwischen zwei Mauerresten befand sich ein zerbrochener Torbogen. Er war etwa in der Mitte zerstört worden. Die übrig gebliebenen Wände waren von Pflanzen überwuchert. Eine Treppe führte von einer Wand hinauf ins Nichts. Seiner Meinung nach war das der perfekte Ort, um einen Horrorfilm à la ›The Blair Witch Project‹ zu verwirklichen. Oder einen Klassiker in Schwarz-Weiß zu drehen mit Werwölfen und Vampiren.
Clay saß gerne hier, um zu zeichnen. Allerdings nur, wenn er allein war und keine anderen Menschen ihn in seiner eigenbrötlerischen Kreativität störten.
»Und hier soll die große Party steigen?«, fragte Danny und ließ den Blick schweifen. »Ich mein … warum nich? Im Winter is’ die Waldbrandgefahr nich so groß. Wir könnten ’n Lagerfeuer machen, damit uns nicht zu kalt wird.«
»Ich bin immer noch der Meinung, wir sollten bei mir zu Hause feiern«, erwiderte Dawn. »Da ist es warm und nicht potenziell tödlich, wenn einer einpennt.«
Danny grinste ihr zu. »Vergiss nie die wichtigste Partyregel: Sei nicht der Gastgeber.«
Farin lief derweil aufgeregt umher und erkundete die Ruine neugierig.
»Das Beste ist hier drüben«, bemerkte Clay und winkte ihn heran. »Komm mal hier rüber!«
Er trat unter die Treppenreste und fegte mit dem Fuß altes Laub und Geäst zur Seite, um eine Bodenluke freizulegen. »Ta-da!«
»Wo führt die hin?«, wollte Danny wissen.
»Weiß man nicht«, antwortete Dawn.
»Ihr wollt mir sagen, die hat niemand geöffnet?«, fragte Danny ungläubig. »Da is’ ’ne Bodenluke mitten im Wald in einer alten Ruine und niemand macht die mal auf?«
»Es ist nicht so, als hätte man es nie versucht«, erwiderte Dawn. »Sie hat sich nie bewegt. Guck genauer hin, da ist nicht mal ein sichtbares Schloss dran!«
Danny schlich um die Luke herum wie eine Katze um eine Maus. »Hm. Komisch. Vielleicht einbetoniert oder so? Hat man’s schon mit Graben versucht?«
»Klar. Sind nicht weit gekommen«, antwortete Clay. »Und wahrscheinlich war es nicht wichtig genug, um mit schweren Geräten anzurücken und den ganzen Boden aufzureißen.«
»Wenn das mal ein Herrenhaus war, dann wird da unten bloß ein alter Weinkeller oder so sein. Und ehrlich gesagt kümmert es die Stadt auch einen Scheiß.« Stan deutete auf die Umgebung. »Keiner fühlt sich verpflichtet, diese traurigen Überreste hier niederzureißen und mal was Neues hinzubauen.«
»Bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh drum. Die Ruine verleiht dem Wald einen ganz eigenen Charme«, erwiderte Clay.
Er bemerkte, dass Farin mehrere Meter von ihnen entfernt stand und sie angespannt anstarrte. Nur sein hellbeiges Fell bewegte sich leicht im kalten Wind.
Clay drehte sich dem Hund zu und ging zu ihm. »Alles in Ordnung mit dir?«
Farin ignorierte ihn vollkommen. Er zitterte merklich und etwas in Clay zweifelte, dass das an der Kälte lag.
»Du kannst dir die Kraft sparen«, sagte Stan hinter ihm.
Das schrille Quietschen alter Scharniere bohrte sich unangenehm in Clays Ohren. Der Golden Retriever zuckte zusammen, als wäre er geschlagen worden, und kauerte sich winselnd in den Schnee.
Clay wirbelte herum. Die Luke stand offen und gab den Blick auf eine Treppe frei, die ins unergründliche Dunkel der Erde führte.
»Also … so schwer war das nich.« Danny runzelte die Stirn und blickte sie nacheinander an. »Bin ich jetzt König von England oder so?«
Clays Herzschlag beschleunigte sich. Er vergaß das ängstliche Verhalten des Hundes und eilte zu den anderen.
Danny hat es geschafft, dachte er aufgeregt. Wir können endlich herausfinden, was da unten ist.
Ungläubig schüttelte Dawn den Kopf. »Willst du mich verarschen?«
»Nee«, erwiderte Danny stumpf.
»Wie hast du das geschafft?«, wollte Dawn wissen.
Danny zuckte mit den Schultern. »Gezogen.« Er musterte sie skeptisch, als erwartete er, dass sie irgendeinen Scherz auflösten. »War das ein Test? Hab ich bestanden?«
»Die Luke war jahrelang zu«, versicherte Stan. »Bislang hat sich daran jeder ’nen Bruch gehoben. Und du öffnest die einfach, als wäre es nichts.«
»Is’ meine geheime Superkraft«, erklärte Danny und spannte den Bizeps an. »Ich mach das Unmögliche möglich, das Angenehme unangenehm und kann anderen vor allem ganz gehörig auf’n Sack gehen.«
»Das ist ja so cool«, jauchzte Clay und klopfte Danny anerkennend auf den Rücken. »Ich geh da sofort runter. Kommt wer mit? Irgendwas hat die Tür jahrelang da unten versteckt gehalten.«
In diesem Moment zogen die unzähligen Horrorfilme, die er in seinem Leben konsumiert hatte, durch seinen Verstand. Er schaltete die Taschenlampe von seinem Smartphone an und hielt sie sich unters Kinn. »Zum Beispiel eine uralte Bestie, die in den Eingeweiden der Erde gefangen gehalten wurde und die wir auf die Welt losgelassen haben.«
»Oh, puh …« Danny kratzte sich am Nacken. »Die Apokalypse wollt ich nich unbedingt heraufbeschwören.«
Dawn spähte in die Dunkelheit. »Das wäre die Stelle im Film, an der man als Zuschauer vor dem Bildschirm hockt und die verblödeten Teenager anschreit, dass sie da nicht runter und am besten nach Hause gehen sollen, richtig?«
»Jup.« Clay ging die ersten zwei Stufen hinab.
»Und wir werden ignorieren, dass es da unten möglicherweise einen paranormalen Serienmörder gibt, der unsere Stadt terrorisieren und uns alle töten wird?«, fragte Dawn weiter.
»Jup«, wiederholte Clay heiter.
»Mein Tipp is’ ’ne Level-fünfzig-Riesenspinne als Endboss«, sagte Danny.
Clay drehte sich zu ihnen um. »Kommt ihr mit?«
»Warum? Hast du Schiss allein?«, feixte Stan.
»Ganz furchtbar sogar«, jammerte Clay. »Jemand muss meine Hand halten. Außerdem macht es weniger Spaß, so was allein zu erkunden.«
»Würde ich jetzt auch behaupten.« Stan trottete ihm hinterher. »Ah, wozu hat man denn seinen schwulen besten Freund?«
Er nahm Clay an der Hand und grinste ihn an. »Aber no homo, ja?«
Dawn folgte ihnen gemächlich. Als Danny ihnen ebenfalls nachkommen wollte, bellte Farin plötzlich.
Clay drehte sich um und sah, wie der Golden Retriever sich den Saum von Dannys Parka schnappte und daran zerrte.
»Hey, ganz ruhig«, beschwichtigte Danny. »Das is’n alter Keller. Wir haben nur Witze gemacht.«
Sie kamen zurück nach oben und fanden ihn vor seinem winselnden Hund kniend, der sich flach gegen den Boden drückte.
»Alles in Ordnung?«, fragte Dawn besorgt.
»Farin is’ kein Fan von Kellern.« Danny streichelte dem Golden Retriever sanft über den Kopf. »Keine Ahnung, woher das kommt. Er hatte schon immer Angst davor. Der is’ auch bei unsern Eltern nie tiefer als ins Erdgeschoss gegangen. Geht einfach vor! Ich bleib mit ihm draußen.«
Tiere haben einen sechsten Sinn für Übernatürliches, dachte Clay. Wenn es irgendwo spukt, schlagen Hunde und Katzen meist zuerst Alarm.
Plötzlich bekam er selbst ein mulmiges Gefühl.
»Gut, dann sind wir das Erkundungsteam Alpha«, verkündete Stan. »Danny bildet die Nachhut.«
Clay schob seine Bedenken beiseite. Er konnte jetzt ohnehin keinen Rückzieher mehr machen. Schließlich war er der Horrorfan unter seinen Freunden. Wenn ausgerechnet er sich weigerte, in den Keller zu gehen, würde Stan ihn vermutlich ewig damit aufziehen.
Clay stieg die alte Steintreppe zuerst hinab, Stan und Dawn folgten ihm dichtauf. Ein unangenehmer Geruch stieg ihm in die Nase. Es roch nach kaltem Stein, Feuchtigkeit und altem Moder.
Clays Herz wummerte dumpf in seinen Ohren; er spürte es bis in seine Kehle schlagen. Abgesehen vom Licht ihrer Lampen war es stockfinster. Man könnte ohne sie die Hand vor Augen nicht sehen.
Wenn hier unten etwas lauerte, was nicht menschlich war, war es die Dunkelheit gewohnt.
Seine Vorstellungskraft erschuf eine leichenblasse, haarlose Kreatur mit blinden Augen, die sich irgendwo in der Schwärze vor ihnen verbarg. Ihr Körper war mager von der langen Gefangenschaft. Die spindeldürren Gliedmaßen endeten in grässlichen Klauen, und ein lippenloser Mund verbarg lange, scharfe Zähne.
Clay mochte es, dass seine Fantasie stets so detailliert arbeitete. Es half ihm nicht nur damit, sich künstlerisch auszudrücken, sondern trug auch wunderbar zur unheimlichen Atmosphäre bei. Sobald er wieder zu Hause war, musste er dieses Monster zeichnen.
»Wir brauchen größere Lampen«, murmelte Dawn. »Der Raum wirkt riesig.«
»Wie gesagt, ich denke, das ist ein alter Weinkeller«, wiederholte Stan.
»Oder ein ehemaliger Folterkeller«, warf Clay ein.
Stan musterte ihn missmutig. »Ich glaub nicht, dass wir hier überhaupt irgendwas finden. Selbst Ratten, Spinnen oder so was sollten längst zu Staub zerfallen sein. Meint ihr eigentlich, dass wir das hier jemandem melden müssen? Der Polizei oder der Stadt?«
»Gute Frage.« Dawn leuchtete an die Decke. »Ich hoffe, das hier ist nicht einsturzgefährdet.«
Clay tastete sich derweil weiter voran. Sein kleiner Lichtstrahl wurde von der schwarzen Mauer vor ihm verschluckt. Jeder Schritt führte ihn tiefer ins Ungewisse.
Was ist, wenn hier Fallen versteckt sind?, dachte er. Eine rostige Bärenfalle oder ein alter Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Decke runterkommt und uns zerquetscht.
Sein beschleunigter Atem verlor sich in kleinen Dampfwolken direkt vor seinem Gesicht.
»Hey, hier ist ein Durchgang«, rief Dawn plötzlich.
Clay und Stan richteten ihre Lampen auf sie. Sie stand vor einer rechteckigen Aussparung in der Wand, in der sich früher mal eine Tür befunden haben konnte. Links und rechts davon waren zwei gusseiserne Halterungen angebracht. Vielleicht für Fackeln?
Zu dritt leuchteten sie den Raum dahinter aus.
»Ist kaum größer als unsere Abstellkammer zu Hause.« Stan hielt inne, als sein Lichtstrahl die hintere Wand streifte und den Blick auf schwere Eisenketten freigab. »Scheiße.«
Etwas Schweres sackte Clay in den Magen. Vorsichtig, als könnte er sich daran verletzen, hob er eine Kette an und öffnete den Verschluss. »Die sind nicht so rostig, wie sie sein sollten«, murmelte er. »Hier sind Leute festgehalten worden.«
»Gefällt mir nicht«, sagte Stan.
Clay wandte sich ihnen wieder zu. »Es gibt genug Geschichten über reiche Irre, die sich eine private Folterkammer bauen. Vielleicht stand hier mal das Herrenhaus eines Sadisten, der in seiner Freizeit Menschen in seinem Keller gefangen gehalten und gequält hat.«
»Du guckst zu viele Horrorfilme, Clemens«, sagte Stan gereizt.
Dass er seinen Vornamen benutzte, war das deutlichste Zeichen, dass Clay den Bogen allmählich überspannte.
»Trotzdem lässt sich nicht leugnen, dass hier Leute festgehalten wurden«, entgegnete Dawn.
Sie fanden zwei weitere Kammern. Die erste stand offen, und auch hier hingen Ketten an der Wand. Die dritte und letzte war mit einer dicken Holztür verschlossen.
»Sollen wir Danny rufen?«, fragte Dawn scherzhaft. »Falls die klemmt.«
Sie legte die Hand auf die Klinke und zog kräftig. Die Tür ging einen Spalt breit auf. »Okay, vergesst es! Aber das Ding ist verdammt schwer.«
Stan schob seine Finger in die entstandene Lücke und half ihr dabei, die Tür gänzlich aufzustemmen. Plötzlich fluchte er.
»Alles okay?«, fragte Clay.
»Jaja«, wiegelte Stan schnell ab und entfernte seinen Handschuh. »Ich glaube, ich hab mich verletzt.«
Dawn richtete ihre Lampe auf seine Hand. »Zeig mal! Wenn du dich hier an irgendwas geschnitten hast, solltest du heute dringend noch zum Arzt und das untersuchen lassen. Wer weiß, was hier unten für Krankheitserreger sind.«
Clay betrat die Kammer. Sein Lichtstrahl berührte eine alte Holzkiste, die vor ihm auf dem Boden stand.
»So schlimm ist es nicht«, wehrte Stan ab. »Alles gut.«
Die Kiste war geschätzt zwei Meter lang und reichte ihm bis zu den Knien. Neugierig beugte sich Clay vor und hob langsam den schweren Deckel an.
»Was machst du da?«, fragte Dawn.
»Hab einen Schatz gefun…«
Clays Stimme riss ab, als sich ihm der Inhalt offenbarte. Sämtliche Wärme schien aus seinem Körper zu weichen, und eine gnadenlose Kälte grub sich in seine Eingeweide. Er stieß einen heiseren Schrei aus und stolperte zurück.
»Was ist?«, rief Dawn erschrocken. »Clay, was ist los?«
Clay deutete zitternd auf die Kiste. »Da … Da liegt jemand drin.«
»Alter, lass das endlich«, fauchte Stan.
»Das ist kein Witz, verdammt«, fuhr Clay ihn heiser an. »Guck doch selbst!«
Er konnte kaum verarbeiten, was er gesehen hatte. Das, was in der Kiste lag, kam seinem gerade erst erfundenen Monster erschütternd nahe. Zusammen mit seinen skeptischen Freunden trat er wieder näher.
Dawn fluchte tonlos. Stan blieb stumm, doch das Entsetzen stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben.
Vor ihnen lag ein Mann. Keine Fantasiegestalt oder Horrorfilmfigur, sondern ein Mensch. Ob er tot war oder nicht, konnte Clay schwer einschätzen, doch sein körperlicher Zustand ließ kaum einen anderen Schluss zu.
Das ist eine Leiche.
Der Gedanke kroch wie eine Made in seinen Kopf.
Wir haben einen Toten gefunden.
Die Made grub sich tief in sein Gehirn.
Keine Panik, mahnte er sich. Sieh es dir an, wie du dir eine Vorlage ansehen würdest, und zeichne ein Bild.
Seine Freunde sagten irgendetwas, aber er hörte ihnen nicht zu. Clays Konzentration richtete sich vollends auf den Unbekannten vor ihm.
Der Mann schien bloß noch Haut und Knochen zu sein; seine Wangen eingefallen, das Gesicht ausgemergelt. Das schwarze, kinnlange Haar war schmutzig, verfilzt und struppig. Spuren grausamer Misshandlungen zeichneten seinen Körper – Dutzende Prellungen, vermutlich sogar Knochenbrüche und offene Schnitte.
Man hatte ihn über einen langen Zeitraum gefoltert, anders konnte es nicht sein. Seine Kleidung bestand aus Lumpen: Das fleckige Hemd hing ihm in Fetzen vom Oberkörper, seine Füße waren nackt, die Hosenbeine endeten eines oberhalb, eines unterhalb der Knie.
Alles an diesem Anblick schockierte Clay, doch ausgerechnet eine Kleinigkeit, die man leicht übersehen konnte, zog seine Aufmerksamkeit auf sich.