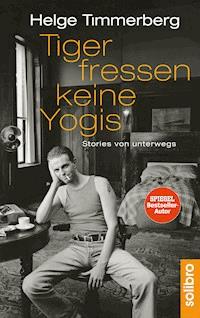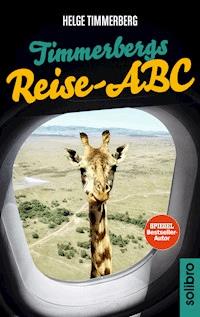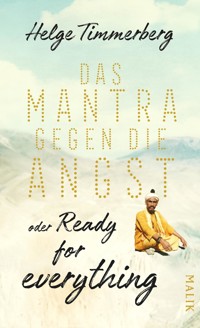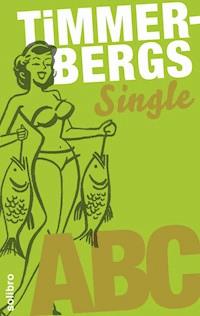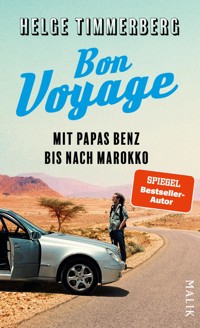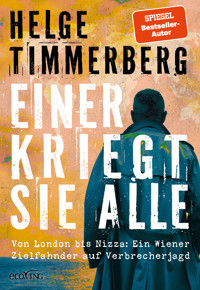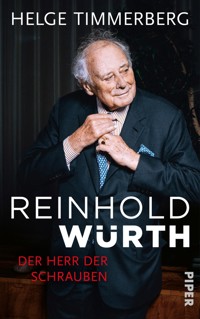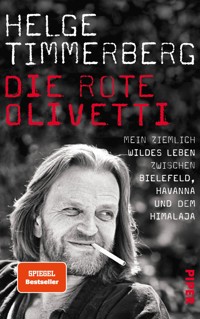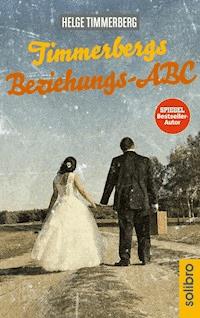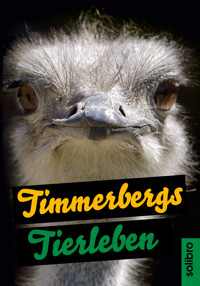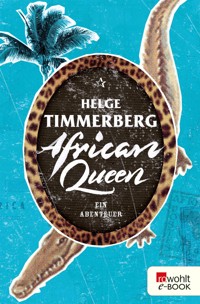
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein temporeiches, witziges Reise- und Liebesabenteuer Helge Timmerberg, Abenteurer und Globetrotter, hat den letzten ihm noch unbekannten Kontinent bereist, sieben Monate lang, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Afrika lag vor ihm wie eine Großwildjagd nach Geschichten. In den Großstädten inspizierte er die Hölle auf Erden, in der Serengeti das Paradies. Er war mit Buschfliegern unterwegs, mit uralten Dampfern, und bangte bei einem nächtlichen Fußmarsch um sein Leben. Er schwamm mit Krokodilen, wurde von einem Elefanten attackiert und von einem Nashorn verfolgt. Er durchstreifte den Regenwald in Uganda, besuchte die weißen Strände von Sansibar und entdeckte die schönste Insel Afrikas, die Ilha de Moçambique. Er wurde im Senegal mit einem Voodoozauber belegt und lernte in Malawi das kleine Einmaleins der Korruption kennen. Er zog durch die Reggaekneipen von Dakar, traf Marabouts, Primatenforscher, Straßendiebe und – Lisa. Dank ihr verbindet sich seine Liebe zum Abenteuer mit dem Abenteuer der Liebe. Beides hat seine Risiken: durchgeknallte Gefühle. Das berühmte «afrikanische Fieber»: Helge Timmerberg hat es gesucht und gefunden. Ein hintergründiges, lebenskluges und lustiges Buch – und eine ebenso exzentrische wie sympathische Abenteurergeschichte, wie sie heute kaum noch zu erleben ist. «Timmerbergs Geschichten sind witzig, unkonventionell und frech. Voller Vertrauen stürzt er sich in Abenteuer, die Normalbürger lieber lesen als selbst erfahren.» Deutschlandfunk
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Helge Timmerberg
African Queen
Ein Abenteuer
Für Lore, Walter,
Flo und Peter
1.DIE INVASION DER PAVIANE
Lisa sagt erst mal gar nichts, als wir das Zimmer betreten. Die vierzehn Stunden Flug mit Zwischenstopps in Kairo, Khartum, Nairobi und Lusaka haben uns etwas zu dünnhäutig für die Hölle gemacht. Das Fegefeuer ist nicht immer heiß, es kann auch kalt sein, entsetzlich kalt und leer. In diesem Raum gibt es nichts, was im weitesten Sinne nach Trost aussieht. Kein Bild, kein Foto, keine Vase, kein Deckchen, keinen Teppich, nicht mal einen Bierdeckel oder so etwas. Kahle Wände, kahler Boden, ein wackliger Stuhl und das Bett mit Albträumen bezogen. Sind wir dafür achttausend Kilometer geflogen? Ich bin in Afrika, aber ich bin nicht mehr allein. Der Vorteil des Zu-zweit-Reisens ist, dass immer nur einer am liebsten tot umfallen möchte, und dem anderen fällt was ein. Ich nehme sofort die Chance wahr, Lisas Held zu sein, und checke wieder aus.
Nächstes Hotel, nächste Prüfung. Das «Korean Garden» hat einen Swimmingpool, ein Restaurant und eine Kakerlake im Bad. Eine nicht besonders große und anscheinend auch bereits halbtote Kakerlake, die sich über den Boden schleppt, bevor Lisa einen Abfalleimer über sie stülpt. «Tu etwas», sagt sie, «bitte tu etwas.» Fakt ist allerdings: Ich ekle mich vor Kakerlaken noch mehr als sie. Also, was soll ich jetzt machen? Drauftreten? Sogar die Kakerlaken-Tötung ohne direkten Körperkontakt ekelt mich, außerdem wäre dann mein Schuh für immer eklig, mit dem Kakerlakenbrei untendran. In die Hand nehmen? Raustragen? Glitsch und Schleim in meiner Faust für, sagen wir, eine volle Minute ertragen? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Der Gärtner kann es. Ich hole ihn von draußen, und er lacht, als er die Kakerlake sieht. Er hat nach meiner Schilderung mit einem Skorpion gerechnet, mit einer Kobra oder einer Ratte. Er nimmt das arme Tier vom Boden und steckt es sich in die Hosentasche. Nachdem ich ihm Trinkgeld gegeben habe, verlässt er noch immer lachend das Zimmer, und das war es dann mit der zweiten Heldentat an diesem Tag.
Lisa reagiert darauf gespalten. Einerseits bin ich schlimmer als ein Mädchen, andererseits souverän. Reist sie mit einem souveränen Mädchen? Oder mit einem mädchenhaften Souverän? Und was bedeutet das für Malawi, wenn erst im «Korean Garden», aber bald auch in jedem anderen Hotel des Landes die Gärtner minimum eine Kakerlake pro Tag in jedes Zimmer legen, weil das Trinkgeld, das einst ein weißer Mann einem der ihren gab, doppelt so hoch wie sein Tageslohn war?
Der erste Tag ist immer schwierig. Bei Fernreisen kommt die Seele erst drei Tage später an. Und man fühlt sich seltsam ohne Seele. Man ist nirgendwo zu Hause, weder im Alten noch im Neuen. Außerdem ist es Sonntag. Da zeigt keine Stadt, was sie kann. Alle Geschäfte geschlossen, die Bürgersteige hochgeklappt, hin und wieder bewegt der Wind auf den staubigen, menschenleeren Straßen einen Fetzen Papier. Mit dieser Ödnis harmonieren die Häuser der Stadt. Hauptsache-es-regnet-nicht-rein-Architekten haben ein Stadtbild des schnörkellosen Funktionalismus auf unterstem Materialniveau geschaffen, und infrastrukturell glänzt die Metropole Malawis mit zwei, drei asphaltierten Straßen. In Lilongwe sonntags allein zu sein bedeutet, einsam im Alkohol zu versinken, aber zu zweit trinken wir manierlich, und im Bett halten wir uns aneinander fest. Jeder ist des anderen Decke und Kissen, jeder ist des anderen Wärme und Schutz. Ich atme ihren Atem, ich atme in sie hinein, und damit schlaf ich ein.
Der zweite Tag ist immer leichter. Ausgeschlafen, satt und von der Sonne geküsst, finden wir sofort die drei besten Adressen für unsere Interessen. Das «Kiboko Town Hotel», den «Fastest Internetshop» und das Restaurant «Don Brioni». Alle drei sind im selben Gebäude. Das Hotel gehört einer geschmackssicheren Holländerin, der Cybershop einem geldgierigen Inder und das Restaurant einem «Fake-Italiener» namens Brian, der weltweit, aber am liebsten auf Kuba Hotel- und Restaurantpersonal ausgebildet hat, bevor er sich in der Hauptstadt von Malawi niederließ, um, wie er sagt, seine alten Tage mit Trinken, Freundemachen und Geldzählen zu verbringen. Der Engländer ist über siebzig, seine afrikanische Frau unter vierzig, und sie sieht exakt so aus wie das, was die Restpotenz eines Siebzigjährigen braucht. Highheels, Hotpants, Megatitten und zwei knallrote Sofas statt Lippen. Don Brioni bietet die Standards der italienischen Küche, außer Pizzas, warum, habe ich vergessen, aber sein ganzer Stolz ist ein Avocado-Gericht. Es fand Erwähnung in einem dicken Hochglanz-Gourmet-Bildband, der über seiner Theke steht, und er zeigt es jedem Gast, also auch mir. «In diesem Buch zu sein, ist so ’ne Art Nobelpreis für Gastronomen», sagt er und strahlt mich an. «Und was machen Sie?»
«Ich bin Schriftsteller», antworte ich und strahle zurück.
«Sind wir das nicht alle?»
Die anderen Gäste: Missionare, Großwildjäger, Geheimdienstler, Buschflieger, Botschaftsmitglieder, UN-Leute und ein paar Touristen, von denen sich aber mindestens die Hälfte nicht als Touristen bezeichnen würde, sondern als Entwicklungshelfer. Medikamente verschenken, Geld verteilen, Brunnen bauen, dafür haben sie bezahlt. Pauschalreisen einschließlich der guten Tat sind zu einem recht blühenden Zweig der Tourismusindustrie geworden; es gibt aber immer noch Individual-Helfende wie den Kanadier, mit dem ich kurz an der Theke spreche. Er hat dreißigtausend Bibeln dabei.
Wir warten hier auf Collin. Der Generalmanager einer Fünfsternelodge in Mosambik und Lisas zukünftiger Chef macht eine Einkaufstour rund um den Malawisee und ist heute in Lilongwe. Gleich werde ich auf das schottische Phantom treffen. Wie wird er auf mich reagieren? Und wie ich auf ihn? Und was wird er zu Lisa sagen? Zu ihrer Mail, die die Lösung für unsere Verlustängste gewesen ist? Sie hatte sie aus Wien geschickt und ihm darin mitgeteilt, dass sie nicht für ein Jahr in der Lodge als Frontdoormanagerin arbeiten werde, sondern nur für drei Monate, und außerdem ihren neuen Freund mitbringe. Collin brauchte eine Woche, um «Das geht okay» zurückzumailen, aber wie okay geht das wirklich, wenn er Lisa gegenübersitzt? Und wie okay geht das für sie? Das sind unsere Fragen unter Don Brionis Deckenventilatoren und bei Don Brionis Wein. Who the fuck is Collin? Und wie wird er sein?
Einige dieser Fragen klären sich auf der Stelle, als Collin kommt. Rote Haare, roter Bart, Sommersprossen und Nickelbrille in einem jungenhaften Gesicht. Lisa hat recht. Ein Pfadfinderlein ist kein Grund für mich, eifersüchtig zu sein. Und er ist nicht allein. Eine hübsche junge Frau namens Rose begleitet ihn, auch sie rothaarig und sommersprossig, und sie scheint ein bisschen verliebt in ihn zu sein. Und er in sie? Man wird sehen, auf alle Fälle ist das ideal. Zwei Paare, ein Busch, und niemand muss auf seine Frau aufpassen. Rose lebt als Volontärin in der Lodge. Sie arbeitet umsonst, ihr Lohn ist das Aufenthaltsrecht im Paradies. Sie sagt, sie sei vor drei Wochen gekommen und müsse sich noch immer fangen, denn die Lodge sei noch schöner als auf den Fotos. Magisch schön. Freut das Lisa? Oder schmerzt es sie? Ich sehe beides kurz in ihren Augen und hoffe, dass unterm Strich nicht Wut rauskommt, denn sie hat ihren Jahresvertrag im Paradies meinetwegen um neun Monate verkürzt. Wird ihr das Glas ein Viertel voll oder drei Viertel leer erscheinen, wenn wir angekommen sind? Collin sieht das entspannt. «Lisa macht in den drei Monaten all den Scheiß, auf den ich keine Lust habe», sagt er, und ich muss herzlich lachen. So reden keine Pfadfinder, nein, so nicht. Anschließend regelt er am Handy, wie es weitergeht. Er besorgt uns eine Kabine für die zwanzigstündige Schiffsfahrt über den Malawisee und eine Unterkunft auf der Insel Likoma sowie ein Speedboot der Lodge, das uns am nächsten Morgen von Likoma zur Küste von Mosambik bringen wird. Drei Anrufe, drei Ergebnisse, sofort, und das in Afrika. Ich revidiere meinen ersten Eindruck vom Generalmanager der Lodge. Und auch den von Rose. Sie trinken so viel wie wir, machen aber früher Schluss, denn sie wollen am nächsten Morgen mit dem Jeep weiterfahren. Die Tour werde noch ein paar Tage dauern, aber zu unserer Ankunft seien sie zurück. «Let’s walk with Johnnie», sagt Collin und bestellt eine Runde Whisky, bevor sie gehen.
Die Reise beginnt immer erst am dritten Tag. Wir nehmen ein Taxi für die hundertfünfzig Kilometer von Lilongwe zum Malawisee. Endlich rollen die Räder, und ich schlafe sofort ein, nachdem wir aus der Stadt raus sind. Lisa weckt mich, ich weiß nicht, wann, und plötzlich ist da Afrika. Das Afrika der Träume, der Postkarten, der Buchcover und Filmplakate. Afrikanische Savanne, afrikanische Bäume, afrikanische Farben und, ach ja, afrikanische Weite. Man vergisst in den Städten, wie groß und unverbaut der Kontinent ist. Wo bin ich? Westlich von Mosambik, östlich von Sambia, nördlich von Simbabwe und südlich von Tansania. Im Land der Nilpferde und Leoparden, im Wirkungsbereich Livingstones und auf alten Sklavenpfaden. Die Weite, die Zeit, die Grenzenlosigkeit der Möglichkeiten, all das weht durch das offene Fenster herein, und ich danke Lisa zum ersten Mal dafür, dass sie mich nach Afrika gebracht hat.
Am See angekommen, checken wir in irgendeiner Hundertdollar-Beachlodge ein. Das ist in Afrika die Mittelklasse. Darunter liegen die Backpacker-Paradiese mit zwanzig Dollar, darüber alles Mögliche. Lisas Lodge kostet dreihundert, andere tausend pro Nacht. Ich hörte sogar von Lodges, die zehntausend Dollar für vierundzwanzig Stunden in der Wildnis nehmen. Da checkt dann Madonna ein, wenn sie Kinder adoptieren will, aber für unsere Zwecke geht die Mittelklasse in Ordnung.
Allerdings fehlt in der «Sunset-Lodge» eindeutig die weibliche Hand. Im Zimmer, im Garten, im Restaurant und am Strand, überall fehlt Moni, die zweite Hälfte von Toni, seit einem Jahr managt er die Lodge allein. «Warum?», frage ich. «Es war ihr zu viel Arbeit», antwortet Toni. Toni ist Deutscher, präziser ein Ossi, und von Beruf Tischler; er hatte einen eigenen Betrieb in der Nähe von Rostock, bevor er wegen der schlechten Auftragslage und des angeborenen Hasses ostdeutscher Bürokraten auf Freiberufliche die Faxen dicke hatte und ihn der Hafer stach. Irgendeine Stimme in ihm sagte AFRIKA, aber Genaueres sagte sie nicht, darum machte es Toni folgendermaßen: Er nahm eine Afrikakarte und drehte sie mit geschlossenen Augen auf dem Tisch, dann tippte er mit dem Finger drauf. Augen auf. Malawi? Nein, Namibia. Das war eine sehr kluge Wahl des Zufalls. In ehemals Deutsch-Südwestafrika gibt es noch jede Menge Deutsche, die Arbeit für gute Handwerker haben, aber Toni arbeitete in Windhuk auch für einen holländischen Hotelier, der ihm einen festen Job anbot. In einer seiner Lodges in Malawi war der Manager gestorben, weil er unglücklicherweise zwei schwere Fieberkrankheiten gleichzeitig bekommen hatte. Toni selbst hatte sechsmal Malaria, seitdem er hier Chef geworden ist, das erste Mal hätte es ihn beinah umgebracht, und er sah das weiße Licht, die restlichen Erkrankungen steckte er wie eine schwere Grippe weg. Und zwischendurch lief ihm Moni davon.
Eine traurige Geschichte, die noch immer nicht beendet ist, denn Toni hat noch ein Problem. Eine Pavian-Invasion. Primaten checkten ein. Sie kamen aus dem Regenwald und fanden, dass eine Lodge für sie artgerechter sei. Nicht ein Pavian, nicht zwei, nicht drei, sondern ein ganzes Volk zog geschlossen aus der Wildnis in Tonis Lodge um, so sechzig bis achtzig Tiere, genauer kann er es nicht sagen, sie lassen sich nur schwer zählen, weil sie sich entweder verstecken oder in Aktion sind, außerdem werden es täglich mehr. Der Trick der Primaten ist die sanfte Übernahme. Sie greifen nicht an, sie beißen nicht, sie vertreiben die Menschen nicht mit ihrer unglaublichen Körperkraft und ihrem fürchterlichen Gebiss, denn sie sind ja nicht blöd. Auch sie wollen keine Paviane als Köche oder einen Affen, der statt des Gärtners dem Swimmingpool täglich sauberes Wasser zuführt. Auch Primaten schätzen Qualität, und wer, außer den Gästen, würde hier sonst sein Essen unbewacht herumliegen lassen? Bestimmt kein Affe, und es wäre ein lausiges Leben, wenn hier Affen nur Affen bestehlen könnten, nein, sie brauchen die Menschen, und ihr Kniff ist: Vergesellschaftung. Schleichende Gewöhnung. Der Garten von Tonis Lodge ist groß, und er hat auch recht zugewachsene Teile, die fließend in den angrenzenden Regenwald übergehen. Diese Transit-Welten sind bereits fest in der Hand der Paviane, hier schlafen sie, und hierhin ziehen sie sich auch tagsüber zurück, wenn zu viele Gäste den freien Rasen nutzen. Aber der Pool in der Mitte des Gartens zählt mit seinen künstlichen Miniaturfelsen und seinem Miniwasserfall ebenfalls bereits als Pavian-Territorium. Hier laben sich nur noch Affen, der Mensch badet am Strand. Morgens allerdings, wenn die Sonne aufgeht, sind im gesamten Open-Air-Bereich von Tonis Lodge nur noch Affen, selbst auf den Zimmerterrassen. Frühaufsteher wie ich haben dann die Chance, Affenkindern beim Spielen zuzusehen und den Alten beim Ficken. Okay, sie machen das auch tagsüber auf offener Bühne, denn Primaten kennen keine Scham. Sie haben keine Religion, und sollte es unter ihnen doch so etwas wie einen Gott geben, so hat er nichts gegen Exhibitionisten. Paviane zeigen gern, was sie haben, warum, ist mir nicht ganz klar. Die Männchen haben dünne Penisse und winzige Hoden, die Weibchen monströs geschwollene Pobacken. Gut, dass Paviane nicht in der Lage sind, Männermagazine zu produzieren, denn sonst hätten wir einen «Playboy» mit den hässlichsten Ärschen der Welt. Pavianärsche zum Ausklappen! Noch finden Tonis Gäste das lustig, aber der Tag wird kommen, an dem ihnen die Affen in die Kaffeetassen pinkeln, und dann ist Schluss mit dem Tourismus, dann kann die Lodge noch ein paar Jahre an Primatenforscher vermietet werden, die hier luxuriöser als anderswo ihren Studien nachgehen. Doch besser, und zwar für alle Beteiligten, wäre es, wenn Toni endlich das tun würde, was hier getan werden muss und was auch sein an Malaria und der Schlafkrankheit verstorbener Vorgänger gemacht hat, um der Sache Herr zu werden. Aber Toni kann seine Abneigung gegen Feuerwaffen einfach nicht überwinden. Er ist Pazifist, er ist zu weich für Afrika. Hat ihn Moni deshalb verlassen? Man weiß es nicht.
2.AFRICAN QUEEN
Man weiß auch nicht, wann die «Ilala» morgen in See sticht. Toni meint, um 18Uhr, sein Fahrer sagt, 17Uhr, und im «Lonely Planet» steht, vormittags um zehn. Don Brioni sagte gestern, man solle, egal, wem man glaubt, vier Stunden vorher da sein. Die «Ilala» sei das unpünktlichste Schiff der Welt und ihr Fahrplan nicht mehr als ein Diskussionsvorschlag fürs Schicksal. Wir sind um 17.30Uhr am Hafen von Chipoka, und ich glaube es fast nicht, wie deckungsgleich dieser rostige Dampfer mit den Träumen Hollywoods ist. Der Film heißt «African Queen», und das deutsche Schiff, das Humphrey Bogart versenkt, sieht aus wie die «Ilala». Das Glück der Cineasten durchflutet mich, weil das Original noch rostiger ist als die Kopie, Lisa dagegen sieht nur den Rost. Und sie sieht, was ihrer Laune noch abträglicher ist, den Rost auslaufen. Wir haben die Abfahrt der «Ilala» um schätzungsweise fünf Minuten verpasst. Und jetzt?
Jetzt flippt Lisa mal kurzfristig aus.
Wir kennen uns seit drei Monaten, und ich weiß noch immer nicht so recht, wie ich damit umgehen soll, wenn sie die Schnittstelle ihrer Existenz mit dem Universum dermaßen einfaltet, dass sich, von ihrer Wut ausgehend, die Welt wie ein großes Stück Papier durchgehend zu verknittern beginnt. Die Welt ist vielleicht übertrieben, aber bis zu Toni reicht die Irritation der Atmosphäre ganz bestimmt: «Warum habe ich nicht auf meine Intuition gehört! Ich habe Toni zweimal gebeten, wegen der Abfahrtzeiten anzurufen. Er sagte, er habe es getan, aber ich wusste, dass er es nicht getan hat. Er hatte einfach keine Lust dazu. Jetzt müssen wir der ‹Ilala› hinterherfahren. Und ich hasse es, in der Dunkelheit auf afrikanischen Landstraßen zu sein.»
Die «Ilala» ist das einzige Passagierschiff, das den drittgrößten See Afrikas regelmäßig befährt, und sie macht das gründlich. Sie läuft im Zickzackkurs elf Häfen an, und der nächste ist glücklicherweise noch auf unserer Seite des Sees und auch nur zwei, drei Stunden mit dem Auto entfernt. Lisa ruft Toni an, um von ihm das zu hören, was sie jetzt hören will. Sein Fahrer wird uns umgehend nach Nkhotakota bringen, und das auch nicht für hundert Dollar, die für diese Tour der normale Preis sind, sondern nur für die Spritkosten und die zwei Red Bull, die der Mann braucht, um auf dem Rückweg nicht einzuschlafen. Eine halbe Stunde später beginne ich, Toni still und heimlich für seine Schlamperei zu danken, denn der Himmel färbt sich während der Fahrt wie auf dem Umschlag eines Afrikaromans: «Die weiße Massai», «Ich träumte von Afrika», «Ich kehre zurück nach Afrika», «Karibu heißt willkommen», «Der Ruf der Kalahari», «Die Regenkönigin» – das sind nur ein paar Beispiele für die Kapitulation der Kreativität vor dem Sonnenuntergang in der Savanne. Eigentlich jedes Cover der von Frauen geschriebenen Romane sieht so aus, aber auch feminisierte Schriftsteller wie Hardy Krüger («Die andere Seite der Sonne») und Henning Mankell («Die flüsternden Seelen») konnten nicht anders, als das weiblichste Bild von Afrika für ihr Buch zu wählen, und das ist zur Hälfte rubinrot, rosenrot, rotweinrot und richtig rot und zur anderen Hälfte mangoorange und zitronengelb, aber dort, wo die Sonne in die Erde sinkt, ist weißes Licht. Und davor steht schwarz und wie hingezeichnet eine Schirmakazie oder ein Affenbrotbaum. Immer. Auch jetzt.
Lisa nimmt meine Hand und sagt nichts. Ich schließe mich ihrem Schweigen an, obwohl es mich drängt, ihr zum zweiten Mal dafür zu danken, dass sie mich nach Afrika gebracht hat. Ich hatte mich nicht nur dagegen gewehrt, sondern auch einiges dafür getan, sie von der Reise abzuhalten. Weil ich dachte, dass ich überreist bin. Weil ich glaubte, nicht mehr neugierig zu sein. Und weil mir dieser Kontinent am Arsch vorbeiging. Sie war stärker als ich, und jetzt freue ich mich über meine Schwäche, denn eine Fahrt durch das ländliche Afrika um diese Uhrzeit gehört zur Champions League der Reiseeindrücke. Das wird mir schlagartig klar. Das ist dasselbe wie eine Wanderung im Himalaya oder eine Nacht unter den Sternen der Wüste. Das ist das ganz große Kino der Seele. Die Erinnerung der Gene. Die Menschheit kommt von hier. Unter diesem Himmel lernten wir, aufrecht zu gehen. Mama Afrika trägt zum Sonnenuntergang ihr ewiges Cocktailgewand. Und was den Unterschied betrifft, das allein oder zu zweit zu genießen: Ein alter indischer Freund sagte einmal zu mir, dass 1 und 1 in der Regel 2 ergibt, aber manchmal ist 1 und 1 auch 11, und dann handelt es sich nicht um eine Addition, sondern um eine Transformation des Genusses. Ich lasse Lisas Hand los, um eine Dose zu öffnen. Ich gebe sie ihr. Unter all den Möglichkeiten, sich wortlos zu bedanken, gilt ein kühles Bier nicht als die schlechteste.
Sechs Stunden später ist die Nacht nur noch schwarz. Wolken schlucken das Licht der Sterne. Es ist ein Hafen ohne Lampen und Laternen. Nur die «Ilala» ist beleuchtet, aber sie ankert zweihundert Meter vom Ufer entfernt. Einen Anlegesteg gibt es nicht. Die Schiffssirene mahnt zum Aufbruch, und um uns herum erheben sich Menschen wie Geister. Sie schnappen sich ihre Körbe, Säcke, Koffer, Käfige und Kinder und rennen zum Wasser. Wir rennen mit, aber werden von einem Mann abgefangen, der uns einen Einbaum anbietet. «Lasst euer Gepäck nicht los», ruft uns der Mann hinterher, als wir mit vier oder fünf anderen Weißen in die Nussschale springen, und jeder hat Angst um seinen Laptop, sein Geld und seinen Reisepass, denn es schaukelt bedenklich. Neben uns waten Afrikaner durch das Wasser, jetzt mit ihrem Gepäck auf den Köpfen. Zwei Beiboote der «Ilala» rasen herbei und halten zehn Meter vor dem Ufer, um die Leute aufzunehmen. Wenn alles gutgeht, werden dabei die großen Passagiere bis zur Hüfte und die kleineren bis unter die Achselhöhlen nass. Wir klettern inmitten des Gedränges von dem Einbaum in eines der Boote und verlieren auf der Stelle was. Es ist nichts Materielles, nur Kulturelles, wir verlieren ein Stück Zivilisation. Mit Rücksichtnahme kommt hier niemand aufs Boot. Mit Höflichkeit findet hier keiner einen Platz. Manieren sind in Afrika Quatsch. Frauen quetschen, Männer schimpfen, ein Kind setzt sich auf meine Gitarre. Um die sorge ich mich auch. Und ich sorge mich um Lisa, aber Lisa hat es ganz gut im Griff, obwohl ihr Rucksack riesig ist. Sie sorgt sich nur um mich. Das ist nicht gut. Es sollte sich immer nur einer sorgen und einer nicht. Geschafft. Wir hocken irgendwie, und ein bisschen auch auf irgendwem, in dem Beiboot, und es zischt ab. Wir nähern uns der «Ilala». Dabei wird sie größer und rostiger. Wie zum Teufel kommen wir auf das Schiff? Mit Strickleitern? Nein, die Leitern sind aus Eisen. Sobald das Beiboot an ihnen angelegt hat, wollen alle mit Kind und Kegel gleichzeitig hoch. Ich mache dabei keine gute Figur, ich bin definitiv ein Anlegesteg-Typ. Trotzdem: Wir sind auf dem Schiff.
Die «Ilala» wurde 1949 in Schottland gebaut und in achttausend Einzelteilen nach Mosambik verschifft, von dort ging es mit der Bahn weiter, und am Malawisee hat man sie wieder zusammengeschraubt. Sie ist 52Meter lang, 620Tonnen schwer und kann 365Passagiere und hundert Tonnen Fracht transportieren. Wenn es unbedingt sein muss, transportiert sie auch mehr. Und noch etwas:
Die «Ilala» entspricht nicht den internationalen Passagiertransportbestimmungen.
Die «Ilala» ist oft kaputt.
Die «Ilala» ist schon mehrfach gesunken.
Aber all das ist unnützes Wissen für Lisa, darum erzähle ich es ihr nicht. Ich behalte auch für mich, dass vor gerade mal einer Woche in Uganda ein ähnliches Schiff gekentert ist. Von den dreihundert Passagieren konnte man zwanzig lebend aus dem Viktoriasee ziehen, der Rest ernährt derzeit die Fische. Und der Malawisee ist noch unberechenbarer. Die Wetterwechsel sind legendär. Als Livingstone den See 1859 entdeckte, nannte er ihn «See der Sterne», weil er so ruhig und glatt war, dass sich der Nachthimmel in ihm spiegelte. Ein bisschen später nannte er ihn «See der Stürme». Fünf Meter hohe Wellen, manchmal auch zehn Meter hohe, macht dieses Binnengewässer mit links. Und tuuuuuuut, wir laufen aus.
Auf dem Unterdeck der Dritte-Klasse-Passagiere geht es Quadratmeter für Quadratmeter genauso zu wie auf dem Beiboot vorhin, auf dem Oberdeck schläft die Zweite Klasse auf Luftmatratzen. Wir finden unsere Erste-Klasse-Kabine im Zwischendeck. Ein schwuler, einäugiger Steward führt uns hin. Er ist betrunken. Der Typ, der uns etwas später das Ticket verkauft, ist auch betrunken, aber die Kabine geht okay. Zwei schmale Betten, ein Tisch, ein Stuhl und nur eine Kakerlake. Und bis auf die Kakerlake ist alles angeschraubt. Ist doch fabelhaft hier. Wir schlucken Lisas Tabletten gegen Seekrankheit mit jeweils einer Dose Bier und gehen noch mal aufs Oberdeck, um dem Schauspiel beizuwohnen, wie die paar Funzeln von Nkhotakota in der Nacht verschwinden. Dabei lernen wir zwei schottische Studenten kennen, beide so um die zwanzig. Außer dass sie jung sind und keinen Bauch haben, sind sie stinklangweilig. Darum redet nur Lisa mit ihnen, ich sitze ein paar Meter abseits auf einer Bank und denke gar nichts. Als sie wieder bei mir ist, frage ich Lisa nach der Uhrzeit.
«Viertel drei», sagt die Wienerin.
«Also Viertel nach zwei?»
«In etwa.»
«Dann trink mit mir auf den Geburtstag meiner Tochter.»
«Wie alt wird sie?»
«So alt wie du.»
Lisa verliert ihr Lächeln. Sie wendet sich ab und sieht ein bisschen verzweifelt in die Dunkelheit. Da haben wir den Salat. Wir arbeiten an dem Thema Altersunterschied seit unserem ersten Kuss, und wir haben darüber zwar noch nicht promoviert, aber zumindest das Wichtigste ist geklärt.
«Und das wäre?», fragt sie.
«Bei uns ist es definitiv keine Vater-Tochter-Beziehung.»
«Aber die anderen denken das.»
«Es ist mir scheißegal, was die anderen denken.»
«Mir nicht.»
Ein Vierteljahrhundert Erfahrung trennt uns. Wäre sie so alt wie ich, interessierte sich auch Lisa weniger dafür, wie sie wirkt, und mehr dafür, wie sie ist, und würde im besten Fall freier und im schlechtesten Fall asozialer sein, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und wenn sie endlich da angekommen ist, wo ich jetzt bin, werde ich wahrscheinlich tot sein. Oder ein Tattergreis, der nicht mehr weiß, wie sie heißt. Der Altersunterschied ist das schwarze Loch unserer Beziehung, und immer wenn wir hineinsehen, fällt uns nichts mehr ein, außer die Botschaft der Hormone. Wir sind verliebt. Das macht die Sache zwingend. Was immer uns da draußen in der Zukunft an offenen Messern erwartet, es ist unser Weg.
Eine Reise, zwei Abenteuer. Afrika und die Liebe. Was ist gefährlicher? Bisher war es immer die Liebe. Dschungel, Bestien, Räuberbanden und marodierende Soldaten haben mich auf Reisen nicht einmal angekratzt. Das habe ich von meinem Opa. Er war in zwei Frankreichfeldzügen als einfacher Soldat, also als Kanonenfutter unterwegs, aber er hat die Kanonen hungern lassen und ist ganz und gar unverletzt wieder heimgekommen. Nicht mal einen Streifschuss konnte er vorweisen. Lieber Vorschuss als Streifschuss ist meine Variation unseres Familienglücks. Nur Amors Pfeile fliegen nicht an mir vorbei, Gott weiß warum. Mein Herz ist so zerschossen, dass es der Zielscheibe eines Frauen-Bogenschützenvereins gleicht. Ergebnis: Ich traue der Liebe nicht, wenn sie mich umarmt, weil ich das Messer fürchte, das sie dabei für gewöhnlich in der Hand hält. In Herzen kann man auch durch den Rücken stechen. Immer und immer wieder. Und das ist mein Problem. Mediziner nennen es das Schmerzgedächtnis. Es macht mir Angst, und Angst ist kein guter Liebhaber. Die Scheißwellen des Malawisees sind mir dagegen relativ egal.
Der «See der Stürme» macht ohnehin auf halblang, also nur fünf Meter hohe Wellenberge, und immer wenn die Wolken aufreißen und den Vollmond freigeben, erhellt er das schwarze Wogen um uns herum bis zum Horizont, und langsam wundert es mich, dass Lisa so cool bleibt. Sie hat Flugangst, aber keine Schiffsangst. Warum? Sie antwortet mit einer Gegenfrage.
«Weißt du, worin für mich der wesentliche Unterschied zwischen einem Flugzeugabsturz und einem Schiffsuntergang liegt?»
«Nein.»
«Ich kann nicht fliegen, aber ich kann schwimmen.»
«Ach so.»
Der Malawisee ist 570Kilometer lang und bis zu 75Kilometer breit, auch bis zu 704Meter tief. Wie lange wir schwimmend bis zum nächsten Hafen bräuchten, ist mir deshalb nicht ganz klar, die «Ilala» wird es in sieben Stunden schaffen. Aber selbst wenn wir mit Schwimmwesten und Gottes Hilfe durchkämen, wäre das nicht das Ende aller Probleme, denn die Ufer des Malawisees sind mit Krokodilen, Nilpferden und Seepythons verseucht. Dabei würden die Nilpferde allein schon reichen, sie sind die gefährlichsten Tiere überhaupt, obwohl sie Vegetarier sind. Aber Hitler war ja auch einer. Ich esse ebenfalls weder Fleisch noch Fisch, und darüber freuen sich alle, die unter uns sind. Dieses Gewässer ist das fischartenreichste der Erde. Vierhundertfünfzig Arten insgesamt, Buntbarsche, Nilhechte, Welse, Karpfen, Salme und diese kleinen Flitzer, deren Name ich vergessen habe, die aber weltweit als der Mercedes unter Aquaristen gelten. Weil sie so bunt sind, so schnell, so geil, so unterhaltsam. Die Männchen jagen die Weibchen, bis denen die Kiemen platzen. Darum hält man in Aquarien auf jeweils einen männlichen Malawisee-Zierfisch drei weibliche. Eins wird gejagt, zwei können Pause machen.
Zurück in der Kabine, variieren wir das Thema Liebe auf unsere Weise. Ich liege lange wach auf meiner Pritsche und bin so scharf wie Nachbars Zierfische, aber will Lisa nicht belästigen, weil ich glaube, dass sie schläft. Und Lisa erzählt mir am nächsten Morgen, dass sie ebenfalls die halbe Nacht wach gelegen hat und mich nicht wecken wollte. Liebe ist, wenn beide unbefriedigt bleiben. Und so beginnt ein weiterer, wunderschöner Tag in Afrika.
3.DIE LODGE
Das weiße Speedboot der Lodge liegt wie ein Gefährt von Außerirdischen zwischen den Einbäumen und Fischerbooten im Hafen von Likoma Island. Fünf Sterne kleben auf ihm, und die beiden Bootsleute tragen Uniformen. Kurze blaue Hosen und beige Poloshirts mit blauen Kragen und blauen Bündchen an den Ärmeln. Sie sind wahnsinnig nett. «Welcome», sagt der jüngere von beiden. «My name Andrew, I speak English, my brother Jackson no speak English.» Nachdem das geklärt ist, bringen sie uns zu einem kleinen Rohbau aus Beton, der die Einwanderungsbehörde beherbergt. Likoma ist die letzte Insel von Malawi vor Mosambik, wir müssen uns abmelden, bevor es weitergeht. Tuuuuuuuuuuut. Das ist die «Ilala». Sie dampft gerade ab.
Auf dem Speedboot bekommen wir Cola aus der Kühlbox und Schwimmwesten. Zurzeit ist es windstill, der See erholt sich vom Sturm der Nacht, aber Jackson gibt Gas und verprügelt mit dem Bug die Wellen. Zwanzig Minuten später ankern wir am Strand von Cobue, ein Nest, das noch kleiner als der Hafen von Likoma ist. Wir krempeln die Hosen bis zu den Knien hoch, springen aus dem Boot und folgen Andrew barfuß zum hiesigen Passbüro. Es ist Sonntag, und es ist nichts los. Ein paar Ziegen, ein paar Kinder, ein Hängebauchschwein, und auch das Büro ist nicht besetzt. Andrew geht los, um den Beamten zu finden, und kommt mit dessen Frau zurück. «Bom dia», sagt sie, «Bom dia», antworte ich. Damit sind wir in Mosambik.
Noch mal dreißig Minuten mit dem Speedboot, aber jetzt parallel zur Küste. Sie ist bergig, wild und grün. Hohe Schilfwiesen am Ufer, dichter Busch dahinter, dazwischen, wie hingesprenkelt, die Grashütten der Fischer, und überall stehen uralte Affenbrotbäume, wie schwarze Riesen, und bewachen die Zeit. Am Himmel sind große, weiße Vögel mit schwarzen Köpfen und schwarzen Flügelspitzen unterwegs. «Seeadler!», ruft Lisa entzückt. Noch entzückender finde ich die bizarren Felsformationen aus Vulkanstein, die wie Finger aus dem Wasser ragen und von Dalí gemalt sein könnten oder von Tolkien beschrieben. Abstrakte Natur, Magie aus Stein, grau zumeist und die Spitzen weiß, und keiner steht allein, sondern immer nur in Gruppen, in familiären Verbänden. Manchmal fahren wir zwischen ihnen hindurch, manchmal müssen wir sie umrunden, und es hört nicht auf. Filigrane Klippen schmücken diese Küste, und dann, fast habe ich es vergessen, bilden sie ein Tor, und dahinter liegt eine kleine Bucht mit einem Anlegesteg, und am Ufer stehen Collin und Rose und winken uns zu.
Wir betreten den heiligen Boden aus Lisas Träumen. Seitdem ich sie kenne, redet sie von der Lodge wie von einem anderen Leben. Und ich redete dagegen. Ich bin dein neues Leben, wir sind die Veränderung, und die Liebe ist das Paradies, nicht irgendeine Ecke in Afrika. Natürlich ist das gemein, ich meine, gemein vom Leben. Erst unterschrieb sie den Vertrag, dann kam ich. Sie musste sich entscheiden, aber konnte es nicht, darum entschied sie sich nur halb oder, genauer, ein Viertel. Die Lodge zum Schnuppern, nicht zum Bleiben. Und ich musste mich auch entscheiden und konnte es nicht und fuhr mit. Jetzt sind wir da und begrüßen Collin mit Handschlag und Rose mit Wangenkuss, und jeder Meter, den wir nun mit ihnen gehen, ist wie ein Traum-Striptease, wie die Entblätterung von Visionen, und darunter kommt eine nackte Wirklichkeit zum Vorschein, die, wie Rose vor Tagen bei Don Brioni sagte, noch schöner ist als die Fotos auf der Homepage. Collin führt uns zu einem anderen Strand. Der Sand ist so weiß wie Papier, das Wasser so türkis wie der gleichnamige Edelstein, und auf den Vulkansteinminaretten, die hier den See schmücken, stehen große Reiher, schlank, elegant und hundertprozent stressfrei, was für den Frieden des Ortes spricht. Durch den Busch, der den Strand begrenzt, schlängelt sich ein Pfad zu Lisas Hütte.
Auch von ihr spricht sie seit drei Monaten. Die Grashütte des neuen Lebens. Der Palast der Genügsamkeit. Einfach, aber sauber, klein, aber mit Terrasse, und das einzige Möbelstück ist ein Bett mit Platz für drei, also ideal für zwei, mit einem weißen Moskitonetz, das bis auf den Boden fällt und das Bett zu einem Raum im Raum macht, zu einem Séparée in der Hütte. Collin und Rose lassen uns für die paar Minuten allein, die es braucht, um anzukommen. Wir stehen auf der Terrasse und sehen in den Busch. Er ist grün, aber nicht sattgrün, er wartet auf den Regen. Durch die Bäume schimmert der See, und gleich links von uns ist ein Bambuswäldchen, vor dem ein kleiner Affe mit riesigen schwarzen Augen sitzt und uns beobachtet.
Ich spüre es auch so, ich brauche mich nicht umzudrehen. Ich tue es trotzdem und blicke in ein total verzweifeltes Gesicht. «Was ist los?», frage ich.
«Willst du es wirklich wissen?»
Eigentlich nicht. Ich weiß es sowieso. Lisa ist wie ein offenes Buch für mich. Aus ihrem Mund hört es sich folgendermaßen an:
«Es ist mein Fehler. Ich hab’s verschissen.»
Was sie meint: Der Fehler bin ich. Ihre Entscheidung für mich hat ihr die Chance genommen, hier ein Jahr zu bleiben oder für immer und ewig. Ich erinnere mich noch genau an diesen Vormittag, an dem sie Collin mitteilte, dass sie den Mann ihres Lebens getroffen hat, den Mann, mit dem sie leben will, und dass sie deshalb nicht so einfach auf Nimmerwiedersehen im Busch verschwinden, sondern nur die drei Monate der Hochsaison kommen kann. Und ich weiß genau, was gerade passiert. Von jetzt an wird es Lisa nur noch darum gehen, doch länger zu bleiben. Von jetzt an bin ich ihr Feind.
Aber schon eine halbe Stunde später schickt Gott eine große schwarze Rauchwolke, um mir zu helfen. Jedenfalls sieht es wie eine Rauchwolke aus, was da über dem See aufsteigt und vom Wind zu uns getrieben wird. Wir sind gerade mit einer Frau unterwegs, die von Collin beauftragt wurde, uns alles von der Lodge zu zeigen. Sie heißt Mama. Und Mama sagt:
«No smoke. Kungo!»
Wissenschaftlicher Name: Chironomidae. Besser bekannt als Zuck- oder Tanzmücke. Die Mücken steigen in Schwärmen bis zu hundert Meter hoch, um sich zu paaren. Die Männchen finden ihre Liebste, indem sie heftig mit den Flügeln schlagen. Dabei entsteht ein Ton, ein Summen, sie singen sozusagen mit den Flügeln in einer artspezifischen Frequenz, von der sich die Weibchen derselben Art angezogen fühlen. Die Evolution hat den männlichen Zuckmücken Genitalzangen spendiert, mit denen schnappen sie sich die Süße und beginnen mit der Begattung noch in der Luft. Zum Höhepunkt kommt es erst auf dem Boden. Diese große schwarze Rauchwolke ist also eine Mückenschwarmorgie, und der Wind treibt sie recht flott direkt auf die Lodge zu. Wir stehen mit Mama am Strand, wenig später stehen wir mit ihr an der Buschgrenze, und noch mal wenig später im Busch, aber es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Plötzlich sind sie da. Überall. In den Augen, in der Nase, im Mund, in den Haaren, auf den Händen, auf Hemd und Hose, zwischen Flipflops und Fußsohlen – überall kopulieren zehn Millimeter große, potthässliche Insekten. Sie verdunkeln den Tag. Kungo hat die Lodge verschluckt. Und wird sie morgen wieder freigeben. Länger leben die Männchen nicht. Ein Massensterben bereits jetzt. Der Boden ist mit entweder vor Lust oder im Todeskampf zuckenden Mücken bedeckt.
«Mama, was machen wir jetzt?»
Mama ist eine schöne Frau um die vierzig und sehr intelligent. Sie ist die Chefin der Afrikaner hier, also Collins schwarze Hand. Und Mama sagt: «Wir fegen sie zusammen und machen McDonald’s draus.»
«Für die Gäste? Oder die Angestellten?»
Mama lacht.
Trotz ihrer ansteckenden Fröhlichkeit macht die Besichtigungstour durch die Lodge jetzt weniger Spaß als gedacht. Wo immer uns Mama hinführt, Kungo ist schon da. Zuerst zeigt sie uns die sieben Chalets für die Gäste. Das sind keine Hütten, sondern kleine Dschungelpaläste. Wände, die mal Felsen waren, Böden aus Teakholz, Möbel aus Bambus, breite Natursteintreppen, die zu Dschungelköniginnen-Betten führen. Jedes Chalet ist anders, und jedes ist mit viel Geschmack, Kreativität und Liebe gebaut, eingerichtet und dekoriert. Die Bäder sind draußen, die Badewannen sehen wie riesige versteinerte Muscheln aus. Aber wen kümmert’s mit fickenden Mücken im Mund? Dasselbe gilt für die imposante zweistöckige Dining Hall im Kolonialstil und für die Restaurantterrasse auf einem Hügel über dem Strand, auf der man an Tischen, aber auch in Hängematten speisen und trinken kann. Es gilt für die Küche, das Lager, die Werkstatt und die Tischlerei, für die Wäscherei und auch das Bootshaus– Kungo wischt die fünf Sterne aus der Lodge. Sie ist zwar noch bewohnbar, aber nicht zu genießen. Und obschon Kungo lästig und eklig ist, freue ich mich über den Erkenntnisschub, den es bei Lisa lostritt.
«Paradies ist anders», sagt sie.
Wie recht sie hat, wie wahr das ist, wie überaus weise. Es gibt keine äußeren Paradiese. Das ist alles Quatsch. Es gibt auch kein neues Leben. Man nimmt das alte immer mit. Egal, was man im Reisegepäck vergessen hat, sich selbst vergisst man nicht. Die Launenhaftigkeit der neuen Heimat plus die Unverwüstlichkeit des alten Ichs bremsen die Freude, ein Gesetzloser zu sein, mächtig. Die Gesetze, die sich nicht abwerfen lassen: Nicht nur wir müssen sterben, es stirbt auch jeder Tag, jedes Gefühl, jedes Glück. Es gibt keinen Fluss ohne Wellen, es gibt kein Leben ohne Auf und Ab, und wenn es doch eins gibt, dann kenne ich es nicht. Die Lodge ist es jedenfalls nicht.
Collin ist derselben Meinung. «Die Lodge ist kein Paradies, aber ein cooler Platz», sagt er.
Wir sitzen inzwischen auf der Terrasse vor Collins Büro. Auf Stühlen, die so groß wie Sessel sind oder so groß wie der Dorfthron irgendeines Buschhäuptlings, und sie sind nicht wirklich bequem, man verliert sich ein bisschen in dem rustikalen Sitzmöbel, es sei denn, man hockt in ihnen entspannt im Schneidersitz, so wie Collin, manchmal legt er auch ein Bein auf den Tisch. Aus unerfindlichen Gründen sind hier weniger geile Mücken unterwegs als überall sonst in der Lodge, die Terrasse und das Büro werden von ihrem Massen-Gang-Bang weitgehend verschont. Vielleicht liegt es an der Küche, die dem Büro gegenüberliegt. Drinnen arbeiten sie mit Gas und Strom, aber davor ist noch eine kleine Grillküche mit einem gemauerten Feuerofen, und das Feuer ist immer an. Vielleicht mögen Zuckmückenschwärme, die wie Rauch aussehen, keinen echten Rauch, vielleicht liegt es an der Größe des Platzes, um den alle wichtigen Betriebsgebäude der Lodge gruppiert sind, vielleicht spricht hier die Thermik ein Wörtchen mit, die Strömungsverhältnisse der Winde, es weht ein bisschen über die Terrasse, und es kann auch sein, dass es alle Gründe zusammen sind, die Kungo von Collins Tisch fernhalten, während er uns das Konzept der Lodge erklärt.
Es wurzelt in dem Wunsch, Afrika zu helfen. Richtig zu helfen. Schenken ist falsche Hilfe. Spenden auch. Wohin soll das führen, außer zu Abhängigkeiten? Hilfe zur Selbsthilfe ist der einzige Weg, und die fünf Gründer der Lodge, zu denen Collin nicht gehört, wussten darüber recht gut Bescheid, denn sie hatten jahrzehntelang für die UNESCO gearbeitet, bevor sie mit einer Cessna über die tausend unberührten Buchten des Malawisees flogen, um die schönste von ihnen auszusuchen. Umgeben von wilden Wäldern, wilden Tieren und ein paar abgelegenen Fischerdörfern. Das nächste ist zwei Stunden Fußmarsch entfernt. Keine Infrastruktur, keine Anschlüsse an die Adern der Zivilisation. Die Materialien, die es brauchte, um die Lodge aufzubauen, stammen aus den umliegenden Wäldern. Der Strom kommt aus Sonnenkollektoren, das Wasser wird aus dem See gepumpt, und das Personal rekrutiert sich aus den benachbarten Dörfern. Die Lodge bildet Köche, Kellner, Zimmermädchen, Bootsleute, Barkeeper, Wächter, Gärtner, Handwerker aus. Achtzig Leute arbeiten hier, und weil jeder Afrikaner, der ein festes Einkommen hat, statistisch gesehen vierzehn Menschen miternährt, leben von dieser Lodge gut elfhundert Menschen, wie Collin zu Recht stolz erklärt. Finanziert wird das Ganze von Leuten, die bereit sind, in der Hochglanzversion afrikanischer Ursprünglichkeit dreihundert Dollar für Vollpension auszugeben. Die meisten bleiben nur drei Tage, und das ist sinnvoll, denn drei Tage funktioniert jedes Paradies.
«Noch Fragen?»
«Wie machen wir es mit mir, Collin? Wieviel zahle ich? Du weißt, ich bin ein armer Schriftsteller.»
«Gib mir ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken, okay? Und wohin wollt ihr eigentlich danach?»
«Wann danach?»
«Nach der Lodge.»
Collin stellt die Frage völlig arglos, vielleicht aus echtem Interesse, vielleicht aus Höflichkeit, aber weh tun will er mit ihr sicherlich niemand hier am Tisch, trotzdem zuckt Lisa zusammen, als habe sie mal kurz ein offenes Stromkabel gestreift.
Der Sonnenuntergang legt sich dann in den bekannten Farben wie ein Theatervorhang auf den Malawisee, und die Milchstraße übernimmt die Deckenbeleuchtung am Strand. Wir sitzen um ein ziemlich großes Feuer. Es ist für zehn oder zwölf oder mehr Herumsitzende gemacht, aber es sind derzeit keine Gäste in der Lodge, und das Feuer gehört uns allein. Auch hier greifen die Anti-Zuckmücken-Garanten Rauch und Wind, Kungo hat sich in den Busch verzogen. Und Lisa ist ganz in Schwarz gekommen, schwarze Strandhose, schwarze Bluse, schwarze Brille, schwarze Haare, lange schwarze Haare, offen getragen, scharf gezogene Lidstriche, und auf ihrem dezent roten Lippenstift glitzert das Sternenlicht ein bisschen, also das volle Ich-zeig-mal-wie-ich-aussehen-kann-Programm. Das wird ein Teil ihrer Arbeit sein. Sie muss jeden Abend mit den Gästen am Feuer Konversation betreiben, oder Guest-Hosting, wie Collin es nennt. Gut aussehen, gut reden, gute Miene zu jedem Scheiß machen. Und das kann Lisa, wenn sie motiviert ist, mit links.
Sie ist überaus motiviert heute Nacht. Collin lacht ehrlich über ihre Scherze, und sie lacht tief und gurrend über seine, und ich weiß, dass man das ein herzliches Lachen nennt, aber für mich ist es Anmache. Ich hasse diese Einschätzung der Lage sowie die Gefühle, in die sie mich bringt. Aber was soll ich machen? Die Eifersucht ist ein Teil der Leidenschaft, und die Leidenschaft ist die ungezogene Tochter der Liebe. Außerdem muss ich selber lachen. Collin antwortet gerade auf Lisas Frage, ob es hier am Strand wirklich ein großes Krokodil gebe. Mama hat es ihr erzählt. Collin sagt, ja, das stimmt, es lebt am Ende des Strands in dem Schilfbestand einer ausgetrockneten Bachmündung. Lisa kann es nicht ganz glauben und ich auch nicht. Stimmt das wirklich, Rose? Und Rose sagt, ja, das stimmt. Sie hat es bereits gesehen. Wie groß ist es? Sehr groß. So vier, fünf Meter. Und was bedeutet das für uns?! Gar nichts, sagt Collin. Erstens ist es ein Seekrokodil, die sind weniger aggressiv als die Krokodile in den Flüssen, und zweitens jagen sie nur bei Dunkelheit. Darum ist in der Lodge das Schwimmen nach Anbruch der Dämmerung zwar nicht untersagt, aber es wird doch dringend davon abgeraten. Warum tötet ihr es nicht? Weil in der Nachbarbucht ein Haufen kleinerer Krokodile lebt, die rüberkommen würden, wenn das große weg ist. Außerdem ist noch nie etwas passiert. Nur einmal hat sich ein Gast beim Schnorcheln mit dem Maul des Krokodils konfrontiert gesehen, etwa zwanzig Zentimeter von seiner Taucherbrille entfernt, aber der Gast war vor Sonnenaufgang im See. Und trotzdem ist nichts geschehen. Das Krokodil hat abgedreht.
«Nein, Lisa», sagt Collin, «es kann wirklich nichts passieren. Ganz sicher. Hundertprozentig. Ich schwör’s. Es ist absolut ausgeschlossen, dass du tagsüber beim Schwimmen gefressen wirst, völlig unmöglich, aber wenn es doch passieren sollte…» – und jetzt legt Collin seine Hand auf ihre Schulter und schaut sie treuherzig an–, «…dann, sorry, Lisa!»
4.DAS KROKODIL, MEINE FREUNDIN UND ICH
Evolution ist faszinierend, ich würde sie gern verstehen. Dann wäre ich auch dem Verständnis von Gott ein bisschen näher. Irgendwas ist immer da, und das verändert sich dann so langsam, dass es keiner der Betroffenen so richtig mitkriegt. Nehmen wir mal an, ein Vogel wird zu einem Krokodil, oder, um es nicht so reißerisch zu formulieren, es war einmal ein Flugsaurier, der die Lust am Fliegen verlor, warum, weiß ich nicht, denn Fliegen ist doch eigentlich ganz schön. Vielleicht, weil er nicht der größte Räuber am Himmel war und die Kollegen ihm die besten Brocken wegschnappten, vielleicht auch, weil er festen Boden unter den Krallen für sein inneres Gleichgewicht brauchte. Er war also nun des Öfteren auf dem Land und zu Fuß unterwegs, deshalb bildeten sich die Flügel zurück, und die Beine wurden lang und dick. Kein Fett wohlgemerkt, pures Muskelwerk. Damit lief er extrem schnell. Er war einen Meter lang, und sein Gebiss riss alles in Stücke, was es zu schnappen bekam. Er war kein Vegetarier. Sein Name damals: Protosuchus. Aber auch auf dem Land gab es zu viel Fresskonkurrenz, ganz zu schweigen von den Fressfeinden, darum ging er nach weiteren vierzig Millionen Jahren ins Wasser, wo er noch heute am besten ist. Die Beine wurden kürzer, aber nicht schwächer, der Schwanz entwickelte sich zu einem antriebsstarken Ruder, und er zog sich insgesamt ein bisschen in die Länge. Die Augen wanderten nach oben, damit er aus dem Wasser lugen kann, und die Nase rutschte nach vorn, so kriegt er Luft, während der Rest seines Körpers mehr oder weniger unsichtbar stundenlang und gern auch länger unter der Oberfläche lauert. Er attackiert im Wasser extrem schnell, auch auf dem Land macht er zwanzig Stundenkilometer aus dem Stand, aber am besten ist er im Grenzbereich der Elemente, weil er dort wie eine Rakete funktioniert, die von einem einzigen starken Schwanzschlag gepeitscht aus dem Wasser schießt, und das macht das Krokodil natürlich zur idealen Uferbestie. Dafür hat die Evolution noch mal hundertneunzig Millionen Jahre gebraucht.
Und es ist noch immer kein Vegetarier.
Das Krokodil schnappt sich alles, was nicht größer ist als es selbst. Die Marke liegt derzeit bei fünf Metern. Aber das ist ausbaubar. Es wächst bis an sein Lebensende und wird, so Gott und Collin wollen, hundert Jahre alt. Und noch etwas, seine Zähne wachsen so oft nach, wie es sein muss, und alle zwei Jahre sieht sein Gebiss wie neu aus. Niemand sollte also darauf bauen, ein zahnloses Krokodil vor sich zu haben. Es schnappt sich Zebras, Antilopen, Stachelschweine und Hyänen, sogar Löwen und junge Flusspferde, und natürlich schnappt es sich auch Fische und Fischer, es katapultiert sich auf ihre Boote und reißt sie runter, oder es kriegt sie am Ufer, wenn sie ihre Netze zusammenlegen, oder es holt sie aus ihren ufernahen Grashütten heraus. In Uganda, dem Königreich der Krokodile, fressen sie zwanzig Menschen pro Woche, der Champ des Landes, bekannt geworden als das «Killerkrokodil», hat allein dreiundachtzig Menschen verspeist, und sehen wir uns den Malawisee an, dann gibt es auf der anderen Seite ein Gebiet, Lower Shire genannt, da haben es die Krokodile auf einer Fläche von zwanzig mal zehn Kilometer immerhin auf neunzig Fischer pro Jahr gebracht. Sie sind natürlich auch selbst schuld. Stichwort: Überfischung. Warum fischen sie alles weg, bis nichts mehr außer ihnen da ist, was ein Krokodil fressen kann? Auf Madagaskar, wo Krokodile so heilig waren wie Kühe in Indien, glaubte man, dass Krokodile nur Menschen fressen, die vorher ein Krokodil getötet haben. Stand jemand unter Krokodil-Mordverdacht, musste er einen krokodilverseuchten Fluss durchschwimmen, und wurde er dabei zerfleischt, war das der Beweis, das Todesurteil und die Exekution des Armen zugleich.