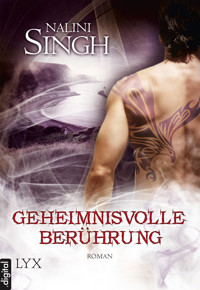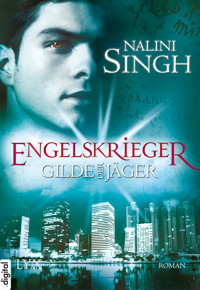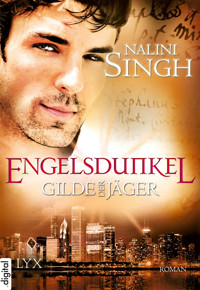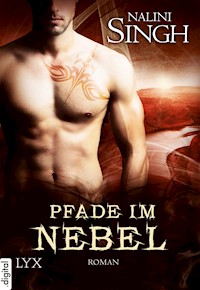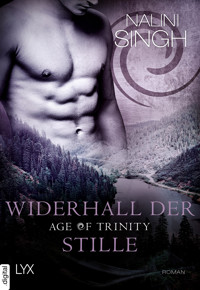
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Psy Changeling
- Sprache: Deutsch
Wird seine Vision wahr werden?
Als ranghohes Mitglied der StoneWater-Bären erhält Yakov Stepyrev den Auftrag, der Medialen Theodora Marshall bei der Ergründung eines Familiengeheimnisses zu helfen. Er traut seinen Augen kaum, als er Theo sieht, denn sie ist die Frau aus seinen Träumen - und seine Seelengefährtin. Doch eine neue Vision verfolgt den Bären jede Nacht, und er kann ihr nicht entkommen. Sie zeigt ihm immer wieder ein und dasselbe Bild: Theos Tod ... Kann Yakov das Schicksal ändern und die Frau retten, die langsam, aber unaufhörlich sein Herz erobert?
»Mit einem AGE-OF-TRINITY-Buch von Nalini Singh kann man wirklich nichts falsch machen!« FRESH FICTION
Der 7. Band der AGE-OF-TRINITY-Serie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Nalini Singh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 643
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Trümmer
1
MOSKWA GAZETA
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1976
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
1988
69
Wandel
Danksagung
Die Autorin
Nalini Singh bei LYX
Impressum
NALINI SINGH
Age of Trinity
WIDERHALL DER STILLE
Roman
Ins Deutsche übertragen von Patricia Woitynek
Zu diesem Buch
Seit er sechzehn Jahre alt war, träumt der StoneWater-Bär Yakov Stepyrev von einer Frau mit blonden Haaren und blauen Augen. Er ist sich sicher, dass sie seine Seelenverwandte ist, und kann es nicht erwarten, ihr endlich auch im wahren Leben zu begegnen. Doch in letzter Zeit haben sich seine Visionen über die Unbekannte verändert, und in ihnen muss er hilflos mit ansehen, wie seine große Liebe angegriffen wird und verblutet. Als er von Silver Mercant, der Gefährtin seines Alphas, den Auftrag erhält, Theodora Marshall, einer Medialen aus einer der mächtigsten Familien, zu helfen, ein altes Geheimnis aufzudecken, ist der Moment, auf den er so lange gewartet hat, endlich gekommen: Theo ist die Frau aus seinen Träumen. Sofort verspürt Yakov den unbändigen Drang, sie – koste es, was es wolle – zu schützen und nie wieder allein zu lassen. Und auch Theo fühlt sich unwiderstehlich zu dem attraktiven Bären hingezogen. Doch um ihre Aufgabe zu erfüllen, muss sie sich ihrem schlimmsten Albtraum stellen, obwohl sie genau weiß, dass sie das nicht überleben wird …
Dieses Buch ist für Geri
Trümmer
Seit dem Fall von Silentium ist es den Medialen nicht länger unter Strafe verboten, Gefühle zu empfinden.
Zum ersten Mal seit über hundert Jahren sind sie frei.
So frei, dass sie womöglich jene vergessen haben, denen diese eine Freiheit verwehrt ist, die sie weder kennen noch verstehen, weil sie durch das Programm irreparablen Schaden genommen haben.
Wo sind die Angehörigen ihrer Gattung abgeblieben, die dazu verurteilt wurden, sich einer »Rehabilitation« zu unterziehen – einer brutalen Gehirnwäsche, die sie in stumpfsinnige Zombies verwandelte?
Sie sind der lebende Beweis für die Grausamkeit von Silentium.
Wer hat ein Auge auf all die, die vollständig gebrochen wurden?
1
Theodora, dein Betreuer hat mir mitgeteilt, dass du dich weigerst, Anweisungen zu befolgen. Ist dir denn nicht klar, dass du dieser Familie nur von Nutzen sein kannst, wenn du tust, was man von dir verlangt?
SolltestdudichweiterhinwidersetzenunddeingenetischesPotenzialnichtausschöpfen,wirstdufürunszueinerreinenfinanziellenBelastung.DaswürdeKonsequenzennachsichziehen.Undseinichtsoeinfältigzuglauben,dassdualsZwillingsschwestereinesSkala-neun-TelepathenbesonderenSchutzgenießt.
Ihr seid mittlerweile siebzehn Jahre alt und somit weit über den Punkt hinaus, wo der Verlust des anderen Geschwisterteils euch in irgendeiner Weise tangieren sollte. Pax hat dich längst vergessen und befindet sich auf Erfolgskurs, seit das Band zu dir gekappt ist. Du bist auf dich allein gestellt.
Private Nachricht von Marshall Hyde an Theodora Marshall (12. Dezember 2072)
Blut, da war so viel Blut. Es sprudelte durch ihre Hände, die sie verzweifelt auf ihre Kehle presste, und färbte ihre totenbleichen Finger scharlachrot. Entsetzen stand in ihren Augen, als sie seinen Blick trafen. Und da wusste er Bescheid.
Sie würde sterben.
Yakov Stepyrev wurde schlagartig wach, sein Herz hämmerte gegen die Rippen, ein warmer Schweißfilm bedeckte seine mittelbraune Haut. Er sah sich hektisch nach der Frau um, aber natürlich war außer ihm niemand im Zimmer.
Trotzdem raste sein Puls noch immer, als er das Gesicht im Kopfkissen vergrub und murmelte: »Govno, Yakov. Du hast sie nicht alle.«
Schwerfällig wälzte er sich auf den Rücken, aber er fand keine Ruhe mehr. Er war ein Bär – normalerweise würde er die Schlummertaste seines altmodischen Weckers drücken und noch ein Weilchen in seinem Bett liegen bleiben. Aber normalerweise wurde er ja auch nicht durch einen brutalen, Adrenalin freisetzenden Traum aus dem Schlaf geschreckt, der von einer Frau handelte, die es gar nicht gab, die nie existiert hatte.
Er spannte die Finger an, und erst da merkte er, dass seine massiven, glänzenden, tödlichen Krallen ausgefahren waren. Sein Fell stellte sich unter der Haut auf, das Tier, das in ihm lebte, war ebenso beunruhigt und aufgewühlt wie die andere, die menschliche Seite von Yakov.
Mit zusammengebissenen Zähnen schlug er die Decke beiseite und zwang sich, die Krallen wieder einzufahren. Er beschloss, Liegestütze zu machen, um seiner kampfbereiten Energie ein Ventil zu geben. Doch zuvor zog er ein Paar Boxershorts an – nicht, weil er prüde gewesen wäre, sondern um zu verhindern, dass sein bestes Stück bei jeder Bewegung über den dicken Teppich rieb.
Doch nicht einmal die anstrengende körperliche Betätigung vermochte seine Gedanken in eine andere Richtung und weg von der Frau zu lenken, die ihm bereits seit seinem sechzehnten Lebensjahr in seinen Träumen erschien.
Wenn auch nie zuvor auf diese Weise.
Blutüberströmt und von Todesangst gezeichnet. Bei der Erinnerung daran überlief ihn immer noch ein kalter Schauer.
Anfangs hatte er die Träume toll gefunden und den anderen Jugendlichen gegenüber damit geprahlt, dass er bereits ganz genau wisse, wie seine zukünftige Gefährtin aussähe, und er ihnen in Bezug auf den Paarungstanz einen Schritt voraus sei. Kein Wunder, da doch sein Großvater ein Hellsichtiger gewesen war.
Nach den merkwürdigen Erfahrungen, die sein Zwillingsbruder und er im Lauf der Jahre gemacht hatten – sprich, Ereignisse vorausgeahnt, bevor sie dann tatsächlich eintraten –, war Yakov sich sicher gewesen, dass seine Träume ihn einen flüchtigen Blick in die Zukunft tun ließen, sie deshalb so überwältigend real schienen, weil sie mit der ihm vorherbestimmten Partnerin zusammenhingen.
Seiner Gefährtin. Der Liebe seines Lebens.
Aber er war kein Teenager mehr, und langsam fing er an, an seinem Verstand zu zweifeln. Die Träume hatten jahrelang ausgesetzt, bis sie vergangene Woche mit Macht zurückgekehrt waren und ihn seither Nacht für Nacht heimsuchten. Die Handlung war immer dieselbe: Er lief als Bär durch den morgendlichen Frühnebel, bis er nach einer Weile feststellte, dass er nicht allein war, sondern in Begleitung einer Frau mit goldblondem Haar und blauen, gehetzt wirkenden Augen.
Irgendwann kniete sie sich neben ihn hin, griff mit der Hand in sein Fell und barg weinend das Gesicht an seinem Hals. Ihre Tränen waren so heiß, dass sie ihn schier versengten und er sich am liebsten gewandelt und sie tröstend in die Arme genommen hätte. Aber er konnte sie in ihrem Schmerz nicht stören, darum ließ er sich stattdessen behutsam auf den Boden sinken und wartete, bis ihre Tränen versiegten und sie ihm in die Augen sehen konnte.
»Es tut mir leid«, flüsterte sie immer wieder mit heiserer Stimme. »Verstehst du nicht, dass es zu spät ist?«
Und dann, ohne Vorwarnung, das Blut, das Entsetzen … das Ringen mit dem Tod.
Seine Muskeln zitterten, als sein Körper mitten in der Liegestütze verharrte und ihn erneut die Erinnerung an seinen Zorn überfiel, während das laute Echo des Gebrülls seines Bären, der nicht bereit war, sich mit diesem Ausgang abzufinden, in seinem Kopf widerhallte.
Yakov wusste mit Bestimmtheit, dass die Träume zu Beginn anders gewesen waren. Die rätselhafte Frau war damals ebenfalls noch im Teenageralter gewesen und er selbst in menschlicher Gestalt; nur die nebelverhangene Lichtung, auf der sie sich begegneten, war immer noch dieselbe. Das Mädchen hatte ihn freudig überrascht angelächelt, dann waren sie zwischen den Blumen umhergerannt wie zwei Bärenjunge, die Fangen spielten.
Alles war damals eitel Sonnenschein gewesen.
Kein mörderisches Grauen, bei dem er hilflos mitansehen musste, wie seine Gefährtin starb.
Da die Liegestütze nichts dazu beitrugen, ihn auf andere Gedanken zu bringen, hörte er damit auf und setzte sich auf den flauschigen Teppich, den er sich trotz der Frotzeleien der anderen Clanmitglieder, die ihn verweichlicht nannten, zugelegt hatte. Ha! Auf einmal waren diese großen, pelzigen mudaks allesamt neidisch gewesen und hatten ihn einer nach dem anderen beiseite genommen, um zu erfahren, wo sie wohl so ein Exemplar herbekämen.
»Warum verfolgst du mich?«, fuhr er das zur Frau gereifte Mädchen an, das er in der Realität nie gesehen, nie getroffen hatte. Allmählich fragte er sich, ob womöglich sein Urgroßvater es gekannt hatte. Déwei Nguyen war ein mächtiger V-Medialer gewesen, der tatsächlich in die Zukunft sehen konnte. Er hatte seine Gabe nur in verschwindend geringem Maß an Yakov und Pavel weitervererbt. Sie manifestierte sich bei ihnen eher in Form einer ausgeprägten Intuition als in einer Fähigkeit, die sie kontrollieren konnten.
Yakov nahm sie als eine Art Juckreiz wahr, der ihn immer dann überkam, wenn sofortiges Handeln geboten war. Er hatte schon früh gelernt, diese Empfindung nicht zu ignorieren, weil sie ihn nie fehlleitete. Diese Flüsterstimme der Voraussicht hatte ihm und seinem Zwillingsbruder viele Male die Haut gerettet – sei es, indem sie sie warnte, dass ihre Eltern nahten und sie lieber sämtliche Beweise für irgendwelche unerlaubten Aktivitäten verstecken sollten, oder sie noch rechtzeitig anhalten ließ, bevor sie sich auf eine witterungsbedingt destabilisierte Klippe hinauswagten.
Doch im Gegensatz zu Yakov träumte Pavel nicht von einer Frau mit gequältem Blick.
»Das liegt daran, dass ich auf Jungs stehe«, hatte er als älterer Jugendlicher gewitzelt und mit seinen dunklen Brauen gewackelt, die identisch mit denen seines Bruders waren. Seine unverwechselbaren aquamarinblauen Augen hatten geblitzt hinter seiner Brille, dem einzigen Detail, durch das sie sich optisch voneinander unterschieden. »Vielleicht ist deine Gefährtin in spe ja eine Mediale, die dich mithilfe von Telepathie in ihre Fänge lockt.«
Yakov hatte nur mit den Augen gerollt, weil die mediale Gattung damals noch vehement Abstand sowohl zu den Gestaltwandlern als auch zu den Menschen hielt. »Es ist wahrscheinlich nur eine Erinnerung, die sich von Denus Geist auf meinen übertragen hat.« Der Ausdruck, den sie für ihren Urgroßvater benutzten, leitete sich von keiner der in ihrer Familie gesprochenen Sprachen ab.
Weder von Pavels und Yakovs Russisch noch vom Vietnamesisch und Mandarin – den Muttersprachen ihres Urgroßvaters, die ihre heißgeliebte Babuschka Quyen ihnen häppchenweise beigebracht hatte – oder dem Englisch ihrer durchtrieben lustigen Babuschka Graciele, und auch nicht von Wacians Portugiesisch, ihrem Großvater väterlicherseits.
Ihrer Mutter zufolge hatten sie als Kleinkinder mitbekommen, wie die Erwachsenen über Déwei Nguyen redeten, und versucht, seinen Namen zu wiederholen, was dann aus ihren Mündern wie »Denu« klang. Und dabei blieb es. Quyen – eins von Déweis beiden Kindern mit einer Bärin – hatte jedem untersagt, Yakov und Pavel zu korrigieren, infolgedessen war ihr Urgroßvater bis zum heutigen Tag ihr Denu für sie.
Sie waren erst nach seinem Tod zur Welt gekommen, aber ihre Großmutter hatte ihnen lebhafte Geschichten über ihn erzählt. »Er sah so gut aus, und er hatte dieses unwiderstehliche Lachen«, schwärmte sie. »In seinen Augenwinkeln erschienen diese winzigen Fältchen, und dann brach es einfach aus ihm heraus.« Die glückliche Erinnerung zauberte ein Lächeln auf ihre Lippen.
Als sie dann älter waren, erfuhren sie auch von den Schattenseiten seines Lebens. »Er war ein ehrenwerter Mann mit dem Herzen am rechten Fleck, aber er trug eine große Traurigkeit in sich.« Quyen zufolge war Déwei bei der Einführung von Silentium bereits verheiratet gewesen und sein Zuhause die StoneWater-Höhle.
»Er hat meine Mutter bis zu seinem letzten Atemzug angebetet und wäre niemals auf den Gedanken gekommen, sie zu verlassen.« Ihr Lächeln wurde ein bisschen wehmütig. »Trotzdem hatte er furchtbare Sehnsucht nach seinen Eltern und Geschwistern. Ich wurde erst geboren, nachdem die Medialen sich der Doktrin ergeben hatten, darum habe ich sie nie kennengelernt. Als Erwachsene habe ich ihn nach seiner Familie gefragt, und er antwortete, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihm wolle, aus Angst, nicht die vorgeschriebene emotionale Distanz wahren zu können.«
Sie hatte den Zwillingen ein Foto ihrer Eltern aus der Zeit von deren Lebensabend gezeigt. Darauf hatte ihnen unter einem dichten Schopf schlohweißer Haare Déwei Nguyens von Lachfalten durchzogenes Gesicht entgegengeblickt, der seine strahlende Frau im Arm hielt, in deren silberner Lockenpracht hier und da noch eine Spur des kräftigen Rottons ihrer Jugend durchschimmerte.
»Ihr zwei liebt so leidenschaftlich, wie er es tat.« Die Augen ihrer Großmutter schimmerten feucht, sie musste schlucken. »Haltet euch und den euren immer fest die Treue, und lasst euch nicht in politische Machtkämpfe hineinziehen. Mein Vater lehrte mich, dass es kein größeres Geschenk gibt als die Liebe.«
»Ich könnte heute deine Hilfe brauchen, Denu«, sagte Yakov im Hier und Jetzt. »Wer ist diese Frau? Hattest du dich als junger Mann in sie verguckt? Gut, dass deine Mimi nie davon erfahren hat.« Laut seiner Großmutter war das Déweis Kosename für seine Gefährtin Marian Marchenko gewesen.
»Meine Mutter hatte ein hitziges Temperament«, hatte Babuschka Quyen lachend erklärt, als die Zwillinge sich nach ihr erkundigten. »Angeblich hat sie Denu, als er um sie warb, einmal mit einer Bratpfanne verfolgt, weil sie fälschlicherweise dachte, er mache einer anderen Bärin schöne Augen. Es spricht für den Charme meines Vaters, dass er sie nicht nur dazu brachte, die Pfanne sinken zu lassen, sondern sie sogar beschwatzte, ihm Pfannkuchen darin zu backen!«
Es war eine von Yakovs Lieblingsgeschichten im Zusammenhang mit der dauerhaften Liebesbeziehung seiner Urgroßeltern. Noch immer lächelnd bei der Erinnerung daran, stand er vom Boden auf. Als er sah, dass die handgefertigte Decke auf seinem Bett schief herabhing, zog er sie wieder zurecht. Es war ein ausgesprochen hässliches, wild gemustertes Stück voller fallen gelassener Maschen. Aber seine Mutter strickte laut eigener Aussage »zur Entspannung, verdammt noch mal«, und Yakov musste immer lachen, wenn ihm beim Aufwachen als Erstes ihr bemühtes Kunstwerk ins Auge stach.
Mila Hien Kuznets war die am wenigsten entspannte Person, die er kannte, und er mochte sie genauso wie sie war.
Aber heute konnte nicht einmal der Anblick der misslungenen Strickarbeit die Spannung lindern, die ihm die Brust zusammendrückte. Yakov ballte die Fäuste, war außerstande, das viele Blut zu vergessen. Hierbei ging es nicht um eine jugendliche Vernarrtheit seines Urgroßvaters, auch wenn er das gern geglaubt hätte. Dafür waren die Träume zu düster und unheilschwanger.
Mit grimmig vorgeschobenem Kinn marschierte er ins Bad, zog sich aus und stieg unter die Brause. Der dem Gestein abgetrotzte Raum war mit üppigen Farnen bewachsen, die dank des ausgeklügelten Tageslichtsystems, das die Höhle – außer dort, wo es nicht erwünscht war – mit natürlichem Licht versorgte, prächtig gediehen.
Yakov liebte es, im weichen Dämmer der kühlen Morgenstunden zu duschen, der originalgetreu die Atmosphäre in der Außenwelt wiedergab. Wer war die Frau? Zweifelsohne würde diese Frage —
Ein gellender Schrei drang an sein Ohr, so markerschütternd und schmerzerfüllt, dass Yakov eine Sekunde brauchte, ehe er begriff, dass er seinem eigenen Kopf entsprang. Er presste die Hände gegen die Wand, rang verzweifelt um Atem, doch es war zu spät. Der Wachtraum nahm unerbittlich Fahrt auf, und plötzlich fand Yakov sich vor einem verwitterten, von dichtem grünem Efeu umrankten schmiedeeisernen Tor wieder. Ein überwältigendes Gefühl von Dringlichkeit bemächtigte sich seiner.
Er drehte sich zu der Frau um, doch da beugte sie sich schon vornüber und drückte den Arm auf ihren Bauch, als sei sie verwundet. Sein Bär drohte, die Kontrolle zu übernehmen, damit Yakov zu ihr lief und ihr half.
Aber das war unmöglich.
Yakov kämpfte mit aller Kraft gegen die unsichtbaren Fesseln, die ihn an Ort und Stelle hielten. Doch so sehr er sich auch anstrengte, er konnte keinen Muskel rühren … weil er nicht das Recht hatte, sie anzufassen.
»Scheiße!« Er riss sich von dem Albtraum – oder welche Art Horrortrip das auch gewesen war – los und stellte fest, dass er immer noch unter dem Wasserstrahl der Dusche stand.
Krallenspuren zeichneten die Felswand.
MOSKWA GAZETA
30. August 2083
Eilmeldung
Zweite Tote entspricht Opferprofil
Nachdem gestern im Bezirk Izmaylovo eine weitere Frauenleiche aufgefunden wurde, gibt es seitens der Ermittlungsbehörden bisher keine Bestätigung, dass wir es mit einem Serienkiller zu tun haben könnten, der auch für den Mord an der neunundzwanzigjährigen Varisha Morozov verantwortlich ist.
Der Name des zweiten Opfers wurde noch nicht veröffentlicht, allerdings soll es sich laut Polizei ebenfalls um eine blonde, blauäugige Mediale in den Zwanzigern handeln.
Auf die Frage, ob junge Frauen dieser Gattung – vor allem solche mit den oben genannten äußeren Merkmalen – besonders wachsam sein sollten, bemerkte Polizeipräsident Yaroslav Skryabin, dass kein Grund zur Panik bestehe. »Wir sind erst am Anfang unserer Untersuchungen. Sich zum jetzigen Zeitpunkt in wilden Spekulationen zu ergehen, wäre sowohl überstürzt als auch unangebracht.«
Darüber hinaus teilte er mit, dass es bislang keine Beweise für eine Zugehörigkeit des Täters zum Volk der Medialen gäbe. »Die Tötungsmethode könnte ebenso gut auf einen Menschen oder einen Gestaltwandler hinweisen«, war sein einziger weiterer Kommentar zu diesem Thema.
Wie genau der Mörder vorging, wurde bis dato nicht bekannt gegeben. Die Gazeta verfügt über Quellen, die den Ermittlern nahestehen, unser interner Ethikrat hat jedoch der Bitte der Behörden entsprochen, keine näheren Informationen zu veröffentlichen, um jede Beeinflussung eines späteren Prozesses zu vermeiden.
Dieser Bericht wird aktualisiert, sobald uns weitere Informationen vorliegen.
2
In diesem Fall findet die geheime Zusatzklausel zu Coda 27 des Silentium-Programms Anwendung. Pax und Theodora können – und müssen – getrennt werden, sobald sie sieben sind. Ich würde sogar zu einem noch früheren Zeitpunkt raten, doch die Gefahr eines geistigen Zusammenbruchs ist zu hoch. Es wäre extrem unverantwortlich, ein solches Risiko bei einem Medialen der Skala neun einzugehen.
Psychologischer Bericht von Dr. Kye Li an den Ratsherrn Marshall Hyde (1. Januar 2061)
Theodora Marshall schloss die Knopfleiste ihrer frisch gestärkten weißen Bluse über der hellen, makellosen Haut, die nichts von den Narben auf ihrem Rücken und in ihrem Bewusstsein erahnen ließ.
Mit den physischen Spuren dessen, was man ihr angetan hatte, konnte sie leben, doch die mentalen Schäden ließen sich nur durch strikte, selbstauferlegte Einsamkeit ertragen.
Bloß war das keine Option.
Pax brauchte sie. Ausgerechnet ihrem Zwillingsbruder, dem Vorzeigekind, das dazu auserkoren war, zu überleben und Ruhm zu ernten, hatte ihrer beider genetisches Erbe einen üblen Streich gespielt. Man nannte es das Skarabäus-Syndrom. Es war der Gipfel der Ironie, dass ihre Gattung von einer solchen Seuche heimgesucht wurde. Einem Virus, das mit immensen Fähigkeiten ausgestattete Mediale befiel und sie buchstäblich von innen heraus zerfraß. Vor der Einführung von Silentium waren sie schon als Kinder dem Tode geweiht gewesen, eine Implosion ihrer Gehirne war unvermeidbar.
Durch das Programm waren diese chaotischen Kräfte in Ketten gelegt worden. Silentium mochte Millionen gebrochen und getötet haben, doch für Individuen wie Pax hatte es sich als nützlich erwiesen, weil es verhinderte, dass die Feuersbrunst ihrer gewaltigen Gabe sie verzehrte. Dann war Silentium abgeschafft worden … und jetzt gab es keine Möglichkeit mehr, den Geist zurück in die Flasche zu bekommen und Skarabäus-Infizierte zu rekonditionieren.
Dr. Maia Ndiaye, die führende Medizinerin auf diesem Gebiet, hatte es folgendermaßen ausgedrückt: »Hat ein für das Virus empfänglicher Medialer erst einmal das Skarabäus-Stadium erreicht, ist der Prozess unumkehrbar. Aufgrund der neuronalen Veränderungen in seinem Gehirn ist der Patient nicht mehr imstande, sich auch nur ansatzweise in Silentium zu begeben.«
Kurz gesagt hatten sich die unermesslichen Kräfte ihres Bruders in ein gefräßiges Monster verwandelt, das in den hintersten Winkeln seines Geistes lauerte.
Theo drehte sich der Magen um bei der Vorstellung, dass Pax aus ihrem Bewusstsein verschwinden könnte. Denn eines hatte ihre Familie nie verstanden: Ihr Großvater mochte sie und ihren Bruder in der realen Welt getrennt haben, trotzdem war es nicht einmal Ratsmitglied Marshall Hyde gelungen, eine Beziehung zwischen ihnen auf der mentalen Ebene komplett zu unterbinden.
Pax hatte ihr viele Male das Leben gerettet.
Und Theo würde alles tun, um sich dafür zu revanchieren. Mit diesem Vorsatz nahm sie das Armband in die Hand, das sie angefertigt hatte, indem sie auf das in ihrem früheren Beruf als Technikerin für medizinisches Gerät erworbene Wissen sowie auf ihr Geschick darin, mithilfe ihrer geringfügigen telekinetischen Kräfte kleinste Bauteile zu transferieren, zurückgegriffen hatte.
Das Armband bestand aus zwei durch Scharniere verbundenen Hälften aus matt schimmerndem Metall, das sie – bis auf das kunstvolle, handgravierte Muster in der Mitte – auf Hochglanz poliert hatte. Es war optisch absichtlich einem beliebten, preisgünstigen Kommunikationsgerät nachempfunden und entsprechend mit einem winzigen Monitor ausgestattet.
Theo schloss es um ihr Handgelenk und überprüfte den Akku.
Einhundert Prozent.
Gut. Das Instrument war dazu gedacht, ihr einen sehr schmerzhaften elektrischen Schlag zu versetzen.
Zufrieden zog Theo sich für ihr Treffen mit Pax fertig an. Ihr Bruder hatte sie um einen Gefallen gebeten, darum konnte sie sich nicht weiter in den stillen Schatten verkriechen, so gern sie es auch getan hätte.
Es galt, eine Schuld zu begleichen.
Eine Blutschuld.
Trotzdem musste sie ihre ganze Willenskraft aufbieten, um durch das imposante Eisentor des Marshall-Anwesens am Stadtrand von Toronto zu fahren. Der Rasen, der die Zufahrt säumte, war präzise auf eine Länge geschnitten, der Asphalt selbst von allem befreit, das so gewöhnlich war wie Schmutz oder Moos.
Der zweihundert Jahre alte marmorne Springbrunnen vor dem Haus war zwar nicht in Betrieb, aber ebenfalls in tadellosem Zustand. Dasselbe galt für die Buchsbaumhecken, die die breite Eingangstreppe flankierten. Fast konnte man meinen, dass der Gärtner ständig ein Lineal mit sich herumtrug.
Blumen gab es nirgendwo.
Sie parkte ihr kleines Auto in dem Rondell am Ende der Einfahrt und würdigte das imposante, traditionelle Backsteingebäude keines Blickes, als sie seitlich daran vorbei und in den dahinterliegenden Garten ging. Wenn es hier einen Ort gab, wo sie je echte Freiheit erfahren hatte, dann war es das verwilderte Areal jenseits der Grünflächen.
Einen Moment stand sie einfach nur schweigend da und glaubte beinahe Pax’ Lachen zu hören, das sich mit ihrem eigenen mischte, während sie miteinander zwischen den Bäumen umhersprangen.
»Hallo, Theo.«
Alles andere als verwundert, dass ihr Bruder sie so schnell gefunden hatte, strich sie mit den Fingern über die Blätter einer dekorativen Pflanze am Rande des Gehwegs, der neuerdings den Rasen in zwei Hälften teilte. »Es hat sich einiges verändert.« Sie hatte den Familiensitz schon sehr lange nicht mehr betreten.
»Ja, sieht ganz so aus.« Pax ließ seine blauen Augen, die ebenso kalt waren wie die seiner Schwester – beiden war Herzenswärme fremd –, über das gepflegte Grün wandern. »Ich versuche, mich so selten wie möglich hier aufzuhalten.«
Theo musste nicht erst fragen, warum; sie kannte den Grund auch so. Das ehrwürdige alte, von Antiquitäten und endlosen Zimmerfluchten strotzende Gebäude hinter ihnen war kein Zuhause. Ihm wohnte zu viel Bosheit, zu viel Verrat inne. »Wieso hast du mich hergebeten?«
»Weil dir das Anwesen zu fünfzig Prozent gehört.«
Theo schnaubte verächtlich, in Pax’ Gegenwart gaukelte sie nicht vor, in Silentium zu sein. Er hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie »gut« sie im Einhalten eines Programms war, das mehr als einhundert Jahre alle Gefühle aus ihrer Gattung getilgt hatte. »Pax, ich weiß sehr wohl, dass Großvater alles dir hinterlassen hat.« Nachdem Theos Rang auf der Skala bestätigt worden war, hatte Marshall Hyde sich nie öffentlich zu seiner Enkeltochter bekannt, sondern so getan, als existierte sie gar nicht.
Im stillen Kämmerlein hatte die Sache jedoch anders ausgesehen.
Dort hatte er durchaus eine Verwendung für Theo gehabt.
»Und ich hoffe bei Gott, dass du mir nichts von seinem Erbe aufbürden willst«, fügte sie hinzu, ehe er etwas entgegnen konnte. »Du weißt, dass jedes einzelne verkommene Mitglied unserer ›geliebten‹ Familie mit gewetzten Messern Jagd auf mich machen würde.« Keiner von ihnen ahnte, wozu Theo fähig war. Für sie gab es keinen Grund zu der Annahme, dass von ihr eine noch tödlichere Gefahr ausging als von ihrem Zwillingsbruder – doch das hieß nicht, dass sie Lust hatte, den Rest ihres Lebens über ihre Schulter zu schauen.
Sie wurde schon von zu vielen Gespenstern verfolgt.
»Das würde ich dir niemals antun.« Pax schob die Hände in die Taschen seiner schwarzen Cargohose. Seine ebenfalls schwarzen Stiefel waren verschrammt, und sein dunkelgrüner Wollpullover zeichnete die muskulösen Konturen seines Körpers nach, an dem nicht ein Gramm Fett war.
Letzteres war ein Resultat seiner eisernen Disziplin. Man hatte Pax nie auch nur die kleinste Schwäche nachgesehen, geschweige denn ihm den Freiraum gegeben, dem brutalen Zwinger zu entwachsen, in den sein Großvater ihn gesperrt hatte.
Er hätte nicht einmal gewusst, wie er es anstellen sollte, etwas anderes als absolut perfekt zu sein.
Dementsprechend bekam man ihn nur selten so leger angezogen wie heute zu sehen. Pax war bekannt dafür, dass er eine Vorliebe für Maßanzüge hatte und großen Wert auf ein »formvollendetes Erscheinungsbild« legte. Jedenfalls hatte das neulich in einer Zeitschrift gestanden.
Theo hatte den Artikel gelesen, weil ihr Bruder die einzige Person auf der Welt war, die ihr am Herzen lag, und es jetzt zur Abwechslung mal an ihr war, ihn zu beschützen – auch wenn er das niemals von ihr erwarten würde. Und sei es vor vermeintlich harmlosen Journalisten, die ein bisschen zu viel Augenmerk auf einen Medialen richteten, dessen einziger Fokus der Geschäftswelt galt. Man konnte schließlich nie wissen, ob diese Leute von seinem Charisma angezogen wurden oder es sich um Stalker handelte.
»Stattdessen habe ich ein geheimes Konto für dich eingerichtet«, erklärte er gerade. »Du findest die Zugangsdaten in unserem Tresor im Medialnet.«
Niemand außer Theo und Pax konnte darauf zugreifen. Der aus massiven Blöcken mentaler Energie errichtete sichere Raum war in das weit gespannte Netzwerk eingebettet, das mit Ausnahme der wenigen Abtrünnigen alle Medialen auf dem Planeten miteinander verband. Der Tresor war an die geistige Schwingung gekoppelt, die Pax’ Gehirn seit dem Mutterleib mit dem seiner Schwester verband.
Dieses unsichtbare Band war nie ganz abgerissen und das Einzige, was Theo all die Jahre gerettet hatte, in denen ihr Großvater es am liebsten gehabt hätte, sich dieses »defekten« Mitglieds der hochangesehenen Familie Marshall zu entledigen. Zu dumm, dass er Pax dann dadurch einen tödlichen Schaden zugefügt hätte.
So etwas kam bei Zwillingspaaren vor.
»Du hast mir schon mehr Geld gegeben, als ich in mehreren Leben ausgeben könnte. Abgesehen davon beziehe ich ein festes Gehalt.« Theo brauchte nicht viel, und nach dem, was sie getan hatte, stand ihr im Grunde auch nichts zu. »Ich bin reichlich versorgt. Besonders da ich jetzt als deine rechte Hand fungiere und du mich entsprechend bezahlst.«
Theo wäre lieber in der Versenkung geblieben, geschützt durch die Machenschaften ihres Großvaters und ihre scheinbare Entfremdung von Pax. Es war einfacher gewesen, ihm zu helfen, als sie noch eine unbedeutende Technikerin war, die niemand auf dem Schirm hatte, aber ihr Bruder brauchte jemanden an seiner Seite, dem er blind vertrauen konnte. Und so war sie jetzt hier, ein Ungeheuer, das sich auf offener Straße zeigte.
Armer Pax. Er war an eine Schwester gefesselt, deren einzige Fähigkeit darin bestand, den Tod zu bringen.
»Wir müssen Vorbereitungen für dein Untertauchen treffen, falls ich sterbe.« Harte, emotionslose Worte, die ihr in Erinnerung riefen, dass das Leben ihres nach außen hin vollkommen gesund erscheinenden Bruders an einem seidenen Faden hing.
Sie wandte den Blick ab, ihr Magen krampfte sich schmerzhaft zusammen.
»Theo.«
Ein Kopfschütteln. »Ich will nicht darüber reden.« Nicht, solange sie nach der kalten und einsamen Einöde ihrer Kindheit bisher erst so wenig Zeit zusammen gehabt hatten. »Ich hasse diesen Ort. Lass uns verschwinden.«
»Warte. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich dich hier treffen wollte. Um mit dir zu reden, ohne Gefahr zu laufen, dass jemand uns belauscht – niemand setzt je einen Fuß auf dieses Grundstück.« Pax blieb am Ende des Wegs stehen, wo der Rasen in eine von anderem Laubwerk umgebene Baumgruppe mündete, was den gefängnisartigen Eindruck, den die dahinter aufragende Mauer schuf, etwas abmilderte. Er zog einen handlichen Organizer von der Größe eines Mobiltelefons aus seiner Tasche.
»Ich habe ein paar Nachforschungen zu Großvaters Anteilen an den Zentren angestellt.« Seine Augen erinnerten jetzt an blaue Eissplitter. »Uns gehören deutlich mehr davon, als ich angenommen hatte.«
Theo kroch ein kalter Schauder über den Rücken. »Das überrascht mich nicht. Es ist genau die Art von Geschäft, die Großvater als lohnende Investition angesehen hätte.« Das wirklich Erschreckende daran war, dass Marshall Hyde mit seiner Einschätzung noch bis vor Kurzem recht gehabt hätte.
Medialenfamilien hatten viel Geld dafür bezahlt, ihre »fehlerhaften« Mitglieder »rehabilitieren« zu lassen. Was für ein harmloses Wort für die komplette Zerstörung einer Person und ihrer potenziellen Zukunft durch eine Gehirnwäsche, die ein Individuum in einen lebenden Leichnam verwandelte.
»Die Akten sind sehr umfangreich, und ich bin noch immer dabei, sie durchzupflügen«, erklärte Pax. »Jedenfalls habe ich eine bruchstückhafte Datei gefunden, in der dein Name erwähnt wird.«
»Was?« Theo blinzelte und zog die Stirn kraus. »Wieso sollte mein Name in irgendeinem Zusammenhang mit den Zentren auftauchen?«
»Keine Ahnung.« Pax öffnete ein Dokument auf dem Organizer. »Das hier ist das Einzige, das ich hochladen konnte. Scheint, als sollte diese Datei gelöscht werden, doch aufgrund eines Systemfehlers ist das offenbar nicht vollständig gelungen.«
Theo nahm ihm das Gerät aus der Hand und inspizierte die schwarzen Buchstaben auf dem weißen Hintergrund. Ein Großteil war zu fragmentarisch, um sie zu entziffern, trotzdem sah sie sofort, was Pax schon vor ihr entdeckt hatte: Theodora M—
Sie war in ihrer Familie die einzige Trägerin dieses Namens, aber … »Wurde ich nicht nach irgendeiner Urahnin benannt?« Theo hatte null Interesse an der Geschichte ihrer Sippe, sie bedeutete ihr, von Pax mal abgesehen, nicht das Geringste. »Vielleicht hat sie ja die ursprüngliche Investition in die Zentren getätigt.« Eine Sekunde später korrigierte sie sich. »Nein, das kann nicht sein. Sie starb, bevor sie gegründet wurden.«
»Korrekt. Und sieh dir das hier an.« Er tippte auf ein Datum, das ihr bisher entgangen war.
2. November 2055.
Der Tag, an dem Pax und sie das Licht der Welt erblickt hatten, Theo exakt zwei Minuten vor ihrem Bruder.
Mit äußerster Sorgfalt überprüfte sie ein weiteres Mal das ganze Dokument, aber alles andere war vollkommen unleserlich. »Du hast die Datei bereits durch ein Programm laufen lassen, um festzustellen, ob sich der Rest irgendwie entziffern lässt.« Es war keine Frage, denn genau das hätte sie getan, und was solche Dinge betraf, tickten sie und ihr Bruder gleich.
Pax nickte. »Soweit ich das beurteilen kann, wurden mehrere Akten zum selben Zeitpunkt gelöscht und wegen der Softwarepanne zu diesem Buchstabensalat.«
Als sie, überzeugt, dass es keine Verknüpfung zwischen ihr und den Rehabilitationsanstalten geben konnte, endlich aufatmete, fügte Pax hinzu: »Das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann, ist, dass sämtliche Unterlagen in diesem speziellen Ordner mit der Beteiligung der Marshalls an einem bestimmten Zentrum in Verbindung stehen.«
Theo umklammerte den Organizer so fest, dass ihre Fingerknöchel unter der Haut hervorstachen. Zorn schwelte unter der Oberfläche der Frau, die sie aus den von ihrem Großvater hinterlassenen Trümmern zusammengestümpert hatte.
Mit aller Macht zwang sie sich, tief einzuatmen, ihre Finger zu lockern und Pax den Organizer zurückzugeben. »Es gibt keinen logischen Grund, warum mein Name in diesen Dateien auftauchen sollte. Großvater hat mich nie in seine geschäftlichen Angelegenheiten eingebunden.«
Sie wich dem forschenden Blick ihres Bruders aus, damit er nicht die Wahrheit erkannte. Er hatte stets gedacht, dass sie böse auf ihn sei, weil er das Lieblingskind war, das glänzende Aushängeschild der Familie.
Das bereitete ihm ein enorm schlechtes Gewissen.
Wie viel schlechter würde er sich erst fühlen, wenn er wüsste, was Marshall Hyde aus ihr gemacht hatte?
Es war besser, ihn in dem Glauben zu lassen, dass sie einen Groll gegen ihn hegte, als zuzugeben, dass sie ihn nur nicht näher an sich heranließ, weil sie es nicht ertragen könnte, wenn er ihre hässliche Fratze sähe. Denn Pax’ Seele war wesentlich empfindsamer als ihre, er hatte Theo schon beschützt, als er noch so klein war, dass er dazu eigentlich gar nicht hätte imstande sein dürfen.
Sie würde für ihren Bruder sterben. Und, was noch wichtiger war, für ihn töten.
»Was wissen wir über dieses spezielle Zentrum?«, fragte sie, als ihr ihre Stimme wieder gehorchte.
Pax hatte das Schweigen bewusst nicht unterbrochen. Er kannte diese Seite von ihr, den chaotischen inneren Scherbenhaufen, der in heftigen Wutausbrüchen explodierte.
Sie war eine unkontrollierbare, tödliche Gefahr für jeden Medialen, der schwächer war als sie.
Da sie nur eine zwei Komma sieben auf der Skala erreichte, wäre das eigentlich kein echtes Problem – wäre sie nicht bedauerlicherweise von Geburt an geistig untrennbar mit einem Telepathen verbunden, dessen Zahlen fast kardinalen Rang erreichten. Wenn Theo in Rage war, konnte sie auf Pax’ Energie zugreifen. Dann stieg ihr Skalenwert sprunghaft auf eine mörderische neun Komma null an, und es gab nur sehr wenige Mediale, die noch darüber lagen.
Ihr Bruder und sie hatten beide schon versucht, dieses Ventil zu schließen. Vergebens.
»Rein gar nichts.« Pax gab keinen Kommentar zu Theos steinerner Miene und starrer Körperhaltung ab. Er hatte keine Ahnung, woher ihr Zorn rührte, aber er kannte den Preis, den sie dafür zahlte, ihn zu bändigen und die freundliche, sanftmütige Fassade aufrechtzuerhalten, die sie perfektioniert hatte, um ihr wahres Ich zu verbergen. »Es finden sich in der Datenbank keinerlei Informationen über diese Einrichtung. Sie existiert schlichtweg nicht.
Allerdings habe ich in einem von Großvaters Privatarchiven Hinweise darauf entdeckt, dass er zum Zeitpunkt seines Todes dabei war, das Zentrum außer Betrieb zu setzen. Er konnte sein Vorhaben nicht mehr zu Ende führen, die Tür blieb sozusagen einen Spalt offen.«
Eine unerklärliche, mit Verbitterung vermischte Übelkeit wallte in ihr auf. »Er hat es sogar vor dir geheim gehalten?«
»Vielleicht hatte er vor, mir davon zu erzählen. Doch dann wurde er ermordet.« Sein Ton war so nüchtern, als spräche er über eine geschäftliche Transaktion.
Manch einer mochte in ihm ein skrupelloses, gefühlskaltes mediales Raubtier sehen, doch für Theo war er einfach nur ihr Bruder, der eine andere Art von Missbrauch überlebt und immer bedingungslos an ihr festgehalten hatte. Es war kein Vergnügen gewesen, als Marshall Hydes Lieblingsenkel und Erbe aufzuwachsen. Theo hatte zumindest den Vorteil gehabt, den Großteil ihrer Zeit außer Sichtweite ihres Großvaters zu verbringen.
Pax schaute ihr unverwandt ins Gesicht. »Wie ist deine derzeitige Verfassung? Traust du dir zu herauszufinden, was genau es mit diesem Zentrum auf sich hat? Es muss wichtig sein, sonst hätte Großvater nicht Stillschweigen darüber bewahrt. Ich kann mich nicht selbst darum kümmern, weil ich in der Firma die Stellung halten muss, solange unser lieber Cousin versucht, die Führungsposition an sich zu reißen.«
»Ich habe mich im Griff.« Der letzte Wutausbruch hatte sie vor drei Monaten überkommen, und für gewöhnlich verging ein halbes Jahr zwischen ihren Episoden. »Ich muss wissen, warum mein Name in diesen Akten auftaucht.« Theo konnte einfach keinen Bezug zwischen ihrer Person und diesen Rehabilitationszentren herstellen.
Sie war geistig voll auf der Höhe.
Man hatte sie nie einer Gehirnwäsche unterzogen.
Eisige Kälte verteilte sich knisternd im Geflecht ihrer Adern.
Bist du ganz sicher, Theo?, meldete sich die hämische Phantomstimme ihres Großvaters.
3
Rangzahl 1: Niedrigstes Skalenniveau. Wird dieser Mindestwert nicht erreicht, ist eine Verbindung mit dem Medialnet unmöglich.
Rangzahl 2: Geringfügige nützliche Fähigkeiten, ausreichend für Tätigkeitsgebiete, die keine nennenswerten geistigen Kräfte erfordern.
Rangzahl 3: Nachweislich vorhandene mentale Gaben, wenngleich sie noch immer im unteren Drittel der Skala rangieren.
Aus der Einleitung von Überblick über die Stufen der Bewertungsskala (24. Auflage), dem von Professor J. Paul Emory und K. V. Dutta verfassten Lehrbuch für die m-medialen Grundkurse 1 & 2
Zwanzig Jahre früher
Theo stand vor dem Büro ihres Großvaters in dem palastartigen Gebäude, in dem alle seine Nachkommen bis zu ihrem achtzehnten Geburtstag lebten. Danach wies man ihnen entweder eine eigene Wohnung in einem familieneigenen Wolkenkratzer zu, oder sie »schlugen eine berufliche Laufbahn« in einer anderen Stadt ein und bezogen dort ein »adäquates Quartier«.
Genau wie die anderen Kinder im Haushalt hatte Theo das von klein auf verinnerlicht. Und sie wusste auch, dass ihr Großvater, obwohl sein Nachname Hyde lautete, das Oberhaupt der Marshalls war. Sie durchblickte das nicht ganz, aber ihre Mutter hatte ihr einmal erzählt, dass er so hieß, weil er eigentlich bei den Hydes hätte aufwachsen sollen.
»Das Abkommen funktionierte nicht so wie gedacht«, hatte sie geistesabwesend hinzugefügt, während sie sich nebenbei mit etwas anderem beschäftigte. »Also kehrte mein Vater zurück. Da er unter seinem Namen als Jugendlicher etliche Prämierungen für seine Leistungen erhalten hatte und schon auf dem besten Weg war, sich einen hervorragenden Ruf aufzubauen, erlaubte man ihm, den Namen zu behalten.«
Theo wusste noch immer nicht, was »Prämierungen« waren, sie vergaß ständig, im Computer nachzusehen. Jedenfalls war ihr Großvater irgendwann zum Patriarchen der Marshalls aufgestiegen.
Er hatte das alleinige Sagen in dieser Familie.
Theo hatte miterlebt, wie ihre Cousins mit achtzehn auszogen, was hieß, dass sie sich nicht länger den drakonischen im Haus geltenden Regeln unterwerfen mussten. Sie hatte mit Pax darüber getuschelt, was sie beide tun würden, wenn sie endlich frei wären, und damals geglaubt, dass ihnen noch viele Jahre blieben, um Pläne zu schmieden.
Bis sie wenige Tage nach ihrem und Pax’ siebten Geburtstag von ihrem Großvater fortgeschickt worden war.
Theo hatte den Grund nicht verstanden und zu weinen angefangen, obwohl ihr klar war, dass das gegen die Vorschriften von Silentium verstieß. Aber es war ihr damals schwergefallen, es einzuhalten, und so hatte sie ihre Mutter schluchzend gefragt, warum man sie von Pax trennte.
Sie durfte sich noch nicht einmal von ihm verabschieden.
Ihre Mutter, deren Augen dieselbe Farbe hatten wie Theos und Pax’, hatte sie mit einem strengen Blick bedacht. »Es ist nur zu eurem Besten, Theodora. Jetzt hör auf, dich zu blamieren, und wasch dir dein Gesicht.«
Wenn sie so mit einem sprach, war es ratsam zu gehorchen, also hatte Theo getan wie ihr geheißen. Sie versuchte unablässig, gedankensprachlich mit ihrem Bruder zu kommunizieren, aber seit ihrer letzten Begegnung war der telepathische Kanal blockiert.
Sie hatte Panik bekommen.
Pax war sonst immer erreichbar gewesen, sein Geist stets mit ihrem verbunden. Da seine Kräfte stärker waren als ihre, konnte er sein Bewusstsein auch über weitere Distanzen nach ihrem ausstrecken und die Entfernung überbrücken, wenn sie Probleme hatte, ihn zu erreichen. Aber jetzt konnte sie ihn nirgendwo finden, und niemand sagte ihr, was das alles zu bedeuten hatte.
Heutzutage geriet Theo nicht mehr in Panik, und sie vergoss auch keine Tränen. Inzwischen wusste sie, warum man sie von zu Hause verbannt und bei einer »Pflegemutter« untergebracht hatte, die für ihre Dienste bezahlt wurde. Colettes Wohnung befand sich weder in einem Wolkenkratzer, noch wies sie irgendeine Gemeinsamkeit mit diesem riesigen Anwesen mit den unzähligen Räumen, antiken Teppichen und weitläufigen Grünflächen auf.
Das Apartment verfügte nur über zwei Schlafzimmer, von denen das kleinere Theo gehörte.
Darin verbrachte sie den Großteil ihrer Zeit.
Sie widerstand dem Drang, die Hände zu Fäusten zu ballen, weil sie es gewohnt war, dass irgendwer sie immer im Auge behalten hatte und sie im Zweifelsfall verpetzen würde.
Das war der einzige Vorteil an ihrer jetzigen Unterkunft.
Dort beobachtete sie niemand.
Colette hielt sich entweder in ihrem Zimmer oder im Wohnbereich auf, wo sie administrative Aufgaben für die Marshalls erledigte. Das war ihr eigentlicher Job, ihre Betreuung von Theo nur eine zusätzliche Last zu ihren anderen Pflichten, für die sie eine beträchtliche Summe erhielt. So hatte sie sich einmal ausgedrückt, als Theo sie hysterisch weinend beschuldigte, sie gekidnappt zu haben.
Das war ganz zu Anfang gewesen, als Theo noch glaubte, das alles sei ein Missverständnis.
Sie war schon vor vielen Monaten eines Besseren belehrt worden. Seither betrug sie sich Colette gegenüber gut, weil sie erkannt hatte, dass diese sie in Frieden ließ, wenn sie ihr keine Scherereien machte.
Es war besser, als überwacht und bestraft zu werden.
Nachdem Theo inzwischen gelernt hatte, welche Menge an Nährstoffen sie in ihrem Alter benötigte, unterbrach Colette noch nicht einmal mehr ihre Arbeit, um sicherzugehen, dass Theo genug aß.
Ihre einzige Interaktion war der gemeinsame Spaziergang, den sie jeden Tag unternahmen und der laut Colette Teil von Theos vorgeschriebenem Körperertüchtigungsprogramm war. Theo passte genau auf, dass sie sich während dieser einen Stunde Freiheit an der frischen Luft nicht danebenbenahm. Sie konnte keinen Stubenarrest riskieren, sonst würden die Schreie in ihrem Kopf womöglich nach außen dringen.
Solange es an ihrem Verhalten nichts zu beanstanden gab und sie ihre Schularbeiten an dem Computer in ihrem Zimmer erledigte, kümmerte sich – von den täglichen Spaziergängen einmal abgesehen – niemand darum, was Theodora Marshall so trieb.
Das verschaffte ihr die Gelegenheit, sich in das Netzwerk ihrer Familie zu hacken.
Eigentlich war sie zu jung für so etwas, und vermutlich hatte deshalb niemand daran gedacht, eine Firewall zu installieren, damit sie nicht auf das komplette System, sondern bloß auf ihren Lernstoff zugreifen konnte. Aber Theo stand eine Menge Zeit zur Verfügung. Sie hatte ihren Bruder nicht mehr, um mit ihm zu reden oder zu spielen, und sie achtete gewissenhaft darauf, ihre schulischen Arbeiten pünktlich oder auch mit etwas Verspätung zu erledigen. Die Erfahrung hatte sie gelehrt, dass das Programm ihr nur weitere Aufgaben aufhalste, wenn sie zu schnell fertig war.
Darum trödelte sie absichtlich, während sie sich gleichzeitig über einen abgeschirmten Teil des Systems Zugang zur Datenbank der Marshalls verschaffte. Es hatte sie einen ganzen Monat gekostet, über das Internet der Menschen und der Gestaltwandler herauszufinden, wie sie ihr Eindringen verbergen und eine Art virtuellen Sichtschutz errichten konnte.
Theo hatte das Gefühl, als würden winzige Tierchen von innen an ihr knabbern.
Das Tablet, das sie benutzte, um ins Internet zu gehen, war gestohlen. Sie hatte es während einer ihrer Spaziergänge, als Colette sich gerade mit einer Kollegin unterhielt, der sie zufällig begegnet war, verlassen auf einer Parkbank liegen sehen und es ohne groß darüber nachzudenken in ihrer Manteltasche verschwinden lassen.
Ihr hatte das Herz auf dem gesamten Heimweg wie verrückt geklopft. Vor lauter Angst, erwischt zu werden, wartete sie, bis Colette eingeschlafen war, bevor sie das Tablet aus dem Versteck hervorholte, in das sie es hastig gesteckt hatte, als sie zu Hause ankam.
Es handelte sich um ein altes, billiges Modell, trotzdem war ihr bewusst, dass sie es irgendwo hätte abgeben müssen, anstatt es einfach einzustecken. Sie fühlte sich nicht mehr ganz so schlecht, nachdem sie das Gerät mit der Ladestation ihres Schul-Tablets verbunden hatte und feststellte, dass es auf niemanden registriert war und weder über eine Fingerabdrucksperre verfügte, noch ein Passwort erforderte.
Allem Anschein nach hatte sein rechtmäßiger Besitzer darauf hauptsächlich gespielt und Nachrichten gelesen.
Wenn er es nur dazu benutzt hatte, würde er es sicherlich nicht sehr vermissen, trotzdem plagte sie noch immer das schlechte Gewissen. Sie hatte noch nie zuvor etwas gestohlen. Aber Colette hatte auf Theos Geräten den Zugang zu sämtlichen Webseiten blockiert, die nicht mit ihrem Unterricht zusammenhingen, und Theo wusste, dass ein Alarm ausgelöst und sie in Schwierigkeiten geraten würde, wenn sie versuchte, die Sperre zu umgehen.
Anfangs hatte sie vorgehabt, mit ihrem Bruder über das Internet Kontakt aufzunehmen. Sie waren noch nie so lange getrennt gewesen, und sie vermisste ihn schmerzlich. Theo hatte gedacht, sie brauchte nur einen E-Mail-Account einzurichten und die Adresse an Pax weiterzuleiten, dann könnte er dasselbe tun und mit ihr kommunizieren.
Nur hatte sie keine Ahnung, wie sie ihm die Daten zukommen lassen sollte.
Colette nahm sie nie mit zum Wohnsitz der Marshalls. Und Theos telepathische Sinne waren gedämpft, als hätte jemand eine dicke Decke darübergeworfen. Wäre da nicht diese intuitive Wahrnehmung gewesen, die ihr sagte, dass Pax noch lebte, hätte sie noch nicht einmal das gewusst.
Das war der Grund, warum sie sich in das Computersystem ihrer Familie hackte.
Es erforderte viel Zeit und Geduld, und was sie dann entdeckte, verwirrte sie über alle Maßen: Sie wurde nicht länger als Pax’ Zwilling geführt, sondern als seine jüngere Schwester. Außerdem stieß sie auf einen Aktenvermerk zu einer Person, an die sie keine Erinnerung hatte: Keja, eine der Schwestern ihrer Mutter, die mit sechzehn gestorben war, als Theo und Pax etwa zwei gewesen sein dürften.
Genau wie Theo hatte Keja im untersten Bereich der Skala gelegen, auch wenn sie mit einer zwei Komma drei sogar noch schlechter abschnitt als Theo, die zumindest eine Sieben hinter dem Komma hatte.
Erst einen Monat später war Theo klar geworden, was sie da gefunden hatte. Man hatte sie aus der Familie verstoßen, weil sie schwach war. Möglicherweise war Keja dasselbe widerfahren. Nur dass sie nicht überlebt hatte. Sie war gestorben. Und niemanden hatte es gekümmert. Keiner sprach je von ihr.
Mit laut wummerndem Herzen hatte Theo sich gefragt, ob auch sie sterben würde.
Und jetzt stand sie – zwei Wochen, nachdem sie in die Datenbank eingedrungen war – vor dem Arbeitszimmer ihres Großvaters und musste an sich halten, um nicht durch die Gänge zu rennen und laut nach Pax zu rufen. Sie wusste, dass sie ihn hier nicht finden würde, hatte sie doch schon immer ein untrügliches Gespür dafür gehabt, ob ihr Bruder in der Nähe war.
In ihrer Kehle bildete sich ein Kloß, ihre Augen fingen an zu brennen. Sie hatte sich in letzter Zeit so sehr beherrscht, keine Gefühle zu zeigen, und darauf gehofft, dass ihre Familie ihr ihre Schwäche vergeben und sie wieder in ihrem Schoß aufnehmen würde.
Aber Pax war nicht hier. Und Colette hatte ihr nicht gesagt, sie solle ihre Sachen zusammenpacken.
Theo blinzelte mehrmals hastig, um nicht dem Ansturm ihrer Tränen zu erliegen.
In diesem Moment kam die Assistentin ihres Großvaters aus dem Zimmer. Die kleine Frau mit den grauen Haaren arbeitete schon für ihn, solange Theo denken konnte. »Du kannst jetzt reingehen«, sagte sie, und für eine Sekunde glaubte Theo, einen weichen Ausdruck in ihrem Gesicht zu sehen.
Sie überlegte gerade, ob sie sie bitten sollte, Pax ihre E-Mail-Adresse zu übermitteln, als die Züge der Frau wieder hart wurden. Was immer ihre sanfte Miene bewirkt haben mochte, es hatte nichts mit Theo zu tun. Sie stand in Marshall Hydes Diensten und würde jedes Wort, das Theo zu ihr sagte, an ihn weitergeben. Und Theo hätte dann jede noch so klitzekleine Chance, ihren Bruder wiederzusehen, verspielt.
»Danke«, antwortete sie mit leiser, emotionsloser Stimme.
Sowie sie sich vergewissert hatte, dass die Knöpfe ihres knielangen schwarzen Mantels ordentlich geschlossen, ihre Strümpfe hochgezogen und ihre glänzenden schwarzen Schuhe tadellos sauber waren, betrat sie das Arbeitszimmer ihres Großvaters.
Mit einem leisen Klicken fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
4
Lieber D,
es hat mich so sehr gefreut, von dir zu hören. Schade, dass ich dich verpasst habe, als du unsere Eltern besucht hast. Mein Aufenthalt in Paris zog sich länger hin als erwartet, weil man mich zur Bauleiterin befördert hat! Mir obliegt jetzt die Oberaufsicht über das gesamte Projekt. Ich könnte platzen vor Stolz!
Ich werde es Mom und Dad heute Abend erzählen. Aber du solltest es als Erster erfahren. Ohne deinen Rat und deine Unterstützung hätte ich niemals mein Examen bestanden. Ich werde dir nie vergessen, mit wie viel Geduld du mir dabei geholfen hast, meinen Weg zu finden. Hätte ich nicht so einen unglaublich tollen älteren Bruder, wäre ich heute nicht die selbstbewusste Frau, die ich bin.
Ich hoffe, Marian und du verlebt eine wundervolle Woche. Es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass du verheiratet bist!! Und das mit vierundzwanzig! Die Trauungszeremonie war so romantisch. Nachdem ihr jetzt ein halbes Jahr Zeit hattet, in ehelicher Glückseligkeit zu schwelgen, solltet ihr ernsthaft darüber nachdenken, mich in Paris zu besuchen. Ich werde noch mindestens zwei Monate hier sein, und mir wurde eine großzügig geschnittene Dreizimmerwohnung zur Verfügung gestellt. An Platz besteht also kein Mangel. Ihr müsst unbedingt kommen!
Deine kleine Lieblingsschwester (dir ist hoffentlich nicht entgangen, dass ich dir in meiner furchtbar krakeligen Handschrift auf echtem Papier schreibe, anstatt eine E-Mail zu schicken. Und ich werde sogar die horrende Gebühr für einen TK-Boten berappen.)
P. S. Die Debatte über die neue Zielsetzung von Silentium wird zunehmend hitziger geführt. Ich weiß nicht recht, was ich davon halten soll. Wie denkst du darüber?
Brief von Hien Nguyen an Déwei Nguyen (19. Februar 1972)
Nachdem er vier Nächte in Folge denselben Albtraum gehabt hatte, war Yakov mit den Nerven am Ende. Er würde es nicht noch einmal ertragen, dieser Frau vollkommen hilflos beim Sterben zusehen zu müssen, ohne eine Chance, sie zu retten.
Yakov hatte gute Lust, irgendjemanden zu erwürgen und ihn gleichzeitig windelweich zu prügeln.
Frisch geduscht, immer noch auf hundertachtzig und viel zu früh auf den Beinen, machte er sich auf den Weg zur Hauptküche, um sich ein Frühstück zu besorgen. In den Gängen begegnete er niemandem, und selbst die Halle – der saalartige Raum, der das Zentrum der Höhle bildete – war verwaist. Es war die Ruhe vor dem Sturm, die einem Schichtwechsel voranging.
In fünfzehn Minuten würde hier ein einziges Kommen und Gehen herrschen.
Der muskelbepackte Bär, der Küchendienst hatte, begrüßte ihn mit einem unwirschen Grunzen, bevor er sich wieder ans Brotbacken machte. Seine Bizepse traten zutage, während er den Teig knetete, als stellte er sich vor, er hätte seinen ärgsten Feind in der Mangel. Yakov konnte nicht begreifen, wieso jemand, der das genaue Gegenteil von einem Frühaufsteher war, beschlossen hatte, Bäcker zu werden.
Jedenfalls verstand der Kerl sein Handwerk, wie das auf dem Selbstbedienungsbüffet angerichtete frische Gebäck belegte.
»Danke, Dan«, murmelte Yakov, woraufhin Bogdan mit seiner mehlbestäubten Hand in der Luft wedelte, wie um zu sagen: Hau schon ab, du Nervensäge.
Yakov ließ ihn in Frieden und machte sich zu Pavels Zimmer auf, um ihn aufzuwecken. Er sparte es sich anzuklopfen, weil er wusste, dass sein Zwillingsbruder die Nacht allein verbracht hatte. Der Mann, in den Pavel vollkommen vernarrt war, hatte heute seinen letzten Arbeitstag bei einem kleinen, in Ecuador ansässigen Familienunternehmen, das ihm bestimmt nicht das bezahlen konnte, was er wert war.
Die Mercants neigten dazu, rätselhafte Entscheidungen zu treffen.
Pavel lag, die Arme über dem Kopf, bäuchlings im Bett und ließ einen Fuß unter der Decke hervorlugen. »Wehe, das ist kein Croissant, was ich da rieche«, brummte er und hob den Kopf. Seine vom Schlaf zerzausten Haare standen wirr in alle Richtungen ab, doch dank ihrer schweren, seidigen Textur – ein Vermächtnis von Pavels und Yakovs Urgroßvater – umrahmten sie gleich darauf wieder sein Gesicht.
Pavel streckte die Hand nach seinem Touchpad aus und schaltete das Licht an, anschließend schaute er zwinkernd wie eine Eule zu seinem Bruder hin. Seine Augen waren identisch mit denen, die Yakov jeden Tag aus dem Spiegel entgegenblickten – mit einem entscheidenden Unterschied: Pavel sah schlecht. Und er weigerte sich hartnäckig, einer Korrekturoperation zuzustimmen. Er ließ noch nicht einmal jemanden mit einem Laser auch nur in die Nähe seiner Augen kommen.
Er tastete auf dem Nachttisch, den Yakov für ihn gebaut hatte, nach seiner Brille und setzte sie auf. Sowie sein Sehvermögen wiederhergestellt war, lehnte er sich mit dem Rücken gegen das Kopfteil des Bettes, wobei er darauf achtete, dass sein Unterkörper züchtig bedeckt blieb. Auch wenn sie Zwillinge und obendrein Gestaltwandler waren, die keine Probleme mit dem Anblick nackter Körper hatten, wäre es selbst für ihre Maßstäbe nicht die feine englische Art, seine Kronjuwelen zur Schau zu stellen.
Pavel streckte gähnend die Hände aus, worauf Yakov ihm einen Kaffeebecher und ein Croissant reichte. Anschließend stellte er das Tablett mit dem restlichen Gebäck neben ihn und setzte sich – anstatt auf den einen Stuhl im Zimmer – seinem Bruder gegenüber ans Bettende, um ihm von dem Albtraum, der ihn Nacht für Nacht plagte, zu erzählen.
Aber schon bei der Erinnerung daran fing sein Magen an zu rebellieren, darum schnitt er erst einmal ein anderes Thema an. »Ich dachte, Stasya hätte euch ein größeres Zimmer im Quartier für Paare angeboten?« Pavel und Arwen hatten zwar noch nicht den Bund der Ehe geschlossen, aber jeder Bär, der Augen im Kopf hatte, konnte erkennen, dass sie eine feste Beziehung eingegangen waren.
Pavel zuckte mit den Achseln. »Offiziell wohnen wir bislang nicht zusammen. Es käme mir doch ziemlich übergriffig vor, umzuziehen, solange Arwen noch mit einer Entscheidung ringt.« Seine Stimme wurde weich, als er den Namen seines Liebsten aussprach.
Yakov hatte Mitleid mit ihm. Gleichzeitig konnte er nachvollziehen, dass Arwen erst zu sich selbst finden wollte, bevor er sich Hals über Kopf darauf einließ, mit Pavel das Band der Gefährten zu knüpfen, eine Entscheidung, die zum Greifen nahe war. Anders als den Zwillingen war es Arwen als Heranwachsendem nicht vergönnt gewesen, ein freies Leben zu führen. Empathen wie er wurden jetzt zum ersten Mal seit über einhundert Jahren nicht nur akzeptiert, sondern regelrecht verehrt.
Selbst für einen Mann wie ihn, der im Schoß einer Familie groß geworden war, die ihn mit aller Macht beschützte, bedeutete das eine radikale Veränderung. »Ich wurde in Liebe erzogen«, hatte er einmal zu Yakov gesagt. »Trotzdem musste ich mein wahres Ich vor jedem außerhalb meiner Familie verbergen.«
»Hat Arwen die Arbeit in Ecuador gefallen?«, erkundigte Yakov sich.
Pavel funkelte ihn an. »Du hast mich nicht in Allerherrgottsfrühe aufgeweckt, um mich wie eine neugierige Babuschka über mein Liebesleben auszuhorchen.« Er trank einen Schluck Kaffee. »Nun sag schon, was los ist.«
Yakov atmete tief durch und zwang sich, es auszusprechen. »Die Träume sind zurück.«
Pavel sah ihn scharf an, plötzlich war er wieder eine ranghohe Führungspersönlichkeit und nicht mehr der schläfrige Bär. »Die von früher, als wir sechzehn waren?«
»Ja – nur intensiver.«
»Damals waren wir auf uns allein gestellt.« Pavel biss von seinem Croissant ab. »Jetzt teile ich das Bett mit einem Empathen. Und unser Alphatier seins mit dessen Schwester.« Er grinste von einem Ohr zum anderen.
Yakov verdrehte die Augen. »So genau wollte ich es gar nicht wissen.« Trotzdem musste er lächeln; es freute ihn unbändig, seinen Bruder derart glücklich zu sehen. »Aber es stimmt schon, dass wir durch sie Mittel und Wege haben, uns Informationen zu beschaffen. Meinst du, jemand von ihnen kennt einen V-Medialen?«
»Es gibt niemanden, den Ena nicht kennt«, antwortete Pavel trocken in Anspielung auf Arwens einflussreiche Großmutter und stopfte sich den Rest seines Croissants in den Mund.
Danach waren nur noch genüssliche Laute zu hören.
Yakov drehte seinen Becher zwischen den Fingern. »Es ist immer noch dasselbe Mädchen«, sagte er leise.
»Das in deinen Träumen?« Pavel pfiff durch die Zähne. »Verdammt, dann scheint sie endlich auf dem Weg zu dir zu sein.«
»Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass sie nur das Echo einer Erinnerung unseres Urgroßvaters ist?«
»Damals waren wir hormongesteuerte Teenager, die einen Scheiß wussten. Sieht sie immer noch so aus wie früher?«
Yakov schüttelte den Kopf, sein Puls raste. »Sie ist erwachsen geworden. Und sie … blutet, ist dem Tode nahe.«
Pavels Gesicht wurde auf einen Schlag ganz ernst. »Erzähl mir alles.«
Also schilderte Yakov seinem Bruder und besten Freund seinen Traum bis ins kleinste, schauderhafte Detail. »Es ist einfach total krass.«
»Zweifellos«, pflichtete Pavel ihm bei. »Aber falls es wirklich eine Zukunftsvision ist, dann dient sie gleichzeitig auch als Warnung. Vergiss nicht, was unserer Babuschka Quyen zufolge Denu darüber zu sagen pflegte.«
»Das Großartigste an der Hellsichtigkeit ist, dass sie es ermöglicht, künftige Schreckensereignisse abzuwenden.« Yakov beugte sich vor und stützte die Arme auf seinen Schenkeln auf. »Aber sie hatte so furchtbar Angst, Pasha, und ich konnte nichts tun, um ihr zu helfen.«
Pavel nahm einen extralangen Schluck von seinem Kaffee und schnappte sich noch ein Croissant, bevor er nickte. »Dann lass uns das Pferd von hinten aufzäumen und erst einmal herausfinden, wieso du in diesen Träumen wie gelähmt bist. Anschließend überlegen wir uns, was du dagegen unternehmen kannst.«
Der Plan war gut gewesen – bis er daran scheiterte, dass Yakov keine genaueren Informationen zu der blutrünstigen Szene liefern konnte. Infolgedessen war seine Laune noch immer im Keller, als er in die Stadt fuhr, um sich mit Silver, der Frau seines Alphatiers, zu treffen. Sie war mitten in der Nacht zu ihrem Büro aufgebrochen, um nach einem weiteren verheerenden Medialnet-Kollaps den Rettungseinsatz zu koordinieren.
Yakov wusste, dass das geistige Netzwerk für die Medialen essenziell war, weil es ihre Gehirne mit dem unverzichtbaren Biofeedback versorgte. Nur ein paar wenige Individuen wie Silver, deren Bewusstsein mit dem einer nicht dem Medialnet zugehörigen Person verbunden war, konnten überleben, wenn diese Leitung unterbrochen würde.
Und jetzt war das Netz im Verfall begriffen.
Mit jedem neuen Riss wurden weitere Mediale gewaltsam davon abgeschnitten. Die Leute brachen tot auf der Straße, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Zuhause zusammen. Yakov hatte einmal mit eigenen Augen gesehen, wie mehrere Personen ohne Vorwarnung in sich zusammensackten, als wären es Marionetten, deren Fäden durchtrennt worden waren. Und es gab keine Möglichkeit, sie zu retten, es sei denn, man verfügte über mediale Kräfte, die so stark waren, dass man die Leute in einen unbeschädigten Teil des Netzwerks transferieren konnte, ehe sie qualvoll zugrunde gingen.
Es war das pure Grauen gewesen.
Als Silver ihm eine Nachricht mit der Bitte zu kommen geschickt hatte, war Yakov davon ausgegangen, dass sich der Notfall ganz in der Nähe ereignet haben musste und sie mehr Einsatzkräfte benötigte. Im schlimmsten Fall würde er bei der Bergung von Leichen helfen müssen, doch er hoffte, dass sich die Druckwelle im Netz rechtzeitig hatte eindämmen lassen, es höchstens ein paar Verletzte gab und er nur gebraucht würde, um für Sicherheit zu sorgen und die Leute zu beruhigen.
Aber er irrte sich.
»Die Erschütterungen waren nicht sehr heftig«, erklärte Silver, die Yakov gegenüber an ihrem Schreibtisch saß, während in dem raumhohen Fenster hinter ihr im dunstigen Grau des Morgens Moskau zum Leben erwachte. »Kein Vergleich zu dem katastrophalen Vorfall, der zur Entstehung der Medialnet-Insel geführt hat.«
Alle nannten diesen in einem Mahlstrom der Gewalt vom Netz abgespaltenen Sektor nur die Insel, weil es die einzige ihrer Art war. Soweit Yakov es verstanden hatte, trieb dieses Konstrukt umgeben von »totem Raum« im Medialnet umher, ohne damit verbunden zu sein.
»Damit auch Nicht-Mediale es sich bildlich vorstellen können: Denken Sie an einen ›Graben‹«, hatte ein Fernsehnachrichtensprecher erklärt. »Der Unterschied ist nur, dass man weder eine Brücke darüber bauen, noch ihn irgendwie anders überwinden kann. Es gibt keinen Weg auf die Insel oder von der Insel weg.«
Yakov schwirrte manchmal regelrecht der Kopf, wenn er versuchte, die Komplexität des Medialnet zu begreifen, aber dank der anschaulichen Graben-Metapher hatte er jetzt eine Ahnung, mit welcher Situation das Netzwerk konfrontiert war. »Aktuellen Nachrichten zufolge gilt die Insel inzwischen als stabil.«
»Ja. Ivan hat hervorragende Arbeit geleistet. Und das in nur zwei Wochen.« Silvers Stolz war nicht zu überhören. »Allerdings gibt es noch so vieles, das er nicht weiß, und wir können ihm nicht helfen, weil niemand von uns auf die Insel gelangen kann.«
»Tja, er ist eben ein Mercant«, versuchte Yakov, ihre Sorge zu beschwichtigen. Er wusste, dass die Mercants ebenso sehr ein Clan waren wie die StoneWater-Bären. Und es tat einem in der Seele weh, wenn man jemandem aus der eigenen Sippe nicht helfen konnte. »Ich bin sicher, dass er als Mitglied unserer Schnüfflergang einen Weg finden wird, um sich die Informationen zu beschaffen, die er braucht.«
Silvers Mundwinkel hoben sich. »Wiederhole das ja nicht in Gegenwart meiner Großmutter, sonst kann ich für nichts garantieren.«
Trotz der scherzhaften Warnung blickten ihre silberblauen Augen gewohnt sorgenvoll.
»Du solltest nach Hause fahren«, meinte er. »Ich denke, du brauchst eine Umarmung. Es überrascht mich, dass Valya dich nicht einfach festgehalten hat, bevor du gehen konntest.« Er spielte auf Silvers ersten Aufenthalt in der Höhle an, als alle dachten, Valentin habe sich vom animalischen Instinkt seines Bären dazu hinreißen lassen, sie zu kidnappen.
»Er hat tatsächlich versucht, mich zum Bleiben zu bewegen.« Der Anflug eines Lächelns. »Aber ich bin aus härterem Holz geschnitzt. Im Übrigen hat er heute jede Menge zu tun. Für ein paar der kleinen Racker ist dies ihr erster Schultag, und du weißt ja, wie viel Kraft sie von ihm beziehen.«
»Ja, sie brauchen ihn.« Gestaltwandlerbärenjunge mochten wilde, furchtlose Geschöpfe sein, trotzdem klopfte auch ihnen das Herz, wenn sie das erste Mal die Schule besuchten. Darum nahm Valentin sie buchstäblich bei der Hand und führte sie in das kleine, inmitten des Territoriums gelegene Schulgebäude. Er umarmte sie, wenn sie es nötig hatten, und blieb, bis sie sich mit ihren Freunden eingewöhnt hatten.
Natürlich waren auch ihre Eltern oder andere Aufsichtspersonen zugegen, um ihnen Mut zuzusprechen und Fotos zu machen, aber niemand empfand Valentins Anwesenheit als übergriffig. Sie wussten alle, dass in bestimmten Situationen ein Raubtiergestaltwandler nichts dringender brauchte als die Berührung und Anleitung durch sein Alphatier. Und Valya war ein guter Anführer, nicht nur wegen seiner Intelligenz und Stärke, sondern auch wegen seines großen Herzens.
»Ich kann mich nicht mehr an meinen ersten Schultag erinnern«, sagte Yakov. »Aber wenn man unserem Vater Glauben schenken darf, haben Pasha und ich auf der Türschwelle einen vielsagenden Blick getauscht, unsere Schulranzen geschultert und sind ins Klassenzimmer marschiert, als wären wir fest entschlossen, Unruhe zu stiften.« Akili Stepyrevs haselnussbraune Augen hatten vor Stolz in seinem dunklen Gesicht geblitzt, als er ihnen lachend diese Anekdote erzählt hatte.