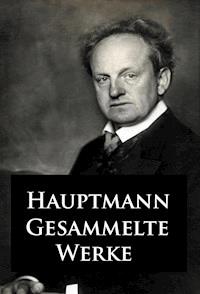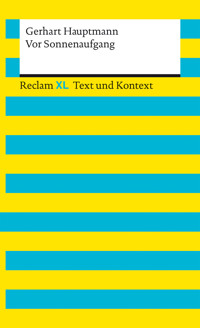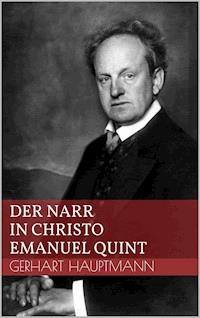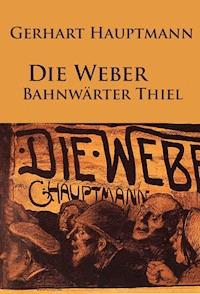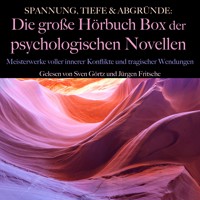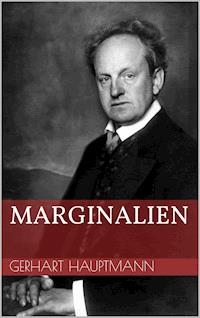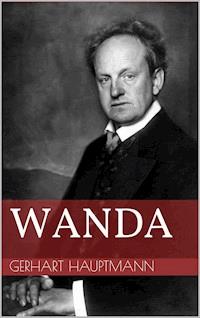Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Dichtung der Ährenlese beschreibt die Kriegszeit und die Verpflichtung gegenüber dem Vaterland aus Sicht des Erzählers. Der Mut zur Veränderung, die Siegeslust und die Furchtlosigkeit stehen im Vordergrund sowie das Zugehörigkeitsgefühl und die Pflicht, dem eigenen Land zu dienen und bis hin zum Tod dazu verpflichtet zu sein. Der Erzähler nimmt den Leser mit auf eine Reise durch die schrecklichen Zustände während des Krieges, über Leichenberge, blutige Morgenröte und dem Tod bis hin zum Sähen neuer Körner für das deutsche Vaterland.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerhart Hauptmann
Ährenlese
Kleinere Dichtungen
Saga
Ährenlese
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1939, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726956436
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Kleinere Dichtungen
Zueignung
Was suchst du noch, mein Freund, auf dieser Erde,
auf der du nun so lange schon geweilt
von Stund an, als ein unsichtbares „Werde!“
dir eines Lebens Schicksal zugeteilt?
Was suchst du noch, inmitten jener Herde,
die nur ein Ziel mit Sicherheit ereilt:
es ist der Tod! Die Arbeit aller Hände
dient seiner Majestät am letzten Ende.
Was ist nicht alles in den Staub gesunken,
was neben dir auf gleicher Strasse schritt!
durstlos verstummt, was Sonnenlicht getrunken
und, wie du selber, sprach, genoss und litt!
O wie erschrakft du, als des Lebens Funken
– Unsterblich schien er! – dem und dem entglitt,
der einer Seele Reichtum um sich streute
und sich mit dir am ewgen Dasein freute!
Der Stunden schlugen viele, die der Zeiger
des Schicksals schaurig lärmte, pflichtgetreu.
Und immer blickte einer auf den Seiger,
erschreckt im Mark, das Auge voller Scheu:
er wollte reden, und er ward zum Schweiger,
dem grossen Schweiger gleich, der immer neu
wirbt für das ewge Kloster der Trappisten,
die in den allerengsten Zellen nisten.
Wer bin ich, so Gewaltiges zu sagen,
das, recht erschlossen, Menschheit nicht erträgt?
Anmassung würde sein, auch nur zu klagen
hier, wo das ewge Wunder uns umregt.
Was sind hier Worte, und was sind hier Fragen,
wo Undurchdringliches sich auf uns legt,
wie Last und doch nicht last, das klein und grosse
Geheimnis, wie es ruht im Mutterschosse!
Genug davon: es tritt in die Kapelle
ein freundlich Holder Gott. Ein Schmetterling
lieh ihm der bunten Flügel Strahlenhelle,
der ewge Gärtner ihm den Rosenring:
das schwere Gold für seines Haares Welle
der Erdgeist, ders ihm um die Schläfe hing.
Und dieser edel-schöne Heitre Knabe
hielt mit zwei Fingern eine Honigwabe.
Ich kenne dich! so klang es durch den Duft
des Marmortempels, den der Gott beglückte:
Ich rief dich auf in diese selge Luft,
mit der ich dich ein Leben lang verzückte –
nicht immer freilich, doch aus deiner Gruft
dich oftmals lockend, drin dein Geist sich bückte,
verurteilt, Nachtgewölke zu durchkriechen,
die widerhallen von Dämonenflüchen.
Wie süss, wie liebreich strömt die Wahrheit mir,
so furchtbar sie auch sei, von deiner Lippe,
vergoldend und verholdend alles mir,
den Totentanz der grässlichsten Gerippe.
O dieser Nächte hässliches Getier:
geschwänzt und zähnefletschend ist die Sippe,
in allem töricht, schmutzig und unflätig,
grimassenselig und aus Bosheit tätigt.
Hinab, hinab, ihr scheusslichen Gebilde,
vor diesem Einzigen, was des Lebens lohnt,
zum Dienst der Schönheit aufruft und der Milde
und überall in reinen Lüften thront!
Unzähliger Früchte duftende Gebilde,
das Ein und Alles, das des Lebens lohnt,
es ist dem hohen Knaben anvertrauet,
der Edles weckt, wohin er immer schauet.
Ihr Hingegangnen, seinem Dienst verschworen
wie ich! Geliebte! kommt in treuem Zug,
vom Geist der heitren liebe neu geboren:
willkommen mir als Wahrheit, nicht als Trug!
Ihr seid am stillen Feste nicht verloren
und schlürft den Wein mit mir aus gleichem Krug!
Ich drücke euch die Hand in lieber Reihe,
mit euch verbunden in der gleichen Weihe.
Ich ging am breiten Strome
Ich ging am breiten Strome,
die Sonne sank im Rücken,
ihr Schein vor meinen Blicken
floss schimmernd im Gewog.
Es kam daher geflossen
aus ferner Höhn Graniten,
ein Schifflein! schwamm inmitten
wie meines Schicksals Bild.
Zu meiner Rechten glänzten
Terrassen und Paläste,
ein Haus wie eine Feste
mit goldnem Engelsschmuck:
Er sass auf Turmesspitze,
goldflüglig heiliger Bote:
wie seine Fackel lohte,
die seine Rechte hielt!
Ins Flammengold der Flamme
drang glänzend ungeheuer
der Abendsonne Feuer,
ward dort zum Meteor.
Der Gottesbote selber
fing Feuer, schoss als Flamme
grell blendend wundersame
Lichtfunken um sich her.
Ich bebte ganz von innen.
Wer bist du? sprach ich leise.
Das Schifflein, schwanker Weise,
floss weiter gen das Meer.
Es sprach, der feurig thronte,
ein einziges Goldgefunkel:
So trat ich einst ins Dunkel,
Kind, deiner Seele ein!
Noch einmal mich zu wissen,
erstrahl ich heut dir wieder,
indem die Sonne nieder
zum schwarzen Hades steigt.
Der Blitz vom Jugendtage
flammt einmal noch in Schöne,
indes dein Schifflein töne
vom ewgen Memnonslaut.
Aus „Insel der Grossen Mutter“
I
Leise Göttertritte hallen
durch der heilgen Haine Rauschen.
Oh, mit keiner wollt ich tauschen,
die Glückseligste von allen.
Wie des Glutbergs hoher Gipfel
da und dort mit Mächten drohet,
in erhabnen Nächten lohet
durch der schwülen Bäume Wipfel,
also tut mein Herz und zehret,
in sich selbst gewaltgen Brandes,
von den Nächten dieses Landes,
seinen Tagen, glanzverkläret.
Und der Genius durchschreitet
nächtlich bebendes Gelände,
unterm Tritte meine Hände,
wohlbeschirmt und wohlgeleitet.
Trinkt die Glut aus allen Träumen,
welche mir vom Herzen zittern.
Kühl vom Weltmeer steigt ein Flittern
und der Brandung tiefes Schäumen.
II
Süsse Luft und zartes Werden:
Wiesen, Wipfel, Waldeshöhen!
So viel blindes Glück auf Erden,
So viel Werben und Vergehen!
Herzen, die geflügelt singen:
Welch ein Schmettern, welch ein Schwingen!
Überall, was herrlich waltet,
so in Baches stillem Eilen,
fühle, wies die Welt gestaltet
im entschwindenden Verweilen.
Des Gestirnes stummes Wollen,
und was hinter allen Sternen
ist und hinter allen Fernen,
schenkt sich nah im Freudevollen.
III
Iphis, du Himmelstochter!
Iphis!
Du erschienst
hoch über uns
auf deinem goldhufigen Zebu,
auf deinem Zebu mit goldnem Gehörn.
Hoch über uns erschienst du
auf der morgendlichen Klippe
im Glanz.
Um dich war Glanz.
Es zuckte deines silbernen Bullen Haut.
Er schnaubte Silbernebel
aus seinen Nüstern,
Wolken von Silber
aus seinem rosenfarbenen Maul.
Segne uns, Iphis,
Himmelstochter!
IV
Ruht, ihr Mütter, von den Mühen
aus nun unter Mondesglühen.
Schmecket Trank und schmecket Speise
mit den Augen, mit dem Munde.
Von der Lebenswunderreise
rastet ihr in dieser Stunde.
Denkt, dass, was sie heut bescheret,
niemals, niemals wiederkehret.
V
Warum legst du Diamanten,
Liebling, in den Schoss der Blinden?
Nichts als Steine wird sie finden
und sich ritzen an den Kanten.
Schenke sie doch meinen Augen,
die nach ihren Blitzen dürsten,
die dich grüssen, ihren Fürsten,
und, an dir erprobet, taugen,
einer Sonne zu begegnen:
und bereit, dich so zu nennen!
lass mich blicken und verbrennen,
und ich will dich, Liebster, segnen.
VI
Heilige Mütter!
Gebärerinnen des Himmelssohnes Bihari Lal,
von Gott erkannt, den Gott gebärend!
Gebärerinnen der Himmelstöchter,
die ihr wandelt
über den Kelchen der Blumen,
durch die Berührungen eurer Sohlen
Farben streuend!
Gebt eure Lippen dem Baum,
er wächst und blüht.
Bald wird der Fall von Früchten
wie Klang von Pauken
den Boden erschüttern.
Euer Kuss erwecke den Fels,
dass kristallene Flut aus ihm bricht,
Himmelsflut, eure Kinder zu nähren,
himmlisch,
wie die Milch eurer Brüste himmlisch ist.
Wer denn hat mich neu erweckt…
Wer denn hat mich neu erweckt
in des Gartens Morgenschlaf?
Wolkengrau den Himmel deckt. –
Stilles Grausen, das mich traf,
spricht zu mir:
Willkommen hier,
du! wie ich so unbewegt
in den Gartentod gelegt. –
Träumtest das und träumtest dies,
alles, was dich bald verstiess.
Mürbe Früchte ruhn im Kies:
alles Gold, was man dir liess.
Was von ungefähr sie fand,
Sträucher streichelt deine Hand:
ob verspätet, ob verfrühet,
nun hier blüht es, wenn es blühet,
oder knospet still ins Nichts
eines leeren Totenlichts.
Verhör ich Hauch und Klang
Verhör ich Hauch und Klang im Buchenwald,
so geistert längst Verschollnes zu mir her:
ein Lockenschimmer, eine Miene bald,
ein heitres Lachen, Lächeln tot und schwer.
In grüner Tiefe schwind ich sinnend hin,
wo Wünsche schmeicheln, die sich längst erfüllt;
Das, was ich war, eh ich geworden bin,
ist da, ist fort, ich bin von ihm umhüllt.
Musik? O viel zu rauh ist jedes Wort!
Selbst fernste Äolsharfen wären schrill:
was da ist, ist nicht da und ist nicht dort,
und was da klingt, es schweigt für immer still.
Anna
Heut warst du bei mir im Grasegarten
mit den fleissigen Händen, den hässlichen, harten,
dem feinen Näschen, dran vibrieren
verräterisch die feinen Flügel,
über der Fülle der warmen Hügel
den starken Hüften, die dich zieren,
du Bauernvenus, mein früher Traum!
Voller Früchte wie ein Apfelbaum
stehst du da: verborgen im Stamme
glüht die süsse, verzehrende Flamme:
ihr opfre ich alles, was ich habe.
Sei mein, du berauschende Honigwabe!
Sei mein Haus, mein Hof, mein Herd!
Erd und Himmel bist du mir wert!
Anna, darben mit dir ist Genuss,
mit dir arm sein Überfluss.
Auf der Jagd nach meiner Seele
Auf der Jagd nach meiner Seele
merkt ich einen kleinen Jäger:
und ich duckte mich erschrocken
vor dem Pfeil- und Bogen-Träger.
Schleichend drang ich durch die Büsche,
die sich deckend leise schlossen:
und ich stand in sichrer Frische,
eh ein Schutz ward abgeschossen.
Atmend, sein nicht mehr gedenkend,
schritt ich meines Weges heiter,
da begann ein Weh zu nagen,
und ich stand und ging nicht weiter.
Und indem ich stand und dachte,
wie sich schwer die Pulse mühten,
fiel ein Regen aus den Wipfeln:
Blüten! Blüten über Blüten!
Mit der unerhetnen Fülle
stand ich da, in meinen Händen,
schaudernd wie bei Gottesnähe,
voller Furcht, mich umzuwenden.
Meines Herzens wildes Ringen
machte Pulse schmerzend klopfen,
an den Blütenkelchen hingen
purpurroten Blutes Tropfen.
Und ein altes Waldweib, schleppend,
unter ihrer Last von Ruten,
rief: „O weh! O schlimmes Zeichen,
wenn die Wipfel sich verbluten!“
Seltsam genug, mein Herz war frei
Seltsam genug, mein Herz war frei,
mein Wesen rein in sich gekehrt,
da ging ein Kind vorbei.
Mein Sinn war wie ein Vogel aufgestört,
er flatterte, er flog dahin und dort.
Mein Schatz war ausgeleert,
mein Hochmut umgekehrt,
die Kleine fort.
Seltsam genug, mit deinem vollen Haar,
kaum vierzehn Jahr,
und schmiegend dich an deine Mutter: ach,
nie war ein Herz so zitternd mein,
ergeben, rein,
was seine scheue Seele schweigend sprach: –
„Ich grüss dich, guter Freund,
schon Hand in Hand“ –
Ich rede, doch mein Sein ist mir entwand,
weil ich verloren, was ich eben fand.
Durchdrungen von Pein …
Durchdrungen von Pein, gemartert schwer
von Sorge und Sehnsuchtsschmerzen
durchwacht ich die Nacht, ach, die lange Nacht,
in Tränen mit pochendem Herzen:
wie wehe, ach wehe! ein jeder Schlag
der Pulse, die qualvoll ringen,
als wollte ein tödlich fressendes Gift.
den Eingang zum Leben erzwingen.
Halt aus, halt aus, nur diese Nacht,
sonst ist es um dich geschehen:
sonst hast du gestern zum letzten Mal
in die funkelnde Sonne gesehen.
O rufe, o rufe mit wildem Schrei
den lösenden Jubel der Sonnen,
sonst hat dich die schwarze Spinne, die Nacht,
für Ewigkeiten umsponnen.
Weisst du, was du bist?
Weisst du, was du bist?
weisst du, was du tust?
Du folterst mich, wenn du lachst!
du marterst mich, wenn du ruhst!
Ich will dich mit einer Kraft überwinden:
wo soll ich sie suchen? wo soll ich sie finden?
wie entgeh ich ihr? wie entring ich mich dir?
Du lässt ja bei Tag und bei Nacht nicht von mir!
Du hast mir eine Wunde geküsst
mit dem reinen verruchten Munde
in einer Stunde,
die nie gewesen ist.
Muss ich verbluten an dieser Wunde?
Aufrichten will ich eine Wand,
und siehe, du greifft hindurch mit der kleinen Hand.
Ich reisse mein Herz heraus, lege an seiner Statt einen Stein:
gleich muss der Stein, wenn du nahst, ein Herze sein.
Ich fluche dir! Und es trieft ein Segen
über dich hin wie ein Maienregen.
Es stieg ein Morgen herauf zu mir
Es stieg ein Morgen herauf zu mir
in der grossen Stadt Paris,
ein Morgen, trüb wie der trübe Gram,
und der neblichte Ostwind blies:
der brachte ein Blatt, ein kleines Blatt
von einem jungen Reis,
hereingeschaukelt auf meinen Tisch
aus des Ostens Winter und Eis.
Wo kommst du her, du grünes Blatt,
so zart und unversehrt?
Von welchem Bäumchen nahm dich der Wind?
Wer hat dich mir beschert?
„Kennst du denn nicht den jungen Baum,
der mich gesendet hierher?
Stolz trägt er die Krone, sein Stämmchen ist
so grad wie des Jägers Speer.“
Ich kannte das Bäumchen, ich kannt es wohl,
seiner Blätter und Blüten Duft.
Es stieg aus dem einen verwehten Blatt
der Frühling und füllte die Luft.
Ein Licht wie Gold, ein Hauch wie Gras
und grüner Maienschein
brach in mein ödes, fremdes Gemach
mit Klingen und Läuten herein.
Da flog ein Rabe herein zu mir,
schwarzflüglig, ins goldene Licht,
der brachte ein Blatt, ein rotes Blatt,
wie der sterbende Herbst sie bricht.
Wo bringst du her das rote Blatt,
du schwarzer Bote du?
Mir schlug das Herz so bang und weh,
und der Rabe krächzte mir zu:
„Kennst du denn nicht den edlen Baum,
der dir gegrünet hat?
der alle seine Früchte dir gab?
Es ist sein letztes Blatt!“
Ein leiser Schrei wie ein Todesruf
durchdrang die Frühlingsglut:
da weinte das Blatt, das rote Blatt,
einen roten Tropfen Blut.
Der Tropfen hing, und der Rabe flog
hin über das grüne Reis.
Der Tropfen fiel, und das grüne Blatt,
es ward wie Schnee so weiss.
Quassiabecher
In meiner Seele haben sich vermählt
Schmerz und die Lust: o liebe, goldne Zeit,
da Schmerz noch Schmerz war, Lust noch Lust. Nun ist
die Lust das Weh und ach! das Weh die Lust. –
Ein lichter Engel fliegt von Ost herauf,
gleich hebt ein schwarzer sich aus Westens Tor,
und in die weiche Krone duftger Lilien,
womit mich jener krönet, windet dieser
oh! scharfe Stacheln! –
Gott schnitt, des Himmels Tropfen drin zu fangen,
aus Quassiaholz mir meinen Becher: ihn
und keinen andern darf ich künftig leeren,
der macht mir bitter selbst den Honigseim!
Morgen
Zwischen Frühlingsstürzen steigend,
die in allen Klüften drängen,
trink ich voll und lausche schweigend:
um mich, in mir, welchen Klängen?
Und, dem sonnigen Gewühle
morgenkühl und heiss verbunden,
träum ich, blick ich, im Gefühle
ganz verloren, ganz gefunden.
Oder irr ich? Ja, ich irre!
Irrtum quillt aus tausend Quellen,
um mich fluten bunter Wirre:
Wasser-, Gräser-, Blumenwellen.
Auge, nicht entgehts dem Blühen,
wo es immer trunken taste,
Herze nicht dem Frühlingsglühen,
selbst Gestein erblinkt im Glaste!
Wer, der mir das Wirrsal löse,
wo so vieles lockt und langet
und mit seligem Getöse
wahrheitsferne lastet, pranget? –
Requiem
Ein Waldhorn fand ich im Tannengrund,
ruhe, du lieber Schläfer!
das hob ich auf an meinen Mund,
ruhe, du lieber Schläfer!
Ich stiess von ungefähr hinein,
da spielt das Horn im Sonnenschein:
ruhe, du lieber Schläfer!
Auf eine Burg will ich steigen hoch,
ruhe, du lieber Schläfer!
da klingt mein Waldhorn lieblicher noch,
ruhe, du lieber Schläfer!
Da wards lebendig im alten Haus
von Tanz und Turney, von Spiel und Schmaus.
O weh, du lieber Schläfer!
Ich hab einen wonnigen Tag gelebt,
ruhe, du lieber Schläfer!
und auch ein buntes Netz gewebt,
ruhe, du lieber Schläfer!
der Tau der Nacht fiel auch darauf,
drum hob ichs am Morgen voll Perlen auf.
Ruhe, du lieber Schläfer!
Was leg ich auf dein frisches Grab?
Ruhe, du lieber Schläfer!
Das Netz, das ich gewebet hab,
ruhe, du lieber Schläfer!
Und auch mein güldenes Hörnelein,
das haucht und singt noch ganz allein:
ruhe, du lieber Schläfer!
Turmzimmer
Von diesem Zimmer ist zu sagen:
Es weiss von schlimmen Stunden und Tagen,
einsam verwachten, kranken Nächten,
wo das Fenster, durch das der Schlummer
floh, hereinliess Sorge und Kummer.
Freilich auch in all ihren Prächten
Mondmagie und Glutenhauch,
schweren, kitzelnden Wiesenrauch.
Ja, durch angstvoll drückende Helle
drang erschreckten Rehbocks Gebelle.
Und vom Abend bis zum Morgen,
endlos, endlos, ein hartes Geknarre,
das ein Vogel, im Grase verborgen,
endlos zetert, die Wiesenschnarre.
Nun, ich selber, ich war der Kranke,
und mir selbst gilt mein Gedanke,
als ein angstvoll grosses Fühlen
mich ins Hoffnungslose drängte
und verlorner Seele Wühlen
mit dem Rauschen sich vermengte
unsichtbarer Felsenbäche,
die sich in die Markung teilen
und getrennt zu Tale eilen.
Ach, dem Schnarren, ach, dem Rauschen
musst ich lange Wochen lauschen.
Und das Rauschen glich dem Meere
in der nächtlich stillen Leere.
Oh, es schlüpften durch das Fenster
zahllos, lautlos Nachtgespenster.
Ob sie meiner Brust entschwebten,
ob in Mondlicht sich gebaren
diese fremd-vertrauten Scharen,
wüsst ich nicht, nur dass sie lebten
durch das bleiche Blut der Leiden,
um von kranker Seelenaue
Schmerzensgräser abzuweiden,
durstig nach dem bittren Taue,
drein sich ihre Rispen kleiden.
Die Barken
Trunken von Mondlicht und ertrunken fast
im Silberdunst der Nacht, fühlt ich die Barke
die Bahn hingleiten. So nussschalen-klein
trug sie Begeistrung, Gottestrunkenheit,
Musik! Der Bursche sang: die Seele jauchzte
in die verlassne Pracht. Die Stimme schwoll
zur Höhe, bebte, drängte sich hervor,
weinend und jubelnd. – Und am Ufer hin
schliefen die Häuser. – Mancher wohl im Bett,
in dunkler Kammer, war wie ich erwacht
und lauschte. Roh zerrissen ward mit eins
der nächtige Zauber. Grauenvoll durchdrang
ein gellend wilder Pfiff das Traumesreich.
Die Schönheit schwieg. Halb schlafend lag ich da,
und fern erstarb allmählich der Gesang.
Auf stieg die ewge Macht der Stille. Leise
grasten des Comersees gespenstige
Kuhherden: Barken, welche Glocken tragen
und ungesehen läuten ob der Flut.
Und weiter träumt ich: in verfallner Burg
am Meere wohnt ich. Durch die Riesenbogen
der Fenster sah der Mond. Bestirnter Himmel
schien her bis übers Lager sich zu breiten.
Tief unten brausten Wasser, warfen sich
dumpf wuchtend gegen die Zyklopenquadern
der Burg. – In tiefer Hafenhalle schlugen
die Barken aneinander.
Die Tauben
O ihr weissen, maurischen Städte! Ihr südlichen Hänge!
Schwarze Zypressen und goldene Kuppeln im Gartengedränge.
Weht ihr und winkt mit langen Tüchern von weisser Seide,
braune Frauen im bunten, golddurchwirkten Kleide? –!
Wem doch winkt ihr? –
Seht, es beginnt zu dunkeln –
über den alten, hohen Zypressen im tiefen Blauen silbern zu funkeln;
und das reine Symbol des hohen Propheten
hebt sich: der Halbmond! – Horch, der Muezzin! Beugt eure Kniee zu beten.
Und das Gebet ist beendet. Langsam durch weisse Hallen
wandeln die Frauen. Klingende Wasser rauschen im Steigen und Fallen.
Sieh, der Halbmond spiegelt mit hellen Wolken sich unten im Becken!
Zitternde Ringe rollen und können das heilge Juwel nicht decken;
und da seufzen die Frauen. Eine beginnt zu klagen:
„Morgen, ja morgen, da wird eine blutige Schlacht geschlagen!
Hassan, Kalut, Kafur, so Gatte als Brüder,
führen die scharfen Klingen wider die Christen-Barbaren.Wann kehren sie wieder?“
Spricht die Zweite: „Allah ist mit uns! Unsere Scharen
werden wie Engel Gottes unter die Völker der Feinde fahren.
Weisse Tauben aus unseren Söllern nahmen die Krieger,
sprachen: ‚Fliegende Boten sollt ihr uns sein! – Ja, Boten der Sieger!‘“ –
Da – mit flatterndem Sausen, licht und gespenstig, entschweben
Tauben, ein Schwarm, den besternten Räumen, wippen und kleben
um den leuchtenden Rand der marmornen Schale. Ein Rucken und Girren,
Flügelschlagen, durstiges Durcheinanderhüpfen, Drängen und Schwirren.
„Tauben! Die Tauben! Sittulhassan, komm, meine Taube!“
Und schon kommt sie herbei mit zierlich nickender Federhaube.
Um den braunen Finger der Herrin klammern sich rosige Krallen;
nun – ein Schütteln: – Dunkle Tropfen sprühen und fallen.
„Freundin, komm und sieh, in meiner Wimper hangt eine Feuchte!“
Jene, erwartungsbebend, nahet mit Tuch und Leuchte,
und die Herzen der beiden Frauen ineinander pochen und klopfen! –
„Siehe, an meinem weissen Tüchlein haftet ein blutiger Tropfen . . .
Blut!! –“
Es ist ein Schrei. –
In Büschen und Hallen
jäh verstummen die wohllautquellenden Nachtigallen.
„Blut!“ –
In fernen Bergen, blonde Barbaren, wild lachende Sieger,
werfen Tauben, in Blut getaucht, hinaus in die Nacht:
Normannenkrieger!
Die Klosteruhr
Die Klosteruhr der Schweigenden spricht:
Mit Klang und Beben
zerrinnt das Leben!
Oder zerrinnt das Leben nicht?
Die da schweigen
in Klostermauern,
hoffen zu dauern:
wie würden sie sonst sich beugen, sich neigen
und ein Leben vertrauern,
ein Leben verschweigen,
sich nur vor dem Künftigen schweigend neigen?
Oder ist es ein Zwiesprachhalten
mit dunklen Gewalten:
ein Bitten, ein Flüstern, am Ende ein Schreien,
womit sie das unerbetene Leben
zurückgeben?
Wie Vögel mit schmerzenden Flügeln schweben,
verwundet von Raubtierkrallen,
zugleich sich heben und fallen?
Ist es Flucht? ist es Todesmut? –
O weisse Schweiger,
die Klosteruhr rückt den Zeiger.
Die Zeit verrinnt. Es verrinnt euer Blut:
durch Klostermauern fühlt man es tropfen
und eure Herzen an Steinen verklopfen.
Mit gelber Haut, überwacht, überweint,
schlurft ihr durch den Käfig des Heiles,
wund von der Wunde des Gnadenpfeiles,
im dumpfigen Zuchthause Gottes vereint,
um in heiseren Wahnsinnsgesängen
wirre Seelen ans Licht zu drängen.
Draussen im Lichte braust das Meer.
Wogen und Wolken wandern schwer,
wandeln schwer und trübe einher.
Da sind keine Mauern –
und doch auch hier nur Schweigen und Trauern,
und doch auch hier ein Zwiesprachhalten
mit dunklen Gewalten:
ein Bitten, ein Flüstern, am Ende ein Schreien
über den leuchtenden Wüsteneien,
sich von dem Fluche des Scheins zu befreien?
Sind Wogen und Winde marternde Fragen,
und niemand will ihnen Antwort sagen?
oder müssen sie nutzlos flehen
zu vergehen?
oder ist es ein trübes Trauern,
dass sie vergehen und nicht dauern?
hoffen sie noch? und warten sie nur?
Horch, die Glocke der Klosteruhr!
Sonne, du klagende Flamme
Mein Sein ist gebrochen, mein Haupt ist leer –
Sonne, du klagende Flamme!
Es trifft mich dein Blick zwischen Wolken und Meer,
Sonne, du klagende Flamme!
Schwer rollet das Schiff, und es wälzt sich dahin,
ich habe vergessen, wer ich bin –
Sonne, du klagende Flamme
Du weinst nur verblassend, verdammest mich nicht,
Sonne, du klagende Flamme!
Meinen Gram zu durchdringen gilt dir Pflicht,
Sonne, du grausame Flamme!
Du beklagst meine Welt, du beklagst ihre Not,
lässest fliessen dein Blut, so heiss, so rot,
Sonne, du leidende Flamme!
Du verscheuchst meinen Schlaf in der schwärzesten Nacht,
Sonne, du stechende Flamme!
entblössest die Wunde, die du mir gemacht,
Sonne, du schreckliche Flamme!
Erweitere nicht ihren blutenden Rand,
nimm weg, nimm weg deine brennende Hand,
Sonne, du fressende Flamme
Du lohst mir im Haupt, dort erblindest du nie,
Sonne, du rasende Flamme!
Wie ertrag ich dich dort oder lösche dich, wie?
Sonne, du tosende Flamme!
Lass ab, du allmächtig wütendes Licht,
sonst zerbricht dein Gefäss, deine Wohnung zerbricht,
Sonne, du heilige Flamme!
Versink in die gläsernen Berge der See,
Sonne, du ewige Flamme!
Lass ruhn meine Schuld, mein verzweifeltes Weh,
Sonne, du rastlose Flamme!
Gewähre der Nacht, zu ersticken mein Leid:
nimm von mir, nimm von mir dein flammendes Kleid,
Sonne, barmherzige Flamme!
Lab ruhen den Mann, seine Qual, seine Last,
Sonne, barmherzige Flamme!
Schlummernd umarmt er des Schiffes Mast –
Sonne, barmherzige Flamme!
Mag er träumen, so gut ers vermag,
und morgen erschaff ihm den neuen Tag,
Sonne, du herrliche Flamme!
Dann mache ihn stark, dass er seiner sich freut,
Sonne, du jubelnde Flamme!
und lass ihn rufen, befreit und erneut:
Sonne, du jubelnde Flamme!
Ich höre es raunen in mir: Es sei!
und lasse erschallen mein Jubelgeschrei:
Sonne, du jauchzende Flamme!
Geheimnis
Von einem Schrosse sag ich, das vergessen
an stillen Flusses waldger Krümmung schimmert.
Ich weiss es heut nicht mehr zu sagen, wessen
es sei gewesen, wer sein Dach gezimmert
und das Gebälke der Zyklopenmauern,
die nächtlich Fledermaus und Kauz umwimmert.
Es schien, so hoch es stand, doch nur zu kauern
vor einer Steilwand, die zur andern Seite
des Stroms sich hob: man sah sie nur mit Schauern.
Sie trug auf ihrer Höhe eine weite
Hochfläche, die noch nie ein Mensch erstiegen,
ein grünendes Oval nach Tief und Breite.
Dort oben sah man fremde Vögel fliegen,
wohl einmal auch längs roter Sandsteinwände,
doch nie zur niedren Welt herunterbiegen.
Nur einmal hielten bleiche Mädchenhände
eins dieser bunten Paradiesgeschöpfe,
das sterbend sie gefunden im Gelände.
Die grossen Vögel trugen goldne Schöpfe
und Farben, wie die Erde sie nicht kannte.
Rubinmais füllte ihre Scharlachkröpfe.
Von fremdem Lichte das Gefieder brannte,
vielleicht vom Tag Saturns und seines Ringes
und seiner Monde warens Abgesandte.
Das bleiche Kind, das sich des Märchendinges
bemächtigt hatte, trug es heim zum Schlosse
und wies es seiner Amme: Sieh, ich fing es!
Sie war des finstern Burgherrn zarter Sprosse,
der einsam, unbeweibt, sich hier verborgen.
Er hatte oft weittragende Geschosse
nach solchem Wild, gesandt. All seine Sorgen,