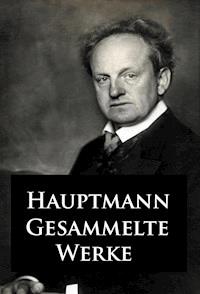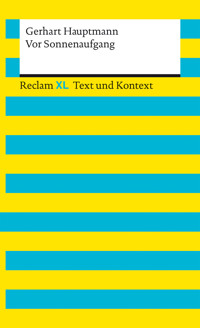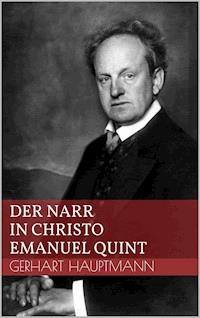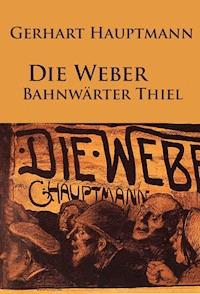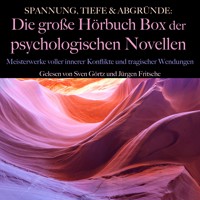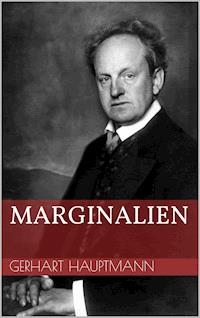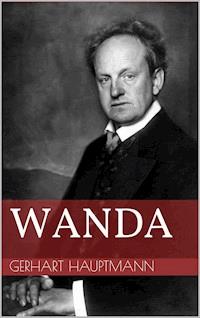Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerhart Johann Robert Hauptmann (geboren 15. November 1862 in Ober Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) in Schlesien; gestorben 6. Juni 1946 in Agnetendorf (Agnieszków) in Schlesien) war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Er gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 935
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Abenteuer meiner Jugend
Erstes Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Siebentes Kapitel Achtes Kapitel Neuntes Kapitel Zehntes Kapitel Elftes Kapitel Zwölftes Kapitel Dreizehntes Kapitel Vierzehntes Kapitel Fünfzehntes Kapitel Sechzehntes Kapitel Siebzehntes Kapitel Achtzehntes Kapitel Neunzehntes Kapitel Zwanzigstes Kapitel Einundzwanzigstes Kapitel Zweiundzwanzigstes Kapitel Dreiundzwanzigstes Kapitel Vierundzwanzigstes Kapitel Fünfundzwanzigstes Kapitel Sechsundzwanzigstes Kapitel Siebenundzwanzigstes Kapitel Achtundzwanzigstes Kapitel Neunundzwanzigstes Kapitel Dreißigstes Kapitel Einunddreißigstes Kapitel Zweiunddreißigstes Kapitel Dreiunddreißigstes Kapitel Vierunddreißigstes Kapitel Fünfunddreißigstes Kapitel Sechsunddreißigstes Kapitel Siebenunddreißigstes Kapitel Achtunddreißigstes Kapitel Neununddreißigstes Kapitel Vierzigstes Kapitel Einundvierzigstes Kapitel Zweiundvierzigstes Kapitel Dreiundvierzigstes Kapitel Vierundvierzigstes Kapitel Fünfundvierzigstes Kapitel Sechsundvierzigstes Kapitel Siebenundvierzigstes Kapitel Achtundvierzigstes Kapitel Neunundvierzigstes Kapitel Fünfzigstes Kapitel Einundfünfzigstes Kapitel Zweiundfünfzigstes Kapitel Dreiundfünfzigstes Kapitel Zweites Buch Erstes Kapitel Zweites Kapitel Drittes Kapitel Viertes Kapitel Fünftes Kapitel Sechstes Kapitel Siebentes Kapitel Achtes Kapitel Neuntes Kapitel Zehntes Kapitel Elftes Kapitel Zwölftes Kapitel Dreizehntes Kapitel Vierzehntes Kapitel Fünfzehntes Kapitel Sechzehntes Kapitel Siebzehntes Kapitel Achtzehntes Kapitel Neunzehntes Kapitel Zwanzigstes Kapitel Einundzwanzigstes Kapitel Zweiundzwanzigstes Kapitel Dreiundzwanzigstes Kapitel Vierundzwanzigstes Kapitel Fünfundzwanzigstes Kapitel Sechsundzwanzigstes Kapitel Siebenundzwanzigstes Kapitel Achtundzwanzigstes Kapitel Neunundzwanzigstes Kapitel Dreißigstes Kapitel Einunddreißigstes Kapitel Zweiunddreißigstes Kapitel Dreiunddreißigstes Kapitel Vierunddreißigstes Kapitel Fünfunddreißigstes Kapitel Sechsunddreißigstes Kapitel Siebenunddreißigstes Kapitel Achtunddreißigstes Kapitel Neununddreißigstes Kapitel Vierzigstes Kapitel Einundvierzigstes Kapitel Nachwort ImpressumErstes Buch
Erstes Kapitel
Anfang und Ende des Lebens, heißt es, sind dem Lebenden selbst in Dunkel gehüllt. Niemand kann sein geistiges Dasein vom Tage seiner Geburt datieren. So bin ich erst am Beginn meines zweiten Lebensjahres zum Bewußtsein erweckt worden und bewahre davon bis heute die Erinnerung.
Ich konnte weder sitzen noch liegen, weil mein Rücken und mein Gesäß, wie man mir später erklärt hat, zerprügelt und zerschunden war. Mein eigener Gedanke und deutlicher Lichtblitz aber war: Was soll aus mir werden, wenn ich beim Sitzen und Liegen maßlose Schmerzen habe?
Es ist meine Amme gewesen, die mich so mißhandelt hat. An die Prügelprozedur selbst habe ich jedoch keine Erinnerung.
Schmerz also hat meinen Geist erweckt, Leiden mich zum Bewußtsein gebracht.
Ich saß auf dem Arm der Kinderfrau und schrie, durch irgend etwas aufs schwerste beleidigt. Die Brave trug mich durch einen dunklen Korridor, der auf den Hof unsres Anwesens führte. Dort brüllte mich eine Stimme an, die mich stumm machte. Das war meine erste Begegnung mit dem preußischen Unteroffizier und die zweite Phase meines Bewußtwerdens.
Der ganze Hof lag voll Militär.
Eines Tages saß ich, von meinem Kindermädchen gehalten, auf dem Fensterbrett eines offenen Fensters und guckte auf den Vorplatz hinab. Dort wurden beim Toben der Regimentsmusik Remontepferde zugeritten. Sie stiegen kerzengrade in die Luft, sie bockten und keilten hinten aus, besonders die wütend geführten Schläge der Pauker machten sie unsinnig.
Es war, wie ich später erfahren habe, kurz vor der Schlacht bei Königgrätz.
Berührungen zwischen den Sinnen und Objekten, heißt es, veranlassen die Bewegung im Geiste des Neugeborenen, die ihn nach allen Dingen greifen läßt. Dies geschieht etwa bis zum dritten Lebensjahr.
Mit dem vierten Jahr ist es in mir bereits überraschend hell geworden.
Eines Tages erschienen fremde Soldaten, Österreicher, auf der Dorfstraße. Es waren Gefangene und Verwundete, hatte ich aufgefaßt. Der eine trug ein weißes, blutiges Tuch um den Hals. Ich nahm an, ihm sei der Kopf vom Rumpfe geschnitten und werde daran durch das Tuch festgehalten. Ein Gefangener hieß Boaba. Er war Tscheche und sprach nicht Deutsch.
Um jene Zeit hatten sich bereits die Gestalten zweier Knaben, meiner Brüder, in meine Seele eingeprägt. Die verwundeten Feinde in den Lazaretten empfingen von ihnen alle möglichen Wohltaten. Georg, der ältere, schrieb von früh bis abends Briefe für sie. Von ihm und dem jüngeren Bruder Carl wurde täglich die Speisekammer der Mutter ausgeplündert und der Raub den kranken Soldaten zugesteckt.
Ich teilte mit Bruder Carl ein Schlafzimmer. Er war, was in diesem Alter viel bedeutet, vier und ein halbes Jahr älter als ich. Er hatte damals schon, ohne es zu ahnen, in mir seinen stillen Beobachter. Ich wunderte mich, ich freute mich, ich machte mich lustig über ihn. Heute ein seltsamer Umstand für mich, ein solches Verhalten in frühester Jugend.
Carl war ein großer Enthusiast. Ich war geneigt, das für Schwäche zu halten. Von Zeit zu Zeit wurde, ebenfalls im Jahre 66, der Durchmarsch der Truppen für eine gewisse Nachtstunde angesagt. In solchen Fällen stellte sich Carl einen großen Korb, gefüllt mit Blumen, unter das Bett, um sie aus dem Fenster über die Marschkolonne auszuschütten. Ich erinnere mich, wie er einmal völlig traumbefangen nach dem Korbe griff, als von der Straße der dumpfe Marschtritt zu uns heraufschallte, wie er schlafend, geschlossenen Auges, damit zum Fenster lief, den Korb entleerte und, ohne ganz erwacht zu sein, ins Bett zurück taumelte. Ich nahm dies nicht erschreckt, sondern kichernd als etwas überaus Komisches auf.
Natürlicherweise waren mir um diese Zeit bereits Vater und Mutter und mein Verhältnis zu ihnen bewußt geworden, ebenso mein Elternhaus, dessen Namen ich kannte wie den des Ortes, in dem es stand. Wie war die Kenntnis unzähliger kleiner Beziehungen, in denen ich zu alledem stand, in mich gekommen? Ich hätte es damals nicht sagen können und kann es auch heute nicht. Diese Mutter, dieser Vater, dieses Haus, seine Räume und seine Umgebung, dieser ganze kleine Ort, Ober-Salzbrunn genannt, waren da wie von Ewigkeit. Und eben der Vater, die Mutter, das Haus, der Ort waren alles in allem für mich: es gab nur das, es gab nichts anderes.
Waisenkinder leben ohne Mütter, sie leben und entwickeln sich. Die Seeleneinheit, die mich mit meiner Mutter verband, machte mir das unbegreiflich. Durch das Herz meiner Mutter, durch ihre Liebe bin ich im Verlaufe des ersten Dezenniums erst sozusagen ausgetragen worden. Mein Vater war der mächtige Gott, in dessen Schutz wir beide standen. Nichts in der Welt konnte wider ihn etwas ausrichten. Wie stolz, wie dankbar macht mich das, wie genoß ich das Glück eines solchen Schutzes im Gefühl glückseliger Sicherheit. Aber eine innige, eine trennungslose Beziehung und Verbindung bestand zu meinem Vater nicht.
Wie kann man in die so überaus komplizierten Verhältnisse einer Familie, eines weitläufigen Anwesens, einer Ortschaft mit dreieinhalb Jahren, kommend aus dem Nichts, wissend hineingewachsen sein? Entweder auf Grund einer geistigen Leistung ohnegleichen oder einer Erbschaftssumme, die mitgeboren ist.
Salzbrunn, wußte ich, ist ein Badeort. Hier quillt ein Brunnen, der Kranke gesund machen kann. Deshalb kommen im Sommer so viele hierher. Sie werden in den Häusern der Ortsangesessenen untergebracht. Auch in unserm Haus, das der Gasthof zur Preußischen Krone ist.
Aber was ist ein Gesunder, was ist ein Kranker? Wieso und woher wußte ich das? Wieso wußte ich tausende, abertausende Dinge, nach denen ich kaum irgend jemanden gefragt hatte? Die unendliche Vielfalt der Erscheinungen schenkte sich mir mit Leichtigkeit, es war allenthalben ein heiteres Aufnehmen.
Ich hatte am Dasein ununterbrochen leidenschaftliche Freude wie an einer über alle Begriffe herrlichen Festlichkeit. Ich sträubte mich, wenn ich sie abends durch den Schlaf unterbrechen sollte. Im Einschlafen packte mich Freude und Ungeduld in Gedanken an den kommenden Morgen.
Freilich, das Haus war traulich und nestartig wohltuend. Aber das Schönste daran waren die Fluglöcher. Ich genoß sie vollauf, als ich einer schnellen und selbständig freien Bewegung fähig geworden war. Ich stürzte des Morgens mit einem Sprung und Freudenschrei ins Freie; manchmal wurde der Schrei nicht laut, sondern lag nur im überschäumenden Gefühl meines ganzen Wesens. Alles in der Natur schenkte sich mir: der Grashalm, die Blume, der Baum, der Strauch, die Berberitze, die rote Mehlbeere, der Holzapfel, alles und alles wurde mir damals zur Kostbarkeit. Dabei hatten sich bereits Höhepunkte des Erlebens meinem Geiste unverlierbar eingeprägt. Das Herumkrabbeln auf einem sonnenbeschienenen Abhang mit gelbem Laub und Leberblümchen unter kahlen Bäumen war ein solcher Höhepunkt. Ich hätte ihn gern zur Ewigkeit ausgedehnt, so wunschlos, so paradiesisch fühlte ich mich. Aber er blieb eine Einmaligkeit, ich suchte vergebens, ihn zu erneuern.
Einmal, ich kann nicht über zwei Jahre alt gewesen sein, überkam mich eine an Verzweiflung grenzende Traurigkeit, die sich in unaufhaltsamem Weinen äußerte und die meine Umgebung sich nicht zu erklären vermochte. Die Erinnerung auch daran befestigte sich in mir. Durch eine mit milchigem Wiesenschaumkraut durchsetzte Wiese angelockt, begab ich mich an das Blumenpflücken. Immer tiefer und tiefer, mich ganz vergessend, geriet ich in die Wiese hinein. Ich weiß nicht, wieso man mich ohne Aufsicht gelassen hatte, so daß ich wohl eine Stunde und länger meiner verträumten Beschäftigung nachgehen konnte. Ein Berg von Cardamine pratensis häufte sich. Ich hatte ihn unermüdlich fleißig am Rande der Wiese zusammengetragen.
Und nun auf einmal überkam mich diese allgemeine, ich möchte fast sagen kosmische Traurigkeit. Ich hatte alle diese Blüten, die da tot und welk übereinander lagen, tot gemacht. Wieso aber konnte ich das getan haben? War ich mir doch bewußt, daß ich aus Liebe zu ihnen gehandelt hatte und nicht in der Absicht, ihr Leben zu zerstören oder auch nur ihnen wehe zu tun. Ich wollte mir eben doch nur ihre Schönheit aneignen.
Der Befehl eines menschlichen Gottes war meines Vaters Gebot.
Eine Mutter wird ihre Kleinen täglich viele Male vergeblich mit den Worten ermahnen: »Bettle nicht!« Die ersten Worte der Kleinsten sind: »Haben, haben!« Mein Vater aber wollte unbedingt vermieden sehen, daß unsere Begehrlichkeit etwa gar den Kurgästen zur Last fiele. Ich, ein besserer kleiner Adam, hielt mich mit bebendem Gehorsam an sein Bettelverbot. Eines Tages kam jedoch einem alten Kurgast, Ökonomierat Huhn, der Gedanke, mich mit einem Spielzeug zu beschenken, das ich mir selber beim Händler aussuchen sollte. Ich wählte einen herrlichen blauen Rollwagen mit Fässern darauf und vier Pferden davor, drückte das Riesengeschenk mit ausgebreiteten Armen an meine Brust und vermochte es kaum fortzuschleppen. Unterwegs nach Hause fiel mir des Vaters Verbot aufs Herz. Zwar gebettelt hatte ich nicht, aber man konnte es leicht voraussetzen, und schließlich sollten wir überhaupt von Fremden nichts annehmen. Bei dieser Erinnerung schrie ich sofort aus Leibeskräften, als ob mich das größte Unglück betroffen hätte. Eine solche tragikomische Mischung des Gefühls in der Brust eines Kindes ist vielleicht eine Seltenheit. Ungeheure Freude über den völlig märchenhaften Neubesitz ward von Entsetzen über den Bruch des Gehorsams überwogen. Ununterbrochen schreiend trat ich mit meinem Schatz ins Haus und vor meine verblüfften Eltern hin, die den scheinbaren Widersinn meines Betragens nicht durchschauen konnten.
Den gartenmäßigen Ausbau der Kurpromenade nannte man Anlage. In diese Anlagen führte mich täglich meine Kinderfrau, wobei uns ein kleines Hündchen begleitete. Ich liebte es, wie natürlich, sehr. Noch eben hatte ich mit ihm schöngetan, als es in ein Boskett schlüpfte. Völlig verändert kam es heraus. Mit heller Kehle und langer Zunge Laut gebend, umkreiste es rasend in weitem Bogen mich und die Kinderfrau, die mich auf die Arme nahm und das Haus zu erreichen suchte. Das Hündchen aber in seiner kreisenden Raserei behielt uns als Mittelpunkt. Alles wurde auf den gefährlichen Vorgang aufmerksam, wer konnte, floh, auch mein Vater wurde benachrichtigt und zog uns schließlich durch eine Glastür ins innere Haus, wo wir vor dem wahrscheinlich von Tollwut befallenen Tier sicher waren.
Es war uns bis auf den Hausflur nachgefolgt, wo man es glücklicherweise abschließen und also unschädlich machen konnte. Ich sah durch die Scheiben seinen fortgesetzten, wütenden Todeslauf, immer im Kreis, über Stühle, Tische und Fensterbretter hinweg, ich weiß nicht wie lange, eh man es durch den Tod erlöste.
Ich bin diesen tiefen und grausigen Eindruck bis heut nicht losgeworden. Und immer, wenn später einer meiner Hunde in einem Boskett verschwunden ist, wurde ich unruhig und habe die Zwangsvorstellung zu bekämpfen gehabt, er werde schäumend und rasend herausstürzen.
Ich weiß nicht, wann mir der immerwährende Wechsel von Tag und Nacht, ihre Gegensätzlichkeit im Bereich der Sinne, des Empfindens und der Vorstellung deutlich ins Bewußtsein gedrungen ist und wann sie mir zu bewußter Gewohnheit wurde. Nicht der Tag, aber der Abend und die Nacht sowie alles Dunkel waren mit Furcht verknüpft. Ein solcher Ausdruck der Furcht war schon das Abendgebet, das meine Mutter mich täglich im Bett sprechen ließ:
Müde bin ich, geh' zur Ruh', schließe beide Äuglein zu. Vater, laß die Augen dein über meinem Bette sein! Alle, die mir sind verwandt, Gott, laß ruhn in deiner Hand ...
und so fort.
Die Furcht des Kindes ist Gespensterfurcht. Sein Tag kennt sie nicht, aber nachts, wenn es wach oder halbwach ist, umgeben es überall Dämonen. Da sie, woran das Kind nicht zweifelt, bösartig sind, gibt man dem geängstigten Knaben, dem furchtsamen Mädchen die Vorstellung eines Schutzengels. Man sprach auch mir von meinem Schutzengel, aber er wurde mir nie überzeugend gegenwärtig. Er gab mir nie ein Gefühl der Geborgenheit etwa in dem Grade, wie mir die Geister der Finsternis Furcht machten.
Eine Zeitlang teilte ich mit den Eltern das Schlafzimmer. Wenn ich, was vorkam, schlaflos lag und beim Scheine des Nachtlichtchens Vater und Mutter bewußtlos schnarchend in ihren Betten sah, waren sie mir wie atmende Leichname. Daß sie vom Tode wieder erwachen würden, ja daß ich sie wecken konnte, wußte ich. Aber ebenso war mir bekannt, daß man dies nicht darf, weil jemand, der weiterleben will, allnächtlich diesen Tod erleiden muß. Und so mußte ich denn das Gefühl einer grenzenlosen Verlassenheit auskosten.
Wenn das Um und An der Nacht mir peinlich war, so sah ich den Schlaf an sich als eine störende Unterbrechung des Tages an und schüttelte ihn des Morgens mit dem Glücksgefühl des Befreiten wie eine gesprengte Fessel ab. Nun konnte ich wieder in himmlischer Betäubung rastlos in der Sonne umherflattern und mich dem überall Selig-Neuen, den Genüssen des Gesichts, des Gehörs, des Geruchs, des Getasts und des Geschmacks hingeben. Ich konnte überall umherfahren, suchend und findend, alles um und um wendend, von der frohen Bezauberung meines Staunens erfüllt.
Vom Morgen gelangte ich so im Rausch des Spiels bis zum Abend hinauf, von dem man mich, und das war die gute Seite der Nacht, bewußtlos wie in einem lautlosen Lift zum Morgen herunterließ, wo das Spiel von neuem beginnen konnte.
An meinem Geburtstage brannten vier Lichter um den Kuchen, in der Mitte das längere Lebenslicht. Die Feier wurde alljährlich mit Geschenken, Kuchen, Lichtern und Blumen gewissenhaft eingehalten. Der Geburtstag fiel glücklicherweise in den Monat November, in die stille, dem Familienleben gehörende Winterzeit. Im turbulenten Gästebetrieb des Sommers würde man seiner kaum oder nur nebenher gedacht haben. So war es ein Tag der Freude, aber auch der Einkehr für mich, da die Mutter mit ernsten Reden des menschlichen Wachsens und Werdens und des menschlichen Schicksals im ganzen gedachte.
Über Spiel und Spielzeug ist viel gesagt und geschrieben worden. Wer den Spieltrieb kennt, weiß, welcher Zauber ihm innewohnt. Echtes Spielzeug kann sogar im Erwachsenen, besonders in Gegenwart von Kindern, das Kind erwecken. Aus dem Spieltrieb erwächst die Kunst. Der Knabe vom vierten, wenn er das Schaukelpferd hinter sich gelassen hat, bis zum achten, neunten Jahr ist ein Universalkünstler. Er hat mit Bauklötzen Dome aufgeführt, er hat sich geübt mit seinem Tuschkasten, er hat allerlei Tiergebilde aus Wachs modelliert, er hat sich zeichnerisch an den Menschen gewagt. Vor allem aber ist er ein Schauspieler ohne Eitelkeit, einer, der keinen Zuschauer braucht, wenn er sich als kommandierender General, als mutiges Pferd oder gar als Lokomotive gebärdet.
Es ist Neigung, niemals Gebot, niemals Pflicht, was zum Spiele treibt. Das Kind ist sein eigener Lehrer und Schüler. Ein Verhältnis von solcher Harmonie und Fruchtbarkeit wird ihm später schwerlich wieder zuteil werden. Es fühlt kein Ziel, es fühlt keinen Zweck. Alles ist, sei es versonnen oder wild, immerwährende Heiterkeit.
Wohl scheint die Natur dabei einen Zweck zu verfolgen: aber selbst die Erwachsenen sehen ihr Walten im Kinde meistens nicht. Deshalb halten sie sich für verpflichtet, schon früh und bei gegebener Gelegenheit, wie meine Mutter an meinen Geburtstagen tat, auf den kommenden Ernst des Lebens in Gestalt des Schulbesuchs hinzuweisen. Ich wollte lange nichts wissen davon, endlich aber wurde ich nachdenklich und sah die Unschuld meines Dahinlebens durch den Gedanken der Mutter gestört, daß dieses so glückliche Leben ein nutzloses wäre und abgelöst werden müsse von einem nützlichen. Seine Berechtigung habe es gleichsam nur als Gnadenfrist. Überschreite es diese Frist, so sei der Mensch, der es weiterführe, ein Taugenichts.
Nun, ein Fohlen, das einen Wasserguß erhält, schüttelt sich und galoppiert dann doppelt schnell und vergnügt in die Koppel.
Wenn ich, etwa als Vierjähriger, mit aufgestützten Ellbogen in einem der Frontfenster meines Elternhauses lag, wurde mein Blick bei klarem Wetter durch einen schöngeformten Berg, den Hochwald, angezogen. Er war dann nicht nur die Grenze meiner Welt, sondern der ganzen Welt. Und ich setzte mit stiller, zweifelsfreier Gewißheit voraus, man könne, auf seine Spitze gelangt, in den Himmel steigen. Oft und oft, wenn wieder und wieder die träumerische Stimmung im Angesicht des heiligen Berges über mich kam, habe ich diesen Fall erwogen und alle möglichen Arten, in denen der Plan auszuführen sei. Den Herrgott selber hatte ich auf einem dunklen Treppenabsatz unseres Hauses inzwischen kennengelernt, wo ein Ehrfurcht gebietendes goldgerahmtes Bild des weißgelockten, bärtigen Greises die Wand zierte. Ich hatte ihn zum Erstaunen der Meinen sogleich erkannt.
Waren die Lichter meines Geburtstages erloschen, so tauchte gleich eine andere Ballung von Licht, eine zunächst nur innerliche Sonne auf. Diese Sonne war Weihnachten. Unter der Lichtflut dieses Festes hat sich wohl der Familienkreis mir am frühesten und deutlichsten eingeprägt: mein Vater, der einen martialischen Schnurrbart und Brillen trug, meine Mutter mit ihrem Wellenscheitel, mein Bruder Carl, Johanna, die Schwester. An meinen ältesten Bruder Georg habe ich aus dieser Frühzeit keine Erinnerung.
Uns Deutschen kann der volle Begriff eines Festes nur noch an diesem Feste klarwerden. Es erhebt sich aus unabsehbaren Tiefen der Vergangenheit, und seine lebendige, oberirdische Tradition wird von Generation auf Generation in der gleichen Empfängnis entgegengenommen.
Die Freude dieses Festes war nicht die unmittelbare gesunde, irdische, sondern sie war eine mystische. Sie erhob sich in überirdischer Steigerung. Über ihr stand eine immergrüne Tanne, ein Nadelbaum, aus dessen Zweigen Kerzen emporwuchsen und ihn zu einer Pyramide von Flämmchen machten. Der Baum war gesunde Waldnatur, die Kerzen auf ihm und er als ihr Träger Mysterium.
O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter!
Welche widersinnige Einfalt beseelt dieses kleine Lied, und welche Tiefen des Entzückens werden durch es im Gemüt des Kindes ausgelöst.
Geschenke, Gaben brachte wohl das ganze Jahr hie und da, aber sie waren nicht von dem Zauber berührt und erfüllt wie die Bescherung unterm Weihnachtsbaum. »Vom Himmel hoch, da komm' ich her.« Nicht die Eltern hatten uns mit Geschenken beglückt, sondern sie waren diesmal wirklich vom Himmel gekommen. Der Vater, die Mutter waren Treuhänder, die sie uns übermittelt hatten.
Darum war die Freude, die Spannung zu Weihnachten übergroß, mitunter so groß, daß mein Organismus sich in der Folge durch eine kurze Krankheit wiederherstellen mußte.
Trotzdem stellte man sogleich Berechnungen über das kommende Weihnachten an, über die Monate, Wochen, Tage, die man bis dahin noch zu bestehen hatte.
Zweites Kapitel
Mein Elternhaus hatte zwei Daseinsformen, die so voneinander verschieden waren wie voll und leer, Wärme und Kälte, Lärm und Stille, Leben und Tod. Damit ist nur das Gebäude, der Gasthof zur Preußischen Krone gemeint, der dem Verkehr nur im Sommer geöffnet war und im Winter geschlossen blieb.
Ende April bezog ihn zunächst ein recht zahlreiches Personal: Köche, Küchenmädchen, Hausmamsell, sogenannte Schleußerinnen, Oberkellner, Kellner und einige Hausdiener. Dann füllten sich bald alle Zimmer mit Kurgästen.
Für den Gasthof also war das die lebendige, der Winter die tote Zeit, für die Familie dagegen war der Sommer die tote, der Winter die lebendige. Vater und Mutter gehörten sommers der Öffentlichkeit, sie waren den Winter über Privatleute.
Die zweite Daseinsform meines Geburtshauses verband sich am tiefsten mit meinem Wesen und prägte es in frühen, entscheidenden Zeiten aus. In dieser stillen, leeren Verfassung gehörte das Haus uns, im Sommer war es uns gänzlich entzogen und uns Kindern auch Vater und Mutter. Sie gehörten mit allem, in allem der Öffentlichkeit.
Die Quelle, der Brunnen war eines der ewigen Themen am winterlichen Familientisch. In einem Umkreis, dessen Radius ungefähr hundert Meter betragen mochte, traten die Heilquellen Ober-Salzbrunns, also die Salzbrunnen Salzbrunns, ans Tageslicht. Als der erste der Oberbrunnen. Gegenüber der Fassade unsres Gasthofs lag der prächtige Saal, den man über seiner Mündung errichtet hatte. An der Salzbach verborgen, zu erreichen auf einem nahen, schwankenden Brettersteg, lag der Mühlbrunnen. Er wurde zu Kurzwecken nicht benutzt und war der Bevölkerung freigegeben. Und, o Wunder! die dritte der Quellen gehörte uns. Ihr ummauerter Spiegel lag innerhalb der Fundamente unsres Gasthofs. An Heilkraft dem weltbekannten Oberbrunnen gleich, war doch ihr Dasein damals unbeachtet und ruhmlos. Ihr Wasser wurde durch eine Pumpe aus Gußeisen von den gleichgültigen Fäusten der Kutscher und Knechte für den Bedarf der Pferdeställe heraufgeholt. Auch wurde der Abwasch davon bestritten. Noch im Bereich meiner Knabenjahre ist dann eine vierte Quelle auf unserm Nachbargrundstück entdeckt worden.
Ich danke es meinem Vater, daß er mir, dem Flüggegewordenen, weder einen Faden ans Bein gebunden, noch mich einem Aufpasser, einem Präzeptor, überantwortet hat. Unbehindert durfte ich ausschwärmen. Das Erste und Nächste, etwa im späten Herbst, war ein ausgestorbener tempelartiger Bau, der sommers als Wandelhalle diente. Dort freute ich mich an dem Hallen meiner Tritte, wenn ich aus Freude an der Wiedergeburt nach dem Schlaf auf und ab rannte. Diese offene dorische Architektur, schlechthin die Kolonnade genannt, gewährte mir auch bei schlechtem Wetter freie Bewegungsmöglichkeit, wie sommers bei plötzlichen Regengüssen den Kurgästen. Einen besseren, schöneren und auch gesünderen Spielplatz als diesen, der mir zudem ganz allein gehörte, gab es nicht.
Vom Spiel lief ich in den anstoßenden Brunnensaal hinab, der immer offen war, und ließ mir an einer langen Stange von einem der Brunnenschöpfer ein Glas in die kreisrund ummauerte Tiefe tauchen, den prickelnden Brunnen schöpfen und heraufholen. Sie taten es immer mit Freundlichkeit und Bereitwilligkeit.
Mit der Zeit erst begriff ich, daß ich einigermaßen bevorzugt war.
Der Vater meiner Mutter war oberster Leiter des Badeorts. Er führte den Titel Brunneninspektor, so daß auch von dieser Seite der Begriff des Brunnens seine schicksalhafte Bedeutung in unserm Hause behauptete. Übrigens hieß ein herrschaftliches Gebäude in den Promenaden der Brunnenhof, ein Haus, das mein Vater gepachtet hatte.
Der Platz zwischen dem Gasthof zur Preußischen Krone und der Kolonnade, genannt Elisenhalle, war Zentrum des Orts. Er wurde außerdem noch begrenzt vom Badeverwaltungsgebäude, in dem mein Großvater Ferdinand Straehler, eben der Brunneninspektor, amtierte. Auf diesem Platze hatten sich einst meine militärischen Eindrücke wesentlich zusammengedrängt: der Österreicher mit dem blutigen Tuch um den Hals, Gefangene, rastende Truppen und ihre zusammengestellten Gewehre. Hier handelten meine Brüder gegen allerlei Tauschobjekte Kommißbrot ein, von hier aus führte der grade Weg bis zu einem Ausflugsort, der Schweizerei, den meine Brüder im Jahre 66 unzählige Male zurücklegten, um, wie schon gesagt, jene Gefangenen und Verwundeten zu betreuen, die man dorthin gelegt hatte. Hier, neben der breiten Freitreppe, vor dem Giebel der Elisenhalle, vor und unter den Basen der dorischen Säulen, saß auch im Winter eine alte knusperhexenartige Kuchenfrau, die aus vielen Gründen, auch dem der unumgänglichen kindlichen Näscherei, nicht aus meiner Kindheit hinwegzudenken ist. Von diesem Platz trat man in die Kurpromenaden und in den Brunnensaal, hier mündete der sogenannte Pappelberg, eine steigende Pappelallee, die nach Wilhelmshöh führte, einem romantischen Burgbau, dem hauptsächlichsten Ausflugsort.
Der durch Jahre vorausgeworfene Schatten des ersten Schultags verdichtete sich. Eines Tages nach Weihnachten sagte meine Mutter zu mir: »Wenn das Frühjahr kommt, mußt du in die Schule. Ein ernster Schritt, der getan werden muß. Du mußt einmal stillsitzen lernen. Und überhaupt mußt du lernen und lernen, weil auf andere Weise nur ein Taugenichts aus dir werden kann.«
Also du mußt! du mußt! du mußt!
Ich war sehr bestürzt, als mir diese Eröffnung gemacht wurde. Daß ich erst etwas werden solle, da ich doch etwas war, begriff ich nicht. War ich doch völlig eins mit mir! Nur immer so weiter zu sein und zu leben war der einzige, noch fast unbewußte Wunsch, in dem ich beruhte. Freiheit, Stille, Freude, Selbstherrlichkeit: warum sollte man etwas anderes wollen? Die kleinen Gängelungen der Eltern störten diesen Zustand nicht. Wollte man mir dieses Leben wegnehmen und dafür ein Sollen und Müssen setzen? Wollte man mich verstoßen aus einer so vollkommen schönen, mir so vollkommen angemessenen Daseinsform?
Ich begriff diese Sache im Grunde nicht.
Etwas auf andere Weise zu lernen als die, welche mir halb bewußt geläufig war, hatte ich weder Lust, noch fand ich es zweckmäßig. War ich doch durch und durch Energie und Heiterkeit. Ich beherrschte den Dialekt der Straße, so wie ich das Hochdeutsch der Eltern beherrschte. Erst heute weiß ich, welch eine gigantische Geistesleistung hierin beschlossen ist und daß sie, geschweige von einem Kinde, nicht zu ermessen ist. Spielend und ohne bewußt gelernt zu haben, hantierte ich mit allen Worten und Begriffen eines umfassenden Lexikons und der dazugehörigen Vorstellungswelt.
Ob ich mich nicht wirklich vielleicht ohne Schule schneller, besser und reicher entwickelt hätte?
Vielleicht aber war das Schlimmste ein Seelenschmerz, den ich empfand. Meine Eltern mußten doch wissen, was sie mir antaten. Ich hatte an ihre unendliche, uferlose Liebe geglaubt, und nun lieferten sie mich an etwas aus, ein Fremdes, das mir Grauen erzeugte. Glich das nicht einem wirklichen Ausstoßen? Sie gaben zu, sie befürworteten es, daß man mich in ein Zimmer sperrte, mich, der nur in freier Luft und freier Bewegung zu leben fähig war, – daß man mich einem bösen alten Mann auslieferte, von dem man mir erzählt hatte, was ich später genugsam erlebte: daß er die Kinder mit der Hand ins Gesicht, mit dem Stock auf die Handteller oder, so daß rote Schwielen zurückblieben, auf den entblößten Hintern schlug!
Der erste Schultag kam heran. Der erste Gang zur Schule, den ich, an wessen Hand weiß ich nicht mehr, unter Furcht und Zagen zurücklegte. Es schien mir damals ein unendlich langer Weg, und so war ich denn recht erstaunt, als ich ein halbes Jahrhundert später das alte Schulhaus suchte und nur deshalb nicht fand, weil es aus dem Fenster der alten Preußischen Krone sozusagen mit der Hand zu greifen war.
Unterwegs gab es Verzweiflungsauftritte, die nach vielem gutem Zureden meiner Begleiterin, und nachdem sie mich an der Schultür unter den dort versammelten Kindern allein gelassen hatte, dumpfe Ergebung ablöste.
Es gab eine kurze Wartezeit, in der sich die kleinen Leidensgenossen tastend miteinander bekannt machten. Im Hausflur der Schule zusammengepfercht, pirschte sich ein kleiner Pix an mich heran und konnte sich gar nicht genug tun in Versuchen, die Angst zu steigern, die er bei mir mit Recht voraussetzte. Diese kleine schmutzige Milbe und Rotznase hatte mich zum Opfer ihres sadistischen Instinktes ausgewählt. Sie schilderte mir das Schulverfahren, das sie ebensowenig kannte wie ich, indem sie den Lehrer als einen Folterknecht darstellte und sich an dem gläubigen Ausdruck meines angstvoll verweinten Gesichts weidete. »Er haut, wenn du sprichst«, sagte der kleine Lausekerl. »Er haut, wenn du schweigst, wenn du niesen mußt. Er haut dich, wenn du die Nase wischst. Wenn er dich ruft, so haut er schon. Paß auf, er haut, wenn du in die Stube trittst.«
So ging es, ich weiß nicht wie lange, fort, mit den Worten und Wendungen des Volksdialekts, in dem man sich auf der Straße ausdrückt.
Eine Stunde danach war ich wieder zu Haus, aß mit den Eltern vergnügt und renommistisch das Mittagbrot und stürzte mich mit verdoppelter Lust ins Freie, in die noch lange nicht verlorene Welt meiner kindlichen Ungebundenheit.
Nein, die Dorfschule mit dem alten, immer mißgelaunten Lehrer Brendel zerbrach mich nicht. Kaum wurde mir etwas von meinem Lebensraum und meiner Freiheit weggenommen und gar nichts von meiner Lebenslust.
Drittes Kapitel
Der Gebäudekomplex des Gasthofs zur Preußischen Krone war im Laufe der Zeiten durch Anbauten entstanden. Schwer zu sagen, welcher seiner Teile mir zuerst zu Bewußtsein gekommen ist. Ich hatte wohl erst ein allgemeines Gefühl seiner Unergründlichkeit. Insoweit blieb er mir lange unheimlich. Ich denke auch hier an die Winterzeit. Da war zunächst unser Winterquartier im ersten Stock. Es waren die Säle: der sogenannte Große Saal und der sogenannte Kleine Saal und endlich der sogenannte Blaue Saal, der in Wahrheit der kleinste war. Da war ferner das Erdgeschoß: ein Schnittwarenladen lag darin, eine verpachtete, dem Straßenbetrieb offene Bierstube, die Wohnung des Fuhrwerksbesitzers Krause und die Kronenquelle, von der schon gesprochen wurde. Das Haupthaus, der Kleine Saal, die Stallungen bildeten und umfaßten dreiseitig einen Hof, dessen vierte Seite nach der Straße offen war. Der Kleine Saal aber wurde von granitenen Pfeilern, sogenannten »Säulen«, getragen. Den unter ihm verfügbaren Wirtschaftsraum bezeichnete man schlechthin als Unterm Saal. Über unserm Winterquartier lag ein zweiter Stock, wo wir Kinder, sommers vom Fremdenbetrieb zurückgedrängt, in kleinen Schlafräumen unser vergessenes Dasein fristeten. Schließlich war das Bodengeschoß mit den Dachkammern ein besonderes Mysterium.
Unter diesen war eine, die sogenannte Siebenkammer, die für uns Kinder einen unheimlich-heimlichen Reiz besaß, obgleich sie in Wahrheit nichts anderes als die sattsam bekannte Rumpelkammer sein wollte. Wir hätten uns schwerlich im Dunkeln hineingetraut. Sonst aber übertraf ihre Anziehungskraft bei weitem die Furcht, die uns im Gedanken an sie anwandelte. Auch war diese Furcht selber anziehend, gleich jenem Gruseln, das der Handwerksbursche im Märchen durchaus lernen wollte.
Altes zerbrochenes oder weggeworfenes Spielzeug von Generationen war darin in unentwirrbarer, verstaubter Menge aufgehäuft: Gummibälle, Puppen, Hausrat von Puppenstuben, Hampelmänner, Pferde und Frachtwagen, Teile von Schäfereien und Menagerien, Schaukelpferde, und so fort und so fort.
Alledem hauchte der kindliche Geist besonders im langen Dunkel der Wintertage phantastisches Leben ein. So war denn die Siebenkammer – und ist es mir in gewissem Sinne noch heute – der Ort, wo auf geheimnisvolle Weise Kobolde, Feen, Knusperhexen und Zauberer, Helden und Menschenfresser sich Rendezvous gaben und durch die Dachluke nachts beim Mondschein aus und ein flogen. Ich brauchte nur an sie zu denken, um ihrem Märchenzauber, ihrer grenzenlosen Magie mit der unendlichen, bunten Vielfalt ihrer Gestalten anheimzufallen. Gehe ich fehl, wenn ich in ihr eine der wichtigsten Rätselquellen meiner späteren Fabulierlust sehe?
Das Winterquartier im ersten Stock bestand aus fünf zusammenhängenden Stuben, welche die Nummern drei bis sieben als Türschilder hatten. So sprachen wir Kinder von der Drei, der Vier, der Fünf, der Sechs und der Sieben. Und mit jeder dieser Zahlen verbindet sich noch heut für mich die Vorstellung eines besonders beseelten Raums. Von allen strahlte die Vier vielleicht die meiste herzliche Wärme aus, die Fünf und die Sechs waren nicht so traulich. Der Charakter der kleinen Sieben hatte seine Besonderheit. Es waren darin Rouleaus, auf denen bunte Spanierinnen mit Fruchtkörben auf den Köpfen zu sehen waren.
Die Seelen dieser fünf Räume tauchen noch heut gelegentlich in meinen Träumen auf, mit mancherlei anderen Elementen verbunden.
Die Tür der Sieben war der Abschluß eines längeren Gangs, dem Fenster nach dem Hofe Licht gaben. Dagegen hatte ein kleiner Alkoven, in dem winters Vater, Mutter und ich schliefen, nur ein Fenster nach diesem Flur hinaus.
Ein oder zwei Winter ausgenommen, hat sich das Leben der Familie hauptsächlich in diesem Teil des Hauses abgespielt.
Ich sagte schon, daß mein sonst strenger Vater mir eine außergewöhnliche Bewegungsfreiheit zubilligte, was von Verwandten und Freunden vielfach gerügt wurde. Ungebunden und überall neugierig ging ich demnach auf Entdeckungsfahrten aus und wußte bald über jeden Winkel des Hauses Bescheid. Fast täglich durchstreifte ich alle Stockwerke, war daheim in Garten und Hof, kannte die entlegensten Räume, von denen einige seltsam genug und hinreichend unheimlich waren.
Das leidenschaftliche Leben, dem ich damals unterlag und das meinen zarten Organismus wie ein überstarker elektrischer Strom bewegt haben muß, erklärt sich nur durch eine ungeduldige Lebensgier, die überall etwas zu versäumen fürchtete. »Gerhart, renne doch nicht so!« sagte meine Mutter. – »Rase doch nicht immer so!« sagte mein Vater. – »Du rennst dir die Schwindsucht an den Hals!« mahnte mein Onkel Straehler, der schöne, von den Damen vergötterte Badearzt, wo er im Freien meiner ansichtig wurde. Frau Krause, Frau des Fuhrwerksbesitzers im Erdgeschoß, die robuste Bauersfrau, hielt sich wieder und wieder die Ohren zu und sagte dabei: »Hör auf, hör auf, dein Schreien macht mich verrückt, Junge!«
Der Wahrheit gemäß wäre vielleicht zu sagen, daß ich um jene Zeit immerhin ein wohlgearteter, aber kein wohlerzogener Junge gewesen bin, dazu war ich zu wild und zu frei aufgewachsen. Wie manchem mag ich durch lärmiges Gebaren, Rennen, Schreien und Ansprüche aller Art lästig geworden sein! Ich bin auch nicht allzu sauber gewesen. Die künstlichen Sitten der elterlichen Bürgerzimmer konnten den natürlichen Unsitten der Straße und des sogenannten niederen Volkes nicht standhalten. Ein nordisches Kind ohne Schnupfen im Winter gibt es nicht, und der Straßenjunge, der mein bewundertes Muster war, wird sich die Nase nur mit dem Ärmel putzen, wenn er es nicht technisch vollkommen mit Daumen und Zeigefinger niesend tut. Daher hatte ich meinen blanken Ärmel, zunächst den rechten, den andern erst, wenn dieser nicht ausreichte.
Frau Greulich hieß eine alte Weißnähterin, die winters über bei uns arbeitete. Die gute Frau war entsetzt und herrschte mich manchmal heimlich entrüstet an, wenn ich ohne Ärmel und Taschentuch den Fluß der Nase durch ununterbrochenes Lufteinziehen erfolglos zu hemmen suchte.
Erkner, ein Vorort von Berlin, wo ihr verstorbener Mann Bahnbeamter gewesen war, hatte übrigens die beste Zeit im Leben dieser Frau gesehen. Immer, fast täglich, sprach sie davon. Sie ahnte nicht, und ich ahnte nicht, welche Bedeutung dieser Ort etwa fünfzehn Jahre danach auch für mein Leben erhalten sollte.
Wenn Sommer und Winter zwei ganz verschiedene Lebensformen des Gasthofs zur Preußischen Krone bedeuteten, freilich nicht ohne Zusammenhang, so kann ich noch heute wie als Kind völlig getrennte Welten unterscheiden, innerhalb seiner Mauern sowohl als auf dem dazugehörigen Grund.
Die Bürgerzimmer erstens umschlossen winters das Familienleben und damit die Wohlerzogenheit. Die Säle im gleichen Stockwerk wiesen gewissermaßen feierlich in eine fremde Welt höherer Lebensform. Im Blauen Saal stand das Klavier. Gelbe Mahagonipolstermöbel schmückten diesen Raum und die lebensgroßen, goldgerahmten Ölbildnisse König Wilhelms und seiner Gemahlin Augusta in ganzer Figur. Hier hatten die monarchischen Gefühle meines Vaters ihren Ausdruck gefunden. Eine Kopie der Sixtinischen Madonna in Originalgröße beherrschte den anderen, den Großen Saal, dessen noch verfügbare zweite Wand eine Kopie der Kreuzabnahme Rembrandts trug, den mein Vater, nach der Fülle der Rembrandtkopien im Kleinen Saal zu schließen, besonders geschätzt haben muß.
Ich begreife noch heute schwer, wie man in der sakralen Atmosphäre des Großen Saales speisen und harmlos plaudern konnte.
Dicht an die Säle stießen dann Küche, Waschküche und Hinterhof, die eine ganz andere Welt darstellten und die im wesentlichen den unabweisbaren Bedürfnissen des Magens und des Bauches zu dienen hatten. Es kam hernach die Welt Unterm Saal, die zwar als ein Teil des Hofes anzusehen ist, aber eigene Funktionen hatte. So lag die Kutscherstube dort und die Putzstube der Hausknechte, besonders aber wirkte sich hier der Betrieb des Weinkellers mit Flaschenwaschen, Fässerreinigen und dergleichen regensicher aus.
Von den Sälen zur Kutscherstube war ein großer Schritt. In einem fensterlosen Raum blakte allzeit eine Ölfunzel, es herrschte keine Sauberkeit, es roch nach Bier, Fusel und Speiseresten. Diese Kutscherstube war eine Dreckbude, wo aber doch viel Behagen, Gelächter, derbes Fluchen und Karten-auf-den-Tisch-Hauen in jenem niederländischen Stil laut wurde, der sich auf manchem Ostade des Kleinen Saals erschloß. Im Giebel des Hauses ebenerdig nach der Straße hinaus lag noch die Bierstube, die Schwemme, wie man in Österreich sagt, deren Tür auf die Gasse ging und die zeitweilig Schauspieler Ermler gepachtet hatte. Sie war ein manierlich volkstümlicher Aufenthalt, der gelegentlich auch wohl von den Honoratioren des Orts besucht wurde.
Der Hintergarten war das Gebiet, wo man sich in der ungebundensten Wildheit austobte. Der große Düngerhaufen der Pferdeställe befand sich dort, der Eiskeller, um den herum es sehr übel nach Schlachthaus roch, aber auch ein Warmhaus, dessen Palmen, Lorbeer- und Feigenbäume und seltene Blumen mir die erste Botschaft einer schönen südlichen Welt brachten.
Der Schnittwarenladen aber von Sandberg, in der Front des Hotels, atmete eine vornehme Stille. Der graubehaarte Scheitel des alten Inhabers, auf dem allezeit ein gesticktes Käppchen saß, sein milder Ernst, seine seltsame Sprache und manches, was man mir von ihm erzählt hatte, da er Vorsteher der Salzbrunner jüdischen Gemeinde war, erfüllten mich mit einem Respekt, in dem sich Befremden und Neugier mischten.
Viertes Kapitel
So ungefähr boten sich zunächst die Schauplätze dar, auf welchen ich mich im Vollgenuß meines Lebenstriebes – im gesunden Kinde ist Freude und Leben ein und dasselbe – in dauerndem Wechsel täglich bewegte. Sie lagen auf zwei verschiedenen Hauptebenen, von denen die eine die bürgerliche, die andere zwar nicht die durchum proletarische, aber jedenfalls die der breiten Masse des Volkes war. Ich kann nicht bestreiten, daß ich mich im Bürgerbereich und in der Hut meiner Eltern geborgen fühlte. Aber nichtsdestoweniger tauchte ich Tag für Tag, meiner Neigung überlassen, in den Bereich des Hofes, der Straße, des Volkslebens. Nach unten zu wächst nun einmal die Natürlichkeit, nach oben die Künstlichkeit. Nach unten wächst die Gemeinsamkeit, von unten nach oben die Einsamkeit. Die Freiheit nimmt zu von oben nach unten, von unten nach oben die Gebundenheit. Ein gesundes Kind, das von unten nach oben wächst, ist zunächst wesenhaft volkstümlich, vorausgesetzt, daß es nicht durch Generationen verkünstelten Bürgertums verdorben ist. Das Kind steht dem bäuerlichen Kindermädchen näher als seiner Mutter, wenn diese eine Salondame ist: und die Mutter, wenn sie es ist, weiß mit dem Kinde, das sie gebar, nichts anzufangen. Fuhrhalter Krause, der im Hofe die Herrschaft führte, sprach mit seinem Sohne Gustav und mit mir, wie man mit seinesgleichen spricht. Nie wurde ihm oder mir von Krause klargemacht, daß wir dumme Jungens seien und uns als minderwertige Wesen anzusehen hätten. Auch von Vater und Mutter erlitten wir keine moralische Erniedrigung, außer wo wir mit Recht oder Unrecht gescholten wurden. Aber es lag nun einmal im Geiste des oberen Bereichs, daß man sich nicht natürlich betragen konnte. Der Unterschied zwischen unten und oben war so groß, wie der zwischen dem sinnlich-seelenvollen Dialekt und dem sinnlich-armen, nahezu entseelten Schriftdeutsch ist, das als Hochdeutsch gesprochen wird. Unten im Hof erzog die Natur, oben wurde man, wie man fühlte, nach einem bewußten menschlichen Plan für irgendeine kommende Aufgabe zugerichtet. Kochen, Essen, Schlafen, das alles ging vor sich in einem einzigen Zimmer des Krausebereichs.
Jegliches Ding darin hatte seine Aufgabe. Oben war eine Zimmerflucht, die zum großen Teil nur von Glasschränken mit Büchern und Nippes, von Spiegeln, unbenutzten Kommoden, Tischen und Sesseln und von einigen schweigsamen Fliegen bewohnt wurde. Die stumme Sprache dieser Dinge, Uhren, Porzellane, Ziergläser, Teppiche, Tischdecken und dergleichen, wiederholte immerzu: Mache hier keinen Riß, dort keinen Fleck, stoß mich nicht an, stoß mich nicht um, und so fort. Unten gab es dergleichen Rücksichten nicht.
Und oben, nicht unten, wohnt auch die Eitelkeit. Da sind ihre großen und kleinen Spiegel, die über das Unten keine Macht haben. Dort prüft der gekünstelte Mensch und schon das Kind tagtäglich sein Aussehen. Bei solcher Gelegenheit hat mich das meine nie befriedigt. Auch dem Gecken mag übrigens etwas anhaften von dergleichen Unzufriedenheit, er würde sonst im Ausputz seiner Person nicht so ruhelos wechseln. Der wohlgekleidete Mensch wird gesehen. Er vergißt nicht, darf nicht vergessen, daß es so ist. Wenn er ausgeht, ist er sein eigener Spiegel. Der einfache Mensch sieht nur um sich her.
Wenn der einfache Mann müde ist, macht er Feierabend, oder er macht eine Arbeitspause, die er sich, wie er kann, versüßt. Der gesunde Mann aus dem Volke ist durch und durch wesentlich: leeres Gerede kennt er nicht. Wenn er spricht, wird es Hand und Fuß haben. Das macht zunächst der immer naheliegende Gegenstand, der seine tägliche Arbeit und deren Fehlschlagen oder Gelingen ist. Jedes Wort dieser Rede ist kraftvoll und vollgültig. Sie gestaltet die Sprache neu und in jedem Augenblick, weshalb schon Martin Luther sagt: »Man muß dem gemeinen Mann aufs Maul schauen, wenn man wissen will, was Sprache ist.« Sokrates sagt ungefähr dasselbe.
Das Speisen am wohlgedeckten Tische meiner Eltern in Nummer Drei verlor für längere Zeit seinen Reiz, als ich einmal bei Krauses gegessen hatte. Ich saß mit Krause, seiner Frau, Gustav und Ida sowie einem alten Knecht um den gescheuerten Tisch. In der Mitte stand eine große, braune, tiefe Schüssel aus Bunzlauer Ton, in die wir, jeder mit seiner Gabel, hineinlangten. Wir griffen zu den Zinnlöffeln, als nur noch Brühe darin vorhanden war. Messer und Teller gab es nicht.
Es ging bei dieser schlichten Bauernmahlzeit schweigsam und manierlich zu. Daß man mit vollem Munde nicht spricht, sollte sich ja von selbst verstehen. Es kommen dabei, selbst in hohen und höchsten Kreisen, Sprudeleien und andere unappetitliche Dinge vor. Trotzdem wir mit ausgestrecktem Arm zulangen und den Bissen durch die Luft führen mußten, ehe wir ihn in den Mund steckten, wies die Tischplatte am Schluß keine Flecken auf. Was Frau Krause gekocht hatte, war ein Gemisch von Klößen und Sauerkraut in einer Brühe aus Schweinefleisch. Dieses Gericht war delikat. Niemals später genoß ich wiederum solches Sauerkraut. Es wurde von dem alten Knecht und von Krause, nachdem sie bedachtsam die Gabel darin gedreht und so die langen, dünnen Fäden wie auf einen Wocken gewickelt hatten, aus der Tunke herausgeholt. Daß sie dieselbe Gabel, die sie in den Mund gesteckt hatten, wieder in die gemeinsame Schüssel tauchten, fiel mir nicht auf. Die langsame Sorgfalt des Vorgangs ließ den Gedanken an etwas Unappetitliches gar nicht aufkommen.
Tischgebete sprach man bei den Mahlzeiten des Fuhrherrn nicht. Aber die ganze Prozedur dieser gelassenen Nahrungsaufnahme, bei der niemand, auch nicht die Kinder, im geringsten Ungeduld, Hast oder Gier zeigte, war feierlich. Sie war beinahe selbst ein Gebet. Hier wußte man, was das tägliche Brot bedeutete, und der Instinkt entschied, welche Würde ihm zuzusprechen war.
Übrigens war durch die schwere, sommersprossige Hand und den heraklischen Arm des Fuhrherrn der Rhythmus dieses Familienmahles angezeigt. Niemand hatte sich unterfangen und seine Gabel oder den Löffel, während er es einmal tat, zweimal in die Schüssel getaucht.
Fuhrmann Krause war eine Art Spediteur. Der Transport des Brunnenversandes zur Bahnstation lag in seiner Hand. Ebenso holte er regelmäßig mit seinem Omnibus von ebender Bahnstation Freiburg die ankommenden Fremden ab und brachte dorthin die Abreisenden. Der Omnibus, wenn er nicht unterwegs war, stand in unserm Hof, wo seine Polster geklopft, seine Achsen geschmiert und das ganze Monstrum mehrmals die Woche von oben bis unten geputzt und gewaschen wurde. Das Klirren der hölzernen Eimer mit den eisernen Tragbogen, das Lärmen der Pferdeknechte machte die Musik dazu.
Ich denke dabei an die Sommerzeit, wo ich überall und nirgend zu Hause war. Die kurze Schulzeit ausgenommen, trieb ich mich in den Ställen zwischen den Pferden, in der Kutscherstube, im Hintergarten, vielfach auch auf den flachen, bemoosten Dächern der Saalbauten herum.
Fast nie erfüllte ich das Gebot meines Vaters: ohne Kopfbedeckung nicht auszugehen. Da ich also, ungehorsam, immer mit bloßem Kopfe herumrannte, vermied ich nach Möglichkeit, von meinem Vater gesehen zu werden. Auch setzte er gewiß nicht voraus, bis zu welchem Grade ich mich in die Gepflogenheiten der Straßenjungen einleben würde. Ich fing zum Beispiel, mit ihnen in einem Rudel vereint, den Omnibus, wenn er von der Bahn kam, vor dem Ziele ab und verfolgte ihn, ebenfalls mitten im Rudel, gehüllt in eine dichte Staubwolke. Der Zweck war, den anlangenden Kurgästen Handgepäck zu entreißen, um es gegen Entgelt hinter ihnen drein in das Logis zu schleppen. Ich habe das nur einmal getan, denn die Behandlung, die ich dabei erfuhr, die Last, die ich zu tragen hatte, und die Entlohnung durch einen Kupferdreier, den ich empfing, all das war angetan, mich von dieser Art Broterwerb abzubringen.
Fünftes Kapitel
Der Gasthof hatte im Winter etwas Vergeistertes. Das Leben seiner sommerlichen Daseinsform durchspensterte seine winterliche. Die Korridore, die einzelnen Logierzimmer, die Säle, die Küche, die Waschküche waren von den Schatten der Gestalten belebt, die im Sommer darin gehaust hatten. Manchmal, etwa wenn nächtlicher Novembersturm das Haus umbrauste, stand ich plötzlich wie angewurzelt in einem der ausgestorbenen, finsteren Flure still, weil, wie in einem hellen Blitz, das Sommerleben des Hauses auflärmte: Wagengerumpel, Eimergeklirr, Kinder- und Kutschergeschrei im Hof, in den Sälen Tellergeklapper und dumpfes Gesumm, Menschengewimmel auf der Straße, polnische Juden mit Pajes und Rockelor, Lärm, Lärm und wieder Lärm! Alles nur einen Augenblick: dann heulte Finsternis um die Mauern.
Wie furchtsame Schafe drängten wir Kinder uns zusammen: wir hatten etwa in Numero Neun ein fürchterliches Husten gehört. Es war das Logierzimmer, in dem ein Lungenkranker vor Jahren gestorben war. Oder von irgendeiner leeren Stube aus wurde nachts die Schelle gezogen: Furcht und Grausen schüttelte uns. Solche Vorfälle wurden meist nicht aufgeklärt.
Mein Vater liebte Nachtlichte. Ein solches kleines, knisterndes Lichtwesen, das auf einer Ölschicht in einem Glas Wasser schwamm, hatte die trostlose Aufgabe, den Weg durch den eisigen Kleinen Saal zur Privatküche sichtbar zu machen. »Gerhart, geh doch mal! Gerhart, hole doch mal!« hieß es in den behaglich durchheizten Wohnzimmern. Dann mußte ich wohl oder übel in den Bereich des Nachtlichts hinaus, der hohen Fenster, erblindet durch Eisblumen, des Saals mit den frierenden Rembrandtbildern an der Wand, mußte mir Mut machen, mußte hindurchjagen, mußte durch die leere Hotelküche, die nach rostigem Eisen roch und wo der Wind Häufchen Schnee auf den kalten Herdplatten jagte, drehte und wirbelte.
Aber wir wären nicht Kinder gewesen, wenn nicht der Kobold in uns auch dieser Drangsal eine lustige Seite abgewonnen hätte. Meine Schwester Johanna ging uns hierin voran. Es handelte sich um das von Kindern so gern geübte Erschrecken. Einer von uns überwand seine Furcht und versteckte sich in der Finsternis. Kam der Beauftragte dann in Sicht, etwa langsam oder furchtsam vorschreitend, so schlug der Versteckte wohl mit einem Stock auf ein Möbelstück, was der Furchtsame mit einem Schrei und Flucht beantwortete. Oder der Beauftragte flog wie gehetzt von Eingangstür zu Ausgangstür, und diese wurde von außen zugehalten. Er rannte zurück, fand, daß auch die Eingangstür verriegelt war, und sah sich den grinsenden Bilddämonen an der Wand und allen möglichen Ängsten preisgegeben.
Fast möchte ich es als Glück meiner Jugend bezeichnen, daß sich unser Dasein nur im Winter zu einem echten Familienleben einengte: im Sommer trat an seine Stelle für mich eine überaus glänzende Vielfalt immerwährender Festlichkeit.
In der zweiten Hälfte des Monats April zogen Hausdiener und Zimmermädchen auf. Das große Reinemachen begann. Die hohen Glastüren des Großen Saals, durch die man eine Terrasse betrat, wurden weit aufgesperrt, desgleichen die Fenster des Kleinen Saals und aller Logierzimmer. Man trug die Matratzen an regenfreien Tagen vor das Haus, wo alsbald Schleußerinnen und Hausknechte unter lauten Späßen und Gelächter die Ausklopfer schwangen. Der ganze Ort widerhallte davon. Es wurden dabei manche Namen gerufen von Leuten, die nicht durchaus beliebt waren, wodurch die Schläge schneller und kräftiger niederknallten.
Des Ungeziefers wegen wurden inzwischen die Fugen der Bettstellen mit Petroleum abgepinselt. In den Fenstern standen die Mädchen halsbrecherisch, wuschen die Scheiben und rieben sie trocken. Oder der Schrubber herrschte, und die Dielen schwammen in schmutzigem Wasser. Überall roch es nach Seife und nassen Hadern, und die milden Lüfte des Frühlings drangen ins innerste Innere des Hauses ein.
Ich empfand dies alles als etwas Beglückendes, wälzte mich auf den Matratzen herum oder berauschte mich zwischen den allerlei Polstermöbeln, die man ebenfalls, um sie auszuklopfen, in den vorderen Ziergarten gebracht hatte. Der Reiz des Ungewöhnlichen, Sessel und Sofas zwischen Gartenbeeten zu finden, versetzte mich in Begeisterung.
Eines Tages hatte dann der Gasthof zur Preußischen Krone zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückgefunden. Die Lungen seiner Fenster bewirkten gesundes Ein- und Ausatmen. Durch seine hellen, wiederum sehenden Augen ergoß sich Licht und spülte aus allen Winkeln die Finsternis. Die Zimmer glänzten vor Wohnlichkeit. Die Kerzen in den silbernen Leuchtern trugen frische Manschetten. Von Kellnern wurden Gläser geputzt. Frau Riedl, genannt die Mamsell, war eingetroffen. Sie hatte hinter einem Büfett vor der Küche ihren Stand, um, wenn es so weit war, die Speisen von dort den Kellnern weiterzureichen. Die Küche, in die nun der Koch eingezogen war, erschien heiter, hell und gar nicht mehr fürchterlich. Lorbeer, Palme, Zypresse und Feigenbaum, alles in Kübeln, schmückten die Außenwand und so die Terrasse vor dem Großen Saal. Die Vögel lärmten in den Anlagen. Einige gedeckte Tische waren im Garten aufgestellt.
Krause wusch seinen Omnibus, während um ihn die Schwalben schrillten, die in den Ställen und Unterm Saal zu Neste trugen. Sandberg stand vor der offenen Ladentür und weidete sich an seinem Schaufenster, in dem er die Schnittwaren neu geordnet hatte. Im Eingangsraum des Gasthofes hatte ein Bijouteriehändler seine Auslage.
So war die Krone aus ihrem Winterschlaf erwacht, hatte ihre Wiedergeburt, ja ihre Auferstehung gefeiert, sich gewaschen, geputzt und Festkleider angelegt. Und nun mußten die Kurgäste kommen, die den Vorteil von alledem haben und bringen sollten. Denn die alte Krone war nicht nur eine Glucke, die winters ihre Flügel über uns hielt, sondern sie legte auch goldene Eier.
Eine Persönlichkeit, die immer wieder besonderen Eindruck machte, war der jeweilige Koch. Man nannte ihn allgemein den Chef. Ein solcher Chef nahm mich, solange ich klein genug dazu war, sooft er konnte, auf den Arm, und ein Name, den er mir gab, Pflaumenfritze, ist mir in Erinnerung. Er trug mich nämlich jedesmal in die Speisekammer und ließ mich in einen Sack gedörrter Pflaumen hineinlangen.
Ein andrer Koch, ein junger Mensch, der mich ebenfalls auf den Arm genommen hatte, ist mir erinnerlich und ein niedlicher Vorgang, der die ganze Küche erheiterte: der lustige Chef nahm mit den Fingern frisch gekochte Spargel von einer Platte, tauchte die Spitzen in Butter und ließ sie mich abbeißen, der übriggebliebene Stengel flog zum offenen Fenster hinaus.
Frau Milo hieß eine Kochköchin, die neben dem Chef wirkte. Auch sie nahm mich eines Tages – etwa dreijährig mochte ich gewesen sein – auf den Arm. Da fiel mir auf, daß irgend etwas an ihr befremdlich hervorragte. Ich hatte den Begriff einer weiblichen Brust noch nicht, so klopfte ich mit der Hand auf den unbegreiflichen Gegenstand und stellte die Frage, was das wäre, worauf die ganze Küche vor Lachen fast außer sich geriet und Frau Milo dunkelrot im Gesicht wurde.
Vom Arme irgend jemandes aus sah ich zum erstenmal die wohlgeordnete Speisekammer vom Dachrödenshof. Das war ein benachbartes Haus, das mein Großvater Straehler, der Brunneninspektor, gebaut hatte und in dem er mit zwei unverheirateten Töchtern wohnte.
Das Interesse der Köche und ähnlicher kinderlieber Menschen setzte aus, als ich älter geworden war und zur Schule ging. Es wäre mir auch nur lästig gewesen.
Ein Wildling wie ich fürchtete Zwang von allen Erwachsenen. Wo ich nur konnte, mied ich sie. Die bloße Berührung durch einen von ihnen war mir unleidlich.
Sechstes Kapitel
Den Zwang und Kerker der Schule konnte man freilich nicht ausschalten.
Im Winter war der Schulweg bis auf Prügeleien und Schneeballschlachten ohne Belang. Im Sommer wurde er dadurch gewürzt, daß wir am geöffneten Kurtheater vorbei mußten. Es war ein Holzbau, äußerlich eine verwitterte Bretterbaracke, die mein Großvater, wie auch Brunnen- und Elisenhalle, Annaturm und anderes, durch seinen Freund und Maler-Architekten Josef Friedrich Raabe, der zu Goethe in engen Beziehungen stand, hatte errichten lassen. Wenn wir zur Schule gingen, waren meist Proben, und vor den Eingängen standen die Schauspieler. Was im Theater selbst vorgehen mochte, blieb uns Kindern lange ein Mysterium; um so wilder wucherten die Gerüchte. Einst wurde mir ein Jüngling gezeigt, der heute sein Benefiz hatte. Was sollte das sein: Benefiz? Etwas Furchtbares sicherlich. Ohne es zu ahnen, kamen wir der altgriechischen Ritualbühne und den Gepflogenheiten des römischen Kolosseums in unsren Gedanken sehr nahe, denn uns war der Jüngling todgeweiht. Es hieß, er müsse am Abend zum Schluß des Stückes sich selber erstechen, oder er werde hingerichtet.
Diese Sache erschien mir selbstverständlich. Von einem flüchtigen Gruseln abgesehen, nahm ich sie hin, als ob man gesagt hätte, morgen werden uns in der Schule Bibelsprüche abgehört.
Der alte Lehrer Brendel, der seine Fingerkniebel gewöhnlich auf die erste Schulbank stützte und darum eine dicke Hornhaut auf ihnen hatte, war der fleischgewordene Zorn. Zorn war Anfang, Mitte und Ende seines Unterrichts. Er würde sich nichts vergeben haben, wenn er unversehens einmal gelacht hätte. Als er gelegentlich mit seinem gelben Rohrstock, um einen Schüler abzustrafen, in die Bank langte, erhielt ich, nicht der Gemeinte, den wuchtigen Schlag, worauf er denn doch betretene Worte stammelte.
Am Schluß der Stunde sang man: »Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen!« Wir setzten stillschweigend hinzu: dafür, daß die Schule zu Ende ist. Nie jauchzte ein tiefer gefühlter Dank zum Himmel. Mit dem letzten Ton brausten wir auf die Straße.
Daß wir in den Kurgästen und in ihren wohlgekleideten, wohlgeputzten Kindern höhere Wesen sehen mußten, war eine Unvermeidlichkeit: kamen sie doch aus Hamburg, Bremen, Berlin, Danzig, ja aus Sankt Petersburg oder Warschau, Städten, von denen ich wenig wußte, deren Namen jedoch wie Sonnen glänzten. Es waren durchaus nicht nur Lungenkranke, die Salzbrunn aufsuchten, wenn auch der hustende, krächzende, Schleim auswerfende Schwindsuchtskandidat zum Bilde des Bades gehörte. Er bewegte sich aber in den Wogen einer ihn nicht beachtenden, heiterbunten Lebewelt, die sich auf der Brunnenpromenade und in der dorischen Tempelhalle täglich mehrmals zusammenfand. Man übte damals noch eine selbstverständliche Duldsamkeit. Der Gesunde, der Leicht-, der Schwererkrankte wurden überall und so auch in der Preußischen Krone unbedenklich und wahllos aufgenommen.
Wie gesagt, die Fremden waren uns Kindern Halbgötter. Um ihretwillen wurden Berge von Fleisch verarbeitet, Frachtkisten mit Seefisch kamen, die besten Gemüse wurden für sie geputzt, die auserlesensten Früchte verarbeitet. Im Innern des Brunnenhofes, eines Logierhauses, das zum Bade gehörte und das mein Vater gepachtet hatte, war ein großes Steinbassin, aus dem man jederzeit mit dem Netz lebende Bachforellen fischen konnte. Daß des Abends Champagnerpfropfen im Saale knallten, war keine Seltenheit.
Alles dies ward von den Fremden beansprucht und, was mehr ist, von ihnen bezahlt. Sie kamen und lebten aus vollen Säckeln. So habe ich wohl sicherlich den Begriff von Geld und Geldeswert schon um jene Zeit gehabt und gewußt, daß es darauf ankam, möglichst viel davon in den Kassenbehältern des Gasthofs zurückzubehalten.
In Beziehung auf die Kinder von Kurgästen kommt mir ein sehr frühes Erlebnis mit Carl in Erinnerung. Man hatte im Vordergarten einen Baum gefällt, der kahle Stamm lag auf der Erde. Eng aneinander gequetscht wie Sperlinge, hatten wir Kleinen darauf Platz genommen. Vornan, allerdings hinter einem weißgekleideten Mägdlein mit bunten Bändern im offenen Haar, das er aus irgendeinem Grunde von rückwärts umarmt halten mußte, saß Carl. Ich kam zuletzt als der Kleinste der Kleinen. Meine Ohnmacht brannte vor Scham und Eifersucht, mein Elend aber war darum so groß, weil ich meine Gefühle verschweigen mußte. Ich erkannte deutlich die Lächerlichkeit, der ich Knirps sonst verfallen wäre.
Wir hatten anfänglich nicht die gleiche Schulzeit, Carl und ich, so machte jeder den Schulweg allein. Später, als ich in seine Klasse aufstieg, legten wir ihn gemeinsam zurück. Ich erkläre es mir als naiv-sadistischen Zug, daß mein Bruder mich manchmal hinten beim Kragen packte, wenn wir die Schule verlassen hatten, und mich, zu meiner Qual, wie einen Arretierten vor sich her nach Hause beförderte. Ich vermehrte dabei meine Leiden durch nutzlosen Widerstand.
Eines Tages auf dem Nachhausewege wurde mir Carls Betragen überaus wunderlich. Aus der Schule getreten, suchte er sogleich einen Ruheplatz, dann einen zweiten. Der Posthof, ein Kastanienhain, war mit hängenden Ketten zwischen niedrigen Granitpfeilern eingefaßt: Carl suchte auf einer der Ketten Ruhe. Dann kam die Straße mit mehreren Prellsteinen: er schleppte sich von Prellstein zu Prellstein fort. So sind wir allmählich nach Hause gelangt. Eine halbe Stunde später erfuhr ich, daß meinen Bruder eine schwere Krankheit befallen habe.
Die Mutter weinte und stellte sich den denkbar schlimmsten Ausgang vor. Der Vater war ernst: man müsse sich auf alles gefaßt machen, nur Gott könne wissen, ob wir Carl behalten würden oder nicht. Aber dennoch: er hoffe zu Gott.
Ich erlebte nun eine Reihe sorgenvoller Tage und auch Nächte mit, da ich zuweilen von meiner Schwester Johanna, als gelte es, von meinem Bruder Abschied zu nehmen, geweckt wurde oder auch von den Geräuschen erwachte, die, da eigentlich niemand im Hause schlief, die ganze Nacht nicht aufhörten. Mein Vater zog außer meinem Onkel, Doktor Straehler, noch einen älteren Arzt, Doktor Richter, ein ortsbekanntes Original, hinzu. Wenn mein Bruder die Krankheit – es handelte sich um eine Lungenentzündung – dann überstand, so retteten ihn, wie mein Vater wenigstens annahm, seine Ratschläge.
Tagelang verbrachte Carl im Zustand der Bewußtlosigkeit. Barbier Krause, ein zweiter Krause, zugleich Heilgehilfe, wie es damals üblich war, der seine Stube in einem kleinen Anbau schrägüber von der Schenkstube hatte, setzte Schröpfköpfe und operierte mit Blutegeln. Die Krankenstube betrat ich nicht.
Meine Schwester und meine Mutter müssen mich von dem, was dort geschah, unterrichtet haben. Der Kranke, von schrecklichen Phantasien geplagt, sah Reihen von Leichnamen, die unter dem Gasthof zur Krone bestattet waren. Als der brave Barbier ihm Schröpfköpfe setzte, rang er seine Hände zum Himmel, und indem er sich beklagte, in was für Hände er gefallen sei, gab er sich selbst die tragikomische Antwort: in Bierhände. Es kam die Krisis und damit der große und befreiende Augenblick, als plötzlich das Fieber gesunken war und Doktor Richter erklären konnte, die Gefahr sei nach Menschenermessen vorüber.
Es ist natürlich, daß meine Mutter mich unter Freudentränen in die Arme schloß. Aber auch mein Vater, von dem ich bis dahin ebensowenig glaubte, daß er lachen wie daß er weinen könne, nahm seine Brille ab und tupfte sich mit dem Tuche die Augen. Als man den Kranken, der mit seltsamer Klarheit seinen eigenen Zustand verfolgt hatte, von dem glücklichen Umschwung verständigte, ergriff ihn eine glückselige Erschütterung. Wir mußten alle zu ihm hineinkommen: »Vater, Vater, ich bin gerettet! Gerhart, denk doch, ich bin gerettet! Mutter, Mutter, ich bin gerettet! Hannchen, hörst du, ich bin gerettet!« wiederholte er, uns die Hände, so gut es gehen wollte, entgegenstreckend, in einem fort. Es hieß so viel: ich darf wieder bei euch bleiben.
Bei diesem Anlaß, der mich wohl zum erstenmal in ein andres als mein eignes Schicksal verwickelte, wurde mir deutlich, welche Fülle verborgener Liebe unter dem so gleichmäßig nüchternen Wesen eines Vaters, einer Mutter beschlossen liegen kann. Von diesen unsichtbaren Kräften und Verbundenheiten hatte ich bis dahin nichts gewußt. Fast befremdeten sie mich, als sie zutage traten, da sie scheinbar über mich hinweggingen, meinem Bruder und nicht mir galten. Und so wurde mir nicht ohne eine gelinde Bestürzung klar, daß mein Bruder nicht nur mein Bruder, sondern der Sohn meiner Eltern war und wie groß der Anteil werden konnte, den ich ihm von ihrer Liebe abtreten mußte.
Dieses Ereignis muß in die Zeiten der Familienenge gefallen sein, wo dann das leere und doch wohl einigermaßen öde Haus den verdüsternden Rahmen bildete. Fieberphantasien des Knaben fanden so auch in uns Gesunden geeignetsten Boden für ihr Fortwuchern, so die von den in langer Reihe unter den Fundamenten des Gasthofs zur Preußischen Krone eingesargten Toten. Noch bis in die Tage der Rekonvaleszenz hinein wollte Carls Glaube an dieses Gesicht nicht nachlassen, so daß man allen Ernstes erwog, der Sache durch Grabungen nachzugehen.
Siebentes Kapitel
Mein Großvater, wurde gesagt, war Bade- oder Brunneninspektor. Er war also gleichsam ein souveräner Herr des Kurbetriebes mit allen seinen vorhandenen Anstalten: voran dem Brunnen, seiner Bedienung, seinem Ausschank und seinem Versand, der Pflege der Elisenhalle und der Vermietung ihrer Verkaufsläden, dem Kursaal, seiner Verpachtung und seinem Betrieb, den gärtnerischen Anlagen der Promenaden und der Pflege des Parks, der Kurkapelle und dem Theater. Wo er nicht ganz befahl, war dennoch sein Einfluß maßgebend. Ich glaube, er besaß auf dem fürstlich-plessischen Kurgebiet sogar Polizeigewalt.
Alle diese eben genannten Betriebszweige charakterisieren den Badeort, und ich bin dankbar, in seiner reizvollen Verbindung von Kultur und Natur aufgewachsen zu sein.
Ich glaube nicht, daß ich immer ein liebenswürdiges Kind gewesen bin. Aber inwiefern ich mir die völlige Nichtbeachtung meines Großvaters zugezogen habe, weiß ich nicht. Wenn ich ihm, wie es wohl geschah, auf dem Wege vom Dachrödenshof zur Kurinspektion begegnete, war er entweder so stolz, gleichgültig oder in sich gekehrt, daß er meinen Gruß nicht erwidern konnte und nur kalt über mich hinwegblickte. Das gleiche geschah, wenn ich etwa auf der Promenade im Grase lag.
Hatte ich also für ihn nichts Anziehendes, so ebensowenig für seine ältelnden Töchter, Tante Auguste und Tante Elisabeth, die allerdings auch für mich nicht die geringste Anziehungskraft besaßen.
Ein Raum im Küchenbau war die Büfettstube. Sie hatte ein breites Fenster nach dem Hintergarten hinaus, wo immer Völker von Hühnern, Enten, Gänsen, ja Truthähnen – Schlachtvieh für die Tafel – herumliefen. Eine Eisenstange in Handhöhe, woran nachts die Läden verfestigt wurden, diente uns Kindern als Reck, an dem wir uns leicht über die Fensterbrüstung hinaus und von außen ins Zimmer zurückschwangen. Häßliche graue Tapeten, welche Steinquadern darstellen sollten, verunstalteten den modrig feuchten, dumpfen Raum, zumal sie da und dort ihre vergilbte und zerfressene Kehrseite zeigten und als Papierfetzen herabhingen.
Dieses versteckte Gemach ist aus meiner frühen Jugend nicht fortzudenken. Wäsche- und Weinschränke standen darin. Der Lärm der Kasserollen, Pfannen und Stimmen der Küche verband sich mit dem Gekräh und Gekoller der Hähne und Truthähne, Entengeschnatter und Gänsegegack. Hier fand ich des Sommers mein bißchen Essen, wenn ich es mir, meist unbeachtet im Lärm des Betriebs, an den Küchentüren erschlichen hatte.
Hier habe ich meinen würdigen Großvater in halblautem Gespräch mit meiner Mutter zuerst genauer ins Auge gefaßt. Der hochgewachsene alte Mann in einem langen, schwarzen Schoßrock hatte Zylinder und spanisches Rohr abgelegt und saß meiner Mutter am Tisch gegenüber. Sie redete flüsternd auf ihn ein, während er seinen Kaffee schlürfte.
Meine Mutter gefiel mir nicht, wenn sie so, was sich wiederholte, mit dem Alten im verborgenen verhandelte, zumal sie mich, seltsam entfremdet, als gehöre ich gar nicht zu ihr, fortschickte, wenn ich nur auftauchte.
Mein Vater – es war nach der Table d'hôte – hielt um diese Zeit seinen Mittagsschlaf, und ich hatte es im Gefühl, daß er von den hier geführten Gesprächen nichts wissen sollte.
Beklagte sich Mutter über ihn? Ähnliches muß ich vermutet haben, denn der Vorgang nahm mich gegen sie und mehr noch gegen den Alten ein. Nun erst begriff ich, daß er nicht nur mein Großvater, sondern auch zugleich der Vater meiner Mutter war. Ich erkannte, wie meine Mutter vor ihm sich demütigte und diese für mich autoritativste unter den Frauen vor ihm zum gehorsamen Kinde wurde. Gegen diese Erniedrigung meiner großen Allmutter empörte ich mich, zugleich bewegte mich Eifersucht, und endlich sah ich die Einheit von Vater und Mutter gefährdet: Gefühle, die sich, gelinde gesagt, in Abneigung gegen den Alten verwandelten. Woher hatte ich dieses instinkthafte Mißtrauen?
Ein immer wiederkehrendes Wort bei ihm war: »Der Fürst, der Fürst.« Er meinte den, dem das Bad gehörte, dessen Beamter und dessen Vertreter er war. Das Substantivum »der Fürst, der Fürst« war überhaupt im ganzen Ober-Salzbrunn das meist gebrauchte, und auch bei uns verging kein Tag, wo es nicht am Familientische gefallen wäre.
Eine Zarin von Rußland hatte die Heilquelle gebraucht, und mein Großvater mußte der hohen Dame alltäglich morgens und abends den Brunnen kredenzen. Bei festlichen Anlässen trug er die schöne Brillantnadel, die er zum Dank dafür erhalten hatte. Ich war wohl immerhin auf ihn stolz.
So bekam zwar nicht dieser Stolz, aber mein Begriff von dem ehernen Bau der Gesellschaft einen erschütterndern Stoß, als mich der Zufall zum Zeugen eines gewissen Vorgangs machte.
Wie täglich strich ich einmal wieder in den Anlagen um das Gebäude der Kurverwaltung herum und sah meines Großvaters stattlich hohe Gestalt hinter der Bürotür verschwinden. Er war versonnen an mir vorübergeschritten, auch diesmal, ohne mich zu beachten. Der ehrfurchtgebietende Greis wurde allseitig gegrüßt, auch von den Rollknechten, die eben dabei waren, schön gehobelte Brunnenkisten versandfertig auf Frachtwagen zu verstauen. Als der Ortsgewaltige aber ihren Blicken entschwunden war, ergingen sie sich in rohen Beschimpfungen, die ich auf ihn deuten mußte. Ich war noch zu klein, um mich einzumischen. Bei dem Gedanken der bloßen Möglichkeit einer solchen Gotteslästerung wäre mir das Herz stillgestanden, hier aber wurde sie auf eine rücksichtslos entehrende Art und Weise Wirklichkeit. Das Erlebte begrub ich in mir, weil mir war, die bloße Erwähnung mache mich mitschuldig.
Achtes Kapitel
Die Jahre bis zur Vollendung des zehnten sind Schöpfungsjahre in jedem Sinn, und sie enthalten Schöpfungstage. Das Kind ist in dieser Spanne Zeit sein eigener geistiger Schöpfer und Weltschöpfer. So war denn auch ich der Demiurg meiner selbst und der Welt.
Aber wie gesagt, sieben Tage genügten mir nicht, denn ich hatte deren bis zum Beginn des siebenten Jahres bereits zweitausendeinhundertneunzig nötig gehabt.
Die Sonne ging auf, und ein neuer Schöpfungstag meiner selbst und der Welt begann. Vielfach ging ich darin wie ein Künstler vor, der sich durch provisorische Formgebung dem vollendeten Ganzen annähert.
Die immer wiederkehrende Mahnung meines Vaters sowie meiner Mutter lautete: »Gerhart, träumere nicht!« oder: »Träume nicht!« Es betraf dies natürlich die Zeiten des Ausruhens, wenn mein Bewegungsdrang in der freien Luft nicht mehr weiterzutreiben war. In der Tat, ich versann mich bei jeder Gelegenheit, so daß man die Frage immer wieder mit Recht an mich richten konnte: »Komm zu dir! Wo bist du denn?!« Ich versann mich etwa, wenn ich vor der Zeit meines ersten Schulgangs, das Kinn in die Hände gestützt, am Fenster lag und auf den fernen Hochwald starrte, den heiligen Berg, hinter dem die Welt zu Ende war und von dessen Spitze aus man in den Himmel stieg. Dieser Berg und seine Bestimmung waren mir immer wieder anziehend. Wenn nicht ich selbst, so ist mein Geist von dort aus unzähligemal in den selbstgeschaffenen Himmel gestiegen und hat sich mit der Rätselfrage der Weltbegrenzung abgemüht.
Dabei erwog ich die menschliche und meine eigene Einsamkeit, die ich schon sehr früh erkannt habe. Die unbegreifliche Größe des Schicksals erfüllte mich, solange ich ihr nachhing, mit einer schauervollen Beklommenheit.
Ich fragte mich: Wie rettet man sich aus der eigenen Verlassenheit? Halte dich an Vater und Mutter! – Vater und Mutter teilen dieselbe Verlassenheit und Verlorenheit! – Wende dich an Bruder und Schwester, die Tausende und Tausende deiner Mitmenschen! Und nun gab ich die Antwort mir selber mit einem Bilde aus meiner bildgenährten Traumes- und Vorstellungswelt: die Gesamtheit der Menschen sah ich als Schiffbrüchige auf einer Eisscholle ausgesetzt, die von einer Sintflut umgeben war. Kinder in den frühesten Bewußtseinsjahren nach der Geburt fühlen vielleicht stärker als Erwachsene das Rätsel, in das sie versetzt worden sind, und bringen vielleicht von dort, wo sie kurze Zeit vorher noch gewesen sind, Ahnungen mit.