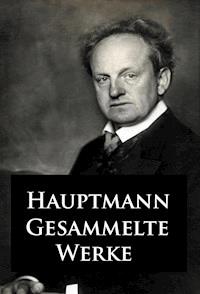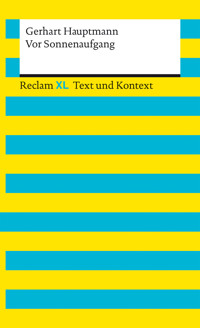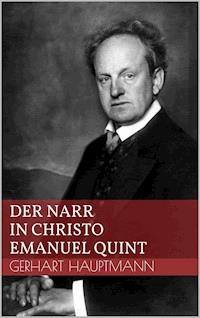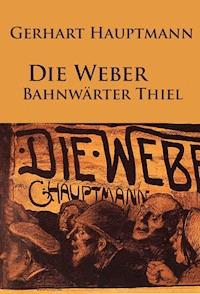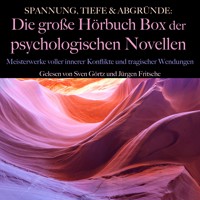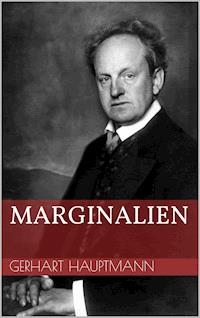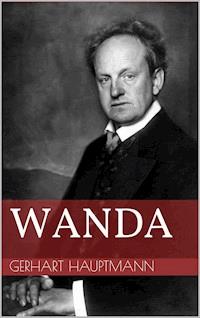Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerhart Johann Robert Hauptmann (geboren 15. November 1862 in Ober Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) in Schlesien; gestorben 6. Juni 1946 in Agnetendorf (Agnieszków) in Schlesien) war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Er gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Um Volk und Geist
Die Sendung des DramatikersWalter LeistikowKunst und JugendIn der Concordia zu WienKunst und WissenschaftOtto BrahmDer Sinn des NobelpreisesAbschied von Paul SchlentherOffener Brief an den Kongress der Alliierten in ParisRichard DehmelFür die GrenzlandsdeutschenDeutsche EinheitFür ein deutsches OberschlesienDeutsche WiedergeburtGoethe und die VolksseeleWalther RathenauDie denkende HandDeutschland – VaterlandAn die SchuljugendDer Glaube an DeutschlandDank an BunzlauDer Weg zur HumanitätMißverstehen und Verstehen im GeistigenDank an die deutschen SchauspielerDer Sinn geistiger EhrungHuldigung an das BuchShakespeare-Tagung in BochumDem Andenken Carl HauptmannsDer Baum von GallowayshireAbschied von HeidelbergGoethe auf dem TheaterGenerationenGruß an die SteiermarkDie Berliner VolksbühneVon den Möglichkeiten des TheatersWilhelm BölscheGruß an die Berliner KünstlerSursum corda!Das Theater wird bestehen!Neue und alte WeltDie Epopöe von der Eroberung AmerikasEröffnung der Gerhart-Hauptmann-Ausstellung in New YorkGoetheBei der Heimkehr aus AmerikaSonne, Luft und Haus für Alle!Die Wilhelm-Meister-SchuleDankworteDer Geist der KulturEröffnung der Gerhart-Hauptmann-Ausstellung in BreslauKunst ist ReligionDank an das SchicksalDer Brunnen des LebensRede in DüsseldorfDas Drama im geistigen Leben der VölkerAn die Deutschen in ÜberseeAbschied von Oskar LoerkeImpressumDie Sendung des Dramatikers
Ansprache auf dem Bankett der Wiener Akademie der Wissenschaften, im März 1905.
Sie haben mir durch eine Reihe von Jahren die herzliche Gesinnung bewahrt. Ich bin dessen froh und danke Ihnen. Ich frage mich nicht, ob ich diese Gesinnung verdiene; denn das hieße soviel als meine Gastfreunde kritisieren. Aber ich bin mir bewußt, nur einer unter vielen zu sein, die das Gute erstreben und nach Maßgabe ihrer Kräfte verwirklichen. Sie wissen, daß ich kein Redner bin. Leute, die sich ein Urteil zuschreiben, sagen: auch kein Dramatiker! Nun, habe ich nicht die Vorzüge dieses hohen, in Betrachtung der Menschheit vielleicht objektivsten Berufs, so habe ich jedenfalls seine Schwächen, und eine der Schwächen ist das Unvermögen, aus der Polyphonie meines Geistes eine Stimme gesondert sprechen zu lassen, und wenn es auch meine eigene wäre! Wie es heute ist, war es ehemals: es meldeten sich in meinem Innern stets viele Stimmen zum Wort, und ich sah keine andere Möglichkeit, einigermaßen Ordnung zu schaffen, als vielstimmige Sätze: Dramen zu schreiben. Ich werde dies weiter tun müssen; denn es ist bis jetzt meine höchste geistige Lebens- und Ausdrucksform. Allein im Reden muß ich mich kurz fassen. Ich sehe den Staatsmann, den Gelehrten, den Künstler auf einem menschlich rein geselligen Boden vereint. Es liegt darin ein schönes Symbol, dessen Bedeutung in diesem Kreise ohne weiteres empfunden wird. Alles Streben auf Erden ist eine Art Dunkeladaptation. Wissenschaft und Kunst, die beiden Geschwister und wahrhaftigen Kinder der Kultur, besitzen in einer gesteigerten Form diese Fähigkeit, und über alles hinaus wohnt ihnen ein Gefühl des Erhabenen inne, eine Ahnung von überirdischem Licht oder überirdischer Harmonie, die – jetzt das Unzulängliche – einst doch Ereignis wird. Wie wir, von freundlichen und von furchtbaren Rätseln umgeben, doch sicher wandeln, möge uns das Vertrauen erhalten bleiben zu unbegreiflich herrlichen Zielen, wie es den Forscher und Künstler bei seiner Arbeit leitet, und möge es uns nicht nur in dieser gegenwärtigen Stunde verbinden. So erhebe ich mein Glas, erhebe es auf das Gedeihen der Wissenschaft und der Kunst, auf das Wohl meiner hohen Gastgeberin, der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, und auf das Wohl ihres allverehrten Herrn Präsidenten!
Walter Leistikow
Rede, gehalten an Walter Leistikows Bahre am 30.Juli 1908.
Die tieftrauernden Freunde Walter Leistikows haben mich für würdig erachtet, dem Schmerz Ausdruck zu geben, der uns alle vor dieser Bahre bewegt. Aber der Größe des Schmerzes entspricht nur selten sein Ausdrucksvermögen, und was mich betrifft: ich darf mich der Einsicht nicht verschließen, daß ich zu denen gehöre, die echter Schmerz nicht beredter macht. Ich verliere an Walter Leistikow einen Freund. Einen Freund verlieren heißt ein Stück Welt verlieren. Diejenigen unter uns, die erfahren haben, was Freundschaft ist, werden wissen, bis zu welchem Grade sich das Leben durch Freundschaft bereichern kann und wie sehr es mit dem Verlust von Freunden verarmt. Was jemand als Freund gewesen ist und was ihm Freunde waren, das macht einen Teil seines edelsten Wertes aus. Wer wollte nicht wünschen, daß der letzte Liebesdienst dieser Erde ihm durch Freunde geleistet werde? Und deshalb stehe ich hier, weil es nicht angeht, sich einem solchen Liebesdienst zu entziehen, und spreche mit lauten Worten vor vielen, was ich sonst nur im geheimen Zwiegespräch mit dem toten Freunde verhandeln würde. Aber eigentlich sage ich das Beste auch in dieser schweren Stunde nur ihm insgeheim, und zwar liegt dies Beste unterhalb meiner Worte. Möchte auch in uns allen das am stärksten klingen, was unterhalb aller Worte ist! Wir sind diesem Toten nicht so fern, wie es scheint, und eigentlich ist in einem tieferen Sinne kein Band zerrissen. Das schwere Gewölk, in dem wir stehen, vereinigt uns: es ist das gleiche große Menschenschicksal, dem wir alle verfallen sind, das gleiche große Todesmysterium, das meiner Meinung nach eine Ergänzung des Lebens ist und dem wir alle entgegenreifen. Ich bin mir bewußt, unergründliche Dinge zu streifen, aber es ist mir nicht anders zumute, als ob die Foltertragik dieses in seinen letzten Jahren so schweren Erdenschicksals in der erhabenen Tragik des Todes wohltätig ausgelöscht worden wäre. Nicht nur wir, die wir dem alten Walter nahestanden, haben erkennen müssen, wie auserlesen als Mensch und Freund er gewesen ist. Die Frucht seines Wirkens gehört dem gebildeten Teil unserer Nation. Wenn es erlaubt ist, im Gleichnis zu reden, so möchte ich sagen, daß seine Künstlerseele etwa dem ruhigen Spiegel eines märkischen Sees glich, der die ganze Melancholie unserer märkischen Heimat widerspiegelt. Die Liebe gerade zu dieser Natur drückt den schlichten und ernsten Grundgehalt der Persönlichkeit unseres toten Freundes aus: ein Grundgehalt, der ihn zu Werken befähigte, die wir kennen und die ein edler Besitz unseres Volkes geworden sind. Solange Berlin, die gefährliche Riesenstadt, sich nicht selbst vergißt, wird es auch des Mannes nicht vergessen, der die düstere Kraft, Anmut und Monotonie seines breiten Wälder- und Seengürtels wie kein anderer geliebt und den Sinnen erschlossen hat. Mitten im Kampfe stehend, und vielfach im lauten Kriegsgeschrei, blieb die besondere Kunst Walter Leistikows unberührt. Sie war phrasenlos. Sie strömte, ähnlich der schlichten Daseinskraft der Natur, die abgeklärteste Ruhe aus. Äußere Kämpfe, innere Leidenschaften und Leiden des Meisters und Menschen drangen in ihr Gehege nicht, diesen stillen und weltfernen Garten, das Ursprungsgebiet aller großen Kunst, das auch ihr Boden gewesen ist. Und nun, du lieber, durchgeprobter Mensch, Künstler, Kamerad und Freund, lebe wohl! In einem anderen und doch verwandten Sinne wartet nun deiner ein weltferner Garten. Unsere Gedanken, unsere Herzen, unsere Liebe, unsere Dankbarkeit folgen dir auch in diesen weltfernen Garten der Stille nach.
Kunst und Jugend
Rede, gehalten beim Bankett am 15. November 1912 zu Berlin.
Sie sind gekommen, um mit mir meinen fünfzigsten Geburtstag zu feiern. Ich danke Ihnen dafür und danke für die Begrüßung, die mir soeben zuteil geworden ist. Ich freue mich von Herzen aller der guten Gesinnungen, die Sie mir entgegenbringen, ohne mir die dankbare Empfindung meiner Seele durch die Frage trüben zu lassen, inwieweit ich dies alles verdient habe. Die meisten unter uns sind ebenso reich an Verdiensten wie ich; denn sie haben, so wie ich, getan, was sie zu tun schuldig gewesen sind.
Aber solche Ereignisse haben über das Persönliche hinaus etwas Bedeutsames. Indem Sie sich hier versammeln, haben Sie eine Bilanz aufgestellt und wollen zum Ausdruck bringen, daß unser aller Wirken innerhalb der letzten fünfundzwanzig Jahre nicht nutzlos gewesen ist. Und Sie wollen ferner durch diese Manifestation auf den Wert künstlerischen Fortschritts auch für die Nation hinweisen. Eine solche Manifestation ist von Wichtigkeit.
Als ich vor fünfundzwanzig Jahren das erste jungdeutsche Drama auf die Bühne stellte, ahnten wir nicht, welch eine Entwicklung vor uns lag. Wir dürfen nicht sauertöpfisch sein und uns blind gegen alles das machen, was seither auf den Fluren deutscher Sprache und Dichtung entstanden ist. Damals schmolz eine Kruste von Eis, unter der die deutsche Dichtung begraben lag. Ich sage das, trotz der einzelnen großen Namen von reinstem Klang, deren Träger damals noch unter den Lebenden waren. Die Jugend fehlte; die Jugend kam und hat seitdem nicht aufgehört, immer wieder ihr Wort zu sprechen. Und da ohne sie nichts von einem schönen bleibenden Werte entsteht, ist das geblieben und nicht abhanden gekommen, was die Stunde von damals gebar und wodurch sie sich auszeichnete: nämlich jene Kraft, jener Ernst und jener Mut und jene Wahrhaftigkeit, ohne die eine wahrhaftige Kunst nicht zu denken ist.
Ich erinnere mich daran, als ich eines denkwürdigen Tages mit dem alten Henrik Ibsen wie mit einem wandelnden Turm die Friedrichstraße herunterging. Er hatte mein erstes Stück gelesen und sagte mir – ja, was sagte er mir? – nichts, als daß es tapfer und mutig sei. Ja, meine Damen und Herren, tapfer und mutig. Es liegt eine unerhörte Schönheit im geistigen Mut und in geistiger Tapferkeit. Wir hatten sie! Und wir hatten sie notwendig.
Sollte ich nun darauf eingehen, Ihnen zu sagen, wieso man sie hier in Deutschland ganz besonders notwendig hat? und welche Gegner sie notwendig machen? Damit finge ich ein Kapitel an, das sich zu Buch und Büchern auswachsen müßte: also lasse ich meine Hand davon. Die großen Emanationen der Kunst zerstören immer und überall das Gewohnheitsmäßige, und wir wissen alle, welchen Grad von Unantastbarkeit man vielfach jener Schimmelschicht der Gewohnheit zubilligt, die alles sanft-selig, ich möchte sagen, wie ein molliges Leichentuch überzieht.
Also Ernst und Mut, die uns niemals verlorengehen dürfen, sind uns bis heut nicht verlorengegangen. Daß ich einer solchen Überzeugung in diesem Augenblick Ausdruck geben darf, ist vielleicht meine stärkste Festfreude. Denn Deutschland ist in der Kunst nicht Amerika, das in Kunstdingen nichts eigentlich zu verlieren hat. Deutschland hat sehr viel in der Kunst zu verlieren. Und wir wissen, daß Stillstand in Sachen der Kunst Rückschritt ist! Also müssen wir mutig vorwärtsgehen. Nur eine kühne, lebendige Kunst der Gegenwart besitzt die Kunst der Vergangenheit. Kein anderes Feuer als das Feuer lebendiger Kunst hat die Kraft, in die dunklen Tiefen vergangener Kunst hinabzuleuchten und ihre ewigen Schätze zu entschleiern.
Zu diesem Zweck genügt der Kult der Gelehrtenstuben bei weitem nicht. Ich bin weit davon entfernt, seinen Wert und seine Bedeutung anzutasten. Aber was wäre ein Homer, ein Shakespeare, ein Goethe, der nur in Gelehrtenstuben und nirgend anders lebendig ist oder etwa nur in den Häusern von Sonderlingen?! Die Dokumente des großen Leidens menschlicher Ingenien, in einem immateriellen und doch gestalteten Stoffe ausgedrückt, müssen ins breite Leben zurückwirken. So veredeln, so erfüllen, so verinnerlichen sie dieses Leben und befruchten es und geben ihm wahrhaft Religion.
Zweifellos errege ich mit diesem letzten Satz in weiten Kreisen gewaltigen Widerspruch. Ich weiß sehr wohl, daß etwa ein evangelisch-lutherisches Theater nicht möglich ist und daß ich mit meiner Ansicht als Vertreter des Satans gelte. Aber das ist eine Köhlermeinung, die eine Sache ältesten Vorurteils und mangelnder Einsicht ist. Man nehme ein Senkblei und lasse es in die Werke Calderons oder Shakespeares hinab, und man wird vergeblich irdischen Grund suchen. Unter der Oberschicht von Gestalten und Bildern ruhen die Schauer der Ewigkeit, der Unendlichkeit. Der Dichter, wahrhaft durchdrungen vom Göttlichen, vom Hauch einer tiefen Erkenntnis berührt, ist zum Werkzeug göttlicher Bildkraft geworden und erfüllt eine köstliche, lebendige Mission, die ihn zum dogmenfreien Priester macht.
Meine Damen und Herren, meine lieben Freunde: Es lebe die dogmenfreie, die große Kunst, der wir alle nach Kräften dienen, es lebe der Geist, der zugleich das Heute, das Gestern und das Morgen lebendig macht, und es lebe die Jugend, die wach bleiben muß, um selber immer wieder die Welt, die oft müde Welt, aufzuwecken, und der das volle, ganze Erbe der Kunst immer wieder überantwortet ist!
In der Concordia zu Wien
Rede, gehalten in der Concordia zu Wien am 18. November 1912.
Ich stehe vor Ihnen in einer Beschämung, die es mir schwer macht, meinen Dank in Worte zu fassen. Sie sind zusammengetreten, um mich zu meinem fünfzigsten Geburtstag willkommen zu heißen, nachdem ich in dieser schönen Stadt oft willkommen gewesen bin. Den Jahren nach älter, als ich war, kam ich zuerst hierher, um die Weihe des Hauses zu empfangen, das gleichsam die Kaaba der Dramatiker ist. Damals schon empfand ich die eigentümliche Wärme des Lebens in dieser Stadt und ihre gleichsam festliche Luft. Ich kam und komme aus einem Lande, dessen Lebensformen kühlere sind, dessen Klima den Künstlern nicht immer ganz so günstig ist, daß sie nicht zeitweise wärmere Gegenden aufsuchen sollten oder daß etwa ein fernher dringender erwärmender Strahl unwillkommen sein sollte.
Es war ein solcher Strahl, und er kam von Wien, der mich aus einer Klammer von Eis löste, als mich die Nachricht traf, daß man mich des Preises für würdig hielt, der den Namen von Österreichs größtem Dichter trägt. Damals hatte ich gerade mit »Florian Geyer« vergeblich an die alte deutsche Volksseele appelliert. Diese Tatsache, verbunden mit anderen ebenso schmerzlichen, hatte mich bitter deprimiert, ja krank gemacht, und ich vermochte das Gift der Hoffnungslosigkeit, das mir ins Blut gedrungen war, nicht zu überwinden.
Niemals ist also ein Preis, eine Anerkennung so zur rechten Stunde gekommen wie damals mir der Grillparzer-Preis, den ich seitdem noch zweimal, und ich sage mit Stolz, im ganzen dreimal erhalten habe und der unlöslich mit meinem inneren Schicksal verwachsen ist. Der Dichter, der sich vom Streit der Meinungen umbrandet sieht, braucht von Zeit zu Zeit eine reine und runde Bestätigung. Man vergesse nicht, daß wir, in der breitesten Öffentlichkeit aufgestellt, lebenslang eine Art Freiwild bleiben. Erstlich gilt, und mit einem gewissen Recht, schon der Versuch, ein Kunstwerk zu schaffen, als Anmaßung. Die Verehrung des Großen aus der Vergangenheit blendet zuweilen das Auge, ja macht es für alles Neue kurzsichtig, besonders wenn das Neue im Werden ist. Niemals wurden über den zarten Keimen echter Kunst in rauhen Klimaten Glashäuser aufgerichtet. Aber auch starke Gewächse sieht man, besonders wenn sie neuartig sind, mitunter als unberechtigte Eindringlinge an und sucht die Gärten davon zu säubern. Man nenne mir einen Künstler, der zeit seines Lebens über das Mißtrauen seiner Mitmenschen völlig Sieger geworden ist, ja auch nur gegen das eigene Mißtrauen! Deshalb ist der Beruf des Dichters, und vor allem des dramatischen Dichters, wie ich aus eigener schwerer Erfahrung sagen kann, kein leichter Beruf, und deshalb war die Bestätigung, die ich in jeder Beziehung von Wien erfuhr, für mich eine so überaus segensreiche und wichtige.
Verehrte Herren! Illustre Versammlung! Sie haben mir zu meinem fünfzigsten Jahre die gleiche Wärme und Herzlichkeit bewahrt, die mir schon vor Jahrzehnten so nötig war, so heilsam und wohltätig mir entgegenschlug. Ihr Anteil an meinem Wirken und meiner Eigenart duldet keinen Verdacht. Im übrigen lassen wir alles beiseite, was auch nur im allergeringsten problematisch ist, und wenden uns dem zu, was sicher ist. Sicher ist, daß wir uns in der gleichen Liebe zur Kunst, in der gleichen Humanität zusammengefunden haben. Sicher ist, daß Sie diese Humanität meinem Wirken zugestehen, und sicher ist, daß mein Wirken von dieser Humanität durchdrungen ist. Somit, da ich eher alles andere als ein Redner bin, beschließe ich diesen meinen, ich möchte sagen, natürlichen und organischen Dank, indem ich ganz einfach meine reichen, natürlichen und organischen Beziehungen zu Ihnen und Wien nochmals herzlich betone. Ich erhebe mein Glas und leere es auf die Kunststadt Wien, die Stadt der dramatischen Kunst, die Stadt der Musik, die Stadt der Wissenschaften, die deutsche Stadt, die unvergleichliche Perle in der Krone Österreichs – und ich trinke auf die Stadt der Humanität und der Concordia, ja der Concordia als aller kulturellen Kräfte Pflegerin, auf die Concordia, die ich gerade in diesem Augenblick von ganzem Herzen fühle.
Kunst und Wissenschaft
Rede, gehalten in der Aula der Universität Leipzig am 23. November 1912.
Ich danke von ganzem Herzen für den mich hochehrenden Empfang in der Aula der alten und berühmten Universität Leipzig. Einen solchen Augenblick zu erleben hat mir nie geträumt, davon wurde mir nichts an der Wiege gesungen.
Und Ihnen, den jungen akademischen Bürgern, den Bürgern der Zukunft, danke ich, daß Sie mich in so feierlicher Weise eingeholt und mir alle die Ehren erwiesen haben, die deshalb so hoch stehen, weil sie aus den Herzen der Jugend hervorbrechen.
Auf einer Woge der Jugend, das heißt der Zukunft, haben Sie mich hier hereingespült, in den Saal und an einen Platz, der sonst nur berufenen Lehrern der Wissenschaft vorbehalten ist. Und hier stehe ich nun als einer, der nichts zu lehren und niemand zu belehren hat, und möchte Ihnen doch etwas sagen, was meinem Dank einen Inhalt gibt.
Wir wissen alle, wie die Wissenschaft zu ihrer Höhe gestiegen, zu ihren Triumphen gelangt ist und daß die deutschen Universitäten ihre vornehmsten Pflegestätten waren. Aber wir wissen wenig von der Pflege der Kunst. Die Künstler, die Dichter insonderheit, sind Gewächse, die an unerwarteter Stelle zu unerwarteter Blüte heranwachsen. Sollte ich etwas von mir selbst sagen, so wäre auch das Ungesuchte, das Unerwartete als das Bestimmende in meiner Entwicklung anzusprechen.
Ich stand auf mir selbst. Ich hatte mir meinen Weg, meine Lehrer zu suchen, die nichts von mir wußten und nur durch ihr losgelöstes Werk mich förderten. Und ich hatte mir aus den widersprechenden Tendenzen des künstlerischen Ringens der Zeit diejenigen herauszufinden, die allem künstlerischen Schaffen gemeinsam sind:
Es war die Treue gegen sich selbst und die Liebe zur Wahrheit.
Fällt man mit dieser Treue gegen sich selbst, so stand man doch ehrlich! Geht man an der Liebe zur Wahrheit zugrunde, so stirbt man einen ehrlichen Tod.
Schon neulich, in Berlin, sprach ich davon, was Henrik Ibsen mir einmal sagte, als er mein frühes Drama »Vor Sonnenaufgang« gelesen hatte: nämlich, daß es tapfer und mutig sei. Das schien ihm das größte Lob zu enthalten. Kommilitonen, er hatte recht! Zur Treue gegen sich selbst, zur Wahrheitsliebe gehört der Mut! Ohne den hohen Mut der Jugend vermögen wir nichts von Belang auszurichten.
Und hier begegnen sich, wie in so mancher anderen Beziehung, Kunst und Wissenschaft. Ich glaube bestimmt, daß die Männer der Wissenschaft ebenso wie die Männer der Kunst die Treue gegen sich selbst, die Liebe zur Wahrheit und den Mut nötig haben.
Es ist nicht mein Beruf, von dieser weihevollen Stätte aus ins Leben zu wirken. Wenn eine Wirkung aus meinem Dasein abzuleiten ist, so ist sie von meiner Kunst abzuleiten. Kunst ist das individuellste Bekenntnis, ist nichts weiter als der ein Leben ausfüllende, dauernde, spezifisch künstlerische Denkprozeß. Er gestaltet die eigene, auch fremde Seelen; andere, sozusagen greifbare Resultate zeitigt er nicht.
Die dramatische Kunst ist gleichsam auf einer produktiven Skepsis errichtet: sie bewegt Gestalten gegeneinander, von denen jede mit ihrer besonderen Art und Meinung voll berechtigt ist. Wo aber bleibt die gesuchte rechte Art und die rechte Meinung? – Sie werden finden, daß die Tragödie keineswegs eine richterliche oder gar Henkersprozedur, sondern eine Formel für das tiefste und schmerzensreichste Problem des Lebens ist. Die Formel für ein Problem, nichts weiter.
Die Wahrheitsliebe des Dramatikers prätendiert nicht die absolute Wahrheit, sondern sie respektiert das kühn erfaßte Mysterium.
Vielleicht berühren wir hier einen der Unterschiede von Kunst und Wissenschaft, die das Mysterium von den Dingen zu nehmen strebt, das wir als etwas Sakrosanktes bestehen lassen.
Es liegt gebettet in der reichen Welt der inneren und äußeren Sinnlichkeit.
Man hat gesagt, ich hätte mich in meiner Kunst zu sehr dem Kleinmenschlichen und dem Allgemeinmenschlichen zugewandt und zu wenig dem, was gerade dem Menschen unserer Tage am Herzen liegt. Nun, meine Herren, nicht nur in der Natur ist das Größte und Kleinste gleich staunenswert. Das Menschliche ist das Große und wird vom Geist der Zeit nicht so sehr variiert, daß die elementaren Dinge und Schicksale hinter die Variationen zurücktreten. So wird das Ewigkeitsschicksal der Menschen immer ein größeres Thema als das zerebral bewußte Schicksal einer Epoche sein.
Jeder Mensch, und auch jeder begabte Mensch, ist einmalig. Er geht nicht nur seinen eigenen Weg durch die Dunkelheit, sondern trägt auch seine eigene Laterne. Mögen andere bessere Wege einschlagen und die Welt anders beleuchten. Mir kommt es darauf an, ein möglichst phrasenloses, ein möglichst erlebtes Werk zurückzulassen.
Man wird deshalb nicht meinen, daß die Gedanken des Fortschritts mir gleichgültig sind und daß der bewegte geistige Inhalt meiner Epoche mich nicht bewegt. Lebe ich weiter, so hoffe ich, auch für diese ganze besondere Zeit eine, das heißt meine bescheidene, poetisch gestaltete Formel zu finden.
Eigentlich sucht der Dichter ja immer nicht Werke, sondern das Werk. Seine Sisyphusnatur zwingt ihn, jedesmal nach dem scheinbar vollendeten Werk neu anzufangen: anzufangen, als ob er noch nie etwas geschaffen hätte! anzufangen, als ob es gelte, nun erst das Stückwerk zu überwinden, das umfassende Ganze hervorzubringen. Das ist jenes gebenedeite Anfängertum, das produktive Naturen meistens auszeichnet.
Was heißt das im Grunde anders, als daß produktiven Naturen eine lange Jugend beschieden ist? Und in diesem Sinne sind sie der Jugend nahe, die den reichsten und vollsten Teil des Daseins bedeutet. Deshalb ist es ein gutes Zeichen für uns und tut uns wohl, wenn die Jugend uns sagt, daß sie uns versteht, daß ihr Pulsschlag mit unseren Werken geht und daß wir ihr nicht fern und fremd erscheinen. In einem solchen Bekenntnis finden wir unsere stärkste Bestätigung.
Liebe Jugend, illustre Versammlung! Ihre uralte, berühmte Universität hat mir bei ihrer Fünfhundertjahrfeier die Würde eines Doktors der Philosophie honoris causa und eines Magisters der Freien Künste verliehen: ein historischer Titel, der mir zuweilen in der Stille besondere Freude macht. – Es war die erste offizielle Ehrung, die mir auf dem Boden meines deutschen Vaterlandes zuteil wurde. Sie macht mich stolz, und ich bleibe erfüllt von Dankbarkeit. Heute haben Sie nicht mir, sondern der deutschen Dichtkunst einen Triumph bereitet. Möge das reiche Früchte tragen! Möchte, ich sage mit vollem Bewußtsein, im Volk der Dichter und Denker auch der Dichter sich wieder zu alter hoher Würde emporrichten! Möchten Dichter und Denker gemeinsam neue Inhalte schaffen, damit die schreckliche Leere nicht eindringe, die wie ein furchtbarer Abgrund die Küsten Europas, des reichen klassischen Erdteiles der Geisteskultur, dröhnend umgähnt!
Und nun, hochansehnliche Versammelte, räume ich diesen Platz, den Ihr Vertrauen mir einzunehmen gestattete. Möge die alte, herrliche Universität Leipzig, mit der ich so tief verbunden bin, sich weiter in die geistigen Geschicke Deutschlands fruchtbar auswirken, immer geliebt und getragen von großen Lehrern und einer Jugend wie dieser, die, Gott sei Dank, noch eine echte, deutsche Jugend ist.
Otto Brahm
Rede am Sarge Otto Brahms, gehalten am 1. Dezember 1912.
Der hier liegt, ist nicht der erste Freund, den ich verloren habe, nicht der erste ausgezeichnete Mensch, den die Welt verliert. Aber solche Verluste sind für die Zurückbleibenden Ereignisse von mysteriöser Tiefe, immer gleich überraschend, verwirrend und schmerzlich.
Indem ich hier rede, in Gegenwart eines Toten, der noch vor ganz kurzer Zeit eine volle und ganz lebendige Gegenwart war, bin ich wie jemand, dem ein Teil seines Wesens abgerissen wurde und dessen Wunde noch offen ist. Davon gebe ich Zeugnis. Ich sage es ganz einfach, ein wie wichtiger Teil meiner Seele mit diesem Manne verbunden war und durch sein Scheiden versehrt wurde. Wir waren verbunden durch eine verwandte Innerlichkeit und durch äußere Umstände. Das Werk dieses Mannes war zum Teil mein Werk, und mein Werk war zum Teil das Werk dieses Mannes.
Durch nahezu fünfundzwanzig Jahre hielten wir innerlich und äußerlich in dem wunderlichen Kriege dieses Lebens zusammen und kämpften für eine Sache, in der wir Schritt für Schritt Boden gewannen. Andere gleichwertige Kämpfer mit uns. Im Kampf verbunden, gab es etwas, das uns noch tiefer verband. Ich darf es nennen: das Ideal. Dieser Mensch, Mann und Freund war deutscher Idealist im reinsten Sinne. Wenn wir ein Bild für das Wesen einsetzen, so kann man von einer Standarte des Ideals sprechen, die er hochhielt. Ein solches Feldzeichen kann schwanken, ja sinken, ohne Unehre, sofern ihr Träger es festhält, das heißt nicht wegwirft. Der hier liegt, hat die Standarte festgehalten und niemals weggeworfen.
Die hier Versammelten kennen ihn. Ich habe nicht nötig, Beweis für mein Zeugnis beizubringen. Wir wissen, daß diesen tief wertvollen Mann die besondere deutsche Eigenschaft des Idealismus auszeichnete. Nicht eines vagen Idealismus, sondern eines festbegründeten, von Überlegung und Umsicht getragenen, eines mit Mut und Zähigkeit gepaarten Idealismus. Ich glaube nicht, daß in der Geschichte des deutschen Theaters eine solche Verbindung von praktischer Kraft und ideeller Kraft jemals vor ihm dagewesen ist. Er zwang das Theater zu einer ernsten, echten und lebendigen Kunst. Er brachte es dem Leben und ihm das Leben nahe in einer Weise, wie es bis dahin niemals geschehen ist. Und in Brahm verkörperte sich eine andere deutsche Eigenschaft: die oft gerühmte, weniger oft wirklich anzutreffende deutsche Treue. Nicht nur, daß er sie der Sache hielt, er hielt sie auch der Person. Das wissen alle, die ihn gekannt haben. Er nahm Schwächen in Kauf um der Treue willen, und er stützte Schwankende, Strauchelnde und Mutlose.
Sein Leben war kein leichter Dienst. Sein Beruf war schwer. Es mag Leute geben, die einen Kampf für die Würde des deutschen Theaters nicht für wichtig genug ansehen, um an seinen Ernst zu glauben. Es ist sein Verdienst, seine Wichtigkeit erkannt und seine Person dafür eingesetzt zu haben. Er belud sich deshalb mit Sorgen, Mühen und Aufgaben aller Art, unternahm Feldzüge, erlebte Siege und Niederlagen, Erfüllungen und Enttäuschungen, weit ab von dem Dasein, wie es der ruhige Bürger in Bequemlichkeit führen kann. Das Verantwortlichkeitsgefühl eines bedeutenden Staatsmannes, dem das Geschick seines Vaterlandes in die Hand gegeben ist, kann nicht größer sein. Er bedarf einer größeren Summe von Arbeit, Ausdauer, Umsicht und Tapferkeit.
Der Mann, der hier liegt, hat einen wahren Kulturkampf ritterlich durchgefochten. Er ehrte sich selbst durch diesen Kampf. Er mehrte den deutschen Kulturbesitz, und dieses Bewußtsein genügte ihm. Rücksicht auf andere, äußere Ehren kannte er nicht. Aber der König von Norwegen hat gerade darum diesen Ritter vom Geist, diesen Ritter vom deutschen Geist, zum Ritter des Sankt-Olaf-Ordens geschlagen.
Wir aber, wie ehren wir diesen Mann? Indem wir sein lebendiges Werk erhalten und fortsetzen: das Werk, dessen Bedeutsamkeit sich dem Betrachter immer tiefer und tiefer erschließt. Es hat auf einer gewissen Ebene die Einheit von Kunst und Volk zum Ereignis gemacht. Das Theater ist in ihm gleichsam zum Atmungsorgan der Volksseele geworden. Er gab dem Abseitigen, eigentlich Volks- und Weltfremden die schlichte Kraft einer naturnotwendigen Funktion.
Wir danken dir, lieber Brahm, für alles, was du so hingebungsvoll für deutsche Art und Kunst geleistet hast. Und ich danke dir für deine niemals schwankende Freundestreue. Ich sage dir ade, ade, du ausgezeichneter, treuer Mensch, Mann und Freund!
Der Sinn des Nobelpreises
Rede, gehalten beim Nobelpreis-Bankett zu Stockholm am 10. Dezember 1912.
Als Empfänger des diesjährigen Nobelpreises für Literatur danke ich Ihnen für die auch mich betreffenden warmen und freundlichen Worte. Sie dürfen gewiß sein, daß ich, und mit mir meine Nation, die mir widerfahrene Ehre von Grund aus zu würdigen weiß. Der Nobeltag ist eine Kulturangelegenheit des ganzen Erdballs geworden, und der großartige Stifter hat seinen Namen für unabsehbare Zeiten mit dem Geistesleben aller Nationen verknüpft. Bedeutende Menschen aller Zonen werden so wie heute noch in fernen Zeiten den Namen Nobel mit ähnlichen Empfindungen aussprechen wie Menschen früherer Zeit den eines Schutzpatrons, des hilfreiche Kraft nicht zu bezweifeln ist, und seine Denkmünze wird in Familien aller Völker von Geschlecht zu Geschlecht fortgeerbt und in Ehren gehalten werden. Es kann nicht anders sein, als daß ich hier dem großen Donator den sich immer erneuernden Tribut des Respekts darbringe. Und nach ihm der ganzen schwedischen Nation, die diesen Mann hervorgebracht und die sein humanitäres Vermächtnis so treu verwaltet. Und hierbei gedenke ich jener Männer, deren aufopfernde Lynkeusarbeit über den Kulturländereien der Erde zu wachen berufen ist, damit gute Keime genährt, das Unkraut gemindert werde. Ich danke Ihnen und wünsche, daß Sie in der segensreichsten aller Tätigkeiten nie erlahmen und nie wahrhaft reicher Ernte ermangeln mögen. Und nun trinke ich darauf, daß das der Stiftung zugrunde liegende Ideal seiner Verwirklichung immer näher geführt werde: ich meine das Ideal des Weltfriedens, das ja die letzten Ideale der Wissenschaft und der Kunst in sich schließt. Die dem Kriege dienende Kunst und Wissenschaft ist nicht die letzte und echte, die echte und letzte ist die, die der Friede gebiert und die den Frieden gebiert. Und ich trinke auf den großen, letzten und rein ideellen Nobelpreis, den die Menschheit sich dann zusprechen wird, wenn die rohe Gewalt unter den Völkern eine ebenso verfemte Sache geworden sein wird, als es die rohe Gewalt unter den menschlichen Individuen der zivilisierten Gesellschaft bereits geworden ist.
Abschied von Paul Schlenther
Rede, gehalten am Sarge Paul Schlenthers im Krematorium Berlin-Wedding am 2. Mai 1916.
Vor allzu kurzer Zeit haben viele von uns, wie jetzt, in diesem tiefernsten Raume gestanden um den Sarg eines geliebten Freundes. Einer der damaligen Leidtragenden ist der, dessen Hingang wir heute betrauern und der nun selbst unter Blumen im Sarge liegt. Wo ich jetzt stehe, dort stand damals er, mühsam gegen die eigene Rührung ankämpfend.
Lieber Schlenther: ich kannte dich immer als einen sein allzeit warmes Gefühl beherrschenden Mann. Damals warst du fast unbeherrscht, beinahe gebrochen in deinem Schmerze.
Indem du hierhergetreten bist, so nahe an das Tor des Todes, sahst du vielleicht jemand, der dich hineinwinkte. Vielleicht flüsterte er dir zu, daß du von der berührten Schwelle nicht mehr weit und nicht auf lange zurücktreten würdest.
In Paul Schlenther ist einer der besten Deutschen aus dem Leben geschieden.
Mit welchem Recht ich dies sage, wissen alle, die das Glück hatten, ihn zu kennen, und viele der besten Stimmen haben in schmerzlichen Nachrufen laut ausgesprochen, was er war. Man vermag dieser allgemeinen, gerechten Würdigung kaum etwas hinzuzufügen.
Schlenther war zunächst eine glänzende Feder. Aber obgleich Tagesschriftsteller im besten Sinne, der seine Feuilletons in genialer Mühelosigkeit schrieb, richtete sich das Augenmerk seiner Seele stets auf das Bleibende. Diesem Zug seines Wesens folgend, ward er auch über den Rahmen des Tages hinaus zum Autor von Rang.
Wer diesen stämmigen, prachtvollen Ostpreußen zuerst kennenlernte, dessen Art schwerblütig, nüchtern, karg, verschlossen und eher für die Praxis des bürgerlichen Lebens geeignet erschien, mußte erstaunt sein über die ein für allemal entschiedene, restlose Hingabe gerade dieser Natur an die besondere Welt des Theaters.
Aber, nun waren es gerade diese Eigenschaften des tüchtigsten Bürgertums, die seine leidenschaftliche Neigung dem Theater so wertvoll machen sollten.
Wir wissen, wie er sich sehr bald nach seinen journalistischen Anfängen aus dem Nur-Negativen ins Positive hinauf entwickelte. Er wollte nicht nur Unkraut ausreuten, er wollte auch Pflanzer und Gärtner sein.
Mit den geistigen Wurzeln selbst tief und warm gebettet in der goldenen Erde des deutschen Nationalbesitzes an dichterischem Gut, schritt er dazu, neue Reben zu pflanzen und in neuen Weinbergen neue Ernten vorzubereiten.
Er sah wohl ein, daß die köstlichste literarische Vergangenheit einzig und allein durch eine starke literarische Gegenwart lebendig wird. Nur das Lebende weckt Lebendiges.
So ward von Paul Schlenther und Otto Brahm in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten jene Freie Bühne errichtet, die der Keim unseres ganzen dramaturgischen Gegenwartslebens geworden ist.
Wer der Entstehung des Baues nahestand, weiß, wie viele praktische Klugheit aufzuwenden war, um ihn unter Dach zu bringen. Die Bauleute bauten mit Kelle und Schwert unter ständigen Angriffen und Bedrohungen durch den herrschenden Geist der Zeit.
Aber mit der Vollendung, mit dem Siege des Instituts bekamen Paul Schlenther und Otto Brahm das Steuer der versandeten Karavelle des allgemeinen deutschen Theaters für lange Zeit in die Hand. Das Schiff wurde flott, bekam Fahrt und übergab sich dem großen Weltmeer, das es hoffentlich, durch gutes und schlechtes Wetter, noch an viele unentdeckte Küsten tragen wird. Denn seit der Zeit hat es Fahrt behalten.
Das deutsche Theater ist eine ernste Macht geworden. Es bleibt dabei, trotzdem eine dramatische Schundliteratur ohnegleichen gerade während des Krieges wuchert und es zu bedrohen scheint. Die alten, lebendig ernsten Tendenzen wirken an den ersten Theatern Berlins, Wiens, wirken in Dresden, in München, in Stuttgart, in Hamburg und anderen Orten fort und werden nach vollendetem Sieg der deutschen Waffen noch gesünder aufblühen.
Freilich müssen wir immer wieder auf Männer hoffen, wie Schlenther einer gewesen ist. Ohne den moralischen Halt, den solche Naturen geben, verfällt das korruptibelste aller Institute rettungslos.
Lieber Schlenther! ich habe hier an deinem Sarg vom deutschen Theater geredet, und ich denke mit gleichem Recht, wie man an dem Grabe des Sokrates von den letzten Fragen der Philosophie reden würde. Die Bühne war mehr als dein Thema, dein Objekt, sie ist dein echtestes Leben gewesen.
Und wir werden zwar auch an die Bühne denken, die nichts als ein Brettergerüst und bemalte Leinwand ist, halten uns aber gegenwärtig, daß auf diesem altehrwürdigen Institut seit grauen Zeiten, immer und immer wieder, im Symbol Teile des großen Weltdramas abgehandelt worden sind. Dieses Gerüst hatte Himmel, Erde und Hölle, hatte, je nachdem, das diesseitige und das Leben nach dem Tode zu tragen. Die Namen der erlauchtesten Geister aller Zeiten und mehr noch die Geister selbst haben es weltweit gemacht und sind mit ihm unlöslich verknüpft. Und wir erfahren von ihm herab, wie jeder von ihnen, als Demiurg, sich, vom Geiste des höchsten Weltenkünstlers berührt, seine eigene Welt erschuf.
Eins der frühesten Dramen findet sich in einem ägyptischen Totenritual oder Totenbuch. Seine Handlung beginnt mit dem Austritt aus der irdischen Welt und setzt sich fort durch die Ankunft in den himmlischen Wohnungen und in der Verklärung der Seele im Lichte der Sonne.
Lieber Schlenther, das sei auch dein Weg.
Ade!
Offener Brief an den Kongress der Alliierten in Paris
Veröffentlicht im »Berliner Tageblatt«, 2. Februar 1919.
Durch die Zeitungen gehen Nachrichten über eine Wiedereinführung der Sklaverei. Es wird gesagt, einer der kriegführenden Staaten sei entschlossen, nach Unterzeichnung des Friedensdokuments und Begründung des Völkerbundes etwa achtmalhunderttausend Kriegsgefangene zurückzubehalten und Sklavendienste verrichten zu lassen Der neue Sklavenhalterstaat soll Frankreich, seine Sklaven sollen nicht Neger, sondern Kinder eines anderen europäischen Landes, meine Landsleute, sein.
Ich bitte den hohen Kongreß, der die heilige Aufgabe hat, den aus tausend Wunden blutenden Nationen den Frieden vorzubereiten, nicht annehmen zu wollen, daß ich solchen Gerüchten insoweit Glauben schenkte, um eine Anklage auf sie zu gründen. Da indessen dieser beispiellose Krieg über die Erde gegangen ist und viele ethische Werte durch ihn fraglich geworden sind, bin ich nicht mehr in der Lage, selbst absurde Gerüchte mit gleicher Sicherheit wie vor dem Kriege als unwahr beiseite zu schieben.
Ich glaube nicht an eine Erneuerung der Sklaverei in Europa: meine Erwägungen rechnen jedoch mit dieser Möglichkeit und, wie ich offen bekenne, wollen ihr vorbeugen.
Es wäre denkbar, daß man den Wiederaufbau französischer Städte durch deutsche Sklaven in Erwägung zöge. Aber man würde doch nicht umhinkönnen, die Frage leidenschaftslos von allen Seiten zu betrachten und ihre allgemeinen Folgen zu berücksichtigen. Und so, denke ich, müßte sich im entscheidenden Augenblick die Einsicht der Unausführbarkeit des Gedankens Bahn brechen.
Im Jahre 1846 hat der Bei von Tunis die Sklaverei in seinem Lande aufgehoben. In England wirkten schon seit 1788 William Wilberforce, Pitt und andere Staatsmänner gegen die Sklaverei. 1807 wurde dann der Abolition-Act of Slavery im Parlament durchgebracht. 1816 fanden Verhandlungen in London statt, durch die der französische Sklavenhandel aufgehoben wurde. Am 1. Januar 1863 erfolgte in den Vereinigten Staaten die Emanzipationsproklamation für alle Sklaven und ihre Nachkommen. Sie wurde am 31. Januar 1864 durch Kongreßbeschluß bestätigt. In Brasilien erschien 1871 das Sklavenemanzipationsgesetz. In der Türkei wurde am 23. Dezember 1876 die Sklaverei für das ganze osmanische Reich rechtlich beseitigt. Dasselbe geschah auf Madagaskar im Jahre darauf.
Das Datum des kommenden Friedensschlusses ist nicht bekannt. Behielte Frankreich, unter Duldung des Kongresses, achtmalhunderttausend Christensklaven, meine deutschen Brüder, zurück, um sie zwangsweise schwere Fronarbeit verrichten zu lassen, so würde dies Datum, was sich auch sonst damit verknüpfte, wie kein zweites in der neuen Geschichte sich jenen glorreichen als eins der schmachvollsten anreihen.
Ich glaube nicht, daß irgendein, gleichviel ob gerechter, ob ungerechter Haß den Europäer von einiger Urteilskraft gegen diese Tatsache blind machen kann, am allerwenigsten einen Franzosen: dieser hat gewiß nicht vergessen, daß ein gewisser Lafayette im Jahre 1789 bei der französischen Nationalversammlung den Antrag auf Proklamierung der allgemeinen Menschenrechte stellte, daß dieser Antrag durchging und daß der erste Artikel dieser »Déclaration des droits de l'homme et du citoyen« in dem Satz besteht: »Die Menschen werden frei und gleich an Rechten geboren und bleiben es.«