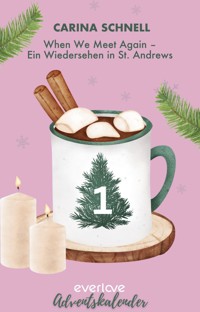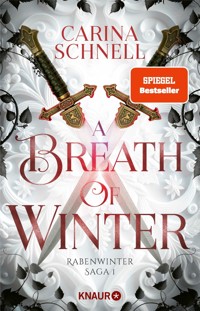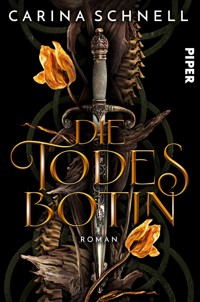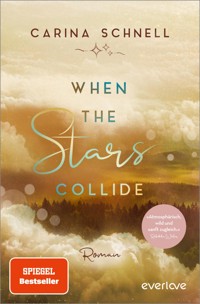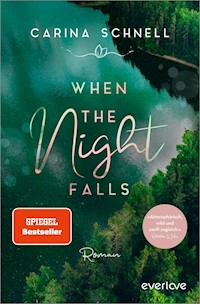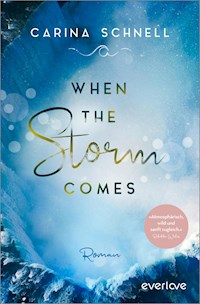4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Feen in Schottland
- Sprache: Deutsch
Vorsicht, Suchtgefahr: Romantische Fantasy vor der Kulisse Schottlands. Carina Schnell entführt uns an einen magischen Ort der Feen und haucht dem klassischen Konflikt "Gut gegen Böse" neues Leben ein. Die kanadische Journalistin Catriona Keith reist nach Schottland, um vor Ort über die politischen Unruhen im Land zu berichten. Auf ihrem Ausflug durch die Highlands begegnet sie im Pub einem mysteriösen Fremden, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt. Als sie kurz darauf angegriffen und gejagt wird, fällt sie auf ihrer panischen Flucht durch einen Tümpel und findet sich plötzlich in Alba, dem Reich der Feen, wieder. Schnell wird klar, dass der gutaussehende Fremde aus dem Pub ein Feenkrieger namens Carrick ist, der zu einem einzigen Zweck ausgebildet wurde: Seherinnen wie Catriona, die Feen sehen und in ihre Welt reisen können, zu töten. Doch als eine Bedrohung heraufzieht, die sowohl das Ende Albas als auch der Menschenwelt bedeuten könnte, müssen die beiden sich zusammentun, um die uralte Fehde zwischen Menschen und Feen beizulegen und ihre beiden Völker zu retten. SPIEGEL-Bestsellerautorin Carina Schnell weiß, wie sie die Herzen ihrer Leser*innen höher schlagen lässt: - Alba - Zwischen den Welten - Alba - Im Schatten der Welten - A Breath of Winter (Rabenwinter-Saga 1)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Schnell Carina
Alba – Zwischen den Welten
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein spannender Fantasy-Roman vor der Kulisse Schottlands. Carina Schnell entführt uns an einen magischen Ort der Feen und haucht dem klassischen Konflikt »Gut gegen Böse« neues Leben ein.
Die kanadische Journalistin Catriona Keith reist nach Schottland, um vor Ort über die politischen Unruhen im Land zu berichten. Auf ihrem Ausflug durch die Highlands begegnet sie im Pub einem mysteriösen Fremden, zu dem sie sich sofort hingezogen fühlt. Als sie kurz darauf angegriffen und gejagt wird, fällt sie auf ihrer panischen Flucht durch einen Tümpel und findet sich plötzlich in Alba, dem Reich der Feen, wieder.
Schnell wird klar, dass der gut aussehende Fremde aus dem Pub ein Feenkrieger namens Carrick ist, der zu einem einzigen Zweck ausgebildet wurde: Seherinnen wie Catriona, die Feen sehen und in ihre Welt reisen können, zu töten. Doch als eine Bedrohung heraufzieht, die sowohl das Ende Albas als auch der Menschenwelt bedeuten könnte, müssen die beiden sich zusammentun, um die uralte Fehde zwischen Menschen und Feen beizulegen und ihre beiden Völker zu retten.
Inhaltsübersicht
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Epilog
Aussprache der Namen
Danksagung
Für Chris
Weil Schottland erst der Anfang war.
Kapitel 1
Willst du mich heiraten?«
Ben sah mich mit seinen blauen Augen erwartungsvoll an. Er kniete vor mir auf dem exquisiten Teppich des The Palace, eine samtbezogene Schatulle in der einen Hand, die er mit der anderen langsam öffnete. Zum Vorschein kam ein Ring, gekrönt von einem gigantischen Diamanten.
Ich verschluckte mich an meinem Dom Pérignon.
Bens strahlendes Lächeln verwandelte sich in eine besorgte Grimasse, als ich äußerst undamenhaft zu husten begann. Die Blicke der anderen Gäste, die Ben mit seinem Kniefall auf uns gezogen hatte, erdrückten mich.
Ich hustete, konnte nicht atmen. Meine Augen huschten zwischen Ben, den reich verzierten Kronleuchtern an der Decke und dem Hummer auf meinem Teller hin und her. Ich bemühte mich, das immer lauter werdende Getuschel unserer Tischnachbarn auszublenden, während ich verzweifelt nach Luft schnappte. Mein panisch umherirrender Blick fiel auf den Diamantring, den Ben mir noch immer entgegenhielt.
Meine Brust zog sich schmerzhaft zusammen, der Champagner brannte in meinem Hals. Da schlug mir jemand von hinten heftig auf den Rücken.
Keuchend öffnete ich die Augen.
»Madam?«
Ich sah mich irritiert um. Etwas drückte sanft gegen meinen Rücken.
»Madam, würden Sie bitte Ihre Rückenlehne senkrecht stellen? Wir beginnen gleich mit dem Landeanflug auf Edinburgh.«
Ich fuhr zu der Flugbegleiterin herum, die mich freundlich anlächelte. »Natürlich, Entschuldigung.«
Hastig kam ich ihrer Anweisung nach, und sie ging weiter. Ein Blick aus dem kleinen Fenster zu meiner Linken zeigte mir, dass das Flugzeug bereits so viel an Höhe verloren hatte, dass ich unter uns grün und braun gesprenkelte Hügel erkennen konnte. Ich hatte beinahe den ganzen Flug verschlafen. Beim Gedanken daran, was für ein Chaos ich in New York zurückgelassen hatte, verkrampfte sich mein Magen. Kein Wunder, dass ich sogar davon träumte.
Ich konnte Bens Gesichtsausdruck nicht vergessen, den Schock auf seinen Zügen, als ich ihm gesagt hatte, dass ich Zeit bräuchte. Wie er sich hastig erhoben, den Ring wieder in seinem Smoking verstaut und den anderen Restaurantgästen einen nervösen Blick zugeworfen hatte. Wie immer war er der perfekte Gentleman gewesen. Aber der Schmerz über die Zurückweisung hatte sich trotzdem auf seinem Gesicht abgezeichnet.
Deshalb war ich auch Hals über Kopf nach Europa geflüchtet: weil ich Zeit brauchte. Nein, verbesserte ich mich in Gedanken, um Recherche für meinen nächsten Artikel zu betreiben. Wenn ich es mir nur lange genug einredete, würde ich es vielleicht irgendwann glauben. Und Ben auch.
Als ich mich nach der holprigen Landung bückte, um durch die Kabinentür des Flugzeugs ins Freie zu treten, sog ich scharf die eisige Luft ein.
Es war Mitte März, aber hier in Schottland war noch nicht viel vom Frühling zu sehen. Auf den Gipfeln der fernen Berge konnte ich Schnee erkennen. Einige der von der dicken Wolkenschicht gefilterten Sonnenstrahlen fielen auf mein Gesicht, und ich hielt einen Moment inne, um die Wärme zu genießen, die Sonnenflecken hinter meinen geschlossenen Lidern tanzen zu sehen.
Als gebürtiger Kanadierin machte mir die Kälte nichts aus. Trotzdem war ich im Herzen eine Sonnenanbeterin und würde jeden einzelnen Sonnenstrahl genießen, den ich nach dem langen New Yorker Winter hier in Europa einfangen konnte.
Da schob sich eine Wolke vor die schwache Morgensonne, und die Magie des Moments war gebrochen. Ich warf noch einen letzten Blick auf die schneebedeckten Gipfel in der Ferne, bevor ich die wackelige Eisentreppe hinunterstieg.
Nachdem ich meinen Koffer vom Gepäckband gehievt hatte, machte ich mich auf die Suche nach einer Telefonzelle. Ich hatte Mom versprochen, sie sofort nach der Landung anzurufen. Wie immer, seit ich nach New York gezogen war, machte sie sich Sorgen um mich, die sich nun, da ich zum ersten Mal den Kontinent verlassen hatte, verdreifacht haben mussten. Ich konnte es ihr nicht übel nehmen. Sie selbst hatte Nova Scotia in ihrem Leben erst ein einziges Mal verlassen, und das auch nur, um ihr kleines Mädchen im Big Apple zu besuchen.
Nachdem sie mein winziges Einzimmerapartment in Brooklyn und meine dürftige Gehaltsabrechnung gesehen hatte, hätte sie mich am liebsten wieder mit nach Hause genommen. Aber ich hatte mich nicht beirren lassen. Ich lebte den Traum, auf den ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet hatte.
Und jetzt hast du es versaut, meldete sich mein Gewissen, und einmal mehr sah ich Bens enttäuschtes Gesicht vor mir, hörte das empörte Getuschel der Restaurantgäste und spürte mein Herz schmerzhaft gegen meine Rippen schlagen. Ich schluckte und sah auf meine Armbanduhr, ein teures Geschenk von Ben. Ich hatte sie schon im Flugzeug auf die europäische Zeit umgestellt.
Ich benutzte meine Finger, um zurückzurechnen. In New York war es jetzt halb ein Uhr morgens, dann musste es zu Hause in Kanada schon halb zwei sein. Trotzdem wusste ich, dass Mom noch wach war und auf meinen Anruf wartete.
Als mein Blick suchend durch die beinahe leere Flughafenhalle schweifte, fiel mir auf, wie neu und auf Hochglanz poliert alles wirkte, ganz im Gegensatz zum JFK-Flughafen in New York. Edinburgh Airport war erst vor zwei Jahren fertig renoviert und durch die Queen eingeweiht worden.
Durch die Glasfront entdeckte ich draußen eine Reihe roter Telefonzellen, wie man sie aus britischen Filmen kannte.
Was für ein Klischee, dachte ich amüsiert. Aber die Touristen fahren sicher voll drauf ab.
Als ich durch die Flügeltüren trat, traf mich die frühmorgendliche Kälte, die durch das Vordach noch nicht von der Morgensonne verdrängt worden war. Ich fröstelte und zog meinen rot-grün karierten Schal enger um den Hals. Zuerst versuchte ich, mich mitsamt meinem Koffer in die Kabine zu zwängen, gab aber schnell auf und ließ ihn davor stehen.
So früh waren erst wenige Leute unterwegs. Niemand würde versuchen, dieses Monstrum zu stehlen.
Ein paar Taxifahrer standen an ihre Autos gelehnt, rauchten oder unterhielten sich gedämpft. Nur eine Handvoll Reisende tapste verschlafen hinter mir aus den Doppeltüren. Sie mussten im selben Flieger gesessen haben.
Ich kramte länger als sonst in meinem Portemonnaie – einem weiteren Geschenk von Ben –, bis ich das richtige Kleingeld gefunden hatte. Ich betrachtete die fremde Währung einen Augenblick, bevor ich sie einwarf. Auf allen Münzen prangte der Kopf Queen Elisabeths der Zweiten. Sie klapperten laut, als ich sie eine nach der anderen in den Schlitz steckte.
Ich drehte die Wählscheibe mit kalten, steifen Fingern, dann tutete es auch schon am anderen Ende. Ganze zwei Mal.
»Darling! Ich dachte schon, dir wäre etwas passiert.«
»Hi, Mom.« Ich verdrehte die Augen.
»Bist du gut angekommen? Wie war der Flug? Ist dein Koffer unversehrt angekommen? Hast du auch genug getrunken?«
Die Besorgnis in ihrer Stimme ließ mich dann doch schmunzeln. Obwohl ich einen siebenstündigen Flug hinter mir hatte, müde war und fror, tat es gut, die Stimme meiner Mutter zu hören. Sie würde sich wahrscheinlich auch dann noch Sorgen um mich machen, wenn ich dreißig und längst verheiratet war.
Verheiratet. Ich schluckte.
»Es ist alles gut, Mom. Ich bin bloß müde. Werde wohl ein paar Tage lang einen Jetlag haben.«
»Hast du Ben schon angerufen und ihm gesagt, dass du gut angekommen bist? Er macht sich sicher auch Sorgen.«
»Es ist ein Uhr morgens in New York. Ben schläft bestimmt. Nicht jeder ist so verrückt wie du und bleibt so lange wach, nur um meine Stimme zu hören.«
»Wie kannst du so was sagen! Natürlich will dein Verlobter deine Stimme hören. Und vor allem will er hören, wie du ein ganz einfaches, klitzekleines Wort aussprichst: ja.«
»Er ist nicht mein Verlobter, Mom. Ich habe ihm noch keine Ant…«
»Noch nicht. Auch wenn ich das immer noch nicht begreifen kann. Ihr seid so großartig zusammen. Was für ein Fang! Und dann dieser Ring … wie hast du da auch nur eine Sekunde lang zögern können? Und er ist ja nicht irgendwer. Weißt du eigentlich, wie viele junge Frauen dafür töten würden, an deiner Stelle zu sein?«
Und jetzt geht es erst richtig los. Ich hielt den Hörer weiter von meinem Ohr weg, während ihre Stimme sich zu einem Crescendo steigerte.
»Einer der gefragtesten Junggesellen des ganzen Staates New York hält um deine Hand an, und du brauchst Zeit? Das ist kein Mann, den man zum Narren halten kann, Darling. Ben wird nicht ewig auf dich warten. Als Erbe einer der reichsten Familien der Upper West Side müssen die Frauen bei ihm Schlange stehen. Und was seine Eltern erst denken müssen. Diese Zurückweisung! Du solltest das so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Am besten jetzt gleich.«
»Mom!« Meine Stimme war eisig geworden, und sie hielt in ihrer Tirade inne. »Wir haben das schon besprochen. Es ist mein Leben, meine Entscheidung. Ich habe nicht Nein gesagt, nur dass ich ein wenig Zeit brauche. Und außerdem kann ich mir diese Story nicht entgehen lassen. Ich brauche die Festanstellung beim New Yorker.«
»Aber wenn du Ben heiratest, müsstet du nie wieder einen einzigen Tag in deinem Leben arbeiten.«
Ich schnaubte. Was für ein Albtraum. Doch sie ließ sich nicht beirren.
»Dieser Traum von einer Karriere als Journalistin hat dich schon zu viel gekostet, ich …«
»Mom, ich habe gleich kein Guthaben mehr. Gibt es vielleicht noch etwas Nettes, das du mir sagen möchtest, bevor wir uns zehn Tage lang nicht hören?«
»Zehn Tage?«
Ich musste mir verkneifen, anhand des Schocks in ihrer Stimme nicht laut aufzulachen. »Du weißt, dass ich erst mal raus in die Natur will. Ich werde in den nächsten Tagen keine Möglichkeit haben, dich anzurufen.«
»Ich kann einfach nicht glauben, dass sie in einem respektablen Bed and Breakfast kein Telefon haben. Das ist doch undenkbar. Wir leben in den Siebzigern, nicht in der Steinzeit.«
»Ich bin in Schottland, nicht in New York. Ich werde tief in den Highlands sein. Die Leute dort leben teilweise weitab vom Schuss und sind noch ziemlich altmodisch.«
»Okay, okay. Wenigstens hast du mich vorgewarnt. Aber Sorgen werde ich mir trotzdem machen. Versprichst du mir, mich sofort anzurufen, wenn du wieder in der Zivilisation bist?«
»Natürlich. Ich muss jetzt los. Mein Fahrer müsste jeden Moment hier sein.«
»Es gefällt mir immer noch nicht, dass du mit einem wildfremden Mann unterwegs bist.«
»Mom! Das ist der einfachste und günstigste Weg, schnell in die Highlands zu kommen und dabei noch etwas von einem Einheimischen zu lernen. Außerdem ist er ja kein Fremder, sondern ein Bekannter von Bens Großvater.«
Endlich gab sie Ruhe, sodass wir uns verabschieden konnten. Als ich den Hörer auf die Gabel legte, entwich mir ein tiefer Seufzer. Ich würde in den nächsten Tagen einen Weg finden müssen, mich von meinem schlechten Gewissen abzulenken und den Kopf freizubekommen, sonst würde ich noch wahnsinnig werden.
Ich wusste nur zu gut, dass ich lediglich eine einzige weitere Chance mit Ben bekommen würde. Meine Mutter hatte recht, er war kein Mann, den man zum Narren halten konnte. Benjamin Alexander James Preston besaß diesen angeborenen Stolz reicher Leute, den man besser nicht zu oft verletzte. Auch seine Eltern, zwei hohe Tiere im Verlagswesen, würden dieses Spiel nicht lange mitspielen. Einmal mehr überkam mich Panik. Es fühlte sich an, als fiele eine Tür vor mir ins Schloss. Die Wände der kleinen Telefonzelle begannen, auf mich zuzurücken, kamen näher und näher. Es gab keinen Ausweg.
Als sich mein Atem beschleunigte, schüttelte ich heftig den Kopf. Nein. Ich würde diesen Urlaub nutzen, um herauszufinden, was ich wirklich im Leben wollte, und hoffentlich die beste Story meiner bisherigen Karriere zu schreiben. Doch um das zu erreichen, musste ich es erst einmal schaffen abzuschalten. Seit vier Jahren hatte ich keinen Urlaub mehr gemacht, und es wurde langsam Zeit. Die Highlands erwarteten mich.
Ich schloss die Augen, atmete tief durch und zuckte zusammen, als zwei laute Schläge ertönten.
Beinahe wäre mir ein Schrei entwichen. Vor der Tür der roten Telefonzelle stand ein dunkler Schemen, den ich kaum durch die von innen beschlagene Scheibe erkennen konnte. Mit einer bedrohlichen Geste hob er eine Hand, um erneut gegen das Glas zu schlagen.
Kapitel 2
Ich wich zurück und stieß gegen das Telefon, das sich schmerzhaft in meinen Rücken bohrte.
Da klopfte es noch zweimal gegen die Tür.
»Miss Keith?«, fragte eine tiefe Stimme mit kehligem schottischem Akzent. »Sind Sie Miss Keith aus New York?«
Ich hätte beinahe laut über meine Schreckhaftigkeit gelacht und stieß die Tür auf.
Der schwarze Schatten wich zurück, als ich ins Freie stolperte. Dort stand ein Hüne von einem Mann. Er hatte rötliches, von grauen Strähnen durchzogenes Haar und einen dichten grauen Bart, durch den er sich mit der Hand fuhr.
»Ich wollte Sie nicht erschrecken, Miss.«
Der Mann steckte doch tatsächlich in einem rot-blau karierten Kilt, der traditionellen Tracht der Schotten. Ich hätte ihn als knielangen Rock bezeichnet, wenn ich nicht gewusst hätte, dass der Schotte das als Beleidigung aufgefasst hätte.
»Graham MacTavish. Ich bin hier, um Sie abzuholen.«
Ich riss meinen Blick von seinen rötlich behaarten Beinen los, die, bis auf ein Paar Kniestrümpfe, nackt waren, und erwiderte sein freundliches Lächeln.
»Ich muss mich für meine Schreckhaftigkeit entschuldigen«, erklärte ich peinlich berührt. »Ich habe Sie nicht kommen sehen.«
Ich streckte ihm meine Hand entgegen, und er schüttelte sie mit seiner riesigen, warmen Pranke.
»Catriona Keith. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mister MacTavish.«
»Bitte nennen Sie mich Graham.«
»Nur wenn Sie mich Cate nennen.«
Er nickte belustigt. »Willkommen in Schottland, Cate.«
Kein Mann vieler Worte. Ich mochte ihn auf Anhieb.
Er nahm mir meinen Koffer ab und führte mich zu einem schwarzen Geländewagen, dessen Felgen mit Schlamm bespritzt waren. Wortlos lud er mein Gepäck in den Kofferraum und öffnete dann die Tür für mich.
Ich war schon beinahe um das Auto herumgegangen, um auf der rechten Seite einzusteigen, da ich ganz vergessen hatte, dass man im Vereinigten Königreich auf der linken Straßenseite fuhr. Es war ein merkwürdiges Gefühl, als Beifahrerin links einzusteigen.
Interessiert musterte ich das Innere des Jeeps, während ich mich anschnallte. Natürlich befand sich auch die Gangschaltung auf der anderen Seite, und ich fragte mich, wie es wohl war, mit links zu schalten. Die Schotten konnten ja nicht alle Linkshänder sein.
Im Stillen dankte ich Ben dafür, Graham MacTavish als meinen Fahrer organisiert zu haben, damit ich nicht selbst fahren musste.
Als Graham auf der anderen Seite einstieg, blieb sein Blick kurz an meinem Haar hängen, bevor er schnell wieder wegsah. Er war nicht der Erste, der es anstarrte. Mein Haar war seit frühester Kindheit so hellblond, dass es fast weiß wirkte, und je nach Lichteinfall beinahe silbern schimmerte. Ich hatte noch nie jemanden mit einer ähnlichen Haarfarbe getroffen. In der Grundschule hatten Steve Barry und seine Freunde mich deshalb aufgezogen. Lächelnd erinnerte ich mich an die Worte meiner Großmutter, die mich stets getröstet hatte. »Du hast Diamanthaar«, hatte sie immer gesagt, während ich vor dem Spiegel an ihrem kleinen Schminktisch saß, den sie mir vererbt hatte, und sie mein Haar bürstete. »Lass dich nicht unterkriegen. Die Schulzeit geht vorbei, und da draußen wartet eine ganze Welt auf dich.«
Ich schenkte Graham ein Lächeln, das ihm hoffentlich sagte, dass mir sein Blick nichts ausgemacht hatte. Er erwiderte es, auch wenn das unter seinem dichten Bart schwer zu erkennen war, ließ den Motor an und fuhr los.
Wir fuhren eine ganze Weile in völligem Schweigen. Anfänglich zuckte ich noch zusammen, wenn uns Autos auf der falschen Straßenseite entgegenkamen. Doch ich bemühte mich, mir nichts anmerken zu lassen. Meine Finger krallten sich aber so fest in meinen Sitz, dass die Knöchel weiß hervortraten.
Da der Flughafen etwas außerhalb der Stadt lag, sah ich leider nicht viel von Edinburgh. Ich sagte mir aber, dass ich mehr als genug Zeit in der schottischen Hauptstadt verbringen würde, wenn ich erst einmal von meinem Ausflug in die Highlands zurück war. Mein Zimmer in einer kleinen Pension im Stadtzentrum war schon gebucht.
Ich konnte es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden, mit den Menschen zu sprechen, die allgemeine Stimmung einzufangen, die die unsichere politische Lage ohne Zweifel aufgewühlt hatte. Ich wollte interviewen, recherchieren, schreiben. Aber zuerst musste ich meinen Kopf freibekommen. Die schottische Unabhängigkeit musste warten.
Trotzdem betrachtete ich die hinter der Fensterscheibe vorbeifliegende Landschaft und die Menschen wie ein Adler. Ich suchte nach Plakaten, Graffiti, irgendwelchen öffentlichen Reaktionen auf den Entscheid des Referendums, das Schottland vor nur zwei Wochen sein eigenes Regionalparlament gekostet hatte. Die Schotten hatten zwar mit einer knappen Mehrheit für die Einführung eines eigenen Parlaments, und damit für mehr Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich, gestimmt, allerdings war die Wahlbeteiligung so gering gewesen, dass es nicht ausgereicht hatte. Seitdem war das politische Klima in Schottland noch aufgeheizter als zuvor. Viele Befürworter demonstrierten auf den Straßen, und es herrschte Angst, dass die extremistischen Separatisten bald neue Terroranschläge verüben würden, wie sie es schon vor einigen Jahren getan hatten.
Was für eine aufregende Zeit, in Schottland zu sein und diese Atmosphäre einfangen zu können.
Ich warf Graham einen Seitenblick zu, traute mich aber noch nicht, ihn mit Fragen zu seiner politischen Einstellung zu bombardieren. Vielleicht sollten wir uns erst einmal näher kennenlernen. Andererseits verabscheute ich Small Talk.
»Keith, eh?«, brummte Graham, als hätte er meine Gedanken gelesen. »Haben Sie Familie in Schottland?« Er hatte den Blick weiterhin auf die Straße gerichtet, wirkte aber ehrlich interessiert.
»Ja, mein Name hat mich wohl verraten. Meine Vorfahren sind von Schottland nach Kanada ausgewandert. Meine Urgroßmutter hat sogar noch Gälisch gesprochen. Ich weiß aber leider nicht, ob ich noch Familie hier habe.«
Mit einem leisen Lächeln erinnerte ich mich an den leichten schottischen Akzent meiner Uroma und an die Lieder, die sie manchmal auf Gälisch vor sich hingesungen hatte.
»Ceiteach«, murmelte Graham. Es war ein rauer, kehliger Laut, und ich wusste nicht, ob ich richtig verstanden hatte.
»Wie bitte?«
»Das bedeutet Keith auf Gälisch. Der wahre Name Ihres Clans.«
»Ich weiß nicht, ob man die Keiths als meinen Clan bezeichnen kann.« Ich lachte nervös.
Die Idee von verschiedenen Clans, die sich gegenseitig bekriegten, wie man es aus Filmen kannte, hatte ich noch nie gemocht.
»Gibt es heutzutage überhaupt noch Clans in Schottland? Ist das nicht eine total veraltete Vorstellung?«
Innerlich schalt ich mich für meine Direktheit. Ich hielt mich seit nicht einmal zwei Stunden in Schottland auf und hatte bereits einen Einheimischen beleidigt. Neuer Rekord.
Graham schien unter seinem Vollbart zu schmunzeln. »Natürlich gibt es die Clans noch. Clan Keith lebt heute noch hauptsächlich im Norden und Nordosten Schottlands. Der aktuelle Clanchief ist James Keith, Earl of Kintore. Der Adelstitel wird seit dem 18. Jahrhundert weitervererbt. Sogar ein paar Schlösser sind noch in Familienbesitz.«
Ich staunte nicht schlecht über sein Wissen. Meine journalistische Neugier war geweckt. »Und was ist mit Ihrem Clan, den MacTavishs?«
»Ein sehr alter Clan mit viel Tradition und einer ungebrochenen Nachkommenslinie.« Er klang stolz.
Während er den Blick weiterhin auf die Fahrbahn gerichtet hielt, deutete er mit dem Finger auf ein Abzeichen, das an dem Kiltüberwurf auf seiner Brust befestigt war. Darauf war ein rundes Wappen zu erkennen, in dessen Mitte der Kopf eines Ebers prangte. Darüber standen in einem Halbkreis die lateinischen Worte NON OBLITUS.
Ich versuchte, mich an meine verhassten Lateinstunden zu erinnern. Wenn ich mich nicht irrte, hieß es so viel wie nicht vergessen oder vielleicht wir vergessen nicht. Es musste sich dabei um das Motto des Clans handeln. Um das Wappen herum war ein Riemen gelegt, der am unteren Ende in einer Schnalle endete.
»Viele Schotten haben alte Nachnamen wie Keith, MacTavish, MacDonald oder Fraser. Das macht sie aber nicht automatisch zu Clan-Mitgliedern«, erklärte Graham. »Ich trage das Abzeichen meines Clans, weil ich ein direkter Nachfahre der Familie unseres Chiefs bin. Riemen und Schnalle symbolisieren meine Abstammung.«
Er strich mit der Hand über den rot-blau karierten Stoff seines Kilts. »Das ist das Muster meines Clans, unser Tartan. Die meisten Clans haben eigene Tartans, aber heutzutage werden viele dieser original schottischen Muster als modische Accessoires getragen.«
Sein Kopf ruckte in Richtung meines rot-grün karierten Schals, den ich abgenommen und auf meinen Schoß gelegt hatte.
Ich musste zähneknirschend zugeben, dass ich den Schal gekauft hatte, weil er mich an die schottischen Tartans erinnerte, die meine Urgroßmutter als Wandtapeten und teilweise als Teppiche in ihrem Haus in Kanada gehabt hatte. Ich war immer stolz auf mein schottisches Erbe gewesen, hatte mich aber nie wirklich damit auseinandergesetzt, konnte weder Gälisch sprechen, noch wusste ich viel über Schottland und seine Kultur. Nun schämte ich mich fast für den Schal, den ich auf einem Flohmarkt in SoHo erstanden hatte.
»Und woher kennen Sie Bens Familie?«, versuchte ich, das Thema zu wechseln.
Graham lachte, ein tiefer, melodiöser Laut. »Benjamins Großvater ist schon in seiner Jugend oft nach Schottland zum Golfen gekommen. Ein Sport, dem ich ebenfalls gerne nachgehe. Er freundete sich mit meinem Vater an, dem einige Golfplätze in den Highlands gehören. Ich kenne Benjamin schon, seit er ganz klein war. Seine Familie hat oft Urlaub in Schottland gemacht.«
Meine Augen weiteten sich. Graham schien ebenfalls einer superreichen Familie zu entstammen, was man ihm überhaupt nicht anmerkte. Er hatte meinen Koffer geschleppt und sich bereit erklärt, mich zehn Tage lang durch halb Schottland zu fahren. Und das alles nur als Gefallen für Bens Verlobte? Ich konnte kaum glauben, dass reiche schottische Erben so anders waren als amerikanische. Graham wurde mir immer sympathischer. Doch in Gedanken schalt ich mich: Freundin, nicht Verlobte. Und das hast du ganz allein zu verantworten.
Als die Straßen nach einer guten Stunde schmaler und kurviger wurden, wies Graham mich an, besonders aufmerksam aus dem Fenster zu schauen. »Wir sind bald da«, erklärte er schmunzelnd.
Bald darauf konnte ich zwischen den Bäumen hindurch Wasser aufblitzen sehen. Als sich die Stämme plötzlich lichteten und ich einen atemberaubenden Ausblick auf einen See hatte, dessen Oberfläche glatt und unbewegt wie ein Spiegel war, keuchte ich überrascht auf. Noch nie hatte ich etwas Vergleichbares gesehen.
Die braungrün gesprenkelten Berge und langsam erblühenden Bäume, die den See umgaben, spiegelten sich in seiner Oberfläche, als wäre sie aus Glas. Die Sonne hatte sich seit ihrer sanften Begrüßung am Morgen nicht mehr blicken lassen. Der Himmel war wolkenverhangen und grau, doch ich hatte das Gefühl, dass das nur noch mehr zur mystischen Atmosphäre dieses Ortes beitrug. Die Härchen an meinen Armen stellten sich unter meinem dünnen Pullover auf, und ich konnte nicht anders, als wie gebannt auf die riesige, unbewegte Fläche zu starren, die ein spiegelverkehrtes Abbild unserer Welt war. Ab und an stießen Vögel herab und erzeugten kleine Wellen, die größer und größer wurden, bevor sie sich wieder verflüchtigten. Sonst blieb alles still und unbewegt.
»Willkommen am Loch Lomond«, sagte Graham.
»Loch heißt See auf Gälisch, richtig?«
Er nickte.
Wir fuhren beinahe eine halbe Stunde am See entlang, und ich konnte die Augen nicht von dem Naturschauspiel lassen. Immer wieder war die Landschaft gesprenkelt mit gelben Ginsterbüschen, die helle Farbtupfer in das Braun und Grün zauberten und aus dem Spiegelbild auf der Seeoberfläche herausstachen. Der Frühling war hier bereits auf dem Vormarsch.
Der Loch Lomond war so riesig, dass kein Ende in Sicht war. Ich konnte zwar das Ufer auf der gegenüberliegenden Seite erkennen, doch der schmale See schlängelte sich unentwegt zwischen den Highlands hindurch, als handelte es sich eher um einen besonders breiten Fluss. Nur die unbewegte Oberfläche ließ etwas anderes vermuten.
Als wir anhielten, hätte ich Graham am liebsten gebeten, weiterzufahren, nur damit ich den See noch länger betrachten konnte. Doch dann fiel mein Blick auf das Haus, vor dem wir geparkt hatten, und ich schluckte jeglichen Protest herunter. Es war kein Haus, es war ein Schloss.
Kapitel 3
Graham hatte den Motor noch nicht ausgeschaltet, da hatte ich schon die Beifahrertür aufgerissen und war aus dem Auto gestürzt.
Das riesige, aus graubraunem Stein gebaute Herrenhaus ragte steil vor mir in den wolkenverhangenen Himmel. Rechts wurde es von einem Türmchen flankiert, zum Eingang führte ein überdachter Vorbau, dessen Dach mit allerlei Verzierungen und kleinen Türmchen geschmückt war. Darüber prangte ein Wappen, das ich sofort wiedererkannte.
»MacTavish«, murmelte ich, während ich den in Stein gemeißelten Kopf des Ebers betrachtete.
Graham war ebenfalls ausgestiegen. Sein belustigter Blick folgte mir, als ich den Kopf zurück ins Auto steckte, um meinen Fotoapparat zu suchen. Das Leder meines alten, ausgeblichenen Rucksacks fühlte sich weich auf meiner Haut an, als ich erst die Schnalle öffnete und dann die Kordel darunter aufzog. Der Rucksack war von oben bis unten gesprenkelt mit Aufklebern meiner Lieblingsbands, darunter The Rolling Stones, The Sweet und Queen, und politischen Statements wie Atomkraft, nein danke und dem Peace-Zeichen.
Ich kramte zwischen einer halb leeren Kekspackung und in letzter Minute hastig hineingeworfener Unterwäsche herum, bis meine Finger auf die Linse trafen.
Ich zückte meine heiß geliebte Nikon F 2 – ein weiteres Geschenk von Ben – und schoss ein paar Fotos vom Anwesen.
In der Zwischenzeit holte Graham mein Gepäck aus dem Kofferraum. Als ich mich zu ihm umwandte, entdeckte ich zum ersten Mal den Ausblick hinter ihm. Ich war so von dem Schloss gefesselt gewesen, dass ich gar nicht bemerkt hatte, dass wir uns auf einer kleinen Anhöhe mit spektakulärer Aussicht auf den Loch Lomond befanden.
Weit und breit konnte ich an seinen Ufern keine Menschenseele ausmachen, weder Häuser noch Bootsanleger. Dieser Teil des Sees lag abgeschieden, weit weg von den Touristenscharen, die uns auf unserem Weg hierher entgegengekommen waren.
»Gehört das Haus Ihrer Familie?«, fragte ich Graham. »Wohnen Sie hier?«
»Ja zum Ersten, nein zum Zweiten«, gab er zurück. »Das Anwesen ist im Besitz der MacTavishs, aber es fungiert heute als Pension für Touristen, die es etwas abgeschiedener mögen.«
Er deutete auf etwas, das sich hinter mir befand, und ich drehte mich um. Etwas abseits stand ein Schild mit der Aufschrift Parkplätze nur für Gäste der Pension.
Ich zog eine Grimasse. Innerlich hatte ich mir schon ausgemalt, wie wir am Abend gemütlich mit dem Chieftain der MacTavishs in einer alten, vom Boden bis zur Decke mit Büchern vollgestopften Bibliothek saßen und uns unterhielten. Im Kamin würde ein Feuer prasseln, und wir hätten alle ein Glas Whiskey in der Hand, dessen Inhalt im Feuerschein wie Bernstein funkelte.
Graham hob entschuldigend die Schultern. »Ich habe ein paar Tage in Glasgow zu tun, bevor ich wieder herkomme und Sie abhole. Ben hat mich informiert, dass Sie vorhaben, ein paar Tage am Loch Lomond zu verbringen, bevor wir weiter in den Norden durch die Highlands fahren.«
Ich nickte. Genau das war der Plan gewesen.
»Dies ist eine hervorragende Pension, die seit vielen Jahren von guten Freunden meines Onkels geführt wird«, fuhr Graham fort. »Emily und ihr Ehemann Stewart werden Ihnen wertvolle Tipps geben, was es in der Umgebung alles zu entdecken gibt. Sie können auch gerne das Auto der beiden ausleihen, wenn Sie weiter den See hinauffahren wollen. Unten am Anleger gibt es außerdem mehrere Boote. Stewart nimmt Sie sicher gerne mal auf eine Tour über den Loch mit.«
Er deutete Richtung See, wo sich hinter den Bäumen am Ufer wohl ein Steg und einige Boote befinden mussten.
Ich schenkte ihm ein Lächeln. Was machte es schon, dass ich nicht in einem richtigen Schloss, sondern in einem Hotel übernachtete. Schließlich war ich nicht für den Luxus hergekommen, den ich in New York an Bens Seite jeden Tag genießen konnte, sondern um Abenteuer zu erleben und neue Erfahrungen zu sammeln. Und um die größte Story meines bisherigen Lebens zu schreiben, ermahnte ich mich.
Graham wies auffordernd mit einer Hand Richtung Eingang. »Bitte, nach Ihnen.«
Ich ließ mich nicht zweimal bitten.
Als wir durch die schwere Eichenholztür traten, fiel mir zuerst der weiche Teppich auf, der unsere Schritte dämpfte und genauso gemustert war wie Grahams Kilt. Das Zentrum der großen, von einer breiten Treppe flankierten Eingangshalle bildete die Rezeptionstheke, auf die mein Begleiter zusteuerte. Er drückte auf eine goldene Klingel, die auf dem blank polierten Holz der Theke stand. Der helle Ton war kaum verklungen, da rauschte auch schon eine beleibte Frau mit haselnussbraunem Haar aus einer Tür hinter der Rezeption heran.
»A ghràidh«, rief sie und zog Graham in eine überschwängliche Umarmung. Ich hätte meinen Begleiter so eingeschätzt, dass ihm diese öffentliche Zuneigungsbekundung vielleicht unangenehm sein könnte, doch er erwiderte die Umarmung herzlich, und die beiden tauschten ein paar Worte auf Gälisch aus.
Mit geröteten Wangen und einem breiten Lächeln wandte er sich zu mir um, nachdem er sich aus ihrer Umarmung gelöst hatte. »Cate, das ist Emily. Ihre Gastgeberin für die nächsten paar Tage.«
Ich streckte eine Hand aus, aber Emily zog mich ebenfalls in eine herzliche Umarmung. »Do bheatha dhan dùthaich, herzlich willkommen«, rief sie. »Ich freue mich, Bens Verlobte kennenzulernen.«
Das Lächeln gefror mir auf den Lippen. »Sie kennen Ben?«, fragte ich leicht säuerlich.
»Ja, ich kenne den kleinen Rabauken schon seit vielen Jahren«, erklärte sie, doch ich hörte schon gar nicht mehr zu. Hatte Ben etwa allen Leuten erzählt, dass wir verlobt waren, noch bevor ich überhaupt Ja gesagt hatte?
Wir hatten meine Reise nach Schottland vor Wochen geplant. Er musste die Anrufe getätigt haben, noch bevor er überhaupt um meine Hand angehalten hatte.
Meine Wangen brannten, und ich zwang mich, nicht auf Emilys Anspielung zu unserer Verlobung einzugehen. Stattdessen lächelte ich und versuchte, trotz der wütend pochenden Ader an meiner Schläfe, dem Gespräch zu folgen.
»Ben hat das beste Zimmer im Haus für Sie reserviert«, erklärte meine Gastgeberin gerade. Sie war hinter die Theke getreten und blätterte in einem dicken Buch. »Ich bräuchte bitte Ihren Reisepass und eine Unterschrift hier und hier. Stewart wird gleich hier sein, um Ihr Gepäck nach oben zu tragen.«
Sie zeigte auf die Treppe, die sich in einem breiten Schwung in die oberen Etagen wand.
»Frühstück gibt es jeden Tag ab acht Uhr. Leider servieren wir Mittag- und Abendessen nur an Wochenenden. Nicht weit von hier ist aber ein kleines Dorf, wo es zwei hervorragende Restaurants gibt. Es ist wirklich nur einen kurzen, angenehmen Spaziergang durch ein Waldstück entfernt und liegt direkt am See. Sie finden dort auch ein paar kleine Geschäfte, ein Postamt und natürlich einen Pub. Wenn Sie telefonieren müssen, können Sie das sehr gerne hier an der Rezeption tun, auf den Zimmern gibt es keine Telefone.«
Meine Gedanken schweiften schon wieder ab, während Emily weiter fröhlich vor sich hinplapperte. Ich konnte es nicht fassen. Wem hatte Ben wohl noch von unserer nicht offiziellen Verlobung erzählt? Seinen Eltern natürlich. Aber wussten es etwa auch schon unsere Freunde, seine Kollegen beim New York Wall Street Journal, der Zeitung seines Vaters? Lag womöglich schon ein Artikel vor, der am Folgetag hätte erscheinen sollen – wenn ich Ja gesagt hätte?
Es rumorte unangenehm in meinem Magen, und ich hätte mich am liebsten übergeben. Ich zwang mich, weiterhin zu lächeln und zu nicken, als Emilys Mann Stewart zu uns stieß und mir ebenfalls vorgestellt wurde. Meine Mundwinkel krampften schon vor Anstrengung, als Graham sich schließlich verabschiedete.
»Ich bin am Donnerstag zurück«, verkündete er. »Sie sind hier in guten Händen, Cate.«
Dann wurde ich auf mein Zimmer geführt und endlich allein gelassen. Nachdem die Tür hinter mir ins Schloss gefallen war, warf ich mich aufs Bett, vergrub den Kopf in den Kissen und hätte am liebsten geschrien.
Als ich mich wieder beruhigt hatte, erkundete ich mein Zimmer und das angrenzende Bad, um mich abzulenken. Alles war exquisit eingerichtet, von den Stoffen der schweren Vorhänge vor den Fenstern über die verschnörkelten Nachttischlampen und den riesigen, mit Schnitzereien verzierten Kleiderschrank bis hin zum vergoldeten Wasserhahn und der vornehmen Badewanne. Jedes Möbelstück schien antik, es waren Sammler- oder Erbstücke von hohem Wert, die zwar alle wild zusammengewürfelt waren, aber doch ein wunderbar gemütliches Gesamtbild ergaben. Überall prangte das Wappen der MacTavishs, und auch hier war der Boden mit rot-blau kariertem Teppich ausgelegt.
Um den Kopf freizubekommen, verbrachte ich den Rest des Tages im Freien.
Zuerst wollten meine Gedanken nicht recht zur Ruhe kommen. Sie drehten sich im Kreis und landeten immer wieder bei Ben und der bevorstehenden Hochzeit.
Als ich durch das kleine Wäldchen geschlendert war, das das Anwesen vom Loch trennte, und schließlich am Seeufer stand, atmete ich einmal tief ein. Ich stellte mir vor, wie beim Ausatmen all die umherwirbelnden Gedanken meinen Kopf verließen, wie ein weißer Nebel, der meinem Mund entwich und meinen Kopf klar und frei zurückließ.
Stille umfing mich und wurde nur von gelegentlichem Vogelgezwitscher und dem Schwappen der kleinen Wellen ans Ufer unterbrochen. Ich starrte eine ganze Weile unbewegt auf die spiegelglatte Fläche hinaus.
Dann begann ich, am Ufer entlangzuspazieren und zu fotografieren. Ich hörte lange nicht damit auf, musste sogar zweimal den Film wechseln. Die üppige, tiefgrüne Natur um mich herum faszinierte mich. Alles hier schien ein mögliches Fotomotiv zu sein – die moosbewachsenen Steine, die uralten, knorrigen Bäume, die sanft geschwungenen Berge am gegenüberliegenden Ufer, der Himmel mit seinen sich auftürmenden Wolkengebilden und immer wieder der See.
Loch Lomond zog mich magisch an. Jedes Mal, wenn ich mich herumdrehte, sah der See anders aus, immer wieder gab es etwas Neues auf der unbewegten Oberfläche zu entdecken. Oft tauchte ich meine Hand ins Wasser, ließ sie trotz der Kälte im weichen Uferschlamm liegen, um den See zu spüren, bis meine Haut ganz rot war.
Als ich hungrig wurde, aß ich einen leicht zerquetschten Schokoriegel, den ich in meiner Jackentasche fand. Ich wollte den See noch nicht verlassen. Am Abend hatte ich noch genug Zeit, in einem der Restaurants im benachbarten Dorf einzukehren.
Als es schließlich dunkel wurde, ohne dass ich durch die dicke Wolkendecke hindurch einen Blick auf den Sonnenuntergang erhascht hatte, machte ich mich auf den Weg, den ausgetretenen Waldpfad hinter dem Haus entlang, den Emily mir beschrieben hatte.
Es war nicht schwer, sich im Halbdunkel zurechtzufinden, denn in regelmäßigen Abständen waren kleine elektrische Laternen in den Waldboden gesteckt worden, die warmes Licht verbreiteten. Außerdem war der Pfad mit Schildern ausgewiesen. Es gab viele Abzweigungen, die, den Schildern nach zu urteilen, zu verschiedenen Wanderwegen führten. In der Richtung, in die die Schilder wiesen, stieg der Boden steil an. Vielleicht würde ich morgen einen der umliegenden Berge besteigen. Ich hatte mir in New York extra Wanderschuhe gekauft.
Das kleine Dorf am anderen Ende des Pfades wurde von einer uralten Kirche dominiert, ansonsten gab es nur wenige Häuser. Alle Gebäude waren aus demselben graubraunen Stein errichtet worden wie die Pension. Aus den Fenstern der Wohnhäuser strömte warmes Licht einladend auf den Bürgersteig.
Wie alt hier alles ist, dachte ich. Antike Dinge hatten schon immer eine besondere Faszination auf mich ausgeübt. Weder in Kanada noch in New York gab es wirklich alte Gebäude, nicht in dem Sinne, wie sie hier in Europa alt waren. Die Häuser, die die einzige Straße im Ort säumten, waren so klein und gedrungen, dass ich mich hätte ducken müssen, um einzutreten.
Die Restaurants waren nicht schwer zu finden. Ich blieb vor dem ersten Lokal stehen, zu dem ich kam. Die Kälte war in meine Glieder gekrochen, und mein Magen knurrte. Ich würde noch genug Zeit haben, das zweite Restaurant zu finden, wenn Graham tatsächlich erst in vier Tagen zurückkam.
Ich öffnete die Tür und duckte mich durch den niedrigen Eingang hindurch. Wärme und Stimmengewirr empfingen mich.
»Willkommen, lassie«, begrüßte mich ein Schotte mit besonders starkem Akzent. »Tisch für eine Person?«
Ich nickte, und er führte mich an einen Tisch in der Ecke. Der riesige Raum musste neben der Küche auch der einzige Raum des Hauses sein. Die unbehandelten Steinwände und die Decke gingen gewölbeartig ineinander über und schufen eine rustikale, aber gemütliche Atmosphäre.
Das Restaurant war voll besetzt. Ich hatte Glück, einen der beiden letzten freien Tische ergattert zu haben. Den bunten Multifunktionsregenjacken über den Stühlen und den offenen Reiseführern auf den Tischen nach zu urteilen, tummelten sich hier hauptsächlich Touristen. Ich konnte aber auch einige Einheimische an ihrem schottischen Akzent erkennen, der dem des Kellners ähnelte.
Ich fragte mich gerade noch, ob die anderen Touristen wohl alle in meinem Hotel übernachteten oder ob es noch andere Herbergen in dieser abgelegenen Gegend gab, da kam der Kellner auch schon mit der Speisekarte zu mir.
»Entschuldige, lassie, aber bei uns gibt’s nur zwei Gerichte. Das hier ist die Whiskykarte.«
Er zwinkerte mir zu. »Bist du bereit für die Erfahrung deines Lebens? Schon mal Haggis probiert?«
Ich hatte von dem schottischen Nationalgericht gehört, das meines Wissens hauptsächlich aus Schafsinnereien bestand. Schmunzelnd stellte ich mir Bens verzogene jüngere Schwester Evangeline vor, wie sie die Nase rümpfte und mit diesem nasalen Ton Igitt! rief. Sie würde nie etwas probieren, was auch nur annähernd auf die Beschreibung von Haggis zutraf. Mit einem breiten Grinsen bestellte ich eine große Portion und ein Glas Whisky.
»Ein guter Jahrgang«, versicherte der Kellner mir.
Mir fiel auf, dass er keinen Kilt trug. Auf den Straßen hatte ich ebenfalls keine Kilt tragenden Männer gesehen, auch nicht hier im Restaurant. Ich nahm mir vor, Graham zu fragen, warum er die traditionelle Tracht trug, wenn ich ihn das nächste Mal sah. Es hatte genug Small Talk zwischen uns gegeben. Ich durfte mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Morgen würde ich Emily und Stewart Fragen zum Referendum stellen und vielleicht am Abend auch die anderen Restaurantgäste löchern. Aber für heute wollte ich es gut sein lassen. Ich war zu erschöpft, und der Jetlag machte sich bemerkbar.
Haggis schmeckte köstlich. Die Konsistenz erinnerte mich an Couscous, das ich während einer Reise mit Ben in Marokko probiert hatte. Serviert wurde es mit Kartoffelpüree, Brokkoli und einer leckeren Soße. Der Kellner erklärte mir, dass es Haggis auch in Form einer Art Wurst gab, wobei man es aus der Pelle heraus aß, sogar zum Frühstück.
Am liebsten hätte ich am Ende noch den Teller abgeleckt, nur mit dem Whisky hatte ich so meine Probleme. Obwohl das Glas von Anfang an nur halb voll gewesen war, fragte ich mich nach der Hälfte, ob die Schotten es mir wohl übel nehmen würden, wenn ich die bernsteinfarbene Flüssigkeit mit Cola mischte. Ich entschied mich dagegen und brauchte noch eine weitere halbe Stunde, um das Glas zu leeren.
Nie wieder, schwor ich mir, als ich aus dem Restaurant in die Dunkelheit hinauswankte. Der pure Whisky war mir sofort zu Kopf gestiegen.
Die kalte Nachtluft traf mich wie ein Hammerschlag, und ich zog meine Jacke enger um die Schultern. Leichter Nieselregen hatte eingesetzt, und ich wollte nur noch ins Bett. Der Weg zurück durch den Wald erschien mir endlos, und als ich schließlich in mein weiches Hotelbett fiel, schlief ich sofort ein.
Kapitel 4
Am nächsten Morgen erwachte ich früh, da mir die Sonne ins Gesicht schien. Mein angetrunkenes Ich hatte letzte Nacht vergessen, die Vorhänge zuzuziehen.
Ich blieb eine Weile liegen, genoss die Wärme auf meinem Gesicht und betrachtete die Staubkörner, die im hereinfallenden Lichtstrahl tanzten.
Nach dem anfänglichen Moment der Behaglichkeit begann ich mich jedoch schrecklich einsam zu fühlen. Seit drei Jahren war ich nicht mehr allein in einem Bett aufgewacht, außer wenn ich meine Mutter zu Hause in Nova Scotia besucht hatte. Das große Bett kam mir furchtbar leer vor. Meine Gedanken wanderten einmal mehr zu Ben. Aber nicht zu dem letzten Mal, als ich ihn vor meiner Reise gesehen hatte, wie er auf Knien um meine Hand angehalten hatte. Nein, ich dachte an Ben mit windzerzaustem Haar und sonnengeküsster Haut auf dem Segelboot seiner Eltern. Ben mit einem Turban auf dem Kopf, als wir in der Wüste Marokkos auf dem Rücken eines Kamels gesessen hatten. Ben im Bett in seinem New Yorker Apartment, wenn ich in seinen Armen lag, er mir übers Haar streichelte und mir Unanständigkeiten ins Ohr flüsterte.
Ich schluckte schwer und kämpfte gegen die Tränen an. Hatte ich alles versaut?
Am liebsten wäre ich aus dem Hotel gestürzt und in Edinburgh in den nächsten Flieger nach New York gesprungen. Wenn Ben mich dann am Flughafen in Empfang nahm, würde ich ihm in die Arme fallen und »Ja, ja, tausendmal ja« rufen, wie in einem kitschigen Hollywoodfilm. Doch ich blieb, wo ich war.
Angst formte sich kalt und hart zu einem Stein in meinem Magen. Ich sah nun andere Bilder vor meinem inneren Auge: Ben, wie er abends in der Disco eine Fremde anlächelte, wie sie zusammen tanzten – und dann gemeinsam nach Hause gingen.
Ich schüttelte den Kopf. Das würde er mir nicht antun. Er könnte mich nie so verletzen. Andererseits – hatte ich ihn nicht ebenso sehr verletzt, als ich ihn abgewiesen hatte?
Aber ich hatte seinen Antrag ja nicht abgelehnt, nur gesagt, dass ich Zeit brauchte. Wenn er mich wirklich liebte, würde er auf mich warten. Ob es mir gefiel oder nicht, ich saß fast einen Monat in Schottland fest. Wenn ich schon nicht hier war, um meiner bevorstehenden Verlobung zu entgehen, dann wenigstens, um einen verdammt guten Artikel über die gescheiterte Unabhängigkeit Schottlands und den politischen Aufruhr im Land zu schreiben.
Ich zwang mich, aufzustehen und eine eiskalte Dusche zu nehmen, wie immer, wenn ich einen langen, anstrengenden Tag vor mir hatte. Du musst dich entspannen, sagte ich mir, während das Wasser auf mich herabprasselte. Du bist im Urlaub. Erhol dich, hab Spaß.
Doch als ich den Speisesaal im Erdgeschoss betrat, dessen hohe Fenster einen fabelhaften Ausblick auf den See boten, wäre ich am liebsten wieder umgedreht.
Dort saßen nur Paare beim Frühstück. Es waren hauptsächlich Pärchen über fünfzig, die sich am Büfett bedienten, ich konnte aber auch einige in meinem Alter ausmachen, die sich verliebt über ihre Teller hinweg anschmachteten. Wer hätte gedacht, dass das kalte und feuchte Schottland ein beliebtes Reiseziel für frisch Verliebte und lang Verheiratete gleichermaßen war?
Vor mich hin grummelnd nahm ich mir einen Teller und belud ihn mit extra viel Speck. Ich war schließlich im Urlaub.
Ich machte einen weiten Bogen um das typisch schottische Frühstück, das, neben Speck und Rührei, auch aus Bohnen, gebratenen Pilzen und Tomaten, kleinen Grillwürstchen und sogar Haggis bestand. Gewöhnlich war ich froh, wenn ich morgens eine Tasse Kaffee herunterbekam. Lange würde ich es in diesem Raum voll liebeskranker Pärchen sowieso nicht aushalten.
Gerade spießte ich das letzte Stück Speck mit meiner Gabel auf, als wäre es ein besonders ekelerregendes Insekt, da trat Stewart an meinen Tisch. »Guten Morgen, Miss Keith.«
»Bitte, nennen Sie mich Cate. Und wir können uns auch sehr gerne duzen.«
»Dabei ist Catriona so ein schöner Name«, sagte er schmunzelnd, wobei sich tiefe Lachfalten um seine blauen Augen zeigten. »Ein sehr alter gälischer Name.«
Ich blinzelte überrascht. Zeit meines Lebens hatte ich Probleme mit meinem Namen gehabt. In Kanada, und später auch in New York, hatten sowohl meine Lehrer als auch meine Kollegen und sogar Freunde ihn ständig falsch ausgesprochen. Immer wieder musste ich erklären, warum man das o nicht aussprach. »Nein, es heißt nicht Catri-o-na, sondern Catrina.« Noch nie hatte ich ein Kompliment für meinen verfluchten Namen bekommen.
Ich deutete auf den Stuhl mir gegenüber. »Möchtest du dich zu mir setzen, Stewart?«
Er nahm Platz und schenkte mir ein breites Lächeln. »Du hast Glück. Heute soll die Sonne den ganzen Tag über scheinen. Das passiert hier äußerst selten um diese Jahreszeit. Wenn du möchtest und noch nichts anderes vorhast, würde ich dich gerne auf eine Bootstour über den Loch mitnehmen.«
Meine Laune hellte sich schlagartig auf. »Das wäre wunderbar.«
»Gut, dann treffen wir uns in einer halben Stunde unten am Pier. Zieh dich trotz des sonnigen Wetters bitte warm an. Auf dem Boot ist es immer frisch.«
Er erhob sich und nickte mir noch einmal zu. Am liebsten wäre ich ihm um den Hals gefallen. Er hatte meinen Tag gerettet.
Heute war die Wasseroberfläche alles andere als unbewegt. Ein frischer Wind wehte, als ich an den Steg trat, der weit auf den See hinausführte. Vier unterschiedlich große Boote schaukelten daneben hin und her. Kleine Wellen schwappten ans Ufer, der gesamte See war in Bewegung. Die wenigen Wolken jagten über den Himmel, und durch den sich stetig ändernden Lichteinfall wirkte es, als veränderte das Wasser ständig seine Farbe. Das leuchtende Grün wurde zu einem Tiefblau, dann Blaugrau und schließlich fast Schwarz, als sich eine dicke Wolke vor die Sonne schob.
Stewart winkte mir von einem der Boote aus zu, und ich beeilte mich, über den Steg zu ihm zu laufen. Das weiße Boot erinnerte mich an einen Fischkutter, auch wenn es beinahe die Größe einer kleinen Fähre hatte. Es hätten noch viele weitere Passagiere Platz gehabt, aber es war weit und breit niemand zu sehen. Nur in der Ferne konnte ich ein paar bunte Regenjacken als verschwommene Flecken in der Landschaft ausmachen – Touristen, die gerade einen der nah gelegenen Berge erklommen.
Stewart winkte mir zur Begrüßung zu und folgte meinem Blick. »Um diese Jahreszeit gibt es hier noch nicht viele Touristen«, erklärte er.
»Was für ein Glück ihr habt, an so einem wunderschönen Ort zu leben«, sagte ich zu ihm, während ich das leicht schaukelnde Boot betrat.
»Glück?« Er hob eine Augenbraue. »Denkst du nicht, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist?«, fragte er, bevor er im Inneren einer verglasten Kabine an Deck verschwand, um den Motor anzulassen. Ich sah ihm verdutzt nach.
Natürlich glaubte ich daran, schließlich war ich nur durch harte Arbeit und Fleiß an dem Punkt in meinem Leben angekommen, auf den ich seit Jahren hingearbeitet hatte. Ich war eine erfolgreiche Journalistin in New York, mit Abschlüssen von renommierten Universitäten und einem Praktikum beim New Yorker. Ich konnte doch nicht einfach in ein Schloss an einem schottischen Loch ziehen, um glücklich zu sein. So hatte ich das nicht gemeint.
Aber warum eigentlich nicht?, fragte eine Stimme in meinem Kopf. Du allein bist deines Glückes Schmied. Wenn du in der Natur glücklicher wärst als im Großstadtdschungel, würdest du es dann nicht tun? Würdest du nicht alles daransetzen, glücklich zu sein?
Ich schüttelte den Kopf. Meine Familie, meine Freunde, mein Job … Ben. Mein ganzes Leben war in New York oder zumindest auf demselben Kontinent. Ich hatte oft von Leuten gehört, die alles aufgegeben hatten und ausgewandert waren. Das hatte ich schließlich auch getan.
Von Kanada in die USA zählt nicht, zischte die gehässige Stimme in meinem Kopf.
Es stimmte, dass ich immer vorgehabt hatte, die Welt zu bereisen, dass mir meine Karriere dann aber wichtiger geworden war. Außerdem hatte ich gleich nach dem Studium Ben getroffen – mein goldenes Ticket in die High Society New Yorks und vor allem in die Verlagswelt. Gemeinsam hatten wir schon einige aufregende Reisen gemacht.
Reisen, die von den Eltern des reichen Verlobten spendiert werden und die man in Fünf-Sterne-Hotels verbringt, zählen auch nicht.
Ich verdrehte die Augen und seufzte. Ich musste einen Weg finden, abzuschalten und all diese Gedanken auszusperren.
Der Wind zerrte mittlerweile an meinem Haar, das unter meiner grünen Mütze hervorlugte. Als das Boot Fahrt aufnahm, zog ich die Mütze noch weiter über die Ohren und gesellte mich zu Stewart in die kleine Fahrerkabine. Seine schwieligen Hände lagen auf dem Steuerrad. »Hab doch gesagt, dass es frisch wird.«
»Die Kälte macht mir nichts aus. Ich komme aus Kanada. Aber der Wind hier ist schon ziemlich schneidend.«
Er warf mir einen erstaunten Blick zu. »Wo in Kanada?«
»Nova Scotia, aus einer Kleinstadt in der Nähe von Halifax.«
»Ach, Neuschottland«, sagte er nachdenklich. »Viele Schotten sind im 18. Jahrhundert nach der letzten Rebellion gegen die Engländer in die Region ausgewandert.«
Ich nickte. Ich kannte die Geschichte um Bonnie Prince Charlie und die letzte große Schlacht der Schotten gegen die Engländer im Jahr 1746 aus dem Geschichtsunterricht. Danach war die gälische Kultur beinahe ausgelöscht worden. Viele Schotten waren in die Neue Welt geflohen oder als Kriegsgefangene dorthin verschifft worden.
»Meine Vorfahren kommen aus Schottland«, erklärte ich.
Stewarts Kopf fuhr zu mir herum, und er musterte mich zum ersten Mal von Kopf bis Fuß. Sein Blick blieb, wie auch schon Grahams zuvor, an meinen Haaren hängen.
»Ich frage mich, wann sie wohl genau ausgewandert sind und warum«, fuhr ich fort. »Ob sie politisch verfolgt wurden oder einfach ein besseres Leben wollten.«
»Das lässt sich sicher herausfinden«, antwortete er.
Ich erwiderte seinen direkten Blick. Stewart hatte, vermutlich, ohne es zu beabsichtigen, ein politisches Thema angesprochen, und ich witterte meine Chance. Er tat mir jetzt schon leid. Er war mit einer unerbittlichen Journalistin stundenlang auf einem Boot gefangen. Er hatte ja keine Ahnung, was da auf ihn zukam.
Ich wollte ihn gerade fragen, wie er vor zwei Wochen beim Referendum abgestimmt hatte, da schoss seine Hand vor und zeigte auf etwas in der Ferne.
Vor uns lag nichts als der weite, offene See, rechts und links flankiert von bewaldeten Hügeln. In der Ferne konnte ich vage erkennen, wie sich der See um eine Biegung schlängelte. Die Sonne war wieder hervorgekommen und glitzerte auf dem Wasser, sodass ich die Augen zusammenkneifen musste, um etwas in der Richtung zu erkennen, in die Stewart zeigte.
»Ein Steinadler!«, rief er freudig erregt.
Ich sah gerade noch, wie ein riesiger Greifvogel vom Wasser aufstieg. In seinen Krallen zappelte etwas.
Ich heuchelte Interesse, riss die Augen auf und gab ein paar erstaunte Laute von mir. In Wahrheit interessierte ich mich aber nur für eins: Stewarts politische Einstellung. Adler hatte ich schon Hunderte in meinem Leben gesehen.
»Was für ein besonderer Moment«, sagte Stewart. »Schade, dass wir nicht schnell genug waren, um ein Foto zu machen.«
Ich sah auf die Kamera herab, die unberührt um meinen Hals hing. Ich hatte noch nicht einmal daran gedacht, ein Foto zu schießen, als er mir den Adler gezeigt hatte.
»Ja, wirklich schade«, murmelte ich. »Aber was ich dich eigentlich fragen wollte …«
»Es gibt nicht nur Adler, Eichhörnchen und Rehe hier, weißt du?«, unterbrach er mich mit einem belustigten Seitenblick. Er musste mein Desinteresse gespürt haben. Für eine Journalistin war ich manchmal wirklich eine miserable Schauspielerin. Ich brauchte eine Strategie, musste mich ihm auf andere Weise annähern. Er interessierte sich eindeutig für Flora und Fauna. Ich würde ihn erst ein wenig erzählen lassen und dann eine passende Überleitung finden.
»So, was gibt’s denn sonst noch?«, fragte ich und gab mir diesmal Mühe, interessierter zu klingen.
»Besonders nachts solltest du dich nicht allein am See herumtreiben.« Seine Stimme hatte einen verschwörerischen, tieferen Klang angenommen. »Da lauert so einiges unter der Wasseroberfläche.«
»Willst du mir etwa weismachen, ihr hättet hier auch so ein Monster wie im Loch Ness?« Ich verdrehte die Augen. »Ist das nicht nur eine Touristenfalle?«
»Loch Ness kannst du dir sparen, ein einziger Zirkus«, lachte Stewart. »Die wahren Monster gibt es hier im Loch Lomond. Schon mal von Kelpies gehört?«
Ich schüttelte den Kopf und seufzte innerlich. Stewart schien ganz in seinem Element zu sein. Ich wollte nichts über Mythen und Legenden hören. Ich war schon immer im Hier und Jetzt verankert gewesen, stand mit beiden Beinen fest auf dem Boden und hatte keine Zeit für Spukgeschichten. Doch er fuhr schon fort.
»Es sind Wassergeister, die Seen und Flüsse heimsuchen und Wanderer in die eisigen Tiefen hinabziehen. Sie erscheinen meist in Gestalt eines wunderschönen, weißen oder schwarzen Pferdes, nur zu erkennen an der tropfenden Mähne. Sobald du dich ihnen näherst, um sie zu streicheln oder zu reiten, ziehen sie dich unter Wasser.«
»Eine clevere Geschichte, um kleinen Kindern Angst einzujagen und sie vom Wasser fernzuhalten« bemerkte ich, doch Stewart ließ sich nicht beirren.
»Manche glauben, dass Kelpies auch eine menschliche Form annehmen können. Sie erscheinen als wunderschöne Männer und Frauen, deren Anziehungskraft du dich nicht entziehen kannst. Bist du ihnen einmal verfallen, kannst du ihrem feuchten Grab auf dem Grund des Sees nicht mehr entkommen.«
Wieder schob sich eine Wolke vor die Sonne, und das Wasser nahm einmal mehr eine tiefschwarze Farbe an. Ich starrte auf die Wellen und fröstelte unwillkürlich. Wie tief war der See wohl an dieser Stelle? Wer wusste schon, was sich wirklich unter der Oberfläche herumtrieb?
Ich dachte dabei zwar eher an riesige, blinde Fische, konnte aber verstehen, warum manche Leute auch heute noch an Spukerzählungen über Kelpies und dergleichen glaubten. Dieser Ort hatte einfach etwas Magisches.
Stewarts Stimme riss mich aus meinen düsteren Gedanken. »Natürlich sind weder das Monster von Loch Ness noch die Kelpies auch nur annähernd so grausam und blutrünstig wie das Feenfolk, die sìthichean. Sie treiben ihre schauerlichen Spielchen schon seit Anbeginn der Zeit mit uns Menschen.«
Ich sah ihn verständnislos an. Wenn ich an Feen dachte, kam mir sofort Tinkerbell aus Walt Disneys Peter Pan in den Sinn. Kleine süße Kreaturen mit spitzen Ohren und Flügeln.
»Es soll ihnen besonders viel Spaß machen, Menschen an der Nase herumzuführen«, fuhr Stewart fort. »Sie locken sie in ihre Welt und lassen sie nicht mehr gehen, bringen Reisende vom Weg ab und entführen sogar kleine Kinder. Du hast sicher von Wechselbälgern gehört.«
Ich schüttelte stirnrunzelnd den Kopf und fragte mich innerlich, wie dieser harmlose Ausflug sich so schnell in einen Horrortrip verwandelt hatte.
»Man glaubt, dass Feen Babys stehlen und an ihrer statt ein Feenkind zurücklassen. Die Eltern ziehen dann unbewusst eine Fee heran und sehen ihr eigenes Kind nie wieder, das unter den Feen aufwächst.«
Stewart lachte, als würde er sich an etwas erinnern. »Als Kind habe ich immer gedacht, dass es sicher schön wäre, im Feenreich zu leben, wo immer Sommer herrscht. Ich bin auf Bäume geklettert und durch Hügel gewandert, um nach Eingängen zu suchen. Bis meine Eltern mir erzählt haben, dass einige Feen sich von Menschenfleisch ernähren und die gestohlenen Kinder als Sklaven unter den Feen leben und harte Arbeit verrichten müssen. Aus war der Traum.«
Er seufzte. »Wer kann schon mit Sicherheit sagen, was wahr ist und was nicht. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollte man die Feen aber auf keinen Fall verärgern.«
Ich zog fragend die Augenbrauen hoch und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ach ja?«
»Zum Beispiel, indem man ihre Behausungen in Hügeln und Bäumen zerstört«, erklärte er. »Daran hält man sich noch heute. In den Highlands wurde vor einigen Jahren eine Straße um einen Weißdornbaum herum gebaut, statt ihn zu fällen, da man glaubte, dass eine solche Tat den Tod durch Feenhand bedeuten könnte. Ein sehr beliebter Feenbaum, der Weißdorn.«
Er zwinkerte mir zu, und ich konnte nicht anders, als zu schnauben. Diese absurde Geschichte würde ich recherchieren!
»Und dann ist da noch die Legende der Bean-Nighe«, sagte Stewart mit leiser, verschwörerischer Stimme. »Sie erscheint als altes Fischweib an Bächen und Teichen, wo sie die Kleider derjenigen wäscht, die bald sterben müssen.«
Er lachte über mein unwillkürliches Schaudern.
»Der Pub-Besitzer im Dorf schwört, dass er eine gesehen hat, einen Tag bevor seine Mutter gestorben ist.«
Nun konnte ich nicht anders, als laut zu lachen, und Stewart fiel in mein Lachen ein.
»Keine Sorge, es gibt auch nette Feen. Brownies erledigen zum Beispiel nachts die Hausarbeit für dich.«
»Na, wenigstens etwas«, gluckste ich.
Zumindest hatte ich heute eins gelernt: Die Schotten besaßen eine äußerst ausgeprägte Fantasie und einen viele Hundert Jahre zurückreichenden Aberglauben.
Nach und nach wurde es voller auf dem See, und andere Boote gesellten sich zu uns. Einige Kapitäne grüßten Stewart mit lautem Gehupe und freudigem Winken.
Emily hatte uns ein Picknick zum Mittagessen eingepackt. Wir hielten das Boot mitten auf dem See an und aßen unser Brot und den Black Pudding, eine Art Fleischwurst aus gebackenem Schweineblut. Von unserem Platz aus hatten wir einen atemberaubenden Ausblick auf die Berge. Auf vielen der entfernteren Gipfel lag noch Schnee.
»Die hohe Bergspitze, die du dort hinten siehst, gehört Ben Nevis. Das ist der höchste Berg Großbritanniens«, erklärte Stewart stolz.
Als wir weiterfuhren und er mich hin und wieder auf die eine oder andere Sehenswürdigkeit am Ufer aufmerksam machte, kam ich endlich dazu, ihn nach dem Referendum und seiner politischen Einstellung zu fragen. Ich schrieb fünf Seiten meines Notizbüchleins voll.
Wir kehrten erst zum Pier zurück, als die Sonne schon tief stand und ihr rotgoldenes Licht weit gefächert über den See warf. Erst als ich einen Fuß auf den Steg setzte, fiel mir auf, dass ich den gesamten Nachmittag über nicht an Ben oder die Zukunft gedacht hatte.
Kapitel 5
A