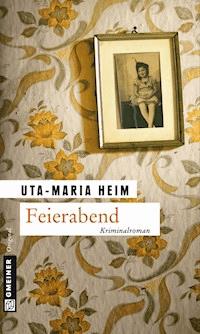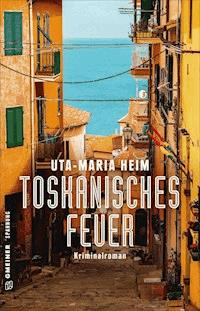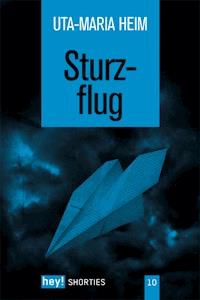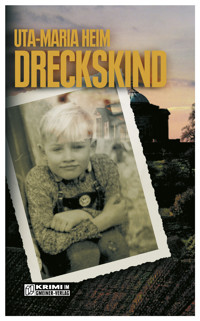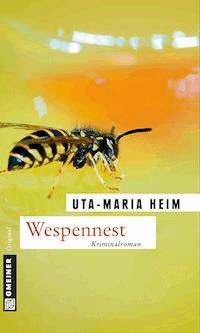Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1790 wanderte der Theologiestudent Friedrich August Köhler von Tübingen nach Ulm - und verfasste den ersten »Wanderführer« der Schwäbischen Alb. Uta-Maria Heim nimmt diese reale Reise zum Anlass und imaginiert klug und humorvoll das Aufeinandertreffen von fünf jungen Rebellen, die alle vom Zeitgeist der Französischen Revolution beseelt sind - jeder auf seine Weise: Der heimatverbundene Köhler möchte Land und Leute studieren. Seine Kommilitonen vom Tübinger Stift, Hölderlin und Hegel, sowie der junge Schelling begleiten ihn durch die kargen Dörfer und die herbstliche Landschaft - sie verbindet das Streben nach Höherem. Und das eigensinnige Mädchen Karoline von Günderrode, das eine große Sehnsucht nach einem selbstbestimmten Leben in sich trägt, vermittelt virtuos zwischen diesen Welten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uta-Maria Heim
Albleuchten
Eine Herbstreise 1790
Zum Buch
Welt im Umbruch Herbst 1790: Der Theologiestudent Friedrich August Köhler wandert von Tübingen über die Schwäbische Alb nach Ulm. Hölderlin und Hegel, seine Kommilitonen am Tübinger Stift, begleiten ihn. Eigentlich hat er keine Lust auf die zwei, aber er fürchtet sich vor den Gaunerbanden, die überall lagern. Mit der Schwarzen Lies hatte er als Kind schon eine Begegnung. Während Hölderlin und Hegel, blind für das Tatsächliche, nach höheren Wahrheiten streben, geht Köhler mit offenen Augen über die Alb und lernt die traditionellen Lebensformen kennen. Bald schließt sich ihnen der 15-jährige frühreife Schelling an. Er hat ein Jahr zuvor die »Geschichte des Klosters Bebenhausen« verfasst, wovon Köhler sehr beeindruckt ist. Solch eine verschriftlichte Beobachtung von Land und Leuten schwebt ihm auch vor, am besten in Form eines Reisejournals von seiner Wanderung über die Alb. Seine Reisegefährten verspotten ihn deshalb. Zu allem Überfluss taucht auch noch ein eigensinniges Mädchen auf und lässt sich nicht mehr abschütteln: Karoline von Günderrode.
Uta-Maria Heim, 1963 in Schramberg geboren, lebt als Hörspieldramaturgin, Dozentin und Autorin in Baden-Baden. Sie studierte Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie in Freiburg und Stuttgart und arbeitete ab 1983 als Journalistin, Kritikerin und Schriftstellerin. Zuletzt erschienen im Gmeiner-Verlag die Toskana-Krimis »Toskanische Beichte«, »Toskanisches Feuer«, »Toskanisches Blut« und »Toskanisches Erbe«. Mit Hölderlin beschäftigt sich Uta-Maria Heim seit vielen Jahren. In den Fußstapfen Köhlers ist sie von Tübingen nach Ulm gewandert. Sie erhielt zweimal den Deutschen Krimi-Preis, außerdem den Förderpreis Literatur des Kunstpreises Berlin, ein Stipendium der Villa Massimo in Olevano Romano sowie den Friedrich-Glauser-Preis. Sie ist Mitglied des PEN.
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2022 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Christine Braun
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_August_Zimmermann_Schwäbische_Alb.jpgISBN 978-3-8392-7408-8
TAG 1 23. SEPTEMBER 1790
Tübingen
Ich muss nach Ulm. Als ob ich nichts anderes zu tun hätte. Ich habe wahrlich genug Verpflichtungen! Außerdem stiehlt es mir die ganzen Herbstferien. Denn als mittelloser Student muss ich den weiten Weg zu Fuß laufen.
Fritz und der Alte wollen mich auf der Wanderung begleiten. Erst zögerte ich. Denn meine beiden Kommilitonen, die mit mir auf der Stube wohnen, halten sich für grandios und meinen, sie seien etwas Höheres. Sie wollen die Welt verbessern. Sie schwärmen von den Umstürzen in Griechenland und Frankreich und wollen einen unvergänglichen Roman oder ein revolutionäres philosophisches Traktat schreiben. Ihr verstiegener Idealismus geht mir gehörig auf die Nerven! Sie sind eine echte Prüfung. Aber zu dritt lässt sich die Strecke leichter bewältigen.
Ich werde ihnen zeigen, dass auch ich eine Mission habe: Ich mag von der weiten Welt wenig wissen, doch ich interessiere mich für die Verhältnisse auf der Schwäbischen Alb. Ich werde ein Reisejournal verfassen, das die Zeitgenossen über die Zustände in der Heimat aufklärt.
Es ist der 23. September, ein Donnerstag. Ein Tag nach Herbstanfang. Kurz nach 14 Uhr brechen wir endlich auf. Am Morgen haben sich die Frühnebelfelder rasch aufgelöst, wacker scheint die Sonne am beständig blauen Himmel, der Herbst hat gerade erst begonnen. Fritz und der Alte schnallen sich ihre geschnürten Felleisen auf den Rücken. Wir verlassen das Stift und gehen an einigen Hauptgebäuden vorbei durch Tübingen. Der Neckar glitzert im warmen Licht der Sonne.
»Es stinkt nach Most«, stellt Fritz fest. Er klingt vergnügt. Der Fritz ist ein strammer Wanderer, groß und kräftig gebaut. Er ist es gewohnt, lange Strecken zügig zu Fuß zurückzulegen, und er braucht das ausdauernde Marschieren für die innere Ruhe und Einkehr.
»Und überall liegt Pferdemist.« Auch der Alte wirkt recht munter. Allerdings steht ihm die Klage wie stets ins Gesicht geschrieben. Um Geld zu sparen, ließ er sich seine Wanderschuhe eine Nummer kleiner fertigen. Das bereut er bereits beim Gang aus der Stadt.
Fritz legt ein beachtliches Tempo vor, das er vermutlich tagelang durchhalten kann. Der Alte folgt ihm ambitioniert. Er ist ein halbes Jahr jünger als Fritz und wohl von Kind auf ungelenk, plump und im Gesicht greisenhaft. Daher sein Spitzname. Alle im Stift heißen ihn »der Alte« oder der »alte Mann«, niemand nennt ihn bei einem seiner Vornamen. Bei jedem von uns dreien lautet einer davon Friedrich, kurz: Fritz. Seinen Spitznamen lässt sich der Alte gefallen. Dabei ist er in jeder Hinsicht ehrgeizig und wird leicht unterschätzt.
Schon nach kurzer Zeit rühmen beide die Vorzüge der ungeheuerlichen Tumulte in Frankreich mitsamt dem Firlefanz von Paris und schimpfen auf die rückständige Heimat. Ich laufe emsig hinterher und schweige. Mich fechten diese ganzen Staatsumwälzungen und politischen Neuerungen nie ängstlich an, aber sie lassen mich auch nicht in ein Hurrageschrei ausbrechen. Ich finde, wir haben es ganz gut getroffen in unserem Württemberg, es ist stets auszuhalten. Die Obrigkeit kommt und geht – mal würgt uns hartes Geschirr, und mal führt man uns locker am Gängelband. Überall Fortschritt, und Hauptsache ist sowieso, dass die Franzosen uns keinen Krieg bringen. Im Übrigen gibt es keinen besseren Flecken als die Heimat.
Da sind meine beiden Weggefährten ganz anderer Meinung. Dem »alten Mann« gelingt es, trotz der Strapazen eine Tirade auf die Deutschen auszustoßen, die an Gemeinheit kaum zu überbieten ist: »Barbaren von alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefunfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark zum Glück der heiligen Grazien, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gutgeartete Seele, dumpf und harmonielos, wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes.1 – Du kannst den Gedanken geschenkt haben. Behalt ihn für deinen Roman.«
»Vergelt’s Gott«, sagt Fritz. »Aber.« Dann stockt er.
Ich habe den Alten noch nie einen so langen Satz sagen gehört. Normalerweise ist er nicht in der Lage, zusammenhängend zu sprechen. Er nuschelt, näselt, stockt, stottert und poltert, und sein Schwäbisch ist noch sagenhafter als Fritzens. Obwohl er aus Stuttgart kommt und der Fritz und ich eher vom Land stammen. Ich bin erst im Schwarzwald aufgewachsen, dann auf der Alb, und habe mich, um nicht verlacht zu werden, beizeiten an das älblerische Schwäbisch angepasst. Ich schwätze fast so wie der Fritz. Der Alte nimmt mich trotzdem nicht ernst und meint, ich sei kein großer Kopf. Er heißt mich »das Fritzle«. Und Fritz tut es ihm gleich.
»Es ist ein hartes Wort und dennoch sag ich’s, weil es Wahrheit ist: Ich kann kein Volk mir denken, das zerriss’ner wäre wie die Deutschen«, pflichtet der gute Fritz ihm nun bei.
»Handwerker siehst du, aber keine Menschen«, ruft der Alte, bestärkt durch den Beifall, als ein Zimmermann uns entgegenkommt und freundlich den Hut schwenkt.
»Denker, aber keine Menschen«, ergänzt Fritz voller Spott und Hohn und deutet mit dem Daumen hinter sich auf mich.
»Priester, aber keine Menschen«, bekräftigt der Alte und wendet den Kopf.
»Herrn und Knechte …«
»Jungen und gesetzte Leute …«
Sie werfen einander die Brosamen zu und picken sie auf wie die Hennen. Es ist ihre geteilte Lust am Sinnieren, die sie zu zweit ausbrüten und wo sie keinen hineinlassen.
»Aber keine Menschen –« Fritz bricht ab.
Der »alte Mann« bleibt kurz stehen und rauft sich die Haare. Dann weist er mit einer weit ausholenden Geste auf einen Acker. »Ist das nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergoss’ne Lebensblut im Sande zerrinnt?«
Die zwei Schafmelker spazieren einträchtig und zufrieden weiter. Was für eingebildete Lackel! Aus jedem ihrer Vorwürfe spricht der Vorteil einer standesgemäßen Geburt, das Vorurteil einer tauben Jugend, die satte Selbstzufriedenheit der Bessergestellten, der Dünkel der Ehrbarkeit. Diese Leute sind allesamt miteinander verwandt! Auch Fritz und der Alte sind weitläufige Vettern, deren Abstammung auf eine illustre Geistesmutter zurückgeht, und Teil einer ansehnlichen Vetternwirtschaft. Obwohl sie so tun, als bewegten sie sich in einem barbarischen Umfeld, sind sie beschützt durch ihre Herkunft, gesegnet mit Geld und guten Gaben und privilegiert. Überhaupt, was für ein Blödsinn, das böse Bild mit dem Schlachtfeld, wo doch die Sonne scheint und uns entgegenkommende Passanten höflich grüßen!
Die zwei glauben, aus ihnen werde was. Aber beide werden es zu nichts bringen. Der Fritz nicht, weil er zu viele Flausen im Kopf hat, und der Alte nicht, weil er säuft wie ein Loch. Zudem ist er maßleidig, grätig, närrisch, qualtätig und händelsüchtig. Beide wollen nicht Pfarrer werden. Ja, aber was sonst? Fritz schreibt Gedichte und träumt von brotloser Kunst. Der »alte Mann« kann nicht mal das.
Ich rege mich nicht auf, sondern laufe hinter den beiden her, ohne ihrer Unterhaltung noch weiter zu folgen. Auf einer gut ausgebauten trockenen Straße geht es Richtung Hechingen. Zu beiden Seiten ziehen sich Rebhänge und Felder entlang der Chaussee. Ich bin bester Dinge, denn vor uns liegen nur gut zwei Stunden Weg, wir besuchen meine Eltern in Nehren südlich von Tübingen. Dort können wir übernachten. Morgen früh soll es dann richtig losgehen. Ich rechne circa sechs Tage bis nach Ulm, wo ich scheint’s etwas zu besorgen habe.
1 Friedrich Hölderlin: Hyperion oder der Eremit in Griechenland. Zweiter Band. Tübingen 1799, S. 112f. Die Autorin erlaubt sich in ihrem Roman, einer literarischen Fiktion, Hölderlin- oder Hegel-Zitate im Schlagabtausch der jungen Studenten entstehen zu lassen. Hier und im Folgenden durch Kursivierung kenntlich gemacht. Erfolgt kein Nachweis, stammt das Zitat aus der zuletzt angegebenen Quelle.
Steinlachtal
Wir erreichen die Mündung des Steinlachtals, das sehr fruchtbar und bunt bestellt ist. Zunächst steigt uns jedoch ein übler Gestank in die Nase. Oberhalb des Bläsibads verpestet stehendes Gewässer die Luft, worüber der Alte natürlich seinen Unwillen äußert.
Doch dann kommen wir in wirtliche Gegenden voller Stoppelfelder und grüner Wintersaat. Die Steinlach fließt hier ruhiger als bei Tübingen, wo sie als reißender Strom in den Neckar mündet. Das Ufer schlängelt sich schön durch das Tal, das sich bald verbreitert. Im Fluss spiegelt sich das bunte Laub der Bäume, durch das die Sonne fällt. Hier im Tal wachsen unter anderem Kraut, Hafer, Gerste, Dinkel und Welschkorn.2 Jetzt allerdings ist alles abgeerntet, und man kann den Stoppelfeldern nicht mehr ansehen, welches Getreide in diesem Jahr angebaut wurde. Die Fruchtfolge wird abgewechselt, und im dritten Jahr liegt das Land brach. Jedoch wird auch das Brachland immer häufiger genutzt für Rüben, Gartengewächse und Futterkräuter. Nur noch selten weiden bloß Schafe darauf. Die Bauern bewirtschaften ihre Felder unter penibler Einhaltung der Trepprechte, wo alles beim Pflügen und Eggen mit dem Spannvieh genauestens geregelt ist. Das geht sogar so weit, dass vorgeschrieben ist, wie viele Schritte der Ochse zum Wenden des Pflugs in das Nachbargrundstück eindringen und wie lange er dazu brauchen darf.
Am Wegesrand blühen immer noch die Wicken. Ihre lilafarbenen und violetten Blüten sind glockenförmig, und die Stängel ragen krautig aus dem Gras. Wo sich gegen Osten hin das Neckartal mit dem Steinlachtal vereinigt, stand an exponierter Stelle der Galgen. Das einfache Volk, der Pöbel, nannte ihn »Hochgericht«. Erst letztes Jahr wurde er abgebaut und an einen entlegenen Ort versetzt. Daran sieht man, wie sich die Zeitläufte ändern. Wollten unsere Väter mit Fleiß für Abschreckung sorgen, indem sie die Todesstrafe direkt an der belebten Straße vollzogen, nehmen wir heute Rücksicht auf sensiblere Seelen, die das beschädigen könnte.
Zuerst wollte ich die zwei hoffärtigen Hutsimpel gar nicht mitnehmen. Es reicht mir, dass sie mit mir und ein paar anderen zusammen im Stift wohnen. Ich konnte mir wahrhaft Vergnüglicheres vorstellen, als mit ihnen auch noch meine Herbstferien zu verbringen. Es ist mir sowieso ein Rätsel, wieso sie mich auf meiner Wanderung begleiten wollen. Ich habe kein Geld und kann mir kein Pferd leisten, die beiden aber schon. Vermutlich will der Fritz einfach über die Ferien zu Fuß unterwegs sein, zur Not halt mit mir, weil wir beide begeisterte Wandervögel sind. 14 Tage sind ungefähr geplant, und der Alte will Fritz das nicht gönnen. Er drängt sich dazwischen, weil er außer Fritz keinen richtigen Freund hat. Um ihn nicht zu verlieren, nimmt er es sogar auf sich, zu dritt von Tübingen nach Ulm zu laufen. Und wieder zurück.
Erst habe ich mich gegen die Begleitung gewehrt, doch dann sah ich ein, dass sie auch Vorteile hat. Ich muss Religions-, Gebiets- und Landesgrenzen überwinden. Dort sind Bestechung, Bedrohung und Betrug gang und gäbe. Überall treiben sich Lumpen und Spitzbuben herum, Pack und Geziefer jeder Couleur. Zudem sind massig obskure Gestalten, Poltergeister, Scheintote, Hexen und Gauner unterwegs, nachts spukt es in den Wäldern, in den Gasthöfen gespenstert Gesindel. Das klingt vielleicht übertrieben, doch es ist wirklich wahr. Das beste Beispiel dafür ist mir persönlich bekannt. Mit Grauen denk ich an die Schwarze Lies, die Erzdiebin und Vagantin Elisabetha Gaßnerin. Kriminell wurde sie schon mit 13 Jahren. Sie kam als Sackgreiferin von der Schweiz über den Schwarzwald bis auf die Schwäbische Alb. Nachgewiesen wurden ihr Raubdelikte in Höhe von insgesamt 5.859 Gulden. Sie wurde verhaftet, in Oberdischingen ins Zuchthaus gesteckt und vom Malefizschenk verurteilt. Er begnadigte sie quasi, indem sie nicht gehenkt, sondern enthauptet werden sollte. Da sie beim Prozess angab, guter Hoffnung zu sein, hat man die Hinrichtung sogar verschoben. Zwei Jahre ist es jetzt her, am 16. Juli 1788, dass sie in Oberdischingen mit dem Schwert geköpft wurde.
Woher ich das so genau weiß? Ich hab alles gelesen, gesammelt und aufgeschrieben, was man über die Gaßnerin in Erfahrung bringen kann. Weil sie mir einen lebenslangen Schreck verpasst hat. Ich bin der Schwarzen Lies nämlich als kleiner Bub beim Pulverturm am Hornberger Schloss begegnet. Dort hab ich mit meinen Spielkameraden Verschlupferles gespielt. Die Beutelschneiderin hat mich hinter dem Felsen gepackt und mir mit dem Sackmesser die Hirschhornknöpfe von der Hose abgehauen. Daheim hab ich dafür links und rechts eine an die Backen gekriegt. Ich wurde mit Strafe belegt, nur weil ich die Wahrheit gesagt habe! Aber der Vater hat mir freilich nicht geglaubt.
Schlimmer als die gestohlenen Hosenknöpfe war, was die Schwarze Lies mir prophezeit hat. Sie hat gedroht, dass der Nachtkrabb kommt, mich in einen Sack steckt und frisst, wenn ich vor Einbruch der Dämmerung nicht wieder daheim bin. Mir war klar, dass ich das kaum schaffen würde. Denn die Sonne ging schon unter und die Spielkameraden waren fortgelaufen. Wie sollte ich allein den weiten Weg finden? Ganz auf mich gestellt und von allen guten Seelen verlassen rannte ich in das pietistische Elternhaus zurück, wohl wissend, was mich dort erwartet.
Als vor Kurzem feststand, dass ich zu Fuß nach Ulm reise, fürchtete ich mich davor, auf der Wanderschaft wieder bedroht und bestohlen zu werden. Und erneut keinen Glauben zu finden und abgestraft zu werden am End. Lieber werde ich ausgeraubt und dabei schwer verletzt, dachte ich, dann wäre jedem klar, dass ich die Wahrheit sage. Oder von mir aus erschossen, dann käme ohnehin jede Strafe zu spät. Doch das war freilich keine Lösung. Also: Griffel weg! Deshalb ließ ich mich von den zwei tauben Burschen überreden – aus Angst, aus reiner Angst tat ich das. In meinem Reisebericht, den ich aus diesen Aufzeichnungen verfassen will, werde ich dieses Motiv aber verschweigen. Und am besten erwähne ich auch nicht, wer meine treuen Begleiter sind. Ich habe schließlich auch meinen Stolz!
2 Als »Welschkorn« bezeichnete man Mais.
Dußlingen
Wir erreichen unten im Tal Dußlingen. Den Einwohnern sagt man nach, dass sie die ungeschliffensten und unflätigsten Leute in der ganzen Gegend seien. Rechte Dussel eben. Damit sind die beiden Hutsimpel schon wieder am Schimpfen und Schelten, obwohl sich kein Mensch auf der Gasse zeigt. Über uns schwebt ein breitflügeliger Bussard, verhöhnt und verfolgt von einem Krabb3, der ihn stupft und scheucht. Dabei stößt er schrille, krächzende Laute aus.
Fritz zeigt mit dem Finger hinauf. »Ein absoluter Quälgeist.«
»Der absolute Geist!«, schreit der Alte begeistert. »Kunst. Religion. Philosophie.«
»Und alles Getrennte«, spottet der Fritz, »findet sich wieder.«4
»Das ist«, sage ich, »Dialektik. These, Antithese, Synthese.«
»Das Fritzle.« Fritz bleibt stehen, grimassiert und fuchtelt wegwerfend. »Komm, gang mer weg. Was versteht Er von der Kunst der Unterredung?«
Der Alte langt nach seinem Sacktuch und tupft sich die Stirn.
»Es geht um die Lehre von den Gegensätzen in den Dingen beziehungsweise den Begriffen«, entgegne ich, »sowie um die Auffindung und Aufhebung dieser Gegensätze.« Ich weiß selber nicht, wo ich das jetzt herbringe.
Wir drei stehen wie die Grasdackel mitten auf der Straße. Wie angewurzelt. Der Alte bückt sich nach dem Sacktuch, das ihm runtergefallen ist.
»Interessant«, proletet er laut. »Man hebt etwas auf, indem man es aufhebt, und damit hebt man es auf.«
»Das«, bestätige ich, »habe ich damit sagen wollen.«
Als wir Dußlingen passieren, haben wir bereits zwei Stunden Wegs hinter uns. Fritz und der Alte laufen blicklos durch das Dorf. Die Hauptstraße säumen Wirtshäuser, sie sind wie die übrigen Häuser und Scheuern des Tals mit Stroh bedeckt. Die meisten Hauswände werden nicht wie in der Stadt hochgemauert, sondern das Balkenwerk wird mit einer Mischung aus Holzsplittern, Mörtel und Kalk verbunden. Die Kirche steht auf einer Anhöhe, die teilweise bewaldet ist. Nach dem Gestank auf dem Bläsiberg genießen wir die klare Luft hier.
Oben biegen wir von der Chaussee ab und wandern über die Wiesen Richtung Nehren. Sie werden nur zweimal im Jahr abgemäht, danach weiden Kühe darauf. Die sind kleinwüchsig und nicht allzu robust, weil sie zu früh trächtig werden. Nehren hat keinen Kälberhirten, der auf die Stiere aufpasst, und die Kalbinnen geben schon Milch, ehe sie zwei Jahre alt sind. Den Bauersleuten ist das recht; sie wollen nicht einsehen, dass es für die Viehzucht schädlich ist.
Inmitten der fruchtbaren Herbstlandschaft hinkt uns ein Bettler entgegen, der arg gebrechlich wirkt. Sein Körper ist missgestaltet, er humpelt am Stock und kann sich nur mühsam taumelnd und stolpernd fortbewegen. Mich dauert er, denn es gibt keine Einrichtung, die ihn aufnehmen könnte, er bekommt keinerlei Unterstützung, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als die Hand aufzuhalten. Im Gegensatz zu den Tagdieben, die an den Landstraßen herumlungern und die Reisenden belästigen, anstatt einer Arbeit nachzugehen, ist er vom Schicksal gebeutelt. Wir geben alle ein paar Kreuzer, ohne zu zögern auch der »alte Mann«.
Ich lobe ihn dafür. »Überhaupt hat es mit der Aufklärung gute Wege, und es darf niemand bange sein, dass die Welt bald vollkommen sein werde.«5
»Das Fritzle wieder«, spottet der Fritz. »Sei Er unter die Weltverbesserer gegangen? Frön Er gar dem deutschen Idealismus? Genial.«
»Das ist der neueste Schrei«, pflichtet der Alte ihm bei. »Man wird dem noch nachgehen müssen. Nicht dass ich mich übertrieben für diesen Kant interessiere, aber wir werden ihn vom Kopf auf die Füße stellen. Mit einem Systemprogramm, das sich gewaschen hat. Kant ist halbgar. Er wird notorisch überschätzt. Man kann bei seiner ›Kritik der praktischen Vernunft‹ nicht stehen bleiben. Doch es ist ein langer Marsch. Um Württemberg ist es weit schlechter bestellt, als manche Schmeichler behaupten. Ein paar Kreuzer aus Mildtätigkeit werden daran nichts ändern. Alles andere ist simple Einfalt, selbst wenn es sich zu höchsten Höhen aufschwingt.«
Fritz nickt und wendet sich nun auch mahnend an mich: »Bleib auf dem Boden, Fritzle. Dir fehlt das Zeug zur deutschen Dichtkunst und Philosophie. Nicht alle schrägen Vögel sind zu Höherem berufen. Du lässt dich halt leicht auf der Leimrute fangen. Aus dir wird ein gescheiter Gimpel werden, dazu taugt immerhin dein allzu zahmer Verstand.«
»Das bodenständige Pfaffenhandwerk will auch gelernt sein«, ergänzt der überzwerche Alte.
Der Fritz lacht sich schlapp, und der Alte fällt ein. Er senkt den Kopf, wohl weil er die Theologie weit unter sich vermutet. Dann fängt er an, besinnungslos zu schreien. Er zeigt auf den Boden. Zwischen seinen Füßen sitzt ein handtellergroßes, rotbraunes, ungewöhnlich abstoßendes Tier. Es hat einen riesigen Kopf mit Chitinpanzer und Facettenaugen, vorne und hinten kurze und lange Fühler, vier Flügel und sechs Beine. Die vorderen gleichen Grabschaufeln.
»Zu Hilf!«, krächzt der Alte. Das Gesicht bleibt ihm stehen. Taumelnd tritt er einen Schritt zurück.
Jetzt bin ich es, der sich krumm und bucklig lacht, obwohl ich weiß, dass ich mit meinem Lachkrampf alles zerstöre. Bevor ich die Besinnung verliere, erhebt sich das teuflische Tier in die Lüfte und fliegt brummend davon.
»Das ist eine Werre, du Simpel«, rufe ich und fuchtle wild hinter dem schweren Insekt her. »Eine Werre, eine Maulwurfsgrille, Gryllotalpa. Ein harmloser Feldschädling vom Stamm der Heuschrecken.«
»Ah so.« Der »alte Mann« schnauft. »Das ist ein Werren, ein Sich-selber-Werren, im Moment vom Erkennen, vom denkenden Erkennen. Es kommt also darauf an, das schwindende Sein als Selbst zu begreifen, als Entfaltung des Subjekts.« Wie immer, wenn es ihm zu bunt wird, tut der Alte beleidigt. Er nuschelt. Ihn plagt die Angst drunterzukommen, als Dummkopf enttarnt und deshalb erst recht ausgelacht zu werden. Seltwegen flieht er in die entlegensten Winkel seines Verstands, und sein Schwäbisch, das doch eigentlich aus der Stadt stammen sollte, wird alleweil krautiger.
Ich halte die Gosch, damit mir nichts Falsches herausrutscht. Mir entweicht glücklicherweise auch kein glucksender Lacher. Das darf nicht passieren, wenn es ums Philosophieren geht. In diesen Dingen versteht der Alte keinen Spaß.
Fritz greift nach seinem Schmierheft und dem neumodischen Bleistift und macht sich Notizen. Seine Zungenspitze fährt über den rechten Mundwinkel. Das ist so eine Marotte, die er sich angewöhnt hat. Nach einer Weile lässt er es wieder bleiben. Er kriegt seine Untugenden meistens in den Griff.
Ich will mich mit dem harschen Urteil meiner Kommilitonen nicht abspeisen lassen. Meine geistigen Rivalen sollen endlich begreifen, dass ich mit ihren Höhenflügen durchaus mithalten kann, wenn auch auf etwas erdigerem Gebiet als dem der Poesie. Anstatt zu feixen, kehre ich zur Vergänglichkeit des Lebens zurück, womit ich mich beim Galgen schon beschäftigt habe. Ich doziere über den Wandel der Bestattungskultur, worüber ich in meiner Lieblingszeitschrift gelesen habe. »Die pompösen Leichenbegräbnisse werden abgeschafft, und man führt die Verblichenen auch auf dem Lande still wie das Vieh auf die Gottesäcker hinaus. In der Stadt, wo kräftig gestorben wird, mag das ja seinen Sinn haben, wenn die Leichenzüge die Straßen nicht verstopfen. Doch das Wegfallen der Leichenpredigten fördert die Irreligiosität und Untugend der vom Luxus verdorbenen und allzu sparsamen Hinterbliebenen. Das Schwinden aufwendiger Rituale verhindert Umkehr und Besserung der Menschen, die sich am Geist der Erhabenheit stärken und laben müssen. Demut und Erbarmen bleiben dabei auf der Strecke. Das Pragmatische des Fortschritts spricht dennoch dafür, es fürderhin so unfeierlich zu halten. Doch sollte man dann nicht auch auf das kostspielige Gepränge der Hochzeiten verzichten? Und auf den Firlefanz bei den Taufen, die ganze Kugelfuhr der christlichen Feste? So käme es gar zu einer Reinigung.«
Der Alte kennt die Zeitschrift wohl auch. »Du hast den Artikel im ›Journal von und für Deutschland‹ trefflich referiert und nebenher eigene Gedanken eingefügt«, erklärt er. »Aber mir fehlt bei dir eine Linie. Du schwingst nach allen Seiten aus wie ein Pendel.«
»Einerseits wird gefrömmelt und die rechte Moral verkündet, andererseits die produktive Ökonomie angebetet, mit einem praktischen Fanatisieren, das an materialistischen Okkultismus gemahnt«, pflichtet der Fritz ihm bei.
Ja so. Die zwei sind sich einig wie selten. Der gemeinsame Gegner bringt den Händel zwischen ihnen zum Erliegen. Das Fritzle ist der Sündenbock – und lässt sich das brav gefallen.
Was soll’s, immerhin verlaufen die ersten Stunden der Reise damit ungewohnt harmonisch. Fritz und der Alte zanken sich sonst viel. Zwar verbindet sie das Band ewiger Freundschaft, doch sind beide überempfindliche Hitzköpfe, die sich noch im ärgsten Streit gegenseitig darin bestärken, die Wahrheit gepachtet zu haben. So auch in diesem Fall und in rarer Eintracht. Der Vorwurf an mich lautet, dass ich nicht gefestigt sei. Und dass man nicht wisse, woran man bei mir ist. Da mag ich mich nicht weiter hineinvertiefen. Es ist manchmal gescheiter, über eine Herabsetzung oder eine Kritiksucht hinwegzugehen.
»Wenigstens gibt es in Württemberg noch genug aufzuklären.« Zur Ablenkung erzähle ich, dass in Mössingen, nur eine Stunde von Nehren entfernt, im Sommer noch ein Hexenprozess stattgefunden habe. Über seinen Ausgang ist mir allerdings nichts bekannt. Wobei mich solche empörenden Vorkommnisse interessieren. Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts sind in Württemberg an die 200 Menschen wegen Hexerei hingerichtet worden. Insgesamt wurden über 350 Untersuchungen und Gerichtsverfahren dokumentiert. Betroffen sind mehr als 600 Personen, meist Frauen. Gelesen habe ich vom tragischen Ableben der Anna Maria Schwegelin anno 1775 und dem Justizmord an Anna Göldi in der Schweiz vor gerade mal neun Jahren. Beide starben durch das Schwert.6
»Es ist schrecklich, dass es so etwas heute noch gibt«, schlussfolgere ich und berichte vom Schicksal der Giovanna Bonanno, einer alten Frau, die im vorigen Sommer in Sizilien mit dem Tod durch Erhängen bestraft wurde. Der Prozess hat ein Dreivierteljahr gedauert. Giovanna Bonanno gestand, eine Giftmischerin zu sein und dass sie Gift an Frauen verkauft habe, die ihre Männer ermorden wollten. Das Gift bestand aus Weißwein, Arsen und Essig gegen Läuse. Es ließ sich jedoch nicht nachweisen, und so wurde Bonanno der Hexerei beschuldigt. »Das hätte genauso bei uns auf der Schwäbischen Alb passieren können. Die Hexenverfolgung ist noch nicht ausgestanden.«
»Dass du dich mit so einem Hafenkäs befassen magst«, tadelt mich der Fritz. »Das ist doch Zeitverschwendung! Such dir lieber geistige Interessen. Zur freien Individualität, zur Einheit mit sich selbst und zur eigenen Identität gelangt das reine Subjekt erst durch die Wahl seines Gegenstands.«
Der Alte setzt noch eins drauf: »So schreibt auch Immanuel Kant in seinem brandneuen Werk ›Kritik an der Urteilskraft‹: ›Befreiung vom Aberglauben heißt Aufklärung.‹ Damit meint er aber nicht, dass man sich mit diesem altbackenen Ochsenmist dermaßen ausufernd beschäftigt. Wir brauchen die Kraft der Utopie, liebes Fritzle, Ziele, die in der Zukunft liegen. Wir müssen nach vorn schauen, noch viel radikaler, als dieser Blender von Kant das tut.«
Zerlumpte Landleute kommen uns entgegen, mit Milchkannen, Ziehkärren und Sensen, grobes Werkzeug mit einem Garbenseil um den Bauch gebunden. Bauern, die weit weniger Wohlstand als die im Schwarzwald haben, wo der Feldbau zwar mühsamer, das Eigentum aber reichlicher verteilt ist. Man hat dort weniger Beschwerden, wird nicht von Forstbediensteten und Dorfmagistraten schikaniert wie hierzulande.
»Bueba, kunt au ebbe hein!«, ruft ein altes, verhutzeltes Weiblein. Die Greisin trägt eine schwarze Tracht mit einer Haube, die ihr Gesicht teilweise verschattet. An einem knorrigen Stock wankt sie auf uns zu.
Fritz bleibt stehen, und wir tun’s ihm nach.
»Wir sollen zu ihr heim?« Um Hilfe heischend schaut der Alte mich an.
Es gefällt mir, dass er auch mal was nicht versteht. So undeutlich und bodenlos, wie er sonst spricht. »Nein, sie will, dass wir zu ihr hingehen.«
»Do bring ich eich nu au Stimpf.« Sie gräbt in ihrem löchrigen Beutel.
»Stimpf?«, fragt der Alte.
Die Greisin zieht drei Paar hellbraune Strümpfe heraus, fein säuberlich gestrickt, tadellos, dünn und glänzend wie Seide. Zögerlich treten wir näher.
»Die schenkt sie uns?« Der Fritz kann es nicht fassen.
»I wo.« Die Steinlachtäler sind unaufrichtig, denke ich, viele charakterlos, und auch dieses Weiblein macht einen verschlagenen Eindruck. Dabei verfügt sie über den hier beheimateten natürlichen Verstand. »Sie will uns die Socken verkaufen.«
Ich gebe ihr eine Münze, die sie strahlend, ihre Zahnlücken und Stumpen entblößend, einsteckt.
3 Gemeint ist ein Rabe. Im Alemannischen heißt er Krabb.
4 Hölderlin: Hyperion, S. 124.
5 Eckart Frahm, Wolfgang Kaschuba, Carola Lipp (Hgg.): Eine Alb-Reise im Jahre 1790: zu Fuß von Tübingen nach Ulm. Ein Lesebuch zur historischen Landschaft mit zeitgenössischen Stichen und Karten. Tübingen 1978, S. 35.
6 Köhler konnte nicht wissen, dass das Urteil bei Anna Maria Schwegelin nicht vollstreckt wurde. Erst 1995 entdeckte ein Historiker, dass die Angeklagte 1781 im Gefängnis des Fürststifts Kempten gestorben ist.
Nehren
Wir verlassen das Flusstal und erreichen eine halbe Stunde später das Pfarrdorf Nehren, das etwas höher im Osten liegt. Es hat 200 arbeitsfähige Bürger, von denen etliche ausgeschwärmt sind, weil sie daheim keine Arbeit vorfinden, keinen Acker und auch sonst nichts, wovon es sich leben ließe. Ein paar davon betteln sich durch halb Schwaben, während andere als Erntehelfer auf der Alb oder sonst wo umherziehen, um sich, womöglich mitsamt Familie, mühsam damit durchzubringen.
Die Sonne steht schon tief. Meine lieben Eltern erwarten uns vor der Tür des Pfarrhauses, ein stattliches Fachwerkhaus aus robusten, mit Ochsenblut bemalten Balken, wo sich neben einem Rosenbusch ein Bänklein befindet. Dort sitzen sie einträchtig, der Vater im ehrwürdigen schwarzen Gewand, die Mutter in einem einfachen hellen Kleid. Sie hat beides selbst genäht, an langen Abenden im Licht einer armseligen Funzel. Sie hat sich dabei die Augen verdorben und bedarf einer Lorgnette. Ihr schlichtes Kleid passt absolut nicht zur eigenartigen und luxuriösen Kleidungsart des Steinlachtals. Die Mädchen und Frauen schmücken sich mit bunten seidenen Bändern, die Jüngeren flechten sie in die Zöpfe hinein. Ihre makellosen Hauben sind frisch gestärkt und die blütenweißen Hemden reich bestickt und mit Spitzen besetzt. Die Mutter hat sich die bescheidene Aufmachung, die sie aus dem Schwarzwald mitbrachte, bewahrt. Nur die Frisur hat sie übernommen und sich mit dem geflochtenen Zopfkranz an die hiesige Mode angepasst. Der Vater hingegen ragt als Pfarrer in seinem äußeren Gepränge aus dem Volk heraus, denn die Männer tragen gewöhnlich blaues Tuch, das ihnen gemeinerweise zu eng, zu kurz und überhaupt zu klein ist, da es ihnen zur Konfirmation oder zur Hochzeit auf den damals noch mageren Leib geschneidert wurde. Dazu ist es Sitte, in gelb gefärbten Beinkleidern herumzulaufen, die, leicht verdreckt zumal, den Anschein erwecken, sie seien aus Wildleder.
Die Eltern erheben sich und reichen uns herzlich die Hand. Ihr Zustand ist ganz unverändert. Ihr Erscheinungsbild ist von stiller, schlichter Zufriedenheit geprägt, und sie sind vollends erfüllt vom Willen Gottes und eins mit sich und der Welt. Fritz und der Alte werden wohlwollend aufgenommen und nicht mit zu vielen Fragen traktiert. Meine Eltern üben stets Zurückhaltung. Die Herkunft hat bei ihnen im Hause nie eine Rolle gespielt, wenn man rechtgläubig und strebsam ist.
Ich halte Ausschau nach meinem jüngsten Bruder, Johann Gottlob Friedrich, genannt Hans. Der ist über 22 Jahre jünger als ich und fast auf den Tag genau 20 Jahre nach meiner Schwester Auguste Friederike Eleonore, der Ellen, geboren, am 20. April. Er ist also noch kein halbes Jahr alt. Zwischen dem Heinerle, meinem anderen Bruder, und dem Hans erlebte die Mutter fünf weitere Geburten, doch die Geschwister sind früh gestorben. Nun, mit Anfang 40, hat sie noch mal ein Kind bekommen. Der Vater ist mit Anfang 50 bald ein alter Mann. Der Hans ist nirgends zu sehen. Da ich keine Erklärungsnot aufkommen lassen und nichts erzwingen will, frage ich auch nicht. Die Ellen und das Heinerle sind wie ich schon ewig aus dem Haus. Ellen versucht, ihre bürgerliche Stellung zu festigen. Sollte ihr das nicht gelingen, nehme ich sie nach dem Studium zu mir. Bevor sie am Leben scheitert, kann sie mir den Haushalt machen. Um das Heinerle braucht man sich nicht zu sorgen. Aus ihm wird ein Medicus practicus.
Von beiden wird kein Gruß ausgerichtet. Scheint’s haben sie keinen Mucks getan. Vermutlich gehen sie ihren Verrichtungen, Pflichten und Geschäften nach und haben es zu ihrem Jammer nicht einrichten können, mich bei den Eltern zu empfangen.
Wir essen in der guten Stube. Zur Feier des Tages hat die Mutter den Tisch reich gedeckt. In der Mitte steht eine Schale mit Äpfeln, Birnen und kleinen, sauren Trauben. Zur Vorspeise gibt es eine Flädlesuppe. Die Flädle sind goldbraun und so dünn, dass man hindurchsehen kann. Die Fleischbrühe schmeckt würzig. Sie ist mit Schnittlauch und Peterling aus dem Pfarrgarten bestreut. Danach wird Schwarzer Brei serviert. Obwohl meine Eltern nicht von der Alb, sondern aus dem Herzen vom Gäu und dem Schwarzwald stammen, gehört dieses simple Traditionsgericht aus grießig gemahlenem Mehl zu ihren Leibspeisen. Die Mutter hat es von einer früheren Nachbarin gelernt. Weizen, Dinkel und Hafer rührt man in kochendes Salzwasser ein, gibt Milch dazu, verkocht alles zu einem braunen Mus und übergießt es mit geschmälzten Zwiebeln. Es ist ein Arme-Leute-Essen, und ich hätte mich nicht gewundert, wenn meine beiden Wandergesellen, die sich schon über das durchschnittliche Essen im Stift beschweren, die Nase gerümpft hätten. Was ist dieser mehlige Matsch gegen den dicken Eintopf mit nahrhaftem Ochsenfleisch, den wir regelmäßig vorgesetzt bekommen!
Auf dem Tisch steht eine Karaffe mit kaltem Pfefferminztee, aus der die Mutter großzügig einschenkt. Wir essen und trinken gierig, denn wir haben unterwegs mit dem Wasser gespart und sonst nichts zu uns genommen.
Zwischen zwei Schlucken sagt der Alte: »Ich möchte ja nimmer lästig sein, aber was gäbe ich darum, wenn in der nächsten Karaffe Wein schwämme, und möge er noch so dünn und räß sein.«
Er spricht fistelnd, näselnd, kaum vernehmbar, verschluckt sich, hustet und prustet, doch haben ihn alle zur Genüge verstanden. Der Vater blickt auf die Mutter. Sie steht auf, etwas schmallippig vielleicht, und bringt einen Krug Most.
Fritz tut so, als ginge ihn das alles nichts an, er speist mit tadellosen Manieren; langt dann aber beim Trinken kräftig zu und genehmigt sich noch vor dem »alten Mann« einen zweiten Becher.
Auf einmal geht ein fürchterliches Gebrüll los, es kommt aus der Kammer. Sofort springt die Mutter auf und rennt hinüber.
»Das ist der Hans«, erklärt der Vater. »Er braucht noch viel Schlaf, aber er hat eine starke Lunge.«
Er geht ebenfalls hinaus, zur anderen Tür, um im Freien nach dem Wetter zu sehen. Meine beiden Wandergenossen wollen sodann ihre Würfel hervorholen, mit denen wir in unserer Stube heimlich »Filzlaus« oder »Kuhschwanz« spielen, ein harmloser und gefälliger Zeitvertreib, bei dem alle sechs mitmachen und wo es nur einen einzigen Würfel braucht. Doch auch nur diesen einen vorzuzeigen, wäre in einem Pfarrhaus nicht angemessen, und schicklicherweise lassen die Burschen ihr Spielzeug stecken.
Bald kommt der Vater, später auch die Mutter wieder. Sie hat den Hans auf dem Arm, und wir huldigen ihm und bewundern ihn. Ich darf ihn sogar kurz halten, strahle ihm ins Gesicht und bin stolz auf meinen kleinen Bruder. Es ist ein strammer Bub, und er ist gut gesättigt. Seine Augen blicken aufmerksam in die Runde, als habe er etwas Unterhaltung verdient, und er lächelt aufmunternd. So singen wir zur Kurzweil geistliche, aber auch weltliche Lieder, die nicht fromm sind, die nirgends geschrieben stehen und die meine Eltern aus unserer Schwarzwälder Heimat kennen.
In Mueders Stübele,
da goht der hm, hm, hm,
in Mueders Stübele,
da goht dr Wind.
I muess verfriere drin
mit minem hm, hm, hm,
ich muess verfriere drin
mit minem Kind.
Wenn des die Mueder wisst,
dass i verfriere muess,
do dät se gräme sich
bis in de Tod.
I gang vors Herrenhus
und du vors hm, hm, hm,
i gang vors Herrenhus
und du vors Tor.
Du hosch koa Hemdle a
und i koan hm, hm hm,
du hosch koa Hem,dle a
un i koan Strumpf.
Du nimmsch de Bettelsack
und i de hm, hm, hm,
du nimmsch de Bettelsack
und i de Korb.
Du gohsch ins riche Hus
un i ins hm, hm, hm,
du gohsch ins riche Hus
un i ens arm.
Du isch dia kalte Supp
un i die hm, hm, hm,
du isch die kalte Supp
un i die warm.
I kriag a Äpfele
und du a hm, hm, hm,
ich krieg a Äpfele
und du a Birn.
Du stecksch de Speck in Sack
un i der hm, hm, hm,
du stecksch der Speck in Sack
un i der Zwirn.
I sag: Vergelts Euch Gott,
und du saisch: hm, hm, hm,
i sag: Vergelts Euch Gott,
und du saisch: Dank!
»Stell dir vor, Fritzle«, sagt die Mutter und wendet sich an mich, »was passiert ist. Der kleine Jacob vom Schmider Johann und seiner Frieda ist vom Heubarn gefallen und hat sich einen Bruch geholt. Geht doch der Vater in der Nacht mit dem Bub aufs Feld, packt einen jungen Apfelbaum, spaltet den Stamm der Länge nach, schiebt den Jacob um Mitternacht dreimal durch, ruft dabei nach der Dreifaltigkeit und bindet den gespaltenen Stamm dann wieder fest zusammen.«
Da mischt sich erklärend der Vater ein, der seiner Natur nach weniger und bedachtsamer spricht als die Mutter. »Es muss dies ohne Zeugen und ohne Bericht geschehen, sonst wirkt es nicht. So will es der Aberglaube. Das Pech war, dass die Frieda zu mir gelaufen kam am nächsten Tag, weil sie gepeinigt wurde von dem Verdacht, der Johann habe sich mit seiner Hirnwut versündigt. Der Baum ist zwar wieder zusammengewachsen, aber der Bruch nicht glücklich verheilt.«
»Und jetzt ist der Pfarrer schuld.« Die Mutter langt sich an den Kopf.
Der Vater zuckt die Achseln. »Bei den schwersten Krankheiten suchen die Bauern keinen gescheiten Doktor auf. Sie ziehen Schäfer, Schinder und Dorfbarbiere zurate, lauter Windbeutel oder allenfalls Quacksalber. Und zur Not mich, den Pfaffen.«
In der Nacht dürfen wir uns die Kammer teilen, in der sonst mein lieber Bruder schläft. Es gibt genug Matratzen, Teppiche, Decken und Kissen für uns drei, sodass jeder seinen Bettzipfel für sich pachten kann. Die Luft ist lau, und zum offenen Fenster scheint der Vollmond herein. Im sanften Lichtstrahl brechen die Bäuerinnen die ganze Nacht ihren Hanf; es ist ein von Jugend an vertrautes Geräusch. In Nehren wird in größerem Maßstab ertragreich Hanf angebaut, auch Flachs, was aber weniger gut gelingt. Für seinen Flachs ist das drei Stunden Fußmarsch entfernte Dorf Bodelshausen in der südwestlichen Ecke des Tals berühmt. Die Bewohner betreiben den Anbau sehr geschickt und bringen es so zu beträchtlichem Wohlstand. Vergleichsweise zumindest; andere Dörfer verzeichnen nur wenige reiche, aber viele arme Leute in ihrer Mitte. Das liegt am Kindersegen und an der Realteilung, wonach die Äcker nach jedem Erbgang kleiner werden, an den notwendigen Abgaben für den Landesherrn, an misslungener Viehzucht, Seuchen, Wildschaden und Missernten. So auch in Nehren. Doch in diesem Jahr ist alles wohlgeraten, was von der begünstigenden Witterung herrührt. Trotzdem ist die Lebensart im gesamten Tal oft sehr ärmlich, weshalb nicht nur die Frauen, sondern auch Männer und Kinder viele Stunden am Tag Hanf und Flachs zu langen Fäden verarbeiten. Selbst im Winter sitzen ganze Familien am Ofen beisammen und spinnen Garn. Alleweil am Freitag wird es in Tübingen auf dem Schnellen Markt an die Weber verkauft.
Mag es vom wohlvertrauten Klang des Hanfbrechens herkommen, der mich über das Beengte hinausträgt und das Irdische entgrenzt – in dieser Nacht begegnet mir ein Engel. Es ist weniger ein Traum als vielmehr eine Erscheinung. Ich meine, überwach dazuliegen und ihn in der Kammer zu empfangen: einen himmlischen Knaben von edlem Wuchs, der gleichsam zur Tür hereinweht und an meine Bettstatt schwebt. Er ist halbwüchsig, nicht besonders groß, stämmig. Sein Kopf zeigt eine seltene Perfektion: liebliche Locken in einem wilden Weizenblond, strahlende blaue Augen, eine fein geschnittene Nase und ein breiter, sinnlicher Mund. Der Jüngling wirkt sehr aufgeweckt. Das Grübchen am Kinn vervollständigt den Eindruck, dass er es faustdick hinter den Ohren hat. Ein schelmischer Tunichtgut. Frech blickt er auf mich herab.
»Bist du wirklich ein Engel?«, frage ich ihn, als ob es daran einen Zweifel gäbe.
»Quatsch. Ich bin der Götterbote.« Der Kerle kichert. »Ein Engel – du glaubst doch nicht an so einen Unsinn?«
»Versündige dich nicht!«
»Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum.«7
»Jaja«, sage ich. »Schwätz du nu. Wenn es weiter nichts ist. Wie heißt du überhaupt?«
»Ich bin der Fritz.«
»Ha no.«
»Die Weltseele«, meint dieser Fritz, nun schon der vierte in unserer Runde.
Vier Württemberger mit Namen Fritz. Denn auch Hornberg im Schwarzwald, wo ich gebürtig bin, gehört noch zum Herzogtum.
»Organismus und Kosmos«, sagt der holde Bub. »Beide durchdringen einander und sind eins. Ich bin der Bote ihres ewigen Zaubers.«
Als ich morgens in der Frühe aufwache, liegt auf meinem Kopfkissen eine Feder.
7 Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen ist des Teufels.
TAG 224. SEPTEMBER 1790
Nehren
Als ich zum Morgenläuten um 6 Uhr in die Stube komme, sitzen meine beiden Begleiter schon am Tisch. Draußen ist es noch stocknacht. Die Funzel spendet spärliches Licht. Der Fritz lechzt nach Kaffee, den er sich nach heutiger Mode angewöhnt hat und den ich nach Kräften meide, so oft es geht, aber er ist zu anständig, etwas zu sagen. Der Alte stiert vor sich hin; er würde vermutlich sogleich zum Mostkrug greifen, ließe man ihn nur. Die zwei wirken arg unausgeschlafen.
Nach einem einfachen, jedoch reichlichen Morgenessen, das uns die Mutter hinstellt und das wir geschwind zu uns nehmen, wollen wir aufbrechen.
»Der Hans schläft wieder«, erklärt die Mutter, auch sie sieht müde aus. »Er hat mich die halbe Nacht auf Trab gehalten. Wenn er so übernächtigt ist, tut er garantiert nicht gut. Auf keinen Fall kann ich ihn aus seiner Wiege nehmen.«
»Dann richte ihm die schönsten Grüße von uns aus. Vor allem von mir, seinem großen Bruder. Spende ihm meinen Segen. Möge der Herr, der allmächtige Gott, stets über ihn wachen und seine Seele beschützen.« Ich nehme die Mutter sanft in die Arme. Solche Gefühlsaufladungen leisten wir uns nicht leichtsinnig, doch man weiß ja nicht, wann und unter welchen Umständen man sich wieder begegnet. Auch dauert sie mich ein wenig. Sie hat mich mit 19 und Hans mit 41 Jahren auf die Welt gebracht, nach sieben weiteren Geburten. Die fünf Kinder zwischen dem Heinerle und dem Hans haben nicht überlebt. Vermutlich waren wir weder verträglicher noch gesünder, doch Mutter hatte mehr Glück, und ihre Nerven waren besser.
Gegen halb sieben haben wir gegessen und unsere Sachen zusammengepackt. Die Mutter gibt uns einen Laib Schwarzbrot mit, das aus Dinkel und Roggen gebacken wurde und lange sättigt. Außerdem Hafer, eingelegtes Kraut, ein paar Handvoll gekochte Bohnen und Äpfel. Dazu eine Kanne Milch und eine große Flasche frisches Wasser. Der Vater holt einen Mockel Speck, zwei Blutwürste und eine Forelle aus dem Kamin. Wir verpacken alles in handliche Säcke und schnüren sie auf unsere Felleisen.
»Leider haben wir keinen Käse«, meint die Mutter. Sie hat vor Eifer rote Backen, und aus ihrem dicken braunen Zopfkranz hat sich eine Haarsträhne gelöst. »Er ist uns ausgegangen, und im Dorf ist keiner zu bekommen.«
Wir schultern die Felleisen und verabschieden uns herzlich. Der Alte macht zwar ein grantiges Gesicht, doch er reißt sich zusammen. Fritz hat sowieso untadelige Manieren; wenn er will, ist er charmant wie ein Weibsbild. Auch ist er von hohem Wuchs, und seine Gesichtszüge sind ebenmäßig, fein, markant und bestechend schön. Er besitzt scharf schraffierte Augen, eine schnurgerade Nase und ausdrucksvolle Lippen. Das ist mir auf der Stube nie so aufgefallen wie jetzt, wo ich ihn mit den wohlwollenden Blicken der Mutter messe.
Stumm machen wir uns von dannen und winken noch einmal zurück. Die Eltern stehen vereint in der offenen Tür in einem kaum vernehmbaren Lichtschein und ziehen sich erst zurück, als wir um die Biegung verschwinden.
Der Morgen ist düster und kalt, und in zackigem Tempo lassen wir den beschaulichen Ort mit seinem viereckig emporragenden, mit Fachwerk verzierten Kirchturm hinter uns. Er ragt noch eine Weile aus einem grauen Schattenwald von Obstbäumen heraus. Wir sind wacker losmarschiert, doch der Elan hält nicht lang. Irre ich mich, oder humpelt der Alte? Tatsächlich, er hinkt leicht, aber er sagt nichts und beißt auf die Stockzähne. Dann sage ich eben auch nichts. Ich will mir nicht wieder welche von seinen abfälligen und besserwisserischen Bemerkungen einhandeln, und ich fürchte Fritzens Spott, wenn er dem Freund zur Seite springt und sich beide gegen mich verbünden. Aber der Fritz will nichts merken, er übersieht geflissentlich, dass mit dem »alten Mann« was nicht stimmt, und stapft vollends in sich gekehrt und blind vor sich hin.
»Den gerauchten Fisch können wir zum Mittag verzehren, das Fleisch erst morgen, weil heute Freitag ist«, erkläre ich meinen Wandergesellen, die dem Karfreitag nicht gedenken, das Freitagsopfer nicht heiligen und das Fastengebot missachten. Sie seien schließlich keine Katholiken, nicht einmal das Stift schere sich darum. Doch auch wir Pietisten sollten uns an die Freitagsregel halten, wobei ich annehme, dass der Fritz es zeitenweise sogar tut und nur der Alte zutiefst anstößige religiöse Prinzipien hat. Allerdings besteht die Gefahr, dass er den Fritz auf seine Seite zieht, und dem will ich vorausschauend entgegenwirken.
Es wird allmählich hell, und im Gras glitzert der Tau. Auf einmal bleibt der Alte stehen. Er wirkt dicklich und verquollen. Vielleicht hat er Katzenjammer von dem vielen Most, den er gestern zur Nacht zu sich nahm?
»Sei so gut, gib mir bitte mal die Strümpfe«, sagt er zu mir. Er drückt sich höflicher aus als sonst, doch wie so oft straft er mich mit dieser Leichenbittermiene. Als ob ich an seinem Weltunglück schuld wäre.
Auch ich halte ein. »Die feinen Stricksocken von dem Weiblein gestern? Ich hab dir die deinen geschenkt. Du hast sie eingesteckt, weißt du das nicht mehr?«
Verstockt wühlt der »alte Mann« in seinen Sachen und fischt schließlich die Socken heraus. Auch ich tue mein Felleisen herunter und lange nach dem Becher. Strecke ihn dem Fritz entgegen, der die Flasche hat. Geistesabwesend und in sich zurückgezogen, als ginge ihn das alles nichts an, gießt er einen Schwall Wasser hinein. Er trinkt und reicht mir den Becher. Zu dritt rasten wir mitten auf dem Fußpfad.
Der Alte nimmt ebenfalls einen Schluck, hockt sich dann auf den Boden, löst die Schuhbändel und zieht die Wanderschuhe aus. Sie sind aus braunem Rindsleder, noch neu und bockelhart. Sofort macht sich an der frischen Luft ein ungesunder Gestank breit, aber nicht nach Fußschweiß, sondern nach gegerbter Tierhaut und etwas Metallischem. Eiter und Blut. Der Alte presst die Hände auf die Fersen. Seine Strümpfe sind voller Blutwasser. Was für ein Hutsimpel!
»Wieso hast du das nicht früher gesagt?«, herrsche ich ihn an. Ich höre den Vater, wenn er mich als Bub getadelt hat, weil ich nicht gefolgt habe. Und nun stauche ich den »alten Mann« zusammen, als wäre er ein kleiner Kerle. Dabei bin ich grade mal zwei Jahre älter als er. Ich besinne mich. »Das muss ja grausig wehtun.«
»Wenn schon. Was hätte es genutzt?« Wieder beißt der Alte die Stockzähne zusammen, er macht sich damit noch das Gebiss kaputt.
»Du hast wohl gedacht, es wird über Nacht besser.« Jetzt mache ich die Mutter nach mit ihrem begütigenden Tonfall. Es klingt verkehrt oder falsch.
Der Alte merkt, dass eine weibliche Nachsicht in meinen Worten aufscheint, und fängt prompt an zu weinen.
»Zeig her!«, fordert der Fritz. Tatkräftig kniet er nieder neben seinen Freund, zieht ihm die Socken aus und inspiziert die Blasen. Er ist auf der Stelle wie ausgewechselt und übernimmt das Kommando. »Der linke Fersen ist halb so wild, aber beim rechten schaut das rohe Fleisch heraus. Das geht bald bis auf den Knochen. Wenn sich das nicht entzündet, kannst du von Glück sagen.«
»Ich brauche ein Ross«, meint der Alte daraufhin.
»Du brauchst vor allem gescheite Schuhe.« Der Fritz zieht seine Wanderstiefel aus, groß, robust und solide gearbeitet. Dabei zart und formvollendet, als ginge es zu einer Hochzeit. Die saubere Handarbeit eines teuren, pedantischen und pflichteifrigen Schuhmachers. Der Fritz verfügt über einen guten Geschmack und lässt sich seine Kleidung was kosten. »Hier, nimm meine. Sie sind gut in Schuss und butterweich. Ich kann eine Weile barfuß gehen.«
»Das kann ich nicht annehmen«, widerspricht der »alte Mann«.
»Du nimmst, was du kriegst. Wenn das nicht heilt, wird der Fuß bald blau und fault, bis er ganz schwarz ist. Dann muss man ihn amputieren.«
Natürlich übertreibt er. Doch nichts gegen einen ordentlichen Hypochonder und seine Reiseapotheke, die Fritz nun aus seinem Felleisen zieht. Er schmiert dem Alten Ringelblumensalbe auf die Fersen, nachdem er sie mit Essigtinktur gereinigt hat, und verbindet sie mit einem in Stücke gerissenen Lumpen.
»Ich habe mir extra neue Wanderschuhe machen lassen«, jammert der Alte.
»Ja, aber ein, zwei Nummern zu klein. Weil das billiger war. Und du warst zu faul, sie vorher einzulaufen. Dein Geiz wird dich noch unter den Boden bringen, und den Rest erledigt deine Faulheit.«
»Vergelt’s Gott!«, stottert der »alte Mann« und kommt schwerfällig auf die Beine.
Ich stehe stumm daneben und bin Zeuge des Schauspiels.
Gomaringen
Nachdem wir die Felder der Gemeinde Nehren hinter uns gelassen haben, erreichen wir nach einer guten halben Stunde den Gemeinwasen von Gomaringen, die Allmende. Auf dieser herrlichen Ebene erstreckt sich von alters her die gemeinsam genutzte Viehweide des Dorfes, die auch als Obstwiese bewirtschaftet wird. In den letzten Jahren kam die Idee auf, sie in abgegrenzte Gütle aufzuteilen und als solche zu verpachten. Diese private Nutzung sorgt für beträchtlichen Ärger, weil die wohlhabenden Bauern für ihr vieles Vieh zahlreiche solcher Gütle pachten und dafür bezahlen müssen, die ärmeren selbst für einen geringen Flecken Wiese nicht zahlen können. Viele nutzbare Morgen liegen deshalb brach, was eine Schande ist. Der Streit zieht sich vom Dorfmagistrat über den Oberamtmann von Tübingen bis hinauf zum Stuttgarter Landesherrn, der zwar verfügt hat, dass an alle Bürger gleich große Stücke Boden zu vergeben seien, wahlweise auch zum Obst- und Gemüseanbau, doch wollen das die Reichen mit Macht verhindern, und sie intrigieren, was das Zeug hält.
»Sollte die Landesregierung nicht die Interessen der ärmeren Mehrheit der Bevölkerung durchsetzen und die wenigen Reichen zu einer gerechten Verteilung zwingen? Ich glaube, sie will das, lässt sich aber von den Großkopfeten vor Ort manipulieren, die mit ihrem Eigennutz das allgemeine Wohl verhindern. Sie liefern einseitige Berichte ab und lügen wie gedruckt. Die Regierung will sicherlich das Beste, hat aber von den Zuständen auf der Alb keine Ahnung.«
Während ich meinen zwei Wandervögeln die Misere schildere, wird mir das volle Ausmaß meiner Mission allmählich bewusst: Es wird schwierig sein, detailgetreu über die Wahrheit zu berichten, in einem Reisejournal, das auch gelesen werden will. Das ist eine Aufgabe, die schwer zu erfüllen sein wird, möchte man das Publikum nicht vergraulen. Man muss auch den positiven Aspekten Aufmerksamkeit zollen. Kleine Beobachtungen mit Wohlwollen schmücken. Auf jeden Fall sollte ich täglich bei der Rast oder allabendlich meine Aufzeichnungen machen. Sonst bringe ich hinterher nichts mehr zusammen.
Fritz und ich schreiten in einem mittleren Tempo voraus, der Alte tappt vorsichtig hintendrein.
»Wie ist’s?«, fragt Fritz über die Schulter zurück.
»Es geht so«, meint der »alte Mann«. »Es war schon schlimmer.«
Ich weiß nicht recht, ob ich auch noch über das Problem der Erbteilung, steinige Bodenbeschaffenheit und den Mangel an Futterkräutern und Düngemitteln referieren soll. Ob sich die beiden für meine lehrhaften Ausführungen überhaupt interessieren? Sie hören mir vermutlich nicht zu, schon gar nicht der Alte, der ein gutes Stück hinter uns herstiefelt.
Doch ich liege falsch, denn plötzlich feixt er von hinten: »Württemberg, pah! Was ist eine Regierung gegen das Reich Gottes? Das hat schon Jesus Christus kapiert. Das Reich Gottes zeigt sich nicht durch Gepränge oder äußerliche Gebärden. Man kann auch nie sagen: Sieh, hier ist es, oder dort ist es. Denn siehe! das Reich Gottes muss inwendig in euch errichtet werden.«8
»Jawohl«, pariere ich. »Dann müssen wir nur bessere Menschen werden, und schon hat die Ungerechtigkeit der Welt ein Ende.«
Die Sonne geht auf. Sehr schwach scheint sie durch die dünne Wolkendecke. Eine Marktfrau kommt uns entgegen, auf dem Rücken einen großen Weidenkorb.
»Jetzt pass auf.« Der »alte Mann« überholt uns emsig und hebt zum Gruß die Hand. »Reich Gottes«, schmettert er.
Die Frau stutzt, fährt sich über die Stirn, lächelt. »Reich Gottes.«
»Na also. Geht doch ganz trefflich.« Der »alte Mann« stolziert grinsend an ihr vorbei.
Ich bin mir sicher, dass wir uns gerade versündigen.
Der Fritz neben mir sinniert: »Reich Gottes, ja was. Gott ist eins mit Kosmos und Natur.« Und er hebt die Hände zum Himmel. »Das Göttliche ist Aufbau und Struktur des Universums, es existiert in uns und in allen Dingen, es beseelt die Welt und ist mit der Welt identisch. Allda bin ich alles miteinander.9 Eines zu sein mit allem, das ist Leben der Gottheit, und Leben in der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen.Eines zu sein mit allem, was lebt, in seliger Selbstvergessenheit wieder einzukehren ins All der Natur, das ist der Gipfel der Gedanken und Freuden.«10
»Diese pantheistische Naturseligkeit«, schimpft der Alte, der wieder in sein gemächlicheres Tempo zurückfällt, »wird dich noch um den Verstand bringen. Ich hasse die Natur und setze mein Leben aufs Spiel, um deines zu bewahren. Nur darum bin ich mit auf diesen Höllenpfad gekommen: um deine betrogene Seele zu retten. Wir müssen an uns arbeiten, Fritz. An uns selber, am Geist! Fritzle, was gäbe ich jetzt für einen randvollen Steinkrug Trollinger und ein paar anständige Maultaschen.«
Ich weiß, was er mir damit sagen will: In den Maultauschen ist das Fleisch versteckt, damit es der Bigotte am Freitag beim Essen nicht sieht. Doch auch der Scheinheilige verschmäht nicht den frevelhaften Genuss und verzehrt das Verwerfliche mit klammheimlicher Inbrunst. Und so einer bin ich seiner Meinung nach. Der Alte muss mich andauernd zur Sau machen. Er ist ein charakterloser Lump, und ich tue ihm noch schön.
»Lass das Fritzle in Ruhe«, befiehlt der Fritz. »Es kann nichts dafür, es ist so kleingeistig erzogen.«
Das sieht ihm gleich. Er pflichtet dem Alten bei, der Schafmelker, und verunglimpft willfährig meine Erziehung. Ausgerechnet er mit seinem Muttermalheur, Mutter hier, Mutter da. Er hängt nicht nur an ihrem Rockzipfel, er hat sich noch nicht einmal abgenabelt. Ein ähnliches Muttersöhnchen hab ich noch nirgends erlebt. Allerdings muss ich feststellen, dass der Fritz auf der Wanderung bisher kein einziges Mal von der Mutter angefangen hat. Offenbar tut Mutter Natur ihm da gut.
Aber für mich entpuppt sich der Weg immer mehr als Prüfung. Andauernd muss ich mich vor meinen Wandergesellen rechtfertigen, die mich als unpoetischen, philosophiefremden, geistfernen Grasdackel verspotten. Das Problem ist: Ich will mich mit ihnen messen. Das strengt mich an. Sie schwätzen sich unablässig die Gescheitheit aus dem Leib. Und sobald ich was zu sagen weiß, werde ich ignoriert. Ich fühle mich ausgeschlossen aus der verstiegenen Vertrautheit der zwei Kommilitonen, die einen verschworenen Umgang miteinander pflegen, in einer Ausschließlichkeit, die keinen Dritten hineinlässt. Ich kenne das zur Genüge von der Stube, doch dünkt es mir dort mitnichten so penetrant wie auf Wanderschaft. Ich muss aufhören, ihnen imponieren zu wollen, es führt eh zu nichts als Verdruss. Es ist mir verleidet, um ihre Gunst zu buhlen.
»Was ist das denn?«, fragt der Fritz. Im Gehen deutet er auf zwei aufgeschichtete Steinhäufen.
»Schießmauern«, erkläre ich. »Haben wir gestern bei Dußlingen schon gesehen. Besonders in kriegerischen Zeiten und sogar noch bis zum Anfang unseres Jahrhunderts wurden die Landleute zu militärischen Übungen angehalten. An Schießmauern, auch beim Freischießen, einem Schützenfest, das heuer kaum noch gepflegt wird. Viele Bauern und Bürger, die früher schießwütig waren, haben nicht einmal mehr eine Flinte im Schrank. Das freilich ist so gewollt und gelenkt. So können sie schon nicht dem Wild nachstellen und das unmäßige Jagdvergnügen ihres Fürsten oder Herzogs schmälern.«
Ein wenig zerstreut und innerlich entzweit erreichen wir nach über einer Stunde den ansehnlichen Ort Gomaringen. In einem stolzen Schlösslein befindet sich die herzogliche Kammerschreiberei. Ein Beamter verwaltet die Güter des Herzoghauses. Vis-à-vis steht die stattliche Kirche. Mitten durchs Dorf fließt die Wiesaz, die mehrere Mühlen antreibt. Wir befinden uns nun am Fuße der Alb, was sich in einem etwas raueren Klima bereits bemerkbar macht. Wolken ziehen vorüber. Es luftet leise, als ginge weiter oben ein Wind. Noch ist es lange vor Mittag und wir haben noch viel Weg vor uns.