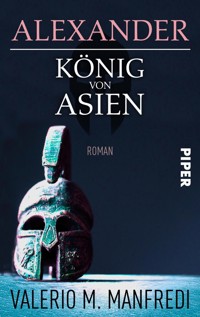
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der spannenden und weltweit begeistert aufgenommenen Roman-Biographie über Alexander den Großen von Valerio M. Manfredi! Alexanders aufsehenerregendes Wagnis nimmt seinen Lauf: Von unbändigem Eroberungswillen getrieben, zieht der strahlende junge Makedonenkönig Alexander nach Persien. Dort bezwingt er den persischen Feldherrn Memnon und erobert auch das Herz von Memnons Frau, der wunderschönen Barsine. In Gordion löst Alexander den berühmten Gordischen Knoten mit einem einzigen Schwerthieb. In der legendären Schlacht bei Issos besiegt er sogar den persischen Großkönig und erreicht schließlich als glorreicher Held Ägypten. Begeisterte Leserstimmen: »Manfredi ist absolute Klasse... jedes seiner Bücher ist ein »Hammer« super recherchiert und spannend bis zur letzten Seite.« »So fundiert wie spannend: Mit diesem großen Werk hat Manfredi sein opus magnum abgeschlossen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Übersetzt aus dem Italienischen von Claudia Schmitt
ISBN: 978-3-492-98410-2
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
Titel der italienischen Originalausgabe: »Aléxandros – Le Sabbie di Amon«
© Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., Mailand 1998, © 2015, Mondadori Libri SpA, Milano
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 2000
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Motto
Karte: Von Phönizien nach Ägypten
1 – Alexander sah von …
2 – Alexander zog sich …
3 – Memnon, der Rhodier …
4 – Ptolemaios kam von …
5 – Der Fluss, der …
6 – Er wurde von …
7 – Die beiden agrianischen …
8 – Die im persischen …
9 – Am nächsten Morgen …
10 – Das Heer rückte …
11 – Apelles traf am …
12 – Rund sechs Wochen …
13 – Der Kommandeur der …
14 – Der Frühling war …
15 – Barsine und die …
16 – Das fürchterliche Dröhnen …
17 – Nachdem die miletischen …
18 – Als er von …
19 – Die Frau liess …
20 – Alexander liess nach …
21 – Alexander flüsterte Eumenes …
22 – Alexander und Hephaistion …
23 – Alexander erwachte, weil …
24 – Auf der Hügelkuppe …
25 – Der Mann kam …
26 – Hab ich richtig …
27 – Der Mann, der …
28 – Alexander liess sich …
29 – Alexander tat in …
30 – Alexander, wir warten …
31 – Nach langem Feilschen …
32 – Die jungen Männer …
33 – Ein Ruderboot näherte …
34 – Von Halikarnassos aus …
35 – Etwa zehn Tage …
36 – Aristandros war wie …
37 – Mit Aristandros’ Hilfe …
38 – Aristoteles nahm eines …
39 – Aristoteles begab sich …
40 – Der Regent Antipatros …
41 – Der Kommandant der …
42 – Der Kommandant der …
43 – Eines Abends mitten …
44 – Nachdem Philipp, der …
45 – Wenige Tage später …
46 – »Schafshirn«, verkündete der …
47 – Die Nachricht verbreitete …
48 – Nearchos’ kleine Flotte …
49 – Alexander hielt noch …
50 – Es war tief …
51 – Parmenion war im …
52 – Das Heer setzte …
53 – Die Bewohner von …
54 – Wenige Tage später …
55 – Gegen Ende des …
56 – Alexander befahl der …
57 – Philipp wusch sich …
58 – Die Reise zur …
59 – Der Vormarsch in …
Nachwort
Karte: Das Weltreich Alexanders des Großen
Et siluit terra in conspectu eius.
Und die Erde verstummte bei seinem Anblick.
Makkabäer 1,3
1
Alexander sah von einem Hügel auf den Strand hinunter, wo sich ein ganz ähnliches Bild bot wie vor tausend Jahren bei Achills Landung: Hunderte von aneinandergereihten Schiffen, Tausende und Abertausende von Kriegern. Aber die Stadt hinter seinem Rücken, Ilion, die Erbin des alten Troja, bereitete sich heute nicht auf eine zehnjährige Belagerung vor, ganz im Gegenteil: Sie öffnete ihm, dem Nachfahren des Achilleus und des Priamos, Tür und Tor.
Schon kamen auch seine Kameraden den Hügel heraufgeritten, doch anstatt auf sie zu warten, wandte Alexander sein Pferd und lenkte es zum Tempel. Er wollte als erster und ganz alleine das uralte Heiligtum der trojanischen Athene betreten. Vor seiner Schwelle angekommen, überließ er Bukephalos einem Diener und trat ein.
Zunächst konnte er nichts Genaues erkennen, denn er war geblendet von der gleißenden Mittagssonne und seine Augen mußten sich erst an das Dämmerlicht im Tempel gewöhnen. Doch nach und nach nahmen die Dinge Konturen an:
Das alte Heiligtum war voll mit Weihgeschenken aller Art, besonders Waffen, die an den Trojanischen Krieg erinnerten, an Homers Epos von der zehnjährigen Belagerung der Stadt, die die Götter selbst errichtet hatten. An jedem dieser »Andenken« war eine Widmung oder Inschrift befestigt, und so konnte Alexander beispielsweise die Kithara des Paris oder den großen Rundschild des Achill ausmachen.
Lange ließ er die Augen umherschweifen und immer wieder verweilten sie bei einem der kostbaren Erinnerungsstücke, die unsichtbare Hände all die Jahrhunderte hindurch gepflegt und erhalten hatten, so daß die Gläubigen und Pilger sich heute noch an ihrem Glanz erfreuen konnten. Alles hing voll damit: die Säulen, das Dachgebälk, die Mauern der Cella. Aber wie viele von diesen Votivgaben waren wirklich authentisch, und wie viele hatten gerissene Priester in ihrer Profitgier nachträglich hinzugefügt?
Alexander fand, daß der bunte Wirrwarr eigentlich besser auf einen Markt als in einen Tempel gepaßt hätte. Das einzig wirklich Echte in diesem Raum war seine Begeisterung für Homer, den blinden alten Sänger, und seine grenzenlose Bewunderung für die Helden, die längst zu Staub geworden waren.
Wie sein Vater einst in den Apollontempel zu Delphi, so war auch er unangekündigt hierhergekommen. Niemand hatte ihn empfangen, doch plötzlich näherten sich leichte Schritte. Alexander verbarg sich rasch hinter einer Säule neben dem Kultbild, einer eindrucksvollen, in Stein gemeißelten Athene, die bemalt und mit echten Waffen ausgestattet war. Die primitive, steif wirkende Statue war aus einem einzigen Block dunklen Steins gehauen. Ihr Gesicht war angeschwärzt vom Rauch der Öllampen, und die hellen Perlmuttaugen stachen auffällig daraus hervor.
Alexander konnte von seinem Versteck aus beobachten, wie ein Mädchen mit blütenweißer Haube und Peplon auf die Statue zuging. Es hatte in der linken Hand einen kleinen Eimer und in der rechten einen Schwamm.
Damit kletterte es auf den Statuensockel, und dann begann es, das Standbild behutsam abzuwischen, wobei sich in der hohen Tempelhalle ein betörender Duft nach Aloe und Lavendel verbreitete. Alexander trat geräuschlos hinzu.
»Wer bist du?« fragte er.
Das Mädchen zuckte zusammen und ließ vor lauter Schreck sein Eimerchen fallen; es schlug mit lautem Gepolter auf dem Boden auf und rollte davon, bis es gegen eine Säule stieß.
»Fürchte dich nicht«, sagte der König. »Ich bin nur ein Pilger, der gekommen ist, die Göttin zu verehren. Aber wer bist du?«
»Ich heiße Daunia und bin eine Tempeldienerin«, erwiderte die junge Frau, eingeschüchtert von Alexanders Aussehen, das wahrhaftig nicht das eines gewöhnlichen Pilgers war. Unter seinem Umhang blitzten ein Harnisch und Beinschienen hervor, und der metallene Gliedergürtel, den er quer über die Brust trug, klirrte bei jeder Bewegung.
»Eine Tempeldienerin? Das hätte ich nicht gedacht. Deine vornehmen Züge, dein stolzer Blick …«
»Du bist wahrscheinlich an die Sklavinnen der Aphroditetempel gewöhnt, die weniger der Göttin zu Diensten sind als den Männern, die sie besuchen.«
»Du nicht?« fragte Alexander, indem er für sie den Eimer vom Boden aufhob.
»Nein, ich bin Jungfrau. Genau wie die Göttin selbst. Hast du je von der Stadt der Frauen gehört? Da komme ich her.«
Das Mädchen sprach in der Tat einen eigentümlichen Dialekt, den Alexander noch nie gehört hatte.
»Nein, diese Stadt kenne ich nicht. Wo liegt sie?«
»In Italien. Sie heißt Lokroi.«
»Und warum nennt ihr sie die Stadt der Frauen?«
»Weil die Adligen dort ausschließlich Frauen sind. Lokroi wurde von hundert Familien gegründet, die alle von Frauen aus Lokris abstammten – das war ihr Heimatland, aber nachdem sie ihre Männer im Krieg verloren hatten, sind sie mit ihren Sklaven geflohen. So erzählt man es sich wenigstens.«
»Und was machst du hier, so weit weg von zu Hause?«
»Ich sühne ein Verbrechen.«
Alexander sah sie verwundert an. »Ein Verbrechen? Was kann ein so junges Mädchen wie du schon verbrochen haben?«
»Nicht ich«, erwiderte die Tempeldienerin, »sondern unser Volksheld, Aias Oileus. Er hat in der Nacht nach der Eroberung Trojas die Tochter von König Priamos, Prinzessin Kassandra, vergewaltigt, und zwar genau hier auf dem Sockel, auf dem früher das wundertätige Bild der Göttin Athene stand, das heilige Palladium, das – wie du sicher weißt – vom Himmel heruntergefallen ist. Seit jenem Tag bezahlen die Lokrer für diese Freveltat, indem sie jedes Jahr zwei Mädchen aus höchstem Adel hierherschicken, die ein ganzes Jahr im Tempel der Göttin dienen müssen.«
Alexander schüttelte staunend den Kopf und fuhr fort, sich umzusehen. Draußen, auf dem gepflasterten Platz vor dem Tempel, hörte man lautes Hufgetrappel – offensichtlich waren seine Kameraden auch angekommen.
Zunächst trat jedoch ein Priester ein, der sofort begriff, wen er vor sich hatte:
»Willkommen, hoher Herr«, sagte er mit einer tiefen Verbeugung. »Wenn wir gewußt hätten, daß du uns mit deinem Besuch beehrst, hätten wir dich anders empfangen …« Er bedeutete dem Mädchen, sich zurückzuziehen, doch Alexander hielt sie zurück und sagte:
»Laß nur. Dieses Mädchen hat mir eine wunderschöne Geschichte erzählt … Stimmt es eigentlich, daß all diese Weihgeschenke aus der Zeit des Trojanischen Krieges stammen?«
»Selbstverständlich. Und das Kultbild, das du hier siehst, ist ein Palladium – die Kopie einer uralten Statue der Pallas Athene, die vom Himmel gefallen ist und die Stadt, die sie besitzt, unbesiegbar macht.«
Unterdessen hatten sich auch Hephaistion, Ptolemaios, Perdikkas und Seleukos dazu gesellt.
»Und wo ist das Original der Statue?« wollte Hephaistion wissen.
»Nun, manche glauben, der Held Diomedes habe sie geraubt und nach Argos mitgenommen; andere behaupten, Odysseus habe sie nach Italien entführt und König Latinos geschenkt; wieder andere sind der Meinung, Äneas habe sie in einen Tempel unweit von Rom geschafft, wo sie heute noch stünde. Es gibt jedenfalls viele Städte, die sich damit brüsten, das echte Bild zu besitzen.«
»Kein Wunder«, erwiderte Seleukos, »diese Überzeugung flößt bestimmt Mut ein.«
»Klar«, Ptolemaios nickte. »Und Aristoteles hätte jetzt sicher gesagt: Ereignisse geschehen nicht nur, sie können auch durch Überzeugung oder Prophezeiungen herbeigeführt werden.«
»Was unterscheidet denn das echte Palladium von den anderen Statuen?« wollte Alexander wissen.
»Das echte Bild«, erwiderte der Priester mit feierlicher Stimme, »kann die Augen schließen und die Lanze schütteln.«
Ptolemaios schnaubte abfällig. »So ein Spielzeug bastelt dir jeder unserer Kriegsbaumeister in einem einzigen Tag.«
Der Priester warf ihm einen eisigen Blick zu, und auch der König schüttelte mißbilligend den Kopf. »Gibt es denn irgend etwas, woran du glaubst, Ptolemaios?«
»Natürlich«, erwiderte der Gefragte und faßte an den Griff seines Schwerts. »Das hier! Und die Freundschaft«, fügte er hinzu, indem er die andere Hand auf Alexanders Schulter legte.
»Und doch werden all die Gegenstände, die ihr hier seht, seit undenklichen Zeiten in diesen heiligen Hallen verehrt«, sagte der Priester ernst. »Und die Grabhügel draußen, entlang des Strandes, bergen seit eh und je die Knochen des Achill, des Patroklos und des Aias.«
Inzwischen war auch Kallisthenes zur Tempelbesichtigung eingetroffen. Ptolemaios ging ihm entgegen und hakte sich bei ihm unter. »Was sagst du zu dem Ganzen, Kallisthenes? Ist das wirklich die Rüstung des Achilleus und das, was dort an der Säule hängt, die Kithara von Paris?« Bei diesen Worten zupfte er ein wenig an den Saiten des Instruments, das ganz dumpf klang und völlig verstimmt war.
Alexander hörte schon länger nicht mehr zu; sein Blick war auf die junge Lokrerin geheftet, die damit beschäftigt war, duftendes Öl in die Lampen zu gießen. Ein von hinten kommender Sonnenstrahl hatte ihr dünnes Peplon durchsichtig gemacht, so daß Alexander ihren schönen Körper betrachten konnte, und dabei begegnete er immer wieder den scheuen Augen des Mädchens, die etwas sehr Geheimnisvolles hatten.
»Ob diese Rüstung nun tatsächlich Achill und die Kithara Paris gehört hat, spielt doch überhaupt keine Rolle«, sagte Kallisthenes. »Im Dioskurentempel in Sparta ist das Ei ausgestellt, aus dem angeblich Helenas Brüder, die Zwillinge Kastor und Polydeukes, geschlüpft sind … Ich bin überzeugt, daß es sich in Wahrheit um das Ei eines libyschen Vogels handelt, den man Vogel Strauß nennt – er kann so groß wie ein Pferd werden. Und unsere eigenen Tempel sind im übrigen ja auch voll von solchen Votivgeschenken. Echt oder nicht, ist völlig egal. Wichtig ist nur, was die Leute glauben, denn das einfache Volk braucht einen Glauben, an den es sich klammern, und etwas, wovon es träumen kann.«
Bei diesen Worten hatte Kallisthenes sich nach Alexander umgedreht, der gerade auf die große Bronzerüstung zutrat; sie war mit schönen Zinn- und Silberornamenten verziert. Alexander strich mit dem Finger über den Schild, auf dem Szenen aus der »Ilias« dargestellt waren, und über den prächtigen Helm mit dem dreifachen Helmbusch.
»Und wie soll diese Rüstung hierher gelangt sein?« fragte er den Priester.
»Bekanntlich hat Odysseus sie dem Aias weggenommen, aber später plagte ihn das schlechte Gewissen so sehr, daß er sie zurückgebracht und vor dem Grab des Aias niedergelegt hat – sozusagen als Opfergabe für eine heile Rückkehr nach Ithaka. Irgendwer hat sie dann von dem Grab hierher in den Tempel gebracht.«
Alexander trat ganz dicht neben den Priester und sagte: »Du weißt doch, wer ich bin, oder?«
»Natürlich, Herr. Du bist Alexander, der König von Makedonien.«
»Richtig. Und mütterlicherseits bin ich auch ein direkter Nachfahre von Pyrrhos, dem Sohn des Achill und Begründer des Königshauses von Epeiros. Du wirst also einsehen, daß ich als Erbe des Achill ein Anrecht auf diese Rüstung habe. Ich möchte sie mitnehmen!«
»Aber Herr …«, stammelte der Priester erschrocken.
»Wie?« meinte Ptolemaios grinsend. »Wir sollen dir glauben, daß dies hier die Kithara des Paris ist und das dort die Waffen des Achill sind, vom Gott Hephaistos persönlich für ihn geschmiedet, und du nimmst uns nicht einmal ab, daß unser König von Achilleus abstammt?«
»Doch, doch«, beteuerte der Priester, »die Sache ist nur, daß es sich hier um geweihte Gegenstände handelt, die diesen Tempel nicht verlassen dürfen …«
»Unsinn«, unterbrach ihn Perdikkas, »laß eine Kopie davon machen und häng die an die Säule, das merkt keiner. Du siehst doch, daß unser König die Rüstung braucht, und da sie nun einmal seinem Vorfahren gehörte …« Er hob die Schultern und breitete bedauernd die Arme aus, wie um zu sagen: Erbschaft ist Erbschaft …
»Schafft mir die Rüstung ins Lager«, befahl Alexander. »Sie soll vor jeder Schlacht wie ein Banner gehißt werden. Und jetzt gehen wir. Unser Tempelbesuch ist zu Ende.«
Die jungen Makedonen verließen nacheinander den Tempel, nicht ohne sich noch einmal umzusehen und das ein oder andere der vielen Votivgeschenke zu betrachten, die hier verehrt wurden.
Der Priester merkte, daß Alexander dem Mädchen nachsah, während es die Tempelhalle durch eine kleine Seitentür verließ.
»Daunia badet jeden Abend nach Sonnenuntergang bei der Skamandros-Mündung im Meer«, raunte er ihm zu.
Der König sagte nichts und ging. Von der Schwelle des Tempels aus sah der Priester ihn kurz darauf sein Pferd besteigen und in Richtung des Lagers am Strand reiten, in dem es wie in einem Ameisenhaufen wimmelte.
Alexander sah sie schnellen, sicheren Schritts durch die Dunkelheit kommen. Sie ging am linken Flußufer entlang und blieb dort stehen, wo sich der Skamandros mit dem Meer vereinte.
Es war eine windstille, heitere Nacht, und da just in diesem Augenblick der Mond aus dem Meer auftauchte, spannte sich ein breites Silberband vom Horizont bis zum Gestade. Das Mädchen legte seine Kleider ab, löste sich das Haar und glitt ins Wasser. Sanfte Wellen umspielten seinen Körper, der wie weißer Marmor im Mondlicht leuchtete.
»Du bist schön wie eine Göttin, Daunia«, murmelte Alexander, indem er sich zu erkennen gab.
Das Mädchen tauchte bis zum Kinn ins Wasser und wich erschrocken zurück. »Tu mir nichts an. Du weißt, ich bin geweiht.«
»Um eine Vergewaltigung zu sühnen, die vor tausend Jahren passiert ist?«
»Um jedwede Vergewaltigung zu sühnen. Auch heute gibt es noch genug Männer, die sich an wehrlosen Frauen vergehen.«
Der König zog sich ebenfalls aus und ging ins Wasser, während sie die Arme vor der Brust verkreuzte, um ihren Busen zu verbergen.
»Ich habe gehört, daß die berühmte Aphrodite des göttlichen Praxiteles genau wie du ihren Busen bedeckt. Denn auch Aphrodite ist schamhaft … Aber vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Komm her.«
Das Mädchen näherte sich ihm langsam, halb schwamm und halb ging sie und dabei tauchte ihr herrlicher Körper immer weiter aus dem Meer auf, das wie in einer zärtlichen Umarmung zuerst ihren Bauch und dann ihre Hüften umfing.
»Laß uns zum Grabhügel des Achill schwimmen. Ich möchte, daß niemand uns sieht.«
»Folge mir«, erwiderte Daunia. »Ich hoffe, du bist ein guter Schwimmer.« Und mit diesen Worten ließ sie sich seitlich ins Wasser gleiten und schwamm behende wie eine Nereide vor ihm her.
»Das bin ich«, antwortete Alexander und warf sich ebenfalls in die Fluten.
Die Küste, die von den Lagerfeuern der Makedonen beleuchtet wurde, bildete an dieser Stelle eine weite Bucht; sie wurde auf der gegenüberliegenden Seite von einer Landzunge begrenzt, auf deren äußerster Spitze man einen Erdhügel erkennen konnte.
Auf diesen schwamm das Mädchen direkt zu, quer durch den breiten Meerbusen. Sie machte beim Schwimmen keinerlei Geräusch und erinnerte Alexander mit ihren weichen, fließenden Bewegungen an eine Meernymphe.
»Du schwimmst gut«, meinte er keuchend. »Alle Achtung!«
»Ich bin am Meer groß geworden … Möchtest du immer noch zu der Landzunge hinüber?«
Alexander antwortete nichts und schwamm weiter, bis er den weißen Schaum der Wellen erkennen konnte, die sich sanft am mondbeschienenen Strand brachen und sogar den Fuß des mächtigen Erdhügels befeuchteten. Das war also das Grab des Achill! Hand in Hand stiegen sie aus dem Wasser und gingen darauf zu. Bei seinem Anblick fühlte Alexander sich vom Geist des großen Helden durchdrungen, und als er sich nach seiner Begleiterin umdrehte, die im silbernen Mondlicht neben ihm stand und seinen Blick suchte, glaubte er die schöne Briseis mit ihren rosa Wangen vor sich zu haben.
»Nur den Göttern sind Augenblicke wie dieser beschieden«, flüsterte er, das Gesicht der lauen Meeresbrise preisgegeben. »Hier hat Achilleus gesessen und den Tod des Patroklos beweint. Und hier hat seine Mutter, die Meergöttin Thetis, die Waffen niedergelegt, die Hephaistos für ihn geschmiedet hat.«
»Dann glaubst du also?« fragte das Mädchen.
»Ja.«
»Aber warum hast du dann im Tempel …«
»Hier ist es anders. Es ist Nacht, der Lärm des Tages ist verebbt … Und du stehst hüllenlos und strahlend vor mir.«
»Bist du wirklich König Alexander?«
»Schau mich an. Wer soll ich sonst sein?«
»Du bist der Jüngling, der mir nachts im Traum erscheint, wenn ich mit den anderen Dienerinnen im Tempel der Göttin schlafe. Der Jüngling, den ich gerne geliebt hätte.«
Sie drehte sich zu ihm um und lehnte ihren Kopf an seine Brust.
»Ich breche morgen auf«, sagte Alexander, »und in wenigen Tagen steht mir eine schwere Schlacht bevor. Vielleicht siege ich, vielleicht sterbe ich aber auch.«
»Dann komm in meine Arme und nimm mich, wenn du möchtest, hier, auf dem warmen Sand, sollten wir es später auch bereuen müssen.« Sie küßte ihn lange und streichelte sein Haar. »Du hast recht«, sagte sie dann. »Augenblicke wie dieser sind nur den Göttern beschieden. Und wir beide werden für diese eine Nacht Götter sein.«
2
Alexander zog sich vor dem versammelten Heer splitternackt aus und rannte, wie der alte Brauch es verlangte, dreimal um den Grabhügel des Achill. Dasselbe tat Hephaistion mit dem Grab des Patroklos, und bei jeder Umrundung schrien mehr als vierzigtausend Mann im Chor:
»Alalalài!«
»Was für ein erstklassiger Schauspieler!« rief Kallisthenes aus, der die Szene aus einiger Entfernung verfolgte.
»Du meinst, er schauspielert?« erwiderte Ptolemaios.
»Aber ganz bestimmt. Alexander glaubt nicht mehr an Mythen und Legenden als du und ich, aber er tut so, als seien sie die pure Wahrheit. Auf diese Weise zeigt er seinen Männern, daß man Träume wagen darf.«
»Du scheinst ihn ja wirklich bis auf den Grund seiner Seele zu kennen«, meinte Ptolemaios sarkastisch.
»Nun, ich habe gelernt, die Menschen zu beobachten – genau wie die Natur.«
»Dann solltest du aber wissen, daß niemand von sich sagen kann, er kenne Alexander. Alle haben seine Taten vor Augen, aber vorhersehbar sind sie nicht, und ihr tieferer Sinn bleibt uns auch oft verborgen. Er glaubt und glaubt nicht, zur selben Zeit, er kann in Liebe schwelgen und einen Moment später einen fürchterlichen Wutanfall bekommen, er ist …«
»Was?«
»Er ist einfach anders. Als wir uns zum erstenmal begegnet sind, war er gerade sechs Jahre alt, trotzdem kann ich bis heute nicht behaupten, ihn wirklich zu kennen.«
»Du magst ja recht haben, trotzdem sind in diesem Moment alle seine Männer felsenfest davon überzeugt, daß er der wiedererstandene Achilleus ist, und Hephaistion der Patroklos.«
»Klar, und nicht nur seine Männer: Er und Hephaistion glauben das in diesem Moment auch. Aber daran bist du mit schuld, Kallisthenes, schließlich hast du mit deinen astronomischen Berechnungen festgestellt, daß unser Einfall nach Asien im selben Monat stattgefunden hat, in dem vor exakt eintausend Jahren der Trojanische Krieg begann.«
Alexander und Hephaistion hatten inzwischen wieder ihre Rüstungen angelegt und kletterten auf ihre Pferde. Als General Parmenion dann Befehl gab, in die Trompeten zu stoßen, sprang auch Ptolemaios in den Sattel. »Ich muß zu meiner Abteilung. Alexander läßt zum Appell blasen.«
Mehrmals noch erschallten die Trompeten, und die ganze Armee bezog entlang des Strandes Stellung, jede Abteilung mit ihrer Standarte und ihren Insignien.
Das Fußvolk umfaßte insgesamt zweiunddreißigtausend Mann. Links außen waren dreitausend »schildtragende Gardisten« aufgestellt, zur Mitte hin folgte eine Truppe von siebentausend griechischen Bundesgenossen – das war gerade ein Zehntel der Krieger, die einhundertfünfzig Jahre zuvor in Plataia gegen die Perser gekämpft hatten. Alle trugen die traditionelle wuchtige Rüstung der griechischen Infanterie und schwere korinthische Helme, die lediglich schmale Schlitze für Augen und Mund hatten und ansonsten ihre Gesichter bis zum Halsansatz bedeckten.
Im Zentrum hatten die sechs Phalanxbataillone mit zirka zehntausend Pezetairoi Stellung bezogen und rechts die Hilfstruppe aus dem Norden: fünftausend Thraker und Triballer, die – verlockt von der Aussicht auf Sold und einträgliche Plünderungen – Alexanders Einladung gefolgt waren; sie galten nicht nur als unglaublich tapfer und kühn, sondern schienen auch gegen Kälte, Hunger und sonstige Strapazen gefeit. Ihr Anblick war allerdings ziemlich scheußlich, denn sie hatten borstiges rotes Haar, lange Bärte und waren obendrein von Kopf bis Fuß mit Tätowierungen übersät.
Die wildesten und primitivsten unter diesen Barbaren waren die Agrianer aus den illyrischen Bergen. Da sie kein Wort Griechisch sprachen, brauchte man einen Dolmetscher, um sich mit ihnen zu verständigen, aber sie waren hervorragende Kletterer, die mit Hilfe von Haken und Seilen aus Pflanzenfasern jede Felswand bezwangen. Die Thraker und alle anderen Hilfssoldaten aus dem Norden waren mit Lederhelmen und -korsetts ausgerüstet sowie mit kleinen, halbmondförmigen Schilden und langen Säbeln, mit denen man sowohl stechen wie hauen konnte. Sie waren bekannt dafür, daß sie auf dem Schlachtfeld wie die wilden Bestien wüteten und im Nahkampf schon mal zubissen, wenn es anders nicht ging. Wie um sie im Zaume zu halten, folgten ganz außen rechts weitere siebentausend griechische Söldner der schweren und leichten Infanterie.
Auf den Flügeln, vom Fußvolk getrennt, hatte die Reiterei Stellung bezogen: zweitausendachthundert schwerbewaffnete Hetairoi, etwa ebenso viele thessalische Reiter, rund viertausend Hilfssoldaten sowie die fünfhundert Elitereiter der »Alexander-Schwadron«.
Der König ritt das Heer auf Bukephalos Abteilung für Abteilung ab. Unter den Kameraden, die ihm dabei folgten, war auch sein Sekretär Eumenes. Er saß stocksteif auf seinem Pferd, denn er trug heute ebenfalls eine Rüstung, und zwar einen athenischen Leinenpanzer, der mit glänzendem Bronzeblech verstärkt und geschmückt war; seine Gedanken beim Abreiten der vielen tausend Soldaten waren eher prosaischer Natur: Er überschlug nämlich im Geiste, wieviel Korn, Hülsenfrüchte, gesalzener Fisch und Rauchfleisch nötig waren, um diese Männer zu sättigen, und wieviel Wein, um ihren Durst zu löschen – es waren Riesenmengen. Woher sollte er das Geld nehmen, um täglich so viel Proviant auf den Märkten zu kaufen? Die Reserven, die er bei sich hatte, würden bald erschöpft sein. Anstatt jedoch zu verzagen, nahm er sich vor, dem König noch heute abend Ratschläge für das Gelingen der Expedition zu geben.
Als sie die Spitze des aufgestellten Heers erreicht hatten, gab General Parmenion auf ein Zeichen Alexanders hin den Befehl zum Aufbruch. Nach und nach setzte sich der lange Zug in Bewegung: in der Mitte das Fußvolk, rechts und links davon in doppelter Reihe die Reiterei. Man marschierte am Meer entlang in Richtung Norden.
Wie ein Reptil schlängelte sich die lange Prozession durch die Landschaft, und Alexanders glänzender Helm, auf dem zwei lange weiße Federn steckten, war weithin sichtbar.
Die schöne Daunia trat in diesem Moment vor das Tor des Athenetempels hinaus und blieb auf der obersten Stufe seiner Treppe stehen. Der junge Mann, den sie in dieser duftgeschwängerten Frühlingsnacht geliebt hatte, wirkte jetzt klein wie ein Kind, und seine Rüstung blitzte in der Sonne, als wäre sie tage- und nächtelang auf Hochglanz poliert worden. Nein, das war nicht mehr er; ihn gab es nicht mehr.
Ein Gefühl der Leere breitete sich in ihr aus, während sie ihm nachsah, und als er schließlich ganz aus ihrem Blickfeld verschwunden war, wischte sie sich rasch mit der Hand über die Augen, ging in den Tempel zurück und zog leise das große Tor hinter sich zu.
Eumenes hatte zwischenzeitlich zwei Stafetten mit Geleitschutz nach Lampsakos und Kyzikos gesandt, mächtige griechische Städte, die am Hellespont lagen – die erste direkt an der Küste und die zweite auf einer Insel unmittelbar davor. Im Auftrag Alexanders sollten die Boten den Bürgern dieser Städte erneut die Freiheit und einen Bündnispakt anbieten.
Der König war begeistert von der Landschaft, durch die sie kamen, und drehte sich an jeder Wegbiegung nach Hephaistion um: »Schau nur, das Dorf dort, schau nur, der Baum, schau nur, das Standbild …« Alles war neu für ihn und erfüllte ihn mit Staunen: die weißen Dörfer auf den Hügeln, die Tempel der griechischen und barbarischen Gottheiten, eingebettet in die ländliche Umgebung, der Duft der blühenden Apfelbäume, das leuchtende Grün der Granatapfelbäume.
Von seinem Exil in den verschneiten Bergen Illyriens einmal abgesehen, war dies Alexanders erste Reise außerhalb Griechenlands.
Hinter ihm ritten Ptolemaios und Perdikkas, während alle anderen Kameraden bei ihren Soldaten waren. Lysimachos und Leonnatos führten die Nachhut an, die dem Zug in einiger Entfernung folgte.
»Warum ziehen wir eigentlich nach Norden?« fragte Leonnatos.
»Alexander möchte die asiatische Seite der Meerengen unter seine Kontrolle bringen. Danach kann keiner ohne unsere Einwilligung aus Asien hinaus oder nach Asien herein, und Athen hätte auch einen Grund mehr, uns gewogen zu bleiben, schließlich müssen seine Getreideschiffe alle dort oben durch. Im übrigen wären damit auch die persischen Provinzen am Schwarzen Meer abgeschnitten … ein kluger Zug also.«
»Das ist wahr.«
Sie ritten im Schrittempo weiter, während die Sonne langsam ihrem Zenit entgegenging. Nach längerem Schweigen sagte Leonnatos: »Eins verstehe ich nicht …«
»Man kann im Leben nicht alles verstehen«, erwiderte Lysimachos ironisch.
»Schon möglich, aber sag du mir, wieso es hier so ruhig ist. Wir sind am hellichten Tag mit vierzigtausend Mann an Land gegangen, Alexander hat den Tempel von Ilion besucht und ist dreimal um Achills Grab gerannt, und keiner wartet auf uns. Ich meine, kein Perser. Findest du das nicht seltsam?«
»Überhaupt nicht.«
»Warum?«
Lysimachos wandte den Kopf nach hinten. »Siehst du die zwei dort oben?« fragte er und deutete auf die Hügelkette zu ihrer Rechten, auf der verschwommen zwei Reitergestalten zu erkennen waren. »Die folgen uns seit heute früh, und bestimmt haben sie uns gestern schon beobachtet und sind auch nicht die einzigen.«
»Dann müssen wir Alexander warnen!«
»Keine Sorge, Alexander weiß das längst, und er weiß auch, daß uns die Perser irgendwo einen würdigen Empfang vorbereiten …«
Der Marsch verlief ohne irgendwelche Zwischenfälle bis zur Mittagsrast und danach ebenso. Von feindlichen Truppen keine Spur, man begegnete nur Bauern, die auf ihren Feldern arbeiteten, und Scharen von Kindern, die lachend und schreiend ein Stück Weg mitliefen.
Gegen Abend wurde in der Nähe von Abydos das Feldlager aufgeschlagen. Parmenion postierte ringsherum Wächter und schickte kleine Erkundungstrupps in die umliegende Gegend, um vor Überraschungsschlägen sicher zu sein.
Sobald Alexanders Zelt stand, rief die Trompete zum Kriegsrat, und alle Generäle versammelten sich um einen Tisch, während das Abendessen aufgetragen wurde. Kallisthenes war auch dabei, aber Eumenes fehlte noch; er hatte gebeten, schon einmal ohne ihn anzufangen.
»Jungs, hier ist es hundertmal besser als in Thrakien!« rief Hephaistion. »Ausgezeichnetes Klima, freundliches Volk, hübsche Mädchen und kein Schwanz von einem Perser! Ich komme mir vor wie in Mieza, als wir mit Aristoteles im Wald Insekten fangen gingen.«
»Mach dir mal keine Illusionen«, sagte Leonnatos. »Lysimachos und ich haben zwei Reiter gesehen, die uns den ganzen Tag gefolgt sind und sich bestimmt auch jetzt irgendwo hier in der Nähe herumtreiben.«
Nun bat Parmenion ums Wort, höflich, wie es sich für einen General von der alten Garde gehörte.
»Du brauchst nicht um Erlaubnis bitten, wenn du sprechen möchtest, Parmenion«, sagte Alexander. »Du bist bei weitem der Erfahrenste unter uns; wir können alle von dir lernen.«
»Danke«, erwiderte der General. »Ich wollte nur wissen, was du für morgen und die nächsten Tage vorhast, Herr.«
»Ins Landesinnere vordringen.«
»Sprich: in persisches Gebiet …«
»Jawohl. Sind wir erst mal bei ihnen eingefallen, werden sie keine andere Wahl haben, als uns auf offenem Schlachtfeld gegenüberzutreten. Und dort schlagen wir sie.«
Parmenion schwieg.
»Bist du nicht einverstanden?«
»Nur bis zu einem gewissen Punkt, Herr. Ich bin schon bei unserem letzten Kriegszug an die Perser geraten: Sie sind keine leichten Gegner, das kann ich dir garantieren. Außerdem haben sie jetzt einen hervorragenden Anführer – Memnon von Rhodos.«
»Ein griechischer Vaterlandsverräter!« platzte Hephaistion heraus.
»Nein, ein Berufssoldat, ein Söldner.«
»Das kommt doch aufs gleiche raus …«
»Nein, Hephaistion. Es gibt Leute, die in unzähligen Kriegen gekämpft haben und am Ende keinerlei Überzeugung oder Ideal mehr besitzen – dafür sehr viel Können und Erfahrung. Solche Leute verkaufen ihr Schwert an den Meistbietenden, aber wenn sie Männer von Ehre sind, und dieser Rhodier ist ein Mann von Ehre, stehen sie zu ihrem Wort – um jeden Preis; es wird sozusagen zu ihrer neuen Heimat, und sie verteidigen es bis zum letzten Tropfen Blut … Memnon stellt eine Gefahr für uns dar, um so mehr, als er über ein Söldnerheer von zehn- bis fünfzehntausend Mann verfügt, alles Griechen und alle bestens ausgerüstet. Und was die Griechen auf offenem Feld leisten können, brauche ich euch ja nicht zu erzählen …«
»Bedenke, daß wir die ›Heilige Schar‹ der Thebaner geschlagen haben«, sagte Seleukos.
»Schon, aber das hier sind Berufssoldaten«, entgegnete Parmenion. »Die machen nichts anderes als den ganzen Tag kämpfen – wenn nicht auf dem Schlachtfeld, dann auf dem Exerzierplatz.«
»Parmenion hat recht«, sagte Alexander. »Memnon ist gefährlich und seine Söldnerphalanx erst recht, vor allem wenn sie von der persischen Reiterei unterstützt wird.«
In diesem Moment betrat Eumenes das Zelt.
»Steht dir gut, die Rüstung«, meinte Krateros mit einem Grinsen. »Du siehst aus wie ein General. Schade nur, daß du so krumme, dünne Beine hast und …«
Allgemeines Gelächter quittierte die Bemerkung, aber Eumenes begann seelenruhig zu deklamieren:
»Ich mag Generäle nicht, die gestriegelt und geschniegelt sind,
sollen sie ruhig häßlich sein und krumme Beine haben – ein Löwenherz, nur darauf kommt es an!«
«Bravo!« rief Kallisthenes. »Archilochos gehört zu meinen Lieblingsdichtern.«
»Laßt Eumenes endlich sprechen«, sagte Alexander. »Ich hoffe, er bringt mir gute Nachrichten.«
»Gute und schlechte, mein Freund. Entscheide du, mit welchen ich beginnen soll.«
»Mit den schlechten«, knurrte Alexander ärgerlich. »An die guten gewöhnt man sich allemal. Gebt ihm einen Stuhl.«
Eumenes ließ sich nieder, was mit der Rüstung gar nicht so leicht war, da sie einen daran hinderte, den Rücken zu krümmen. »Die Bewohner von Lampsakos teilen uns mit, daß sie sich schon frei genug fühlen und auf unseren Beistand verzichten können. Mit anderen Worten: Wir sollen ihnen vom Leibe bleiben.«
Alexanders Miene hatte sich verdüstert, und man sah ihm an, daß er einem Tobsuchtsanfall nahe war. Eumenes sprach deshalb ohne Pause weiter: »Aus Kyzikos kommen dagegen gute Nachrichten. Die Stadt ist uns freundlich gesonnen und möchte sich uns anschließen. Und das, liebe Freunde, ist wirklich eine ausgezeichnete Nachricht, wißt ihr warum? Weil die Perser ihre Söldner durchweg in der Währung von Kyzikos bezahlen – in Silberstateren nämlich. Hier habt ihr einen«, sagte er und warf eine glänzende Münze auf den Tisch. Sie begann sich wie ein Kreisel zu drehen und hörte nicht auf, bis die haarige Hand Kleitos’ sie mit einem trockenen Schlag zum Stillstand brachte.
»Na und?« fragte der General, indem er die Münze in den Fingern herumdrehte.
»Wenn Kyzikos kein Geld mehr in die persischen Provinzen fließen läßt, werden die Satrapen bald in Schwierigkeiten sein. Dann müssen sie sich entweder selbst besteuern oder aber ihre Söldner mit anderen Zahlungsformen abspeisen – was nicht so leicht sein dürfte. Und dasselbe gilt natürlich für alle Heereslieferanten, die Flottenbesatzung und so weiter.«
»Kompliment, Eumenes! Wie hast du das fertiggebracht?« fragte Krateros.
»Indem ich mich rechtzeitig um die Sache gekümmert habe«, erwiderte der Sekretär. »Wenn ich gewartet hätte, bis wir in Asien landen, wäre bestimmt nichts daraus geworden. Um ehrlich zu sein, verhandle ich schon ziemlich lange mit Kyzikos …« Er senkte den Kopf. »Ich habe schon zu Zeiten König Philipps damit angefangen.«
Bei diesen Worten trat Stille in dem Zelt ein, und es war, als sei der Geist des großen, durch Mörderhand gefallenen Herrschers mitten unter ihnen.
»Gut«, sagte Alexander schließlich. »Das ändert aber nichts an unseren Plänen. Morgen stoßen wir ins Landesinnere vor. Und dort stöbern wir den Löwen in seinem Versteck auf.«
In der gesamten bekannten Welt gab es niemanden, der so genaue und gut gezeichnete Landkarten besaß wie Memnon von Rhodos. Es hieß, sie gingen auf die tausendjährige Erfahrung der Seeleute seiner Insel und auf das Können eines Kartographen zurück, dessen Name streng geheimgehalten wurde.
Der griechische Söldnerführer öffnete die Karte, rollte sie flach auf dem Tisch auf, beschwerte alle vier Ecken, angelte sich aus einer Schublade eine Spielfigur und stellte sie in das Gebiet zwischen Phrygien und den Dardanellen.
»Alexander befindet sich im Augenblick ungefähr hier«, sagte er.
Um den Tisch herum standen die persischen Befehlshaber, alle in Uniform, also mit Hosen und Lederstiefeln bekleidet: Arsamenes, der Gouverneur von Pamphylien, Arsites aus Phrygien, Rosakes, Rheomithres, der Kommandeur der baktrischen Kavallerie, sowie der Oberbefehlshaber Spithridates, Satrap von Lydien und Ionien, ein hünenhafter Perser mit olivfarbener Haut und tiefgründigen schwarzen Augen; er war Vorsitzender der Versammlung.
»Wie sollen wir gegen ihn vorgehen?« fragte er den Söldnerführer auf griechisch.
Memnon hob den Blick von der Karte – er war um die Vierzig, hatte graumelierte Schläfen, muskulöse Arme und einen sehr gepflegten Vollbart, den er sich so zurechtstutzen ließ, daß er aussah wie die Männerfiguren auf den Reliefs und Vasen der berühmten griechischen Künstler.
»Was gibt es Neues aus Susa?« fragte er.
»Im Moment gar nichts. Ich denke, wir können frühestens in zwei Monaten mit massiver Verstärkung von dort rechnen: Truppen auszuheben ist eine langwierige Sache, und die Entfernungen sind riesig.«
»Wir können also nur auf unsere eigenen Streitkräfte zählen.«
»Genaugenommen, ja«, Spithridates nickte.
»Dann sind wir zahlenmäßig unterlegen.«
»Aber doch nur geringfügig!«
»Das genügt … Die Makedonen haben ein ausgezeichnetes Kampfkonzept, ich würde sagen, das beste, das es überhaupt gibt. Sie haben auf offenem Feld Heere aller Art und Herkunft besiegt.«
»Was schlägst du also vor?«
»Alexander versucht uns zu provozieren und aus der Reserve zu locken, aber ich denke, es wäre besser, einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Hört meinen Plan: Wir senden scharenweise berittene Späher aus, die uns täglich über die makedonischen Truppenbewegungen unterrichten. Gleichzeitig versuchen wir, durch Spitzel Alexanders Absichten herauszubekommen. Von hier ziehen wir uns sofort landeinwärts zurück, und dabei lassen wir nur ›verbranntes Erde‹ hinter uns – ihr kennt die Taktik: Der Feind darf kein Korn Getreide und keinen Tropfen Wasser mehr finden.«
Der Rhodier ließ seine Worte einen Moment lang nachklingen, bevor er weitersprach:
»Die Abteilungen, die Alexander daraufhin abkommandieren wird, um Lebensmittel und Futter für die Tiere zu besorgen, müssen kontinuierlich und systematisch von uns angegriffen werden – beispielsweise durch schnelle Reitertrupps. Erst wenn der Feind halb verhungert und entkräftet ist, fallen wir mit ganzer Wucht über ihn her. Und unsere Flotte verschifft unterdessen ein Expeditionskorps nach Makedonien …«
Spithridates starrte lange auf die Karte, ohne ein Wort zu sagen, dann fuhr er sich mit der Hand durch den dichten, krausen Bart und ging zu einem der vielen Fenster, von denen man das umliegende Land überblicken konnte.
Das Tal von Zelea war wundervoll: Aus dem Garten, der seinen Palast umgab, drang der bittersüße Geruch eines blühenden Weißdorn herauf und betörender Jasmin- und Lilienduft. Göttergewächse, die nur in seinem Pairidaeza wuchsen, wie die vielen Kirsch- und Pfirsichbäume, entfalteten ihre weiße Blütenpracht in der lauen Frühlingssonne.
Er ließ seinen Blick über die bewaldeten Berge schweifen, über die Paläste und Gärten der anderen persischen Adligen, die um den Tisch hinter ihm versammelt waren, und dann versuchte er sich die Folgen von Memnons Rat auszumalen und vorzustellen, was blieb, wenn man dieses smaragdgrüne Meer rücksichtslos niederbrannte: eine mit rauchender Asche bedeckte, schwarz verkohlte Einöde.
»Nein!« sagte er plötzlich und drehte sich ruckartig um.
»Aber, Herr«, wandte Memnon ein, indem er neben ihn trat. »Hast du meinen Plan gut überdacht? Ich bin der Ansicht …«
»Er ist nicht durchführbar, Kommandant«, fiel der Satrap ihm ins Wort. »Wir können nicht unsere Felder, unsere Gärten und Paläste verbrennen und Hals über Kopf fliehen – das verbietet uns schon allein die Ehre. Außerdem: Sollen wir unser Land schlimmer verheeren, als der Feind es je tun würde? Das wäre ein Verbrechen. Nein. Wir werden es mit ihm aufnehmen und ihn zurückwerfen. Was ist dieser Alexander denn schon? Ein eingebildeter junger Bursche, der einmal eine ordentliche Lektion verdient hat.«
»Bitte bedenke, daß auch ich Besitztümer und ein Haus in dieser Gegend habe, die ich bereit wäre, für einen Sieg zu opfern«, sagte Memnon.
»Deine Loyalität steht außer Frage«, erwiderte Spithridates. »Ich habe lediglich gesagt, daß dein Plan nicht durchführbar ist. Noch einmal: Wir werden es mit diesen Makedonen aufnehmen und sie zurückwerfen. Ab diesem Moment sind alle Truppen in Alarmbereitschaft«, fuhr er an die anderen Generäle gewandt fort. »Ruft jeden nur einigermaßen kampffähigen Mann zu den Fahnen. Und beeilt euch, wir haben nicht viel Zeit.«
Der Rhodier schüttelte den Kopf. »Das ist ein Fehler, den ihr noch bereuen werdet. Aber dann ist es wahrscheinlich zu spät.«
»Sei nicht so pessimistisch«, sagte der Perser. »Ich weiß schon eine günstige Stellung, aus der wir sie angreifen können.«
»Und die wäre?«
Spithridates beugte sich über den Tisch, stützte sich mit dem linken Ellbogen auf und fuhr mit dem Zeigefinger der rechten Hand suchend über die Landkarte. Schließlich deutete er auf einen kleinen, blau eingezeichneten Fluß, der sich in nördlicher Richtung durch die Landschaft schlängelte und ins Marmarameer mündete.
»Hier!«
»Am Granikos?«
Spithridates nickte. »Kennst du das Gebiet, Kommandant?«
»Einigermaßen.«
»Ich kenne es gut, ich war dort oben schon öfter zur Jagd. Der Fluß hat an dieser Stelle steile, lehmige Ufer: Für Reiter dürfte es fast unmöglich sein, dort raufzukommen, und für Fußsoldaten äußerst schwierig.«
Spithridates schlug mit der Faust auf den Tisch und sah auf.
»Wir werden sie zurückwerfen, und noch am selben Abend treffen wir uns hier in meinem Palast in Zelea zum Siegesbankett!«
3
Memnon, der Rhodier, kehrte erst mit Einbruch der Nacht in seinen Palast auf dem Hügel zurück. Die herrliche Villa war in orientalischem Stil erbaut und lag inmitten eines riesigen Parks, in dem es vor Jagdwild nur so wimmelte. Auch Weinberge, Obstplantagen, Olivenhaine und Getreidefelder sowie Höfe, Bauernhäuser und Viehherden gehörten zu dem Anwesen.
Der griechische Söldnerführer lebte seit Jahren wie ein Perser unter Persern. Seine Gemahlin Barsine war eine Tochter des persischen Satrapen Artabazos – eine wunderschöne Frau mit dunkler Haut, langem schwarzem Haar und den zierlich geschmeidigen Körperformen einer Antilope.
Ihre beiden Söhne, elf- und fünfzehnjährig, sprachen fließend Griechisch und Persisch und waren in beiden Kulturen erzogen worden. Als persische Jungen hatten sie neben Reiten und Bogenschießen auch moralische Tugenden wie die, niemals zu lügen, gelernt, als Griechen hielten sie Tapferkeit und Ehre hoch, kannten Homers Epen, die Tragödien von Sophokles und Euripides und die Lehren der ionischen Philosophen. Ihren olivfarbenen Teint und das pechschwarze Haar hatten sie von der Mutter geerbt, den muskulösen Körper und die grünen Augen vom Vater. Eteokles, der Ältere, hatte einen griechischen Namen, sein Bruder Phraates einen persischen.
Der paradiesische Garten von Memnons Palast wurde von persischen Gärtnern versorgt und enthielt viele seltene Pflanzen- und Tierarten, darunter zauberhafte indische Pfauen aus der legendären Ganges-Stadt Palimbothra. Die Villa selbst schmückten persische und babylonische Skulpturen, alte hethitische Flachreliefs, die Memnon aus einer verlassenen Stadt im Hochland hatte, wundervolle attische Speise-Service, Bronzefiguren aus Korinth und dem fernen Etrurien sowie in leuchtenden Farben bemalte Skulpturen aus parischem Marmor.
An den Wänden hingen Gemälde der berühmtesten zeitgenössischen Maler: Apelles, Zeuxis, Parrhasios. Es handelte sich vorwiegend um Jagd- und Kriegsszenen, aber auch um Darstellungen der großen Sagenhelden und ihrer Abenteuer.
Das ganze Haus war ein einziger Schmelztiegel unterschiedlicher Kulturen, und doch hatte jeder Besucher, ohne es begründen zu können, den Eindruck einer wundervollen Harmonie.
Memnon wurde bei seiner Ankunft von zwei Dienern empfangen, die ihm aus der Rüstung halfen und ihn ins Bad begleiteten, damit er sich vor dem Abendessen ein wenig erfrischen konnte. Dort gesellte sich Barsine zu ihm und reichte ihm ein Glas leichten Weins, bevor sie sich neben der Wanne niederließ, um ein wenig mit ihm zu plaudern.
»Weiß man schon Neues über die Invasion?« fragte sie.
»Ja, Alexander dringt ins Landesinnere vor. Vermutlich legt er es auf einen frontalen Zusammenstoß mit uns an.«
»Sie wollten nicht auf dich hören, und jetzt haben wir den Feind vor der Haustür.«
»Keiner hat dem Jungen so viel zugetraut. Alle waren überzeugt, er würde noch jahrelang in Griechenland Krieg führen und dabei seine Kräfte restlos aufzehren. Aber das war offensichtlich eine fatale Fehleinschätzung.«
»Was ist er für ein Mensch?« fragte Barsine.
»Schwer zu sagen … Er ist jung und sieht gut aus. Vom Wesen her soll er leidenschaftlich, ja aufbrausend sein, in Momenten der Gefahr jedoch kalt wie ein Eisblock. Offenbar kann er dann selbst die heikelsten und schwierigsten Situationen mit kühlem Kopf beurteilen.«
»Und Schwächen hat er keine?«
»Nun, er trinkt gern Wein und liebt die Frauen, aber feste Verbindungen hat er nicht – bis auf die mit einem gewissen Hephaistion … anscheinend mehr als ein guter Freund: Die beiden sollen Liebhaber sein.«
»Ist er verheiratet?«
»Nein. Er ist aus Makedonien aufgebrochen, ohne einen Thronfolger zu hinterlassen. Und vorher hat er angeblich sämtliche privaten Besitztümer unter seinen engsten Freunden aufgeteilt.«
Als Memnon aus dem Bad stieg, bedeutete Barsine den Dienerinnen, sich zurückzuziehen, und kümmerte sich selbst um ihren Mann. Sie hüllte ihn in ein weiches Tuch aus ionischem Linnen und trocknete ihm damit den Rücken ab, während er weiter über seinen Feind sprach:
»Einer von diesen reich beschenkten Freunden soll ihn gefragt haben: ›Und was behältst du für dich?‹ – ›Die Hoffnung‹, soll er gesagt haben. Ob man das nun glaubt oder nicht, es zeigt jedenfalls, daß der junge König bereits eine Legende ist, und das paßt mir überhaupt nicht: Gegen einen Mythos anzukommen ist verflixt schwierig.«
»Und es gibt wirklich keine Frau an seiner Seite?« wollte Barsine wissen.
Eine Dienerin holte das feuchte Badetuch ab, und eine andere half Memnon dabei, in einen knöchellangen blauen Chiton mit silberbestickten Säumen zu schlüpfen.
»Warum interessiert dich das so?«
»Weil Frauen meistens der schwache Punkt der Männer sind.«
Memnon hakte sich bei seiner Gemahlin unter und führte sie in den Speisesaal, der nach griechischer Art mit niederen Tischen und Liegen ausgestattet war.
Nachdem er sich ausgestreckt hatte, schenkte eine Magd ihm aus einem herrlichen, zweihundert Jahre alten korinthischen Mischkrug noch etwas von dem leichten, spritzigen Wein nach.
Memnon deutete auf ein Gemälde des Malers Apelles – eine gewagte Liebesszene zwischen Ares und Aphrodite –, das ihm gegenüber an der Wand hing. »Weißt du noch, wie Apelles dieses Bild bei uns gemalt hat?«
»Natürlich, ich erinnere mich noch sehr gut«, erwiderte Barsine, die dem Gemälde absichtlich immer den Rücken zuwandte: Sie errötete heute noch bei seinem Anblick und hatte sich nie an die griechische Freizügigkeit in solchen Dingen gewöhnen können.
»Und das Mädchen, das als Aphrodite für ihn Modell gestanden hat – kannst du sie dir noch denken?«
»Ja, sie sah wundervoll aus – eine der schönsten Frauen, die ich je gesehen habe. Man glaubte fast, die Göttin der Schönheit und Liebe in Person vor sich zu haben.«
»Dieses Mädchen war Alexanders griechische Geliebte.«
»Das ist doch nicht dein Ernst!«
»Doch. Sie heißt Kampaspe, und als sie sich zum erstenmal vor Alexander auszog, war er so hingerissen, daß er augenblicklich Apelles bestellt und damit beauftragt hat, ein Nacktporträt von ihr zu malen. Aber der Maler hat sich in sein Modell verliebt, und Alexander hat es gemerkt.«
»Oh, Schreck!« entfuhr es Barsine. »Und was hat er gemacht?«
»Er hat sie ihm geschenkt! Und zum Dank dafür wollte er nur das Bild. Tja, dieser Alexander ist nicht kleinzukriegen, nicht einmal durch die Liebe, fürchte ich … ein zäher Bursche, glaub mir.«
Barsine sah ihm tief in die Augen. »Und du?« fragte sie. »Läßt du dich von der Liebe kleinkriegen?«
Memnon erwiderte ihren Blick und sagte: »Sie ist der einzige Gegner, dem ich mich beuge.«
In diesem Moment kamen die beiden Jungen herein, um gute Nacht zu sagen.
»Wann nimmst du uns endlich in eine Schlacht mit, Papa?« fragte der ältere der beiden.
»Das hat noch Zeit«, schmunzelte Memnon. »Werdet erst einmal groß.«
Eteokles und Phraates gaben Vater und Mutter einen Gutenachtkuß. »… und entscheidet, auf welcher Seite ihr kämpfen wollt«, murmelte Memnon leise vor sich hin, während die Jungen schon wieder aus dem Zimmer rannten.
Barsine schwieg lange.
»Woran denkst du?« fragte sie ihr Mann.
»An deine nächste Schlacht, an die Gefahren, denen du ausgesetzt bist, an die bangen Stunden, in denen ich vom Turm nach dem Boten Ausschau halte, der mir sagt, ob du wohlauf oder tot bist.«
»Das ist mein Leben, Barsine. Ich bin Berufssoldat.«
»Ich weiß, aber dieses Wissen nützt mir nichts. Wann soll es stattfinden?«
»Was, der Zusammenstoß mit Alexander? Ich fürchte bald, sehr bald.«
Sie beendeten ihr Abendmahl mit süßem Zypernwein, und Memnons Blick wanderte immer wieder zu dem Gemälde von Apelles hinauf, auf dem der Kriegsgott Ares, die Waffen neben sich im Gras, auf einer Wiese lag, den Kopf im Schoß der nackten Aphrodite, die seine Schenkel liebkoste.
Irgendwann stand Memnon auf und nahm Barsine bei der Hand. »Gehen wir ins Bett«, sagte er.
4
Ptolemaios kam von seinem Inspektionsgang rund um den Schutzwall des Lagers zurück und begab sich noch einmal zur Hauptwache, um sicherzustellen, daß die Wachablösungen entsprechend geregelt waren und funktionierten.
Dann sah er, daß in Alexanders Zelt noch Licht brannte. An den Leibgardisten und an Peritas vorbei, der in seinem Hundekorb schlief, ohne ihn eines Blickes zu würdigen, ging er auf das Zelt zu und steckte seinen Kopf hinein: »Du hast nicht zufällig einen Becher Wein für einen müden alten Krieger, der halb verdurstet ist?«
»Ich hab schon an deiner Nasenspitze erkannt, daß du das bist«, lachte Alexander. »Komm rein und schenk dir ein. Leptine hab ich ins Bett geschickt.«
Ptolemaios schenkte sich Wein aus einem Krug ein und nahm einen großen Schluck. »Was liest du da?« fragte er dann, indem er dem König über die Schulter schielte.
»Xenophons ›Anabasis‹.«
»Ach, dieser Xenophon … führt zehntausend Söldner heim und tut, als hätte er den Trojanischen Krieg gewonnen.«
Alexander kritzelte etwas auf ein Blatt, legte seinen Dolch als Lesezeichen auf die Papyrusrolle und hob den Kopf. »Ich finde seinen Bericht hochinteressant. Hör, was hier steht:
Als nun der Abend hereinbrach, kam für die Feinde die Zeit wegzugehen. Denn die Barbaren schlugen ihr Lager nie in einer geringeren Entfernung als sechzig Stadien von den Griechen weg auf, weil sie einen nächtlichen Überfall befürchteten. Ein persisches Heer taugt nämlich in der Nacht nichts. Denn ihre Pferde sind angebunden und meistens an den Füßen gefesselt, damit sie, falls sie losgebunden würden, nicht fliehen. Bei einem Überfall muß der Perser seinem Pferd erst die Decke auflegen und es aufzäumen, muß sich auch selber erst panzern, bevor er das Pferd besteigt. Das alles ist nachts schwierig, zumal bei einem Überfall …
Ptolemaios nickte. »Und du glaubst, das entspricht der Wahrheit?«
»Warum nicht? Jedes Heer hat seine Gewohnheiten, und die legt es nicht so leicht ab.«
»Was spukt dir im Kopf herum?«
»Unsere Kundschafter haben mir berichtet, daß die Perser von Zelea aus nach Westen ziehen, sprich: uns entgegenkommen. Sie wollen uns also den Weg versperren.«
»Das ist anzunehmen.«
»Allerdings … Wenn du ihr Anführer wärst, Ptolemaios: Welchen Ort würdest du auswählen, um unseren Vormarsch aufzuhalten?«
Ptolemaios trat an den Tisch, auf dem eine Landkarte von Anatolien ausgebreitet war, nahm eine Öllampe und fuhr damit mehrmals über das Gebiet zwischen Küste und Landesinnerem. Irgendwann hielt er inne: »Vielleicht den Fluß da … Wie heißt er?«
»Granikos«, erwiderte Alexander. »Ja, die Perser werden aller Wahrscheinlichkeit nach dort auf uns warten.«
»Und du hast vor, dieses Bächlein bei Nacht und Nebel zu überqueren und sie am andern Ufer noch vor Sonnenaufgang aus dem Bett zu holen. Richtig geraten?«
Alexander hatte den Kopf schon wieder über Xenophons »Zug der Zehntausend« gebeugt. »Glaub mir, diese ›Anabasis‹ ist ein höchst aufschlußreiches Werk. Du solltest dir unbedingt eine Kopie davon besorgen.«
Ptolemaios schüttelte den Kopf.
»Stimmt etwas nicht?«
»Doch, doch, der Plan ist ausgezeichnet. Nur daß …«
»Was?«
»Na ja, ich weiß nicht … Ich meine, nachdem du Achills Grabhügel umrundet und seine Rüstung und Waffen aus dem Tempel von Ilion geholt hast, da hätte ich mir eigentlich eine Schlacht auf offenem Feld erwartet, Front gegen Front, bei hellichtem Tag, eine … eine richtig homerische Schlacht, um es einmal so zu sagen.«
»Das kommt schon noch«, erwiderte Alexander. »Was glaubst du, warum ich Kallisthenes mitgenommen habe? Aber im Moment will ich keinen einzigen Mann unnötig riskieren. Und dasselbe müßt ihr auch tun.«
»Keine Sorge.«
Ptolemaios setzte sich und betrachte seinen König, wie er in der Papyrusrolle las und sich dabei unablässig Notizen machte.
»Dieser Memnon aus Rhodos ist ein harter Knochen«, sagte er nach einer Weile.
»Ich weiß. Parmenion hat mir von ihm erzählt.«
»Und die persische Kavallerie?«
»Wir haben längere Lanzen mit stabileren Schäften.«
»Hoffentlich reichen die aus.«
»Den Rest besorgt die Überrumpelung und unser Siegeswille«, sagte Alexander. »Wir müssen sie schlagen, Ptolemaios, koste es, was es wolle! Und jetzt geh ins Bett, wenn du einen guten Rat willst. Wir brechen früh auf und werden den ganzen Tag marschieren.«
»Du willst morgen abend in Stellung sein, stimmt’s?«
»Ja. Unser nächster Kriegsrat findet am Ufer des Granikos statt.«
»Und du legst dich nicht schlafen?«
»Ich hab noch genügend Zeit zum Schlafen … Die Götter mögen dir eine ruhige Nacht bescheren, Ptolemaios.«
»Dir auch, Alexander.«
Ptolemaios ging in sein Zelt, das er auf einer kleinen Anhöhe im östlichen Teil des Lagers hatte aufschlagen lassen, zog sich aus, wusch sich und bereitete alles für den nächsten Morgen vor. Bevor er sich schlafen legte, warf er einen letzten Blick hinaus und sah, daß nur in zwei Zelten noch Licht brannte: in dem Alexanders und in dem Parmenions, das sich am anderen Ende des Lagers befand.
Die Trompeten weckten die Soldaten laut Alexanders Anordnung vor Sonnenaufgang, aber die Köche waren schon länger auf den Beinen und hatten bereits das Frühstück zubereitet; in großen Kesseln dampfte ein halbflüssiger Gerstenbrei, Maza genannt, der mit Käse versetzt war. Die Offiziere dagegen bekamen Kornfladen, Schafskäse und Kuhmilch serviert.
Beim zweiten Trompetenstoß schwang sich der König aufs Pferd und bezog beim Osttor des Lagers seinen Posten an der Spitze des Heers, umringt von seiner Leibwache nebst Perdikkas, Krateros und Lysimachos. Hinter ihm setzten sich die Phalanxbataillone der Pezetairoi in Marsch, gefolgt von der schweren griechischen Infanterie und von den Hilfstruppen der Thraker, Triballer und Agrianer. Zwei Reihen schwerbewaffneter Reiter eskortierten den langen Zug, während mehrere kleine Reitertrupps, die nur leicht bewaffnet waren, vorausritten.
Der Himmel begann sich im Osten rot zu färben, und die Luft war erfüllt vom Pfeifen der Spatzen und vom Gezwitscher der Amseln. Aus den umliegenden Wäldern flogen immer wieder riesige Schwärme von Wildtauben auf, die das laute Stampfen der marschierenden Füße und das Waffenklirren aufgescheucht hatten.
Vor Alexanders Augen breitete sich Phrygien mit seinen tannenbedeckten Hügeln und seinen unzähligen kleinen Tälern aus, deren kristallklare Bäche von silbern flimmernden Pappeln und Trauerweiden gesäumt wurden. Viehhirten und Schäfer mit Hunden führten ihre Herden auf die Weiden, und alles wirkte ruhig und friedlich, obwohl das Blöken der Lämmer und das Muhen der Kälber natürlich völlig im Tosen der vorüberziehenden Armee unterging.
In den Tälern, die auf beiden Seiten parallel zur Marschroute verliefen, ritten kleine Spähtrupps, die weder mit Rüstungen noch mit sonstigen Insignien ausgestattet waren und die Aufgabe hatten, persische Beobachter fernzuhalten. Aber im Grunde war diese Vorsichtsmaßnahme kropfunnötig, denn jeder Hirte oder Bauer hätte ein feindlicher Spitzel sein können.
Den Abschluß der langen Kolonne bildete ein halbes Dutzend thessalischer Reiter, die Kallisthenes, Philotas sowie einen Maulesel mit zwei Quersäcken voller Papyrusrollen eskortierten. Wenn gerastet wurde, holte sich der Geschichtsschreiber aus dem Gepäck des Maultiers ein Holztäfelchen und eine Rolle Papyrus, setzte sich auf einen Hocker und begann unter den neugierigen Blicken der Soldaten zu schreiben.
Es hatte sich schnell herumgesprochen, daß der hagere, etwas altklug wirkende junge Mann die Geschichte dieser Expedition aufschrieb, und insgeheim hoffte jeder, früher oder später von ihm verewigt zu werden. Nicht das mindeste Interesse erweckten hingegen die trockenen Berichte von Eumenes und anderen Offizieren, die im Auftrag Alexanders Tagebuch führten und die genaue Abfolge der Etappen festhielten.
Gegen Mittag wurde eine längere Rast eingelegt, und dann marschierte man ohne Unterbrechung bis in unmittelbare Nähe des Granikos weiter. Dort ließ Alexander im Schutz einer niederen Hügelkette das Nachtlager aufschlagen. Kurz vor Sonnenuntergang berief er in seinem Zelt den Kriegsrat ein, um den Versammelten seinen Schlachtplan auseinanderzulegen. Anwesend waren Krateros, der eine Abteilung der schweren Kavallerie befehligte, Kleitos der »Schwarze«, Parmenion als Anführer der Pezetairoi und selbstverständlich Alexanders persönliche Leibwache, zu der alle seine Kameraden gehörten: Ptolemaios, Lysimachos, Seleukos, Hephaistion, Leonnatos, Perdikkas, ja selbst Eumenes, der offensichtlich Gefallen an seiner Rüstung gefunden hatte, denn er erschien zu den Versammlungen nur noch in voller Montur, sprich mit Harnisch, Beinschienen und Wehrgehänge.
»Sobald es dunkel ist«, begann der König, »wird eine kleine Sturmtruppe den Fluß überqueren und sich dem persischen Lager so weit wie möglich nähern, um es auszuspähen; diese Truppe soll sich aus leichten Fußsoldaten und Männern der Hilfstruppen zusammensetzen. Einer von ihnen kehrt sofort um und meldet uns, wie weit das Lager vom Fluß entfernt ist. Die andern bleiben auf ihrem Posten. Sollte sich im Laufe der Nacht bei den Persern etwas rühren, teilen sie uns das natürlich umgehend mit.« Die Versammelten nickten mit dem Kopf. »Wir selbst zünden heute nacht keine Feuer an, und morgen früh wird ohne Trompeten geweckt, und zwar kurz vor der vierten Wachablösung. Wenn wir freie Bahn haben, überquert die Kavallerie als erste den Fluß und stellt sich am andern Ufer auf; sobald das Fußvolk auch drüben ist, setzt sich alles in Bewegung. Dann kommt der entscheidende Moment des Tages«, sagte Alexander mit einem Blick in die Runde. »Wenn ich richtig vermute, befinden sich die Perser um diese Tageszeit noch in ihren Zelten – zumindest sind sie nicht in Schlachtordnung aufgestellt. Unsere Reiterei fällt in einem Blitzangriff über sie her und sät Verwirrung. Dann rückt das Fußvolk nach und versetzt ihnen den eigentlichen Hammerschlag. Die Sturmabteilungen und Hilfstruppen erledigen den Rest.«
»Wer führt die Kavallerie an?« fragte Parmenion, der bis zu diesem Augenblick schweigend zugehört hatte.
»Ich«, erwiderte Alexander.
»Davon rate ich ab, Herr. Das ist zu gefährlich. Überlaß das doch Krateros – er hat Erfahrung mit den Persern, er war ja schon bei unserer letzten Asienexpedition dabei.«
»General Parmenion hat recht«, meinte Seleukos. »Das ist unsere erste Begegnung mit den Persern; besser, wir riskieren nicht zuviel.«
Der König unterbrach die Diskussion mit einer knappen Geste. »Ihr habt mich in Chaironeia gegen die Heilige Schar der Thebaner und am Ister gegen Thraker und Triballer kämpfen sehen: Wie könnt ihr glauben, daß ich es diesmal anders machen würde? Nein, ich werde die Königsschwadron persönlich anführen und als erster Makedone mit dem Feind in Tuchfühlung gehen. Meine Männer sollen wissen, daß ich mich denselben Gefahren aussetze wie sie und daß wir in dieser Schlacht alles aufs Spiel setzen – auch unser Leben. Mehr habe ich euch für den Moment nicht zu sagen. Ich erwarte euch zum Abendessen.«
Keiner hatte den Mut, ihm zu widersprechen, aber Eumenes beugte sich zu Parmenion hinüber, der neben ihm saß, und flüsterte: »Ich würde ihm jemanden mit viel Erfahrung zur Seite stellen, einen, der nicht zum erstenmal gegen die Perser kämpft und ihre Technik kennt.«
Der General nickte. »Daran habe ich bereits gedacht. Kleitos wird morgen neben ihm kämpfen und ihn beschützen«, sagte er. »Keine Angst, Eumenes, es geht schon alles gut.«
Nachdem die Versammlung aufgelöst war, verließen alle das Zelt und begaben sich zu ihren Truppeneinheiten, um die letzten Anweisungen zu geben. Nur Eumenes blieb zurück und näherte sich Alexander: »Dein Plan ist ausgezeichnet«, sagte er. »Aber es gibt da eine unbekannte Größe, die mir ernste Sorgen macht …«
»Memnons Söldner.«
»Genau. Wenn die zu einem geschlossenen Block zusammenrücken, wird es selbst für unsere Reiter schwer, gegen sie anzukommen.«
»Ich weiß, und unsere Phalanx hätte es nicht viel leichter – unter Umständen müßte sie sich sogar auf einen Kampf mit kurzen Waffen, also Schwert und Streitaxt, einlassen. Das wäre sehr gefährlich, aber ich habe da noch was im Hinterkopf …«
Eumenes setzte sich auf einen Hocker und zog sich den Umhang über die Knie, genau wie Philipp es nach seinen berüchtigten Wutanfällen immer getan hatte. Bei Eumenes war der Grund allerdings ein anderer: Er hatte sich noch nicht an den kurzen Militärchiton gewöhnt, und in frischen Nächten wie dieser fror er an den Beinen.
Der König holte eine Papyrusrolle aus der berühmten Schatulle, in der sich auch die Homerausgabe befand, die Aristoteles ihm geschenkt hatte, und breitete sie auf dem Tisch aus. »Du kennst doch den ›Zug der Zehntausend‹, nicht?«
»Klar – der wird inzwischen ja an allen Schulen gelesen, weil er so leicht verständlich geschrieben ist.«
»Gut, dann hör zu. Wir befinden uns auf dem Schlachtfeld von Kunaxa; der jüngere Kyros unterhält sich mit dem Heerführer Klearchos:
Er rief Klearchos zu, er solle sein Regiment gegen das Zentrum der Feinde führen, weil sich dort der Großkönig befinde. ›Und wenn wir dort siegen‹, sagte er, ›haben wir alles erreichte.‹«
»Mit anderen Worten: Du willst den Anführer unserer Feinde mit eigenen Händen umbringen«, stellte Eumenes mißbilligend fest.
»Ja, und deshalb führe ich die Königsschwadron an. Danach kümmern wir uns um Memnons Söldner.«
»Verstanden, und jetzt gehe ich lieber, denn auf meine Ratschläge würdest du ja sowieso nicht hören.«
»Nein, Herr Generalsekretär«, Alexander lachte. »Aber gern habe ich dich trotzdem.«
»Ich dich auch, verdammter Dickschädel. Die Götter mögen dich beschützen.«
»Das wünsche ich dir auch, mein Freund.«
Eumenes ging in sein Zelt, legte die Rüstung ab, zog sich etwas Wärmeres an und vertiefte sich bis zum Abendessen in ein Handbuch über Kriegstaktik.
5
Der Fluss, der aufgrund der Schneeschmelze im Pontischen Gebirge sehr viel Wasser mitführte, floß schnell dahin; ein sanfter Westwind bewegte die Blätter der Pappeln entlang seiner Ufer; es waren steile Ufer aus Tonerde, die sich während der starken Regenfälle der letzten Wochen mit Wasser vollgesogen hatten.
Alexander, Hephaistion, Seleukos und Perdikkas standen auf einer kleinen Anhöhe, von der aus man sowohl den Lauf des Granikos überblicken konnte als auch ein gutes Stück des Gebiets am jenseitigen Ostufer.
»Was meint ihr?« fragte der König.
»Die Böschungen sind aufgeweicht und schlüpfrig«, sagte Seleukos. »Wenn sich die Barbaren dort drüben aufstellen, können sie nach Belieben Pfeile und Speere auf uns abschießen.«
»Sprich: unsere Truppen dezimieren, bevor sie überhaupt am andern Ufer sind«, setzte Hephaistion nach.





























