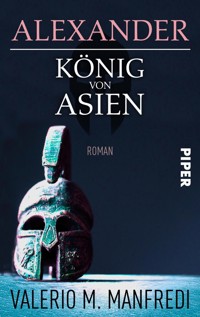6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein klassischer Mysterythriller von Italiens Bestseller-Autor Valerio Manfredi Bei Ausgrabungsarbeiten in der Nähe von Rom werden sieben Statuen gefunden, darunter vermutlich auch das mythenumwobene hölzerne Standbild der Athene. Dem Archäologen Fabio gelingt es, die rätselhaften Indizien zu entschlüsseln, die über die Jahrhunderte hinweg von der Antike bis in die heutige Zeit zum Abbild der Göttin führen. Doch auch ein Kreis von machtbesessenen Intriganten, besser bekannt als die »Institution«, interessiert sich für das legendäre Palladion, denn es verleiht demjenigen, in dessen Hände es fällt, ungeahnte Kräfte. Um an das Standbild zu kommen, sind sie allerdings auf Fabios Wissen angewiesen. Es entspinnt sich ein erbitterter Kampf …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Italienischen von Peter Klöss
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018© 1985 Valerio M. ManfrediTitel der italienischen Originalausgabe: »Palladion«© Arnoldo Mondadori Editore S,p.A., Mailand 1985This edition published in arrangement with Grandi & Associati© der deutschsprachigen Ausgabe: 2004 Piper Verlag GmbH, MünchenDeutsche Erstausgabe: Heyne Verlag, München 2000
Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
VORGESCHICHTE
ERSTER TEIL
Alabanda, Kleinasien, im Jahre 574 nach der Gr?ndung Roms, zur neunten Stunde der Kalenden des Monats Sextilis
ZWEITER TEIL
Grottaferrata, Kloster San Nilo, im Jahr unseres Herrn 1071, um die siebte Stunde des 4. Februar
Dritter Teil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vierter Teil
Zwei Jahre sp?ter
EPILOG
We are not impotent – we pallid stones.
Not all of our power is gone …
Wir sind so machtlos nicht, wir bleichen Steine! Nicht ganz ging unsere Macht dahin …
E. A. Poe
Für Christine
Das Palladion, das heiligste Abbild der Göttin Athene, kam vom Himmel, und König Laomedon stellte es auf dem Burgfelsen von Troja auf. Von dort stahl es Odysseus und schenkte es Kirke, der Zauberin. Telegonos, der Sohn des Helden und der Kirke, überließ es dann dem Latinus, der in der Stadt Lavinium einen Tempel für das Standbild errichtete. Andere dagegen behaupten, Äneas habe es den Griechen wieder abgenommen und auf seiner Flucht aus Troja mit nach Italien gebracht. Das Palladion vermag die Augen zu schließen und die Lanze zu bewegen, und daran erkennt man es, denn viele Städte rühmen sich, das echte Standbild zu besitzen.
Servius
VORGESCHICHTE
Der Mann war noch jung, kaum dreißig Jahre alt, er war groß und stämmig und hatte markante, einprägsame Gesichtszüge. Gewiß ein Fremder, denn in dieser Gegend hatte man ihn noch nie gesehen. Eine Zeitlang lief er am Flußufer auf und ab, und manchmal blieb er stehen und starrte auf den Strom. Mehrmals hatte er sich schon dem Tor der Werkstatt genähert, als ob er eintreten wollte. Doch dann war er wieder fortgegangen. Als es Zeit wurde, die Werkstatt zu schließen, legte der Steinmetz Hammer und Meißel aus der Hand und schickte sich zum Gehen an.
Plötzlich stand der junge Mann vor ihm.
Er hatte eine dunkle Hautfarbe und große, ausdrucksvolle Augen. Die schräg einfallenden Strahlen der Abendsonne betonten die Gesichtszüge und die nackten Arme.
»Bist du der Besitzer dieser Werkstatt?« fragte er.
»Ja, was gibt’s?«
»Ich habe einen Auftrag für dich.«
»Wie du siehst, schließe ich gerade. Du bist doch schon länger hier, konntest du dich nicht früher entschließen hereinzuschauen?«
Der junge Mann antwortete nicht.
»Kannst du nicht morgen wiederkommen?«
»Nein, morgen muß ich fort … ich reise ab. Und ich werde sehr lange fortbleiben.«
»Wenn das so ist .« Der Steinmetz machte kehrt und schloß die Tür zur Werkstatt wieder auf.
»Also, was soll ich für dich anfertigen?«
»Eine Steinplatte mit einer Grabinschrift.«
»In den nächsten Tagen habe ich sehr viel zu tun.«
»Es eilt nicht.«
»Dann läßt es sich machen. Suche dir das Material aus und laß mir Text und Maße für die Platte da.«
Der junge Mann wählte weißen Marmor aus Luni, dann nahm er ein Stück Kreide und schrieb etwas auf die Arbeitsplatte der Werkbank.
»Hier«, sagte er, »dies ist der Text.«
Der Steinmetz glaubte, in der Stimme des anderen ein leichtes Zittern gehört zu haben. Er warf einen Blick auf den Text, dann sah er dem jungen Mann in die Augen. Sie strahlten hell und reglos, und eine unendliche Melancholie lag darin.
»Dein Sohn?«
Der Jüngling schüttelte den Kopf. Einen Augenblick lang trübte sich sein Blick.
»Mein Sohn? Nein«, sagte er. »Ich … ich bin der Sohn.«
Der Steinmetz fragte nicht nach. Er war es gewöhnt, mit Leuten zu sprechen, die vor Schmerz wirres Zeug daherredeten.
»Wieviel bin ich schuldig?« fragte der junge Mann.
»Das hat keine Eile, du kannst bezahlen, wenn du die Tafel abholst.«
Doch der junge Mann bestand darauf. Er müsse wegen eines Auftrags in ein fremdes Land und wisse nicht genau, wann er zurücckäme. Der Steinmetz nahm das Geld.
»In acht, neun Tagen ist der Grabstein fertig«, sagte er.
»Zu gegebener Zeit wird jemand vorbeikommen und ihn abholen. Leb wohl.«
Der Fremde wandte sich zum Gehen und überquerte mit entschiedenem Schritt den Hof. Der Steinmetz schloß seine Werkstatt und das Tor ab und machte sich auf den Heimweg. Bevor er um die Ecke bog, drehte er sich noch einmal um.
Der andere stand noch immer am Flußufer, reglos wie ein Stein. Die Abendbrise zerzauste sein Haar und preßte den leichten Stoff seiner Kleider gegen die muskulösen Schultern.
Er blickte auf das Flußwasser, das unter ihm dahinströmte.
ERSTER TEIL
Moriar stando, contempturus animam quam mihi febricula eripiet una.
Aufrecht werde ich sterben, voller Verachtung für das Leben, das ein nichtiges Fieber mir entreißen kann.
Flavius Constantius Julianus Römischer Kaiser
Alabanda, Kleinasien, im Jahre 574 nach der Gründung Roms, zur neunten Stunde der Kalenden des Monats Sextilis
Zenturio Publius Afranius hatte sich im Schutz der Stadtmauer unter einen Feigenbaum gelegt, um ein Schläfchen zu halten, als einer seiner Männer atemlos vom Lager her gerannt kam und ihn aufschreckte: »Zenturio! Ein Reiter ist angekommen, der dich unverzüglich sprechen will. Er sagt, er sei ein Bote des Senats.«
»Was? Ein Bote des Senats? Wo?«
»Unten, in der Wachstube, anscheinend ist es sehr eilig.«
Der Zenturio sprang auf, griff nach dem Helm, der an einem Ast des Feigenbaums hing, setzte ihn schwungvoll auf und folgte dem Legionär so rasch es ging. Als er vor der Wachstube ankam, hielt er einen Augenblick lang inne, um seine Kleidung in Ordnung zu bringen. Dann warf er einen raschen Blick auf das verschwitzte, von Fliegen bedeckte Pferd und trat ein.
Durch die Tür fiel ein Lichtstrahl auf einen jungen Offizier der Reiterei. Seine Augen waren gerötet, Haar und Bart staubbedeckt. Auf dem ledernen Brustpanzer funkelten die Rangabzeichen eines Militärtribuns. Publius Afranius stand stramm und grüßte: »Ave, ich bin der Garnisonskommandant, Zenturio Publius Afranius, fünfte Kohorte, sechste Legion, ich stehe dir zu Diensten.«
»Ich habe eine dringende Botschaft des Senats an den Konsul«, erwiderte der Offizier knapp. »Wo hält er sich auf?«
»Ich weiß es nicht, man hat mich darüber nicht unterrichtet, aber wir haben Befehl erhalten, den jüngst eingetroffenen Nachschub nach Termessos zu schicken. Dort wird man dir sagen können, wo genau der Konsul und das Heer sich aufhalten. Hier bist du jedenfalls falsch, und ich frage mich, welcher Dummkopf dich zu uns geschickt hat. Du hättest der Straße folgen müssen, die nach Tabai und weiter nach Kibyra führt.«
»Das hätte zu lange gedauert«, entgegnete der Offizier. »Mir wurde nämlich gesagt, daß es hier in der Nähe eine Brücke über den Fluß Harpasos gibt und ich durch diese Abkürzung einen Tag früher in Tabai ankomme.«
»Schon«, antwortete der Zenturio kopfschüttelnd, »aber dann mußt du durch ein Gebiet, das von pisidischen Räubern und Galaterbanden heimgesucht wird, die aufgrund einer Hungersnot noch grausamer sind als sonst. Das war wirklich ein guter Rat! Wäre es nicht besser gewesen, du hättest dich eingeschifft und wärest über das Meer direkt nach Aspendos gefahren?«
Der Tribun zeigte einen Anflug von Ärger: »In den kilikischen Gewässern gibt es mehr Piraten als Fische, aber davon einmal abgesehen – natürlich hätte ich mich von einem Kriegsschiff dorthin bringen lassen, wenn ich gewußt hätte, daß der Konsul so weit vorgedrungen ist. Warum hat er das Operationsgebiet verlassen, das ihm vom Senat zugewiesen war?«
»Da fragst du mich zuviel«, antwortete der Zenturio, »ich habe Befehl von meinen Vorgesetzten, dieses verfluchte Loch zu halten, wo es nichts gibt außer Ziegen und Bremsen. Doch weil du schon einmal hier bist und den Konsul einholen mußt, werde ich dir eine Eskorte mitgeben, die dich bis zur Brücke geleitet. Dort triffst du wieder auf die Hauptstraße, die von uns kontrolliert wird.«
»Einverstanden, die Männer sollen sich fertigmachen. Gib mir ein frisches Pferd und Lebensmittel für zwei Tage, ich breche unverzüglich auf.«
Der Zenturio sah ihn erstaunt an. »Unverzüglich? Verzeih, aber das ist ein leichtsinniger Entschluß. Bevor ihr die Brücke erreicht hättet, würde euch die Dunkelheit überraschen und ihr müßtet die Nacht in gefährlichem Gebiet verbringen. Du solltest lieber ein Bad nehmen, essen, dich ausruhen und dann morgen früh bei Sonnenaufgang aufbrechen. Es war schon sehr unvorsichtig, daß du dich hierher ohne Eskorte vorgewagt hast.«
»Ich hatte eine Eskorte, zwei griechische Offiziere aus dem Heer von König Eumenes von Pergamon, doch das Pferd des einen wurde lahm, und der andere konnte nicht mit mir Schritt halten.«
»Die Griechen haben zu weiche Hintern«, grinste der Zenturio, »mit meinen Leuten wird es dir besser ergehen. Also, willst du es dir nicht noch einmal überlegen?«
»Mein Entschluß steht fest, Zenturio. Tu, wie ich dir gesagt habe, und während du die Eskorte zusammenstellst, werde ich gerne einen Bissen nehmen … und ein Bad.«
»Der Brunnen ist draußen im Hof. Was das Essen betrifft, so gibt es Brot, Käse und hartgekochte Eier. Wein ist keiner da, der ist zu Essig geworden.«
»Das genügt vollkommen, Zenturio, aber es muß rasch gehen.«
Kurz darauf stand ein kleiner Trupp Reiter im Hof des Wachkorps bereit. Der Tribun nahm noch rasch eine Mahlzeit ein und ließ währendessen den nackten Oberkörper von der Sonne trocknen.
Sobald der Offizier den letzten Bissen verschlungen und sich wieder angekleidet hatte, sprang er auf sein Pferd und gab das Signal zum Aufbruch.
»Einen Augenblick!« rief der Zenturio, der mit einer Wachstafel in der Hand herbeigelaufen kam, »die Quittung!«
Der Tribun drückte seinen Siegelring hinein, dann gab er dem gedrungenen Fuchs, den er gegen sein erschöpftes Pferd eingetauscht hatte, die Sporen.
In der Mitte des Hofes nahm Publius Afranius einen Moment lang Habtachtstellung ein. Gleichzeitig versuchte er, das Siegel auf der Wachstafel zu entziffern, und stellte fest, daß er das Pferd sowie acht Maß Getreide, drei Maß Mehl, zwei Maß Dörrfleisch und sechs Reiter der sechsten Schwadron einem gewissen Lucius Fonteius Hemina mitgegeben hatte, dem Sohn des Caius, Tribun der dritten Legion.
Der Zenturio nahm den Helm ab und kehrte unter seinen Feigenbaum zurück, doch inzwischen war jede Müdigkeit von ihm abgefallen.
Nachdem sie die Stadtmauer von Alabanda umritten hatte, schlug die Reiterschar den Weg ein, der in östlicher Richtung auf die Hügel zuführte. Zum Schutz vor der dichten Staubwolke, die von den Pferden aufgewirbelt wurde, banden sich die Männer ihre Tücher vor den Mund.
Je weiter sie vordrangen, desto rauher wurde die Landschaft ringsum, und die Strahlen der langsam auf das Meer herabsinkenden Sonne hoben die scharfen Kanten der Felsen hervor, die hier und da aus dem buckligen Gelände herausragten. Vor sich in der Ferne konnte der Tribun die violetten und purpurnen Gebirgszüge Lykiens erkennen. Als der Weg durch eine Schlucht führte, schwärmten die Männer der Eskorte aus und trieben ihre Tiere die Hänge hinauf, um den Abgesandten des Senats und Volkes von Rom gegen einen möglichen Hinterhalt zu schützen, zu dem der wilde Landstrich reichlich Gelegenheit bot.
Als er einen ausreichend hohen Hügelkamm erreicht hatte, zügelte Lucius Fonteius sein Pferd. Er rief den Eskortenführer zu sich, um ihren Standort zu bestimmen und das Gelände in Augenschein zu nehmen. Die Türme von Alabanda waren schon seit geraumer Zeit im Westen verschwunden, und die riesige Sonnenscheibe schien sich auf der welligen Weite der mysischen Landschaft schlafen zu legen. Für einen Augenblick vertrieb ein Windstoß den strengen Geruch der schweißglänzenden, geifernden Pferde.
Der Tribun deutete auf eine feine Staubwolke, die in großer Ferne über die Hochebene dahinzog und ab und zu von den Strahlen der erlöschenden Sonne entzündet wurde: »Räuber?« fragte er den Eskortenführer mit sorgenvollem Blick.
»Das glaube ich nicht, dafür bewegt sie sich zu langsam. Ich schätze, es handelt sich um eine Nomadenkarawane oder eine Viehherde, die von der Weide zurücckehrt.«
»Wo befinden wir uns jetzt, deiner Meinung nach?«
»Von hier aus läßt sich das schwer sagen, aber wenn wir diesen Kamm dort erreichen, bevor die Sonne am Horizont versinkt, werden wir es vielleicht erfahren. Siehst du den Felsspalt dort? Durch diesen Spalt fallen die letzten Sonnenstrahlen und bringen die Wasser des Harpasos zum Glitzern, so daß man den Fluß auch noch aus großer Entfernung sieht, obwohl die Landschaft ringsum schon in Dunkel getaucht ist.«
»Dann also rasch, laß uns keine Zeit verlieren.« Sie preschten den Hang hinunter, ritten durch ein kleines Tal und erklommen die nächste Steigung bis zum Kamm, wo ein tiefer Einschnitt im Fels noch Sonnenstrahlen hindurchließ. Sobald sie oben angelangt waren, gab der Eskortenführer dem Tribun Zeichen und deutete auf einen fernen Punkt am Horizont, wo noch für kurze Zeit ein silbernes Band schimmerte wie die schuppige Haut einer Schlange, die sich bei Einbruch der Nacht in ihr Versteck verkriecht.
»Das ist der Harpasos«, sagte der Eskortenführer, »das bedeutet, daß es noch ungefähr fünfundzwanzig Meilen bis zur Brücke sind. Wenn wir hier oben eine Wache zurücklassen, könnten wir das Lager unten in dem Tal aufschlagen, das wir eben durchquert haben, und morgen früh vor Sonnenaufgang wieder aufbrechen.«
Gankenverloren streichelte der Tribun seinem Pferd den Hals. »Ich habe eine bessere Idee«, sagte er dann, »wir ruhen uns bis gegen Mitternacht aus, dann ziehen wir weiter. Diese Nacht ist Vollmond, der Himmel ist klar, so daß wir dem Pfad ohne Schwierigkeiten folgen können.«
»Aber Tribun«, wandte der Eskortenführer ein, »die Pferde sind am Ende ihrer Kräfte, und auch die Männer sind müde.«
»Euer Zenturio meint, die Griechen hätten einen weichen Hintern, aber wie ich sehe, verhält es sich bei euch nicht viel anders«, grinste der Offizier. »Ich muß unbedingt zum Konsul, und deshalb werde ich um Mitternacht wieder im Sattel sitzen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt.«
»Wie du willst«, antwortete der Eskortenführer, während er still in sich hinein fluchte, »du führst das Kommando.« Er riß sein Pferd herum und ritt zu seinen Leuten im Tal.
Am nächsten Morgen, als es schon hellichter Tag war, kam der Trupp in Sichtweite der Brücke über den Harpasos, die kaum mehr war als ein Holzsteg, der von einer Handvoll Legionäre bewacht wurde. Der Tribun drehte sich um und verabschiedete sich von seinen Reisegefährten: »Lebt wohl, Freunde, und … danke für eure Gesellschaft!« Mit einem bitteren Lächeln hob der Eskortenführer die Hand. Möge dich die Unterwelt verschlucken, dachte er bei sich, um ein Haar wären wir draufgegangen . uns mitten in der Nacht wie die Verrückten über diesen Ziegenpfad zu hetzen! Statt dessen sagte er laut: »Ich danke dir für den Spazierritt, Tribun. Gute Reise!«
Lucius Fonteius ritt zu dem Wachposten auf der anderen Seite der Brücke, wechselte das Pferd und machte sich auf den Weg nach Tabai. In der folgenden Nacht kam Kibyra in Sicht, das wenig mehr war als ein großes Dorf mit einem Wall aus rohem Gipsgestein. Ein schwüler Wind wirbelte Staubhosen von der Hochebene auf und trieb trockenes Gebüsch von ausgedörrten Hügeln durch die dunklen Gassen.
Den Mund mit dem Umhang bedeckend, ritt Lucius Fonteius im Schritt durch die Ortschaft. Schließlich gelangte er zur römischen Garnison, dem einzigen Gebäude, das vom Licht einer Laterne erleuchtet war. Er verbrachte eine unruhige Nacht auf einem übelriechenden Strohsack. Immer noch schmutzig und verschwitzt, da er sich nicht hatte waschen können, brach er bei Morgengrauen auf. Er durchquerte unwirtliche, hügelige Gegenden und hielt ab und zu an, um die Landkarte zu studieren, die ihm die griechischen Offiziere aus Smyrna mitgegeben hatten. Dann und wann sah er auf den glühenden Felswänden längs der Straße riesige, in Stein gehauene Figuren, Bildnisse alter Könige und Krieger, die unter der Glut der Sonne zerbröckelten.
An einem verlassenen Ort mitten auf der Hochebene machte er Rast und kauerte sich zwischen die Wurzeln einer einsam dastehenden Kiefer. Mit dem grünlichen Wasser aus einer spärlichen Quelle tränkte er das Pferd, er selbst trank lieber das warme Wasser aus seiner Flasche.
Im Osten zeichneten sich nun die schneebedeckten Gipfel des Taurus-Gebirges ab, und im Westen, am Horizont, der von dichtem Dunst verschleiert wurde, versank die Sonne blutrot. Als sie die scharfkantigen Bergspitzen berührte, schien es ihm fast, als würde die gigantische Kugel zerbersten und die Welt mit ihrer zinnoberroten Glut überschwemmen. Doch vielleicht wurde sein Geist auch nur in der Stunde, bevor der Schlaf kam, von einer feindlichen Gottheit aus diesen trostlosen Landen gepeinigt. Vollkommen erschöpft gelangte er in der folgenden Nacht vor die Tore von Termessos. Die Stadt, die sich die Hänge eines bewaldeten Tals hinaufzog, schimmerte weiß im Mondlicht. Die Wachsoldaten führten ihn auf den von Arkaden eingefaßten Hauptplatz, der von einem gewaltigen Tempel beherrscht wurde.
Die dunkelblau bemalten und mit purem Gold verzierten Säulen stützten ein imposantes Giebelfeld, in dem sich eine Vielzahl in Stein gehauener Götter und kraftvoller Helden tummelte; die Falten werfenden Gewänder der Figuren wurden vom Widerschein zweier Kohlenbecken, die auf Dreifüßen auf der Zugangstreppe glommen, leuchtendrot gefärbt. Im Gästehaus des Tempels ruhte der Legat der sechsten Legion, der hiesige Festungskommandant.
Lucius Fonteius ließ ihn aus dem Bett holen.
Der Legat genoß in jener Nacht die Gesellschaft der schönsten und erfahrensten Hetäre der Stadt, einer Frau, um deren Gunst die mächtigsten Männer Asiens buhlten und von der es hieß, sie habe einem berühmten Bildhauer der Stadt als Aphrodite Modell gestanden.
Nachdem der Legat sich aus den kundigen Armen gelöst hatte, ging er ins Atrium hinunter und stieß dabei sämtliche Verwünschungen aus, die er im Lauf eines langen Lagerlebens gelernt hatte. Dann stand er einem Mann gegenüber, der, schwankend und mit fiebrigem Blick, die Hand zum Gruß hob: »Ave, Legat, ich bin Lucius Fonteius Hemina, Tribun der dritten Legion. Auf Befehl des Senats muß ich unverzüglich zum Konsul. Wo hält er sich auf?«
Der Legat grinste: »Tribun, du hältst dich ja kaum noch auf den Beinen, es geht dir nicht gut. Ich lasse dir ein Bad und ein Bett bereiten, und unsere Unterhaltung setzen wir dann morgen fort.«
Aus einem Futteral, das er um den Hals trug, zog Lucius Fonteius eine Papyrusrolle und reichte sie dem Offizier. »Dieses Dekret«, sagte er, »gibt mir die Befugnis, dir, auch wenn du einen höheren Rang bekleidest, Befehle zu erteilen und dich abzusetzen, wenn du ihnen nicht Folge leistest. Zum letztenmal, wo ist der Konsul?«
Der Legat verstummte, nahm die Rolle und trat zum Lesen in den Schein einer Fackel, die einer seiner Legionäre in dem dunklen Atrium entzündet hatte.
»Also?« fragte der Tribun noch einmal.
»Gestern morgen war der Konsul auf der Straße nach Perge«, antwortete der Legat. »Falls er Syllion nicht schon erreicht hat, müßte er zur Stunde eigentlich nicht weit davon am Taurus-Fluß lagern, an der Straße, die zum Paß führt.«
Aschfahl im Gesicht sprang der Tribun auf. Er kramte in seinem Beutel, zog eine Landkarte hervor und breitete sie im Schein der Fackel aus.
»Hör mir gut zu, Legat«, sagte er, »ich muß wissen, ob auch nur die mindeste Aussicht besteht, den Konsul zu erreichen, bevor er Syllion erreicht.«
»Möglich wäre es«, erwiderte der Legat. »Der Konsul kann beschlossen haben, seinen Truppen in Perge eine Rast zu gönnen . oder er hat Scherereien mit den Pisiden gehabt . möglich auch, daß in diesem unebenen Gelände der Troß den Vormarsch der Fußtruppen aufgehalten hat . oder .« fuhr er, an den Fingern aufzählend, fort.
»Das genügt mir«, unterbrach ihn der Tribun, »ich werde mich jetzt eine Stunde ausruhen. Du sorgst unterdessen für ein frisches Pferd und bestimmst zwei Männer, die mich führen werden.« Der Legat nickte. »Und wenn dir etwas an deinem Rang liegt«, fügte Lucius Fonteius hinzu, »vergiß nicht, mich zu wecken.«
Dann folgte er dem Legionär, der ihn in sein Schlafgemach führte.
Der Legat verstand beim besten Willen weder die Eile noch den Grund, weshalb dieser Mann, der mit seinen Kräften fast am Ende war, sich mitten in der Nacht einen mörderischen Ritt zumutete. Es mußte etwas dahinterstecken. Deshalb wählte er seinen besten Kurier aus und trug ihm auf, den Konsul von dem seltsamen Besuch in Kenntnis zu setzen. Möglich, daß es sich um ein politisches Manöver handelte, ja, so mußte es sein, denn es drohten keine unmittelbaren Gefahren von außen, die ein dermaßen ungewöhnliches Vorgehen gerechtfertigt hätten. Doch weshalb gab man einem Militärtribun für die Übermittlung der Botschaft außerordentliche Vollmachten? Der Konsul würde ihm gewiß dankbar dafür sein, daß er ihn davon unterrichtete, und, wer weiß, vielleicht würde er sich daran erinnern, wenn sie eines Tages nach Rom zurückgekehrt waren. Und so kam es, daß, als Lucius Fonteius das Lager erreichte, das Feldherrenzelt hell erleuchtet war und Cnaeus Manlius Vulso, der Konsul, ihn höchstpersönlich auf der Schwelle erwartete, eingehüllt in den Feldherrenmantel und umgeben von zwölf Liktoren. Nachdem er vom Pferd gestiegen war, trat der Tribun auf den Konsul zu und hob die Hand zum Gruß: »Salve, Konsul«, sagte er, »ich bringe dir eine Botschaft des Senats.« Manlius Vulso musterte ihn von Kopf bis Fuß: »Eine reichlich wichtige Botschaft, muß ich wohl annehmen, wenn du dich so abgemüht hast, um sie mir zu überbringen.«
»So ist es«, antwortete der Tribun, »und glücklicherweise erreiche ich dich noch rechtzeitig.« Verwundert über den großen Aufwand mitten in der Nacht, ließ er den Blick nach rechts und links schweifen und fügte hinzu: »Es überrascht mich, dich zu dieser Stunde wach zu finden, hast du etwa wichtigen Besuch erwartet?«
»Den deinen«, entgegnete der Konsul trocken, während er ins Zelt trat und dem Tribun bedeutete, ihm zu folgen. Er bot ihm eine Sitzgelegenheit an und nahm selbst auf seinem kurulischen Stuhl Platz. »Ich höre, Tribun«, sagte er dann.
»Ich überbringe dir einen Befehl des Senats«, begann der Tribun etwas verlegen, »der dir gebietet, unter gar keinen Umständen den Taurus zu überschreiten, und ich danke den Göttern, daß ich gerade noch rechtzeitig eingetroffen bin, wenn ich nicht irre .«
»Du irrst nicht, in der Tat«, erwiderte der Konsul. »Der Taurus liegt genau vor uns, weniger als einen Tagesmarsch entfernt, jenseits des Flusses, der hinter unserem Lager vorbeifließt. Und um aufrichtig zu sein, hatte ich die feste Absicht, schon morgen den Fluß zu überqueren und vor Einbruch der Nacht in Syllion zu sein.«
Der Tribun zog den Papyrus mit dem Senatsbefehl hervor und reichte ihn dem Konsul. »Hier steht geschrieben, daß du dein Vorhaben nicht ausführen kannst«, sagte er ohne Umschweife. Und während Manlius Vulso das Schriftstück überflog, beobachtete Lucius Fonteius dessen Gesichtszüge. Der Konsul drehte den Kopf zum Eingang, als lausche er den Rufen der Wachen, die sich zum drittenmal in dieser Nacht ablösten, dann wandte er sich wieder seinem Gast zu: »Hier steht, daß ich mein Vorhaben nicht ausführen kann, aber es steht nicht da, warum. Seit wann wird ein mit allen Machtbefugnissen ausgestatteter Konsul über die Gründe eines Befehls im unklaren gelassen? Doch wohl nicht etwa, weil sich hinter der Majestät des Senats politische Gegner und Intriganten verbergen? Ich kenne sie zur Genüge und fürchte sie wie giftige Schlangen.«
Er rollte das Dokument wieder zusammen, und in der vollkommenen Stille, die das Lager umgab, war das Rascheln des Papyrus deutlich zu hören. Lucius Fonteius war so müde, daß er sich der Ohnmacht nahe fühlte, bei jedem Lidschlag brannten ihm die Augen, als wären sie voller Sand. Doch es gab noch einen zweiten Teil der Botschaft, den er laut Befehl mündlich übermitteln sollte. Die Zeit dazu war nun gekommen … danach konnte er sich ausruhen … schlafen.
»Hör mir zu, Konsul«, sagte er, »viele Zeichen der Götter, die gegen deine Unternehmung sprechen, haben den Senat bewogen, das Delphische Orakel zu befragen, und dieses hat eine schreckliche Antwort gegeben .«
»Das Delphische Orakel?« fragte der Konsul verblüfft.
»Ja, antwortete der Tribun, »und dies sind die genauen Worte des Gottes:
Exei gär stratie polyfertatos obrymothymos Telothen ex Asies hothen anatoläi heliou Eisin, käi diabäs steinon poron Hellesponton Ten Romen käi Italian porthesei Eän to Täuron oron yperbäinete.«
Der Konsul unterbrach ihn spöttisch: »Du schmeichelst mir, Tribun, aber mein Griechisch ist nicht so gut, als daß es mir erlaubte, dermaßen schwierige und ausgefeilte Verse zu verstehen. Macht es dir etwas aus, sie mir in Latein zu sagen?«
»Das Orakel spricht vom Untergang Roms. Wenn unsere Heere die Grenze des Taurus überschreiten, wird eine gewaltige Heeresmacht über das Abendland herfallen und Italien vernichten .«
Der Konsul sprang auf und schnitt ihm erneut das Wort ab. »Willst du mich auf den Arm nehmen?« rief er. »Wer in Rom kann so töricht sein, daß er nicht bemerkt, daß dies ein Manöver des Königs Antiochos von Syrien ist, um unsere Legionen am Fuß des Taurus aufzuhalten und zu retten, was von seinem Reich übriggeblieben ist? Falls es sich jedoch nicht um leichtgläubige Torheit handelt«, fuhr er, mit großen Schritten das Zelt durchmessend, fort, »dann ist es Mißgunst gegenüber meinen Erfolgen, ein Manöver, um mir die Ehre eines großen Sieges zu entreißen, der, vergiß das nicht, Rom neue Territorien bringen würde, große Macht, ungeheure Reichtümer!«
»Niemand ist so leichtgläubig«, entgegnete der Tribun, »und deshalb haben die Senatoren in dem Verdacht, daß König Antiochos das Orakel vielleicht beeinflußt oder bestochen haben könnte, den Pontifex Maximus gebeten, die Sibyllinischen Bücher zu befragen …«
»Und?«
»Die Antwort war die gleiche: Unsere Heere dürfen den Taurus nicht überschreiten, sonst wird eine Katastrophe über Rom hereinbrechen, von der man sich nie wieder erholen wird.«
Bei diesen Worten hielt Manlius Vulso plötzlich inne und blieb reglos in der Mitte des Zelts stehen. »Ich glaube nicht an Orakel«, sagte er. »Wir haben Hannibal besiegt, Philipp von Makedonien gedemütigt, den König von Syrien vernichtet. Welches Heer der Welt könnte heute noch die Macht Roms bedrohen? Die Schwachen oder die Besiegten verschanzen sich hinter den Orakeln und rütteln an Götterstatuen in der Hoffnung, uns Angst einzujagen, uns, die wir keine menschlichen Mächte mehr fürchten.«
Der Tribun stand auf und trat zum Konsul, er redete auf ihn ein und versuchte den stolzen Mann zu überzeugen, aber im Innern spürte er bereits, daß all seine Anstrengungen vergebens gewesen waren. »Hör zu, Cnaeus Manlius, andere vor dir haben die Zeichen der Götter mit Verachtung gestraft und teuer dafür bezahlt . denk nur an Konsul Flaminius, der mit all seinen Männern am Trasimenischen See umkam .«
»Flaminius war unfähig!«
»Mag sein . aber glaubst du, daß unsere Macht ewig währen kann? Wenn du dich nach allen Himmelsrichtungen umsiehst, wirst du kein Heer sehen, das unsere Legionen herausfordern könnte … Aber hältst du dich für größer als Kyros und Alexander? Auch sie hielten sich für die Herren der Welt, und heute sind sie Staub. Auch sie waren ganz plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht, um ihre Feinde zu vernichten …« Mit entschlossener Miene sah Manlius Vulso sein Gegenüber an. »Deine Augen sind glasig«, sagte er eisig, »du bist außer dir vor Müdigkeit, und deshalb werde ich so tun, als hätte ich deine anmaßenden Worte nicht gehört. Du hast deine Mission erfüllt und mir die Botschaft des Senats überbracht. Damit ist es genug. Geh jetzt schlafen, der Morgen ist nicht mehr fern.« Er rief eine Wache und ließ den Tribun in seine Unterkunft bringen, ein Zelt nahe dem Quartier der pergamenischen Reiterei. Lucius Fonteius, der all seiner Tatkraft beraubt war, ließ sich auf das Feldbett sinken und fiel sofort in einen Schlaf, der so tief war wie der Tod.
Das Licht im Feldherrenzelt in der Mitte des Lagers war gelöscht, doch Konsul Vulso legte sich noch nicht schlafen. Nachdem er den Mantel auf einem Hocker abgelegt hatte, trat er nur mit der kurzen Militärtunika bekleidet aus dem Zelt. Langsam folgte er der Lagerstraße bis zum Osttor. Vor ihm erhob sich das mächtige Bollwerk des Taurus, und aus dem Talgrund ließ sich das Gurgeln des Flusses vernehmen, der zwischen dichtem Weidengebüsch dahinfloß.
Plötzlich zuckten über den Berggipfeln Blitze auf, wie Alpträume auf der Stirn eines Giganten. Der Konsul hob den Blick. »Wetterleuchten«, sagte er zu sich, »dann wird es nicht regnen.«
Lucius Fonteius erwachte erst, als es schon lange Tag war. Die Äste einer großen Pappel hatten sein Zelt vor der Sonne geschützt, so daß sich die Kühle der Nacht darin gehalten hatte. Er horchte auf das Zirpen der Zikaden und das Gezwitscher der Spatzen, sonst drang kein Geräusch von draußen an sein Ohr. Aber er hatte doch nicht an einem einsamen Ort geschlafen, sondern mitten in einem römischen Heerlager! Er schnallte den Gürtel um die Hüften und stürzte aus dem Zelt – das Lager war verlassen. Das war doch nicht möglich! Zwanzigtausend Mann und tausend Pferde waren aufgebrochen, ohne daß er aufgewacht war . Und doch begann der Mist der Pferde und Maultiere bereits zu trocknen. Der Konsul hatte das Heer ohne Trommelwirbel und ohne Lärm genau in dem Augenblick in Bewegung gesetzt, als der Tribun im tiefsten Schlaf lag. Lucius Fonteius rannte zur Böschung und sah, daß die Spuren des Heeres zur Furt hinabführten und sich rasch im Flimmern der von der Sonne bereits stark aufgeheizten Luft verloren. Er fiel auf die Knie und preßte die Fäuste gegen die Stirn.
Wenige Schritt entfernt weidete sein Pferd gemächlich einen Mastixstrauch ab und vertrieb die Fliegen durch regelmäßiges Wedeln seines Schweifs. Der Tribun stand auf, ging zu dem Tier und strich ihm über Maul und Stirn.
Rom war fern . jenseits der lykischen Berge, jenseits der verbrannten Steppen des öden Axylons, jenseits des großen Bittersees, jenseits der schneeweißen Salzwüste . Rom wartete auf die hochmütige Antwort des Konsuls, auf sein Todesurteil.
Schmalen Tälern folgend, erklomm Lucius Fonteius die rauhen, kahlen Berge im Norden, ohne daß Mühen und Hunger ihm noch etwas anhaben konnten. Wie ein Gespenst ritt er zwischen Staubwirbeln hindurch über die Hochebene, langsam, getragen von seinem Pferd, das einer unsichtbaren Spur zu folgen schien. Er gelangte nach Synnada, Fontes Alandri, und von dort folgte er wieder dem Lauf der Sonne nach Westen. Als er an die Mauern von Kallatebos kam, grüßten ihn die römischen Wachsoldaten mit: »Ave, Tribun.« Doch er hörte sie nicht, denn in seinen Ohren hallte nur das unaufhörliche, monotone Hufgetrappel seines Pferdes wider. Vier Tage später kam die Küste in Sicht, und ein Schiff, das von Smyrna aus in See stach, nahm ihn an Bord. Der Kapitän, ein Grieche aus Patara, versuchte mehrmals während der Überfahrt mit ihm zu sprechen, doch gelang es ihm nie, den Tribun in ein Gespräch zu verwickeln. Nachts beobachtete er, wie sein Passagier stundenlang an Deck auf und ab ging. Als er ihn nach dreizehn Tagen in der Abenddämmerung an der Südmole von Ostia an Land setzte, fühlte er sich wie von einer Last befreit.
Es war noch hell genug, um bis nach Rom zu kommen, und deshalb rief der Tribun einen Schiffer an und bat ihn, er möge ihn in die Stadt bringen.
Ein günstiger Westwind blähte das Segel, und das Boot fuhr mühelos den Tiber hinauf.
Je deutlicher sich die Mauern und Dächer der Stadt gegen den Himmel abzeichneten, desto mehr spürte Lucius Fonteius die Last der Gedanken, die er in den letzten Tagen tief in seiner Seele eingeschlossen hatte. Was würden die Senatoren sagen und was der Pontifex Maximus, was würde mit der Stadt geschehen, über der jene düstere Weissagung lag?
Die Sonne war schon untergegangen, als das Boot in der Nähe des Herkules-Altars ans Ufer stieß. Der Tribun zog sein Geld aus der Tasche und bezahlte den Schiffer, dann sah er noch eine Weile zu, während dieser das Segel einholte und den Bug in Strömungsrichtung drehte. Der Schiffer war ein abgehärmter Alter mit weißem Bart, und in der Finsternis, die die Häuser umhüllte, schienen dem Tribun die Wasser des Flusses schwarz wie die des Acheron.
Er folgte dem Vicus Jugarius hinauf bis zum Kapitol, wo die Tempel der Götter von Fackelschein erleuchtet wurden. Dort wandte er sich an einen der Diener, die gerade die Türen des Jupitertempels schlossen, und bat ihn, den Pontifex Maximus davon in Kenntnis zu setzen, daß Lucius Fonteius aus Asien eingetroffen sei und ihn dringend zu sprechen wünsche. Anschließend setzte er sich auf die Stufen des Tempelsockels und wartete. Der Stein war noch warm, tagsüber mußte es sehr heiß gewesen sein. Die nach Kiefern und Lorbeer duftende Brise bewegte leicht die Baumwipfel am Fuß des Hügels, langsam kam der Vollmond hinter dem Quirinal hervor und erleuchtete die Säulen und Statuen des Forums. Er hörte Schritte und sah den Pontifex und eine Handvoll Senatoren über die Via Sacra herannahen und schließlich hinter den Rednertribünen zum Vorschein kommen.
»Salve, Tribun«, begrüßte ihn der Pontifex, sobald er ihn erkannt hatte. »Als ich von deiner Ankunft hörte, ließ ich auch diejenigen Mitglieder des Senats benachrichtigen, die über deine Mission unterrichtet sind. Komm, gehen wir in den Tempel, dort können wir unbesorgt sprechen.«
Nach diesen Worten drückte der Pontifex das Tor auf und trat ein, gefolgt von den Senatoren.
»Wir sind dir dankbar, daß du uns so rasch hast benachrichtigen lassen, und warten gespannt auf deinen Bericht. Also, hast du den Konsul gesehen? Hast du ihm unsere Botschaft überbracht?«
»Ich habe ihn gesehen. Er hielt sich in Pisidien auf, jenseits von Termessos.«
»Und weiter?« fragte der Pontifex beunruhigt.
»Er wollte mir kein Gehör schenken. Cnaeus Manlius Vulso hat sein Heer gegen Syllion geführt und den Fluß überquert, der die Grenze zu Kilikien bildet. Ich muß annehmen, daß er die Straße eingeschlagen hat, die zum Paß führt.«
»Willst du damit sagen, daß du dir dessen nicht sicher bist?«
»Nachdem er meine Botschaft angehört hatte, entließ mich der Konsul. Ich war so müde, daß ich mich nicht mehr auf den Beinen halten konnte. Seit Tagen hatte ich nicht mehr geschlafen, und so sank ich in einen tiefen Schlaf, sobald ich mich niedergelegt hatte. Als ich erwachte, war es hellichter Tag, und das Heer war schon in aller Stille aufgebrochen, gewiß auf Befehl des Konsuls. Ich habe die Spuren gesehen, die zur Furt führten, nach Syllion hin. Ich hatte weder die Kraft noch den Mut, meinerseits dem Konsul über jene Grenze zu folgen, also machte ich mich unverzüglich wieder auf den Weg, um euch vom unglücklichen Ausgang meiner Mission zu berichten. Ich bitte euch, mir zu glauben, Patres conscripti«, fügte er, den fassungslos lauschenden Senatoren zugewandt, hinzu. »Ich habe nichts unversucht gelassen und meine Kräfte nicht geschont, um meinen Auftrag auszuführen. Jetzt wißt ihr Bescheid. Eure Aufgabe ist nun, die geeigneten Entscheidungen zu treffen, damit Stadt und Volk kein Übel widerfährt.«
Der Tribun verstummte und erhob sich. Der Pontifex betrachtete ihn. Lucius Fonteius war abgemagert und hatte eine trockene, gespannte Haut; das Licht der Tempellaternen verlieh seinem Blick einen wirren, manchmal fast unheimlichen Ausdruck.
»Du kannst gehen, Tribun«, sagte er, »du hast deinen Auftrag ausgeführt, und wir danken dir dafür. Nun müssen wir Vorkehrungen treffen … geh, und mögen die Götter dir eine ruhige Nacht gewähren. Unsere wird es bestimmt nicht sein.«
Einige Augenblicke herrschte tiefes Schweigen zwischen den Säulen des Heiligtums. Die sechs Greise waren in Gedanken versunken und hörten nicht die langsamen, schweren Schritte von Lucius Fonteius Hemina, der den Tempel verließ, die Freitreppe hinabstieg und auf der Via Sacra rasch von der plötzlichen Finsternis verschluckt wurde, die eine dunkle Wolke vor dem Antlitz des Mondes hervorgerufen hatte.
Rom, im Jahre 575 nach der Gründung der Ewigen Stadt, zur zweiten Stunde der Iden des Februarius
»Soeben ist die Bestätigung eingetroffen«, sagte Quästor Furius Labeus, »damit sind alle Zweifel ausgeräumt: Die Streitmacht von Cnaeus Manlius Vulso wurde auf dem Rückweg in Thrakien angegriffen und hat schwere Verluste erlitten. Es ist unglaublich – unsere Legionen haben Antiochos von Syrien und die Galater besiegt, und nun soll eine Bande thrakischer Straßenräuber ihnen einen solchen Schlag versetzt haben.«
»Wo hat es sich zugetragen?« fragte der Pontifex Maximus.
»An einem Ort namens Steinoporia im Chersonesos.«
Der Pontifex erbleichte, und auch die fünf Senatoren, die am frühen Morgen in seinem Haus zusammengekommen waren, sahen einander bestürzt an.
»Oh, ihr Götter im Himmel«, murmelte der Pontifex, »dies ist gewiß das Zeichen, die Warnung, daß sich das Orakel erfüllt. Die Prophezeiung lautete: ›kai diabas steinon poron Hellesponton …‹, und Vulsos Heer wurde an einem Ort namens Steinoporia am Hellespont geschlagen. Kein Zweifel, es ist ein Zeichen, daß die Götter auf törichte Weise herausgefordert wurden. Und das ist nur der Anfang, Patres conscripti, wir müssen uns auf weit schlimmeres Unheil gefaßt machen.«
»Auch wenn das, was du sagst, wahr ist«, schaltete sich der Quästor ein, »ich habe nicht den Eindruck, daß wir den Kopf so sehr hängen lassen müssen . Irgend etwas müssen wir doch tun können. Und darüber hinaus können wir nicht gänzlich sicher sein, daß Manlius Vulso wirklich den Taurus überschritten hat, solange wir nicht die Beauftragten des Senats im Gefolge des Asienheeres befragt haben.«
»Ich für meinen Teil hege keine Zweifel, leider«, erwiderte der Pontifex, »und deshalb denke ich, daß wir keine Zeit zu verlieren haben. Schon seit geraumer Zeit sind die furchtbarsten Prophezeiungen im Umlauf .«
»Seit Konsul Acilius Glabrius vor drei Jahren die Gegend um den Athene-Tempel in Böotien verwüstet hat«, präzisierte einer der Senatoren.
»So ist es«, sagte der Pontifex, »und wir haben sogar die Möglichkeit in Betracht gezogen, daß jene Prophezeiungen vom Haß der Griechen und der Asiaten gegen uns diktiert waren. Aber wie ihr wißt, wurden sie durch die Sibyllinischen Sprüche bestätigt – die Bedrohung bleibt. Deshalb ist es unerläßlich, einen Sühneakt zu vollziehen, bevor sich Niedergeschlagenheit, oder, schlimmer noch, Panik breitmachen . Seit undenklichen Zeiten ehrt die Stadt die Penaten, die unser Stammvater Äneas aus Troja mitführte, sowie das heilige Abbild der Athene im Tempel von Lavinium, das Palladion .«
»Das Orakel des Apollon Smintheus«, fügte der älteste der Senatoren hinzu, »weissagte einst, daß die Römer ihre Stadt erhalten können, solange sie das vom Himmel gefallene Standbild der Göttin bewahren .«
»Deshalb, Patres conscripti, ist es notwendig, so schnell wie möglich im Tempel von Lavinium Sühneriten zu zelebrieren und auch Vorsorgemaßnahmen für die Sicherheit des Tempels und des Palladions selbst zu treffen – solange die Statue nicht auf das Kapitol gebracht worden ist. Vergessen wir nicht, daß die Niedertracht der Menschen uns nicht weniger schaden kann als der Zorn der Götter. Das Schiff Aquila, das wir auf die erste Nachricht von der Niederlage des Konsuls hin nach Kleinasien ausgeschickt haben, um dem Willen der Göttin zu entsprechen, müßte inzwischen mit seiner wertvollen Ladung die Heimreise angetreten haben. Was würde geschehen, wenn in einem Augenblick wie diesem das Palladion aus dem Tempel geraubt würde?«
»Aber das ist doch unmöglich«, wandte einer der Senatoren ein. »Es gibt sieben Abbilder der Göttin, und niemand außer dem Tempelpriester weiß, welches das echte Palladion ist.«
»Nichts ist unmöglich, wenn das Spiel um einen so hohen Einsatz geht«, entgegnete der Pontifex. »Deshalb meine ich, daß wir so rasch wie möglich Tribun Hemina nach Lavinium schicken sollten, damit er den Priester, der das Heiligtum bewacht, unterrichtet und für eine schlagkräftige Besatzung auf dem heiligen Gelände sorgt. Unterdessen werde ich selbst die Vorbereitungen für die notwendigen Sühneriten sowie für die feierliche Zeremonie anläßlich der bevorstehenden Rückkehr der Aquila veranlassen. Die Sibyllinischen Sprüche können nicht die Unwahrheit sagen, und die Niederlage unserer Streitmacht in Thrakien ist fast mit Gewißheit der Beweis dafür, daß Cnaeus Manlius Vulso die Taurusgrenze überschritten hat.«
Die fünf Senatoren erhoben sich und gingen, nachdem sie sich vor dem Pontifex verbeugt hatten, schweigend hinaus. Nur Quästor Furius Labeus blieb an der Tür stehen, als habe er noch etwas auf dem Herzen.
»Wolltest du noch etwas sagen, Quästor?« fragte der Pontifex.
»Ich will aufrichtig sein«, ergriff der Richter schroff das Wort, »auch wenn ich vielleicht gotteslästerlich erscheine. Ich bin mir keineswegs sicher, ob es wirklich Athenes Zorn ist, der die Stadt bedroht – was sicherlich Sühneriten rechtfertigen würde. Mein Eindruck ist vielmehr, daß es darum geht, dem Ansehen von Konsul Manlius Schaden zuzufügen, denn in jedem Fall steht er als derjenige da, der den göttlichen Zorn hervorgerufen hat.«
Der Pontifex Maximus erbleichte, aber der Quästor fuhr ohne mit der Wimper zu zucken fort. »Ich frage mich«, fügte er hinzu, »wem all das nützt, wem der Ruin des Konsuls Vorteile bringt. Ich kenne bereits die Antwort auf diese Frage, und du kennst sie auch, glaube ich, wo du doch so gut mit Publius Cornelius Scipio, genannt Africanus, befreundet bist. Dessen gewiß strahlender Ruhm wäre bei günstigem Ausgang der Unternehmungen des Konsuls in Asien Gefahr gelaufen, ein wenig von seinem Glanz zu verlieren. Nein, verehrter Pontifex, ich bin kein Frevler. Ich glaube an die Macht der Götter ebenso wie an die Heimtücke der Menschen. Wisse also, daß der Konsul Vulso in Rom wohl viele mächtige Feinde hat, aber auch viele Freunde . und zwar Freunde, die zu allem entschlossen sind.« Er warf die Toga über die Schultern, ging hinaus und schlug die Tür hinter sich zu.
Lavinium, am Tag nach den Iden des Februarius, zur vierten Stunde nach Sonnenuntergang
Nachdem er sein Pferd angebunden hatte, überquerte Tribun Hemina den verlassenen Tempelhof, stieg die Freitreppe des Sockels hinauf und pochte an die Tür, doch niemand öffnete ihm. Er ging rechts um den Tempel herum zur Wohnung des Priesters, die im rückwärtigen Teil des Heiligtums lag. Er klopfte und bemerkte, daß die Tür offen war. Überrascht legte er die Hand an den Schwertgriff und blickte hinein: Im Innern war es dunkel, und er hatte Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden. Er spitzte die Ohren, damit ihm nicht das leiseste Geräusch entging, doch er hörte nur das Pfeifen des Windes, der eisig aus Norden blies. Dann trat er ein.
Der Tribun rief, doch er erhielt keine Antwort. Durch den Eingangsbereich gelangte er ins Atrium, das von einer Öllampe spärlich erhellt wurde. Möbel, Stühle, Gerätschaften – alles war an seinem Platz.
Er betrat den Gang, der auf die Rückwand des Tempels zuführte, und sah, daß durch eine angelehnte Tür am Ende des Gangs der matte Schein der Laternen im Innern des Tempels einsickerte. Er stieß das Türchen auf und trat ein, doch nachdem er einige Schritte zur Mitte des Heiligtums hin gemacht hatte, blieb er wie versteinert stehen: Auf dem Fußboden lag ein Mann. Lucius Fonteius kniete sich neben ihn und drehte ihn um – es war der Priester des Tempels!
Die starren Augen und die steifen Gliedmaßen deuteten darauf hin, daß der Priester bereits seit einigen Stunden tot war. Lange betrachtete der Tribun jene bläulichen Lippen, die ihr entsetzliches Geheimnis nie mehr preisgeben würden. Dann riß er sich los und dachte an das mächtige Idol, von dem in dieser kritischen Stunde dem Anschein nach die Rettung Roms und Italiens abhing. Instinktiv hob er den Blick zu den sieben Nischen, als hoffte er auf ein Zeichen, das ihm zeigte, welches der sieben steinernen Bildnisse das echte Standbild war, und erstarrte: Die Nischen waren leer. Keuchend lehnte er sich an eine Säule und versuchte, Ordnung in das Durcheinander seiner Gedanken zu bringen. Plötzlich hatte er eine Eingebung, er entzündete eine Fackel und begann Stück für Stück den Fußboden abzusuchen. Er fing bei dem Sockel an, der die sieben Nischen trug, und bemerkte Spuren im gelben Sand. Den Weg zurückgehend, den er bei seinem Eintreten gekommen war, folgte er den Spuren und gelangte in den rückwärtigen Hof. Mit der Fackel leuchtete er über den Boden und sah sich aufmerksam um. Ohne Zweifel hatte jemand an diesem Ort ein Loch gegraben und anschließend versucht, sorgfältig jede Spur zu tilgen.
Ein feiner Eisregen setzte ein, der die Fackel zischen ließ und sie fast löschte, und in diesem Augenblick hörte der Tribun Schritte im Innern des Tempels und gleich darauf das Quietschen von Türangeln: Jemand floh durch die Vordertür. Er lief rechts um den Tempel herum und kam gerade rechtzeitig, um zu erkennen, wie der Schatten eines Pferdes hinter der Hofmauer hervorkam und die Straße nach Rom einschlug. Der Tribun rannte zu seinem Pferd, sprang auf und schlug ihm die Fersen in die Weichen. Das Tier wieherte und stampfte auf dem Pflaster vor dem Tempelsockel, dann galoppierte es die dunkle Straße entlang.
Lucius Fonteius Hemina beugte sich vor an den Hals seines Reittiers und versuchte, die Straße zu erkennen, während die Dunkelheit ringsum immer tiefer wurde und der Wind auffrischte. Rasch wurde aus dem Regen Schneegestöber, doch der Tribun zügelte sein Pferd nicht, er war fest entschlossen, den Unbekannten einzuholen.
Vor ihm bog die Straße nach rechts, danach ging sie wieder geradeaus zwischen zwei hohen, steilen Böschungen, die eine Flucht zur Seite, in die Wälder unmöglich machten. Hier würde er den anderen einholen. Er spornte sein Pferd noch mehr an und erreichte die Kurve mit zu hohem Tempo. Das Tier rutschte aus und fiel auf die Knie.
Mit schmerzerfülltem Wiehern rappelte es sich wieder auf, strauchelte, fiel erneut, galoppierte die Böschung hinunter und schleifte seinen Reiter hinter sich her. Stundenlang hörten die Bauern in den umliegenden Hütten Schreie, Hilferufe, ersticktes Wehklagen, doch niemand hatte den Mut, sich bei diesem Wetter in die Dunkelheit hinaus zu wagen, denn es war eine unglückverheißende Nacht, die von verhexten Schatten bevölkert wurde.
ZWEITER TEIL
Eine Nacht und einen Tag
habe ich in den Meereswogen zugebracht…
Paulus von Tarsus
Grottaferrata, Kloster San Nilo, im Jahr unseres Herrn 1071, um die siebte Stunde des 4. Februar
Theodoros von Phoc?a hob den Kopf vom Schreibtisch und blickte durch das Fenster auf die tiefh?ngenden, grauen Wolken, die ?ber die Albaner Berge zogen. Ach, der Himmel von Konstantinopel, dieser erhabene und ferne Himmel, der sich smaragdfarben und leuchtend rot ?ber dem Goldenen Horn w?lbte, ?ber der Kuppel der Hagia Sophia. Nie w?rde er ihn wiedersehen, nie mehr . Wunderbares Konstantinopel, verkommene, grausame Stadt, Stadt des Irrsinns, Gefangene der Intrige und der L?ge, strahlende Residenz der letzten C?saren . blutr?nstiges Monstrum. Rom war unter den Stiefelabs?tzen der Barbaren erniedrigt worden, und dennoch war das Reich Gottes nicht ?ber die Erde gekommen. Die Adler hatten sich von Kapitol und Tiber abgewandt und kreisten nun ?ber dem Bosporus, doch sie hatten keinen Ort gefunden, an dem sie sich niederlassen konnten. Die Erben Konstantins des Gro?en waren grausame und korrupte Tyrannen, nicht besser als Nero und Caligula. Aus Feigheit hatten sie das Kreuz Jesu aufgerichtet, nicht aus Fr?mmigkeit, einzig aus der Hoffnung heraus, damit die kriegerischen Feinde zu b?ndigen. Erbarmungslos gegen?ber den Schwachen, feige gegen?ber den Starken, war ihre einzige Waffe das Gold, mit dem sie bestachen, Teufelszeug . Nein, nie w?rde er die goldenen Kuppeln Konstantinopels wiedersehen, das vom Blut der Seinen befleckt war . seines Vaters, den man mit gl?hendem Stahl geblendet hatte, seiner im Schlaf erstochenen Br?der. Verr?ter hatte man sie genannt, Freunde des r?mischen Papstes.
Patriarch Kerullarios hatte die Ostkirche aus der Autorit?t des r?mischen Pontifex gel?st, hatte sich gegen den Stuhl Petri aufgelehnt und ?ber Exkommunikation, Kirchenbann und Interdikt nur h?hnisch gelacht. Mit M?he hatte Theodoros das eigene Leben gerettet, und jetzt war er aufgrund der F?rsprache des p?pstlichen Legaten, des Kardinals von Silva Candida, in diesen heiligen Mauern aufgenommen worden. W?rden ihm die Stille des Klosters, Arbeit, Gebet und Studium jemals Schlaf und Frieden wiederbringen? W?rden die Gespenster verschwinden, w?rde sich das Dunkel lichten, in dem seine Gedanken gefangen waren?
Ein Rabenschwarm strich durch die schmale Fenster?ffnung, der aschgraue Himmel hallte von ihrem Kreischen wider. Verwirrt blickte er sich um. Und doch war dieser heilige Ort so friedlich, gingen seine Br?der heiter ihren Pflichten nach: Igino von Celano, der die Kriegsgeschichte Prokopios? von Kaisareia ?bertrug, Anicetos von Kerkyra, der die Homilien Gregors von Nazianz mit gold- und purpurfarbenen Miniaturen versah, Arnaldo von Vetralla, der Strabos Geographie folgend eine Weltkarte mit den Buchten, Inseln und Halbinseln des Mittelmeers und des ?u?eren Ozeans anfertigte, schlie?lich Nikephoros von Ioannina, der am anderen Ende des Grapheions an einem Lesepult stand und mit betr?bter Miene eindringlich zu ihm her?bersah. Nikephoros von Ioannina . ihm wollte er die tiefsten Geheimnisse seiner Seele anvertrauen. Mit ihm war es einfacher . er schien bereits vieles zu wissen.
Der alte M?nch verlie? seinen Platz, ging durch den Saal und setzte sich neben ihn.
?Du hast deine Arbeit unterbrochen, Theodoros, ist etwas nicht in Ordnung??
?Meine Seele ist traurig, Vater, und der Himmel ist so grau .?
Als ob er nicht zugeh?rt h?tte, betrachtete Nikephoros die beiden Inkunabeln, die aufgeschlagen auf dem Schreibtisch lagen: ?Die r?mische Geschichte des Polybios, XXII. Buch. Deine Transkription ist sehr sch?n, doch warum liegt dort auch Titus Livius??
Theodoros wandte die feuchten Augen wieder dem Fenster zu. ?Es schneit?, sagte er.
Langsam und sp?rlich rieselten die gro?en Flocken herab und legten sich als wei?e Schicht auf das steinerne Fensterbrett.
?Er soll die St?dte, Landgebiete, D?rfer und festen Pl?tze diesseits des Taurus r?umen3 ??, las Nikephoros aus dem Text des Titus Livius vor. ?Das sind die Bedingungen des Friedens von Apameia zwischen K?nig Antiochos von Syrien und Konsul Manlius Vulso. Ist es nicht so??
?Der Text ist verf?lscht?, sagte Theodoros, ohne den Blick vom Fenster abzuwenden. ?Lies die Anmerkungen hier am Seitenrand.?
?berrascht vom barschen Ton dieser Antwort fuhr Nikephoros zusammen und betrachtete die angegebene Stelle.
?Ich kann das nicht lesen?, sagte er, ?die Schrift ist zu klein, und meine Augen sind nicht mehr die von einst.?
?Es handelt sich um eine Anmerkung des Kopisten: ?Ich wei?, da? dieser Text verf?lscht und l?ckenhaft ist??, las Theodoros auf Lateinisch vor, ??weil ich einmal im Kloster von Subiaco die Geschichte des Polybios unter dem Titel der K?nige gesehen habe.??
?Seltsame Worte. Was bedeuten sie deiner Meinung nach??
Theodoros hob eine Seite der Inkunabel des Polybios an, so da? das Licht vom Fenster hindurchschien.
?Siehst du dieses Pergament?? fragte er. ?Es wurde abgeschabt und neu beschrieben, der Text ist mit Sicherheit verf?lscht. Da Livius in dieser Passage Polybios treu folgt, dachte ich, ich k?nnte bei dem lateinischen Autor die vollst?ndige Version der Ereignisse finden, die auf der entsprechenden Seite des griechischen Schriftstellers fehlt. Aber diese Anmerkung beweist, da? auch Livius? Text verf?lscht ist.?
?Das ist tats?chlich seltsam . Was folgerst du daraus??
?Das Problem ist nur zu l?sen, wenn wir annehmen, da? der Text des Polybios, auf den die Anmerkung hinweist, sich von dem unterscheidet, den ich gerade kopiere ?? Je l?nger er seine Argumente vorbrachte, desto fester wurde Theodoros? Stimme, als w?rde er mit jedem Wort die Kontrolle ?ber seine Gef?hle und den Kontakt zur Wirklichkeit wiedergewinnen.
?Ein abgeschabtes und neu beschriebenes Blatt an sich besagt noch nicht viel. So etwas geschieht h?ufig, wie du wei?t, besonders in Zeiten, in denen Mangel an Schreibmaterial herrscht. Man nimmt Pergament mit Transkriptionen von geringem Wert, schabt es ab und verwendet es wieder, indem man es in einen kostbaren Kodex einf?gt, der sonst unvollendet bliebe.?
?Aber sieh genau hin?, beharrte Theodoros, ?das abgeschabte Blatt sieht genauso aus wie die anderen und geh?rte demnach schon immer zu diesem Band. Jemand mu? den urspr?nglichen Text ausgel?scht und das Blatt neu beschrieben haben.?
Schweigend betrachtete Nikephoros eine Seite nach der anderen. Schlie?lich sch?ttelte er den Kopf: ?Wenn ich recht verstanden habe, meinst du, da? dein Band den urspr?nglichen Text des Polybios enthielt und da? jemand ihn abgeschabt hat, um ihn nach seiner Vorstellung umzuschreiben. Ist es so??
?Richtig! Und ich denke auch, da? ich in Subiaco die