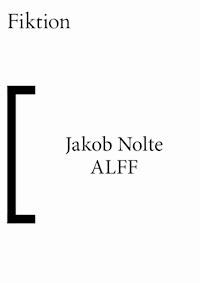
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fiktion
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über das Buch: Jakob Noltes Romandebüt ALFF erzählt von einer Mordserie an der High & Low High School in Beetaville, Neuengland. Ein „Vollstricker“ hat Benjamin, den Vorsitzenden des Debattierclubs, erschlagen und seine Leiche an einen Zaun genäht. Der Mord löst eine Reihe von bizarren jugendkulturellen Ereignissen aus: von der Gründung der Band La Deutsche Vita bis zum Entstehen der Anachronistischen Jugend. Nach einem zweiten Mord wird Agent Donna Jones berufen und verzweifelt an dem scheinbar unlösbaren Fall. Im Stil eines Highschool-Mystery-Thrillers unternimmt ALFF einen rasanten Parcours durch ein imaginäres Amerika der Neunzigerjahre. Der Roman ist getrieben von einer unbändigen Verwunderung und Freude über einen kulturellen Imperialismus, der sich in den Jahren zwischen Kurt Cobains Tod und 11. September an einem Wendepunkt befindet. Wie Karl May schreibt Jakob Nolte von einem Land, das noch ungetrübt ist von persönlichen Erfahrungen. Der 25-jährige nimmt es mit Film, Fernsehen, Literaturgeschichte und dem wahren Leben auf—und gewinnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Erstveröffentlichung Fiktion, Berlin, 2014www.fiktion.cc ISBN: 978-3-9816970-0-1
Projektleitung Programm Mathias Gatza, Ingo Niermann
Projektleitung Kommunikation Henriette Gallus
Lektorat Mathias Gatza
Korrektorat Rainer Wieland
Graphikdesign Vela Arbutina
Programmierung Maxwell Simmer, Version House
Das Copyright für den Text liegt beim Autor.
Fiktion wird getragen von Fiktion e.V., entwickelt in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt und gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.
Fiktion e.V., c/o Mathias Gatza, Sredzkistrasse 57, D-10405 Berlin
Vorstand Mathias Gatza, Ingo Niermann
Jakob Nolte ALFF
what if life is just some hard equation on a chalkboard in a science class for ghosts
The Silver Jews
Das Heilige Gespenst
Meggy wirft die Kinderaugen auf. Aufs Kinderzimmer. Auf die neun Finger, den Wecker. Die morschen Kontinentalplatten. Sie wäscht sich. Sie putzt die Zähne und zieht Jeans und Pullover über den Pyjama. Treppenstufen nimmt sie zwei mit einem Schritt, Schritte zwei mit einem Sturz. Sie greift nach der Kühlschranktür, dem Müsli, dem Schlüssel zum Schloss, schließt das Visier und startet. An ihr vorbei rasen: Wiesen, Kleinhaushälften, Eltern und ältere Eltern. Als sie den Eingang zur Schule erreicht, hört sie das Kippen eines schlecht geparkten Motorrollers hinter sich, geht aber weiter. In der Matheklausur kreuzt sie korrekte Antworten an. Jemand sperrt sie in einen Spind. Jemand schlägt ihr die Bücher aus der Hand. Jemand tritt ihr die Brille aus dem Gesicht.
Hinter den Korridoren, hinter der Schwingtür und den Fahrradständern, hinter dem Schulhof, hinter dem Baseballfeld hängt der leblose Körper des Jungen. Penibel wurde seine Haut in das langweilig symmetrische Geäst des Zauns eingenäht. Nachdem Polizisten den Tatort ausgiebig photographiert haben, lösen sie den Leichnam mit einem Teppichmesser aus den Maschen, wobei die Klinge sowohl am rechten Ellenbogen, als auch an der rechten Ferse bricht. Langsam gleitet er in die Arme des Leichenbestatters, in die Enge des Sargs und den Bauch des Friedhofs. Bis auf einige sind fast alle, die auf die High & Low High School gehen, zum Begräbnis gekommen: Lehrer, Schüler, Hauspersonal, der Bademeister des Außenbeckens. Benjamins Eltern stehen da, vor ihnen das grableere Rechteck und über ihnen eine belanglose Sonne. Sein Vater mit der dünnen Krawatte und seine Mutter mit einer Kette aus orangenen Perlen. Sie sagt
– Er war nie still, er war nie laut.
Es ist ein Herbst im Jahr 1994. Die Speiseeisverkäufe gehen zurück. Homecoming. Meggys Gesicht ist schön. Meggys Gesicht wäre schön, wenn sie kein Muttermal unter dem rechten Auge hätte. Ihr Gesicht ist entsetzlich. Hinreißend. Je nachdem. Ihre Augen sind grün und blau, links und rechts. Ihre Nase ist fein, ihre Fingerspitzen sind fein und wie aus Holz, wie aus alten Holzlöffeln gemacht, solche, wie sie schon die Großmutter durch den Spinat zog. An der linken Hand fehlt der Ringfinger. Meggy kleidet sich ein in Schichten aus Seide und Kaschmir und Strick, in gedeckte Farben, in Schuhe aus wildem Leder. Sie war nie still, nie laut, nie dumm. Was sie am letzten Sommer gestört hat, das war nicht die Abwesenheit des Schönen, sondern das Abhandenkommen der Heiterkeit, welche einen beim Nichtstun beruhigt und entspannt. Eine parasitäre Vorstellung von Erfüllung hat sich in ihren Gedanken breitgemacht, eine Idee von Selbstüberschreibung und Neuerfindung.
Benjamin wacht auf, er schaut auf den Wecker und flucht. Er flucht in allen ihm erdenklichen Weisen. Flucht gegen das Leben, die Zeit, den Himmel und die Tiere im Wald. Warum hat ihn seine Mutter nicht geweckt, so, wie sie es jeden Morgen tut? Im Schlafzimmer findet er keine Vorfahren, im Wohnzimmer keine. Doch nicht etwa in der Küche? Nein, auch in der Küche etwa nicht. Benjamin schneidet sich zwei Scheiben vom selbstgebackenen Brot ab, toastet sie, belegt sie mit einigen Süßkartoffelstreifen, Sprossen, Brie, Birnenscheiben, Mayonnaise und einem Salatblatt Blattsalat. Es schmeckt gut. Dazu trinkt er Orangensaft und dekoffeinierten Filterkaffee. In Benjamins Vorstellung ist Decaf so etwas wie die Airforce, weil das F am Ende des Wortes ausschaut wie der Flügel eines Kampfjets. Wenn Benjamin in der Kaffeedose eine verzauberte Befehlfee finden würde, welche es ihm freistellt, einen Befehl auszuführen, egal welchen, er würde den Befehl geben, Belgien zu bombardieren. Er findet, dass die Belgier zu gut davongekommen sind, was ihre Verbrechen während und nach der Kolonialzeit angehen. Gerechtigkeit. Dafür, dass seine Mutter nicht da gewesen ist, als er hätte aufstehen müssen, dafür räumt er die Küche nun aber auch nicht auf. Hätte er gewusst, dass eben jenes offen gelassene Mayonnaiseglas für den Rest des Lebens seiner Mutter ein Symbol der Willkür Gottes, eher dessen Nichtexistenz werden würde, er hätte etwas Interessanteres hinterlassen. Oder etwas Einfacheres. Er besteigt sein Fahrrad, fährt zur Schule, zungenküsst Nataly unter der Tribüne, lässt sich einen Witz über seine Sommersprossen gefallen, kippelt, kaut Kaugummi und fällt. Warum bin ich nicht im Baseballteam? Warum hat Nataly so kleine Brüste? Was ist das, die unsterbliche Seele? Kurioserweise fragt sich Benjamin an diesem Tag nur zwei der drei Fragen, wobei eigentlich nur eine so richtig spannend ist. Kommenden Tags wird er am frühen Mittag von drei Jungen gefunden, die im Wald ihre erste Zigarette rauchen wollen. Nataly legt ihre flache Hand auf Benjamins Wange, welche eine große Ähnlichkeit mit der Milchstraße hat. Sie sagt
– Bis gleich.
und
– Das T-Shirt ist dir vielleicht doch etwas zu klein.
oder
– Ich wünschte, du wärst eine Antilope, allein in der Steppe und dann kommt eine wilde Löwin und reißt dich. Ich wäre dann die Naturphotographin.
aber vor allem
– Bis gleich.
Vierzehn Monate später wird ein Hund den Fetzenrest seiner Kleidung in der Nähe einer ganz anderen Stadt in einem ganz anderen Staat finden.
Wer bisher nicht erwähnt wurde: der wütende Rothaarige mit den Pockennarben, die Einäugige.
Am Tag nachdem Benjamins nackter Leichnam am Zaun gefunden wurde, treffen sich Nataly und Meggy auf der Mädchentoilette. Sie stehen nebeneinander an verschiedenen Waschbecken, doch es ist ein Spiegel, der ihre Gesichter zurückwirft.
– Es tut mir leid das mit –
– Ja?
– Ja.
Nataly zeigt ihr den Knutschfleck am Hals.
– Weißt du, woher ich den habe?
– Ist er –
– Es ist das Einzige, was Benjamin noch in dieser Welt hält. Ist der Knutschfleck weg, war es das.
Nataly wühlt mit tränendicken Augen in ihrer Handtasche herum, einer, die voll mit Zetteln und Stiften und Haarklammern und einer Nagelfeile ist. Sie drückt sich das spitze Kosmetikutensil dorthin, wo gestern noch Benjamins Lippen scharf waren. Nataly verliert das Bewusstsein. Meggy wird vom sprudelnden Blut ergriffen und verliert das Bewusstsein. Susie, Susie und Susann kommen ins Bad. Beim Anblick der Blutlache verlieren sie das Bewusstsein. Zum Glück fällt Susie aber derart in den Türspalt, dass ein junger Voyeur seinen Blick unter Susies Rock werfen kann. Sofort verliert er das Bewusstsein. Einige Minuten vergehen, in denen nichts passiert, außer dass Nataly verblutet. Meggy kommt zu sich. Sie zieht die Feile aus Natalys Hals und verschließt die Wunde mit ihrem Daumen. So fahren sie ins Krankenhaus und Nataly überlebt den Spaß, bleibt jedoch für eine Weile unter Selbstmordwacht.
Die Schule schließt für ein paar Tage und Meggy überlegt sich, wie sie von nun an leben soll. Sie hat ein Faible für Radiosender, Nationalhymnen und kurze Bücher. Sie liebt das Kino, weil man dort in die Sonne starren kann, ohne blind zu werden. Was sie nicht hat: ein funktionierendes Familienband, ein Pferd, ein funktionierendes Haarband, einen Pferdeschwanz, Schwänze.
Die Mitglieder des Party Party Clubs sind entsetzt. Wie sollen sie so kurz nach der Hinrichtung eines ihrer Mitschüler einen guten Homecoming-Ball organisieren? Und was ist mit all den Mottos, die sie sich ausgedacht haben? Mörder allgemein – alle gemein, Wir baumeln am Strick der guten Laune oder Hoffentlich stirbt Benjamin bald, all das geht nicht mehr. Es würde ironisch wirken und mehr noch, pietätlos.
Meggy denkt also nach und ihr fällt etwas auf. Sie will Gutes tun und den Menschen helfen. Sie will wie ein Mädchen sein, dem nicht nachzusagen ist, dass es keine Aufgabe in der Welt hat. So schnell bekommt sie aber keine Stelle bei der Polizei und schult daher auf Privatdetektivin um. Sie beginnt ihre Ermittlungen im Fall Benjamin MacNash am Tatort vor dem Zaun. Eisig weht ihr der Wind in die Wimpern. Die Straßen sind grau, der Kosmos trostlos. Ein Indiz, denkt sie sich, irgendein Indiz muss es doch geben. Sie befühlt das Gras und zerreibt einen Käfer zwischen den Fingern, riecht an ihnen. Sie notiert sich: Die Mörderin oder der Mörder muss groß sein und stark und handwerklich geschickt und vielleicht einen Hang zum Stricken und Häkeln haben. Er oder sie muss ohne Skrupel sein, dafür mit Skalpell und vielleicht ein Serientäter. Doch die Spur der Tinte wird von Regentropfen verzerrt. Wer macht so was überhaupt? Also ich meine, wer hat das überhaupt, so extreme Emotionen wie Hass, Liebe oder Lust? Endlich findet sie etwas Handfestes, einen Hinweis. Es ist ihr unbegreiflich, wie die Polizisten diesen übersehen konnten, aber immerhin bestätigen sich dadurch ihre Vorurteile gegen selbige.
Während der Zeit im Krankenhaus scheinen sich Meggy und Nataly anzufreunden.
– Feinde? Ich weiß nicht, ob er Feinde hatte. Eigentlich nicht, wer sollte schon etwas gegen ihn gehabt haben? Er war ein normaler Junge, er hat sich gut mit den Sportlern vertragen, gut mit den Mathematikern, gut mit den Lehrern und Menschen aller Konfessionen, seine Eltern waren schön, fürsorglich, bedächtig und ich habe ihn geliebt.
– Eifersucht?
– Nein.
– Trotzdem würde es mich freuen, wenn ich mal zu euch zum Essen kommen könnte.
– Klar.
– Ich rufe an. Ganz bestimmt werde ich dich anrufen. So gegen frühen Abend einmal?
– Sicher.
Die Asymmetrie macht Nataly Angst, Meggys Gesicht erinnert sie an etwas, an irgendetwas.
Des Novembers Gedärm, es ist kalt. Meggy hat in der Matheklausur ein A. Sie ist die Beste. Mister Cello lobt sie. Nach dem Unterricht sperrt man sie in einen Spind, schlägt ihr die Bücher aus der Hand und tritt ihr die Brille aus dem Gesicht. Das Geräusch einer startenden Flugzeugturbine dröhnt in ihren Ohren. Sie hat Angst zu explodieren, allein, hilflos im Dunkeln. Sie schreit und schreit.
Nataly hat sich für die Skifreizeit eingetragen, aber fühlt sich unwohl, da sie als vom Tod gefickt gilt und eine Außenseiterin ist. Was sie ungemein ärgert.
Home-o-ween. Da die Stadt noch die gute Trauer in sich trägt, hat sich der Party Party Club dazu entschlossen, doch keine Party zu machen, sondern eine illegale Party in einer alten Maschinenhalle, die früher eine Fleischerei war und davor ein Krematorium. Weil ja auch Halloween ist und Kürbisse gegessen werden. Nataly, Miranda und die beiden Boys Joseph und Lenny sitzen in einem Auto und schaukeln durch die Straßen, um faule Eier auf Häuser zu werfen und Briefkästen mit Baseballschlägern einzuschlagen. Nataly hat Miranda auf der Skifreizeit kennengelernt und die beiden berührten mindestens eine angespannte Wade der jeweils anderen. Die Vorstellung, sich jemals wieder zu verlieben, in einen anderen Jungen, als Benjamin es einer war, kam ihr widerwärtig vor, falsch, und um es nun Gott endlich heimzuzahlen, vergeht sie sich an Frauenfedern. Da das soziale Aus aber in der Nähe von gleichgeschlechtlicher Liebe herumlungert, geben beide vor, ein Date zu haben und so fahren sie zu viert herum und sprechen oft nicht viel, dafür läuft gute Musik.
– Und auf der Party erst.
– Auf welcher Party denn?
– Habt ihr nichts davon gehört, Mäuschen?
– Mäuschen?
– Na, ihr seid doch zwei spitze Mäuschen, oder nicht?
Was man ertragen muss.
Meggy liegt in der Allee. Sie starrt dem Himmel entgegen, welcher links und rechts und oben und unten von Baumkronen angeknabbert wird. Es rieselt auf sie herunter: Blatt, Blättchen, Baummüll. Das Farbspektrum ähnelt dem einer Autopsie. Sie liegt auf dem Asphalt und trinkt Roggenschnaps. Sie wirft einen schwarzen Stein in die Luft und fängt ihn mit dem Mund, sie versucht zu kauen, aber er ist zu hart. Sie lutscht an ihm, spielt mit ihrer Zunge an dem Stein herum, will ihn irgendwo unterbringen, irgendwo zwischen zwei Zeilen, aber es gelingt ihr nicht. Ihr wird klar, dass das Universum nicht in einem Gleichgewicht und dass das Puzzleteil die zu vermeidendste aller Metaphern ist. Ihr wird klar, dass es nur Messer gibt, die in alles schneiden, und Mägen, die alles verdauen. Sie beißt und beißt auf den Stein, bis ihr ganzer Mund voll ist mit Blut und Zahnsplittern, sie gießt Roggenschnaps dazu und es brennt und in einem Schmerz verschluckt sie alles, den Kalk, das Blut, den Schnaps, den Stein.
Viervierteltakte wiederholen sich abermals. Nataly, ihre geheime Liebschaft Miranda und die beiden Boys Joseph und Lenny stehen in einer Ecke, die viel zu groß für sie ist, und halten sich an einer Erdbeerbowle fest. Wenn man sie sich vorstellen würde, wie sie dastehen, umgeben von Tanzenden und Diskokugeln, dann von ganz weit weg. Mit einer mikrowellenhaften Leere in Kopf und Leben und Tomatensoßenspritzern an der Innenseite ihrer Augen. Alles ist anders, bis alles wieder gleich ist. Nataly fragt sich, während sie tanzt, während sie sich über diese Pille unterhält, die da xtc heißt, die die Boys irgendwoher bekommen haben, irgendwem abgeschwatzt, irgendwem aufgeschwatzt, während sie einen Schluck trinkt, während Miranda mit der Hand versucht, unter ihre Pofalte zu kommen, ob das immer so ist mit den Toten. Ob sie immer zurückbleiben in der Vergangenheit, oder ob es eine Möglichkeit gibt, sie mitzunehmen. Ob sie zuschauen. Sie weiß noch, wie sie einmal mit ihren Eltern auf Hawaii war, sie und ihre Schwester waren Nächte entfernt von der Geschlechtsreife, es war eine unbeschwerte, eine herrliche Zeit. Und an der Theke einer sonnigen Strandbar erzählte ihr ein alter Mann vom Voodoo. Blitzlicht, Nebel, Zigarettenwetter. Waren das alles Tote, die in der Gegenwart vergessen wurden? Später sitzen Nataly und Miranda auf dem Rücksitz eines Autos. Sie spucken auf die Morgensonne. Sie suchen Schutz und Wärme. Sie berühren sich nicht, sie erzählen sich bloß von wertgeschätzten Kriminalromanen und Nataly fragt sich insgeheim, ob es ein Geschenk der Welt an sie ist, dass sie so verdammt gut darin ist, andere glücklich zu machen.
Benjamins Mörder wird von der Schülerzeitung Vollstricker genannt.
– Warum nicht Vollstrickerin?
fragt niemand.
Nataly war es nicht. Das weiß Meggy. Klar, sie ist gewaltbereit, in der Strick- und Stick-Society, außerdem emotional waghalsig, aber dennoch nicht abwegig. Überhaupt zweifelt Meggy daran, dass es jemand aus der Schule war. Die Art des Mordes, der Schlag mit dem Hammer auf den Schädel, die Lust am Knacken und das akribische Ausstellen der eigenen Arbeit, das wirkt nicht wie etwas, was Schüler der High & Low High School machen würden. Alle ihre Bekannten sind viel zu faul, als dass sie den Aufwand nicht scheuen würden.
Miranda schläft ein, Nataly untersucht sie. Ihre Brust bewegt sich auf und ab, die Luft in ihren Lungen ist warm, ihre Haut, der dünne Fetzen, der sie vor dem Auslaufen bewahrt, zart. Man könnte Brillengläser mit ihrer Haut putzen. Nataly fährt ihr über die Lippen. Nimmt sich die Unterlippe. Hält sie zwischen Daumen und Mittelfinger. Zieht. Und spuckt ihr in das Schiffchen zwischen Mund und Zähnen. Ihr Gesicht ganz nah an ihrem. Sie fasst sich in die linke Hosentasche und in die rechte und schläft ein.
Als Benjamin 14 Jahre alt wurde, waren er und Nataly bereits zwei Jahre zusammen. Also schenkte sie ihm etwas Besonderes, denn sie waren sich sicher, dass sie füreinander und die Ewigkeit geschaffen waren. Es war der Ring, den sie im Wald fand. Er war aus Holz und Gold. Als Widergroßherzigkeit bekam Nataly zu ihrem Fünfzehnten auch einen Ring. Benjamin gewann diesen aus dem Draht seines geliebten Röhrenfernsehers. Sie waren verliebt und ernst und es war gut. Als klarwurde, dass Benjamin ein verstorbener junger Mann ist, knipste sich Nataly den Ring vom Ringfinger und den Ringfinger von der Hand.
Einmal, es ist bereits kurz davor, Frühling zu werden, treffen sich Nataly und Meggy draußen auf dem Feld. Der Winter war nie da gewesen und der Boden weich, das Licht noch gefroren. Beide strecken sie der anderen die Narbe der linken Hand entgegen. Die Verkrüpplungen greifen ineinander wie Zahnräder einer antiken Mechanik.
– Hast du gehört, es soll ein älteres Pärchen aus dem Wald gewesensein, welches in einer Hütte wohnt, das deinem Geliebten das Leben nahm.
– Ich weiß.
– Sie werden morgen hingerichtet.
– Ich weiß.
– Sie waren es aber nicht.
– Ich weiß.
– Komisch.
sagt Meggy.
– Nicht so wichtig. Wir müssen weg von hier. Wir müssen raus, raus aus allem.
Doch wo einmal ein Wunsch war, da wächst nichts mehr.
Das Stadion befindet sich am Rand der Stadt, welche von einem Wald und einem kleinem Berg begrenzt wird. Dieser ist die einzige Erhöhung in einem Radius von mehreren zehntausend Metern, mit Ausnahme vom Kirchturm der Kirche. Überhaupt ist es ein flaches Städtchen, auch wenn man meint, dass die Häuser drei Stockwerke haben, so sind die Wände der einzelnen Räume derart niedrig, dass es eigentlich, verglichen mit den meisten anderen ostamerikanischen Städten, nur zwei Stöcke sind. Dafür gibt es breite Straßen und der Wind pfeift kaum. Alles ist entweder graugrün, weiß oder rot, abgesehen von den Telefonmasten, welche erstaunlich schwarz sind für ihr Alter. Auch die Kabel, die telekommunikative Partitur aus den frühen Sechzigern, als hier alles neu gemacht wurde, die Häuser, die Straßen, der Himmel, haben nichts von ihrem Schwarz eingebüßt. Die Kirche steht nicht direkt im Zentrum der Stadt, stand sie nie, sondern ist dort, wo, würde man das Städtchen mit einer Dartscheibe vergleichen, von oben gesehen, die Dreifach-Neunzehn liegt. Der Kirchturm steht da und ist von überall aus zu sehen, ist jedem, der es sich selbst gegenüber für angemessen empfindet, ein mahnender Zeigefinger, wie er da dem All entgegenragt. Natürlich lächerlich niedrig und nicht ansatzweise wolkenkratzend, doch immerhin höher als alles um ihn herum, kalt und streng. Wobei die Strenge schon an der eigenen Fassade aufhört, da die Uhrzeiten, welche er in die vier Himmelsrichtungen zeigt, jeweils falsch sind. Jede auf ihre eigene, nicht nachvollziehbare Weise. Gerüchten zufolge gibt die Norduhr drei Mal am Tag die richtige Zeit an, man muss nur genau hinschauen. Das ist also die Kirche. Aufgrund einer Bürgerinitiative findet die Exekution ausnahmsweise im Stadion statt. Meggy und Nataly gehen gemeinsam hin. Überall sind Holzspäne ausgestreut und um das Kampffeld herum stehen Sicherheitsmenschen mit Wassereimern und Decken. Das Pärchen aus der Hütte im Wald wird schreiend und bettelnd in die Mitte geführt, in das Blickfeld der ausverkauften Ränge. Die Sicherheitsmenschen nehmen ihre Decken, werfen sie auf die Verurteilten und prügeln sie daraufhin mit den Wassereimern zu Tode. Das Ganze dauert 47 Minuten und die Eisverkäufe sind schlechter als erwartet; dafür verdienen die Nüsschenverkäufer eine Menge.
Nach dem Spektakel schlendern Meggy und Nataly gemeinsam durch die Innenstadt. Einem Ort der Leere, der verstaubten Fensterfassaden und der Straßenlaternen. Früher gab es ein Fischgeschäft und ein Käsegeschäft, es gab Spezialisten für Schuheinlagen, für die Lottozahlen und Pistazieneis. Es gab Tresen und Theken, einzigartig in diesem Land, Inseln des Fachwissens über beispielsweise Kürbisse. Es gab eine Frau, die ein ganzes Geschäft nur für Kürbisse hatte, es gab Kürbisse in der Form von Schnecken, von Phiolen und Blumenkohl, heute hat es geschlossen. Die Innenstadt ist zu einem großen langen Sonntag geworden, mit Ausnahme vom Diner. Alles, was die Bewohner der Stadt sonst zum Leben brauchen, müssen sie sich in den Kellern und Katakomben suchen, im Kanalisationssystem, dort, wo sich im Sommer '92 der Darkmart einrichtete. Still hat er seine Regale in den Untergrund gemeißelt und verdrängte Parzelle um Parzelle alles ökonomische Leben aus der Stadt. Manchmal, in den kurzen Nachtstunden, in denen der Darkmart nicht geöffnet hat, da steigt ein Dampf durch die Abwasserdeckel herauf und der Geruch von verbranntem Stein, man hört das leise Winden der Verkaufsregale unter der Erde, den Tatzelwurm aus Tupperware, Fleischkonserven und Milchgallonen, seinen heißen Atem. Nataly redet viel von Miranda, und davon, dass ihre Eltern und Schwester nichts wissen dürfen von dieser verbotenen Liebe und wie schön es aber ist, und wie unterschiedlich die Liebenden im Lieben seien. Sie setzen sich ins Diner und werden von einem patzigen Matrosen bedient.
– Was darfs denn sein? Ein Salatblatt für die Häschen?
– Nein.
– Zwei große Coke, Zucchinibürger und Fries.
Aus ihrer Tasche zieht Meggy den Hinweis, den sie gefunden und dann vergessen und dann wiedergefunden und dann wieder vergessen und dann zufällig auf dem Schreibtisch gesehen und dann verlegt und dann vom Gedächtnis zurück ergattert hatte, um ihn Nataly zu zeigen. Den vom Tatort. Beide wissen nichts damit anzufangen.
– Also.
– Es scheint eine Art geometrischer Nebel zu sein.
– Oder vielmehr ein Besteck.
– Vielleicht ein Schlüssel?
– Oder eine Kurbel?
– Vielleicht ein Motor?
– Oder ein Werkzeug?
– Vielleicht ist es Kunstwerkzeug?
– Oder Kunst?
– Vielleicht Zeug?
Sie sind sich uneinig. Das Essen kommt und Nataly vergeht die Lust am Rateraten, sie denkt sich insgeheim, dass sie ihr Gegenüber verachtet. Meggy ist asymmetrisch-eigenwillig bis uninteressant und außerdem schlecht gepflegt. Es kommt oft zusammen, weiß Nataly, dass schöne Menschen spannend und aufregend sind, schlau und schnell, während weniger schöne Menschen einen Abhang zum Banalen haben. Wer ihr, also Meggy, denn dann helfen könnte, bei der Identifizierung des Hinweisgegenstands, das wäre wohl eher Bobby, der König des Knabenlands.
– So? Und wer ist das? Und wie soll ich ihn kennenlernen?
– Ich kenne da wen.
sagt Nataly. Angst, Glück, Angst und Glück. Weil ihnen der Matrose gefällt, geben sie sehr viel Trinkgeld. Meggy bleibt noch etwas sitzen und notiert sich etwas.
Mittlere Vögel singen und zwischen den halbhohen Häusern der Stadt stolpert Nataly ins Grübeln. Stöcke, Steine, Kronkorken drücken sich scharf in die durchgetretenen Sohlen ihrer Turnschuhe. Sie kaut auf ihrem Haar herum. Danach auf dem Knoten ihres Freundschaftsarmbands, danach auf ihren Fingernägeln, Kuppen, Gelenken. Schließlich hockt sie sich hin und kaut auf ihrem Knie herum. Was, wenn sich Meggy wieder mit mir treffen will? Was, wenn sie meine Freundin sein will? Was, wenn niemand jemals diesen Mord aufklärt? Wie viel Zeit soll ich noch mit dieser Person verbringen? Was für Anlässe wird sie wohl finden, mich anzurufen? Mich mit ihr zu belästigen. Nataly beißt. Mit den Schneidezähnen hat sie ein kleines Loch in ihr Knie gepult und reißt dieses nun mühselig weiter auf. Sie hat sich auf die Seite gelegt, mitten auf den Bürgersteig und schleckt träumerisch über die offengelegte Kniescheibe. Später dann, viel später, als sie endlich eingeschlafen ist, da kommen Joseph und Lenny vorbei mit ihren roten Rollern und entführen sie. Sie bringen sie nach Hause und Joseph hat sie sich in seine Arme gelegt und ist vorbei an der Tür, an der Mutter, an dem Vater, in ihr Zimmer und bettet sie. Er häutet sich aus Trainingsjacke und Shirt, legt sich zu ihr. Seine Arme zum Kissen verschränkt. Er bietet ihr eine Zigarette an, sie schüttelt den Kopf. Er bietet ihr seine Zunge an, sie schüttelt den Kopf. Auf seiner Brust glänzt ein kleiner Jesus an einem kleinen Kreuz.
– Glaubst du an Gott?
Er zieht Nataly den Rock aus, küsst ihre Füße, ihre Schienbeine, ihre Oberschenkel, ihre Hüften, den Stoff ihrer Unterwäsche, der lauwarm ist, und sie kreischt, schimpft und spuckt, hört nicht mehr auf. Sie ballt ihre Finger zur Faust und schlägt ihm in den Nacken. Ihre Schwester, die bisher bloß zugeschaut hatte, nimmt einen Filzstift und rammt ihn Joseph in die Rippen. Er wehrt sich nicht. Auf seiner Haut bilden sich feine Risse. Zu dem Geruch der Lust gesellt sich der Gestank der Angst.
An der High & Low High School gibt es strikte Regeln, etwa wer wann wo was in der Mensa essen darf, und wie lange. Natürlich bekommen nicht alle Essen ohne Fleischbeilage. Manche Schüler müssen ganze halbe Jahre lang Hack, Gulasch, Schnitzel, Gulasch oder Gulasch essen. Die Regeln greifen auch auf andere Bereiche des Alltags, sogar auf alle. Halten Schüler und Schülerin sie ein, so ist das die Entscheidung für die ritualisierte Demütigung und gegen die Grausamkeiten der Improvisation, welche ungleich schrecklicher sein können. Vorrang erhält, wer älter, schöner oder wohlhabender ist. Meggy hat ein Problem mit diesen Strukturen. Da sie sie schlicht nicht erkennt, kann sie sie nicht respektieren, kontextualisieren oder reproduzieren. Vielleicht, weil sich ihr gesamtes Leben rein in der Gegenwart abspielt. Vielleicht aus Kalziummangel. Vielleicht ist dieses Problem, welches ihr großes Lebens- und Weltproblem ist, auf eine Eigenart und Weise der große Vorsprung, den sie dieser voraushat.
Als Nataly an die Decke ihres Kinderzimmers starrt und die Stimme ihrer Schwester ignoriert, klingelt das Telefon und sie blendet alles aus. Wo Joseph ist, das weiß sie nicht, nicht einmal, ob er überhaupt bei ihr war. Ihr Blick schwenkt von der Decke zur Wand. Benjamin hatte ihr einmal Reign in Blood von Slayer geschenkt und sie seinen kleinen Angel of Death genannt. Sie hatte sich daraufhin ein Slayer-Poster gekauft und es an die Wand gehängt. Miranda hatte ihr eine Kassette mit ihren Lieblingsliedern aufgenommen und sie fragt sich, ob sie nun ein Poster an die Wand hängen soll, welches Miranda abbildet, oder eines von den Interpreten ihrer Lieblingslieder. Natalys Vater Henry, ihre Mutter Amy und ihre Schwester Emily legen sich in dieser Reihenfolge zu ihr ins Bett. Amy fragt, warum sie denn nicht an das Telefon gegangen, ob sie denn nicht gewusst habe, wer da dran gewesen sei. Nein, das weiß sie nicht.
– Woher denn? Wer denn?
Es ist niemand an das Telefon gegangen.
– Wollen wir zu Abend essen?
Aber alle sind sie satt und bleiben liegen. Sie überlegen sich, wer es hätte sein können, wer um diese Zeit anruft. Die Verwandten aus Zürich? Die Beschmutzer? Der Wärter mit den Holzaugen? Die Gefallenen? Sie sitzen da und an ihnen ziehen die verpassten Leben vorbei, die Tage im Park, die ruhigen Stunden und die Hände. Vor allem die Hände, die ihnen über ihre Oberarme gestrichen und Schatzkarten auf Rücken gezeichnet hätten. Wie sie am Bahnhof gestanden hätten, und das plötzliche Umschlagen von Zärtlichkeit zu Lust sie dazu bewegt, die Muskeln zu verkrampfen. Den anderen halten, übergriffig werden und verschlingen.
Lenny ist dünner als Joseph. Man kann seine Rippen, seine Handgelenke erkennen unter der Haut. Er hat dickes kurzes schwarzes Haar und trägt eine Nickelbrille, die am rechten Rand mit Hefe und Backpapier geflickt wurde. Er besitzt viele Schallplatten und einen Schallplattenspieler, außerdem einen roten Roller. Nachts, wenn sein Vater schläft, geht er an den Schrank mit den Flaschen und an den Schrank mit den Büchern. Aus beiden nimmt er sich die schönsten Ausgaben und fährt mit dem roten Roller durch die Alleen. An jedem Platz, der ihn an Joseph erinnert, hält er an, liest ein Kapitel und stürzt einen Schluck. Als ihm auffällt, dass es in der russischen Literatur von gestern einmal Mode war, kurze Kapitel zu schreiben und in der schottischen Braukunst von heute ist, starke Schlücke zu manufakturieren, ist es zu spät. Er ist unwahrscheinlich betrunken. Er fährt in einen Zaun und einen Graben, verliert den Kontakt zu seinen Beinen und Teile seiner Gliedmaßen. Der Unfall hat Lenny verändert, nicht nur, dass er seinen rechten Fuß nachzieht, er ist leichter geworden. Als er dort lag, zwischen Latten und den Scherben seines Frontlichts, das Gesicht auf dem Boden, zwischen den Splittern, den Blick auf die blutige Hand, wie Tropfen entstehen und in den Boden sickern, wie alles ein Schwarz wird, als er gewartet hat auf irgendjemanden oder irgendetwas, ihn von seiner Bewegungslosigkeit zu befreien, da ist etwas in ihm gekeimt. Eine Pflanze, die größer und stärker wurde mit jeder Minute Stille. Die Kraft einer gefüllten Badewanne. Er liest alle Bücher seines Vaters und hört alle Schallplatten, die der Schallplattenladen anbietet. Joseph kommt ihn oft im Krankenhaus besuchen, doch Lenny ist es gleich. Einmal kommen sogar Miranda und Nataly zu ihm.
– Wie geht es dir?
– Ich weiß, dass ihr ein Paar seid.
– Wir wissen, dass du Joseph liebst.
Unter Einfluss von Drohungen verlassen sie sofort den Raum. Lenny lässt sich ein Gibson SG und mehrere Verstärker und Verzerrer in sein Krankenzimmer liefern. Er spielt ein experimentelles, flächiges, lärmiges und zum Teil extrem entstelltes Gitarren-Album mit dem Titel Doom Town Boys auf den Anrufbeantworter von Joseph. Diese Kompositionen sind, verglichen mit der Musik, die in der Zukunft noch entstehen wird, durchaus gewöhnlich, für die Gegenwart allerdings wegweisend, beziehungsweise wären es gewesen, wenn Josephs Vater den Dreck nicht sofort gelöscht hätte, denn so viel passt nun mal nicht aufs Band.
Die Direktorin der High & Low High School trifft Meggy auf dem Flur, alleine und mit zuckenden Augenlidern.
– Was machst du denn hier auf dem Flur?
Meggy bricht unter sich zusammen.
– Was ist denn?
Meggy stemmt ihre Arme gegen den Linoleumboden, versucht das Gewicht ihres Körpers zu halten.
– Meggy?
Sie übergibt sich.
– Was hast du denn?!
Schüttelt sich vor Kälte.
– Schnell einen Arzt!
Sie blickt die Rektorin an. Sie flüstert.
– Die Zeitungen sind schlecht. So ohnegleichen schlecht. Ich ertrage es nicht mehr. Es ist zu viel. Das hält niemand aus. Diese Bazillen, diese Krankheit, die sich Journalismus nennt.
– So? Dann geh doch in die Schülerzeitung und mach es besser.
Mit letzter Kraft schlägt Meggy der Direktorin ins Gesicht.
– Aber du bist ja ganz wütend. Ich möchte dich in den Arm nehmen.
– Niemals!
Sie kugelt sich davon, schluchzt in die Ferne, einer Umarmung knapp entronnen, und wenn sie allein auf dem Feld steht, und um sie ist nichts als der Geruch der unbebauten Luft, dann spannt Meggy ihre Arme aus und wartet, dass sich der Wind unter ihren Körper legt. Ein Drachen. Sie flattert. Nataly zieht sie an ihrer Schnur zu sich herunter.
– Ich habe gehört, du hast die Direktorin geschlagen?
– Ja.
– Warum?
– Sie hat mich beschmutzt.
– Achso.
– Und das darf niemand.
– Warum wolltest du dich mit mir treffen?
– Ich bin sehr alleine, Nataly.
– Deswegen wolltest du mich sehen?
– Ich habe Angst um dich und Miranda. Das Paar aus der Hütte, sie waren keine Mörder, nicht Benjamins.
– Benjamin?
– Du bist meine einzige Freundin und ich möchte, dass dir nichts zustößt.
Nataly muss sich das Lachen verkneifen, tut so, als würde sie sich ihre Schuhe zubinden und kappt das Seil, welches Meggy mit der Erde verbindet. Sie fliegt davon, verfängt sich in einer Reihe Pappeln, die wie Langstreckenraketen vor dem Horizont herumwachsen.
Zu Hause wird Nataly von ihrer Schwester Emily gefragt, ob sie ihren Vanillepudding essen darf. Nataly stimmt zu, obwohl es ihre liebste Süßspeise ist.
Zu Hause wird Meggy von ihrer Mutter gefragt, warum sie eine grausame Natur hat, doch Meggy schweigt. Sie sitzen zu zweit am Küchentisch, Meggys Mutter trinkt eine halbe Flasche Rotwein und Meggy isst Feigen mit Weichkäse. Meggys Mutter kann ihrer Tochter nicht in die Augen schauen. Auch während der krampfhaften, an sich selbst erstickenden Unterhaltung haftet ihr Blick auf dem Rotweinglas. Meggy schweigt. Sie schauen eine Dokumentation im Fernsehen. Meggys Mutter bringt ununterbrochen Variationen ihrer eigenen dummfeigen Meinungen hervor. Die zahme Soziopathie, die ihrem Charakter anhaftet, verliert sich im Suff. Sie trinkt eine halbe Flasche Rotwein. Meggy macht Hausaufgaben auf ihrem Zimmer. Meggys Mutter trinkt eine halbe Flasche Rotwein. Meggy schließt die Tür ab. Meggys Mutter trinkt eine halbe Flasche Rotwein. Auf jeder Treppenstufe hoch zum Zimmer ihrer Tochter eine weitere halbe Flasche Rotwein. Meggy stemmt einen Stuhl gegen die Türklinke. Sie legt sich ins Bett. Sie trägt Jeans und Pullover über ihrem Pyjama. Eine Ader in ihrem Auge platzt. Als ihre Mutter sie am nächsten Morgen verlässt, um zur Arbeit zu fahren, sie wird mindestens eine Woche fort sein, Schatz, in Santa Fe, tut Meggy so, als wäre es der Kuss eines Jungen, der ihr wollüstig die Seele rauben will, und nicht der ihrer Mutter. Eine Menge Geld hat sie dagelassen, aber die Tochter ist nicht besonders gut im Geldausgeben. Sie ersteht immerfort schlichte und fade Dinge. Sie weiß nicht, wie man einen draufmacht oder -setzt. Und so was. Daher gibt es Mischreisgerichte und Filme von Lucio Fulci. Heute etwa Paura nella città dei morti viventi. Wenn Meggy es sich aussuchen könnte, dann würde sie in den Achtzigerjahren in Italien leben und Mario heißen. Vielleicht würde sie (Mario) in einem Café einer jungen Frau begegnen und mit ihr und mit einem Fahrrad an Strände fahren, um Melonen zu verkaufen. Das Meer wäre aus Wasser und das Wasser tief und blau und klar und salzig. Die Oberfläche wäre nie glatt. Wäre man in dem Meer, man würde auf- und niedersteigen mit seinem Kopf. Vielleicht würde er (Meggy) die junge Frau in einen Schraubstock einklemmen und sie zwingen, all die Kerne zu essen, die die Touristen in den Strand gespuckt haben.
Als Benjamin MacNash geboren wurde, nahmen ihn seine Eltern hoch und hielten ihn ins Licht, wie einen Brief, den man nicht öffnen darf, aber trotzdem lesen möchte. Sie hatten gehofft, in dem Babykörper eine verschlüsselte Nachricht zu finden. Einen Zettel. Wir können alle gerettet werden, erlöst, indem wir unsere Sprache zerstören. Indem wir die Wörter ausweiden und ihre Innereien in die Kadaver anderer Wörter stopfen. Grob und grausam. Bis alle Wörter zerstückelte Restbestände aus unlesbaren Zeichen sind. Erst dann, wenn es unter den Wörtern keine Unterschiede mehr gibt, erst dann kann es unter den Menschen keine Unterschiede mehr geben. Aber der kleine Benjamin stellte sich als ein normaler Junge heraus, nicht als Orakel. Als er schließlich zwölf Jahre alt geworden war, nahmen die MacNashs seine Herkömmlichkeit hin und begannen wieder damit, im Alltag zu lächeln. Außerdem hatten sie Sex. Erst war es gar nicht so einfach, vor allem sein Vater fühlte sich unwohl bei dem Gedanken sein Glied in der Nähe des Geburtskanals zu wissen, welcher ja nun nicht mehr einfach nur so hieß, sondern tatsächlich ein Geburtskanal war, er hatte es mit stolzem Blick gesehen, und in diesen hinein zu penetrieren. Aber nach eingängigen Unterhaltungen begriff er das Geschlecht seiner Frau neu und lustvoll. In der Tanzschule Milk & Milk hatten sie eine Werbeanzeige für exotische Tänze aus Bulgarien und Rumänien gesehen und schnell wurden Tanzen und Sexualität im frühen Alter, neben der Erziehung des Sohns, ihrer beider Hauptanliegen. Bis dieser dann ermordet wurde. Vor allem machen sich die beiden Vorwürfe, weil sie sich in der Nacht vor Benjamins Schädelbasisbruch die Hütte eines befreundeten Pärchens aus der Tanzschule ausgeliehen hatten, um eine schwierige Sexualtechnik zu trainieren. Der Rest ihres Lebens fühlt sich sehr kurz an.
Joseph klagt an.
– Wenn ich morgens in der Dusche bin und mich eingeschäumt habe, wer legt seine Finger um meinen Penis? War ich nicht lange genug ohne Schönes, Edles & Gutes?
Was er außerdem sah, war eine Gestalt, eher eine Person oder einen Schatten, einen schwachen Schatten, vielleicht mit einem Gesicht, aber sicher war er sich nicht. Mehrere Teile dieses Anblicks wirkten eigenartig ineinander verschachtelt. Er mit einem Fellmantel oder einem Federkleid.
– Wo war das?
– Die Gestalt schlich über das Schulgelände, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich habe etwas gesehen, es aber sofort vergessen.
Joseph spielt an dem Serviettenspender herum, vor ihm ein großer Erdbeermilchshake.
– Wenn du mich nicht hypnotisiert hättest, ich hätte mich an nichts erinnert.
– Und wann war das, wann genau?
– Am frühen Morgen, gerade war es hell geworden.
– An besagtem?
– An besagtem Tag, an dem man Benjamins Leiche fand.
– Und du hast es niemandem erzählt?
– Bis eben nicht, nein.
Gute Arbeit, denkt sich Meggy und bestellt ein Bier.
– Schon 21?
fragt sie der grimmige Matrose.
– Ne, ist mein Erstes heute.
– Na dann.




























