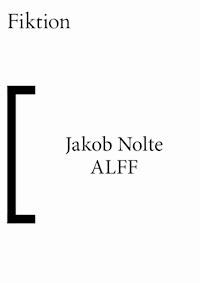18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Jede Biografie ist ein Evangelium«
Kurzes Buch über Tobias beschreibt in achtundvierzig Kapiteln das Leben des Schriftstellers, Pfarrers und Televangelisten Tobias Becker. Er wuchs in Niedersachsen auf und lebt in Berlin, spielt gern Tischtennis und will das Gute. Auf einer Reise nach Belgrad verliebt er sich in einen Mann namens Tobias und bekehrt sich zu Gott. Er wird Zeuge, wie Menschen zu Hasen werden, sich Liebe in Hass verwandelt und ein Flugzeug in den Alpen verbrennt. Wie viele Männer wähnt er einen Messias in sich. In Tobias Beckers Welt ist alles unausweichlich miteinander verwoben: Familie, Glauben, Subjekt und Gewalt. Es ist eine Welt voller Alpträume und Wunder.
Jakob Noltes neuer Roman ist eine moderne Heiligenerzählung, ein mystisches Rätsel. Er handelt von der Einsamkeit in der Heimat und der Verlorenheit in den Städten, von Allmacht und großer Unsicherheit, Spiritualität und dem Internet, der Sehnsucht nach Zugehörigkeit und dem Streben nach Sinn. Er wirft alle Vorstellungen von biografischem oder autofiktionalem Schreiben über den Haufen und lotet auf einzigartige Weise den Reichtum der Literatur aus: Erzählen voller Witz und Wissen, voller Romantik, Traurigkeit und funkelndem Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jakob Nolte
Kurzes Buch über Tobias
Roman
Suhrkamp
Kurzes Buch über Tobias
Aufgrund einer optischen Täuschung sah es so aus, als würden sich die Rotorblätter bloß langsam oder fast gar nicht bewegen, aber das stimmte nicht. Der Helikopter landete vor Tobias auf dem Feld. Blätter und Stöcke wirbelten umher. Er fror, seine Ohren dröhnten, und obwohl er wusste, wie spät es war, krempelte er sich den Ärmel hoch und guckte auf die Uhr. Es war kurz nach zehn. Aus Angst, dass ihm übel werden könnte, hatte er am Morgen nur einen Kaffee getrunken. Jetzt blubberte sein Magen.
Langsam ging er auf die Maschine zu. Hinter seinen Brillengläsern bildete sich eine Träne, zitterte und wehte davon. Tobias hielt seine Mütze fest. Sein Schal stand im rechten Winkel vom Hals ab. Da sein Mantel mit Knöpfen anstatt mit einem Reißverschluss geschlossen wurde, drang kalte Luft an seine Brust. Die Daunenweste, die er den Winter über unter der Jacke trug, hatte er am ersten Frühlingstag in den Schrank gehängt. Von den Männern im Cockpit schaute ihn nur einer an. Der andere regelte etwas an den Instrumenten. Tobias klopfte an die Scheibe.
»Entschuldigung«, rief er. Der Co-Pilot öffnete die Vordertür. »Ich bin Tobias.« Der Co-Pilot zog sein Handy aus der Tasche und zeigte Tobias ein Foto von ihm, auf dem er noch volles Haar hatte. »Ja«, rief Tobias. Der Mann zeigte auf sein Headset, um ihm zu signalisieren, dass er ihn bei dieser Lautstärke nicht verstand. »Ach so«, rief Tobias. Dann zeigte der Co-Pilot wieder auf das Bild auf seinem Handy und dann wieder auf Tobias. Tobias zeigte auf das Bild und auf sich und machte eine Faust mit dem Daumen nach oben.
»Es ist Tobias«, sagte der Co-Pilot in das Mikrophon seines Headsets. Erst jetzt stellte der Pilot den Motor ab. Mit einem Geräusch, das dem Auslaufen einer Schallplatte nach Abschalten des Schallplattenspielers ähnelte, drehten sich die Rotorblätter aus. Es war ein ruhiger Tag. Vereinzelt hörte man Rascheln, Gezwitscher oder das Hinabfallen von Ästen. Plötzlich erklang aus dem nahegelegenen Waldstück ein Schuss, auf den nach einem kurzen Moment zwei weitere hastige Schüsse folgten.
»Tobias«, sagte der Pilot, »setz dich zu uns.«
»Hey.«
»Das ist mein Bruder«, sagte der Pilot und zeigte auf den Co-Piloten.
»Hey«, sagte der Co-Pilot. Als sie ihre Mikrophone zum Kinn runterklappten, erkannte Tobias, wie ähnlich sie sich sahen. Ihre Bewegungen waren nahezu synchron.
»Bist du so weit?«, fragte der Pilot.
»Ich denke schon«, sagte Tobias.
»Schön«, sagte der Pilot. Der Co-Pilot öffnete Tobias die hintere Tür und half ihm beim Einsteigen. Er erklärte ihm den Gurt und wie er das Headset zu verwenden hatte.
+
Tobias und sein Freund Tobias verfolgten die Schlange bis in den Alexandergarten. Sie waren überrascht, dass sich bereits so viele Menschen versammelt hatten, aber sahen der Wartezeit gelassen entgegen. Bei einer Fastfood-Kette hatten sie sich Kaffee, Muffins mit Ei und Käse und Eiskrem gekauft. Es war eins der Laster, zu denen sich Tobias nur im Urlaub hinreißen ließ: Eis zum Frühstück zu essen. Die beiden gingen davon aus, über eine Stunde anstehen zu müssen, bis man sie ins Lenin-Mausoleum lassen würde. Tobias hatte sich seine Sonnenbrille ins Haar gesteckt.
»Endlich«, sagte er.
»Es wird bestimmt gut«, sagte Tobias.
+
Tobias reichte Tobias Karotten und eine Zucchini mit der Bitte, sie zu schneiden. Auf die Frage, wie groß die Stücke sein sollten, sagte er, dass Tobias das selbst entscheiden könne. Er ließ etwa zwei Zentimeter Abstand zwischen den Schnitten und schrägte sie leicht an. In der Pfanne brieten bereits rote Zwiebeln und Rosmarin, zu denen Tobias' Freund nun den Rest gab. Auch etwas Zucker streute er darüber. Jedes Mal, wenn eine neue Zutat die Beschichtung berührte, zischte es. Dazu gab es Reis. Tobias deckte den Tisch und setzte sich. Er begann seinem Freund von einem E-Mail-Wechsel zu erzählen, den er seit ein paar Tagen mit einem befreundeten Pfarrer führte, in dem es zunächst um das Lächeln eines Engels und zuletzt um den Begriff »explosiv-starr« gegangen war, und wollte wissen, ob ihm ein Beispiel dafür einfalle. Tobias fragte ihn, woher er den Pfarrer kannte, denn er hatte noch nie von ihm gehört. Tobias antwortete, dass er ihn vom Seminar kannte. Tobias sagte, dass er Liebesbriefe explosiv-starr finde. Tobias gab ihm recht und lobte ihn für seinen Scharfsinn. Beide lachten. Tobias füllte das Gemüse und den Reis in zwei Schalen und stellte sie auf den Tisch. Er bemerkte, dass Salz und Pfeffer fehlten, und holte sie vom Gewürzboard. Tobias meinte, dass es super schmecken würde. Allerdings bemängelte er, dass die Karotten zu viel Biss hätten, gab sich dafür aber selbst die Schuld.
Er machte den Abwasch, während Tobias das Badewasser einlaufen ließ. Sie hatten ausgemacht, jeden Mittwoch ein gemeinsames Bad zu nehmen und sich sechzig Minuten ungestört alles zu erzählen, was gerade in ihnen vorging, da man, selbst wenn man zusammenwohnte und so gut wie alles teilte, schnell dazu übergehen konnte, den anderen als selbstverständlich anzusehen. Meistens weinte einer der beiden dabei, und danach waren sie glücklich. Sie hatten eine freistehende Badewanne, und als Tobias ins Zimmer kam, war sein Freund schon zum Großteil hinter einer Schaumburg verschwunden. Tobias zog sich aus und setzte sich ihm gegenüber. Sein Po berührte das heiße Wasser, und er atmete laut ein.
+
Zu seinem 25. Geburtstag hatte Tobias von seinem Bruder ein HTC One M8 in Gunmetal-Grau geschenkt bekommen. Vorher hatte er ein Huawei, mit dem man zwar Angry Birds spielen, Fotos machen und Musik hören konnte, das allerdings schon vor Online-Dating-Apps in die Knie ging. Mit dem neuen Telefon konnte Tobias mobil im Internet surfen. Sein Vertrag bei DeutschlandSIM gewährte ihm 1 GB Datenvolumen pro Monat. Tobias' Bruder hatte ihn gewarnt, dass auch er bald zu den Zermatschten gehören würde, die täglich stundenlang auf ihre Screens starrten, aber Tobias winkte bei dieser Vorstellung selbstbewusst ab.
Mittlerweile zählte Google Chrome 48 offene Fenster. Tobias befürchtete, dass das Wissen, das in den offenen Tabs stand, verschwinden würde, wenn er sie schlösse; gleichzeitig zeigten die Jahre, dass er das, was er zu lesen vorhatte, nicht las.
In der Reihenfolge ihres Erstaufrufs waren die geöffneten Seiten folgende: die deutsche Wikipedia-Seite des Marcel-Carné-Spielfilms Hafen im Nebel, die deutsche Wikipedia-Seite des österreichischen Kriegsverbrechers, Nationalsozialisten, SS-Gruppenführers und Generalleutnants der Polizei Odilo Globocnik, die englische Wikipedia-Seite des indischen Thrillers Aalavandhan, ein Artikel über den Mond von Arne Ahlert auf der Seite diezukunft.de (Lesedauer 6 Minuten), die deutsche Wikipedia-Seite der Phantastik- und Erotikzeitschrift Der Orchideengarten, die deutsche Wikipedia-Seite des österreichischen Trickfilmkünstlers Erik Jan Hanussen, die Google-Suche »kenzaburo oe hiroshima notes pdf«, die deutsche Wikipedia-Seite zu dem Begriff »Ideologem«, die Google-Suche »mich weyermann bamberg«, die deutsche Wikipedia-Seite über das Massaker von Katyn, die deutsche Wikipedia-Seite über die Geiselnahme von Beslan, die englische Wikipedia-Seite des Songwriters und Somniloquists Dion McGregor, die Google-Suche »chiaoscuro« (wobei die Suchergebnisse für den Begriff »chiaroscuro« angezeigt wurden), die deutsche Wikipedia-Seite über Atavismus, wobei das Wiederauftreten anatomischer Merkmale von stammesgeschichtlichen Vorfahren gemeint ist und nicht der soziologische Terminus, die Google-Suche »olfaktorisch«, die Google-Suche »Kiese Laymon«, die deutsche Wikipedia-Seite zum psychoanalytischen Begriff »Oknophilie«, wobei keiner der Unterpunkte angeklickt wurde, die deutsche Wikipedia-Seite des österreichischen Schriftstellers Gerhard Roth, die deutsche Wikipedia-Seite des veralteten Begriffs »Defraudation«, die Google-Suche »inconnue de la seine«, die Google-Bildersuche »gaugin d'où venons nous«, die Google-Bildersuche »93 rolex daytona«, die Google-Bildersuche »christine de pizan«, der Songtext von Was blasen die Trompeten? Husaren heraus! auf volksliederarchiv.de, die Informationsseite zur Ausstellung René Magritte La Période Vache auf der offiziellen Webseite der Schirn Kunsthalle Frankfurt, die deutsche Wikipedia-Seite des russischen Unternehmers Sergei Pantelejewitsch Mawrodi, die deutsche Wikipedia-Seite des US-amerikanischen Trickfilmzeichners, Drehbuchautors und Regisseurs Frank Tashlin, die deutsche Wikipedia-Seite der deutschen Schriftstellerin Gisela Elsner, die Google-Suche »the rustle of spring«, die Google-Suche »pma«, die Google-Suche »nebelparder«, die Google-Suche »pseudolallist«, wobei keine Ergebnisse gefunden wurden und ihm ein Wikipedia-Artikel zu Christenverfolgung vorgeschlagen wurde, die deutsche Wikipedia-Seite des argentinischen Journalisten und Schriftstellers Alan Pauls, die deutsche Wikipedia-Seite des argentinischen Autors Ricardo Piglia, die englische Wikipedia-Seite des argentinischen Autors und Journalisten Rodrigo Fresán, ein NYT-MAG-Artikel mit dem Titel Losing Earth: The Decade We Almost Stopped Climate Change, ein Thread über Tischtennis-Clubs in Peking auf der Onlineplattform mytabletennis.net, die englische Wikipedia-Seite des chinesischen Films Crazy Stone, die deutsche Amazon-Seite von Franziska Gräfin zu Reventlows Gesammelte Werke: Romane + Erzählungen + Essays + Gedichte, die deutsche Amazon-Seite von Byung-Chul Hans Shanzhai: Dekonstruktion auf Chinesisch, die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts zu Lesotho, die Webseite der Hostaria del Monte Croce in Berlin-Kreuzberg, die Google-Suche »tirzah«, die Suhrkamp/Insel-Autorenseite von Vladimir Jankélévitch, die englische Wikipedia-Seite zu dem Begriff »Luddite«, der zunächst eine Gruppe von radikalen britischen Textilarbeitern beschrieb, die ihre Webstühle zerstörten, und sich dann zu einem Antonym von Industrialisierung, Automatisierung, Computerisierung und neuen Technologien im Allgemeinen entwickelte, die deutsche Wikipedia-Seite über die Gezeiteninsel Lindisfarne in Northumberland, die englische Wikipedia-Seite der ältesten märchenhaft romantischen Erzählung Japans, The Tale of the Bamboo Cutter, und Facebook, wo ihn jemand dazu eingeladen hatte, eine Seite, die denselben Namen wie die Person hatte, die ihn dazu eingeladen hatte, mit »Gefällt mir« zu markieren.
+
Tobias rannte vom südlichen Ausgang des S-Bahnhofs Babelsberg zur Tramstation. Die Taktung der Potsdamer Verkehrsbetriebe war so, dass man den Anschluss aus Berlin kommend meist nicht oder nur knapp bekam. Es war Sonntagmorgen und Tobias verkatert. Wenn er diese Tram verpasste, käme er noch mal zwanzig Minuten zu spät, was bedeuten würde, dass die Galerie, in der er ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte, weiterhin geschlossen bliebe. Nachts hatte es geschneit. Ein Auto musste scharf bremsen und hupte, als Tobias bei Rot über die Straße sprintete, die zum Bahnsteigsteig führte. Auf den Schienen rutschte er aus und fiel auf die rechte Hand. Eine beißende Frische signalisierte ihm unmissverständlich, dass seine Haut aufgerissen war. Die Türen der Tram waren dabei, sich zu schließen. Flehend streckte Tobias dem Tramfahrer seine Wunde entgegen, während Blut in seinen Ärmel lief. Im Führerhäuschen machte er eine Bewegung aus, die Aus-dem-Weg oder Rein-mit-dir heißen konnte. Tobias rappelte sich auf und stemmte sich durch die Tür, die noch einen Spalt offen war. In der Tram untersuchte er seine Verletzung und entfernte ein paar Körnchen Streusalz, die halb unter seiner Haut steckten. Bei jeder Berührung zuckte er. Eine Frau reichte ihm ein Taschentuch. Vor nicht mal vier Stunden war er aus dem Golden Gate Club nach Hause getorkelt. Er bedankte sich überschwänglich. Es war sein erster Winter in Berlin. Erschöpft trank er einen halben Liter Wasser aus einer abgewetzten Spreequell-Flasche und ließ sich in einen der harten Sitze fallen.
Vor dem Kunstraum Potsdam war niemand zu sehen. Manchmal, wenn er zu spät kam, erwarteten ihn erboste Gäste und wiesen ihn auf die im Internet oder auf Flyern angegebenen Öffnungszeiten hin. Bei diesem Wetter würden kaum Leute kommen, hoffte Tobias. Nachdem er die Wunde an seiner Hand auf dem Klo einigermaßen gereinigt und verarztet hatte, setzte er sich an seinen Arbeitsplatz und holte seinen Laptop aus dem Rucksack. Er hatte befürchtet, dass er beim Sturz zu Schaden gekommen war. Aber die fünf weißen Brötchen, die er für den Tag als Verpflegung dabeihatte, hatten den Aufprall abfedern können. Er würde sie später mit Ketchup essen. Tobias klappte den Laptop auf, begann Musik zu hören und spielte ein paar Runden Microsoft 3D Pinball. Eigentlich wollte er weiter an seinen Bewerbungen für die Schreibstudiengänge in Leipzig und Hildesheim arbeiten, aber seine Konzentrationsfähigkeit war noch nicht so weit. Er dachte an gestern Nacht und an Alina.
Gerade schrieb Tobias an einer Kurzgeschichte über einen Taxifahrer, der nachts betrunkene Fahrradfahrer umfuhr, weil er testen wollte, wie wenig er dabei empfand, anderen Menschen das Leben zu nehmen. Die Straßenverkehrsordnung gab ihm recht, und mit der Zeit wurde er zu einer Legende, und es entwickelte sich ein Trend, nachts betrunken mit Fahrrädern auf Kreuzungen stehen zu bleiben und darauf zu warten, ein Rennen mit dem Tod zu beginnen. Als Vorlage dienten Tobias Videos von der Stierhatz in Pamplona. Der erste Satz der Erzählung lautete Das ekstatisch monotone Blinken der Warnblinklichtanlage wirkt wie ein kläglicher Versuch, den Takt der Dunkelheit zu finden, und der letzte Gott, nimm den linken Fuß vom Pedal. Tobias hatte ein gutes Gefühl bei der Bewerbung.
+
Nachdem es in der Aula des Viktoria-Gymnasiums eine Theateraufführung von Igor Bauersimas norway.today gegeben hatte, führte Tobias ein Interview für die Schülerzeitung Vicky, das er auch für das Schülerradio Viktoria FM verwenden wollte. Er fragte die Beteiligten, wie sie sich dem Thema Selbstmord genähert hätten, wie es sich anfühlte, von Schule zu Schule zu reisen, und ob die Publika sich stark voneinander unterschieden. Die Mehrzahl des Wortes Publikum zu verwenden machte Tobias stolz. Er fragte nicht, wie es möglich war, sich all den Text zu merken, denn diese Frage hatte ihm der Leiter der Zeitungs-AG verboten. Es war wohl einfach so, dass sich Theaterleute eine unbegrenzte Menge Text merken konnten. Für das Schülerradio nahm er das Gespräch und den Applaus auf, um daraus einen kleinen Beitrag zu schneiden. Alle zwei Monate erschien eine neue Sendung, die man im Internet nachhören konnte, und die Schülerzeitung erschien einmal je Quartal.
Radio und Zeitung standen in unverhältnismäßig harter Konkurrenz zueinander, obwohl das Personal der Redaktionen nahezu identisch war. Die meisten Leute, die für die Schülerzeitung schrieben, engagierten sich auch fürs Radio und umgekehrt. Das hatte den Vorteil, dass man die Beiträge, an denen man arbeitete, leichthin für beides verwenden konnte. Nach dem Treffen der Radio-AG am Dienstag redeten alle vom Zeitungs-AG-Treffen am Donnerstag. Die Missgunst stammte nicht von den Schülern und Schülerinnen, sondern wurde von den Leitern gestreut, die unverfroren über das andere Medium herzogen, ohne zu bemerken, dass sie ihre eigene Truppe schlechtmachten. So konnte es vorkommen, dass der Leiter der Zeitungs-AG einen Artikel von Tobias (zum Beispiel zu der geplanten Neuanschaffung von Kellen und Tischtennisbällen für den D-Keller) über den Klee lobte, wohingegen er den Radiobeitrag zum selben Thema ohne Erbarmen verriss. Der Clou war, dass die Schüler im Radio unter ihren Vor- und in der Zeitung unter ihren Nachnamen publizierten und sich die beiden Lehrkräfte ohnehin schon so viele Namen merken mussten, dass sie bei den AGs nachlässig geworden waren. Diese vom ganzen Viktoria-Gymnasium insgeheim zelebrierte Feindschaft sollte Gegenstand eines Films der Dokumentarfilm-AG werden, die jeden Mittwoch Sitzung hatte, aber nach drei Treffen wurde ihnen klar, dass bei dem Thema jede Hoffnung fehlte. Und sie wollten ihre Energie nicht auf etwas verschwenden, das lediglich auf die Erbärmlichkeit des Lebens verwies.
Tobias sah, wie das Bühnenbild in einen Transporter geladen wurde. Er wollte wissen, wo die Schauspielerin und der Schauspieler waren.
»Vielleicht rauchen«, meinte eine Technikerin. Und tatsächlich fand Tobias sie auf der gegenüberliegenden Seite des Gymnasiums, vor einem Kiosk an einem Stehtisch Kaffee trinkend.
»Entschuldigung, Entschuldigung«, sagte er außer Atem, »aber eine Frage habe ich doch noch.«
»Schieß los«, sagte der Schauspieler.
»Ich weiß, dass Sie das vielleicht blöd finden werden. Aber ich muss Sie das einfach fragen.«
»Ja?«, sagte die Schauspielerin.
»Wie schaffen Sie es, sich all diesen Text zu merken?«
Der Schauspieler zog an seiner Zigarette, wobei sich sein Gesichtsausdruck merklich verfinsterte.
»Es ist besser, wenn du jetzt gehst«, sagte er.
+
Einige der Beamten hegten einen starken Verdacht gegen Tobias, der sich, je länger der Fall dauerte, nur verfestigte. Aber belegen konnten sie nichts. Weder Beweise noch Zeugenaussagen belasteten ihn. Zwar hatte Tobias Frau Shah mutmaßlich zuletzt gesehen, was der Polizei auch durch den Kellner einer Bar bestätigt wurde, der sich daran erinnern konnte, wie die beiden am Tresen sitzend zwei Bier tranken, bevor sie den Laden verließen, aber Tobias' Freund bestätigte sein Alibi für die Zeit ab halb eins, da sei er nach Hause gekommen. Um spätestens ein Uhr habe er sich schlafen gelegt. Vielleicht sei er weniger redselig als sonst gewesen, meinte sein Freund, aber das müsse nichts heißen. Das einzig Komische war der bereits viel besprochene und bedachte Hase, auf den sich niemand einen Reim machen konnte. Tobias sagte, dass er ein Geschenk gewesen sei, das ihm Frau Shah nach den gemeinsamen Getränken überreicht hatte. Der Kellner konnte sich an kein Haustier erinnern, aber sie hätte ihn auch in einer Tasche dabeihaben können.
»Der Hase war ein Geschenk von Frau Shah?«, fragte eine Beamtin.
»Ja«, sagte Tobias.
»Und warum schenkt Ihnen Frau Shah einen Hasen?«
»Wir hatten uns seit meinem Geburtstag nicht mehr gesehen. Sie war bekannt für eigenwillige Geschenke.«
In seinem Verhör bestätigte Tuchel den Beamtinnen diese Eigenschaft. Er konnte sich gut vorstellen, dass seine Freundin sich so was ausgedacht hatte. Wahrscheinlich, weil sie geglaubt hatte, dass ein Hase einen positiven Effekt auf Tobias ausüben würde. Darüber geredet hätten sie allerdings nicht. Tobias sei für Tuchel ein rotes Tuch gewesen, weswegen sie die Freundschaft der beiden in den meisten Gesprächen ausgeklammert hatten. Die, die nicht glaubten, dass es Tobias war, glaubten, dass es Tuchel war. Auch ein Suizid wurde nicht ausgeschlossen. Oder dass Frau Shah irgendwo ein neues Leben begonnen hatte. Ihr geheimnisvolles Verschwinden verfolgte einige der am Fall Beteiligten traumatisch bis in die Rente.
Tobias traf Tuchel im Kommissariat. Ohne ein Wort zu sagen, umarmte er ihn. Die letzten Tage hatten ihn deutlich gezeichnet. Er war blass, abgemagert und roch nach Alkohol. Das nächste Mal, dass sie sich sahen, war auf der Trauerfeier, die die Shahs etwa zwei Jahre nach dem Abhandenkommen ihrer Tochter organisierten, um irgendwie mit dem Verlust umzugehen und eine Möglichkeit zu finden, die tiefe Wunde, die diese Tragödie in ihre Ehe gerissen hatte, zu heilen.
+
Damit sie den Kontakt zueinander nicht verlören, hatte Alina Tobias die Mitgliedschaft in einem Tischtennisverein geschenkt. Sie probierten, zweimal die Woche miteinander zu trainieren. Donnerstags gab es einen festen Termin mit einer Trainerin, bei dem ihnen die Grundschläge und Techniken unter fachlicher Leitung beigebracht wurden, und für den zweiten Termin schauten sie, wie es am besten passte. Meistens trafen sie sich am Dienstag. Obwohl Tobias in Mitte wohnte und Alina mittlerweile in Schöneberg, hatten sie sich für den TTC Neukölln in der Nähe des Hermannplatzes entschieden. Beide konnten die Halle von ihren Wohnungen aus mit dem öffentlichen Nahverkehr leicht erreichen. Sie waren nicht besonders gut, aber spielten gerne. Und nach ein paar Monaten stellte sich zu den meisten dort eine unverbindliche Zugewandtheit ein, sodass sie begannen sich wohlzufühlen. Alina hatte wie Tobias ein Freiwilliges Soziales Jahr im kulturellen Bereich absolviert. Sie hatten sich beim Kennenlerntreffen kennengelernt und hingen von da an in ähnlichen Freundeskreisen rum oder trafen sich zufällig auf Partys, aber mehr als eine für diese Zeit und sozialen Gefüge übliche Freundlichkeit entwickelte sich zunächst nicht. Beziehungsweise nur von Tobias aus. Erst auf dem letzten der drei Seminare, die alle Freiwilligen während ihres Jahres zusammen besuchten, keimte ein wechselseitiges romantisches Interesse, weshalb sie nachts in einem Waldstück außerhalb der Kurt-Löwenstein-Bildungsstätte in Werftpfuhl miteinander schliefen. Den Anfang hatte alles im Clown-Workshop genommen.
»Das Lächerliche war von Beginn an der Kern unserer Beziehung«, hatte Alina Nino zwischen zwei Partien harten Squashs gesagt. Dabei löste sich ein Gemisch aus Schweiß und Blut von ihrem Ellenbogen und tropfte auf den Hallenboden.
Tobias konnte mit seiner Zunge Spuckebläschen formen und sie aus dem Mund schießen. Dazu spitzte er die Lippen, öffnete sie und legte seinen Kopf leicht in den Nacken. Das Bläschen, das vorne auf der Zunge haftete, musste er behutsam fortpusten. Es ging darum, den schmalen Grat zwischen zu hartem und zu leichtem Pusten zu finden, sodass das fragile Gebilde aus Speichel weder zerplatzte noch kleben blieb. Diesen Vorgang mit leicht schielenden Augen auszustellen hatte beim Workshop für viele Lacher gesorgt. Mit einem roten Ball auf der Nase ging Tobias auf Alina zu und bedrohte sie mit seinen Spucke-Projektilen. Sie wich angewidert aus, kokettierte allerdings ein wenig. Es war an ihr, die Szene komödiantisch zu drehen und den Hoch- in einen Tiefstatus umzukehren. Doch sie verspürte keinen Druck, und das war das Schöne und so Einzigartige an der Beziehung zu Tobias gewesen, die Leichtigkeit, mit der alles passierte, das Gefühl von Geborgenheit und nicht zu erschütterndem Einverständnis, das er ihr gab. Langsam begann sie damit, die Spuckebläschen zu sammeln und sie zu einem Strauß zusammenzubinden, den sie mit einem (allerdings nur pantomimisch angedeuteten) Batzen ihrer eigenen Spucke versiegelte und Tobias als verschämtes Liebeszeugnis überreichte.
Ziel der staatlich geförderten Institution des Freiwilligendienstes ist es, sicherzustellen, dass der Mittelstand weiterhin als impermeable Membran zwischen den Einkommensklassen fungiert und sich dicht ineinander verwebt, stand auf einem der Post-its, die Tobias zum Abschluss des Seminars auf den Rücken geklebt worden waren. Darunter hatte Alina ihre Nummer geschrieben und ein Herz gemalt. Alle sollten sich gegenseitig Post-its auf den Rücken kleben, auf denen nette Dinge standen. Auch Tobias hatte Alina ein Herz und seine Nummer auf das Post-it geschrieben, nur war ihm sonst nichts Originelles eingefallen. Trotz der körperlichen Nähe, die zwischen den beiden entstanden war, beendeten sie das Wochenende lediglich mit einer Umarmung.
Drei Tage darauf riefen sie zur selben Zeit beieinander an, weswegen sie nicht durchkamen und es fünf Minuten später noch mal versuchten, wobei sie wieder nicht durchkamen und Alina dann den Impuls verspürte zu warten, woraufhin irgendwann Tobias erneut anrief – dieses Mal erfolgreich. Sie konnten die Absurdität der Situation kaum fassen und sahen es als Zeichen ihrer übernatürlichen Verbindung an. Noch für den gleichen Abend verabredeten sie sich, um Köfte zu essen und durch ein verlassenes Schwimmbad außerhalb des S-Bahn-Rings zu stromern, was, wie sie entschieden hatten, der erste Tag ihrer Beziehung war, den sie immerhin zwei Mal jubilarisch feiern würden.
Über diese Zeiten sprachen sie allerdings nur noch selten. Alina lebte mit ihrem Freund zusammen am Bayerischen Platz und Tobias mit Tobias an der Ruppiner Ecke Rheinsberger Straße. Von der Barbarossastraße brauchte Alina mit der U7 Richtung Rudow wie Tobias von der Bernauer Straße mit der U8 Richtung Hermannstraße laut Google Maps 19 Minuten bis zum Hermannplatz. Alina und Tobias hatten in den warmen Monaten oft an einer der vielen Betonplatten in den Parks und Hinterhöfen Berlins gespielt, und da dachte sich Alina, dass es doch schön wäre, wenn sie das auch im Winter fortsetzen könnten. Der professionelle Beistand war zunächst ein Surplus.
Sie hatte sich etwas hinausgewagt mit dem Geschenk, denn es bedeutete ja, dass Tobias von nun an jede Woche mit ihr zum Sport gehen musste, aber tatsächlich begegnete er dieser Art von Routine mit Begeisterung. Die leibliche Beschäftigung tat ihm gut, denn sonst schaffte er es lediglich, sieben- bis elfmal im Jahr joggen zu gehen, und abgesehen von Sex, Schwimmen oder Spaziergängen war da nicht besonders viel, wozu er seinen Körper brauchte.
Beim Training war Heike für sie verantwortlich, eine sanfte Frau in den Fünfzigern, deren Begeisterungsfähigkeit alle im Verein rührte. Beim ersten Training reichten ihr die Haare bis über die Schultern, und beim zweiten waren sie zu einem Bob geschnitten. Tobias fragte sich, ob etwas Einschlägiges in ihrem Leben passiert sei, aber sagte nichts. Der Sport sollte für sich stehen und nicht als Vehikel für Konversationsbelange missbraucht werden. Man redete hauptsächlich über Techniken, übte Kritik oder gab Zuspruch. Neben Aufschreien purer Freude bei geglückten und bittersten Flüchen bei versemmelten Ballkontakten waren die drei häufigsten Worte, die in der Halle fielen, »schön«, »schade« und »sorry«. Auf Platz vier kam »danke«. Manche sprachen sich während der hitzigen Duelle auch Zauberformeln zu, die ihnen Kraft und Konzentration verleihen respektive die Gegner verunsichern sollten.
Da Alina und Tobias im Grundkurs waren und beide kein systematisches Vorwissen besaßen, erlernten sie zunächst die Basics: den Vorhand- wie Rückhandkonter, den Schuss, den Rückhandschupf (den Vorhandschupf eingeschränkt), den Rückhandtopspin, den Vorhandtopspin und die Ballonabwehr. Auch einige Angaben machten sie sich zu eigen. Nur der Flip war, wie ständig betont wurde, zu schwer. Ihnen wurde beigebracht, dass man einen Ball, der mit Unterschnitt gespielt wurde, von weiter unten ziehen musste, um ihn auf die andere Plattenseite zu bekommen, und bei Überschnitt genau umgekehrt. Außerdem galt es, tief in die Knie zu gehen und auf die besonderen Funktionen der Ellenbogen zu achten. Gemeine Bälle spielte man in den Wechselpunkt. Heike sprach häufig vom Goldenen Dreieck, der Stelle vor dem Körper, wo man die auf einen zuschießenden Bälle zu treffen habe. Dazu faltete sie ihre Hände etwa vierzig Zentimeter vor ihrem Bauchnabel zusammen.
»Hier lesen wir, hier schreiben wir, hier essen wir und hier spielen wir auch Tischtennis«, sagte sie.
»Und hier beten wir«, sagte Tobias.
»Auch das«, sagte Heike.
+
Details aus Tobias' gestrigem Traum im Überblick:
Er ist auf einem Kreuzfahrtschiff, oder er schaut einen Film über eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff – diese Ebenen sind nicht voneinander zu unterscheiden.
Auf dem Schiff passieren grausame Morde. Körper werden mit bloßen Händen aufgerissen, ein Gesicht wird auseinandergezogen, man sieht, wie ein Gebiss Zahn für Zahn freigelegt wird, Fasern lösen sich langsam voneinander, Knochen sind zu erkennen, viel Blut, unheimlich viel Blut und Organe.
Tobias verspürt ein ihm unbekanntes Ausmaß an Angst. Später wird er sagen: absolute Angst. Er bangt nicht bloß um sein Leben – er würde den Tod leichthin annehmen –, er verzweifelt an der Vorstellung, so zu leiden, wie es die Opfer des Mörders mussten.
Tobias weiß, dass man ihn töten und quälen möchte, er ist auf der Flucht, er versteckt sich.
Es gibt ein Radio mit einer Radioantenne. Es liegt umgekippt in einer Blutlache. Ein Lied spielt, Störgeräusche ertönen. Die Gestaltung dieses Bildes ist nicht rot und dunkel, sondern gelb und strahlend blau.
Ein Dozent aus Hildesheim ist da, ein Mann.
Tobias ist mit Freunden auf dieser Reise, sie sitzen im Spielkasino oder am Pool. Der Alltag der Gäste ist seltsam unbeeinflusst von dem Horror, der auf dem Schiff wütet. Tobias will über den nahenden Tod reden, einen Plan aushecken und so weiter, aber die anderen reden über Krabbencocktails. Es fühlt sich an, als wollten sie ihn mit dieser Unterhaltung in die Knie zwingen.
Tobias wird auf einen alten Mann mit Glatze aufmerksam. Er begreift, dass dieser Mann der Mörder ist. Der Mann lächelt ihn an. Tobias läuft davon. Er flieht in einen Fahrstuhl, der von innen mit Spiegeln verkleidet ist. Er schaut in den Spiegel und sieht, dass er selbst der alte Mann mit Glatze ist. Er lächelt sich selbst an. Sein Gesicht ist voller Blut. An seinen Händen sind Fleischbrocken und viele Zähne. Diese Gefühle spürt er: Panik, Selbstbewusstsein.
Tobias ist auf dem Oberdeck. Alles ist voller Leichenteile, er reißt die Körper seiner Freunde auseinander. Als er einem Kind den Kopf abbeißt, spürt er, wie seine Vorderzähne zwei Wirbel voneinander trennen. Die Haare an seinem Gaumen lassen ihn würgen. Die Sonne ist blau. Er schaut aus seinen Augen und sieht seine Hände, steht aber auch hinter sich und beobachtet sich aus der dritten Person. Die Versehrten, insofern sie noch leben, schreien. Das Radio spielt ein Lied, leise und mit schlechtem Empfang.
Als er schweißgebadet aufwachte, musste Tobias kotzen. So wahr waren ihm die Traummomente erschienen und so nah waren sie noch an seinem Erleben. Er kotzte und zitterte und weinte im Badezimmer der WG. Er traute sich nicht, in den Spiegel zu schauen, da er befürchtete beziehungsweise wusste – ein Teil von ihm war sich sicher –, dass er noch der alte Mann mit Glatze war. Dass sein Innerstes aus purem, unaufhaltsamem Bösen bestand.
+
Zwar hatte Tobias befürchtet, dass ihm die Rückkehr nach Niedersachsen als eine Form von biografischer Verkrüpplung vorkommen würde, schließlich kannte er dortige Klein- wie Großstädte bereits zur Genüge und blickte mit dem neugewonnenen Selbstverständnis eines Hauptstädters auf seine Umgebung, doch weit gefehlt. Sicher vermisste er das Berliner Nachtleben und Kulturangebot, aber da er Alina einmal im Monat besuchte, erfuhr sein Fernweh regelmäßig Linderung.
»Ich vermisse es, in Berlin zu wohnen«, sagte Tobias an einem Sonntag im Mai, während ihm jemand einen Riss Rotkäppchen-Sekt in ein mit Eis gefülltes Geripptes goss. Es war hell. Es war mild. Alle verkatert. Von halb bürgerlichen und halb ironischen Bedürfnissen geleitet, feierte Christine, die ein FSJK im Haus der Wannsee-Konferenz gemacht hatte, ihren Geburtstag als Brunch. Aus den gesprungenen Fenstern ihrer WG blickten sie auf das Willy-Brandt-Haus und hörten abwechselnd Tiki und Healing Music. Ein Mann mit Perlenkette zeigte einem Mann mit umgedrehter Schirmmütze Videos auf YouTube. Eine Frau in einem roten Kleid erklärte einer Frau in einem grauen Pullover etwas über die Golanhöhen, wobei ihre Stimme sich überschlug. Auf einer Küchentür, die als Tischplatte diente, standen Kuchen, Teelichter und Drinks. Jede Person in diesem Raum rauchte. Wimpelketten hingen unter den Decken. Die Haare hatten sich die meisten selbst geschnitten. Das Motto der Party war Mitte-dreißig-Sein, und alle Gäste waren dazu angehalten, sich so zu verhalten, wie es ihrer Vorstellung von sich in zehn bis fünfzehn Jahren entsprach. Lustvoll wurde davon gesprochen, dass man gleich losmüsse und momentan nicht so viel Zeit habe und unwirklich erschöpft sei und dass das Trinken einem am nächsten Morgen stärker zu schaffen mache; und dass sie Rücksicht auf ihre Partner nehmen müssten und dass sie sich entscheiden müssten und dass ihnen aufgefallen sei, dass sie seltener in Kneipen gingen und in Klubs erst recht und selbst die wichtigsten Ausstellungen kaum noch mitbekämen, dass sich das eingeschlichen habe, und das Krasse aber wäre, dass es ihnen nichts ausmachte, dass ein Ideal, nach dem Reisen und wilde Räusche ein erfüllendes Lebenskonzept seien, Quatsch wäre, und dass sie sich von Herzen darüber freuen könnten, einfach einen Abend zu Hause zu bleiben und was zu glotzen. Außerdem seien da das Kind oder die Schwangere oder die Schwangere und das Kind oder der Mann, der seine Karriere auf Halt gestellt hatte und dafür diffus etwas zurückbekommen wollte, und die Depressionen und die Ideenlosigkeit und die Erschöpfung und die Vierzig-Stunden-Woche und die Krankheiten der Eltern und die abzubezahlenden Rechnungen und Kredite und der Unwille oder das Unvermögen, sich um eine größere Wohnung zu bemühen; und dass man sich ein Häuschen draußen wünsche, dass man gemerkt habe, wie familienfeindlich diese Stadt sei, wie wenig Platz es hier gebe, wenn man die Sehnsucht nach einer großen Familie und nicht bloß nach der nuklearen hätte, einer wirklich großen Familie, einer Familiengemeinschaft, wenn man so wolle. Dass sie mit dem Gedanken spielten, zurück in ihre Heimat zu ziehen, in die bald leerstehenden Häuser ihrer Eltern, und es tatsächlich nie vermissten, das Jungsein.
»So schlimm kann es doch gar nicht sein in diesem Hildesheim«, reimte Nino, der damals noch mit Hauke zusammen war.
»Ist es auch nicht. Keine Ahnung.«
»Ja.«
»Es mag ein Detail sein, aber schau mal zum Beispiel dieses Glas.«
»Ja?«
»Ach, keine Ahnung.«
»Was meinst du denn?«
»In Hildesheim gibt es keine Gerippte.«
»Und?«
»Es ist nur so ein Gefühl. Ich weiß auch nicht, was ich da rede.«
»Kennst du In der Provinz bin ich der Märchenprinz?«
»Hahaha, ja.«
»Ich bin der Märchenprinz, ich bin der Ma-Ma-Ma-Ma.«
»Hahaha.«
»In der Provinz bin ich der Märchenprinz.«
»Hahaha.«
»Hahaha.«
»Hahaha«, sagte Tobias. Dann rollten sich beide eine Zigarette mit dünnen Blättchen. Der Rauch fügte sich gut in die Musik, das Sonnenlicht und die Zimmerpflanzen ein. Der Aschenbecher, in den sie aschten, war aus Gold.
Je nach Seminarplan fuhr Tobias sonntags spät oder montags früh mit der Mitfahrgelegenheit zurück nach Hildesheim. Zunächst fand er ein Zimmer in einer Zweizimmerwohnung mit einem Mathe-Studi im 3. Semester. Allerdings wurde beiden schnell klar, dass sie sich nichts zu sagen hatten oder sogar Abscheu füreinander empfanden (Tobias führte diese Vermutung auf einen Blick zurück, den der Mathe-Studi ihm zugeworfen hatte, als er um halb vier frustriert und daher ohne zu klopfen in sein Zimmer gekommen war, um ihn dazu aufzufordern, die Musik leiser zu drehen, und ihn kaum bekleidet mit einem kurzrasierten Typen zu der auf 33 anstatt auf 45 Umdrehungen pro Minute abgespielten Single von Goldies Heart of Glass tanzen sah), sodass Tobias Ausschau nach etwas Neuem hielt.