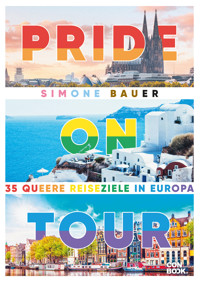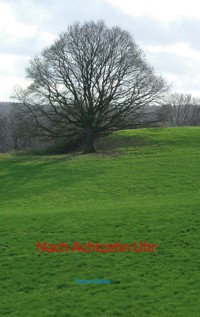9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schwarzkopf & Schwarzkopf
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Eigentlich gehört Emma zur 'Generation Komasaufen', doch anders als ihre Freundinnen findet sie schon lange keinen Gefallen mehr daran, sich jedes Wochenende volllaufen zu lassen. Nach einer schlimmen Nacht im Krankenhaus und einer unangenehmen Begegnung mit einem sturzbetrunkenen Verehrer beschließt sie daher, künftig auf Wodka, Wein und Co. zu verzichten. 'Lebe lieber alkoholfrei' lautet Emmas neues Motto. Leider ist ihre Clique davon gar nicht begeistert. Schnell hat Emma den Ruf einer Spaßbremse, Spielverderberin, Schlaubergerin. Und den bunten Cocktails und leckeren Mixgetränken gänzlich zu entsagen ist auch gar nicht so leicht, wie es sich die 16-Jährige erhofft hat. Doch zum Glück taucht bald ein junger Mann auf, der Emma auch dann mag, wenn sie nüchtern ist. Und so schwirrt ihr bald der Kopf – nicht weil sie betrunken ist, sondern verliebt. Fragt sich nur, ob sie diesen Rausch heil übersteht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Ähnliche
Simone Bauer
Alkoholfrei
Roman
1
Sinnfrei
Wir kamen gerade aus dem Aberdeen. Also nicht aus der Stadt, sondern aus Aberdeens gleichnamiger Kneipe. Aberdeen hieß natürlich nicht wirklich so, sein echter Name war Gregor Keller und er war der beste Wirt der Stadt. Nicht, weil seine Bar so ein tolles Ambiente versprühte. Um ehrlich zu sein, die schottische Einrichtung machte den Laden nicht gerade attraktiv für uns. Shots für einen Euro allerdings schon. Außerdem wusste Aberdeen, dass wir alle noch unter 18 waren, und schenkte uns trotzdem Alkohol aus. Vielleicht dachte er, die Ahoi-Brause, die er zum Wodka reichte, würde die Getränke schon irgendwie jugendfrei machen.
Seit ein paar Wochen war ich 16 und seit meinem Geburtstag tummelte ich mich am Freitagabend immer auf den Straßen zwischen dem Aberdeen und dem Boulevard, der Disco, in die man in unserem Alter bereits durfte. Eigentlich auch nur bis Mitternacht. Aber in diesem Viertel schien man beide Augen zuzudrücken, nicht zuletzt, weil wir guten Umsatz brachten.
Die Luft roch in dieser Nacht nach Abenteuer – und nach Zigarettenrauch, viel zu viel Parfüm und der Bierfahne, die Frida hinter sich herzog. Als wir das Boulevard erreichten, amüsierte sie sich gerade darüber, dass sich ihr Atem weiß gegen die dunkle Nacht abzeichnete. Ich fand das weniger witzig, bedeutete es doch, dass es eisig kalt war.
Und anders, als ich es mir erhofft hatte, wurde uns ein schneller Einlass in den Laden verwehrt. Der Türsteher, mit dem wir mittlerweile per Du waren – man kannte sich eben –, schüttelte den Kopf. »Es sind zu viele Leute im Club, ich kann euch nicht reinlassen. Seid froh, dadrin ist es wie in einer Büchse voller Sardinen.«
»Aber es ist auch wesentlich wär …«, setzte ich frierend an, doch Antonia unterbrach mich: »… geiler«
Frida sagte gar nichts, sie versuchte vergnügt, kleine weiße Wolken in die Luft zu jagen, die sich im Dunkeln verflüchtigten.
Vor uns standen einige Schüler aus unserer Jahrgangsstufe. Ich ließ meinen Blick schweifen, auf der Suche nach einem ganz bestimmten Jungen aus der Parallelklasse. Als er plötzlich hinter mir auftauchte, erschrak ich mich.
»Zigarettchen?« Er zündete sich eine selbst gedrehte Kippe an und streckte sie mir hin.
Mein Herz machte einen Hüpfer, wurde aber sofort von meinem Verstand gezügelt. »Hannes, ich rauche doch immer noch nicht.« Ich lächelte und probierte den Augenaufschlag, von dem man immer las, dass er eine besondere Wirkung auf Männer haben sollte.
Er schien aber nicht zu funktionieren und das betörende Lächeln genauso wenig. Hannes rollte nur mit den Augen und wandte sich wieder seinem Tabak zu.
Ich seufzte. Hoffentlich würden wir bald im Boulevard sein. So wenig ich es mochte, davor anzustehen, so gut gefiel es uns drinnen. Meine Freundinnen und ich hatten zwar schon oft versucht, in andere Lokale Einlass zu bekommen, aber entweder hatten wir keinen Erfolg gehabt oder uns dann dort schlichtweg nicht wohlgefühlt. Zudem fiel unser Alter anderswo einfach auf und die Ü-20-Jährigen hatten keine Lust, zusammen mit Realschülern zu feiern. Das konnte ich gut verstehen. Manchmal wollte nicht mal ich mit Realschülern feiern.
Hinter uns kamen gerade ein paar 15-Jährige an, sie waren in der Klasse unter uns. Sie lachten übermütig, voller Hoffnung, nach uns reinhuschen zu können. Hannes bot einer von ihnen ebenfalls eine Kippe an. Wut verdrängte Frost. Warum beachtete er mich nicht länger als drei Sekunden? Machte ich etwas falsch? Ich hatte sogar meine Locken geglättet! Was war an der 15-Jährigen besser als an mir?
Frida hatte sich aus der Kneipe noch ein Bier mitgenommen, obwohl sie eh schon lallte. Fahrig strich sie sich durch die rot gefärbten Locken, fummelte an ihrem Nasenring und verschmierte mit dem Hals der Bierflasche ihren Lipgloss. Wenigstens hatte sie es aufgegeben, mit ihrem Atem Figuren in die Luft zu zeichnen. Ihre Albernheit schlug gerade in Depression um.
»Wo ist Stefan?«, fragte sie leidend.
»Wahrscheinlich hat ihn Aberdeen wieder so lange zugetextet, bis er sich noch ein Bier bestellt hat«, überlegte ich laut.
Stefan war Fridas Freund und kam mit jedem klar. Das hieß aber nicht, dass er nicht auch eine ziemlich linke Bazille sein konnte. Er hatte Fridas Herz gewonnen und sich in unsere Gruppe eingegliedert, als wäre es ein Kinderspiel, zwischen seit Jahren befreundete Mädchen zu treten. Es würde auch ein Leichtes für ihn sein, irgendwann die Geschäfte seines kinderlosen Onkels zu übernehmen. Und in die Regensburger Mafia einzusteigen. Wenn es so etwas wie eine Regensburger Mafia überhaupt gab.
Bevor ich weiter darüber nachdenken konnte, tauchte er aus dem Nichts auf, gab Frida einen Klaps auf ihr Hinterteil und einen Kuss. Antonia machte ein Würgegeräusch.
Stefan ignorierte es, ließ von seiner Freundin ab und zückte seinen nagelneuen Blackberry. Sein Onkel investierte gern in ihn und Stefan hatte nichts dagegen, wenn sein Onkel die Spendierhosen anhatte. Leidenschaftlich hämmerte er auf dem Smartphone herum. Er spielte wahrscheinlich nur ein dämliches Spiel, tat aber so, als würde er eine E-Mail an wichtige Geschäftspartner verfassen. Wir Mädels dienten als Publikum – da es nichts anderes zu sehen gab, sahen wir ihm zu.
Es dauerte nicht lange und Antonia wurde es leid, Stefan zu beobachten – etwas, was Frida leider nie wurde –, weshalb sie sich mir zuwandte. Ihr Lächeln war strahlend: »Gut siehst du aus!«, kiekste sie.
So etwas hörte man nur dann von Antonia, wenn sie hacke war. Denn Antonia, die so oft wie möglich ihre ohnehin schon schlohweißen Haare nachfärbte und einen akkuraten Pixiecut trug, ließ sich normalerweise nicht dazu herab, anderen Komplimente zu machen.
»Das Dunkelblau steht dir. Und die Glitzerdetails … fallen auf. Sind trotzdem cool«, beurteilte sie mein Outfit.
Keine von uns hatte ein Top an, das den Wert von 15 Euro überstieg. Wir kauften unsere Klamotten meistens bei Pimkie oder New Yorker, wenn wir uns am Samstagnachmittag vom Weggehen erholt hatten. Tatsächlich shoppten wir sehr häufig – auch, weil wir mussten. Schließlich wuschen wir die Shirts für einen besseren, engeren Sitz mit kochendem Wasser und nach wenigen Malen waren sie so zerstört, dass wir sie wegwerfen konnten. Sicher, wir hätten uns den Kauf von vier Shirts sparen können, wenn wir ein richtig schönes Oberteil gekauft hätten, das immer gut saß und super aussah, aber das hätte nicht zu uns gepasst. Außerdem waren diese Shoppingtouren so etwas wie »unser Ding«, unser Ritual, etwas, das nur wir drei taten. Ich genoss es, Teil dieser unerschütterlichen Union zu sein, die samstags eben shoppen ging.
»Aber der rosa Cardigan passt leider überhaupt nicht dazu, Süße.« Antonia schürzte die Lippen.
»Toni, du weißt doch: Als ich das letzte Mal ohne Jacke weggegangen bin, habe ich mir die schlimmste Erkältung aller Zeiten zugezogen«, rechtfertigte ich mich. »Außerdem haben wir Anfang Oktober.«
Die Kälte der letzten Septembertage und der Schweiß auf meiner nackten Haut hatten dazu beigetragen, dass mir für zwei Wochen die Stimme gefehlt hatte. Es hatte ewig gedauert, meine Mutter zu überzeugen, heute Abend rauszudürfen. Frida und Antonia wurden grundsätzlich zum Freitagabend wieder gesund. Selbst, wenn hohes Fieber sie die ganze Woche daran gehindert hatte, am Unterricht teilzunehmen. Bei mir funktionierte das anders. Ich verpasste für gewöhnlich nur den Spaß, ging dafür aber zur Schule. Wenigstens war der Abend toll gewesen, dem ich die Erkältung zu verdanken gehabt hatte. Zum ersten Mal hatte Hannes mich so richtig wahrgenommen und über einen meiner Witze gelacht. Sein Lachen war so atemberaubend tief! So männlich und unerschütterlich. Mmm …
»Antonia, wo du doch nur Klamotten im Kopf hast und absolut nichts anderes«, Stefans Lächeln war irgendwo zwischen anzüglich und gemein, »da solltest du dir mal Gedanken über einen Job in einem Laden für Nuttenfummel machen.«
»Halt die Klappe, Stefan«, fauchte Antonia.
»Ja, sei nicht so fies, Schatz«, bat Frida ihn. Es kam selten vor, dass Frida sich gegen ihren Freund auflehnte, aber wenn, dann tat sie es zumeist für uns. Unter all diesem verwischten Lipgloss und dem Mundgeruch steckte eben doch ein nettes Mädchen.
Seit der Grundschule waren Antonia, Frida und ich nun schon unzertrennlich. Wir waren alle Einzelkinder und fühlten uns wie Schwestern. Und wie Schwestern stritten wir uns schon mal, vertrugen uns danach aber gleich wieder.
Der Türsteher nickte leicht und schon stürzten meine Mitschüler in den Club, als wäre Ausverkauf bei H&M.
Stefan trat unterdessen an den Türsteher heran und ließ dabei seinen Blackberry in die Tasche seiner Baggyhose gleiten, die zwar zerlöchert war, aber mit großer Wahrscheinlichkeit teurer als mein gesamtes Outfit inklusive Haarschnitt! »Hey«, sagte er lässig.
Der Türsteher boxte ihn nur freundschaftlich – er hatte sich schon mal mit Stefan die Kante gegeben und ihm dabei anvertraut, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hatte. Weil sie sich lieber mit einem, wie sie ihn nannte, »Superhengst« amüsierte. Armer Türsteher. Laut Stefan hatte er dabei sogar ein bisschen geweint.
Auch Hannes klatschte den starken Kerl ab, dann folgten wir den Jungs ins Innere. Ein zufriedenes Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus. Meine Finger waren steif gefroren, doch kaum war ich im Boulevard, schien mein Körper wieder aufzutauen. Hier roch es immer nach Trockennebel und Damenparfüm. Die Luft war schon fast schwül. Schnell raus aus dem Cardigan! Ich warf ihn auf eine Sitzecke, Antonia ihr Halstuch daneben. Dass Frida schon mal ihre Handtasche unbeaufsichtigt herumliegen ließ, interessierte hier niemanden. Es war, als ob der gemeine Regensburger kein Interesse am Diebstahl hätte, sobald er über die Schwelle des Boulevard trat.
Auch wenn mich das Anstehen beinahe wieder nüchtern hatte werden lassen, war ich jetzt wieder voll dabei. Laute Popmusik dröhnte durch den Raum. Ich konnte nicht mehr still stehen. Sobald das ganze Prozedere abgehakt war – Einlass, an der Bar Freunde treffen und Getränke bestellen, auf der Toilette den Lidstrich nachziehen –, würde es auf die Tanzfläche gehen – und ich liebte es zu tanzen. Also drängte ich Frida und Antonia in Richtung Klo. Frida verabschiedete sich von Stefan mit einem Kuss, der einen glauben ließ, wir würden nie wieder zurückkehren.
»Heute ist die Stimmung genauso geil wie beim letzten Mal, als du dabei warst«, verkündete Antonia, während Frida sich ihr Haar aufplusterte und ich meinen Eyeliner auspackte.
Frida kiekste: »Werd ja nie wieder krank! Verstanden?«
Ich wusste zwar nicht genau, ob meine Anwesenheit der Grund für die gute Stimmung war oder nicht, aber eigentlich war mir das auch egal. Ich wollte nicht mehr groß diskutieren, ich wollte nur noch den Beat genießen und das Gefühl, wenn er mir durch Mark und Bein fuhr.
Als wir vom Klo kamen, begab ich mich direkt auf die Tanzfläche und suchte von dort aus nach Hannes. Mein Blick fand ihn am anderen Ende, er hatte ein paar Kumpels getroffen. Sie begrüßten sich gerade, als sich etwas in mein Sichtfeld schob.
Ein Mädchen war vor mir stehen geblieben, um mich mit großen grünen Augen anzusehen. »Wow, du tanzt aber gut!«, begrüßte es mich. Ein durch den Raum flirrender Laser ließ sein strohblondes, kinnlanges Haar grün erscheinen, passend zu seiner Iris. Das Mädchen war hübsch und natürlich und zeigte nicht so viel Haut wie ich und meine Freundinnen. Wenn ich nicht so betrunken gewesen wäre, hätte ich es vermutlich als Mathilda Gerke, meine Nachhilfeschülerin, erkannt und sofort umarmt. Doch in meinem Zustand war ich nur noch zu einem leisen »Danke!« und einem halbherzigen Lächeln imstande. Nicht einmal auf das Kompliment, das Mathilda mir gemacht hatte, konnte ich reagieren. Stattdessen sah ich sehnsüchtig zu Hannes hinüber und wünschte mir, dass er sich spontan dazu entscheiden würde, mit mir zu tanzen. Ich hatte schon oft mit ihm getanzt. Und manchmal hatte er mich dabei sogar berührt. Das hatte einen Schwarm Schmetterlinge in meinem Bauch frei werden lassen, jedes süße Mal.
*
Wenn wir von Antonias Vater abgeholt wurden, dann meistens vor zwei – dann wollte er nämlich ins Bett. Nach zwei war die Emma, die sich ohne Scheu unter der Discokugel drehte, dann wieder die Emma, die im Tanzkurs ganz nah an der Wand stand. Und diese Emma ließ sich nun auf einen Stuhl in der Küche plumpsen und den Abend Revue passieren.
Mir fiel wieder ein, dass mich dieser komische Kumpel von Hannes über den Haufen gerannt und mit Jacky-Cola begossen hatte. Langsam zupfte ich an meinem Top herum und schluckte. Igitt, der braune Drink hatte Spuren hinterlassen! Durch den Alkohol war meine Reaktionszeit etwas verzögert – in Zeitlupe stand ich auf und schaltete das Licht ein. Im Schein der Küchenlampe wurde das volle Ausmaß des Flecks deutlich: Das T-Shirt war ruiniert, zweifelsfrei.
Ich dachte an den nächsten Shoppingsamstag, an das Shirt, das ich kaufen würde, und an das Geld, das übrig bleiben würde. Ich würde es auf die Seite legen. Vielleicht für den großen Ausbruch. Die süße Flucht vor allem, was ich gewohnt war. In etwa einem Jahr wollte ich eine Sprachenschule in München besuchen, um Fremdsprachenkorrespondentin zu werden. Ich wollte mein Französisch aufbessern und vielleicht sogar noch eine dritte Fremdsprache lernen. Spanisch vielleicht. Oder Chinesisch. Aber zuerst musste ich von der Schule angenommen werden. Und das dann meinen Eltern beibringen. Ich hatte ihnen zwar nicht versprochen, ihren Buchladen zu übernehmen, aber ebenso wenig hatte ich ihnen bisher angedeutet, dass ich vorhatte, in eine größere Stadt zu ziehen. Die meisten Leute trauten es mir ohnehin nicht zu, dass ich das durchzog.
Zugegeben, ich ging nicht damit hausieren, wie viel mir an der Sprachenschule lag. Und noch dazu war mir es peinlich, was den Wunsch geweckt hatte, endlich in die große weite Welt hinauszuziehen. Es hatte alles damit begonnen, dass wir keinen Fernseher hatten. Meine Mutter hatte mir in der fünften Klasse sogar verboten, Sex and the City zu gucken. (Antonia hatte unterdessen schon die Rollen verteilt – sie war natürlich Samantha, Frida war Charlotte und ich hätte Carrie werden können, wenn ich doch nur gewusst hätte, was das bedeutete.) Vor zwei Jahren hatte ich aber zum Glück einen Weg gefunden, endlich auch fernzusehen. Ich guckte all die interessanten Serien unter der Bettdecke auf meinem Laptop. Hörte ich meine Eltern im Flur, klappte ich den Laptop schnell zu, damit sie nicht mitbekamen, dass ich Serien konsumierte, die mich in Städte wie Los Angeles, New York und Boston entführten. Ich wollte ja nicht, dass sie mir mein Allerheiligstes wegnahmen – und damit meinen Sprachpartner. Denn dadurch, dass ich die Serien im Original sah, waren meine Englischkenntnisse immer besser geworden. Meinen Traumberuf »Lieblingsserien übersetzen« hatte ich bei der Agentur für Arbeit zwar bisher nicht finden können, aber ich hatte entdeckt, was mir wirklich Spaß machte. Meine Eltern würden natürlich nie erfahren, warum ich mich plötzlich so für Fremdsprachen begeisterte.
Ebenso wenig wie meine Englischlehrerin. Wie die meisten Lehrer hatten wir Frau Gordon schon seit der Fünften. Es war ihr lange nicht aufgefallen, dass ich mich in Englisch in den letzten zwei Jahren erheblich gesteigert hatte. Denn ich war nicht unbedingt die größte Vorleserin der Klasse. Ich meldete mich selten, zu traumatisierend waren die Male gewesen, an denen ich an der Tafel ausgefragt worden war und versagt hatte. Als Frau Gordon dann doch gemerkt hatte, wie raketenartig mein schriftliches Können abgegangen war, hatte sie mich nach dem Unterricht zu sich geholt und mich in Abwesenheit meiner Klasse abgefragt. Seither hielt sie meine Leistungssteigerung für die Folge ihrer pädagogischen Methoden. Und ich ließ sie gern in dem Glauben.
Frau Gordon war es auch, die mir Prospekte verschiedener Sprachenschulen mitgebracht hatte. Für München hatte ich mich entschieden wegen des Flairs und der Tatsache, dass mich dort keiner kannte, weil niemand mit mir in den Kindergarten, die Grundschule und die Realschule gegangen war. Ich wollte eine völlig neue Emma sein, obwohl ich wahrscheinlich die alte bleiben würde. Außerdem gefiel mir an München, dass der Englische Garten tatsächlich größer war als der Central Park. Dass die Bavaria manchmal wirkte wie Lady Liberty in Klein. Und dass sich dort unterschiedliche Kulturen mischten. Jeder Zugereiste war in der bayrischen Landeshauptstadt willkommen.
Auch, dass ich inzwischen Nachhilfe in Englisch gab, war Frau Gordons Verdienst. Ich mochte sie wirklich gern. Und noch mehr mochte ich ihren Sohn Stuart. Er war mein Tanzlehrer und ich himmelte ihn an wie einen Filmstar.
Allerdings konnte mich gerade weder der Gedanke an ihn noch der an meine Zukunft aufheitern. Hannes hatte mich mal wieder nicht beachtet, dafür hatte sein Bekannter mein T-Shirt versaut. Ich seufzte. Aber wenigstens war der Rest des Abends spitze gewesen. Zumindest hatten das meine Freundinnen in Gegenwart von Antonias Vater behauptet. Manchmal hatte ich das Gefühl, Antonia und Frida reichte das: trinken, den Facebookstatus updaten, wie geil doch alles ist, beim Nachschminken kurz darüber reden, dass dieser Abend den letzten übertraf, und weitertrinken. Sie dachten nicht so viel darüber nach, was sie taten und wohin das führte. Ihnen gefiel es, sich treiben zu lassen. Und ihnen gefiel, was der Alkohol mit ihnen machte. Toni kam noch mehr aus sich heraus, wenn sie betrunken war. Zu viel, wenn man bedachte, dass sie ihre Zunge dann gern in den Hals verschiedener Typen zu stecken pflegte. Und bei Frida hatte ich das Gefühl, dass sie vergessen hatte, wie man nüchtern Spaß haben konnte. Außerhalb der Schule sah ich sie kaum noch ohne ein Glas in der Hand.
Mein Kopf dröhnte und das helle Licht in der Küche machte das nicht besser. Ich beschloss loszutorkeln. Es wurde Zeit, endlich eins mit dem Bett zu werden.
In meinem Zimmer schlug mir die übliche Kälte entgegen. Wir wohnten in einem Altbau in der Regensburger Innenstadt, der nicht immer so kuschelig warm war wie die Häuser meiner Freundinnen. Aber es machte mir nichts aus, mit einer Decke mehr zu schlafen.
Als ich mich einwickelte, fiel mein Kopf auf den Marienkäfer aus Plüsch, den mein Vater am Tag meiner Geburt gekauft hatte. Seitdem war er Teil meiner Betteinrichtung und mein treuer Bettgefährte. Ich sagte leise: »Gute Nacht, lieber Marienkäfer.« Und versuchte, etwas Schönes zu träumen.
*
»Glaubt ihr, dass ich an einer amerikanischen Highschool der Head Cheerleader wäre?«
»Frida, mit deinem Nasenring dürftest du nicht mal bei der Turnmannschaft mitmachen«, antwortete ich und wischte mir eine Strähne aus dem Gesicht.
Ich hatte heute Morgen wenig Lust zum ordentlichen Kämmen gehabt und auch das schwarze Kleid, das zerknittert an mir herabhing, hatte ich mir nur schnell übergeworfen. Antonia war hingegen topgestylt – wie an jedem Tag.
»Aber ich wäre zumindest beliebt, oder? Ich meine, Stefan ist der totale Quarterback-Typ!«
»Ich glaube nicht, dass beliebt zu sein wirklich so wichtig ist, dass wir es beim Pausenbrot diskutieren müssen. Und außerdem fehlt Stefan zum Quarterback ein ordentliches Kreuz.«
»Also ich wäre ganz sicher Kapitän der Cheerleader«, warf Antonia nun ein.
»Du hast doch nicht mal einen Freund«, entgegnete Frida und sog an ihrem Trinkpäckchen.
»Na und? Hast du gemerkt, wie viele Leute uns alleine auf dem Weg hierher gegrüßt haben? Kommt sicher nicht davon, dass du so charmant bist.« Antonia winkte einem Jungen zu, der an uns vorbeilief – ohne dass sie ihn überhaupt kannte, nur um ihr Argument zu untermauern.
»Darf ich kurz einwerfen, dass ihr ausschließlich Quatsch besprecht? Können wir dabei bleiben, dass keine von uns ein Star ist, sondern dass wir ein perfektes Trio sind?«
»Die drei Musketierinnen!«
»Die Pink Ladys!«, rief Frida und zog an ihrem rosafarben Hosenträger, der an ihrer zerlöcherten schwarzen Jeans befestigt war.
Ich seufzte und biss von meinem Wurstbrot ab. »Genug jetzt!«, nuschelte ich mit vollem Mund. »Wir brauchen keinen Gangnamen. Oder Quarterbacks.«
Ich war ja auch ein verträumtes Mädchen, aber Frida sehnte sich noch mehr nach einem hollywoodreifen Leben als ich. Okay, vielleicht lag es daran, dass sie die Schule hasste. Sehr zum Verdruss ihrer Mutter. Die wiederum eine große Anhängerin der Anti-TV-Policy meiner Eltern war. Ständig gab es bei Frida zu Hause Krach. Zwar gewann sie fast immer, aber es musste anstrengend sein, sie zu sein. Wahrscheinlich flüchtete sie sich deshalb jedes Wochenende in Partys und Alkohol.
»Was spräche denn dagegen, wenn das Leben manchmal wie im Film wäre?« Frida schob schmollend die Lippe vor. »Dann würden wir mit ziemlicher Sicherheit nicht hier stehen, Leberwurstbrote essen und gleich Mathe haben. Stattdessen würden wir Banken überfallen oder …«
»Sorry, aber ich hätte keinen Bock, im Gefängnis zu landen«, unterbrach ich sie.
»Mach dich mal locker«, schnaubte Frida.
Ich seufzte. Vorsichtig sah ich mich um. Ich weiß auch nicht, was plötzlich in mich fuhr, aber ich hatte eine Idee. »Willst du sehen, wie ich mich mal locker mache?«, fragte ich Frida.
Sie grinste. »Ich bitte darum.«
»Alles klar.« Ich nahm meine beiden Brothälften auseinander – oder das, was noch davon übrig war – und klatschte eine von ihnen neben Fridas Kopf an die Wand. Mom hatte das Brot eh viel zu dick bestrichen. Das kam davon, wenn man sich das Essen aus Zeitmangel nicht selbst zubereitete.
Das Brot rutschte langsam an der Wand hinab und hinterließ eine schmierige Spur aus Butter und Leberwurst. Frida brach in Lachen aus. Aber nicht nur sie war am Prusten, auch alle anderen Schüler im Umkreis hielten sich die Bäuche. Ich hingegen lachte nicht. Ich hatte Angst, dass ich gleich von einem Lehrer bestraft werden würde.
»Klasse Aktion, Hader!«, rief Hannes mir vom anderen Ende des Ganges aus zu.
»Okay, so sehr mir jetzt gerade das Herz aufgegangen ist: Ich glaube, ich bin dann mal weg.« Ich zeigte meinen Freundinnen das Victory-Zeichen, bevor ich zur Toilette lief, um mich zu verstecken. »Ciao mit V!«
»She’s outta here!«, krächzte Antonia lachend.
*
»Danke, dass du mich zu Antonia fährst. Sie wollte etwas mit meinen Haaren ausprobieren.«
»Ich finde deine Haare gut, so wie sie sind«, erwiderte mein Vater, ohne mich anzuschauen, den Blick hatte er fest auf die Straße vor uns geheftet.
Ich war nicht gewillt, darauf einzugehen. Zum einen, weil mich die Meinung meines Vaters in modischen Fragen nicht wirklich interessierte. Zum anderen, weil Antonia gar nicht vorhatte, mir eine neue Frisur machen. Wir wollten vorglühen.
»Kommt Frida auch?«, fragte mein Vater.
Ich sah weiter aus dem Beifahrerfenster. »Natürlich«, entgegnete ich.
»Ihr seid ja unzertrennlich. Und das seit der ersten Klasse! Weißt du noch, wie du Frida kennengelernt hast?«
Das fragte mich mein Vater jedes Mal, wenn die Sprache auf Frida kam. Und jedes Mal antwortete ich dasselbe: »Am ersten Tag in der Grundschule. Ich war total verängstigt. Ihre quietschbunte Pausenbox hat mich angelockt.«
Fridas offene und kreative Art hatte mich damals wirklich überwältigt. Ihre Brotdose war mit Stickern beklebt und mit Glitzerstiften verziert worden und darin hatten sich neben zwei Pausenbroten auch Weintrauben und Kirschen befunden. Aus ihnen hatte Frida kleine Männchen gebaut, mit denen sie in der großen Pause ein Stück aufführte. Ich glaube, es hatte »Weintrauben-Megaman und die holde Prinzessin« geheißen. Und auch, wenn man mit Essen nicht spielte, es hatte mir damals mächtig imponiert, dass sie es tat. Sie war so lustig gewesen. Und war es auch heute noch. Doch manchmal dachte sie leider nicht darüber nach, dass ihre Witze andere verletzen konnten. Sie reflektierte nicht mehr, weil Stefan auch nicht reflektierte. Und die quietschbunte Pausenbox existierte auch schon lange nicht mehr.
Mein Vater hielt an. Von der gestrigen Tanzstunde war ich noch etwas geschafft und müde, hatte leichten Muskelkater. Ich hätte auch einfach sitzen bleiben, mich wieder heimfahren lassen und einfach nur ins Bett gehen können. Doch stattdessen stieg ich aus, verabschiedete mich und wurde gleich darauf von Antonia empfangen.
»Emma, wie findest du meine falschen Wimpern?«, begrüßte sie mich und schlug mehrmals die Augen auf und zu.
»Graziös«, entgegnete ich.
Antonia machte einen Knicks und sprang begeistert die Treppe rauf, ich folgte ihr in ihr Zimmer. Zwischen Twilight-Memorabilien und rosafarbenen Kissen hatte Frida gerade den Wodka geöffnet.
»Hier, auch welche für dich.« Antonia reichte mir eine Packung mit langen schwarzen Härchen. In gleichmäßigem Abstand waren kleine Glitzersteinchen aufgebracht, die super zu meinem Oberteil passten.
»Danke. Hilfst du mir beim Raufkleben?«
»Aber sicher«, antwortete Antonia und wies mit der Hand auf ihren Schreibtischstuhl. Ich sollte mich setzen. »Frida, dann warte ich mal mit dem Wodka.«
Frida hatte bereits drei Gläser vorbereitet. Auf Antonias Bitte hin zuckte sie mit den Schultern und genehmigte sich alle drei Shots.
»Weißt du, ich weiß echt nicht, warum du Stuart so magst. Er ist so gemein«, sagte Antonia beiläufig, während sie mit dem Kleber hantierte.
Sie ärgerte sich noch immer darüber, dass Stuart in der gestrigen Stunde einen Witz auf ihre Kosten gemacht hatte. Zugegeben, er war ziemlich fies gewesen, aber sie hatte es auch ein bisschen verdient gehabt. Antonia hatte die Eleganz nämlich nicht gerade mit Löffeln gefressen, tanzte aber dennoch mit Vorliebe in der ersten Reihe. Auch Stuart war das aufgefallen und er hatte sie bereits mehrmals gebeten, zu Hause zu üben, damit sie Fortschritte machte. Doch Antonia tat nichts und wiegte sich weiterhin ungelenk, aber voller Inbrust hin und her. »Ich habe gestern eine neue deutsche Redewendung gelernt«, hatte Stuart nun gestern in den Raum gerufen. »Antonia, du bist ein echter Körperklaus!« Alle hatten gelacht. Auch ich.
»Er ist halt ein super Tänzer«, erklärte ich Antonia nun. »Und er hat es sicher nicht böse gemeint. Du kennst ihn doch …«
Antonia antwortete nichts, stattdessen machte sich Frida nun erneut bemerkbar.
»Er ist heiß«, warf sie ein. »An dem würde ich mich gerne mal verbrennen.«
Ich prustete los und auch Antonia schüttelte sich vor Lachen. Beinahe klebte sie mir meine Lider zusammen.
*
»Hey Emma, wer ist denn die heiße Schnecke neben dir?«, fragte Frida, als wir Stunden später an einem Spiegel in der Nähe der Garderobe vorbeiwankten. Sie zeigte mit dem Finger auf sich selbst.
»Das weiß ich nicht so genau. Aber hast du Antonia gesehen?«
Ich hatte keine Zeit, mit Frida darüber zu debattieren, wie gut ihr Partyoutfit saß. Wir vermissten die Dritte im Bunde. Und das schon seit beinahe zwei Stunden. Ich hatte allein die Tanzfläche gerockt, als es mir aufgefallen war, dass ich Antonia seit einer Ewigkeit nicht gesehen hatte. Die Glitzerpartikel hatten sich von meinem Oberteil gelöst und waren hochgewirbelt worden, wo sie mit denen an meinen Wimpern Liebe gemacht hatten. Sternenstaub hatte in der Luft getanzt – ich war glücklich gewesen. Bis ich mächtig sauer geworden war.
Antonias Vater würde uns gleich abholen und es war sicher nicht schlau, ohne seine Tochter beim Auto aufzukreuzen. Außerdem machte ich mir Sorgen.
»Antonia? Wer ist diese Antonia?« Frida musste sich am Spiegel abstützen, um mir gerade in die Augen blicken zu können.
Ich antwortete nicht. Stattdessen packte ich Stefan, der gerade an uns vorbeilief – vermutlich war er auf dem Weg zur Toilette –, und herrschte ihn an: »Kannst du bitte fünf Sekunden auf deine Freundin aufpassen? Ich muss Antonia suchen.«
Er nickte mit aufgerissenen Augen und nahm Fridas Hand.
»Ich bin gleich zurück, ihr bleibt hier!«, sagte ich und warf ihm noch einen strengen Blick zu. Der Gedanke, dass Antonia gerade etwas richtig Bescheuertes anstellte, machte mich plötzlich wieder nüchtern. Dabei hatte ich unzählige Tequilashots meine Kehle hinunterlaufen lassen. Während ich auf die Tanzfläche lief, konnte ich aus dem Augenwinkel sehen, dass Stefan die in Konfettifarben gekleidete Frida gegen den Spiegel drückte und ableckte. Glücklicherweise entgingen mir die Einzelheiten.
Auch konnte ich mich nicht weiter mit Hannes befassen, der mir vor die Füße stolperte und nach dem fünften Jägermeister deklarierte, dass er »wahnsinnig beschwipst« sei. Ich hatte eine wichtigere Mission.
Ich fand Antonia im Vorhof des Boulevard. Ihre Haare standen in alle Richtungen ab. Spucke flog durch die Luft, während sie auf eine Reihe 15-Jähriger einquasselte: »Das nennt ihr einen Push-up-BH? Soll ich euch mal einen Push-up-BH zeigen?«
Schon machte sie sich an ihrem schwarzen Spitzentop zu schaffen. Unser Freund, der Türsteher, schielte bereits gespannt in ihre Richtung und die ein oder andere 15-Jährige dachte inzwischen sicher, dass man sein Schamgefühl am Eingang des Boulevard abgeben musste.
Ich rollte mit den Augen und stürmte auf sie zu. »Antonia!«, fauchte ich. »Antonia, lass das.«
»Was ’n?« Sie ließ von ihrem Top ab und sah mich aus trüben Augen an.
»So Toni, wir gehen jetzt wieder rein, holen die Frida und fahren dann heim. Dein Vater wartet schon«, sagte ich, griff nach ihrer Hand und drängte sie wieder in Richtung Disco und anschließend zur Garderobe.
Als wir zehn Minuten später im Wagen ihres Vaters saßen, fragte der uns, wie es gewesen war. Meine Freundinnen antworteten nicht. Antonia war noch seekrank, weil ich sie nicht gerade sanft durch die Gegend geschubst hatte, und Frida befand sich auf Wolke sieben – ob ihr Spiegelbild oder Stefans Kuss der Grund dafür war, war ungewiss. Also sagte ich bereitwillig, dass es »spitze« gewesen war. Die Details verschwieg ich natürlich. Antonia sah derweil aus, als würde sie gleich ihren Mageninhalt auf dem Boden des Benz’ verteilen.
Es war immer wieder erstaunlich, dass Antonias Vater unseren Zustand tolerierte. Er war der Meinung, unter seiner Aufsicht würden wir nicht außer Kontrolle geraten. Hätte er gewusst, dass seine einzige, kleine Tochter sich beinahe vor der Tür des Boulevard ausgezogen hatte, hätte er uns wohl kaum fröhlich Bon Jovi vorgespielt. Nein, dann hätte er uns gewiss umgebracht.
2
Wertfrei
Um nicht mit dem Wurstbrotskandal in Verbindung gebracht zu werden, kehrten wir nicht an unseren üblichen Platz im Schulflur zurück. Einige Lehrer hatten Brandreden gehalten, wie sie zu Vandalismus in der Schule standen, und ich hatte keine Lust darauf, als Täterin identifiziert zu werden. Ich hatte doch nur meine Ehre (und Lässigkeit) verteidigen wollen. Also trafen wir uns von nun an auf den Stufen zum Obergeschoss, um unser Pausenbrot zu verzehren.
Während Antonia jammerte, weil sie sich in der Sportstunde zu sehr am Reck verausgabt hatte, baute sich Frida ein Riesensandwich aus Antonias Toast mit Tomate-Mozzarella und ihrem eigenen Schinkenbrot.
»Wisst ihr, worauf ich mich richtig freue?«, fragte ich, an meiner Brezel nagend. »Unsere Abschlussfahrt nach Frankfurt! Die wird grandios!«
»Absolut. Vier Tage schulfrei«, jubelte Frida und nahm einen Bissen von ihrem Monsterbrot, dabei renkte sie sich beinahe den Kiefer aus.
Antonia warf ihr einen angewiderten Blick zu. Vermutlich überlegte sie, ob sie einen Schlangen-Beute-Witz machen sollte. Sie entschied sich dagegen und nahm sich dann doch lieber des eigentlichen Gespräches an. »Aber Hallo! Und Frankfurt soll ja wirklich toll zum Einkaufen sein. Mama braucht ein Paar neue Stöckelschuhe!«
»Und wir werden ein gemeinsames Zimmer haben«, rief Frida und klatschte dabei in die Hände. Ein Stück Tomate flog durch die Luft und landete auf der Stufe unter uns.
»Schade, dass die Fahrt erst im März ist«, seufzte ich.
Antonias Augen glimmten auf. »Hey, wollen wir schon mal für die Fahrt proben? In der letzten Novemberwoche habe ich sturmfrei, da fahren meine Eltern zu unserer Verwandtschaft nach Thüringen. Ich darf daheimbleiben, weil ich ja für die Schule lernen muss.«
Wir lachten – als würde Antonia tatsächlich lernen! Sie fuhr fort: »Was haltet ihr davon: Ladies Night? Ich besorge den Sahnelikör und dann bleiben wir die ganze Nacht wach?«
»So verlockend das auch klingt, aber meine Großeltern feiern am letzten Novemberwochenende ihre goldene Hochzeit«, entgegnete ich.
Antonias Mundwinkel fielen nach unten. »Oh nein, Süße! Es ist immer so traurig, wenn wir nicht vollzählig sind!«
»Ja, dann verpasst du, wie wir Telefonstreiche machen, ohne die Nummer zu verbergen.«
»Was machen denn Scherzanrufe ohne unterdrückte Rufnummer für einen Sinn?«
»Es ist zum Beispiel sehr wirkungsvoll, wenn du bei Dirk anrufst und ihm erzählst, du hättest gesehen, wie er Frida beim Sozireferat angegafft hat«, kicherte Antonia.
Ich zog die Brauen zusammen. »Das hat er doch gar nicht, oder?«
Dirk war ein ungeheuer lieber Kerl. Nur ein bisschen zu emo, um von »normalen« Mädels ernst genommen zu werden. Sein schwarzes, asymmetrisch geschnittenes Haar hatte ihm aber immerhin eine Beziehung mit dem einzigen Emomädchen des örtlichen Gymnasiums eingebracht.
»Ja, aber er macht sich dann in die Hose, weil er Angst vor Stefan hat«, gackerte Frida. »Beim letzten Mal, als wir ihn angerufen haben, ist er drei Wochen lang nicht mehr mit uns weggegangen!«